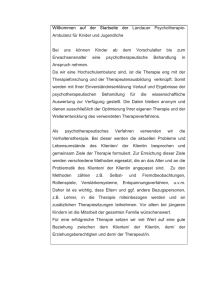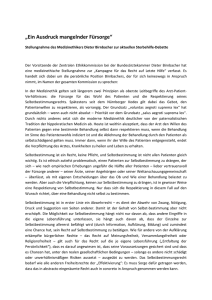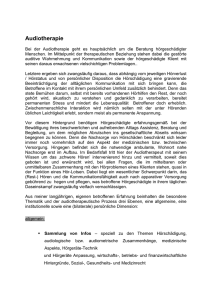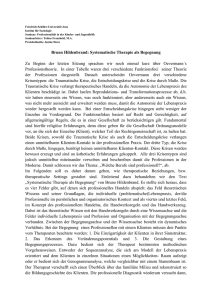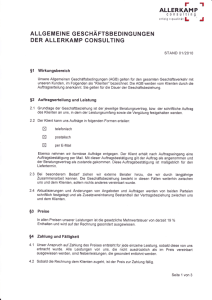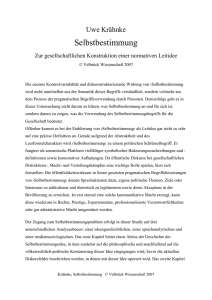Brüll - Selbstbestimmt in Beziehungen leben. vortrag am 18.11.15 in
Werbung
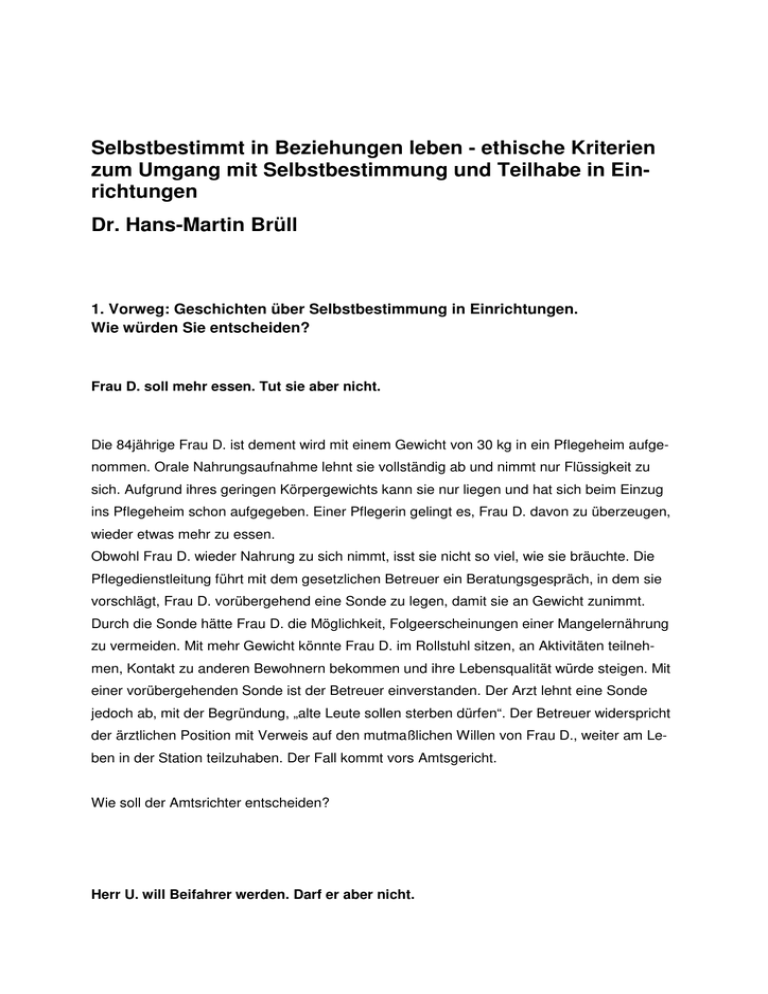
Selbstbestimmt in Beziehungen leben - ethische Kriterien zum Umgang mit Selbstbestimmung und Teilhabe in Einrichtungen Dr. Hans-Martin Brüll 1. Vorweg: Geschichten über Selbstbestimmung in Einrichtungen. Wie würden Sie entscheiden? Frau D. soll mehr essen. Tut sie aber nicht. Die 84jährige Frau D. ist dement wird mit einem Gewicht von 30 kg in ein Pflegeheim aufgenommen. Orale Nahrungsaufnahme lehnt sie vollständig ab und nimmt nur Flüssigkeit zu sich. Aufgrund ihres geringen Körpergewichts kann sie nur liegen und hat sich beim Einzug ins Pflegeheim schon aufgegeben. Einer Pflegerin gelingt es, Frau D. davon zu überzeugen, wieder etwas mehr zu essen. Obwohl Frau D. wieder Nahrung zu sich nimmt, isst sie nicht so viel, wie sie bräuchte. Die Pflegedienstleitung führt mit dem gesetzlichen Betreuer ein Beratungsgespräch, in dem sie vorschlägt, Frau D. vorübergehend eine Sonde zu legen, damit sie an Gewicht zunimmt. Durch die Sonde hätte Frau D. die Möglichkeit, Folgeerscheinungen einer Mangelernährung zu vermeiden. Mit mehr Gewicht könnte Frau D. im Rollstuhl sitzen, an Aktivitäten teilnehmen, Kontakt zu anderen Bewohnern bekommen und ihre Lebensqualität würde steigen. Mit einer vorübergehenden Sonde ist der Betreuer einverstanden. Der Arzt lehnt eine Sonde jedoch ab, mit der Begründung, „alte Leute sollen sterben dürfen“. Der Betreuer widerspricht der ärztlichen Position mit Verweis auf den mutmaßlichen Willen von Frau D., weiter am Leben in der Station teilzuhaben. Der Fall kommt vors Amtsgericht. Wie soll der Amtsrichter entscheiden? Herr U. will Beifahrer werden. Darf er aber nicht. Herr U. ist 30 Jahre alt, arbeitet im Lager einer Servicefirma und wohnt vollstationär auf einer Wohngruppe der St. Gallus-Hilfe. Seine Mutter ist gesetzliche Betreuerin. Herr U. hat eine geistige Behinderung und ist Epileptiker. Er bekommt etwa ein bis zwei Anfälle in der Woche. Einen Schutzhelm zu tragen lehnt er strikt ab. Herr U. hat den Wunsch, als Beifahrer auf dem Lkw zu arbeiten. Seine Mutter stimmt diesem Wunsch nicht zu. Die Firma steht dem Wunsch von Herrn U. grundsätzlich positiv gegenüber, möchte vom Arzt eine Garantie, dass durch die Medikamente das Anfallrisiko reduziert wird. Der Arzt kann einer Beschäftigung als Beifahrer nur zustimmen, wenn Herr U. einen Schutzhelm trägt. Es kommt zu einem Gespräch zwischen allen Beteiligten. Zu welcher Lösung kommen die Beteiligten? Eine Heimbewohnerin soll fixiert werden. Ob sie das will? Seit einigen Tagen fällt auf, dass Frau O. mehrmals orientierungslos nachts durch die Station wandelt und dabei andere Mitbewohner durch lautes Geschrei weckt. Einige belästigt sie auch sexuell. In der letzten Nacht ist sie schwer gestürzt und hat sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Nach dem Krankenhausaufenthalt kehrt sie zurück auf die Station. Die Heimleitung beantragt während des Krankenhausaufenthaltes beim Amtsgericht eine nächtliche Fixierung. Dagegen erhebt der gesetzliche Betreuer Einspruch. Wie soll der Amtsrichter entscheiden und wie begründet er seine Entscheidung? Frau Z. schlägt Frau A. Darf sie aber nicht. Bei der Morgentoilette entdeckt Altenpflegehelferin C. bei der Bewohnerin A. eine Fülle von blauen Flecken, die über den ganzen Körper verteilt sind. Die verwirrt erscheinende Frau A. sagt auf Anfrage von Frau C. aus, dass ihre Zimmernachbarin, die inzwischen stark orientierungslose Frau Z., auf sie eingeschlagen hat. Frau C. meldet den Fall der Wohnbereichsleiterin B. und der Heimleiterin F. Diese zieht die gesetzlichen Betreuer der beiden Heimbewohnerinnen zu einem Gespräch hinzu. Was sollen sie tun und wie begründen sie ihre Entscheidung? Diese Fallgeschichten aus der Praxis von Sozialunternehmen in Süddeutschland machen vielerlei deutlich: Selbst bestimmt in sozialen Einrichtungen zu leben ist nicht einfach. Sie haben immer in einem persönlichen und/oder institutionellem Kontext statt. Die Entscheidungsfindung, was in schwierigen Situationen, die das Recht auf Selbstbestimmung verletzen, zu tun ist fällt schwer. Ich werde Ihnen im Folgenden auf dem Hintergrund der geschilderten Fälle ein paar Begriffsklärungen vorschlagen: Um was geht es, wenn wir von "Selbstbestimmung" sprechen? Was versteht man unter "Teilhabe"? Wie steht es um die Möglichkeiten und Grenzen von selbstbestimmten Leben in sozialen Einrichtungen. Welchen Beitrag kann "die" Ethik zur Frage nach Selbstbestimmung von Klienten leisten? Und schließlich stelle ich Ihnen ethische Kriterien zusammen, die für den Umgang mit Selbstbestimmung und Teilhabe in Sozialunternehmen wichtig werden können. Ganz am Ende meines Vortrages stelle ich noch Anfragen an alle Akteure, die im Zusammenhang mit Menschen mit Hilfebedarf und deren Recht auf Selbstbestimmung zu tun haben. Meine Anfragen und Thesen speisen sich aus Erfahrungen mit stationären Lebenswelten, aus Leitungserfahrungen, einer kontinuierlichen Bildungsarbeit mit Mitarbeitern in der Alten- Behinderten- und Jugendhilfe und nicht zuletzt meiner Arbeit im Ethikkomitee der Stiftung Liebenau. Dieses Sozialunternehmen hat zur Orientierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine programmatische Schrift herausgegeben mit dem programmatischen Titel: Autonomie stärken.1 2. Was heißt Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? 1. Der Leitbegriff der Moderne Selbstbestimmung bzw. Autonomie geht zurück auf das Griechische: Autos= Selbst und nomos= Gesetz. Das heißt: Ich gebe mir selbst Gesetze. Ich lebe nach meinem Gesetz. Das Prinzip der Selbstbestimmung wird im deutschen Grundgesetz Artikel 2 aufgenommen und als ein Rechtsanspruch prominent formuliert: "(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. !"#" &''$$$ ) '' '&' ' ( & %$ (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden." In Ergänzung und zur Verdeutlichung wird auch von Eigenverantwortlichkeit gesprochen. Ich gebe dann "Antwort auf" eine Situation Ich stelle mich der Verantwortung gegenüber Personen in meinem Umfeld, gegenüber meine Nachbarschaft, gegenüber Institutionen. 2. "Selbstbestimmung " betrifft in diesem Sinn der Verantwortlichkeit im Handeln nie nur den Einzelnen, sondern berücksichtigt auch die Beziehung zu Anderen. In einem vertieften Sinn kann also von einer Autonomie in Beziehung2 gesprochen werden. So ist eine Abgrenzung gegenüber einem rücksichtlosen Egoismus möglich. Wer selbstbestimmt lebt, tut dies immer in Beziehungen. Selbstbestimmung verlangt Rücksichtnahme auf die Selbstbestimmungsrechte anderer, damit Zusammenleben gelingen kann. Meine Freiheit gelingt nur dann, wenn ich die Freiheitsrechte anderer respektiere. Meine Selbstbestimmung stößt damit auch an eine Grenze. Es ist die Grenze der Selbstbestimmung anderer. Wo Selbstbestimmungsansprüche aneinander geraten, entstehen Konflikte. 3. Eine so gedachte Autonomie in Beziehung widerspricht aber auch einem oft anzutreffenden Euphorismus des freien Wollens, meiner Autorenschaft für alles und jedes. Hier sei an die Ambivalenz menschlichen Daseins erinnert. Der Mensch ist nicht nur "König" (Herr seiner Selbst), er findet sich auch in Situationen als bedürftigen "Bettlers" vor. Dem Selbst-Sein und Selbst-Wirken-Können steht auch das Erdulden von Situationen oder das Bedürftig-SeinKönnens gegenüber. Diese Ambivalenz trifft nicht nur etwa auf Menschen mit Behinderungen zu. Es betrifft Jede und Jeden. 4. Noch etwas zum Begriff der Teilhabe. Sie ist ja der zentrale Begriff der Behinderternrechtskonvention der Vereinten Nationen. Sie hat zwei Bedeutungen. Einmal: Teilhabe als schlichtes Dabei-Sein. Ich bin dabei im Verein, auf dem Marktplatz oder im Fußballstadion. Zum anderen ist Teilhabe auch ein normativer Begriff: Ich bin dann noch nicht dabei, ich soll(te) eigentlich dabei sein. Ich habe ein Recht, dabei zu sein. Es gilt auch der Imperativ: Du sollst teilhaben. 5. Als moralische Grundorientierung liegt dem Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe die Anerkennung des jeweiligen Anders-Sein zugrunde. Nur wenn ich andere in ihrem AndersSein akzeptiere, wird ein selbstbestimmtes Leben möglich, das die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zulässt. Diese Moral der Akzeptanz des Anders-Seins gilt universell, auch für Menschen mit eingeschränkter Selbststeuerung. Ihnen trotz dieses Handicaps zu mehr Teil* + , - .,& - ) - -, /) / , 0 ) - - -, 1 , / / &/ 2 !""3 habe am Leben zu verhelfen, gelingt dann, wenn ich die Basis der gegenseitigen Anerkennung im Handeln akzeptiere und praktiziere. 3. Möglichkeiten und Grenzen von Selbstbestimmung und Teilhabe der Klienten in Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe 1. Der Doppelcharakter von sozialen Einrichtungen: Sie schützen/fördern und begrenzen/verhindern Einrichtungen der Behinderten-, Alten- und Jugendhilfe haben einen Doppelcharakter: Sie schützen ihre Klienten vor sich selbst und einer überfordernden Umwelt. Sie fördern zugleich Selbstbestimmung und Teilhabe ihrer Klienten als "Agenturen für Inklusion", indem sie zu aktiven Gestaltern und Netzwerkern in Sozialräumen werden. Sie können aber auch aus historischen, rechtlichen oder ökonomischen Gründen zu einem limitierenden Faktor für Selbstbestimmungswünsche von Klienten werden. Vielfach verhindern starre Dienstzeiten, räumliche Bedingungen oder zu wenig bzw.schlecht ausgebildetes Personal die Teilhabechancen ihrer Klienten. 2. Asymmetrische Verhältnisse Die Beziehungen in Einrichtungen zwischen Klient und Personal sind asymmetrisch geprägt Die Medizinethikerin Monika Bobbert3 hat auf die wichtigsten vier Asymmetrien von Betreuern/Assistenten und Klienten hingewiesen: 1.Die professionellen Helfer haben einen fachlichen Wissensvorsprung gegenüber den Betreuten. 2.Sie bewegen sich innerhalb der Institution in einer ihnen vertrauten Rolle, die ihnen Sicherheit gibt. 3.Sie leiden im Unterschied zu denen, die sie betreuen, nicht unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 4.Sie stehen nicht in Abhängigkeit von den Betreuten und unterliegen damit 3 Monika Bobbert: Patientenautonomie und Pflege. Begründung und Anwendung eines moralischen Rechts. Frankfurt a. M. 2002 nicht dem Druck, deren Erwartungen zu entsprechen. 3. Zielkonflikte lösen: normativ oder diskursiv Klienten leben in sozialen Einrichtungen nicht (ganz) freiwillig. Sie erleben hinsichtlich ihres Bedürfnisses nach einer eigenen Gestaltung ihrer stationären Lebenswelt Einschränkungen. Institutionen folgen ihren eigenen Gesetzen. Die Gesetze sind nicht notwendig die Gesetze des Einzeln mit seinen Ansprüchen und Wünschen. Diese Tatsache führt zu strukturell bedingten Zielkonflikten. Wer als Langschläfer ein ganzes Schulleben zum frühen von der Schulordnung geforderten Unterrichtsbeginn gezwungen wurde, bekommt eine Ahnung von der Brisanz dieses Zielkonflikts. Und das Beispiel zeigt auch, dass solche Zielkonflikte in der Regel normativ und direktiv (etwa über Heimordnungen) gelöst wurden. Diesen Zielkonflikt zwischen Autonomiewunsch und institutionellen Sachzwängen kann man auch diskursiv angehen. D.h. es muss verhandelt werden, wie und unter welchen Umständen Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte gelebt oder eingeschränkt werden dürfen bzw. müssen. Beispiele: Freiheitsentziehende Maßnahmen aufgrund eines richterlichen Beschlusses. Einschränkungen im Zahlungsverkehr oder in der Frage gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Die Zielkonflikte zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und den tatsächlichen Möglichkeiten von Einrichtungen können normativ über Regeln oder Gesetze geregelt werden. Sie können aber auch diskursiv über Verfahren angegangen oder gegebenenfalls aufgelöst werden. 4. Bedeutung "der" Ethik für einen fairen Umgang mit Selbstbestimmung und Teilhabeprozessen von Klienten in sozialen Einrichtungen Was kann nun "die" Ethik zu einem fairen Umgang mit solchen Zielkonflikten beitragen? Als erstes, indem sie ihr Kerngeschäft macht und in Zielkonflikten über verantwortliches Handeln reflektiert, am besten mit möglichst allen Betroffenen. Ethik heißt also zunächst, sich Gedanken mit anderen machen über verantwortliches Handeln. "Die" Ethik kann sich dabei in all ihre Dimensionen einbringen. Ich habe derer drei ausgemacht: 1. Sittliche Haltungen leben und diese reflektieren können: Die Tugendethik Auf unser Thema hin wäre zu fragen, welche sittliche Haltungen in sozialen Einrichtungen gelebt werden. Wird etwa der Respekt vor der Würde der Klienten gelebt und von den Leitungen befördert. 2. Sich an bestimmten Wertenormen und Regeln ausrichten und diese begründen können: Die normative Ethik Bezogen auf unser Thema wäre zu fragen, ob in den Einrichtungen Regeln zur Gewaltprävention, zum Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen, zu einer humanen Sterbebegleitung etc. existieren. 3. Strittige Fragen im wertegeleiteten Prozess mit anderen handlungsorientiert klären: Die Diskursethik Existieren in den Einrichtungen Plattformen für die Reflexion von problematischen Situationen? Gibt es spezifische Formen der ethischen Aufarbeitung von dilemmatischen Situationen wie sie etwa in den letzten Jahren immer häufiger installiert werden? Ethikkomitees oder das Instrument der ethischen Fallbesprechung haben dabei schon häufig gute Dienste für Klienten, Angehörige, gesetzliche Betreuer und Mitarbeiter geleistet und sie zu tragfähigen Handlungsoptionen geführt. 5. Ethische Kriterien zur Beurteilung und Handlungsorientierung in strittigen/dilemmatischen Situationen 1. Universelle Kriterien Kriterien sind Maßstäbe für verantwortliches Handeln. Sie geben Auskunft, wie auf möglichst gute, "richtige" Art und Weise mit schwierigen Situationen im Umgang mit Klienten und ihrer gesetzlichen Vertreter umzugehen ist. Ich unterscheide generelle und spezielle ethische Kriterien. Generelle ethische Kriterien/Prinzipien bei der Beurteilung von dilemmatischen Situationen. Die Medizinethiker Beauchamp & Childress haben 2009 vier Principles of Biomedical Ethics 4 ausfindig gemacht. Diese Prinzipien können auch als generelle Kriterien herangezogen werden, um Situationen einer Wertanalyse zu unterziehen. Sie sind wesentlicher Bestandteil von ethischen Fallbesprechungen. 1. Respekt vor der Autonomie (respect for autonomy) 2. Nicht Schaden (nonmaleeficence) 3. Fürsorge (beneficence) 4. Gerechtigkeit (justice) Im Horizont dieser Kriterien/Prinzipien werden Leitfragen gestellt: Wird bei Person A der Respekt auf Selbstbestimmung deutlich? Inwieweit hat es an dem Respekt gengelt? Welcher Schaden ist für Person B entstanden? Wer hat am meisten Vorteile im Fall? Wer hat den größten Schaden? Wie wird für wen gesorgt? Fällt jemand aus der Für- und Mitsorge heraus? Erfährt jemand überhaupt keine Aufmerksamkeit? Wer wird hier wem gerecht? Wem widerfährt Ungerechtigkeit? Auf wessen Kosten wird Gerechtigkeit geübt? 2. Spezielle Kriterien für Klienten/gesetzliche Betreuer5 Zu diesen universellen Kriterien/Prinzipien kommen spezielle ethische Kriterien zu Selbstbestimmungs- und Teilhabeprozessen im institutionellen Kontext zum tragen:: In jedem Fall ist der Rechtsanspruch der Klienten anzuerkennen: 1. Recht auf Festlegung des Eigenwohls. Jeder Klient oder ersatzweise der gesetzliche Betreuer muss die Chance in Institutionen erhalten, selbst festzulegen, was ihm gut tut. 2. Recht auf Information. Jeder Klient oder ersatzweise der gesetzliche Betreuer hat ein Recht auf Information zu seinem gesundheitlichen Zustand. Es besteht die selbstverständliche Möglichkeit, in Arzt und sonstige Hilfeplanaufzeichnungen Einblick zu nehmen. 3. Recht auf möglichst geringe Einschränkung des Handlungsspielraums. Jeder Klient oder ersatzweise der gesetzliche Betreuer erhalten die Möglichkeit, bei Einschränkungen des Selbstbestimmungsrechtes zu intervenieren. Dafür müssen die 4 5 Beauchamp & Childress Principles of Biomedical Ethics. New York 2009 2 .& + 6" Einrichtungen spezielle Verfahren entwickelt haben, die begründen helfen aus welchem Grund der eigene Handlungsspielraum des Klienten eingeschränkt wird/wurde. 4. Recht auf Zustimmung zu oder Ablehnung von Handlungen Dritter. Jeder Klient oder ersatzweise der gesetzliche Betreuer erhalten institutionell die Möglichkeiten auf Zustimmung zu oder Ablehnung von Handlungen, die von Dritten verursacht bzw. angeordnet wurden. 5. Recht auf die Wahl zwischen möglichen Alternativen. Jeder Klient oder ersatzweise der gesetzliche Betreuer erhalten institutionalisierte Chancen aus möglichen Handlungsalternativen wählen zu können. 3. Spezielle Kriterien für Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen 1.Mit asymmetrischen Beziehungen bewusst umgehen Da es beim Recht auf Autonomie nicht nur um ein bloßes Abwehrrecht geht, sondern auch darum, eine Willensbildung zu ermöglichen über Sachverhalte, die den Betreuten zum großen Teil fremd sind, muss die Asymmetrie zwischen Betreuten und Helfern ( siehe Kapitel 3.2) soweit wie möglich verringert werden. Um die Autonomie der betreuten Menschen zu fördern, ist es notwendig, diese Asymmetrien abzubauen bzw. dort, wo sie nicht verringert werden können, zumindest bewusst mit ihnen umzugehen. 2. Ethische Urteilskompetenz gewinnen Die Fallbeispiele haben gezeigt, dass in oft schwierigen Situationen Entscheidungen getroffen werden mussten. Das verlangt von den Betreuerinnen die Fähigkeit einer sorgfältigen Wahrnehmung und Beobachtung sowohl der Klienten als auch der eigenen Verhaltensweisen im Konfliktfall. Notwendig ist auch die Kompetenz zur Analyse der Zusammenhänge, in denen Autonomie gefährdet ist bzw. gefördert werden kann. Ebenso wichtig ist die Orientierung der Mitarbeiter an Leitwerten, die dem Professionsethos und dem Leitbild der Betreuungsorganisation entsprechen. Erforderlich ist die Fähigkeit, in Verhaltensalternativen angesichts von Autonomiewünschen zu denken. Zudem ist es bei dilemmatischen Situationen notwendig, dass Entscheidungen klar, transparent und nachvollziehbar begründet werden. Zur Professionalität ethischer Urteilskompetenz zählt schließlich die Überprüfung der gefäll- ten Entscheidung und deren eventuelle Revision oder Abänderung, wenn das Ziel einer gestärkten Autonomie nicht (mehr) erreichbar scheint. 3. In Beratung mit dem Betroffenen und seinem Umfeld entscheiden In allen Fallbeispielen ist auch deutlich geworden, dass es keine einsamen Entscheidungen von professionellen Helfern über die Autonomiechancen der Betroffenen geben darf. Entscheidungen in brisanten Situationen bedürfen der Einbeziehung des Betroffenen oder eines Stellvertreters, der die (mutmaßlichen) Anliegen des nicht (mehr) entscheidungsfähigen Betreuten vertritt. Bewährt hat sich auch das Prinzip der Interdisziplinarität, weil verschiedene Fachperspektiven den Fall in seiner Vielschichtigkeit offen legen und die Kreativität in der Lösungsfindung befördern. Das hat zwar den Nachteil einer zeitlichen Verzögerung in der Entscheidungsfindung, macht aber gemeinsam gefundene Lösungen tragfähiger. Je nach Situation ist es auch hilfreich, wenn das verwandtschaftliche und soziale Umfeld in die Entscheidungsbildung integriert wird. Auch dieser Schritt kann „lästig“ sein, birgt aber den Vorteil, dass die Ressourcen des Umfelds in die Lösungssuche produktiv eingebracht werden können. 4. Mit der „zweitbesten Lösung“ leben lernen In den Fallbeispielen wurde erkennbar, dass selten „glatte“ und ideale Lösungen gefunden werden konnten. Immer musste zwischen den verschiedenen Ansprüchen ein tragfähiger Kompromiss gefunden werden. In der Regel kann sich bei der Auflösung von dilemmatischen Situationen nicht eine Seite allein durchsetzen. Es bedarf also auch des Mutes, zu so genannten „zweitbesten Lösungen“ zu stehen. Oft ist eine „möglichst gute“, aber praktikable Lösung besser als die optimale, die sich in der Praxis als nicht realisierbar erweist. 6. Anfragen an alle an Selbstbestimmungs- und Teilhabeprozessen Beteiligten 1. Wer trägt welche Verantwortung? Eine mögliche Leitlinie: So viel Eigenverantwortung wie möglich, so viel Begrenzung wie nötig.. 2. Welche Regeln gelten im Aushandlungsprozess? Eine mögliche Leitlinie: Interventionen, die Selbstbestimmung einschränken, sind nur mit akzeptierten Regeln erlaubt. 3. Wie können die Lebenschancen der Klienten unterstützt werden?orientiertes Milieu eingebunden sind. Mögliche Leitlinie: Einschränkungen sind nur gerechtfertigt, wenn sie in ein ressourcen 4. Wie werden Sensibilität und Kompetenz für Selbstbestimmungs- und Teilhabechancen entwickelt? Mögliche Leitlinie: Für den institutionellen und professionellen Umgang mit autonomieeingeschränkten Menschen bedarf es instuitutionelell gestützter Formen der Bewaältigung und der Entscheidungsfindung in schwierigen Grenzsituationen. Dr. Hans-Martin Brüll Schwalbenweg 19 88285 Bodnegg Mail: [email protected] Mobil: 0171-7659215