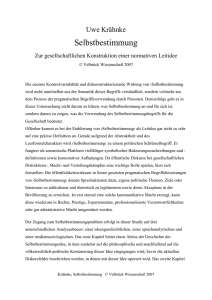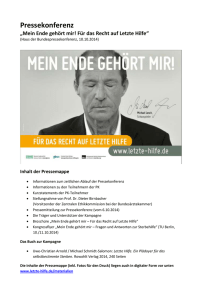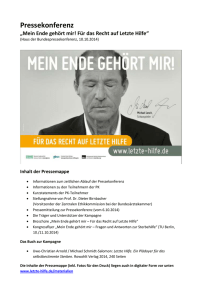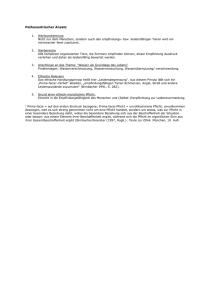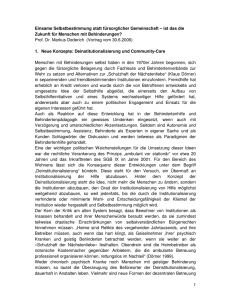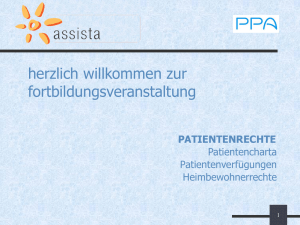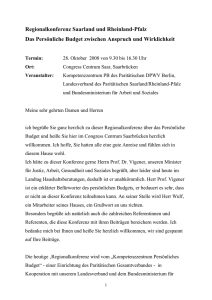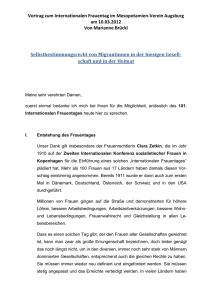„Ein Ausdruck mangelnder Fürsorge“
Werbung

„Ein Ausdruck mangelnder Fürsorge“ Stellungnahme des Medizinethikers Dieter Birnbacher zur aktuellen Sterbehilfe-Debatte Der Vorsitzende der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer Dieter Birnbacher hat eine medizinethische Stellungnahme zur „Kampagne für das Recht auf Letzte Hilfe“ verfasst. Es handelt sich dabei um die persönliche Position Birnbachers, der für sich keineswegs in Anspruch nimmt, im Namen der gesamten Kommission zu sprechen: In der Medizinethik gelten seit längerem zwei Prinzipien als oberste Leitbegriffe des Arzt-PatientVerhältnisses: die Fürsorge für das Wohl des Patienten und die Respektierung seines Selbstbestimmungsrechts. Spätestens seit dem Nürnberger Kodex gilt dabei das Gebot, den Patientenwillen zu respektieren, als vorrangig. Der Grundsatz „voluntas aegroti suprema lex“ hat grundsätzlich – wenn auch nicht absolut – Priorität vor dem Grundsatz „salus aegroti suprema lex“. Durch nichts anderes setzt sich die moderne Medizinethik deutlicher von der paternalistischen Tradition der hippokratischen Medizin ab. Heute ist weithin akzeptiert, dass der Arzt den Willen des Patienten gegen eine bestimmte Behandlung selbst dann respektieren muss, wenn die Behandlung im Sinne des Patientenwohls indiziert ist und die Ablehnung der Behandlung durch den Patienten als selbstschädigend gelten muss. Immer dann, wenn ihr der Wille des Patienten entgegensteht, endet die Verpflichtung des Arztes, Krankheiten zu heilen und Leben zu erhalten. Selbstbestimmung ist ein Recht, keine Pflicht, und Selbstbestimmung ist nicht allen Patienten gleich wichtig. Es ist ethisch zutiefst problematisch, einen Patienten zur Selbstbestimmung zu drängen, der sich – wie nach empirischen Erhebungen ungefähr die Hälfte aller Patienten – lieber vertrauensvoll der Fürsorge anderer – seiner Ärzte, seiner Angehörigen oder seiner Weltanschauungsgemeinschaft – überlässt, als mit eigenen Entscheidungen über das Ob und Wie einer Behandlung belastet zu werden. Aber auch die Verpflichtung, keinen zur Selbstbestimmung zu drängen, ist in gewisser Weise eine Respektierung von Selbstbestimmung. Nur dass sich die Respektierung in diesem Fall auf den Wunsch richtet, über eine Behandlung nicht selbst zu bestimmen. Selbstbestimmung ist in erster Linie ein Abwehrrecht – es dient der Abwehr von Zwang, Nötigung, Druck und Suggestion von Seiten anderer. Damit ist der Gehalt von Selbst-bestimmung aber nicht erschöpft. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung hängt nicht nur davon ab, dass andere Eingriffe in die eigene Lebensführung unterlassen, sie hängt auch davon ab, dass der Einzelne zur Selbstbestimmung allererst befähigt wird (durch Information, Aufklärung, Bildung) und zumindest eine Chance hat, sein Recht auf Selbstbestimmung zu betätigen. Wie für andere von der Aufklärung erkämpfte bürgerlichen Rechte – das Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder Religionsfreiheit – gilt auch für das Recht auf die je eigene Lebensführung („Entfaltung der Persönlichkeit“), dass es darauf angewiesen ist, dass seine Voraussetzungen gesichert sind und dass es Chancen hat, unter den realen gesellschaftlichen Bedingungen – solange es andere nicht schädigt oder unverhältnismäßigen Risiken aussetzt – ausgeübt zu werden. Das Selbstbestimmungsrecht bedarf wie alle anderen Freiheitsrechte der „Effektivierung“: Es muss Sorge dafür getragen werden, dass das in abstracto eingeräumte Recht auch in concreto in Anspruch genommen werden kann. Damit kommt erneut das Gebot der Fürsorge ins Spiel. Gerade an den Lebensgrenzen bedarf es ärztlicher Hilfe, wenn Selbstbestimmung nicht nur proklamiert, sondern auch gelebt werden soll. Fürsorge für den Patienten zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die Wünsche des Patienten ernst genommen werden (was eine kritische Prüfung dieser Wünsche nicht ausschließt), der Patient sachgerecht beraten wird und ihm Wege zur Verwirklichung seines Lebensentwurfs aufgezeigt werden. Das gilt auch für den Patienten, der lieber sterben als weiterleben möchte, dem dieser Wunsch aber nicht durch den Abbruch oder die Nicht-Aufnahme einer medizinischen Behandlung erfüllt werden kann. Selbstverständlich sollte kein Arzt verpflichtet sein, einem Sterbewilligen Mittel zu einem Suizid zur Verfügung zu stellen. Das sollte seine persönliche Gewissensentscheidung bleiben. Aber ihm sollten auch keine prohibitiven rechtlichen oder standesrechtlichen Hindernisse in den Weg gelegt werden. Das ist u. a. deshalb wichtig, weil vieles dafür spricht, Beratung und Praxis der Sterbehilfe – zumindest auf lange Sicht – in die Hände von Ärzten zu legen. Nur Ärzte können – sofern sie sich die dazu notwendigen Kompetenzen angeeignet haben – beurteilen, wie weit der Suizidwunsch eines Patienten Ausdruck einer behandelbaren Depression oder anderen psychischen Störung ist und wie weit er auf eine reale und dauerhafte Notlage zurückgeht, in der er einem nach seinen Maßstäben unerträglichem Leiden ausgesetzt ist und die sich mit keinem anderen Mittel beheben oder lindern lässt. Eine solche Hilfe durch gesetzliche oder standesrechtliche Verbote zu vereiteln oder zu erschweren, ist nicht im Interesse der großen Zahl von Patienten, denen ihr Selbstbestimmungsrecht wichtig ist. Da so gut wie jeder ein potenzieller Patient ist, ist es gegen das Interesse großer Teile der Gesellschaft. Die Chancen schwerkranker Patienten, ihren Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben zu verwirklichen, würden weiter reduziert, die Aussichten, wenn nicht auf die Hilfe ihres Hausarztes, so doch auf die eines anderen Arztes zählen zu können, zunichte gemacht. Natürlich ist zu hoffen, dass die Verbesserung der Versorgung mit Palliativmedizin in Zukunft dazu führt, dass weniger Sterbenskranke sich in einer so verzweifelten Lage sehen, dass sie sich einen früheren als den „natürlich“ eintretenden Tod wünschen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Angesichts der realen Verhältnisse zeugt der Versuch, die in Deutschland ohnehin erheblich eingeengten Möglichkeiten der Sterbehilfe zu beschneiden, nicht nur von Geringschätzung des Rechts auf Patientenselbstbestimmung, sondern auch von mangelnder Fürsorge. Prof. Dr. Dieter Birnbacher, geboren 1946, ist einer der renommiertesten Ethikexperten im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit den anthropologischen und ethischen Grundlagen- und Anwendungsproblemen der modernen Medizin (Organtransplantation, Prädiktive Medizin, Reproduktionsmedizin, Sterbehilfe, Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitssystem etc.). Bis zu seiner Emeritierung 2012 war er Professor für Philosophie an der Universität Düsseldorf, seit Ende 2013 ist er Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. 20. Oktober 2014