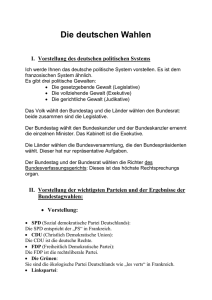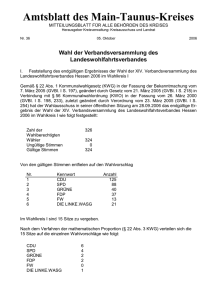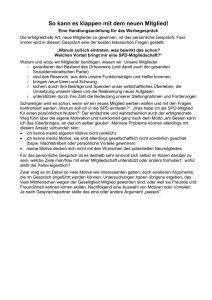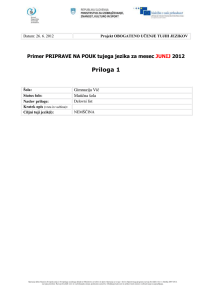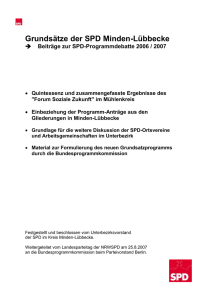Terminplan Inhalt - Universität Potsdam
Werbung
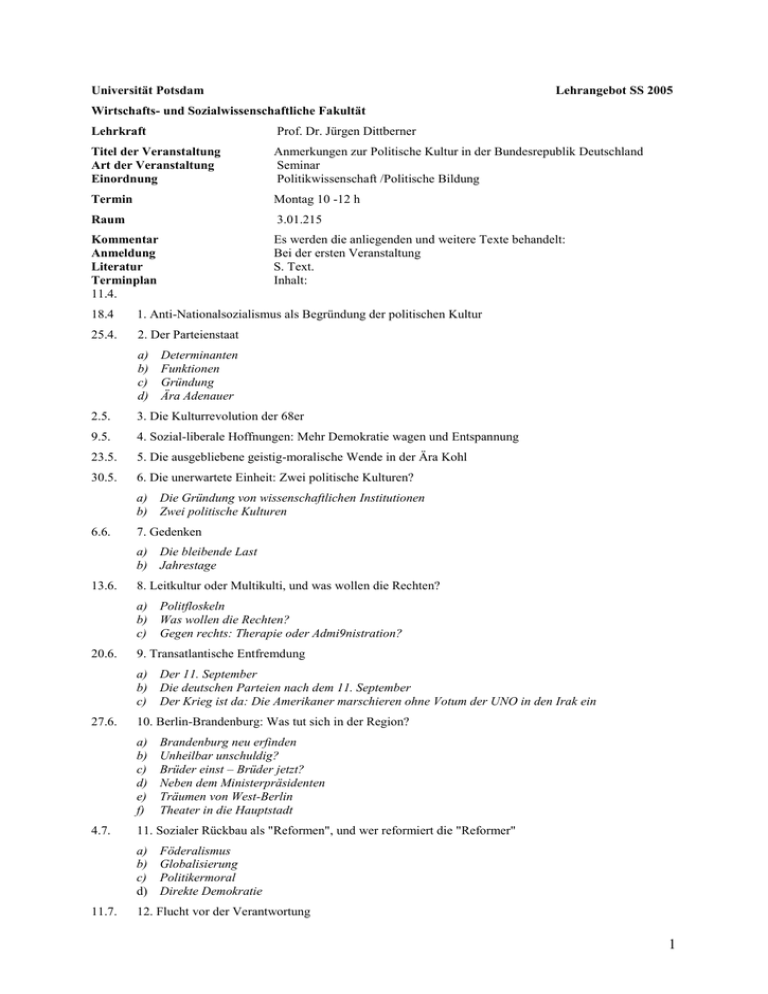
Universität Potsdam Lehrangebot SS 2005 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät Lehrkraft Prof. Dr. Jürgen Dittberner Titel der Veranstaltung Art der Veranstaltung Einordnung Anmerkungen zur Politische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland Seminar Politikwissenschaft /Politische Bildung Termin Montag 10 -12 h Raum 3.01.215 Kommentar Anmeldung Literatur Terminplan 11.4. Es werden die anliegenden und weitere Texte behandelt: Bei der ersten Veranstaltung S. Text. Inhalt: 18.4 1. Anti-Nationalsozialismus als Begründung der politischen Kultur 25.4. 2. Der Parteienstaat a) b) c) d) Determinanten Funktionen Gründung Ära Adenauer 2.5. 3. Die Kulturrevolution der 68er 9.5. 4. Sozial-liberale Hoffnungen: Mehr Demokratie wagen und Entspannung 23.5. 5. Die ausgebliebene geistig-moralische Wende in der Ära Kohl 30.5. 6. Die unerwartete Einheit: Zwei politische Kulturen? a) Die Gründung von wissenschaftlichen Institutionen b) Zwei politische Kulturen 6.6. 7. Gedenken a) Die bleibende Last b) Jahrestage 13.6. 8. Leitkultur oder Multikulti, und was wollen die Rechten? a) Politfloskeln b) Was wollen die Rechten? c) Gegen rechts: Therapie oder Admi9nistration? 20.6. 9. Transatlantische Entfremdung a) Der 11. September b) Die deutschen Parteien nach dem 11. September c) Der Krieg ist da: Die Amerikaner marschieren ohne Votum der UNO in den Irak ein 27.6. 10. Berlin-Brandenburg: Was tut sich in der Region? a) b) c) d) e) f) 4.7. 11. Sozialer Rückbau als "Reformen", und wer reformiert die "Reformer" a) b) c) d) 11.7. Brandenburg neu erfinden Unheilbar unschuldig? Brüder einst – Brüder jetzt? Neben dem Ministerpräsidenten Träumen von West-Berlin Theater in die Hauptstadt Föderalismus Globalisierung Politikermoral Direkte Demokratie 12. Flucht vor der Verantwortung 1 Politische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland 1. Anti-Nationalsozialismus als Begründung der politischen Kultur Es ist Jahrtausendwechsel. Die deutsche Hauptstadt ist wieder Berlin, nicht länger Bonn. Die alte „Staatspartei” der Union mitsamt ihrem liberalen Korrektiv ist durch eine rot-grüne Koalition abgelöst worden. Aus einem Pflastersteinrebell wurde ein Bundesaußenminister und der scheinbar ideal-typische „Homo Politicus“ an der Spitze der SPD hat das Handtuch geworfen. Die DM geht und der Euro kommt. Ein Jahrhundert der Weltkriege, der Massenmorde, der politischen Ideologien und Religionen geht zu Ende. Viele glauben, Deutschland sei in der Welt internationaler Organisationen und Verflechtungen mittlerweile so organisiert, daß ein Genozid jedenfalls von hier aus nie wieder erfolgen kann. So sei selbst ein Militäreinsatz deutscher Soldaten in Serbien trotz der im letzten Weltkrieg dort von Deutschen verübten Gewalt zu rechtfertigen. Wird und kann daher auch Schluß sein mit dem Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus und deren Opfer? In den letzten zehn Jahren des scheidenden Jahrhunderts gab es ein Aufleben der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Der Spielberg-Streifen „Schindlers Liste” füllte die Kinopaläste und bot reichlichen Gesprächsstoff für Podiumsdiskussionen in Akademien und Talkrunden auf allen Fernsehkanälen. Daniel Goldhagens Buch über Hitlers „willige Vollstrecker”1 löste ein Strohfeuer der Debatten unter Historikern, Journalisten und Betroffenheitspolitikern aus. Für das geplante Holocaust-Mahnmal in Berlin wurden elaborierte Kolloquien, Wettbewerbe, Auswahlsitzungen und Ausstellungen veranstaltet. Ungezählte Feuilletonzeilen sind darüber geschrieben worden. Die neu in die größer gewordene Bundesrepublik gekommenen „Nationalen Mahnund Gedenkstätten” der DDR wurden übernommen und Gegenstand von Konzeptions- und Zielplanungen der Historiker und Architekten. Die 50. Jahrestage der Befreiung vor allem der Konzentrationslager wurden wie Staatsakte zelebriert. Politiker hielten dabei Gedenkreden, ehemalige Häftlinge aus ganz Europa wurden zu den Festakten eingeladen. Tage- und nächtelang lasen sich Menschen die endlosen Texte der Tagebücher Victor Klemperers aus der Zeit von 1933 bis 1945 vor.2 Ein Holocaustgedenktag wurde vom Bundestag beschlossen. „Gedenken” war in diesen zehn Jahren zwischen 1990 und 2 000 zum Inbegriff der politischen Korrektheit geworden. Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, war eine Zeitlang unangefochtene Autorität auf diesem Gebiet. Ob aus Überzeugung, politischer Opportunität oder schlechtem Gewissen heraus: Seines Rates, seiner Zustimmung versicherten sich die Politiker im Bund und in den Ländern. Er hatte für den Holocaustgedenktag geworben, für die Veranstaltungen zum Jahrestag der Befreiungen der Konzentrationslager, er segnete die Konzeptionen für die Entwicklungen der Gedenkstätten ab. Ausgerechnet Ignatz Bubis war es, der 1998 eine Debatte darüber auslöste, ob es nunmehr zu viel sei mit dem politischen Gedenken. Hatte Martin Walser noch sein persönliches Mißbehagen gegen das institutionalisierte Gedenken ausgedrückt, so war der Vorwurf von Bubis gegen den Schriftsteller als „geistigem Brandstifter” das Startsignal für grundsätzlichere Erörterungen. Aus der moralischen Instanz Bubis war Partei geworden. Stimmen kamen auf, die sich dagegen wandten, daß die Diskussionen um das nationale Selbstverständnis in Deutschland zu sehr rückwärtsgewandt seien. Man müsse Rücksicht nehmen auf die Gefühle der Opfer, aber auch auf die der vielen anderen, war zu hören. Dabei hatte es den Eindruck, daß diese Diskussionen letzten Endes aufgekommen waren, weil die 1 Goldhagen, Daniel Jonah (1996): Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Berlin: Siedler Verlag 2 Notwendigkeit einer weniger ideellen, dafür aber um so materielleren Bewältigung der Nazivergangenheit auf die Nation zugekommen war: Die vor allem aus den USA prasselnden Klagen kluger und frischer Anwälte zielten auf Entschädigungen für überlebende Juden und andere Opfer, die von den Nationalsozialisten beraubt worden waren, denen Banken ihr Vermögen vorenthalten hatten oder die als Sklaven bei heute noch existierenden Firmen hatten arbeiten müssen. Als diese zweite Repararationswelle auf Deutschland und seine Wirtschaft zurollte, wurde es ernst. Der neue Kanzler Gerhard Schröder machte die Reparationsfrage zur „Chefsache” und zur gleichen Zeit war zu hören, daß es nun doch ein Ende haben müsse mit den Vorhaltungen über die Schuld des deutschen Volkes. Neben dem moralischen und politischen Gedenken, neben dem Bemühen um angemessene Riten und Gedenkorte hatte es von Anfang an eine materielle Seite der Vergangenheitsbewältigung gegeben. Das Wort „Wiedergutmachung” hallt aus der Frühzeit der Bundesrepublik her. Vor allem an Israel, auch an einzelne Opfer und Opfergruppen hatten die verschiedenen Bundesregierungen seit der Kanzlerschaft Konrad Adenauers über 100 Milliarden DM gezahlt. Demgegenüber nahm sich das Engagement von Firmen, die durch die Naziverbrechen materielle Vorteile erzielt hatten, eher bescheiden aus: Der Weltkonzern „Siemens” beispielsweise hatte von 1958 bis 1988 ganze sieben Millionen DM an die Jewish Claims Conference für geleistete Zwangsarbeit gezahlt und sagte 1998 unter dem Druck der Klagen aus den USA weitere 20 Millionen DM zu.3 Siemens hatte in Ravensbrück eine Produktionsstätte mit KZ-Häftlingen betrieben. Aber zu einem klaren Engagement bei der dortigen Gedenkstättenarbeit konnte sich die Firma trotz vieler lauter Forderungen und leiser Bitten nicht durchringen. Eines der Argumente, die zur Abwehr der Forderungen zu hören waren, lautete, die Firma Siemens sei in den neunziger Jahren eine ganz andere als Siemens zwischen 1933 und 1945 so wie Deutschland auch ein anderes geworden sei. Wahrscheinlich ist, daß die relativ bescheidenen Bitten aus Ravensbrück, Oranienburg und Potsdam um Hilfe bei der Gedenkstättenarbeit nach internem juristischen Ratschlag abgewehrt wurden, weil der Konzern Präjudizwirkungen befürchtete. Doch spätestens seit die Schweizer Banken zähneknirschend 2,2 Milliarden Mark für beraubte Naziopfer bereitstellten, um so Prozessen in der USA aus dem Wege zu gehen, kam das Thema Entschädigungen für Zwangsarbeit und Raub mit voller Wucht nicht nur auf Siemens, sondern auf die gesamte erste Garde der deutschen Wirtschaft - von Daimler Benz über Krupp und Degussa bis hin zu VW und BMW - zu. Der Kanzler und die deutschen Spitzenmanager wußten seitdem, daß hohe Zahlungen fällig waren. Sie wollten sie auch leisten, damit das Kapitel abgeschlossen würde, die Firmen wieder ihren globalen Geschäften nachgehen könnten und das Ansehen Deutschlands in der Welt nicht beschädigt würde. Es ist bemerkenswert, wie sehr sich die Debatte über den Nationalsozialismus in Deutschland seit 1995 entfernt hatte von der politischen und moralischen Hauptsache: der Klage darüber, daß das entwickelte Staatswesen eines zivilisierten Volkes zur Verbrecherorganisation geworden war, unter deren erbarmungsloser Willkür Abermillionen Menschen gelitten hatten und ermordet worden waren. Die späten Entschädigungen werden nicht geleistet um der Opfer willen, sondern weil der juristisch-politische Druck es den Managern angemessen erscheinen läßt. Die Institutionalisierung des Gedenkens wird nicht kritisiert wegen der ihr innewohnenden Routine und Widersprüchlichkeit, sondern wegen der vor ihr ausgehenden Zumutung für die Befindlichkeit der Deutschen und ihres Landes. Die Vergangenheit stört die Gegenwart und verleidet die Zukunft. Bis zur Wiedervereinigung war das gewiß nicht anders, aber zwei deutsche Staaten und die Mauer galten als die 2 Klemperer, Victor (1995): Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933 – 1941 und 1942 – 1945. Berlin: Aufbau-Verlag 3 Der Spiegel 49. 30.11.1998. 37 3 unabänderliche und unübersehbare Folge der Vergangenheit. Sich gegen diese Folge aufzulehnen, galt als ebenso sinnlos, wie es ein Aufstand gegen das Wetter gewesen wäre. In der Übergangszeit von der Bonner zur Berliner Republik war das verstärkte Gedenken wohl Ausdruck der Unsicherheit, wie mit der unerwarteten nationalen Einheit umzugehen sei. Die mit der Einheit beschenkte Nation war wie ein Kind, das sich zunächst fürchtet vor einem neuen Spielzeug, bis es dann um so hemmungsloser mit ihm hantiert. Als die Phase der Unsicherheit vorbei war, wurde die Last der Vergangenheit nicht mehr ertragen. Sie sollte abgelegt werden. Das sagten nicht nur Schriftsteller in aller Öffentlichkeit, sondern auch - diese allerdings vorsichtig - verantwortliche Politiker. Diejenigen, die sich dagegen wehrten, konnten jedoch den Abwurf der Vergangenheit nicht dadurch verhindern, daß sie dagegen polemisierten. Die Entwicklung ist fatal. Auf der einen Seite wird das Schicksal der Opfer des Nationalsozialismus allmählich ad acta gelegt, so wie es im Alltagsleben auf Dauer die meisten nicht rührt, wenn es dem Nachbarn schlecht geht. Auf der anderen Seite ist das Lösen von der Vergangenheit der Ausdruck einer Sicherheit, daß ähnliches in diesem Lande nicht wieder geschehen kann. Und das ist falsch. Beim Brand eines Ausländerheimes konnte die Fernsehnation miterleben, wie Menschen zu verbrennen drohten, derweil die Ordnungskräfte tatenlos waren und der Mob Beifall spendete. Die Politmanager der Neuen Mitte waren stolz darauf, daß ihre Inszenierungen beim Wahlvolk ankamen, ohne daß dies mit den vertrackten Inhalten und Problemen der Politik belästigt würde. Warum waren sie sicher, daß nicht ganz andere eines Tages noch besser als sie inszenieren können und das Tor aufgestoßen wird für einen Weg fort vom sozialen und liberalen Rechtsstaat? Das für diesen Weg empfängliche Wählerpotential wurde auf 15% geschätzt, das Geld zur Mobilisierung dieser Menschen war da wie das Beispiel der DVU zeigte: Es fehlte - glücklicherweise! - der Kommunikator, welcher diese Möglichkeiten erfaßt, interne Streitereien in der rechtsextremen Szene schlichtet und eines Tages im Bundestag Parolen wie „Deutschland den Deutschen” hätte erklingen lassen. Christ- wie Sozialdemokraten hatten mit ihren „Das-Boot-ist-voll”-Reden einen dafür empfänglichen Boden vorbereitet. Als es 2005 so weit war und die Rechtsparteien DVU und NPD Kooperationen vereinbarten, war das Gezetere groß. Wie schon beim vermasselten Verbotsantrag gegen die NPD wirkte die „politische Klasse“ hilflos. Nicht weil sie den Keim eines abermaligen Kulturverfalls erkannte, sondern weil sie um den Wirtschaftsstandort Deutschland fürchtete, wurde die Politikerklasse nervös. Es wird riskanter, wenn das Gemeinwesen seine moralische Verankerung in der bewußten Negation des Nationalsozialismus verliert. Ganz offensichtlich ist die mittlerweile institutionalisierte Form des Gedenkens nicht geeignet, diese Verankerung zu sichern. Was hilft der Gedenktag des 27. Januar? Welcher verstockte Geschichtsfälscher wird durch das Verbot der Holocaustlüge auf den Pfad der Tugend zurückgeführt? Was interessieren die Öffentlichkeit die Streitereien unter Opfergruppen über die Größe von Gedenktafeln? Ist es hilfreich, wenn die Medien den obersten Repräsentanten der jüdischen Deutschen zum nationalen Schiedsrichter in Fragen politischer Korrektheit stilisieren? Was bedeutet es für den liberalen Rechtsstaat, wenn die Politik verbietet, dass vor seinen Gedenkstätten demonstriert wird? Und was schließlich ist davon zu halten, daß „Gedenken” mittlerweile vielen zum Beruf geworden ist? Eine Debatte über diese Fragen ist notwendig! Wir brauchen eine Reform des Gedenkens. Die Gedenkkultur in Deutschland muß vom hohen Sockel herunter. Die Staatsakte zu diesem Metier sollten reduziert werden. Politiker sollten sich weniger in Sonntagsreden zum Thema üben, sondern im Alltag etwas beispielsweise dafür tun, daß die KZ-Gedenkstätten nicht verfallen. Es ist auch an der Zeit, darüber zu reden, ob diejenigen, die sich als Repräsentanten verschiedener Opfergruppen ausgeben, überhaupt demokratisch legitimiert sind. Statt Gedenken zum Beruf zu machen, sollte man sich dieser 4 Aufgabe viel mehr in den Bildungseinrichtungen des Landes annehmen. Schulen und Universitäten gehören in einen Verbund mit den Gedenkstätten. Die Gedenkstätten müssen ihre teilweise esoterische Isolierung aufgeben. Es muß ein Ende haben mit der moralischen Abstrafung derjenigen, die bei Debatten über den Nationalsozialismus nicht genau im Zentrum der politischen Korrektheit liegen. Vor allem darf es bei diesem Thema nicht länger jenen Dualismus geben zwischen den „Wissenden” und den zu Bekehrenden, zwischen den Gerechten und den Ungerechten, zwischen den Guten und den Bösen. Wer weiß schon, wie sich die einen oder die anderen unter den heutigen Akteuren im Ernstfalle verhalten würden? So wichtig es für das Gemeinwesen ist, an den Nationalsozialismus zu erinnern, so falsch ist es, eine allgemeine moralische Pflicht daraus zu machen. Auch diese moralische Pflicht würde wie andere in der säkularisierten Gesellschaft früher oder später mißachtet. Doch was nicht moralische Pflicht ist, muß deswegen nicht verschwinden. Es wird weiterhin die KZ-Gedenkstätten geben, so wie andere historische Stätten bleiben werden. Die besonders in den authentischen Orten schlummernde Mahnung von der Zerbrechlichkeit menschlicher Kultur und Zivilisation kann in Zukunft verstanden und aufgenommen oder ignoriert werden. Je mehr diese Stätten - auch kontrovers - mit dem Alltagsleben verwoben sein werden, desto größer wird die Chance, daß ihre Mahnung gehört wird. Praktisch bedeutet das, daß es gut wäre für die Gedenkstätten, wenn sie sich nicht nur mit Schulen und Universitäten verweben, sondern auch mit Theatern, Chören und Orchestern, ebenso mit Betrieben und Behörden. Die Gedenkstätten sollten die Sphäre der sakralen Weihe verlassen und sich hinein begeben in den profanen Alltag. Wenn sie das schaffen, können sie ihren Beitrag dazu leisten, daß die Menschen in diesem Lande nicht noch einmal ihre politische Kultur verlieren. 2. Der Parteienstaat Ob man sie mag oder nicht: Die politischen Parteien haben sich zum institutionellen Kern des Staatswesens Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Ohne die Betrachtung ihrer politischen Parteien würde man diese Republik nicht verstehen. Parteien entsenden die Mitglieder der Parlamente und der Regierungen. Sie bestimmen die Besetzung von Spitzenpositionen in der öffentlichen Verwaltung; sie haben Einfluß auf die Berufung der Richter des Bundesverfassungsgerichtes, der Mitglieder des Zentralbankrates der Bundesbank, der deutschen Kommissare in der Europäischen Union. Über die Rundfunk- und Fernsehräte der öffentlich-rechtlichen Anstalten wirken sie auf die „Vierte Gewalt“, die Medien, ein. Die Politik des Staates wird über die und durch die Parteien definiert. Gegen diese Omnipotenz der politischen Parteien werden - verstärkt seit den achtziger Jahren - Bedenken vorgetragen.4 Mit ihrem Einfluß überzögen die politischen Parteien die ihnen vom Grundgesetz zugedachte Rolle, bei der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken, nicht jedoch, diese zu bestimmen. Kritisiert wird, daß sich die Parteien den „Staat als Beute“ nähmen,5 daß sie die im Zuge der Globalisierung notwendigen Deregulierungen für Deutschland nicht schafften, daß sie über immer weniger Mitglieder verfügten und ihnen Wähler davonliefen. Das alte Bonner Parteiensystem sei nach 1989 einfach auf die Neuen Länder übergeklappt worden, wodurch sich die Entfremdung der Parteien vom Volke noch verstärkt habe. Jürgen Dittberner; „Sind die Parteien noch zu retten?“. Die deutschen Parteien: Entwicklungen, Defizite und Reformmodelle, Berlin 2004 5 Hans Herbert von Arnim, Der Staat als Beute. Wie Politiker in eigener Sache Gesetze machen, München 1993 4 5 Doch in der Berliner Republik bleiben die Parteien Kern des politischen Systems. Nur hat dieser Kern an Festigkeit verloren. Diese könnte wiederhergestellt werden, wenn die Beutepolitik der Parteien gegenüber dem Staat beendet und sichergestellt werden könnte, daß die politischen Parteien zuvörderst eine dienende Einstellung annehmen. Weiterhin müßten die Parteien einiges für ihre Akzeptanz tun, damit sie für Mitglieder attraktiver werden. Das könnte geschehen, wenn die untersten Gliederungen in die Lage kämen, den Menschen Ratschläge zu geben bei der Lösung ihrer Alltagsprobleme mit Arbeitsplätzen oder Wohnungen. Große Politik ist auf der untersten Ebene nicht mehr gefragt: Was soll der Abgeordnete Meier schon noch Interessantes über den Irak berichten, wenn am Abend zuvor der US-Präsident sich hierzu im Fernsehen ausgelassen hat? Wenn andererseits die Zahl der Parlamentssitze an die Wahlbeteiligung gekoppelt und bei einer Wahlbeteiligung von 70% nur 70% der möglichen Parlamentsmandate verteilt würden, müßten alle Parteien sich anstrengen, die „Partei der Nichtwähler“ so klein wie möglich zu halten. Schließlich müssen alle politischen Parteien bei ihrer Arbeit immer berücksichtigen, daß die Bürger im Osten Deutschlands eine andere politische Sozialisation erfahren haben als die im Westen. Steht beispielsweise auf der westlichen Seite der Wert „Leistung“ hoch im Kurs, so ist auf der östlichen Seite „Sicherheit“ wichtiger. a) Determinanten Das Bonner Parteiensystem war geprägt durch die bösen Erfahrungen der deutschen Vergangenheit. Um die Strukturschwächen der Weimarer Demokratie zu vermeiden, wurden die Parteien nach 1945 durch den Art. 21 GG in den Mittelpunkt gerückt. Der Wille des Volkes sollte sich im Parlament und in der von diesem abhängigen Regierung über die politischen Parteien artikulieren. Die Parteien sollten daher offen sein für Mitglieder und sich in allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen stets aufs Neue legitimieren. 6 Um den Willen des Volkes möglichst angemessen im Parlament widerspiegeln zu können, entschied man sich für das Verhältniswahlsystem, bei dem Abgeordnete über Listen entsprechend den Anteilen bei den Wahlergebnissen in die Parlamente delegiert werden. Gleichwohl wollte man auch regionale Anbindungen der Abgeordneten bewahren. So ist es zu erklären, daß das Verhältniswahlsystem mit dem Mehrheitswahlsystem kombiniert wurde. Die Hälfte der Abgeordneten wird über Wahlkreise ermittelt, die andere Hälfte über Listen, die allerdings maßgebend sind für die Gesamtverteilung der Mandate im Parlament auf die Parteien. Bei den Bundestags-, auch bei den meisten Landtagswahlen haben die Wähler somit eine „Erststimme“ für den Wahlkreis und eine „Zweitstimme“ für die Landesliste, die allein ausschlaggebend ist für die Zusammensetzung des Parlamentes. In der Regel haben nur die großen Parteien CDU/CSU und SPD die Chance, Abgeordnete mit Hilfe der Erststimme zu gewinnen. Das lange politische Überleben der FDP7 läßt sich damit erklären, daß sie es bisher noch bei jeder Bundestagswahl geschafft hat, genügend Zweitstimmen für den Einzug in den Bundestag zu erzielen. Meist Im „Parteiengesetz“ sind die Einzelheiten der inneren Ordnung der Parteien geregelt. Es ist vorgeschrieben, dass die Delegiertenversammlungen und die Vorstände von unten nach oben gewählt werden müssen. So sind alle politischen Parteien in Deutschland ähnlich aufgebaut mit Mitgliedergruppen an der Basis, Kreis-, Landesund Bundesparteitagen mit den dazugehörigen Vorständen. Innerparteilich von Gewicht sind zusätzlich die Fraktionen - in den kommunalen Vertretungskörperschaften, den Kreistagen, Landtagen und dem Bundestag sowie - falls vorhanden - die Dezernenten oder Mitglieder der Regierungen. Dieses Parteiengesetz wurde übrigens erst 1967, also 18 Jahre nach dem Auftrag durch die Verfassung, geschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hatte es vom Erlass dieses Gesetzes abhängig gemacht, dass die Parteien weiterhin staatliche Mittel für ihre Arbeit erhalten könnten. 7 Jürgen Dittberner, Die FDP. Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven. Eine Einführung, Wiesbaden 2005 6 6 verhalf ihr dabei eine direkte oder indirekte „Zweitstimmenkampagne“, die sie als Juniorpartner einer der beiden Hauptparteien anpries. So war es 1961, als die mit der CDU 8 im bürgerlichen Lager verbundene FDP den allgemeinen Unmut über die lange Herrschaft Konrad Adenauers aufnahm und mit dem Slogan „Mit der CDU aber ohne Adenauer“ 12,8% der Wählerstimmen - ihr bislang bestes Bundestagswahlergebnis - errang. Adenauer selber hingegen wußte natürlich vom Gewicht der Zweistimmen, und zögerlichen Wählern soll er bei Wahlversammlungen geraten haben: „Wenn Se nich` janz so zufrieden sind mit der CDU, meine Damen und Herren, dann geben Sie ihr eben nur die Zweitstimme!“ Das mit dem Mehrheitswahlrecht kombinierte Verhältniswahlrecht ist eine wesentliche Determinante des deutschen Parteiensystems, weil es das Überleben der „Partei der zweiten Wahl“,9 der FDP ermöglicht hatte, aber auch das Aufkommen der „Grünen“ 10, die bei einem reinen Mehrheitswahlsystem ebenso wie die FDP wohl keine Chance gehabt hätten. Eine Sonderrolle seit Bestehen der Bundesrepublik spielt die bayerische CSU. Sie ist halb ein Landesverband der CDU, halb eine eigenständige Regionalpartei.11 Ein Novum war der Erfolg der PDS12 bei der Bundestagswahl 1995, als sie mittels mehr als drei Direktmandaten im Osten Berlins in den Bundestag kam, obwohl sie bundesweit weniger als fünf Prozent der Wählerstimmen bekommen hatte. 1998 dann kam sie bundesweit über die 5-%-Grenze, und 2002 erreichte sie nur zwei Direktmandate, so daß außer diesen beiden keine weiteren PDS-Vertreter mehr dem Bundestag angehören. Prägend für das deutsche Parteiensystem ist die Fünfprozentklausel. Sie wurde eingeführt nach den Erfahrungen in der Weimarer Republik, daß eine große Zahl von Splitterparteien die parlamentarische Willensbildung erschwert und klare parlamentarische Mehrheiten verhindert hatte. Die Fünfprozentklausel, die übrigens kein Verfassungsgebot ist und erst 1957 in der heutigen Form in Kraft trat, hat dazu beigetragen, daß viele kleinere Parteien wie der „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE), die „Bayernpartei“ (BP), die „Deutsche Partei“ (DP) oder die „Zentrumspartei“ (ZP), die im ersten oder zweiten Deutschen Bundestag noch vertreten waren, aus dem Parteiensystem ausgeschieden sind. Seit den neunziger Jahren ist eine Diskussion über Sinn und Ungerechtigkeit der Fünfprozentklausel entbrannt. Das abschreckende Beispiel Weimars verblaßt. Vor allem bei den kommunalen Vertretungskörperschaften, wackelt die Sperre. In Berlin beispielsweise hat das Landesverfassungsgericht entschieden, daß bei den Wahlen zu den regionalen „Bezirksverordnetenversammlungen“ (BVV`s) die Fünfprozentgrenze nicht gelten dürfe. Bei der staatlichen Parteienfinanzierung wird die semistaatliche Stellung der politischen Parteien deutlich. Schon in den fünfziger Jahren sahen sich die politischen Parteien nicht in der Lage, ihre Arbeit aus eigenen Mitteln Mitgliederbeiträge, Spenden oder Einkünfte aus Vermögen - zu finanzieren. Zudem hatte das Bundesverfassungsgericht 1958 in seinem „Spendenurteil“ die bis dahin gängige Praxis abgeschafft, bei der über Fördervereine („Staatsbürgerliche Vereinigungen“) eingesammelte Parteienspenden für staatsbürgerliche Zwecke steuerbegünstigt waren. Das Gericht wollte die in dieser Regelung befindlichen Vorteile für die bürgerlichen Parteien CDU/CSU und FDP abschaffen und verwies in einer Nebenbemerkung auf die Möglichkeit der direkten staatlichen Parteienfinanzierung. Damit hatte es die Schleusen geöffnet: Der Staat wurde fortan immer stärker zur direkten und indirekten Mitfinanzierung der Parteien herangezogen. 8 Frank Bösch, Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU, Stuttgart/München 2002 Jürgen Dittberner, FDP – Partei der zweiten Wahl. Ein Beitrag zur Geschichte der liberalen Partei und ihrer Funktionen im Parteiensystem der Bundesrepublik, Opladen 1987 10 Joachim Raschke, Die Grünen. Wie sie wurden, was sie sind, Köln 1993 11 Alf Mintzel, Die CSU-Hegemonie in Bayern. Strategie und Erfolg. Gewinner und Verlierer, Passau 1998 12 Eva Sturm, „Und der Zukunft zugewandt“. Eine Untersuchung zur „Politikfähigkeit“ der PDS, Opladen 200 9 7 Anfänglich wollte man den Kuchen am liebsten unter den Bundestagsparteien aufteilen und die im Parlament nicht repräsentierten „Kellerkinder“ unberücksichtigt lassen. Doch das Verfassungsgericht verbot die Sperrklausel bei der Parteienfinanzierung. Die Folge war, daß auch kleinere Parteien öffentliche Mittel erhielten, wenn sie sich an Wahlen beteiligten. Dadurch wurde es beispielsweise den „Grünen“ finanziell möglich, sich nacheinander an mehreren Wahlen zu beteiligen, und das ist einer der Gründe dafür, daß sie es schafften, in das etablierte Parteiensystem einzudringen. Tabelle 1: Parteienhaushalte 1990 (Einnahmen in Millionen DM) 13 CDU CSU Grüne FDP PDS SPD Beiträge 87 16 10 11 30 129 Spenden 72 36 10 23 1,2 36 ChAgl.* 8,1 2 0 1 11 9 WKE+ 142 33 20 45 28 128 * = Chancenausgleich / + = Wahlkampferstattung Die Griffe der etablierten Parteien in die Staatskasse waren häufig dreist und direkt. In einer Art Krieg um die Parteienfinanzierung schritt hiergegen immer wieder das Bundesverfassungsgericht ein. Bis 1992 kam es zu 17 Entscheidungen des höchsten deutschen Gerichtes in dieser Sache. Der Entscheid von 1992 wollte der staatlichen Finanzierung der allgemeinen Tätigkeit der politischen Parteien Grenzen setzen und annullierte ein System der Finanzierung, das sich bis dahin durchgesetzt hatte mit den Eckpfeilern „Wahlkampferstattung“ und „Chancenausgleich“ - wobei der Chancenausgleich als Kompensation für Parteien mit geringem Spendenaufkommen gedacht war, jedoch in diesem Sinne nicht funktionierte. Nach diesem System hatten die Parteien 1990 neben ihren Beiträgen und Spenden, wie in Tabelle 1 gezeigt, staatliche Zuschüsse erhalten. Nach 1992 bestanden drei Bedingungen für die staatliche Parteienfinanzierung: 1. Vorrang der Eigenfinanzierung vor staatlicher Finanzierung. 2. „Relative Obergrenze“: Öffentliche Mittel dürfen die Summe der von der Partei selber erwirtschafteten Mittel nicht überschreiten. 3. „Absolute Obergrenze“: Die öffentlichen Mittel sollen die Durchschnittswerte der Jahre 1989 bis 1992 nicht überschreiten. 1994 wurde das Parteiengesetz wegen des Entscheids von 1992 novelliert. Danach erhielten die Parteien bei Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen 1 DM für jede Wählerstimme erstattet - bei den ersten 5 Millionen Wählern 1,30 DM. Außerdem wurden Beiträge und Spenden, die die Parteien einnahmen, zusätzlich aus öffentlichen Kassen bezuschußt. Begründet wurde die direkte staatliche Parteienfinanzierung damit, daß die Parteien im Wahlkampf mit der Wählermobilisierung eine öffentliche Aufgabe leisteten und daß sie generell Träger der politischen Bildung seien. Auch sollten die Parteien durch die öffentlichen Zuschüsse immunisiert werden gegen Abhängigkeiten von privaten Spendern. Tabelle 2: Direkte und indirekte Parteienfinanzierung 1992 14 13 Ulrich von Alemann, Parteien, Reinbek bei Hamburg 1995, S. 35 8 Direkte Staatsfinanzierung 230.000.000 DM “Parteisteuer” (Mandatsträgerbeiträge) 60.000.000 DM Steuerbegünstigungen ( bei Beiträgen und Spenden) 180.000.000 DM Zahlungen an Fraktionen( Bundestag und Landtage) 231.000.000 DM Zahlungen an Parteistiftungen 670.000.000 DM ZUSAMMEN 1.371.000.000 DM Es scheint, als ob die staatliche Parteienfinanzierung in Deutschland zu üppig ist. Neben der direkten Unterstützung gibt es die indirekte Finanzierung der Parteiarbeit durch den Umweg über Abgeordneten- und Mandatsträgerabgaben, Leistungen an die Fraktionen sowie über die parteinahen Stiftungen. Alle Transfers aus öffentlichen Kassen zugunsten der politischen Parteien zusammen ergaben 1992 nach Hans Herbert von Arnim eine Summe von 1.371.000.000 DM. Tatsächlich ist die Summe noch höher, denn von Arnim hat beispielsweise übersehen, daß auch die Jugendorganisationen der politischen Parteien ebenfalls staatlich alimentiert werden. In Berlin sind diese Organisationen im „Ring politischer Jugend“ zusammengeschlossen und erhielten jahrelang aus dem Topf der Jugendförderung öffentliche Zuwendungen. Die staatliche Parteienfinanzierung in Deutschland ist unüberschaubar und - auch im Vergleich mit anderen Ländern15 - stark ausgeprägt. Gegen zudringliche Spenden sind die Parteien dennoch nicht immunisiert, wie die Skandale in der CDU und in der SPD nach 1998 sowie bei der FDP nach 2002 gezeigt haben. Über die Höhe und die Form der Finanzierung wird es stets Streit geben. Wichtig ist, daß die Entscheidungen, die Abgeordnete als Parteienvertreter hierbei in eigener Sache treffen, transparent und überprüfbar sind. Es ist gut, daß das Bundesverfassungsgericht sich immer wieder mit dieser Thematik befaßt und die Parteien korrigiert und daß sich die Öffentlichkeit einschließlich der Wissenschaft nach langem Desinteresse seit einiger Zeit bei diesem Thema engagiert. Unstrittig ist, daß die Parteien finanziell in der Lage sein müssen, ihren Verfassungsauftrag zu erfüllen, bei der politischen Willensbildung mitzuwirken. Aber in einer Zeit allgemeiner Deregulierung müssen sie hierbei zu äußerster Sparsamkeit bei ihren Ausgaben gezwungen werden. Sie dürfen durch die öffentlichen Zuschüsse nicht faul werden. Zu den Determinanten des deutschen Parteiensystems gehört auch die Wirtschaftsordnung der alten Bundesrepublik, die soziale Marktwirtschaft. Bei seiner klassischen Ausformung als ZweieinhalbParteiensystem zu Beginn der sechziger Jahre war die soziale Marktwirtschaft geradezu das Pendant der Politik. Die zwei „Volksparteien“ CDU/CSU und SPD 16 beiderseits der Mitte mit dem „liberalen Korrektiv“ der FDP waren erfolgreich und dominierend, weil sie als Garanten des „Wirtschaftswunders“, des materiellen Wohlstands, galten. Die SPD war hierbei eingeschlossen seit 1959, als sie sich in Bad Godesberg auf Betreiben Herbert Wehners, Willy Brandts und Fritz Erlers nach dem Vorbild der erfolgreicheren Union zur alle Schichten und Gruppen der Bevölkerung ansprechenden Volkspartei („catch-all-party“) reformiert hatte. Die Parteien waren wie die Firmenmarken, deren Namen mit dem Wirtschaftswunder verbunden waren: „Persil“, „VW“, „BMW“, „Mercedes“, „Kloeckner“, „Hoechst“ oder „Deutsche Bank“. Andere Marken wie „Borgward“ etwa hatten sich in der Wirtschaft ebenso wenig halten können wie die „Deutsche Partei“ oder das „Zentrum“ in der 14 Hans Herbert von Arnim, Der Staat als Beute. Wie Politiker in eigener Sache Gesetze machen, München 1993, S. 284 15 S. Rolf Ebbighausen u.a., Die Kosten der Parteiendemokratie. Studien und Materialien zu einer Bilanz staatlicher Parteienfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1996 9 Politik. CDU/CSU, SPD und FDP waren eingeführte Marken der Politik. Die Sache kam ins Schwanken, als nach 1961 die nachgewachsene Generation sich mit der alleinigen Wohlstandsgarantie nicht mehr begnügen wollte, eine Demokratisierung der Gesellschaft forderte und in den Vietnamprotesten vom allgegenwärtigen Vorbild der USA abrückte. Mit der ersten wirtschaftlichen Baisse wurde die politische Rechte in Gestalt der „NPD” stärker und rüttelte - schließlich doch erfolglos - am Monopol des Zweieinhalb-Parteiensystems. Der von der jungen Generation ausgehende Wertewandel jedoch schuf mit den „Grünen“ einen neuen Mitspieler am politischen Markt. Noch immer ist die Wirtschaft das Pendant der politischen Parteien. Aber bei über vier, später sogar fünf Millionen Arbeitslosen seit den neunziger Jahren ist das Eis dünner geworden, auf dem sich die Parteien bewegen. Im Osten ist eine offensichtlich temporäre Regionalpartei entstanden, die Mitgliederbasis der Parteien hat abgenommen, die Parteibindungen der Bürger sind gelockert, die Zahl der Nichtwähler ist gestiegen. Noch halten sich die einzelnen Parteien aus Tradition, aufgrund ihrer gewachsenen institutionellen Verflechtung mit dem politischen System und das Parteiensystem insgesamt aufgrund des Mangels an Alternativen. Parteien werden aber mehr und mehr als lästige Beigabe einzelner beliebter Politiker gesehen, und das Wählervotum richtet sich an Personen aus. Die Chancen eines Machtwechsels im Bund hängen in den Augen der Öffentlichkeit davon ab, wie sich jeweilige Spitzenkandidaten präsentieren und welche Inszenierung sie den Wählern bieten. Darstellung 1: Determinanten des westdeutschen Parteiensystems Verfassungsrang: Artikel 21 Wahlsystem: Verhältniswahl mit Elementen der Mehrheitswahl Sperrklausel (5%) Staatliche Parteienfinanzierung (Mitfinanzierung) (Soziale) Marktwirtschaft Die Personalisierung der Politik ist die Folge des geschwundenen Glaubens an die Problemlösungskompetenz der Parteien. Sie entspricht einer personalisierten Betrachtungsweise aller Bereiche des Lebens, wie sie von den Massenmedien herbeigeführt wurde. Interessant sind die Stars, die „Promis“ im Sport, in der Kultur und Unterhaltungsszene und auch in der Wirtschaft. Gerhard Schröder steht so in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Thomas Gottschalk oder Johannes B. Kerner. Zwar ist die Marktwirtschaft offiziell noch immer das Hauptziel aller politischen Bemühungen der Politik, aber das Etikett „sozial“ hat an Wert verloren, und die Parteien müssen auf der Hut sein, daß es nicht eines Tages ein neuer Promi der Politik schafft, mit rechtsradikalen Parolen das gesamte Parteiensystem aufzurollen. Es scheint, daß die etablierten Parteien versuchen, dem vorzubeugen, indem sie selber am rechten Rand fischen. Die Unterschriftenaktion der hessischen CDU gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die „Möllemann-Friedmann-Affäre“ und der „deutsche Weg“ der SPD im Bundestagswahlkampf 2002 haben das deutlich gemacht. Doch ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer? b) Funktionen 16 Franz Walter, Die SPD. Vom Proletariat zur Neuen Mitte, Berlin 2002 10 Über die vom Grundgesetz postulierte Funktion der „Mitwirkung an der politischen Willensbildung“ des Volkes hinaus erfüllen die politischen Parteien tatsächlich weitere politische Funktionen, die sich entweder aus ihrem Verfassungsauftrag oder ihrem Organisationscharakter ableiten. Für viele ihrer Mitglieder sind die Parteien soziale Bezugsgruppen. Sie bieten Lebensinhalt, Geselligkeit, Statusfestigkeit und eröffnen einigen von ihnen Karrierechancen. In ihrer Eigenschaft als soziale Bezugsgruppe unterscheiden sich die Parteien nicht von anderen Organisationen, in denen Menschen zusammenwirken, handele es sich um Betriebe, Behörden, Vereine oder Verbände. Für die Mehrzahl ihrer Mitglieder sind die sozialen Rollen in den Parteien allerdings weniger prägend als Berufsrollen - für die dünne Schicht der Funktionäre und Berufspolitiker hingegen nehmen ihre politischen Parteirollen häufig ihr gesamtes soziales Leben in Anspruch. Es wird oft davon gesprochen, daß die Parteien für die Bevölkerung die Funktion der politischen Bildung ausüben würden. Hierbei handelt es sich um sehr vage Zusammenhänge, denn da die Parteien Hauptakteure im politischen Prozeß sind, wird das Interesse an politischen Vorgängen im Gemeinwesen mit politischer Bildung gleichgesetzt. Der Hinweis auf die politische Bildung ist auch deswegen problematisch, weil die Parteien hieraus sogleich den Anspruch der staatlichen Alimentierung ableiten. Die ihr Wesen wohl am zentralsten treffende Funktion ist die der Partizipation der Bürger am politischen Prozeß. Durch Parteien wird der politische Willensbildungsprozeß geöffnet für alle und bleibt nicht geschlossen - auf bestimmte Personen und Institutionen beschränkt - wie in einer Monarchie oder einer Diktatur. Daß nur sehr wenige Bürger die Chance der Partizipation aktiv nutzen, ändert an der Bedeutung dieser Funktion nichts. Mit ihren Forderungen und Programmen wirken die politischen Parteien daran mit, daß in der Gesellschaft allgemeine, auch konträre politische Zielvorstellungen entwickelt werden. Insofern können Parteien politische Ziel- und Sinngeber sein. An den stets um die Gruppe der unentschiedenen Wechselwähler bemühten politischen Parteien der Bundesrepublik wird kritisiert, daß sie alle mehr oder weniger den Wünschen dieser Bevölkerungsschicht hinterherlaufen, deren - ihnen aus Umfragen bekannten - Wünsche artikulieren und somit als politische Ziel- und Sinngeber versagen. Zweifellos sind die politischen Parteien die zentralen Agenturen bei der Rekrutierung des politischen Personals in der Bundesrepublik. Es ist kaum möglich, eine politische Aufgabe wahrzunehmen, ohne Mitglied einer politischen Partei zu sein. In den Versammlungen der politischen Parteien, von ihren Vorständen und Parteitagen sowie in den Fraktionen werden die politischen Repräsentanten ausgesucht. Praktisch haben die politischen Parteien ein Monopol bei der Rekrutierung des politischen Personals in der Bundesrepublik. Anders als beim öffentlichen Dienst wird dabei nicht nach formalen Kriterien wie Ausbildungsabschluß ausgewählt, sondern in erster Linie nach politischer Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit. Noch niemand hat den Nachweis erbracht, daß die politisch über die „Ochsentour“ Aufgestiegenen besser oder schlechter wären als die formal qualifizierten Beamten über die „Hühnerleiter“. Bei den Politikerkarrieren gibt es schnelle Aufstiege und jähe Abstürze, bei den Beamten ein allmähliches Schweben nach oben. Die Politiker auf allen Ebenen und damit die Parteien erfüllen schließlich die Aufgabe der Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsfindung für alle wichtigen Fragen des Gemeinwesens. Zwar haben die politischen Parteien und ihre Repräsentanten hierbei nicht das Monopol - die Medien, die Lobbyisten, die Wissenschaft, die Verwaltung, ausländische Interventionen und viele andere wirken bei den Entscheidungen mit. Verantworten müssen die Entscheidungen jedoch am Ende die Parteienvertreter bei den Abstimmungen in den Parlamenten oder in den Regierungen. 11 Darstellung 2: Funktionen der politischen Parteien Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes Soziale Bezugsgruppe für die Parteimitglieder Politische Bildung Entwickeln politischer Zielvorstellungen Rekrutierung politischen Personals Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsfindung in der Politik Die Entscheidungsfindung, die Rekrutierung des politischen Personals und die Partizipation der Bürger sind die zentralen Funktionen, welche die politischen Parteien erfüllen. Sie geraten in Rechtfertigungs- und Legitimationskrisen, wenn sie - wie im Falle der Großen Steuerreform Mitte 1997 - keine Entscheidungen treffen, wenn das von ihnen ausgewählte Personal zu wünschen übrig läßt oder wenn - wie in Deutschland schon lange - zu wenige Bürger sich über die Parteien am politischen Prozeß beteiligen. Die Parteien müssen aufpaßen, daß sie ihre politischen Funktionen erfüllen. Andernfalls verlieren sie ihre Existenzberechtigung. c) Gründung Im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 einigten sich die Siegermächte darauf, „in ganz Deutschland alle demokratischen Parteien zu erlauben und zu fördern“. 17 Tatsächlich jedoch verhielten sich die vier Mächte in dieser Angelegenheit sehr unterschiedlich. Die Sowjets hatten bereits am 10. Juni 1945 in ihrem „Befehl Nr. 2“ für ihre Besatzungszone „die Bildung und Tätigkeit aller antifaschistischen Parteien“ erlaubt. Die amerikanische Militärregierung ließ politische Parteien im September des gleichen Jahres zu, allerdings zunächst nur für die Kreisebene. Die Briten erlaubten die Parteigründungen im September sogleich auf Zonenebene, während sich die Franzosen zögerlich verhielten und im Dezember zwar Parteien grundsätzlich zuließen, sich mit der praktischen Umsetzung aber Monate Zeit ließen.18 Die Sowjets verfolgten das Ziel, mit Hilfe der politischen Parteien von Berlin aus Einfluß auf das gesamte Deutschland zu gewinnen. Die KPD, die SPD, die CDU und die LDP („Liberal-Demokratische Partei“) gründeten in der Hauptstadt Parteizentralen („Zentralausschüsse“), die einen Führungsanspruch auch für die Westzonen erhoben. Dieser gesamtdeutsche Anspruch aus Berlin wurde im Westen abgelehnt und teilweise heftig abgewehrt. Bei der SPD war es Kurt Schumacher, der von Hannover aus eine Gegenposition zu Berlin und dem von den Sowjets abhängigen Zentralausschuß unter Otto Grotewohl, Max Fechner und Gustav Dahrendorf aufbaute. Schumacher setzte die Neugründung der westdeutschen SPD, deren erster Vorsitzender er wurde, durch. Bei den bürgerlichen Parteien herrschten ohnehin dezentrale Tendenzen, die den Berliner Zentralen keine Chance ließen. Verstärkt kam auch hier bei der Ablehnung der Berliner Ansprüche die Furcht vor der Abhängigkeit von den Kommunisten hinzu. In der CDU hatte somit der Berliner Gründerkreis um Jakob Kaiser und Ernst Lemmer wenig Chancen. Im Westen bildete sich in der britischen Zone über die Landesverbände Rheinland und Westfalen hinaus die „Zonen-CDU“ als das stärkste Kraftfeld der Union insgesamt, das Konrad 17 Günter Olzog / Hans-J. Liese, Die politischen Parteien in Deutschland. Geschichte. Programmatik. Organisation. Personen. Finanzierung. 24., überarbeitete Auflage, München / Landsberg a.L. 1966 18 ebenda 12 Adenauer19 von Köln aus beherrschte. Adenauer wurde schließlich - das allerdings erst 1950, als er schon Bundeskanzler war und die CDU in Goslar als Bundespartei gegründet wurde - Bundesvorsitzender dieser neuen Partei. Zu stellvertretenden Bundesvorsitzenden wählte der Bundesparteitag Friedrich Holzapfel und Jakob Kaiser. Bei der LDP gab es zwar vielfältige Kontakte zu den sehr unterschiedlichen Parteigründungen im Westen, am Ende aber gingen auch die Liberalen in Ost und West unterschiedliche Wege. Mit der Gründung der FDP unter ihrem ersten Vorsitzenden Theodor Heuss im Dezember 1948 in Heppenheim an der Bergstraße war auch bei den Liberalen aus Furcht vor dem Einfluß der Sowjets eine reine Westpartei entstanden. Immerhin hatte es mit der “Demokratischen Partei Deutschlands” (DDP) eine gesamtdeutsche Parteiorganisation vor 1949 gegeben. Diese im März von Vertretern der FDP und LDP gegründete Partei hatte mit Theodor Heuss und Wilhelm Külz gleichberechtigte Vorsitzende. Weil er Külz Einbindung in die sowjetische Blockpolitik vorwarf, zerschnitt Heuss 1948 das Tuch: Die FDP entwickelte sich im Westen zur einflußreichen dritten Partei, während die LDP nach dem baldigen Tode von Külz unterdrückt, gesäubert und zum Satelliten der SED degradiert wurde. Die KPD schließlich hatte im Westen Deutschlands ohnehin keine besondere Resonanz, so daß der gesamtdeutsche Anspruch der Berliner Genossen um Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck von Anfang an illusorisch war. In den Anfangsjahren fand das Parteileben überall unter Aufsicht der Siegermächte statt. Deren Offiziere oder Beauftragte saßen dabei und scheuten vor Interventionen nicht zurück. Die so entstandenen Parteien wurden später vor allem von rechten Gruppierungen als „Lizenzparteien“ bezeichnet, womit sie als von den Mächten gegen die deutschen Interessen installierte Institutionen diffamiert werden sollten. Im Jahre 1948 wurde auf Anordnung der Militärgouverneure in den drei westlichen Zonen mit der „Währungsreform“ die DM eingeführt. Ludwig Erhard, damals Direktor des Amtes für Wirtschaft, hatte sich mit dem Konzept der freien Marktwirtschaft im Frankfurter Wirtschaftsrat gegen die SPD, aber auch Teile der CDU, durchgesetzt. Die DM wurde auch in den Westsektoren Berlins eingeführt. Darauf reagierten die Sowjets mit der Blockade West-Berlins, die wiederum von den westlichen Alliierten mit der „Luftbrücke“ abgewehrt wurde. Vor diesem Hintergrund erhielten die Ministerpräsidenten der bereits existierenden westdeutschen Länder ebenfalls 1948 von den drei Militärgouverneuren die Aufforderung zur Gründung eines westdeutschen Staates. Auf einer Konferenz in Rittersturz bei Koblenz hatten die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder Bedenken, die Teilung Deutschlands durch Gründung eines westdeutschen Separatstaates zu zementieren. Der gewählte, aber von den Sowjets nicht bestätigte Bürgermeister Berlins, Ernst Reuter, zerstreute diese Bedenken, indem er einen staatlichen Neubeginn im Westen als Chance erläuterte, daß eines Tages auch der Osten Deutschlands hinzukäme. So wurde aus den Landtagen ein „Parlamentarischer Rat“ gewählt, der sich am 1. September 1949 konstituierte. Der Rat hatte - entsprechend der Zusammensetzung der Landtage - eine schwache Mehrheit der bürgerlichen Parteien. Sein Präsident war Konrad Adenauer von der CDU, Vorsitzender des zentralen Hauptausschusses Carlo Schmid von der SPD. Kurt Schumacher, der Vorsitzende der SPD und eigentliche Gegenspieler Adenauers war infolge einer Verletzung aus dem 1. Weltkrieg und vor allem wegen der Nachwirkungen seiner langen KZ-Jahre gesundheitlich nicht in der Lage, direkt im Rat vor Ort zu sein. Der Parlamentarische Rat beschloß am 8. Mai 1949 das Grundgesetz. Der Text wurde - mit einigen Änderungen - Hans-Peter Schwarz, Adenauer, Bd. 1 Der Aufstieg 1876 – 1952, Stuttgart 1968 und Bd. 2 Der Staatsmann: 1952 - 1967, Stuttgart 1991 19 13 zuerst von den Militärregierungen und dann von einer ausreichenden Anzahl der Landtage genehmigt und trat am 24. Mai in Kraft. Die Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag waren am 14. August 1949. Die Bundesrepublik Deutschland war gegründet. = Deutsche Konservative Partei / Deutsche Rechtspartei d) Ära Adenauer20 In den fünfziger Jahren setzte sich in der Bundesrepublik eine politisch-psychologische Grundeinstellung durch, in der Privates Vorrang vor Öffentlichem hatte und Sicherheit im Materiellen und Sozialen der herrschende Wert war. Im Rahmen der globalen und nationalen Ost-West-Konfrontation transformierte sich diese Haltung in einen kräftigen Antikommunismus, dem die politische und wirtschaftliche Westintegration der Bundesrepublik entsprach. Wie in einer Schonung konnten in dieser Konstellation die neuen politischen Institutionen und die liberale Wirtschaftsordnung anwachsen. Die Bundesrepublik wurde gesehen als eine Konflikte negierende „nivellierte Mittelstandsgesellschaft”. Konrad Adenauers Politik entsprach diesen Grundstrukturen und setzte sie gegen zunächst durchaus vorhandene anderslaufende Tendenzen konsequent durch. Deswegen heißt die Zeit von 1949 bis 1961 zu Recht die „Ära Adenauer“. Auch die Entwicklung des Parteiensystems ist weitgehend aus Gefolgschaft oder Gegnerschaft zu Konrad Adenauer zu erklären. Die aus heterogenen Quellen gespeiste Neugründung der CDU mit ihrem bayerischen Pendant entwickelte sich allmählich von einem Machtinstrument des Bundeskanzlers zu einer lose integrierten Partei mit einem leichten politischen Eigengewicht. Ursprüngliche Bündnispartner der Union wie die DP oder der BHE wurden von der Adenauer-Partei aufgesogen oder überrollt. Die FDP stürzte sich wegen ihrer Konflikte mit Adenauer wegen des Wahlrechts und der Saarfrage in ihre erste große Krise. Die SPD schließlich suchte zunächst nach einer Alternative zur Adenauer-Politik und fand dann doch ihr Heil in deren Anerkennung und Kopie. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist das noch heute durchschlagende duale Parteiensystem zweier großer Blöcke mit der FDP als mehrheitsbeschaffender Funktionspartei. Die dieses duale System bildenden klassischen Bundestagsparteien hatten 1949 72% der Wählerstimmen errungen, und 1961 war ihr gemeinsamer Anteil auf 95% gestiegen! Viele der in der Ära Adenauer politisch Sozialisierten aber sollten später neue nichtmaterielle Werte vertreten und die Basis werden für die Nach-Adenauer-Partei der „Grünen“. In der ersten Legislaturperiode führte Adenauer die CDU/CSU, die FDP und die DP zu einer bürgerlichen Koalition zusammen, deren Mehrheit äußerst knapp war: Mit 202 von 402 Stimmen wurde er zum Kanzler gewählt. Die Wahl von Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten war ein Zugeständnis an den größten Bündnispartner der Union, die FDP. Die folgenden Auseinandersetzungen innerhalb der bürgerlichen Koalitionen unter Adenauer in den ersten beiden Legislaturperioden haben unmittelbar zur Aufreibung der kleineren Parteien und zur Spaltung sowie dem Überwechseln der FDP in die Opposition 1956 geführt. Trotz der knappen Mehrheit im Jahre 1949 und trotz zahlreicher Krisen war die Mehrheit für die Unionsparteien bis 1961 niemals ernsthaft infrage gestellt. Die Zeit von 1949 bis 1953 kann als wichtigste Periode für die Formierung des Parteiensystems in Westdeutschland gesehen werden. Denn neben der SPD, der Union und der FDP hatten die in dieser Zeit im Bundestag vertretenen Parteien DP, ZP, KPD, DRP und WAV die Chance der parlamentarischen Profilierung. Andererseits hoben die westlichen Besatzungsmächte am 17. März 1950 den Lizenzzwang für Parteien auf, und es kam zur Bildung von über zwanzig neuen Parteien. Aber von den kleineren 1949er Bundestagsparteien 20 Dieses Unterkapitel ist stark orientieret an: Jürgen Dittberner, Zur Entwicklung des Parteiensystems zwischen 1949 und 1961; in Dietrich Staritz, Das Parteiensystem der Bundesrepublik. 2. Auflage, Opladen 1980, S. 129ff. 14 schaffte neben der FDP lediglich die DP 1953 noch einmal den Sprung in den Bundestag. Von den zahlreichen Neugründungen des Jahres 1950 hatten lediglich zwei größere Wählerresonanz: Der „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE) und die neonazistische „Sozialistische Reichspartei“ (SRP). Manfred Rowold erklärt in seinem Buch über die kleinen und gescheiterten Parteien die vorübergehenden Erfolge dieser beiden Gruppierungen beruhten darauf, daß „deren Wirkungsmöglichkeiten bis dahin durch einen künstlichen Rückstau beschränkt waren: es sind dies die Vertriebenen ... und die neonazistische Rechte“. 21 Der BHE als reine Interessenpartei verlor im folgenden seine Basis durch die erfolgreiche Integration der Heimatvertriebenen, und die SRP konnte sich gegen die antinationalsozialistische Staatsdoktrin nicht halten. Die aus der Tradition der antipreußischen Welfenbewegung hervorgegangene „Deutsche Partei“ (DP) hatte hauptsächlich in Niedersachsen ein großes Anhängerreservoir und erzielte hier 19% der Stimmen. Die DP konnte sich im Bundestag bis 1961 nur durch Wahlabkommen mit der FDP, vor allem aber mit der CDU, halten. Ab 1957 war die DP praktisch ein Satellit der CDU. Der CDU war es von Anfang gelungen, denjenigen Politikern die soziale Basis zu entziehen, die sich für eine Wiedergründung des alten Zentrums eingesetzt hatten. Zwar war das Zentrum mit Helene Wessel als Sprecherin im ersten Bundestag vertreten, geriet aber mit seiner stark föderalistischen, sozialistischen und im Bildungsbereich klerikalen Politik zwischen alle Stühle. Die KPD scheiterte, obwohl sie eine der vier Lizenzparteien gewesen und während der Gründungsphase der Bundesrepublik in allen wichtigen parlamentarischen Gremien vertreten war. Die KPD trat wie die SED im Osten zunächst für einen eigenständigen deutschen Weg zum Sozialismus ein. Als es aber auf der internationale Ebene zum Bruch zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien eben wegen der Frage eigener Wege zum Sozialismus kam, vollzog die KPD 1948 einen Kurswechsel, erkannte die unbedingte Führung der KPdSU an und stellte schließlich 1952 den revolutionären Klassenkampf in den Mittelpunkt ihrer Politik. Zuvor war es zu „Säuberungen“ in den Reihen der KPD gekommen. Die KPD lehnte das Grundgesetz ab, beteiligte sich aber mit mäßigem Erfolg an den Bundestagwahlen. Als im April 1956 ein Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde, widerrief die KPD ihr revolutionäres Programm und wollte es durch ein Bekenntnis zum Parlamentarismus ersetzen. Zu dieser Zeit war sie nur noch in Bremen und Niedersachsen mit insgesamt 6 Abgeordneten vertreten. Als das Bundesverfassungsgericht am 17. August 1956 die Verfassungswidrigkeit der KPD festgestellt hatte, war diese schon zu einer bedeutungslosen Splitterpartei geworden. In der Geschichte des bundesrepublikanischen Parteiensystems hatte es nur zweimal den Fall gegeben, daß das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit einer Partei festgestellt hatte und diese anschließend verboten wurde. Vor der KPD hatte dieses Schicksal die SRP ereilt. In Niedersachsen (11%) und in Bremen hatte diese Partei Erfolge erzielt. Auf Antrag der Bundesregierung erklärte das Verfassungsgericht die SRP am 23. Oktober für verfassungswidrig. Waren beim KPD-Verbot die revolutionären Zielsetzungen für das Verbot maßgebend, so gab bei der SRP der undemokratische innere Aufbau der Organisation den Ausschlag. Adenauers klare Politik der Integration der Bundesrepublik in das westliche Staaten- und Bündnissystem war in der ersten Legislaturperiode heftig umstritten. Ein Hauptargument gegen die Politik des Bundeskanzlers war, durch die Westintegration würde die Wiedervereinigung unmöglich. Zu einem zentralen Streitpunkt entwickelte 21 Manfred Rowold, Im Schatten der Macht. Zur Oppositionsrolle der nicht-etablierten Parteien in der Bundesrepublik, Düsseldorf 1974, S. 26f 15 sich der Status des Saarlandes, das unter französischer Verwaltung stand. Adenauer wollte einen Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat, bei dem auch das Saarland als autonomes Gebiet assoziiert werden sollte. Hauptwidersacher des Kanzlers auch in dieser Sache war der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher,22 der die Einladung des Saarlandes zum Europarat als rechtswidrig bezeichnete. Sie widerspräche dem Selbstbestimmungsrecht. Mit dem Europarat würde zudem der Weg zu einem nichtsozialistischen Europa eingeschlagen. Gegen diese rigorose Oppositionspolitik des Parteivorsitzenden gab es innerhalb der SPD Widerstand: Sozialdemokratische Reformer wie Max Brauer, Paul Löbe und Willy Brandt warnten vor einer Isolierung der SPD und forderten die Partei auf, die sich in Europa bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Kurt Schumacher starb am 20. September 1952 an den Folgen seiner schweren KZ-Haft und seiner Tabaksucht. Obwohl sein Nachfolger als Parteivorsitzender, Erich Ollenhauer, Schumachers Politik im Wesentlichen fortsetzte, gewannen die Reformer in der SPD an Boden und setzten sich schließlich 1959 innerparteilich durch. Im Grunde war die Entscheidung für die Politik und Person Adenauers mit der Bundestagswahl 1953 gefallen. Die alte Koalition aus CDU/CSU, FDP und DP wurde um den BHE erweitert, um eine 2/3-Mehrheit für Verfassungsänderungen zugunsten der Wehrpolitik zu sichern. Doch die Viererkoalition war von starken inneren Spannungen geprägt. Hauptstreitpunkte waren die Saar- und die Wahlrechtsfrage. Mit seinem Ziel einer „Europäisierung“ der Saar stieß Adenauer auf heftigen Widerstand auch bei der FDP und beim BHE. Und als der CDU-Politiker Paul Lücke mit Parteifreunden einen Wahlrechtsentwurf vorlegte, bei dem 60% der Abgeordneten direkt und 40% über Listen ohne jeden Ausgleich gewählt werden sollten, war die Unruhe bei der FDP groß. Dieses „Grabenwahlsystem“ hätte ihren Einfluß erheblich geschmälert. Adenauer brachte das Wahlrecht mit der Saarfrage in Verbindung. Im November 1954 drohte er der FDP, bei einer Ablehnung des Saarstatus müßten die Liberalen aus der Koalition ausscheiden, und es werde das reine Mehrheitswahlsystem eingeführt. Daraufhin machte der FDP-Vorsitzende Thomas Dehler23 die Zustimmung seiner Partei zu den Wehrgesetzen von einer befriedigenden Lösung der Wahlrechtsfrage abhängig. Dehler verwies auf die seit Dezember 1954 in Bayern bestehende Viererkoalition aus SPD, FDP, BP und BHE gegen die CSU. In sechs weiteren Bundesländern, so Dehler, ließe sich die CDU mit Hilfe der SPD in die Opposition drängen, und dann werde es im Bundesrat keine Mehrheit für des Kanzlers Wahlrechtspläne geben. Daraufhin zog Adenauer seinen Wahlrechtsentwurf zurück. Als im November 1954 die Abstimmung über das Saarabkommen im Kabinett stattfand, stimmten die vier FDPMinister nicht zu. Bei der Abstimmung im Bundestag im Februar 1955 votierten die FDP und der BHE gegen das Abkommen. Die Bundesminister stimmten jedoch mit dem Kanzler. Die Folge war das Platzen der Koalition. Die BHE-Bundesminister Oberländer und Kraft verließen ihre Partei und hospitierten bei der CDU/CSU, zwei BHE-Abgeordnete wechselten zur FDP, und die Restfraktion des BHE ging in die Opposition. Auch zwischen der Union und der FDP kam es zum offenen Bruch: Entsprechend der Ankündigung Dehlers wurde der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold, mit einem konstruktiven Mißtrauensvotum der SPD und FDP durch den Sozialdemokraten Fritz Steinhoff ersetzt. Dieser Wechsel im größten Bundesland war ausschließlich aus bundespolitischen Gründen herbeigeführt worden: Die CDU wolle ihre Koalitionspartner mittels des Wahlsystems zerstören und in der Saarfrage deutsche Interessen aufgeben. Im Bundesrat hatte die Bundesregierungskoalition ihre 2/3-Mehrheit verloren. Bei der FDP gab es 22 23 Peter Merseburger, Der schwierige Deutsche. Kurt Schumacher. Eine Biographie, Stuttgart 1995 Udo Wengst, Thomas Dehler 1897 – 1967. Eine politische Biographie, München 1997 16 daraufhin eine unionstreue Abspaltung von 16 Abgeordneten, unter ihnen die vier Bundesminister. Diese Abspalter gründeten 1959 die „Freie Volkspartei“ (FVP), die sich im Parteiensystem nicht behaupten konnte. In dieser Zeit der Konflikte war Adenauer innerhalb der Union zunächst die alleinige und unumstrittene Autorität. Die CDU wurde als „Kanzlerwahlverein“ bezeichnet. Trotz der Streitereien mit seinen Koalitionspartnern setzte der Kanzler die Grundlinien seiner Politik der Westintegration durch. Doch just zu der Zeit, als „der Alte“ seine Ziele erreicht hatte - die Bundesrepublik war 1955 souveränes Mitglied der NATO geworden, und die soziale Marktwirtschaft schaffte das „Wirtschaftswunder“ - regten sich in der Partei Kräfte, die die Machtfülle des Kanzlers beschränken wollten. Gegen den Willen des Kanzlers gab ihm ein Bundesparteitag vier statt zwei Stellvertreter im Amt des Parteivorsitzenden bei, unter anderen Karl Arnold. Die CDU begann, sich vom Patriarchen zu emanzipieren und bildete allmählich eine eigene Organisation. Der Wandel vom Kanzlerwahlverein zur modernen Parteiorganisation setzte ein. Doch zunächst erzielte die Union mit Konrad Adenauer den größten Erfolg ihrer Geschichte: Mit der legendären Parole „Keine Experimente“ ging sie 1957 in den Wahlkampf und gewann die absolute Mehrheit. Die CDU/CSU regierte mit ihrem Satelliten DP allein, die SPD und die FDP befanden sich in der Opposition. Trotz des großen Wahlsieges wurde immer häufiger vom „Ende der Ära Adenauer“ gesprochen. Als er die außen- und wirtschaftspolitischen Grundlagen der Bundesrepublik geschaffen hatte, war der Kanzler 81 Jahre alt. Er sollte noch sechs weitere Jahre regieren. Nach dem Ausscheiden des Patriarchen aus der Politik befand sich die Union in einer Krise, die sie eigentlich erst 1982 überwunden hatte, als sie mit Helmut Kohl wieder an die Macht gekommen war. Das Wahlergebnis 1957 beschleunigte bei der anderen großen Partei, der SPD, den Reformprozeß. Infolge des schlechten Wahlergebnisses schwand die Autorität des Parteivorsitzenden Ollenhauer. 1958 wurden mit Willy Brandt, Herbert Wehner und Fritz Erler Reformer in den Bundesvorstand gewählt. Der Vorstand beauftragte eine Kommission mit der Ausarbeitung eines Grundsatzprogramms, das 1959 in Bad Godesberg verabschiedet wurde. Die SPD erkannte die von den Regierungen Adenauers geschaffenen Grundstrukturen der Bundesrepublik an und entfernte sich vom Typ der marxistisch beeinflußten Klassenpartei hin zur unideologischen, für alle Gruppen in der Gesellschaft offenen Volkspartei. In Godesberg sagte Fritz Erler, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag: „Wir kämpfen nicht gegen den Staat, sondern um den Staat, und zwar nicht um einen Staat der fernen Zukunft, nicht erst um den Staat im wiedervereinigten Deutschland, sondern auch und gerade um den Staat in dieser Bundesrepublik, die wir regieren wollen und werden.“ Für die Bundestagswahl 1961 wurde der junge Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, 24 als Kanzlerkandidat nominiert. Gegen den „Alten aus Röhndorf“ sollte er - ganz im Stil amerikanischer Wahlkämpfer - Frische, Jugend und Zukunft personalisieren. Zur Vorbereitung dieses Wahlkampfes hatte sich der spätere Regierende Bürgermeister Berlins, Klaus Schütz, in die USA begeben, um dort die erfolgreiche Kampagne John F. Kennedys gegen Richard Nixon zu studieren. In der CDU mußte derweil Adenauer Ludwig Erhard,25 den ungeliebten „Vater des Wirtschaftswunders“, als Kronprinz neben sich dulden. Der Wahlslogan der CDU 1961 lautete „Adenauer/Erhard und die Mannschaft“. Auch in der FDP hatte sich in der Zeit von 1957 bis 1961 ein Wandel zu einer moderneren Parteiorganisation hin vollzogen. Der schroffe Franke Thomas Dehler wurde nach einer Übergangszeit unter Rheinhold Maier durch Erich Mende als Parteivorsitzendem ersetzt. Mende war ein stolzer Ritterkreuzträger und ein national 24 25 Peter Merseburger, Willy Brandt 1913 – 1993. Visionär und Realist, Stuttgart/München 2002 Volker Hentschel, Ludwig Erhard. Ein Politikerleben, München / Landsberg a. L. 1996 17 ausgerichteter Rechtstaatsliberaler. Er ging in den Wahlkampf mit dem Ziel einer erneuten Koalition mit der CDU, aber ohne Adenauer. Überlagert wurde der 1961er Wahlkampf durch den Bau der Mauer in Berlin. Willy Brandt bekam als Regierender Bürgermeister riesige Medienaufmerksamkeit. Er war „vor Ort“, während man Adenauer vorwarf, zu spät nach Berlin gekommen zu sein. Willy Brandt war allenthalben präsent. Beim Besuch des amerikanischen Präsidenten Kennedy wirkte er wie dessen natürlicher Partner, während jedermann sah, daß zwischen dem Präsidenten und dem Bundeskanzler die „Chemie nicht stimmte“. Die Wahlen von 1961 wurden von allen Beteiligten auch als eine Entscheidung über die Ablösung Adenauers aus der deutschen Politik begriffen. Während die FDP jenen Kräften in der Union Hilfe versprach, die Adenauer durch Erhard ersetzen wollten, stellte die SPD dem greisen Kanzler die personelle Alternative des jungen Willy Brandt gegenüber. Innerhalb der Union wußte man zwar, daß Adenauer abgelöst werden müßte, über das Wie und Wann aber bestanden keine klaren Vorstellungen, zumal der Kanzler selber sich mit Energie, List und Tücke gegen seine Ablösung wehrte. Nach einigem Koalitionsgerangel, in dessen Verlauf Adenauer auch einmal die SPD als möglichen Koalitionspartner ins Gespräch brachte, einigten sich Union und FDP auf eine befristete Kanzlerschaft Adenauers. Der FDP wurde das als „Umfall“ angekreidet. Seither haftet das Etikett „Umfallerpartei“ an ihr. Erich Mende blieb der Regierung fern. Er wurde erst Vizekanzler als am 16. Oktober 1963 Ludwig Erhard tatsächlich zum zweiten Kanzler der Bundesrepublik gewählt wurde. Die „Ära Adenauer“ war beendet. Das Parteiensystem befand sich in einer Umbruchphase. 3. Die Kulturrevolution der 68er Durch die Zwischenzeit waren Berlin (-West) einerseits und (Berlin (-Ost) mit Brandenburg andererseits zwei Welten geworden. An der Freien Universität Berlin fanden Seminaren statt, die auch von den Kommilitonen Rudi Dutschke und Bernd Rabehl besucht wurden. Im Wintersemester 1964/65 hielt Prof. Otto Stammer 26 ein Oberseminar ab zum Thema: "Demokratischer Sozialismus und Marxismus". Dieses Seminar hatte von vornherein etwas Provokantes, denn hinter dem vordergründig theoretischen Titel war eine Auseinandersetzung mit dem Godesberger Programm der SPD beabsichtigt. Stammer, der von den Studenten wegen seiner Gradlinigkeit und glänzenden Rethorik geliebte Professor der Soziologie, war alter Sozialdemokrat und herzlicher Gegner des Godesberger Reformprogramms seiner Partei aus dem Jahre 1959. Daraus und insbesondere aus seiner Abneigung gegen Herbert Wehner machte er keinen Hehl. Das war mutig an einer Hochschule, wo es ansonsten zum guten Stil zählte, Politisches nur höchst kodiert anzusprechen. Das Seminar sollte ein Zerriß des Godesberger Programms werden. Innerhalb und außerhalb der SPD hatte Stammer immer wieder kritisiert, daß dies kein Grundsatzprogramm sei, weil ihm keine umfassende Gesellschaftsanalyse vorausging. Das Seminar würde nach den Vorstellungen seines Leiters auch zeigen, daß der Marxismus trotz aller Fehlentwicklungen im Osten und aller Verteufelungen im Westen für den Sozialwissenschaftler ein seriöser Ansatz der Gesellschaftsanalsyse war. 26 Otto Stammer, Prof. Dr. rer.pol., geb. 1900, war von 1925 bis 1929 politischer Redakteur und Leiter des steirischen Arbeiterbildungswerkes, von 1939 bis 1932 Dozent und Leiter der Arbeiter-Wirtschaftsschule in Peterswaldau, mußte bei den Nationalsozialisten seine Dozententätigkeit aufgeben, war 1937 bis 1948 in der Industrie tätig und wurde 1951 Prof. für Soziologie an der Freien Universität Berlin sowie 1954 Leiter des dortigen Instituts für politische Wissenschaften. 18 Für das damalige geistige Klima der Bundesrepublik war das eine politische Provokation. Im Verlaufe der Veranstaltung, deren Teilnehmer zum großen Teil später selber Professoren wurden, geschah etwas Ungeheuerliches: Der Student Dutschke kritisierte nicht etwa im angemessenen Seminarton, sondern in seiner später bekannt gewordenen Dämagogik: "Otto Stammer werfe ich vor, daß er hier hinter akademischen Mauern die revisionistische SPD attackiert, anstatt sich aktiv am Kampf dagegen zu beteiligen!" Es war eine Tabuverletzung, einen Professor ohne seinen Titel anzusprechen und insbesondere den so geachteten Stammer direkt anzugreifen. Im Seminar wurde damit ein Diskssionsstand deutlich wie er im SDS vorherrschte. Der SDS ("Sozialistischer Deutscher Studentenbund") war bekanntlich der beim Parteivorstand in Ungnade gefallene ehemalige Studentenverband der SPD27 und Wegbereiter der Außerparlamentarischen Opposition. Die Abkapselung des Ostens durch die Mauer und die damit einhergehende Verteufelung nicht nur des realen "Sozialismus", sondern auch seiner theoretischen Grundlagen bewirkten bei der studentischen Jugend das Bedürfnis, selber zu prüfen, was an diesen Grundlagen dran ist, ob sie in der DDR falsch umgesetzt waren oder immanent zu Zuständen wie im anderen Teil Deutschlands führen mußten. So kam es im Schatten der Mauer gerade im Westen Berlins zu einer Marxismus-Renaissance. Prof. Lieber hielt Vorlesungen über den "Stamokap", den staatsmonopolistischen Kapitalismus, die wie Verschwörungsversammlungen besucht wurden und bei denen alles Gesagte von den Studenten förmlich aufgesaugt wurde. Sie besorgten sich Originaltexte von Marx und Engels. Als die Mauer vom Westen her etwas durchlässiger wurde, erwarben viele Studenten sämtliche Ausgaben der 36- bändigen Ausgabe des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED mit den Werken von Karl Marx und Friedrich Engels.28 Brav setzten sich die Eleven mit Texten folgenden Charmes auseinander: "Soweit Unterschied zwischen capital fixe und capital ciculant in bezug auf die individuelle Konsumtion als Gesichtspunkt hereinkommt, so ist dieser schon damit gegeben, daß das capital fixe nicht als Gebrauchswert in die Zirkulation eingeht. (Vom Samen in der Agrikultur, da er sich vervielfältigt, geht / ein Teil als Gebrauchswert in die Zirkulation ein.) Das nicht-alsGebrauchswert-in-die-Zirkulation-Eingehen unterstellt, daß es nicht zum Gegenstand der individuellen Konsumtion wird."29 Die West-Berliner Studenten saßen in Zirkeln in "Kapitalkursen" zusammen und versuchten, den Inhalt der Abhandlungen des Meisters zu verstehen und zu erlernen. In Anspielung auf die jeweils zu zehn Ost-Mark erwerblichen und in blaue Plastikdeckel eingefaßten Bände der Gesamtausgabe hieß es - halb spöttisch, halb respektvoll - , die Studenten hätten sich "blaugelesen". Aber es war weniger die komplizierte und etwas verstaubt wirkende Botschaft, die beispielsweise den Soziologie-Studenten letztlich von den Kapital-Kursen abschreckte, sondern es war das Verhalten des Botschafters - des Kursleiters - , das zu einem Abbruch der Kursteilnahme führte. Dieser versuchte nicht, die Texte offen zu diskutieren und sie dadurch zu erklären, sondern war darauf bedacht, die Botschaft zu verkünden. Das geschah auch mit moralischem Druck: "Wenn Ihr das nicht so seht ,seid ihr entweder zu blöd, es zu kapieren, oder ihr seid nicht bereit, Euren kleinbürgerlichen 27 s. Tilmann Fichter/Siegward Lönnendonker, Kleine Geschichte des SDS, Der Sozialistische Deutsche Studentenbund von 1946 bis zur Selbstauflösung, Berlin 1977, S. 64 ff. Die Auseinandersetzung um das Godesberger Programm war ein Hauptanlaß für den Verstoß des Studentenverbandes durch die Mutterpartei. 28 Institut für Marxismus beim ZK der SED (Hg.), Karl Marx/Friedrich Engels, Werke 1 bis 36 sowie Ergänzungsbände, Berlin 1967 29 Marx-Engels-Lenin-Institut Moskau (Hg.), Karl Marx, Grundrisse der (Rohentwurf politischen Ökonomie) 1887 - 1858, Anhang 1850 - 1859, Berlin 1953 19 Interessenstandpunkt zu verlassen!" Dem Studenten dämmerte es, daß das Fehlverhalten des Führungspersonals sowohl in der DDR als auch im Kapital-Kurs etwas mit der Botschaft zu tun haben mußte. Ihr schon bei Marx angelegter und von Lenin pointierter Anspruch auf absolute, weil angeblich wissenschaftlich fundierte, Wahrheit war die Quelle des diktatorischen und illiberalen Verhaltens vieler Menschen, die im Namen des Marxismus auftraten, ob als Politiker oder Wissenschaftler. Die Marx- und Theorie-Versessenheit insbesondere des SDS und einiger seiner Protagonisten entwickelte trotz vieler Vorbehalte bei großen Teilen der Studenten in Berlin eine Dynamik, die zum Medium der Kritik der jüngeren Generation an zahlreichen Eigenschaften der westdeutschen Gesellschaft wurde. Schon in der "SpiegelKrise" im Jahre 1962 und in der Notstandsdebatte danach wurde deutlich, daß gerade die studentische Jugend einen Widerspruch zwischen dem demokratischen Anspruch und der Wirklichkeit der Republik empfand. Diese Reserve gegenüber dem politischen System wurde größer, als im Dezember 1966 in Bonn eine Große Koalition zwischen CDU/CSU und SPD gebildet wurde. Daß in dieser Koalition der ehemalige NSDAP-Parteigänger Kurt Georg Kiesinger Kanzler und der ehemalige Emigrant Willy Brandt Außenminister waren, wurde von offizieller Seite als innere Aussöhnung deklariert, bei großen Teilen der jungen Generation aber als moralisch verwerflich empfunden. Es kam hinzu, daß damals angesichts des Vietnam-Krieges Zweifel an der moralischen Unantastbarkeit der USA aufkeimten und daß eine Reform des Bildungssystems notwendig schien, wollte man in der Bundesrepublik keinen "Bildungsnotstand" haben. Diese und weitere Legitimationsdefizite kumulierten, als am 2. Juni 1967 beim Besuch des Schahs von Persien in Berlin der Student Benno Ohnesorg durch den Schuß eines Polizeibeamten getötet wurde. Der Vorgang und die anschließenden Versuche der Vertuschung durch den Senat von Berlin, einhergehend mit einer Verteufelungskampange "der Studenten", löste in Kreisen der akademischen Jugend eine Radikalisierungswelle aus. Die Differenzen mit dem SDS und den Botschaftern des Marxismus-Leninismus rückten in den Hintergrund: Auch liberale und konservative Angehörige der Universitäten beteiligten sich an Demonstrationen, Vollversammlungen oder "sit-ins". Berlin, die deutsche Spaltung und gar Brandenburg waren in dieser Zeit gar kein Thema. Der Konflikt zwischen "Establishment" und "Außerparlamentarischer Opposition" beherrschte die Szene, und man fühlte sich eins mit ähnlichen Bewegungen in Berkley/ USA oder in Paris. In jenen Jahren wurden die Weichen gestellt für sehr unterschiedliche politische Wege jener Aktivisten, die man im Nachhinein "die 68er" nennt. Während Rudi Dutschke , den viele den Kopf der Studentenbewegung nannten, die Parole vom "langen Marsch durch die Institutionen" ausgab, veröffentlichte die "Kommune I" am 24. Mai 1967 ein Flugblatt, das angeblich als Satire gemeint war, aber von vielen als Aufforderung zum Terror verstanden wurde: "Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Bisher krepierten die Amis in Vietnam für Berlin. Uns gefiel es nicht, daß diese armen Schweine ihr Cocacolablut im vietnamesichen Dschungel verspritzen mußten. Deshalb trottelten wir anfangs mit Schildern durch leere Straßen, warfen ab und zu Eier ans Amerikahaus und zuletzt hätten wir gern HHH in Pudding sterben sehen. Den Schah pissen wir vielleicht an, wenn wir das Hilton stürmen, erfährt er auch einmal wie wohltuend eine Kastration ist, falls überhaupt noch was dranhängt...es gibt böse Gerüchte. Ob leere Fassaden beworfen, Repräsentanten lächerlich gemacht wurden - die Bevölkerung konnte immer nur Stellung nehmen durch die spannenden Presseberichte. Unsere belgischen Freunde haben endlich den Dreh heraus, die Bevölkerung am lustigen Treiben in Vietnam wirklich zu beteiliogen: sie zünden ein Kaufhaus an, dreihundert saturierte Bürger beenden ihr aufregendes Leben und Brüssel wird Hanoi. Keiner von uns braucht 20 mehr Tränen über das arme vietnamesische Volk bei der Frühstückszeitung zu vergießen. Ab heute geht er in die Konfektionsabteilung von KaDeWe, Hertie, Woolworth, Bilka oder Neckermann und zündet sich diskret eine Zigarette in der Ankleidekabine an. Dabei ist nicht unbedingt erforderlich, daß das betreffende Kaufhaus eine Werbekampagne für amerikanische Produkte gestartet hat, denn wer glaubt noch an das "made in Germany"? Wenn es irgendwo brennt in der nächsten Zeit, wenn irgendwo eine Kaserne in die Luft geht, wenn irgendwo in einem Stadion die Tribüne einstürzt, seid bitte nicht überrascht. Genausowenig wie beim Überschreiten der Demarkationslinie durch die Amis, der Bombardierung des Stadtzentrums von Hanoi, dem Einmarsch der Marines nach China. Brüssel hat uns die einzige Antwort darauf gegeben: burn, ware-house, burn!" Als Mitglied der Universität konnte man den sich anbahnenden Terror erkennen, als im November 1968 ein dem SDS verbundener Kollege mittags im Restaurant verkündete: "Heute abend fliegen Steine!" Und am Abend kam es tatsächlich zu einer "Schlacht am Tegeler Weg".30 Zur gleichen Zeit tagte der Ortsverein Wedding der SPD. Den Vorsitz führte eine Abgeordnete, die Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin war. An Seminardiskussionen Gewöhnte waren überrascht von Form und Inhalt der Veranstaltung. Daß die Diskussion im urberliner Straßenjargon geführt wurde, irritierte etwas. Daß aber die zu geltende Meinung von der Vorsitzenden vorgegeben und zögerliche Abweichungen einzelner Diskutanten von der Mehrheit sofort rüde niedergeredet wurden, schreckte ab. Man fühlte sich an den Dortmunder Parteitag der SPD vom 1. bis 5. Juni 1966 erinnert. Im dortigen Arbeitsausschuß "Mitgliederpartei, Massenmedien und Verbände" kam es zu einer Kontroverse zwischen dem fränkischen Delegierten Bruno Friedrich, der mehr innerparteiliche Demokratie forderte, und Herbert Wehner. Mit an physische Gewaltanwendung grenzender lautstarker Demagogie fiel Wehner dabei über Friedrich her, so daß Beobachter an die ihm aus Filmen bekannten Brülltiraden von Naziführern erinnert wurde. Bei Diskussion über die Studentenbewegung im Berliner Abgeordnetenhaus dagegen, war es allein der Vertreter der FDP, Hermann Oxfort, der eine differenzierte Analyse vortrug, während von den anderen Rednern nur verurteilt wurde. Solche Beoachtungen führten manche Jungakademiker zur FDP. Die Parole "Mehr Demokratie wagen" entsprach genau dem politischen Empfinden der Beigetretenen. Ob Rudi Dutschke bei seinem Marsch durch die Institutionen an die FDP gedacht hatte, ist allerdings eher fraglich. Als Benno Ohnesorg am 2. Juni in der Krummen Straße von dem Polizeibeamten Kurras erschossen wurde, erreichte die Sudentenrevolte ihren emotionalen Höhepunkt. An jenem Tag hatten Berliner Studenten gegen den herzlichen Empfang eines Potentaten, des Schahs von Persien, durch den Berliner Senat demonstriert. Eine demokratisch orientierte Regierung sollte keinen Herrscher empfangen, der Geheimdienste unterhielt, politische Gen verfolgte, selbst in Deutschland “Prügelperser”einsetzte und im übrigen den Pomp stätbarocker Fürsten entfaltete. Daß der angeblich unpolitische Ohnesorg bei jener Demonstration sein junges Leben lassen mußte, weil das “Establishment” - heute würde man sagen: die “politische Elite” - vor allem von der Springer-Presse gegen die Studenten aufgehetzt war, erfüllte die Mehrheit der Studierenden mit tiefer Trauer und großer Wut. 30 Der 1993 verstorbene FU-Professor und Theologe, Helmut Gollwitzer, ein vehementer Unterstützer der Studentenbewegung, meldete nach der "Schlacht" mit der Polizei im Auditorium Maximum der FU bei einer Vollversammlung Widerspruch gegen die Gewaltanwendung, die Menschenleben gefährdet hätte, an. Er wurde dafür ausgebuht. 21 Nach Ohnesorgs Tod setzte sich ein Konvoi von Kleinwagen auf den Weg über die Transitautobahn nach Helmstedt. Die Autos waren mit Trauerfloren versehen und wurden von den “Grepos” - Grenzpolizisten - der DDR höflich behandelt, was ungewöhnlich war. Noch Wochen später sah man überall auf den Straßen WestBerlins “Enten” - “Deux Chevaux”, alte “VW-Käfer” - oder “R4s” - ” Renault 4" - mit schwarzen Bändern an den Rückspiegeln. Das war für damalige schon eine kleine poltische Bewegung. Doch von “68ern” sprach zu der Zeit noch niemand. Später wurde Rudi Dutschke, der Studentenführer, von einem verhetzten Jugendlichen auf dem Kurfürstendamm angeschossen. Dutschke war Moralist, Sozialist, Theoretiker und empfand sich als Revolutionär. Mit seiner rauhen Stimme entwickelte er auf Massenversammlungen jene Diktion und Rhetorik, durch die sich die Studenten angesprochen fühlten. Wegen seiner Popularität war er unter Insidern umstritten, von seinen Kommilitonen überwiegend geachtet, von der Springer-Presse als Chaot und Wüstling verteufelt. Die Nachricht von dem Anschlag verbreitete sich in der Stadt wie ein Lauffeuer. Spontane Versammlungen fanden statt, und immer wieder hieß es : “Springer hat mitgeschossen!” Die Aufgebrachten drängte es nach Aktionen. Diesmal wollten sie sich nicht mehr mit schwarzen Stoffbändern an den Autos begnügen. Die Diskussion über Gewaltanwendung - gegen Sachen, gegen Menschen? - kam auf. Ein große Menge traf sich vor dem Springerhaus in der Kochstraße. Es knisterte, die Stimmung war gespannt. Dann gingen plötzlich Autos aus dem Fuhrpark des Zeitungskonzerns in Flammen auf, und das Glasportal des Gebäudes zerbarst in tausend Stücke. Dieser Protest hatte für einige Drahtzieher - die es nun schon deutlich gab Konsequenzen. Einer von ihnen war der “APO-Anwalt” Horst Mahler. Er wanderte später ins Gefängnis und verlor seine Konzession. Später tummelte er sich in der rechtsradikalen Szene. Rudi Dutschke aber starb Jahre nach dem Attentat an dessen Folgen einen späten, frühen Tod. Er war der eigentliche 68er. Doch diesen Begriff gebrauchte niemand, weder beim Ohnesorg-Tod, noch beim Dutschke Attentat. Die Bewegung war dafür stets zu vielschichtig. Sie war entstanden aus der Empörung junger Menschen über den Widerspruch zwischen Moral und Realität des sich demokratisch gebärdenden deutschen Westens nach 1945. Angefangen hatte es 1961 mit der “Spiegel”-Affaire, als sich unter jungen Intellektuellen Empörung über die rechtswidrigen Eingriffe der Adenauer-Regierung gegen die Pressefreiheit breit machte. Der Held der Stunde war der Herausgeber des Nachrichtenmagazins, Rudolf Augstein - damals wie heute sicher kein “60er”. Nach der “Spiegel-Affaire” wuchs der Realitätsschock der Nachkriegsjugend, als offenbar wurde, daß das bis dahin heiß geliebte Vorbild der fünfziger Jahre, die USA, einen ungerechten Krieg gegen ein kleines Volk in Südostasien führte. Dann sahen die Studierenden, daß ihre so hochgestochen daherkommende Alma Mater ziemlich patriarchalische Strukturen hatte und fragwürdige Inhalte vermittelte. Diese und weitere Enttäuschungen empfanden Studierende als Ausdruck der die herrschenden Klassen stützende politische Struktur. Viele, jedoch längst nicht alle von ihnen gaben ihren Empfindungen Ausdruck, zuerst verbal - dann bis hin zum Terror aktiv. Die permanenten oder gelegentlichen Aktivisten wurden getragen und auf den Weg gesetzt von einer Infrastruktur des Protestes. Hier waren die eigentlichen Drahtzieher und ihre Helfer versammelt. Häufig wird der “SDS”, in dem auch Dutschke aktiv war, als Kern der Studentenbewegung angesehen. Der “Sozialistische Deutsche Studentenbund” war eine einstige Jugendorganisation der SPD. Der Verband mochte nicht vom Studium marxistischer Texte lassen, als die SPD mit ihrem Godesberger Programm auf Reformkurs ging. Der SDS wurde daher von der Mutterpartei verstoßen. Auch der als Ersatz gegründete 22 “Sozialdemokratische Hochschulbund” (“SHB”) verhielt sich nicht linientreu. Er betrieb Marxstudien und veranstaltete Aktionen an der Universität in etwas weniger radikaler Weise als der SDS. Einer ihrer Wortführer war Knut Nevermann, Sohn des Hamburgischen Bürgermeisters und heute oberster Beamter Gerhard Schröders “Staatsministers für Kultur”. Ein 68er? In einer großbürgerlichen Wohnung in der Charlottenburger Wielandstraße hatte sich zudem der “Republikanische Club” gegründet, in dem sich aufsässig Fühlende verschiedener Richtungen versammelten das war der Kabarettist Wolfgang Neuss ebenso anzutreffen wie der fast überall unvermeidliche Horst Mahler, aber auch “liberale Scheißer” - wie der Slogan hieß - waren geduldet. Schließlich gab es Wohngemeinschaften - “Kommunen”. “Kommune 1" und “Kommune 2" würzten die Bewegung mit kulturrevolutionären Aktionen wie kollektiven Nacktphotos, aber auch schon mit zweideutigen Flugblättern wie “Burn, warehouse, burn”. Fritz Teufel und Rainer Langhans gaben die Clowns der Bewegung. Die Parole “Teufel ins Rathaus” hatte ebenso Witz wie die Entgegnung des vor dem Richtertisch Gelandeten nach der Aufforderung zum Erheben: “Wenn`s der Wahrheitsfindung dient...” Immer wieder fanden an den Universitäten Vollversammlungen statt, immer wieder “ist ins”, später “go ins”. Es wurde diskutiert, geredet, theoretisiert, gespottet und verhöhnt. Als Klaus Schütz, der Regierende Bürgermeister von Berlin, das Audi Max der Freien Universität bei einer Vollversammlung besuchte, wurde zum Vergnügen der Versammelten hinter dem Rücken des Bürgermeisters ein Schild hochgehalten: “Und solche Idioten regieren uns.” Die Stimmung wurde verbissener: Schütz polemisierte nach seinem Besuch an der FU, man müsse den “Typen nur ins Gesicht schauen”. In der Springerpresse wurden “die Studenten” weiterhin als langhaarige Zottelfiguren diffamiert. Berliner Werktätige verspürten schon `mal Lust, den “Chaoten” eins zu verpassen. Doch von “68ern” war immer noch nicht die Rede. Es gab auch genügend viele Studenten, die stolz betonten, mit den “Chaoten” nichts zu tun zu haben. Sie wollten, sagten sie, an der Uni lernen und dann Karriere machen. Diese “68er” wurden damals gerne in erschreckten bürgerlichen Kreisen als die “wahren Studenten” präsentiert. Es waren häufig dieselben Menschen, von denen viele sich heute - arriviert - gerne als aufsässige 60er bezeichnen. In der Auto-Rezeption waren damals viel mehr Menschen durch die Straßen gezogen mit Bildern von Che Guevara und einem “Ho, Ho, Ho Chi Min” auf den Lippen, als es jemals in der Wirklichkeit gewesen sind. Die “68er” sind ein Mythos. Die Studentenproteste haben eine Universitäts- und Bildungsreform ausgelöst, deren egalisierende Auswirkungen heute beklagt werden. Sie waren das Hauptmedium der politischen Sozialisation einer Generation, deren Erfolgreiche sich heute gerne “politische Elite” nennen. Sie haben Nachahmer in den zahllosen Bürgerinitiativen gefunden. Die Studentenproteste haben der in den fünfziger Jahren formalen Demokratie Inhalte geben. Das “Mehr Demokratie wagen” Willy Brandts wäre ohne die Proteste undenkbar gewesen. Die politischen Parteien erhielten infolge der so unrevolutionären Parole Rudi Dutschkes vom “Marsch durch die Institutionen” Blutauffrischung. Und die “Grünen” können in den 60er Vorgängen eine ihrer Quellen sehen. Heute wollen viele dabei gewesen sein. Was gestern angefeindet und verpönt war, gilt - da es vorbei ist - im Nachhinein als chic. Sich als 68er zu präsentieren, ist für viele heute eine Attitüde, sich interessant zu machen. Rudi Dutschke war der 68er. Auch die Nevermänner können mit Recht behaupten, sie seien welche gewesen. Horst Mahler aber auch. Die Studiendirektoren oder Bankvorstände Nils oder Peter Krause oder Meyer aber flunkern meist, wenn sie sich als “68er” bezeichnen. 23 Und andere drehen die Wahrheit um. Die innovatorische Wirkung der Bewegung war an der Gewaltfrage gestoppt. Schon die Diskussion, ob Gewalt gegen Menschen erlaubt sei oder “nur” Gewalt gegen Sachen, hat eine repressive Wirkung gehabt, denn sie fiel hinter den bis dahin ausgemachten Grundsatz des Gewaltmonopols des Staates zurück. “Häuserkämpfer” und “Pflastersteinrebellen” waren so gesehen schon keine 60er mehr, noch viel weniger die Leute von der “RAF” oder andere Terroristen. Die Gewaltbereiten haben die Studentenbewegung zerstört, ihr die inhaltliche und personelle Basis genommen. Aus der Bewegung wurden Sektierergruppen mit zunehmendem Realitätsverlust. Josef Fischer ist sicher keiner, der es nötig hätte, mit einer gar nicht vorhandenen 68er Vergangenheit zu renommieren. Daß er sich dennoch auf den Mythos 68 berief, kann eigentlich nur Verdrängung sein. Fischer verdrängte, daß schlimme Prügelszenen und weiteres auch in den Siebzigern nicht die Deckung irgendeiner demokratischen Bewegung gefunden haben. Die Fronten waren seinerzeit ebenso klar wie heute. Die Frankfurter Szene war außerhalb des demokratischen Spektrums, und das einzugestehen, ist offensichtlich schwierig für jemanden, der Demokratie und Menschenwürde für die Maßstäbe seines politischen Handeln über alle persönlichen Brüche hinweg bezeichnet. Auch Fischer war kein 68er. Er stand offensichtlich wie andere auch eine Zeitlang außerhalb des vom Grundgesetz gezogenen Rahmen. Diesen Rahmen hat er später gefunden und wurde einer der höchsten Repräsentanten des darauf ruhenden politischen Systems. Als solcher durchlebte er Höhen und Tiefen eines deutschen Spitzenpolitikers. Den Mythos „68“ allerdings konnte Fischer zu keiner Zeit zu recht in Anspruch nehmen. 4. Sozial-liberale Hoffnungen: Mehr Demokratie wagen und Entspannung Ein Jahr nach der Regierungsbildung 1961 offenbarte die „Spiegel“-Affäre, wie sehr die Union unter dem Ausklingen der Ära Adenauer in eine Krise geraten war. Auf Weisung der Bundesanwaltschaft wurden in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ durchsucht. Anlass war eine angeblich die Sicherheit der Bundesrepublik gefährdende Veröffentlichung über das NATOManöver „Fallex 62“. Die Durchsuchung, die Festnahme von Journalisten und die harte Haltung Adenauers („Ein Abgrund von Landesverrat“) sowie des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß brachte eine intellektuelle und linksbürgerliche Öffentlichkeit gegen die Bundesregierung und die reaktionär erscheinende Union auf. Der Verteidigungsminister mußte demissionieren, und am 19. November 1962 zog die FDP ihre Bundesminister aus dem Kabinett zurück. Wie es Adenauer schon 1961 getan hatte, so sondierten auch diesmal Unionspolitiker Paul Lücke und Freiherr von und zu Guttenberg mit der SPD - repräsentiert durch Herbert Wehner - die Möglichkeiten eines Zusammengehens. Die SPD, vor deren möglicher Regierung Adenauer einst mit dem Seufzer „armes Deutschland” gewarnt hatte, kam infolge der Krise der Union nach ihrer Bad Godesberger Reform ins Spiel. Diesmal machten diese Gespräche die FDP wieder gefügig, und es wurde eine Kabinettsumbildung vereinbart, bei der die FDP erreichen konnte, daß Adenauer sich festlegte, nach den Parlamentsferien im Herbst 1963 zurückzutreten. Im Jahre 1963 erfolgte dann nicht nur bei der CDU der Wechsel von Adenauer zu Erhard mit Erich Mende als Vizekanzler und Minister für gesamtdeutsche Fragen. Auch bei der SPD gab es nach dem Tod Erich Ollenhauers im Dezember einen Wechsel. Willy Brandt wurde SPD-Vorsitzender und gleichzeitig erneut Kanzlerkandidat. Die Kanzlerschaft des populären Ludwig Erhard litt von Anfang an unter internen Querelen der Union. Da gab es den außenpolitischen Streit zwischen den USA-orientierten „Atlantikern“, zu denen der von Erhard gestützte 24 Außenminister Gerhard Schröder gehörte, und den frankophilen „Gaullisten“. Hinter allen Sachstreits standen stets Machtfragen. Insbesondere die CSU testete nach dem Abgang des „Alten“ aus, ob und wie sie ihre Stellung unter dem „Dicken“ ausbauen konnte. Bei der Bundestagswahl 1965 wirkten sich zaghafte Gewichtsverlagerungen im Verhältnis der parteipolitischen Lager aus. Die CDU verfehlte knapp die absolute Mehrheit, die FDP verlor erheblich, und die SPD galt als der Gewinner, der sich endgültig aus dem „30-%-Turm“ der fünfziger Jahre befreit hatte. Die 2. Regierung Erhard hatte vor allem eine Wirtschafts- und Finanzkrise zu bewältigen, die sich 1966 und 1967 in einer allgemeinen Rezession, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem Defizit des Staatshaushaltes - im Wesentlichen als Folge von Wahlversprechen - gezeigt hatte. Beachtenswert ist, daß damals eine Arbeitslosenzahl von 673 000 Menschen (Februar 1967) als bedrohlich und eine Ursache für das Erstarken der rechtsradikalen NPD gesehen wurde. Im Bundeshaushalt 1967 (74 Mrd. DM) gab es eine Deckungslücke von über 4 Mrd. DM. Die FDP lehnte die von der Union vorgesehenen Steuererhöhungen ab und machte das Ganze zur Koalitionsfrage. Ein Kompromiß, dem die FDP-Minister zustimmten, wurde von der FDPBundestagsfraktion zu Fall gebracht, weil man in der Presse erneut als „Umfallerpartei“ bezeichnet worden war. Wieder einmal zogen die Liberalen ihre Minister zurück, und nach dem 27. Oktober 1966 stand Ludwig Erhard als Kanzler eines Minderheitenkabinetts da. Zuvor, im Juli, hatte es infolge von Landtagswahlen in NordrheinWestfalen einen Machtwechsel gegeben. Die SPD löste die CDU als stärkste Partei in Düsseldorf ab und regierte fortan mit der FDP zusammen. In Bonn wurde das Zustandekommen der sozial-liberalen Koalition im größten Bundesland als Schlappe des Kanzlers gewertet. Zugleich verzeichnete die NPD bei Landtagswahlen Siege, die zu Lasten der CDU gingen und Zweifel an deren Integrationskraft aufkommen ließen. In Hessen beispielsweise wählten am 6. November 1966 7,9% der Wähler die rechtsradikale Partei. Die Zeichen standen auf Sturm. Unter CDU-Politikern breitete sich im Sommer 1966 der Wille aus, Erhard zu stürzen, um die Macht im Bund nicht zu verlieren. Aber bei einer Bundestags-debatte am 4. Oktober 1966 sprach der Unions-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel die mittlerweile legendären Worte „Erhard ist und bleibt Bundeskanzler. Wir wünschen die öffentliche Debatte darüber zu beenden.” Nach für die CDU schlechten Wahlergebnissen in Hessen gab Erhard dem Drängen insbesondere der CSU unter Führung von Franz Josef Strauß nach. Die CDU/CSU-Fraktion nominierte den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kurt Georg Kiesinger als Kandidaten für die Leitung einer Großen Koalition, die nun ausgehandelt wurde. Am 1. Dezember 1966 wurde Kiesinger 3. Kanzler der Bundesrepublik, und die SPD zog unter Vizekanzler und Außenminister Willy Brandt zum ersten Mal in ein Bundeskabinett ein. Obwohl durch sie die SPD ins Spiel gebracht wurde, gab es gerade bei den Sozialdemokraten, ihren Anhängern und darüber hinaus in der linken und liberalen Öffentlichkeit viele Bedenken gegen die Große Koalition. Befürchtet wurden eine unkontrollierbare Machtakkumulation, eine Verfestigung der Herrschaftsverhältnisse und eine die Rechte der Bürger einschränkende Politik. Die von der Koalition behauptete innere Versöhnung der ehemaligen Mitläufer und Gegner der Nationalsozialisten, symbolisiert durch die Zusammenarbeit des früheren NSDAP-Mitglieds Kiesinger mit dem einstigen Emigranten Brandt, galt vielen als anstößig und unglaubwürdig. Unvergessen waren die auch aus CDU-Kreisen geschürten Schlammschlachten gegen Brandt, den Emigranten. Erster Ausdruck dieses Unbehagens war, daß bei der Wahl des Kanzlers mindestens 89 Koalitionsabgeordnete, die meisten gewißlich SPD-Mitglieder, Kiesinger ihre Stimme verweigerten. 25 Mit ihrer verfassungsändernden Mehrheit setzte die Große Koalition das „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft” - kurz: „Stabilitätsgesetz” - und die Notstandsgesetze durch. Das Stabilitätsgesetz gab der Regierung haushalts- und wirtschaftspolitische Instrumente an die Hand, die bis dahin beim Bundestag oder bei den Ländern gelegen hatten. So kann die Regierung bei einer Gefährdung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes die Kreditaufnahme der Länder und Gemeinden begrenzen oder Steuersätze bis zu 10% nach oben oder unten verändern. Die Notstandsgesetze sehen für den Fall eines inneren oder äußeren Notstands vor, daß Grundrechte und Rechte des Parlamentes eingeschränkt werden dürfen: Im Notstandsfall soll ein kleiner Ausschuß als Notparlament tätig werden. Es können Beschlagnahmungen erfolgen und die Versammlungsfreiheit aufgehoben werden. Der Einsatz der Bundeswehr bei einem „inneren Notstand“ ist möglich. Nicht realisieren konnte die Große Koalition ihr drittes Vorhaben der Wahlrechtsreform, das auf die Etablierung eines Zweiparteiensystem mit Hilfe des Mehrheitswahlrechtes hinauslief. Gegen diese Wahlrechtspläne gab es Widerstand vom linken Flügel der SPD, der eine innerparteiliche Schwächung befürchtete. Als dann durch Gutachten und Analysen der Mehrheit der SPD-Funktionäre klar wurde, daß alle vom CDU-Innenminister Paul Lücke vorgelegten Modelle der SPD und CDU/CSU zwar die alleinige Repräsentanz im Parlament sicherte, die SPD aber zur ewigen Nr. 2 machen würde, ließ die SPD das Projekt fallen. Mit ihrem sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Karl Schiller betrieb die Große Koalition eine streng keynesianische Wirtschaftspolitik31. Der Hamburger Wirtschaftsprofessor verstand es nicht nur, mit neuen Institutionen und Begriffen wie „Konzertierte Aktion“ (regelmäßige Zusammenkunft von Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, Regierung und anderer Wirtschaftsbeteiligten) oder „Mifrifi“ („Mittelfristige Finanzplanung“) das Publikum zu unterhalten, sondern auch, die wirtschaftliche Lage tatsächlich zu verbessern. Doch in der Öffentlichkeit gab es ein breites Unbehagen gegen die Große Koalition. Sie war nicht Ursache, aber gewiß ein Auslöser für die „Außerparlamentarische Opposition” (APO) der studentischen Jugend. Die Notstandgesetzgebung wurde als Bestätigung der Furcht vor einem autoritären Staat gesehen. Nicht nur die Gewerkschaften, auch die Mini-Opposition der Liberalen kämpften dagegen an. Die unversehens aus der Regierung gedrängte FDP bekam einiges vom Zeitgeist zu spüren. Politiker wie Karl-Hermann Flach, Werner Maihofer oder Walter Scheel setzten in der Partei einen sozial-liberalen Kurs durch. Um den Preis der Existenzgefährdung wurde die Mitglieder- und Wählerschaft weitgehend ausgetauscht. Doch trotz gelegentlicher Berührungen blieb die FDP der APO fremd. Parteipolitisch ging die Hauptzielrichtung hier gegen die SPD, denn der aus der SPD eliminierte Studentenverband SDS („Sozialistischer Deutscher Studentenbund“) und auch sein parteioffizieller Nachfolger SHB („Sozialdemokratischer Hochschulbund“) waren Hauptträger der APO und bedienten sich im Widerstand zur reformierten Mutterpartei marxistischer Gesellschaftsanalysen zur Begründung ihrer Politik. Angekündigt durch die „Spiegel“-Affäre, beschleunigt durch die Bildung der Großen Koalition, entzündete sich die APO zunächst an zwei Themen: dem Krieg der Amerikaner in Vietnam und den Mängeln des Bildungswesens in Deutschland. Die USA – „Amerika“! - hatten in den fünfziger Jahren in allem als demokratisch, gerecht, human und einfach vorbildhaft gegolten. Nun hatte der Protest gegen den schmutzigen Krieg dieser Weltmacht gegen ein kleines Volk in der deutschen Gesellschaft die Wirkung eines Tabubruchs. Entsprechend wütend waren die Reaktionen der Mehrheit der Bevölkerung und des Staates darauf. Gerade die nun einsetzenden staatlichen Repressionen jedoch heizten die APO-Bewegung weiter an. 26 Der „Imperialismus“ insgesamt war jetzt im Visier. So kam es zu studentischen Protesten, als der Schah von Persien im Juni 1967 Berlin besuchte und der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen worden. Die darauf folgende Protestwelle änderte einiges in der Bundesrepublik. Folgen der Studentenbewegung waren eine umfassende Bildungsreform mit einer Ausweitung und Demokratisierung der Bildungsangebote von der Schule bis zur Universität, das Aufkommen von parteiunabhängigen Bürgerinitiativen in vielen Bereichen des Lebens und die demokratische Öffnung mancher Institutionen des Staates von den Leistungsverwaltungen („gläsernes Rathaus“) bis hin zu den Parlamenten, die nun ihre Sitzungen häufiger öffentlich abhielten und Anhörungen – „Hearings“ genannt - veranstalteten. Auf der anderen Seite keimte in der Studentenbewegung auch der Terrorismus, der mit den Mordaktionen der „Rote Armee Fraktion” (RAF) die dunkelsten Tage der Bundesrepublik brachte. Der Aufruf von Rudi Dutschke zum „langen Marsch durch die Institutionen“ führte zwar der SPD und in geringem Maße auch der FDP studentenbewegte Mitglieder zu - die dort später manchmal als „APO-Opas“ verspottet wurden -, doch keine der etablierten Parteien vermochte die durch die APO und ihre Folgen geprägte Generation wirklich an sich zu binden. Themen wie der Umwelt- oder Datenschutz wurden einer neuen Generation Kristallisationsmasse für die Gründung einer eigenen und erfolgreichen Partei, die der „Grünen“. Im übrigen ist es falsch, wenn behauptet wird, ein zentrales Thema der APO sei die erstmalige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gewesen oder der Aufstand der Kinder gegen ihre Vätergeneration. Das hatte bei der Bewegung keine zentrale Rolle gespielt. Im Sinne einer politisch korrekten Aufarbeitung des Nationalsozialismus hatte es sogar Schieflagen gegeben, beispielsweise bei den engen Kooperationen radikaler Teile der APO mit der gegen Israel kämpfenden palästinensischen PLO. Entgegen ursprünglicher Befürchtungen und wohl auch gefördert durch die Protestbewegung hatten sich die Gemeinsamkeiten der Großen Koalition bald erschöpft. Es war nicht nur die Wahlrechtsreform, die nicht zustande kam. Auch in gesellschaftspolitischen Fragen kamen die Partner nicht zusammen. Vor allem fand der Außenminister Willy Brandt keine ausreichende Unterstützung bei der Union für seine Politik, die Machtverhältnisse im Osten als Folge des 2. Weltkrieges anzuerkennen und dorthin Kontakte aufzunehmen. Durch den Wandel der FDP zum Sozial-Liberalismus schien sich der SPD eine Perspektive jenseits der Union zu eröffnen, falls die Wahlergebnisse von 1969 das erlauben würden. Die sozial-liberale Phase hatte ein Vorspiel, eine richtige Ouvertüre: Im März 1969 fand in Berlin die Wahl des Bundespräsidenten statt. Für die CDU/CSU kandidierte Gerhard Schröder, der vormalige Außenminister. SPDKandidat war Gustav Heinemann, einst Mitbegründer der CDU und erster Bundesinnenminister unter Konrad Adenauer. Heinemann war Vorstands-mitglied der Rheinischen Stahlwerke in Essen und zugleich Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Unter den Nazis war er in der Bekennenden Kirche aktiv gewesen. Heinemann hatte 1950 sein Ministeramt niedergelegt als Protest gegen die Absicht des Kanzlers, deutsche Truppen aufzustellen. Er gründete 1952 eine „Gesamtdeutsche Volkspartei“ (GVP), die zu den vielen erfolglosen Parteien nach 1945 gehörte. Für die SPD zog er 1957 in den Bundestag ein und hielt dort im Januar 1958 eine bittere Rede der Abrechnung mit Konrad Adenauer und seiner „verfehlten Deutschlandpolitik”. Diese Rede war so scharf, kühl und pointiert, daß die Unionsabgeordneten „wie vom Blitz getroffen“32 waren. Das Tischtuch zur Union war zerschnitten. 31 32 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London 1961 Arnulf Baring, Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel, Stuttgart 1982, S. 58 27 Dieser Heinemann war als möglicher Bundespräsident eine Provokation für die CDU/CSU. Der Vorsitzende der FDP, Walter Scheel, wollte die Wahl des Sozialdemokraten zum Nachweis der Koalitionsfähigkeit der FDP mit der SPD machen und bereitete die Partei mit großem Einsatz auf die Wahl Heinemanns vor. In der Fraktion der Bundesversammlung gab es drei Probeabstim-mungen, bis die FDP die zur Mehrheit notwendigen Stimmen der SPD präsentieren konnte. Das war schwierig genug, denn die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung waren knapp, und die Union hatte deutlich gemacht, daß Schröder die Wahl auch annehmen werde, wenn die Stimmen der NPD für ihn den Ausschlag geben würden. Doch bei der Versammlung erreichten weder Heinemann noch Schröder im 1. und 2. Wahlgang die notwendige Mehrheit. Mit 512:506 Stimmen wurde Heinemann im dritten Wahlgang gewählt. Einsam verließ der geschlagene Schröder die Ostpreußenhalle. Die SPD lud am Abend die FDP zu einer Siegesfeier in den „Philips-Pavillon” am Funkturm ein. Hier herrschte Sektlaune, und die Verdächtigungen gegen die unsicheren Liberalen vom Nachmittag waren vergessen. Zwei Tage später polarisierte Heinnemann wieder, indem er verkündete, es habe ein „Stück Machtwechsel” stattgefunden.33 Nach der Bundestagswahl im September 1969 vollzog sich der tatsächliche Machtwechsel, weil mit der SPD/FDP in Bonn die Vorherrschaft der Union gebrochen wurde. Obwohl die Union stärkste Fraktion geblieben war, obwohl die FDP nur knapp über der 5%-Sperrgrenze lag und der neue Kurs dort weiter umstritten blieb, gingen Willy Brandt und Walter Scheel das Bündnis ein. Am 21. Oktober 1969 wählte der Bundestag mit 251 gegen 235 Stimmen Willy Brandt zum ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler. Die Union sprach von einer Verfälschung des „Wählerwillens“ und strebte eine kurzfristige Rückkehr zur Macht an: Es stellte sich eine Polarisierung des Parteiensystems ein. Der neue Bundeskanzler kündigte in seiner Regierungserklärung unter dem Schlagwort „Mehr Demokratie wagen“ das umfangreichste Reformprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik an. Das Hauptprogramm der Koalition war die Ostpolitik mit der Anerkennung der DDR und der gesamten politischen Situation in Osteuropa. Die sozial-liberale Koalition empfand sich als politischer Ausdruck des „neuen Mittelstandes“, der aus einer zunehmenden Zahl von hochqualifizierten, materiell abgesicherten Menschen bestehen würde. Dieser neue Mittelstand brauche für seine Entwicklung Demokratie als durchgängiges Regulationsprinzip überall in der Gesellschaft sowie Ausgleich und Versöhnung mit den Nachbarn Deutschlands auch im Osten. Tatsächlich traten damals viele akademisch gebildete und sozial-liberal orientierte neue Mitglieder in die SPD und auch in die FDP ein. Das aktuelle Problem war nur, daß mindestens bei der FDP der „alte Mittelstand“ - also Selbständige, kleine und mittlere Unternehmer - noch immer stark verankert war und innerparteilich gegen die neue Linie der FDP arbeitete, zumal der Verlust von 3,7% bei der Bundestagswahl die Parteiführung nicht gerade gestärkt hatte. In Nordrhein-Westfalen organisierten sich die Gegner des Kurses der Parteiführung in einer „National-Liberalen Aktion“ (NLA). Im Bundestag selber war der Bestand der Koalition gefährdet, was der Öffentlichkeit deutlich wurde, als die liberalen Abgeordneten Erich Mende, Heinz Starke und Siegfried Zoglmann im Oktober 1991 zur CDU/CSU übertraten. Das grundsätzliche Problem der Koalition war, daß sie mit der Theorie vom neuen Mittelstand einem kurzlebigen und wenig verifizierten Konstrukt der Sozialwissenschaft aufgesessen war, denn gegen Ende der sozial-liberalen Ära, bekamen die hochqualifizierten Abhängigen Angst vor zu vielen Reformen vor allem der Wirtschaft und suchten flugs ihr Heil bei den neokonservativen Versprechen Helmut Kohls. 33 a.a.O., S. 120ff 28 So kam es, daß die Regierung Brandt/Scheel im Innern Reformen voran trieb - beispielsweise für die Hochschulen, vor allem Grundlagenverträge der neuen Ostpolitik vorbereitete, die Vier-Mächte-Verhandlungen über West-Berlin initiierte - es aber im Bundestag mit Verweigerern, Abweichlern und Überwechslern zu tun hatte. Die Basis für das gesamte Projekt schien dahinzuschmelzen. Eigentlich war die Regierung Brandt/Scheel ein „Bündnis für die Neue Ostpolitik“,34 wie Arnulf Baring formuliert. Mit großem Einsatz und unter hohem Druck hat die Regierung die Kontakte nach Osteuropa geknüpft, Gesten der Versöhnung wie den Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer Ghettos gezeigt, Verträge verhandelt, die Abstimmung mit dem Westen nicht vergessen und alles in aufgeheizter innenpolitischer Stimmung in einem labilen Parlament vertreten. Dabei ereignete sich bis dahin Undenkbares: Am 19. März trafen sich Bundeskanzler Willy Brandt und der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Willy Stoph. Die Menge rief „Willy, Willy!“, und es war klar, daß Stoph nicht gemeint war. Ebenso bewegend war es, als im Dezember des gleichen Jahres Brandt und der polnische Ministerpräsident Cyrankiewicz in der polnischen Hauptstadt die Warschauer Verträge unterzeichneten. Während die nun in der Opposition befindliche CDU/CSU die neue Ostpolitik einerseits heftig bekämpfte, den durch sie geschaffenen Tatsachen aber andererseits hinterher hechelte wie einst die SPD der Westpolitik Adenauers, fand der Kanzler hohe internationale Achtung und Anerkennung. 1971 wurde Willy Brandt der Friedensnobelpreis zugesprochen. Aber das immunisierte ihn nicht gegen die Feindschaft im Innern. Alles schien vergebens, als ein weiterer Bundestagsabgeordneter der FDP das Regierungslager am 23. April 1971 verließ und die Koalition damit ihre Mehrheit im Parlament verlor. Die Union hoffte nun auf den schnellen Weg zurück an die Macht und brachte zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein konstruktives Misstrauensvotum ein. Willy Brandt sollte als Kanzler gegen Rainer Barzel ausgewechselt werden. Doch überraschenderweise scheiterte der Antrag, und als Informierte schon vor der offiziellen Verkündung den Namen „Willy Brandt“ ins Plenum riefen, brach ein Jubel der Begeisterung bei der Koalition aus, während die Opposition in lähmendem Entsetzen verharrte. Bei den Übertritten und auch bei der Abstimmung selber hatten wohl nicht alle Abgeordneten nur nach ihrem Gewissen entschieden. Offensichtlich ist von beiden Seiten „geschmiert” worden. Noch in den neunziger Jahren hatte ein Gericht versucht, Aufklärung zu schaffen, als es um die Rolle des seinerzeitigen Fraktionsgeschäftsführers der SPD, Karl Wienand, bei der Abstimmung gegen Brandt ging. Es wurde vermutet, das Scheitern des konstruktiven Mißtrauensvotums beruhe darauf, daß an Unionsabgeordnete über Wienand „Stasi-Gelder“ geflossen seien. Willy Brandt blieb nach dem Überraschungsergebnis zwar im Amt, und der Bundestag ratifizierte, bei Enthaltung der Union, die Ostverträge am 17. Mai 1972. Doch kurz zuvor war der Haushalt des Bundeskanzlers nicht durch das Parlament gegangen, und sehr bald lief alles auf vorzeitige Neuwahlen hinaus. Diese fanden nach einer gescheiterten Vertrauensfrage Brandts am 19. November 1972 statt. Die Bundestagswahl hatte der Koalition eine glänzende Bestätigung gebracht. Zum ersten Mal wurde die SPD stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag und konnte mit Annemarie Renger, der früheren Weggefährtin Kurt Schumachers, das Amt des Parlamentspräsidenten besetzen. Doch im Triumph lag der Keim zur Krise. In der SPD kamen Stimmen auf, die das durch die Ostpolitik gute Wahlergebnis fälschlicherweise mit „linken“ gesellschaftspolitischen Vorstellungen aus der SPD erklärten und hofften, die FDP abschütteln zu können. Der Kanzler schlaffte nach der Phase der Anstrengungen ab, verfiel in Krankheit und Depressionen. Die FDP fühlte sich nach innerer Konsolidierung gestärkt und betonte gegen die SPD liberale und marktwirtschaftliche Akzente 29 in der Innen-, Wirtschafts- und in der Gesellschaftspolitik. Die Liberalen fühlten sich hierzu veranlaßt durch die CDU, bei der sich in einem innerparteilichen Machtkampf der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, gegen Rainer Barzel durchgesetzt hatte („Keiner wählt Rainer“). Die Union lockte einerseits die Liberalen, andererseits diffamierte sie die FDP als „Blockpartei“, als Anhängsel der SPD. Die ostpolitische Euphorie verflog, Widersprüche taten sich auf. Die Terrorwelle der sich „Rote Armee Fraktion“ („RAF“) nennenden Baader-Meinhof-Gruppe erforderte in den Augen vieler Koalitionäre nicht mehr Demokratie, sondern mehr Repression. Walter Scheel setzte sich aus der Regierung ab, indem er als Nachfolger Gustav Heinemanns das Amt des Bundespräsidenten anstrebte. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herbert Wehner, war mit dem labilen Zustand und präsidentialen Führungsstil des Kanzlers unzufrieden und trug zu seinem Autoritätsverlust bei: „Der Kanzler badet gerne lau!“, wurde er zitiert. Als schließlich Anfang 1974 der persönliche Referent Willy Brandts, Günter Guillaume, als Spion für die DDR enttarnt wurde - worüber der Innenminister Hans-Dietrich Genscher bereits ein Jahr zuvor vom Verfassungsschutz informiert worden war -, erklärte Willy Brandt am 6. Mai seinen Rücktritt. Der Bundestag wählte Helmut Schmidt zu seinem Nachfolger, und als Walter Scheel im Juli 1974 tatsächlich sein neues Amt antreten konnte, war die reformerische Regierung Brandt/Scheel durch die konsolidierende Schmidt/Genscher abgelöst worden. Mit der Verabschiedung der Ostverträge war die wichtigste Bindung zwischen den Koalitionspartnern dahin. Statt weiter zu reformieren hatte die Regierung Schmidt/Genscher nun die Aufgabe, eine sich verschärfende Wirtschaftskrise zu meistern und den Terrorismus zu bekämpfen. Außenpolitisch sollte eine Kurskorrektur vorgenommen werden, weil der Westen im Falle des Scheiterns von Abrüstungsverhandlungen mit dem Osten im Wettrüsten die Schraube anziehen und mit vor allem auf deutschem Boden stationierten Mittelstreckenraketen „nachrüsten“ wollte. Diesen „Doppelbeschluß“ sollten die Parteien absegnen. Hierbei wie in der Wirtschaftspolitik wurde deutlich, daß der Kanzler Schmidt nicht die Mehrheit seiner Partei hinter sich hatte, daß zwischen ihm und der Mehrheit der Sozialdemokraten ein Riß klaffte. Die Wahlen zum 8. Deutschen Bundestag brachten der Koalition Verluste ein. Die Union war wieder stärkste politische Kraft. Das Wahlergebnis, bei dem die FDP sich verbessert, die SPD aber stagniert hatte, wird vielfach als Auslöser für den folgenden Verfall der sozial-liberalen Koalition gesehen. Die Koalitionsverhandlungen wurden in gereizter Atmosphäre geführt. Es ging um den Versuch, den Staatshaushalt zu konsolidieren. Die Freien Demokraten drängten auf Einsparungen auch zu Lasten der Sozialpolitik, was bei der SPD auf Widerstand stieß. Zunehmend war die Rede davon, daß das Reservoir an Gemeinsamkeiten erschöpft sei. Das Wort von der „Endzeitstimmung“ kam auf. In Umfragen sank die Popularität der SPD weiter ab. Die FDP fürchtete, mit in deren Sog zu geraten und unterzugehen. Dennoch entwickelte sich die Legislaturperiode bis 1980 relativ stabil. Als Politmanager und Wirtschaftsfachmann, später auch Staatsmann, genoß Helmut Schmidt hohes Ansehen in der Bevölkerung, von dem die FDP profitierte. Der innere Konsolidierungsprozeß der Union war noch nicht abgeschlossen, so daß diese als Alternative nicht infrage kam. Kohl mußte zur Bundestagswahl 1980 Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidaten vorlassen, bevor er selber nach der Macht greifen konnte. Der FDP kam die Kandidatur von Strauß sehr recht, konnte sie sich doch ihm gegenüber als vernünftige Alternative darstellen. Genscher bezeichnete in internen Parteikreisen Strauß immer wieder als „unseren besten Wahlhelfer“. Der damalige Generalsekretär der FDP, Günter Verheugen, bezeichnete 34 Arnulf Baring, a.a.O., S. 195 ff 30 das im Nachhinein - nach seinem Wechsel zur SPD - als „reine Überlebensstrategie“.35 Die Wahlparole der FDP war: „Für eine Regierung Schmidt/Genscher - Gegen Alleinherrschaft einer Partei - Gegen Strauß - Diesmal geht`s ums Ganze. Diesmal FDP”. Über diese Verwendung seines Namens war der Bundeskanzler nicht angetan, wie überhaupt das innere Klima nach der Wahl 1980 nicht mehr gut war. In der größer gewordenen FDP-Bundestagsfraktion saßen nun zahlreiche rechtsliberale Gegner des sozialliberalen Kurses. Sie waren auf ursprünglich als aussichtslos eingeschätzten Listenplätzen ins Parlament gekommen und trafen sich im „Wurbs-Kreis”, so genannt nach dem der FDP angehörenden Vizepräsidenten des Bundestages, Richard Wurbs. Dieser Kreis soll mehr als die Hälfte der Mitglieder der Fraktion mobilisiert haben. Auch die „Linken“ trafen sich regelmäßig. Es soll sogar eine Gruppe der gruppenlosen Abgeordneten gegeben haben.36 Diese Fraktionierung der FDP-Fraktion war Ausdruck einer Unsicherheit der Partei, die in allen Gliederungen bestand. Das kam auch im Verhalten des Parteivorsitzenden und Vizekanzlers Hans-Dietrich Genscher zum Ausdruck, der zwar den direkten Bruch mit den Sozialdemokraten nicht forcierte, aber mit seiner Forderung nach einer „Wende“ in der Politik das geistige Klima für einen solchen Bruch schuf. Genschers Taktik hatte das Ziel, für den von ihm gewünschten oder zumindest erwarteten Bruch mit den Sozialdemokraten diese als die Täter dastehen zu lassen und die FDP als die Unschuld vom Lande. Genscher setzte auch Schmidt unter Druck: Unter erheblichem persönlichen Engagement des Parteivorsitzenden stimmte der FDP-Parteitag im Mai 1981 in Köln dem Rüstungs-„Doppelbeschluß“ nach heftigen Kontroversen zu. Zwar hatte der Berliner Parteitag der SPD zuvor im Dezember 1979, Schmidt folgend, den Doppelbeschluß grundsätzlich akzeptiert. Aber die gegen diesen Beschluß gerichtete und nicht nur von den Grünen getragene „Friedensbewegung” hatte doch weite Kreise der SPD erfaßt, so daß die Haltung der Sozialdemokraten von Genscher und anderen leicht als labil hingestellt werden konnte. Schmidt durchschaute das und versuchte zu verhindern, daß Sozialdemokraten an der Friedensdemonstration am 10. Oktober 1981 in Bonn mitmachten, wo sich 300 000 Menschen vor der Universität versammelten. Wie zum Beweis für die Wankelmütigkeit der SPD sprach dort als einer der Prominenten das sozialdemokratische Präsidiumsmitglied Erhard Eppler. 37 Die Regierung - voran der Kanzler - hatte die Entwicklung „draußen im Land“ nicht mehr im Griff. Ein Gewerkschaftsskandal um die Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“, bei dem es um Bonzenwirtschaft und Veruntreuung gegangen war, fiel auch der SPD auf die Füße. Der SPD-Geschäftsführer Peter Glotz nahm sich die Freiheit, in aller Öffentlichkeit über einen Bruch mit der FDP zu spekulieren, denn er dozierte, die SPD müße damit rechnen, „über kurz oder lang in die Opposition zu gehen“. 38 In München tagte im April 1982 abermals ein Parteitag der SPD und faßte angesichts steigender Arbeitslosigkeit, aber auch vor dem Hintergrund einer Kette verlorener Wahlen in den Ländern und Kommunen, finanz- und beschäftigungspolitische Beschlüsse, die der FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zuvor verworfen hatte: höhere Kreditaufnahmen, Ergänzungsabgaben für höhere Einkommen, Arbeitsmarktabgabe, Abbau von Steuerprivilegien und Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Die Beschlüsse von München wurden als Spaltpilz gesehen: Entweder würde die SPD auf einer Umsetzung bestehen, dann wäre das das Ende der Koalition, oder die SPD verzichtete darauf, dann würde das die Verfallstendenzen der SPD beschleunigen. 35 Günter Verheugen, Der Ausverkauf. Macht und Verfall der FDP, Hamburg 1984, S. 107f Güter Verheugen, a.a.O., S. 121f 37 Eppler hatte zuvor als Spitzenkandidat der SPD die Landtagswahlen in Baden-Württemberg verloren. Spötter hatten behauptet, das sei daher gekommen, dass der etwas sauertöpfig wirkende Eppler ausgerechnet im kulinarisch opulenten “Ländle” die vielen dargebotenen Wurstsorten durch eine “Einheitswurst” hatte ersetzen wollen... 36 31 Auch die FDP geriet aus dem Gleis: Bei Landtagswahlen in Niedersachsen wurde sie von den „Grünen“ als dritte Partei überholt, im Berliner Abgeordnetenhaus nach der „Alternativen Liste“ (AL) die vierte Partei, bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg scheiterte sie, und in Hessen kündigte ein Landesparteitag die gute Zusammenarbeit mit der SPD unter Holger Börner auf.39 Gleichzeitig trafen sich in Köln 700 „linke“ FDPFunktionäre unter dem Motto „Noch eine Chance für die Liberalen“. Genschers Politik wurde dort als „Verrat“ bezeichnet. Dieser erkannte, daß ihm ein „geordneter“ Wechsel zur Union hin nicht gelingen werde. Die Parteiführung wurde unsicher und machte sich lächerlich. Als der Wechsel in Hessen zur CDU als Maßnahme zur Stärkung der sozial-liberalen Koalition im Bundesrat ausgegeben wurde, riefen Kommentatoren: „Schwachsinn!“ Und Genscher wurde mit einem Maikäfer verglichen: „Seit letztem Sommer hat er gepumpt, gepumpt, gepumpt - nur geflogen ist er nicht. Genscher hat so lange gemaikäfert, bis ihm ... das Gesetz des Handelns entglitt.”40 Das „Gesetz des Handelns” ergriffen nun andere Politiker: Otto Graf Lambsdorff und Helmut Schmidt. Der Minister erklärte in aller Öffentlichkeit, die bevorstehenden Hessen-Wahlen wären ein Test auf eine Wende der FDP zur Union. Der Kanzler tadelte ihn in einer Kabinettssitzung dafür und forderte ihn zur Vorlage seiner wirtschaftpolitischen Vorstellungen auf. Am 9. September 1982 legte der Wirtschaftsminister das als „Lambsdorff-Papier“ bekannt gewordene „Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit” vor. Das Papier entwickelte rein marktwirtschaftliche Konzepte, die mit der SPD nicht zu realisieren waren. Der Kanzler wollte diesen Fehdehandschuh ursprünglich nicht aufgreifen und dachte daran, die Krise durchzustehen, bis mit nahender Bundestagwahl 1984 der Spielraum für die FDP immer enger würde. Dennoch kündigte er am 17. September vor dem Bundestag die Koalition überraschend auf und teilte den Rücktritt - der wie ein Rauswurf wirkte - der FDP-Minister mit. Zeitzeugen sind sich uneinig, was die Gründe für das Handeln des Kanzlers waren. Ralf Dahrendorf schreibt: „Die Historiker werden in den Prozeß des Wechsels gewiß ihre eigenen Erklärungen hineintragen; aber wer die Ereignisse aus der Nähe verfolgt hat, weiß, daß sie, wie das so zu gehen pflegt, aus einer Serie von nicht ganz zufälligen Zufälligkeiten bestanden: dem Zeitpunkt des Lambsdorff-Papieres zur Wirtschaftspolitik, dem plötzlichen Adrenalinstoß in Helmut Schmidt und ähnlichem mehr.“ 41 Demgegenüber meint Günter Verheugen: Schmidt „wollte sich mit seiner Regierung nicht auf dem Rost braten lassen, bis er nach Meinung der FDP gar war.“42 Schmidt warb nach Art. 68 des Grundgesetzes für Neuwahlen, die stattfinden könnten, wenn eine Vertrauensfrage des Kanzlers negativ beschieden würde. Von nun an setzte in der völlig mutlosen und zerstrittenen FDP eine Serie der Niederlagen bei Landtagswahlen sein. Die vom Kanzler des „Verrats“ gescholtene FDP fiel nacheinander in Hessen, Bayern und anderen Bundesländern unter die Sperrklausel. Der Rettungsanker war, daß sich in der Union die Meinung Helmut Kohls durchsetzte, den Neuanfang nicht über Neuwahlen zu beginnen, sondern über ein konstruktives Mißtrauensvotum. Die „Koalitionsverhandlungen”, die die FDP daraufhin mit der Union führte, waren in 38 Der Tagesspiegel, 1.101981 Solche Veränderungen lösen bei den Beteiligten tiefe Emotionen aus. So zerstritten sich die Berliner Parteimitglieder der FDP heillos, als die Mehrheit der Fraktion einen CDU-Senat unter Richard von Weizsäcker auf Wunsch der Bundesspitze und gegen den Willen des Landesparteitages tolerierte. Der Landesvorstand stellte die Fraktionsmehrheit vor ein Parteigericht. - Bei einer Fraktionsvorsitzendenkonferenz der FDP in Wiesbaden versicherten Holger Börner und sein freidemokratischer Ministerkollege, Gries, sich gegenseitig ihres persönlichen Respekts. Den Tränen nahe kündigten sie ihre Zusammenarbeit auf. Es war eine berührende Szene. 40 Wilfried Herzt-Eichenrode, Maikäfer, pump!, in: Die Welt, 2.7.82 41 Ralf Dahrendorf, Die Chancen der Krise. Über die Zukunft des Liberalismus, Stuttgart 1983, S. 44 39 32 Wahrheit Kapitulationsverhandlungen. Die Union verwehrte dem als sozial-liberal eingestuften und zurückgetretenen Innenminister Gerhart Baum nicht nur die Rückkehr in sein Amt; sie akzeptierte ihn auch nicht als Mitglied der FDP-Verhandlungsdelegation. Die FDP gehorchte und stimmte schließlich dem Verhandlungsergebnis mit knappen Mehrheiten zu: In der Fraktion gab es 32 Ja- und 20 Neinstimmen bei zwei Enthaltungen, im Bundesvorstand eine 18:17-Mehrheit. Mit den Stimmen einer FDP-Mehrheit und gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und einer FDP-Minderheit wurde Helmut Kohl am 1. Oktober 1982 anstelle von Helmut Schmidt zum Bundeskanzler gewählt. Die sozial-liberale Koalition war zu Ende. Die SPD ging in die Opposition. In der FDP gab es auf dem Berliner Parteitag im November 1982 ein dramatisches Nachspiel zur in Bonn vollzogenen „Wende“. Die dezidiert sozial-liberale Seite des Parteienspektrums formierte sich und postulierte drei Ziele für den Bundesparteitag: „ - klare Mißbilligung des Koalitionswechsels und des ganzen Vorgehens, - personelle Erneuerung (Genscher muß weg), - programmatische, radikal-liberale Perspektiven”. Der eher konservative Uwe Ronnebuger aus Schleswig-Holstein sollte Hans-Dietrich Genscher als Parteivorsitzenden ablösen. Bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden erhielt Genscher jedoch 222 Stimmen, Ronneburger 169. Die Linksliberalen konnten sich auf dem Parteitag nicht durchsetzen. Die Bundestagsabgeordnete Ingrid Matthäus-Maier kündigte daraufhin wie weitere Delegierte ihren Austritt aus der FDP und ihren Beitritt zur SPD an. Es gab dramatische Szenen. Man sprach vom „Parteitag der Tränen“. Damals und in der folgenden Zeit verließen etwa 15000 Mitglieder die FDP, von denen 2 000 SPD-Mitglieder wurden. Mittelfristig wurde dieser Abgang durch Neueintritte von Maklern, Rechtsanwälten, Handwerksmeistern und mittleren Unternehmern kompensiert, die die FDP in ihrer Not an der Seite der CDU stabilisieren wollten. Die FDP wurde im Unionslager zur „Partei der zweiten Wahl“. Auf der anderen Seite etablierten sich die Grünen im Parteiensystem neu. Man sprach von zwei Lagern im deutschen Parteiensystem: Die CDU/CSU und die FDP auf der einen, die SPD und die Grünen auf der anderen Seite. 5. Die ausgebliebene geistig-moralische Wende in der Ära Kohl Der Wechsel ins andere Lager wurde der FDP als „Verrat” angekreidet. Waren doch ihre Abgeordneten nach dem Slogan für eine Regierung „Schmidt/Genscher“ in den Bundestag gekommen. Auch Konservative nahmen den Liberalen den Wechsel nicht ab. So schrieb Golo Mann in der „Weltwoche“: „Dreizehn Jahre lang habt ihr alles mitgemacht und gutgeheißen, und plötzlich war alles falsch, plötzlich seid ihr die Gegner derer, deren Freunde ihr gestern noch wart, und die Freunde derer, deren Gegner ihr gestern noch wart.” Nur um seinen Ministerposten zu retten, sei Genscher zur Union gewechselt.43 In Umfragen war die Wählergunst der Liberalen auf 2,3% gesunken. Dennoch setzte der neue Kanzler Kohl gegenüber der FDP durch, daß alsbald Neuwahlen stattfinden sollten, um den Machtwechsel durch die Wähler legitimieren zu lassen. Die FDP hätte damit gerne etwas gewartet, aber die Wahlen sollten schon im März sein. Sie brachten der CDU/CSU eine glänzende Bestätigung ihrer Führungsrolle, und die FDP - die zuvor reihenweise aus den Landtagen geflogen war - zog als ihr Anhängsel wieder in den Bundestag ein - im Huckepack, wie die Differenz zwischen 2,8% und 7,0% bei Erst- und Zweistimmen zeigt. 42 43 Günter Verheugen, a.a.O., S. 135 Golo Mann, “Man hätte nicht tun dürfen, was man am 1. Oktober in Bonn tat”, in: Weltwoche, 6.10. 1982 33 Als neue Partei zogen die Grünen 1983 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag ein. Die Bundestagsfraktion wurde das neues Kraftzentrum innerhalb der Partei und prägte das Bild der Grünen nach innen und außen erheblich. Die ersten Fraktionssprecher waren Marieluise Beck-Oberdorf, Petra Kelly und Otto Schily. Über die Startphase im Deutschen Bundestag schreibt Hubert Kleinert: „Schon der Einzug der neuen Fraktion in den Bundestag ... vollzog sich unter spektakulären Begleitumständen. Morgens um neun versammelte sich eine bunte Schar von Menschen auf einem Platz mitten in Bonn. Unter ihnen befanden sich die frischgebackenen Abgeordneten der neuen Fraktion. Gemeinsam zog man mit Blumen, Topfpflanzen und einer überdimensionierten Weltkugel zum Regierungsviertel, wo die Abgeordneten dann symbolisch von der Basis in den Bundestag verabschiedet wurden. Durch eine solche Inszenierung kamen die Kamerateams aus aller Welt so richtig auf ihre Kosten.“44 Auch innerhalb des Plenums war der Neuigkeitswert der Grünen so groß, daß deren Abgeordnete bisher Außerparlamentarisches über die Friedens- und Sexualphilosophie wenig gekonnt vortragen mochten und dennoch Aufmerksamkeit erzielten. Die Grünen waren ein Medienereignis. Die nunmehr auch von den Wählern legitimierte neue Bundesregierung hatte nach der Zeit sozial-liberaler Reformen eine Rückkehr zu den vermeintlichen Tugenden der Adenauer-Zeit versprochen. Die tragenden Werte dieser neokonservativen geistig-politischen Führerschaft sollten Freiheit, Leistung und Selbstverantwortung sein. Doch trotz des guten Starts zeigte sich in der Mitte der Legislaturperiode, daß es nicht gelingen wollte, die Arbeitslosenquote zu senken. Im Mai 1985 lag diese Quote bei 8,% - das waren 2 192 627 Arbeitslose. Und wieder präsentierte die Politik das alte Bild: Während in der CDU/CSU die Neigung zur Verabschiedung staatlicher Beschäftigungsprogramme stieg, lehnte die FDP diesen Weg ab und forderte marktwirtschaftliche Lösungen. Die Hauptwidersacher der FDP in der Koalition waren die Sozialausschüsse und die CSU. Ein anderes „geerbtes“ Thema konnte dagegen von der Koalition rasch erledigt werden - die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen („Nachrüstung“) in der Bundesrepublik. Trotz heftigsten Widerstandes der breiten Friedensbewegung stimmten die Koalitionsabgeordneten im November 1983 der Nachrüstung zu. So sehr sich die FDP in der neuen Koalition wirtschaftspolitisch fast dogmatisch marktwirtschaftlich gebärdete, so verstand sie sich in der Außen- und Ostpolitik als Garant der Kontinuität. Die Westbindung der Bundesrepublik, die Stärkung der europäischen Zusammenschlüsse und der vertragliche Interessenausgleich mit dem Osten waren die Säulen dieser Politik. In der Deutschland- und Ostpolitik begab sich die Union, die einst die Ostverträge bekämpft hatte, auf eine Linie der Kontinuität. Gelegentliche Ausbrüche des Bundeskanzlers, der beispielsweise der Landsmannschaft der Schlesier sein Erscheinen auf einem Treffen zugesagt hatte, oder seine Querelen mit dem französischen Staatspräsidenten halfen dem immer mehr in die Rolle des deutschen Chefdiplomaten hineinwachsenden Außenminister Genscher, sich als Kraft der Vernunft zu profilieren und seine Popularität zu steigern. Es ist erstaunlich, wie aus dem „Verräter“ von 1982/83 bald einer der populärsten Politiker Deutschlands wurde. Die Zuständigkeit für die Innenpolitik war von der FDP unter Gerhart Baum nunmehr auf die CSU unter Friedrich Zimmermann übergegangen. Es wurde ein Abbau des Rechtstaates und eine Vernachlässigung der Umweltpolitik befürchtet. Doch Zimmermann setzte die Katalysatoren-Pflicht für Autos durch und gab zunächst der FDP Gelegenheit, sich etwa beim Demonstrations-strafrecht oder in der Ausländerpolitik gegen die etatistische Union als „Bremser“ zu profilieren. Langfristig verlor sie jedoch diese Rolle, weil die Union bei 44 Hubert Kleinert, Aufstieg und Fall der Grünen. Analyse einer alternativen Partei, Bonn 1992, S. 37 34 Fragen wie dem Asylrecht die SPD auf ihre Seite zog und es nun auf die FDP nicht mehr ankam. Immer öfter mußte die FDP spüren, wie sehr ihr Spielraum eingeschränkt war. Insgesamt war die Wahlperiode zwischen 1983 und 1987 nicht besonders glanzvoll. Zwar war die DM stark wie nie, schienen die öffentlichen Haushalte weitgehend konsolidiert, und Exporte erreichten Rekordhöhen, - aber das Versprechen einer geistig-politischen Führung konnte die Bundesregierung nicht einhalten. Die SPD und die „Grünen“ hatten die absolute Mehrheit der Wähler unter 45 Jahren hinter sich, während bei den über 60jährigen die Union der Favorit war. Spannender und interessanter als im neokonservativen Lager ging es im grün-sozialdemo-kratischen Lager zu, wo die Richtungsstreite tobten und in der SPD die Meinungen zu rot-grün als politischer Alternative geteilt waren. Der CDU/CSU brachen traditionelle Wähler weg, so auf dem Lande, wo die EG-Agrarpolitik enttäuschte. Hinzu kam eine weitgehende Unlust an der Politik in der Bevölkerung, so daß der Anteil der Nichtwähler stieg. Selbst in parteinahen Publikationen wird 1987 als „Krisenjahr der CDU“ 45 bezeichnet. Für die Union war das Wahlergebnis von 1987 schlecht: Es war das schwächste seit 1949. Im Herbst des gleichen Jahres brach die „Barschel-Affäre“ über die Union herein. Der CDU-Ministerpräsident von SchleswigHolstein, Uwe Barschel, hatte seinen sozialdemokratischen Gegenspieler, Björn Engholm, mit Hilfe der Staatskanzlei übel diffamieren lassen („Barschels schmutzige Tricks“, so „Der Spiegel”), diesen Tatbestand bis zu einer „Ehrenwort“-Pressekonferenz geleugnet, war anschließend ins Ausland gereist und wurde am Ende tot in einer Badewanne eines Genfer Hotels aufgefunden. Zuvor hatte der „Flick-Skandal” die moralische Glaubwürdigkeit der Koalition erschüttert. Flick hatte mit Geldzuwendungen an die Parteien ihm steuersparende Leistungen auch in den Ländern erkauft. In der Sprache des Flick-Konzerns war das eine „Pflege der Landschaft”. 1983 hatte die SPD im Bundestag einen FlickUntersuchungsausschuß beantragt. Helmut Kohl, der selbst Geldbeträge angenommen hatte, sagte vor dem Ausschuß falsch aus. Heiner Geißler entschuldigte das mit einem „Blackout“. 1984 begann vor dem Bonner Landgericht ein Prozeß gegen Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff und seinen Vorgänger Hans Friderichs, ebenfalls FDP-Mitglied. Mit Prozeßbeginn trat der Minister zurück. Das Gericht sah den Tatbestand der Beamtenbestechung und des Zusammenhanges von Leistungen für die FDP und Steuerbefreiungen als erwiesen an. Es verurteilte die Politiker sowie den ehemaligen Generalbeauftragten des Flick-Konzerns, von Brauchitsch, zu Geldstrafen: Lambsdorff und Friderichs zu je 180 00 DM, Brauchitsch zu 550 000 DM. Außerdem war der Verdacht aufgekommen, Rainer Barzel habe 1973 den CDU-Vorsitz für Helmut Kohl geräumt, nachdem er von Flick 1,6 Millionen DM erhalten habe. Nach diesen Vorwürfen trat Barzel vom Amt des Bundestagspräsidenten am 26.10.1984 zurück. Dietrich Thränhardt schreibt, es sei der „Eindruck des Bauernopfers“ entstanden, „da Kohls alter Rivale Barzel zurücktreten mußte, während Kohl im Amt blieb.“46 Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler versuchte es mit einer Reform der CDU als „Volkspartei der Mitte“: Das Erbe von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard sollte bemüht werden. Aber die innerparteiliche Unzufriedenheit verging nicht. Bei einem Bundesparteitag im Herbst 1988 erzielte Kohl ein schlechtes Ergebnis bei der Vorsitzendenwahl. Innerhalb der Partei traten Meinungsverschiedenheiten zu diversen Fragen auf. Es ging um so unterschiedliche Themen wie die Abtreibungsfrage, um Südafrika oder auch um die von der 45 Konrad -Adenauer-Stiftung (Hg.), Kleine Geschichte der CDU, Stuttgart 1995, S. 156 Dietrich Thränhardt, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Erweiterte Neuausgabe, Frankfurt am Main 1996, S 276 46 35 Regierung geplante Quellensteuer. Die Fraktion unter Alfred Dregger forderte gegenüber der Parteizentrale unter Generalsekretär Heiner Geißler mehr Einfluß. Der Ernst der Lage für die Koalition insgesamt wurde deutlich, als bei den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin im Januar 1989 eine Abwahl der dortigen CDU/FDP-Koalition erfolgte, sich eine Mehrheit für rot-grün herausbildete, die FDP unter der 5-%-Grenze blieb und die rechtsradikalen „Republikaner“ in das Parlament einzogen. In der Folge kam es in der Union zu Personaldiskussionen auch um Helmut Kohl. Doch dieser setzte sich erneut durch. Er trennte sich von Heiner Geißler als Generalsekretär, der dieses Amt zwölf Jahre wahrgenommen hatte. An dessen Stelle schlug er Volker Rühe vor. Auf einem Parteitag im September 1989 in Bremen wurden Kohl und Rühe bestätigt. In dieser Zeit erreichte die Bundesrepublik zwar den höchsten Beschäftigungsstand ihrer Geschichte (29 Millionen Erwerbstätige), aber die Zahl der Arbeitslosen blieb bei 2 Millionen. Auf dem Ausbildungssektor sprach die Opposition von einer „Lehrstellenkatastrophe“, obwohl immerhin 700 000 Lehrstellen vorhanden waren. Erste Ansätze zur Steuer- und Gesundheitsreform wurden unternommen, erwiesen sich aber doch bestenfalls als Zwischenlösungen. All diese Widersprüchlichkeiten hatten zur Folge, daß das Ansehen der Union und des Kanzlers in der Bevölkerung nicht hoch waren. Da kamen der Zusammenbruch des Ostblocks und die deutsche Wiedervereinigung. Bundeskanzler Kohl begriff mit Hans-Dietrich Genscher nach anfänglichem Zögern die Chance zur Vereinigung und nutzte sie in Verhandlungen und der Ausarbeitung eines Vereinigungskonzeptes. Kohl, an dem Freund und Feind genörgelt hatten, der als „Birne aus Oggersheim“ Verspottete, wurde der „Kanzler der Einheit“ und schlug bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen seinen Herausforderer Oskar Lafontaine, der auf die Risiken der Vereinigung hingewiesen hatte. Die Wiedervereinigung hatte Kohl die Kanzlerschaft gerettet, vor allem durch den großen Zulauf im Osten. Die Bundesregierung unter Kohl hatte die politische Entscheidung getroffen, die Wiedervereinigung gegen alle politischen, sozialpsychologischen und ökonomischen Hemmnisse durchzusetzen. Daß Helmut Kohl und HansDietrich Genscher sich dabei gegen Widerstände aus London und Paris, gegen Unlust bei der Mehrheit der Westdeutschen, gegen Befürchtungen bei einer Minderheit der Ostdeutschen und gegen allen ökonomischen Sachverstand - wie er zum Beispiel vom Präsidenten der Deutschen Bundesbank artikuliert wurde - durchsetzte, ist auf der einen Seite zweifellos als staatsmännische Leistung zu werten, bescherte der nun im vereinten Deutschland regierenden Koalition aber große innere Probleme. Wahrscheinlich hatte der Kanzler in der Wiedervereinigungseuphorie tatsächlich geglaubt, sehr bald würden im deutschen Osten „blühende Landschaften“ entstehen. Daß tatsächlich Transferleistungen in Milliardenhöhe von West nach Ost über zehn Jahre und mehr hinweg zu leisten wären, daß Stillegungen ganzer Industriestandorte kommen würden, Arbeitslosigkeit und weitere Abwanderungen aus dem Osten, damit mußten sich der „Kanzler der Einheit“, seine Regierung und das gesamte Parteiensystem seither ohne durchgreifenden Erfolg herumschlagen. Die während der revolutionären Ereignisse in der DDR im Jahre 1989 erfolgten eigenständigen Entwicklungen vom Blocksystem hin zum Pluralismus der letzten Volkskammer wurden schon sehr früh von den Westparteien gesteuert und mündeten nach der Wiedervereinigung ein in die Strukturen des alten westdeutschen Parteiensystems. Zu Recht bemerkt Ulrich von Alemann: „Angesichts dieser dramatischen Veränderungen ist es kaum zu fassen, wie wenig sich an den Grundstrukturen der deutschen Politik und des Parteiensystems an der Oberfläche geändert hat.”47 Die Großparteien CDU und SPD haben sich ebenso wie die FDP auf den Osten ausgeweitet, wobei die SPD mit einer ostdeutschen sozialdemokratischen Neugründung fusionierte, während die 36 bürgerlichen Parteien ohne großes Federlesen die ihnen adäquaten ehemaligen Blockparteien schluckten. Die größten Schwierigkeiten hatten die Grünen und Bündnis 90 miteinander. Hinzugekommen war die SEDNachfolgepartei PDS. Daß die politischen Parteien nach der Vereinigung keine Konzeptionen für die Gestaltung des vereinten Deutschlands hatten, wurde sehr deutlich bei der Entscheidung über die Hauptstadt. Auffallend dabei ist, daß die politischen Parteien, die doch sonst überall mitreden und bestimmen wollen, keine eigenen Positionen entwickelt hatten. Sie überließen es ihren Abgeordneten, am 20. Juni 1991 ihrem „Gewissen“ folgend zu entscheiden. Auch nach der Abstimmung hat keine politische Partei ein klares Programm dazu entwickelt, wie der Umzug erfolgen sollte und wie man sich auf die neue Lage einstellen wollte. Das meiste wurde der Regierung oder Ausschüssen und Kommissionen überlassen, die zwischen verschiedenen Interessen lavierten. Die Ausnahme war die PDS, die als ostdeutsche Regionalpartei mehrheitlich für einen schnellen Umzug war und erwartete, daß im vereinten Deutschland die Erfahrungen und Interessen der Ostdeutschen stärker berücksichtigt würden. Das noch von Alemann diagnostizierte Kontinuität des Parteiensystems über die Vereinigung hinaus erfolgte allenfalls an der Oberfläche. Darunter taten sich bislang unbekannte Strukturen und Probleme auf, auf die das Parteiensystem der Berliner Republik reagieren mußte 1. Es besteht über Jahre hinweg eine strukturelle Arbeitslosigkeit, von der mehrere Millionen Menschen betroffen sind. Weder die Regierung Kohl noch die Regierung Schröder konnten daran etwas ändern. Das zweite Kabinett Schröder versuchte, auf der Grundlage der Hartz-Kommission und mit einem „Superminister“ nach dem Vermittlungsverfahren vom Dezember 2003 hierbei erfolgreicher zu sein. Insgesamt droht dennoch die Gefahr, daß die Bürger der Glauben an die Garantie allgemeinen Wohlstands durch das Parteiensystem endgültig verlieren. Damit entfiele eine der klassischen Legitimationsgrundlagen dieses Systems. 2. Es bestehen seit der Vereinigung zwei politische Kulturen in Deutschland. Wie sollte es anders sein, nachdem die politische Sozialisation in Ost und West bei wichtigen Werten geradezu gegensätzlich verlaufen war? Wurden im Westen Leistung und Durchsetzungsfähigkeit als grundlegende vermittelt, so waren es im Osten Gemeinschaft und soziale Sicherheit. War von Westen aus New York der Mittelpunkt der Welt, so war es vom Osten her Moskau. Der Osten sollte sich dann an den Westen anpassen. Das führte zu unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen: Die Systemkritiker im Untergang des Staatskommunismus verabsolutierten ihre in der Wende gemachten Erfahrungen und sind seitdem für westliche Verhältnisse ungewohnt rigoros und unerbittlich in der Verteufelung der Machtträger des alten Systems. Die Verlierer und die sich mißverstanden Fühlenden aus dem alten System wollten ihre eigene Identität „einbringen“ und machten die PDS stark. Die meist bei den Grünen gelandeten Rigoristen aus dem Osten und die mittlerweile allerdings im Niedergang befindliche PDS waren neue Elemente im Parteiensystem. Über zehn Jahre nach der Wiedervereinigung sind ernste Bemühungen in den Parteien zu erkennen, sich stärker für die Befindlichkeiten im Osten zu öffnen: Die ostdeutsche Parteivorsitzende Angela Merkel versucht, ihre innerparteiliche Macht auszuweiten, die SPD präsentiert bewußt „Ost“-Themen wie die Bush-Administration und „Ost“-Personen wie Manfred Stolpe, und selbst bei den Grünen drängt der Bürgerrechtler Schulz in den Vordergrund. 3. Das alte Zweieinhalb-Parteiensystem gehört der Vergangenheit an. Nach den Grünen schaffte vorübergehend auch die PDS den Einzug in den Bundestag, indem sie die Sperrgrenze überwand. Die FDP hat ihre Monopolstellung als Mehrheitsbeschaffer verloren und irrlichtert seitdem bei der Suche nach ihrem Standort. 47 Ulrich von Alemann, a.a.O., S.23 37 4. Das mühsam dem Bundesverfassungsgericht abgetrotzte System der staatlichen Parteienfinanzierung geriet mehr und mehr ins Wanken: Wissenschaft und Öffentlichkeit erkannten, daß von der Kommune bis zum Bund über direkte Zuschüsse an die Parteien, indirekte Finanzierungen an Stiftungen und Fraktionen sowie an Diätenzahlungen ein ganzer Strauß der Zuschüsse aus öffentlicher Hand gebunden worden war, der nun kritisch beäugt wird. Die nach 1998 bekannt gewordenen Spendenskandale der CDU und der SPD sowie die finanzielle Seite der Möllemann-Affäre bei der FDP belegen, daß staatliche Mitfanzierung der Parteien diese keineswegs gegen die Gier nach privaten Zuwendungen immunisiert. 5. Der alte Glaube, daß man die Macht mit Hilfe der Umfrageforschung und eines professionellen Wahlkampfes erhalten kann, ist dahin. Die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Umfrageforschung sind herausgearbeitet. Vor allem ist bekannt, daß eine noch so ausgetüftelte Fragetechnik immer nur Simulation sein könne: Das tatsächliche Verhalten in der Sekunde, in der ein Wähler in der Kabine sein Kreuzchen auf dem Wahlzettel schreibt, kann nicht vollkommen antizipiert werden. Viel schwieriger noch ist es, die Wirkung von Werbemaßnahmen wie Plakate, Filme, Kampagnen in der so vielfältigen Gesellschaft genau zu berechnen. 6. Auf dem Höhepunkt der Ära Adenauer galt der Satz „Macht hält Macht“. Danach kam der Machtwechsel. Zwar erreichte die „Machtmaschine“ Kohl Mitte der neunziger Jahre Adenauersche Dimensionen, doch die Abwahl 1998 lehrte, daß jede Macht zerbröselt. Und viel hätte nicht gefehlt, daß 2002 eine Regierung schon nach vier Jahren die Macht wieder verloren hätte. Doch trotz dieser schon Mitte der neunziger Jahre erkennbaren Defizite behauptete sich das alte System noch einmal bei der zweiten gesamtdeutschen Bundestagswahl - aus Mangel an Alternativen. Die Ära Kohl war zwar formal nicht zuende, aber die Probleme türmen sich über den „Kanzler der Einheit“: Eine Steuerreform wurde nicht umgesetzt. Der Staatshaushalt war weniger in Ordnung als zu Schmidts Zeiten. Die Arbeitslosenzahl waren so hoch wie nie. Die eigenen Mitstreiter wie der Bundesfinanzminister Theo Waigel verloren die Lust am Geschäft. Das Wort vom „Reformstau“ machte die Runde. 1998 war Wechselstimmung. Helmut Kohl hatte sie nicht erkannt, weder innerparteilich noch allgemein. Wieder einmal klammerte sich einer so lange an die Macht, bis sie ihm entrissen wurde. Gerhard Schröder, der damalige Liebling der Bosse und der Bild-Zeitung, personifizierte mit seinem linken Tandem Oskar Lafontaine den Wechsel und wies Kohl den Weg aus dem Kanzleramt. Noch in Bonn wurde die erste rot-grüne Bundesregierung installiert. Doch die Residenz am Rhein wurde abgewickelt. 1999 zog die Hauptstadt nach Berlin um. 6. Die unerwartete Einheit: Zwei politische Kulturen? a) Die Gründung von wissenschaftlichen Institutionen "Der Mangel an gebildeten, staatsverbundenen, mit den einheimischen Verhältnissen vertrauten Beamten, der Wunsch, die Stadt an der Oder wirtschaftlich weiter zu fördern, und die Absicht, die außenpolitische Geltung Brandenburgs in der Niederlausitz und in Schlesien, in Pommern und Polen zu erhöhen, veranlaßten Kurfürst Joachim I. 1506 zur Errichtung der ersten, dem Leipziger Modell folgenden brandenburgischen 38 Landesuniversität in Frankfurt. Ihr Schwerpunkt lag in der Juristenfakultät." i Heinz Kathe schreibt das in einer Kulturgeschichte Preußens und erinnert damit an die Gründung der Viadrina. 48 Wie gründete man fast 500 Jahre später ohne einen Kurfürsten in zwei Jahren drei Universitäten, fünf Fachhochschulen und einige Forschungsinstitute? Nach der westdeutschen Bildungsreform in den siebziger Jahren hätte jeder Kenner auf diese Frage geantwortet: "Gar nicht, weil es unmöglich ist." Doch zumindest in Brandenburg schien das Undenkbare in der Aufbauphase des Landes erreichbar geworden zu sein. Der Einigungsvertrag hatte eine rasche Erneuerung der Wissenschaftseinrichtungen der ehemaligen DDR vorgesehen. Sie sollten auf ihre Leistungsfähigkeit hin überprüft werden. Die "Brandenburgische Landeskommission für Hochschulen und Forschungseinrichtungen" resümierte im April 1993: "Im Oktober 1990 gab es in Brandenburg vier Hochschulen: die aus der pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" hervorgegangene Brandenburgische Landeshochschule in Potsdam, die aus der Ingenieurschule Cottbus hervorgegangene Hochschule für Bauen in Cottbus, die aus der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR hervorgegangene Hochschule für Recht und Verwaltung in Potsdam-Babelsberg und die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg. ... An Instituten der Akademie der Wissenschaften wies das Land auf: die Zentralinstitute für Astrophysik und Physik der Erde in Potsdam, die Institute für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke, für Hochenergiephysik in Zeuthen und für Halbleiter-Physik in Frankfurt/Oder." Nicht erwähnt hatte die Landeskommission die kleineren Institute der "Akademie der Wissenschaften der DDR" ("AdW") in Caputh ("Einsteinlaboratorium"), Niemegk (Erdmagnetismus), Potsdam (Hochdruckphysik) sowie die dann beim brandenburgischen Landwirtschaftsminister verwalteten Institute der "Akademie der Landwirtschaftswissenschaften" ("AdL") . Insgesamt waren in Brandenburg 1990 bei der AdW 727 und bei der AdL 775 Wissenschaftler beschäftigt. Beide Akademien warten zentralistisch organisiert. Daß die Umwandlung der Wissenschaftseinrichtungen der DDR von dort aus gewollt und keineswegs im Zuge der Übernahme vom Westen aufgestülpt wurde, zeigen die Schlußfolgerungen einer Denkschrift, die ein "Fachausschuß Wissenschaft/außeruniversitäre Forschung" im Oktober 1990 vorgelegt hatte. Dieser Fachausschuß war eingesetzt worden vom Ressort für Kultur, Wissenschaft und Bildung der damaligen Bezirksverwaltungsbehörde Potsdam. Die Unterschiede zwischen der Forschung in der DDR und der öffentlich geförderten Forschung in Westdeutschland wurden wie folgt gesehen: - Die DDR-Forschung sei stärker vermischt gewesen mit Ressort- und Industrieforschung, - es habe in der DDR kaum eine Anbindung an die Universitäten und keinen zügigen Personalaustausch gegeben, - im Osten hätten Technologie-Parks und An-Institute als Scharniere zwischen Forschung und Wirtschaft gefehlt, - in der DDR sei der Anteil fest angestellter Mitarbeiter sehr hoch gewesen, und - es hätte dort viel zu stark ausgebaute technische Dienste, beispielsweise beim Gerätebau, gegeben. ii Im Ergebnis der Überprüfungen wurden die brandenburgischen Forschungsinstitute zum großen Teil als Einrichtungen der westdeutschen Trägerinstitutionen der Forschung wie der Max-Planck-Gesellschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft oder als vom Bund geförderte "Blaue- ListeInstitute" weitergeführt. Meist erhielten sie einen Status als zeitlich begrenzte Arbeitsgruppen oder als Außenstellen westdeutscher Zentralen. Bei Berufungen wurde auf eine Anbindung an die Hochschulen geachtet. 48 Heinz Kathe, Preußen zwischen Mars und Museen. Eine Kulturgeschichte von 1100 bis 1920, München/Berlin 1993 39 Teilweise hatten die brandenburgischen Forschungsinstitute auch international einen ausgezeichneten Ruf. Das galt zum Beispiel für die Astrophysik. Die aus den "Königlichen Observatorien für Astrophysik, Meteorologie und Geodäsie bei Potsdam"49 hervorgegangene Forschungseinrichtung auf dem Telegraphenberg hätte durchaus wieder ein zentrales Forschungsinstitut werden können. Aber der Vorschlag, Einrichtungen aus Süddeutschland dazu nach Potsdam zu verlagern, erzeugte bei den Mitarbeitern im Süden der Republik helles Entsetzen. Das Vorhaben wurde fallengelassen, und Potsdam bekam die Zentrale nicht. An den Hochschulen waren in Brandenburg 1990 215 Professoren und Dozenten für 6897 Studenten tätig. Der Quotient Studentenzahl zu Bevölkerung betrug in diesem Land 0,27 %. In Sachsen-Anhalt war diese Relation 0,71 % und im Durchschnitt der alten Bundesländer 2,54 %. Wie alle Hochschulen in der DDR hatten auch die Brandenburgischen einen hohen Anteil fest angestellter Wissenschaftler, und sie waren strikt getrennt von den Forschungseinrichtungen. Die allgemeinen Schwächen der Hochschulen in der DDR und mehr noch die magere Ausstattung des Landes mit Hochschulen waren die Hauptgründe für die Errichtung von Universitäten und Fachhochschulen im Lande. Im "Vertrag zur Bildung der Landesregierung Brandenburg in der ersten Legislaturperiode des Landtages 1990 1994" dem Vertrag der Ampelkoalition also, heißt es dazu noch sehr vorsichtig: "Ein Landeshochschulgesetz wird vorbereitet. Die Gründung einer Landesuniversität Brandenburg sowie von Fachhochschulen wird angestrebt. Die Standortfragen werden im Rahmen der Landesentwicklung entschieden." Sollte es eine Landesuniversität geben oder mehrere, das war eine der Streitfragen im Zuge der Regierungsbildung 1990. Eine Landesuniversität mit möglicherweise mehreren Standorten würde das Land verkraften können und hätte bei der Wissenschaftswelt angesichts der Unterausstattung der neuen Landes und der Konzentration von Hochschulen in Berlin breite Unterstützung gefunden. Mit der Berufung Hinrich Enderleins zum Wissenschaftsminister war jedoch die Entscheidung für gleich drei Universitäten verbunden. Potsdam, Frankfurt an der Oder und Cottbus sollten ihre Universitäten bekommen. Daneben sollten fünf Fachhochschulen gegründet werden. Im 1957 von Bund und Ländern gegründeten Wissenschaftsrat, einem Fachgremium zur Bewertung von Hochschul- und Forschungsplanungen, wurde diese Linie anfangs noch ziemlich deutlich als maßlos kritisiert. Hier hätte man es lieber gesehen, Brandenburg hätte sein Hauptgewicht auf die Fachhochschulen gelegt und somit auf die Ausbildung von Studenten mit günstigen Berufsperspektiven. Insbesondere die beabsichtigten Gründungen in Cottbus und Frankfurt an der Oder wurden in Zweifel gezogen. Die Landesregierung und der Wissenschaftsminister konnten dagegen ihre Position nur halten mit dem Konzept von Mini-Universitäten an der Oder und in der Lausitz. Auf ganze Fächergruppen wurde verzichtet, und Brandenburg machte wieder einmal aus der Not eine Tugend. Nach dem Motto "Small is beautifull" versprach man der akademischen Jugend "studierbare" Universitäten. Im Osten Deutschlands beherrschten Ende 1990 zwei Begriffe die Wssenschaftswelt: "Evaluation" und "Abwicklung". Der Wissenschaftsrat nahm seine Überprüfungaufgaben wahr, und die Landesregierung schlossen ganze Einrichtungen, die fachlich und politisch keine Zukunft haben würden. In Brandenburg wurde die politisch belastete Akademie für Staats- und Rechtwissenschaft, die vergebens eine Reform unter dem Namen Hochschule für Recht und Verwaltung versucht hatte, auf Beschluß der Landesregierung geschlossen. Die Bereiche Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft wurden abgewickelt, die Rechtwissenschaft in die Brandenburgische Landeshochschule - die spätere Universität 49 Die Königlichen Observatorien für Astrophysik, Meteorologie und Geodäsie bei Potsdam. Aus Amtlichem Anlass Herausgegeben Von Den Beteiligten Directoren, Berlin 1990 40 Potsdam - übernommen. Der Minister, der Staatssekretär und der Abteilungsleiter fuhren nach PotsdamBabelsberg, wo Studenten und Mitarbeiter in einem überfüllten Hörsaal darauf warteten, zu erfahren, was die Landesregierung über ihre Zukunft beschlossen hatte. Nur äußerlich konnte man sich an die einstigen Vollversammlungen der Freien Universität Berlin erinnert fühlen. Die Veranstaltung nahm jedoch einen anderen Verlauf als jene tumultösen Happenings der APO-Zeit. Der Minister erhielt das Wort und teilte nervös, offensichtlich innerlich erregt aber dennoch couragiert den Abwicklungsbeschluß der Landesregierung mit. Das Ende! Kein Sturm der Entrüstung brach los, keine Tränen flossen; es gab keine wütenden Tiraden. Nach dem schweigend zur Kenntnis genommenen Bericht des Ministers meldeten sich einige und fragten nach den Konsequenzen des Kabinettbeschlusses für bestimmte Gruppen von Hochschulangehörigen: "Was wird aus den Schreibkräften? Werden auch die alle entlassen?" Andere wieder wollten wissen: "Warum werden die Sprachlehrer in die Wüste geschickt, wo sie doch künftig an der Uni Potsdam gebraucht werden?" Studenten erkundigten sich: "Werden die bisherigen Semester jetzt annulliert, oder von den kommenden Hochschulen anerkannt?" Die Politikwissenschaftler fragten eigentlich nur noch rhetorisch: "Warum hat man uns keine Chance gegeben, wir hatten doch schon ein Reformmodell entwickelt?" Der Minister und seine Mitarbeiter konnten nicht auf jede dieser Fragen zuverlässige Antworten geben. Zur gleichen Zeit waren die ersten Evaluierungskommissionen in Brandenburg eingetroffen. Der Wissenschaftsrat hatte sie eingesetzt, und ihre Aufgabe war es nun, Hochschul- und Forschungseinrichtungen zu begutachten und Empfehlungen für die Zukunft abzugeben. Eine Kommission begutachtete die in Brandenburg ansässigen Fachschulen, um zu sagen, welche von ihnen in Fachhochschulen umgewandelt werden könnten. Seit Gründung des Wissenschaftsministeriums in Potsdam hatte auf diesem ein großer Druck der Fachschulen gelegen, deren Lehrer hofften, ihre berufliche Zukunft als Fachhochschulprofessoren zu sichern. Gebetsmühlenartig wurden diesen Lehrern und ihren Schülern immer wieder gesagt: "1. muß der Wissenschaftsrat Eure Umwandlung empfehlen, 2. muß das Land sich diese Empfehlung zueigen machen und 3. werden dann Hochschullehrerstellen ausgeschrieben; es gibt keinen Übernahme-Automatismus von Fachschullehrern zu Fachhochschullehrern." Dennoch blieb der Druck groß; viele Lehrer hofften, daß alle diese Voraussetzungen eintreffen und sie am Ende der Ruf an eine neu gegründete Fachhochschule ereilen würde. Die Kommission reiste durch das Land und besichtigte Fachschulen. Was das Land vorhatte, wußten die Mitglieder schon: Fachhochschulen sollten in Potsdam/Brandenburg (Soziales/Technik), Wildau (Technik), in der Lausitz (Technik) und in Eberswalde (Forstwissenschaft) gegründet werden. Die Kommission kannte natürlich auch die Vorgaben des Wissenschaftsrates für die Gründung von Fachhochschulen; dort hatte man besonderen Wert auf günstige Berufschancen für Absolventen einerseits und auf die regionalen Entwicklungseffekte andererseits gelegt. So vorbereitet erschien die Kommission in den Schulen, besichtigte die Räume, sprach mit den Kollegien und begab sich zum nächsten Ort der Evaluation. Wenig später legte sie ihre Empfehlungen vor. Diese Empfehlungen waren wichtig, denn der Wissenschaftsrat machte sie sich in der Regel zu eigen. Für das Land war eine Hochschulgründung aber nur mit einer entsprechenden Empfehlung des Rates möglich, denn der Bund machte seine Mitfinanzierung vor allem beim Hochschulbau vom Rats-Votum abhängig, und die notwendige wissenschaftliche Reputation hing auch von der Position des Wissenschaftsrates ab. Entsprechend bitter war die Reaktion vor Ort, wenn die Kommission eine Einrichtung negativ bewertet hatte. Da wurde gesagt, die Kommissionsmitglieder seien durch die Räume geeilt und hätten nur oberflächlich mit den Fachlehrern parliert. Von "Kolonialherrenverhalten" war die Rede. Die Mitglieder der Kommission verteidigten sich mit 41 ihrer Professionalität: "Wir besuchen in einer Woche teilweise zehn Einrichtungen und haben einen Blick dafür entwickelt, was geht und was nicht. Im übrigen müssen wir die Vorgaben der Landesregierung und des Wissenschaftsrates beachten." Bitterkeit blieb. Hier wie auch in der Wirtschaft, wo die Treuhand Strukturentscheidungen traf, war es für die Landesregierung günstig, daß eine Institution wie der Wissenschaftrat die unpopulären Entscheidungen auf sich nahm. Mit dieser scheinbaren Kompetenzverlagerung konnte sie das Vertrauen auch enttäuschter Bürger bewahren. Tatsächlich hatte der Wissenschaftsrat in den Jahren der Wende ein enormes Arbeitspensum geleistet und solide Empfehlungen gegeben. Bis zur Gründung der Hochschulen mußten in Brandenburg folgende - mehr oder weniger hohe - Hürden genommen werden: 1. Die Proklamation des politischen Willens durch die Landesregierung und durch den Landtag gehörte zu den weniger schwierigen Hürden. Alle Fraktionen im Landtag versprachen sich von den Hochschulgründungen Entwicklungsimpulse für das Land. Und wenn der aus dem Bundesbildungsministerium gekommene Minister das Mammutprogramm für realisierbar hielt, dann würde es wohl auch so sein. Es war ein Leichtes, das sich eben erst in seiner Rolle findendes Parlament dazu zu bewegen, schon im Mai 1991 ein "Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg" zu verabschieden. Herr des Gesetzgebungsverfahrens war in dieser Gründerzeit nicht etwa der Landtag, nicht die Regierung als Ganzes, nicht das zuständige Ministerium, sondern ein Club von drei Personen: Der Minister, der zuständige Abteilungsleiter und der Vorsitzende des Landtagsausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Vom Minister kamen die Vorgaben und der Glaube an ihre Realisierbarkeit, vom Abteilungsleiter in Anknüpfung an seine Referententätigkeit im Bundesbildungsministerium der aus 16 bekannten Landeshochschulgesetzen destillierte 17. Text, und der Ausschußvorsitzende bugsierte das Werk durch das Parlament. Wer Beratungen über Hochschulgesetze in den alten Bundesländern gekannt und daran mitgewirkt hatte, der konnte sich nur die Augen reiben und verwundert feststellen, daß es in Brandenburg überhaupt keine Diskussion über den Gesetzentwurf gab. Den Abgeordneten war das Hochschulrecht mit den Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes unbekannt, und eine kritische Hochschulöffentlichkeit, die beispielsweise die Themen "Gruppenuniversität" oder "Ordnungsrecht" hätte problematisieren können, gab es nicht. Es war beim Hochschulgesetz nicht anders als bei anderen grundlegenden Rechtsnormen des sich konstituierenden Bundeslandes: Es war die Stunde der Referenten aus dem Westen, die ihr Gesellenstück ablieferten und sich damit häufig die Basis schufen für leitende Posten in der brandenburgischen Verwaltung. Im § 2 des so verabschiedeten Gesetzes heißt es seitdem: "Das Land Brandenburg errichtet die Universität Potsdam, die Europa-Universität Frankfurt/Oder und die Technische Universität Cottbus. ... Das Land Brandenburg errichtet Fachhochschulen; dabei ist ein nach Aufgabenstellung, Fachrichtung, Zahl, Größe und Studenten ausreichendes und ausgeglichenes Angebot an Fachhochschulen anzustreben." 2. Mit dem Hochschulgesetz in der Hand hatte der Wissenschaftsminister die Möglichkeit, durch Verordnung die Hochschulen zu gründen und Gründungskommissionen mit Gründungsrektoren an den Spitzen einzusetzen. Bei der Suche nach geeigneten Persönlichkeiten für diese Aufgabe war Eile geboten, denn der Kreis der infrage Kommenden erhielt in dieser Zeit zahlreiche Angebote aus den neuen Bundesländern. Zur Gestaltung der Hochschullandschaft im Lande Brandenburg hatte das Land insgesamt zehn Kommissionen eingesetzt: Eine Landeskommission, eine Fachhochschulkommission, drei Gründungskommissionen der Universitäten und fünf der Fachhochschulen. Insgesamt waren in diesen Kommissionen 144 Personen, meist 42 Wissenschaftler, tätig. Von diesen Personen waren neun Ausländer, 41 Ost- und 94 Westdeutsche. Drei der zehn Vorsitzenden dieser Kommissionen waren "Ossis", mithin sieben "Wessis". Im Ministerium erfolgte die Auswahl geeigneter Personen gelegentlich per Zuruf. Für die Technische Universität Cottbus wurde der vielbeschäftigte Wissenschafts-Unternehmer Prof. Günter Spur von der TU Berlin ausgewählt. Wie die anderen Gründungsrektoren der Universitäten, die Professoren Knut Ipsen (Frankfurt/Oder) und Rolf Mitzner (Potsdam) und übrigens auch die Gründungsrektoren der Fachhochschulen, leistete Spur Pionierarbeit. Ohne seine Zielstrebigkeit, seinen Einsatz und seine Überzeugungskraft wäre das Projekt TU Cottbus möglicherweise schon in der Gründungsphase gescheitert. Bereits Ende August 19991 beschloß der Spur zur Seite gestellte Gründungssenat der Universität Cottbus die Errichtung von fünf Fakultäten für 6 250 Studenten. Gründungsdekane wurden eingesetzt, und am 11. November 1991 fand im Staatstheater die feierliche Immatrikulation des 1. Studienganges in Anwesenheit des Ministerpräsidenten, des Oberbürgermeisters und anderer Politiker statt. Prof. Mitzner in Potsdam war übrigens der einzige Ostdeutsche unter den Gründungsdirektoren. 3. Nach der Proklamation des politischen Willens und der Ausarbeitung der Konzepte ging es ab der zweiten Jahreshälfte 1991 darum, die Ressourcen für Hochschulen im Landes zu erkämpfen. Das war eine der schwierigsten Hürden. Es wurde gerungen um Stellen, Räume und Geld. In Frankfurt/Oder herrschte mehr noch als in anderen Orten eine wahre Universitätsbegeisterung. beabsichtigte Neugründung der Europa-Universität Die knüpfte an die erste brandenburgische Universität überhaupt, die "Universitas Viadrina" an, die von 1506 bis zu ihrer Verlegung nach Breslau im Jahre 1811 in Frankfurt bestanden hatte. Die neue Frankfurter Universität sollte Ausstrahlung nach Polen und ganz Osteuropa haben. So erklärt sich der stolze Name "Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)". Für die erste Ausbaustufe waren drei Fakultäten ("Kulturwissenschaften" als Innovation, Jura und Wirtschaftswissenschaften) für rund 4000 Studenten vorgesehen. Sitz der Universität sollte das ehemalige Gebäude der Bezirksverwaltung in der Innenstadt sein. Hier entstand ein Streit. Der Finanzminister suchte - wie überall im Lande, so auch in Frankfurt - Räumlichkeit für die neu errichteten Finanzämter. In Frankfurt beanspruchteer dafür daßelbe Gebäude wie die Universität. Die Universität sollte an den Stadtrand gehen und dort frei werdende Militärgebäude nutzen. Das lehnten die Universität und das Wissenschaftministerium ab: Die Viadrina gehöre in das Weichbild der Oder, sie müsse für polnische und deutsche Studententen gleichermaßen erreichbar sein. Der Landesrechnungshof schaltete sich in den Streit ein und schlug sich auf die Seite des Finanzministers. Vor dem Parlament wiederum machte die Kontrollbehörde eine Bauchlandung; die Abgeordneten nahmen einhellig Partei für die Universität. Schließlich wurde in einem "Chefgespräch" zwischen den Ministern ein landesweiter Kompromiß gefunden, von manchen als "Kuhhandel" bezeichnet. Danach konnte die Universität in das begehrte Frankfurter Gebäude einziehen, in Oranienburg aber Unterbringung des dortigen Finanzamtes im akzeptierte der Wissenschafts- und Kulturminister ehemaligen Verwaltungsgebäude der SS für die Konzentrationslageriii unter der Voraussetzung, daß die damals in Vorbereitung befindliche "Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten" in diesem Gebäude ebenfalls unterkommt. Der nächste Streit ging um die Stellen. Allein für Professoren begehrten in ihren Gründungsschriften - die TU Cottbus 133 Stellen, - die Europa-Universität 46 Stellen und - die Universität Potsdam 215 Stellen. 43 Dazu kamen Stellenanforderungen für weitere wissenschaftliche Mitarbeiter und sonstige Dienstkräfte. Nach zähem Hin und Her konnte das Wissenschaftsministerium, immer das Parlament auf seiner Seite wissend, sich durchsetzen. Aber es drohte neues Unheil.: Das Kabinett selber wollte über die Einstellung und Berufung von Professoren entscheiden. Darüber hinaus hatte der Landtag eine restriktive Haltung zum Thema "Berufbeamtentum" eingenommen, und in der Folge lehnte zumindest das Innenministerium seine Mitwirkung bei der Verbeamtung von Professoren ab. In den Gründungssenaten herrschte Krisenstimmung. Alle Berufungen nach Brandenburg seinen gefährdet, hieß es. Der Staatssekretär fuhr im Sommer 1992 zu allen drei Universitäten in Gründung und erklärte die Haltung des Wissenschaftsministeriums, daß schon aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit mit anderen Bundesländern Hochschullehrer auch in Brandenburg Beamte sein müßten (weil sie nun einmal sein wollten). Auch würde man es nicht zulassen, daß im Kabinett über Berufungen oder Ernennungen entschieden werde. Berufungen spreche der Wissenschaftsminister aufgrund der eingereichten "Listen" der Hochschulen aus, und die Ernennung zu Beamten werde der Berufung auf dem Fuße folgen. Das Kabinett werde informiert, entscheide aber nicht.- Im Fraunhofer-Institut in Berlin fand dazu zusätzlich ein Gespräch mit dem Cottbuser Gründungsrektor statt. Er wollte ein klares Wort des Ministerpräsidenten, das allein die Bedenken gegen das Brandenburger Berufungsverfahren in der Wissenschaftswelt entkräften könne. Die Staatskanzlei hatte dem Wissenschaftsministerium zuvor mitgeteilt, wegen der "Professorensache macht der MP keinen Termin". Noch vom Fraunhofer-Institut aus versuchte Spur, dennoch Stolpe zu sprechen. Die Sekretärin meldete: "Ministerpräsident Stolpe ist nicht zusprechen." Spurs Weisung: "Dran bleiben! Immer wieder versuchen!" Spur bekam seinen Termin beim "MP". Und der sagte ihm nach Konsultation mit dem Wissenschaftsminister zu, Brandenburg werde bei der Einstellung von Professoren nicht anders verfahren als die anderen Bundesländer. Diese Nachricht war wichtig für die Bewältigung der nächsten Hürde im Gründungsprozeß, dem Wissenschaftsrat. 4. Der Wissenschaftsrat, genauer gesagt seine Wissenschaftliche Kommission, war eine Versammlung hochgelobter Primadonnen. Jeder Wissenschaftler dort hielt sich auf dem Fachgebiet, das er vertrat, für ein "As", und diese Einschätzung war in den meisten Fällen zutreffend. Ohne den Rat, so die Selbsteinschätzung dieses Gremiums, würde sich in der deutschen Hochschullandschaft gar nichts bewegen. Zumindest für Brandenburg war das eine hypertrophe Einschätzung, denn faktisch wurden die Entscheidungen über die Gründungen von den zuständigen Politkern des Landes und des Bundes getroffen. Der Rat konnte korrigieren, Hinweise geben, Gewichte verlagern, verzögern. Projekte verhindern oder gar initiieren konnte er nicht. Der Typus der angesehenen und unabhängigen Wissenschaftler, der sich in den Wissenschaftsrat wählen läßt, hängt doch von der Politik vor allem des Bundes ab, weil sie letztenendes über die von ihm begehrten Ressourcen verfügt. Professoren, die darauf keinen Wert legen, kommen auch nicht in den Wissenschaftsrat. Und daß im vorliegenden Fall der Bund die brandenburger Pläne der Hochschulgründungen unterstütze, setzten die Räte vielleicht in vorauseilendem Gehorsam - bei der gleichen Parteiorientierung von Bundesbildungsministerium und dem Potsdamer Wissenschaftsministerium einfach voraus. Bevor sie ihren Segen gaben, stellten die Räte jedoch zunächst einmal Frage an Frage: Welche Gebäude sollten denn nun in Cottbus an die Fachhochschule und welche an die Universität gehen? Und wie, bitteschön, stimmt man das Gründungskonzept mit den TU`s in Berlin und Dresden ab? Ein Prominenter von ihnen begab sich in die Öffentlichkeit: Von einer Europauniversität halte er nicht viel, da habe es schon früher Versuche gegeben 44 und heute sei da praktisch nichts Europäisches. Und schon gar nichts halte man von der Frankfurter Idee, einen Studiengang Wirtschaftsphysik einzurichten. Seltsamerweise geriet das größte Gründungsprojekt, die Universität Potsdam, nicht ins Visier. Offensichtlich reichte der günstige Standort der Landeshauptstadt direkt neben Berlin aus. Die Potsdamer hatten fünf Fakultäten vorgesehen (Jura, Philosophie I und II, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, MathematikNaturwissenschaften) für 13 000 Studenten. Auch daß Potsdam zugleich eine Fachhochschule und die Hochschule für Film und Fernsehen beherbergte, störte niemand. Potsdam war ein Selbstläufer; hier bedurften die Hochschulen auch nicht des Zuspruchs durch die Stadt wie in Frankfurt an der Oder. Sie erhielten ihn auch nicht... Frankfurt und Cottbus wurden endlich evaluiert. Der Rat formulierte noch einige Änderungswünsche Betriebswirtschaftslehre bitte nur in Frankfurt, nicht aber in Potsdam und die Wirtschaftsphysik in die "zweite Aufbauphase" der Viadrina - , aber die Gesamtentwicklung wollte und konnte er nicht stoppen. Der Gründung der brandenburgischen Universitäten und Fachhochschulen wurde am Ende zugestimmt. Die Hochschulen hatten damit die Geburt geschafft, ob sie lebensfähig sind, wird die Zukunft zeigen. Der schnelle und wenig systematisch geplante Gründungsprozeß hat es mit sich gebracht, daß es nun Regionen im Lande gibt, die sich vernachlässigt fühlen und ebenfalls Hochschulgründungen fordern. Das ist in Schwedt, in Eisenhüttenstadt und auch in der Prignitz der Fall. Die Landespolitik wird sich hier mit Defiziten herumplagen müssen. Frankfurt hat - angesichts ausländerfeindlicher Vorkommnisse und stockender Berufungen - um die Einlösung seines Anspruchs zu kämpfen. Allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz hat es keine systematische Abstimmung mit der Hochschulentwicklung in Berlin gegeben, wo beispielsweise die drei Universitäten FU, TU und Humboldt trotz Abbaubemühungen Brandenburg weit in den Schatten stellen. Ganze Fächergruppen lassen sich in Brandenburg nicht studieren. Berlin hat drei Universitätsklinika, Brandenburg hat keines, und der Wissenschaftsrat wollte daran auch nichts ändern. Auf der anderen Seite leistet sich die direkt nebeneinander zwei Spezialhochschulen, die Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam und die Film- und Fernsehakademie im Westen Berlins. Sowohl von Berliner als auch von brandenburger Seite wurde eine Zusammenlegung dieser Einrichtungen von Anfang an blockiert. Mit seinen Gründungen hat Brandenburg eine eigene Wissenschaftslandschaft geschaffen und bietet beispielsweise 23 000 Universitätsstudienplätze an - ein Drittel des Volumens der FU in Dahlem. Die brandenburger Einrichtungen sind nur zu verstehen als Ergänzungen zu den Berliner Institutionen, und als solche sind sie sinnvoll. In Berlin gab es 1994 140 000 Studenten. Bei allen strukturellen Mängeln sind die Wissenschafts- und Hochschuleinrichtungen für die Wirtschaft und die politische Kultur Brandenburgs unverzichtbare Institutionen. Der Landesregierung kann daher nur empfohlen werden, pfleglich mit diesem Erbe umzugehen, das ihr in einer außergewöhnlichen Zeit zugefallen ist und daß heute nur zu leicht verspielt werden könnte. b) Zwei politische Kulturen Ende 1993, vor der Kaskade von Bundestags- und zahlreichen Landtagswahlen, geschah in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam Ungeheuerliches: Bei den Oberbürgermeisterwahlen lag der Kandidat der PDS, Rolf Kutzmutz, im ersten Wahlgang vor dem sozialdemokratischen Amtsinhaber, Horst Gramlich. Gramlich hatte eine unglückliche erste Amtsperiode hinter sich, aber daß Potsdam nun von einem "Kommunisten regiert" werden könnte, regte Gemüter in ganz Deutschland auf. Vor allem Kritiker aus dem 45 Westen fanden es empörend, daß der sympathische Kutzmutz mit SED-Vergangenheit auch eine Mitarbeit bei der Stasi zugegeben hatte. Freilich war seine Stasi-Geschichte weniger brisant als die des Ministerpräsidenten des Landes, Manfred Stolpe. Aus dem Parteihauptquartier der CSU im fernen München war zu hören, man sollte die PDS verbieten, und im nahen ehemaligen West-Berlin polterten CDU Politiker, man habe nicht vierzig Jahre gegen den Kommunismus gestanden, um nun im Zuge der möglichen Vereinigung Berlins mit Brandenburg von einer Landeshauptstadt aus regiert zu werden, an deren Spitze ein Kommunist säße. Diese Fürsorge um Potsdam hatte sich zweieinhalb Jahre später nach dem Scheitern der Fusion durch die Volksabstimmung als voreilig erwiesen. Aber auch aus dem Kommunisten im Rathaus wurde nichts. Für den zweiten Wahlgang wurde ein Bündnis für Gramlich und gegen Kutzmutz geschmiedet. CDU, Grüne und FDP warben für den ungeliebten OB, der es dann noch einmal schaffte. Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Brandenburg und die Reaktionen hierauf im Westen zeigten, daß Deutschland Jahre nach der Vereinigung zwei politische Kulturen hatte. Das könnte sich zum Wesen der Berliner Republik zu verfestigen und wäre ein gravierender Unterschied zur Bonner Republik. Das Produktivkapital sitzt im Westen und hat an der Wiedervereinigung verdient. Von West nach Ost wandert dauerhaft kein Kapital, dafür wandern qualifizierte Arbeitnehmer von Ost nach West. Mit öffentlichen Transferleistungen auch in Milliardenhöhe läßt sich der Sozial- und Bewußtseinsunterschied nicht wegkaufen. Im Osten hatten die Menschen die deutsche Einheit neben der Befreiung von der Diktatur überwiegend auch als eine Befreiung im regionalen Sinne empfunden. Nicht nur der Kurfürstendamm, auch die Alpen und sogar die Everglades waren erreichbar geworden. Wirtschaftlich und sozialpsychologisch brachte die Einheit aber auch "Befreiungen" von der Lebenssicherheit. Existenzielle Besitzstände wie Wohnung und Arbeit gerieten in Gefahr und gingen vielfach verloren. Der Westen übernahm das Kommando in der Republik, im Bund sowieso, aber auch in den Ländern und in den Kommunen. Trotz des Umzugsbeschlusses des Deutschen Bundestages wurde die Politik am Rhein fortgesetzt, als sei die deutsche Vereinigung lediglich eine Arrondierung des Bundesgebietes um einige Wüsteneien. In den Behörden Brandenburgs, seinen Kreisen und Gemeinden gaben "Wessis" – aus der anderen Lebenswelt von Rhein und Ruhr kommend – den Ton an. Weil sie als Botschafter der ersehnten Konsum- und Luxuswelt gesehen wurden, waren sie zunächst – wenn auch mit einem unangenehmen Gefühl der Unterlegenheit – willkommen. Innerhalb von zwei Jahren kam die Ernüchterung. Trotz der Versprechen und der Helfer aus dem Westen ging es für viele hier sozial bergab, und sie konnten oder wollten nicht sehen, wo es bergauf gegangen war. Zwar wurden Straßen gebaut, Häuser renoviert und investiert. Aber die Arbeitslosenquoten wurden zweistellig, ganze Wirtschaftszweige brachen ab. Auf Liegenschaften wurden Altansprüche erhoben. Immer mehr Brandenburger erkannten, daß sich die Westhelfer mit Buschgeldern und Sprungbeförderungen selber ganz gut helfen konnten, ansonsten aber auch nur mit Wasser kochten. Wen wundert eigentlich der aufgekommene Frust? Wen wundert der Zulauf zur PDS, die ein altes "Wir-Gefühl" der DDR anspricht und deren Repräsentanten wenigstens nicht die roten Socken von der Sorte waren, die sich nach der Wende als Oberkapitalisten aufspielten? Wen wunderte das relativ magere Abschneiden der SPD beispielsweise in Potsdam, wenn sich diese Partei trotz des Stolpe-Untersuchungsausschusses über die IMTätigkeit eines PDS-Genossen scheinbar moralisch empört gab, während solche Tätigkeit dem SPD-Genossen verziehen wurde? 46 Der Erfolg der PDS in Potsdam war Ausdruck einer nicht erreichten inneren Einheit. Daß die Konkurrenzparteien über dieses Ergebnis unglücklich waren, ist geschenkt. Daß aber im Westen darüber hinaus aufgeschrien wurde über die Ungerechtigkeiten des Brandenburger Kommunalwahlergebnisses, was die einstigen Vereinigungsbefürworter in der Minderheit und deren Gegner in der Mehrheit sähe, zeugte von Ignoranz und Selbstgerechtigkeit. Dabei hatte das westliche politische System auch in Brandenburg einen großen Erfolg erzielt. All der Frust über die empfundenen Erniedrigungen der Menschen im Osten wurde gebündelt durch eine parlamentarische Partei und in geradezu klassischer Weise in die repräsentative Versammlung der Gebietskörperschaft transmissioniert. Alles ging nach guten demokratischen Regeln vonstatten. Was wollte man eigentlich mehr angesichts einer noch nicht vollendeten deutschen Einheit? Ohne politische Bildung im westlichen Sinne und trotz der Erfahrungen unter der SED-Diktatur hatten sich die Brandenburger in einer schlimmen moralischen und wirtschaftlichen Krise als passable Demokraten erwiesen. Daß dies von der Politik im Westen nicht gesehen wurde und die Wähler stattdessen Vorwürfe hörten, zeugte von der Ferne dieser Politik von einem Teil ihres Veranwortungsbereiches. Potsdam war keine Eintagsfliege, und die Republik mußte sich an die Erfolge der neuen Partei im Osten gewöhnen. Anfang 1996 stellte die PDS etwa 6000 Parlamentarier in den Kommunen sowie landauf, landab in der früheren DDR 180 Bürgermeister. Diese gehörten innerparteilich meist zu den "Realos", also jenen, die alte Ideologien über Bord werfen und pragmatische Politik machen wollten. So wurde der Bürgermeister von Neuruppin im Brandenburgischen mit den Worten zitiert: "Es spielt überhaupt keine Rolle, daß ich in der PDS bin." Und einer der PDS-Bezirksbürgermeister in Berlin, Uwe Klett im Bezirk Hellersdorf mit vierzig Prozent PDS-Stimmen im Rücken, spottete öffentlich über die "Staatsgläubigkeit " seiner Genossen, forderte gar "Wettbewerb in der Verwaltung". Solchen Politikern freilich standen in der Mitgliederschaft der Partei DDRNostalgiker gegenüber, die Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung gleichermaßen als Folge der uneingeschränkten Profitgier der Kapitaleigner sahen. Bei den Wahlen der Jahre 1994/95 setzte die PDS ungeachtet ihrer inneren Zerstrittenheit ihre Erfolge in den Ländern des deutschen Ostens fort. Aber innerparteilich öffnete sich von 1991 bis 1995 eine Schere zwischen der Zahl der Mandatsträger und der Mitgliederstärke der PDS. Die Mitgliederzahl sank einerseits von rund 173.000 auf 120.000 im Jahre 1995, aber durch gute Wahlergebnisse, zuletzt in Berlin, verfügte die Partei andererseits über 159 Mandate im Deutschen Bundestag sowie in den Landtagen Ostdeutschlands und der Hauptstadt. Während unter den Aktiven besonders den Medien viele jüngere Mitglieder auffielen – unter anderem die Anführerin der dogmatischen "Kummunistischen Plattform", die sechsundzwanzigjährige Sahra Wagenknecht oder die aus der Arbeitsgemeinschaft "Junge GenossInnen" stammende dreiundzwanzigjährige stellvertretende PDS-Vorsitzende Angela Marquardt – sah es an der Basis grauer aus. 60 Prozent der PDSMitglieder hatten 60 und mehr Lebensjahre hinter sich, während der entsprechende Seniorenanteil in der CDU 35 und in der SPD 26 Prozent betrug. Derweil in der Partei über mögliche Koalitionen mit der SPD oder den Grünen gestritten wurde, und in Sachsen-Anhalt die Duldung einer rot-grünen Landesregierung fast schon Alltagsroutine war, schreckten meist aus der SED hervorgekommene Grauköpfe junge Sympathiesanten ab, der Partei beizutreten. Selbst die Aussicht auf eine schnelle Karriere konnte die Abneigung gegen die alten Genossen nicht kompensieren. Die PDS war beispielsweise in Brandenburg mit 17.950 Mitgliedern die mitgliederstärkste Partei, jedoch nur 2,7% dieser Mitglieder war jünger als 30 Jahre. Der entsprechende Anteil war bei der SPD 7,2% und bei der CDU 5%. Im gleichen Jahr konnte die Landespartei 117 Neuaufnahmen verzeichnen, während 47 es die CDU auf 712 und die SPD auf 253 neue Mitglieder brachte.50 Die PDS könnte eines Tages von der Mitgliederschaft her austrocknen. So könnte der Zeitpunkt kommen, an dem die im Osten Deutschlands 1995 noch mit rund zwanzig Prozent der Wähler triumphierende Partei von innen her abbrennt. Eine wider Erwarten doch einsetzende Angleichung der politischen Kultur des Ostens an den Westen würde diesen Prozeß geradezu entfachen. Diese Krise könnte ab dem Jahre 2000 auf die PDS zukommen. 51 Das Jahr der Wende in der DDR, 1989, ist auch das Geburtsjahr der PDS. 52 Auf ihrem Sonderparteitag im Dezember mutierte die abgewirtschaftete Staatspartei SED zunächst zur "SED-PDS" und wenig später zur "Partei des Demokratischen Sozialismus" (PDS). Noch zwei Monate zuvor hatte sich die autistische Führungsclique der DDR-Staatspartei vor winkenden Bürgern zum 40. Jahrestag der DDR feiern lassen. Aber im Volke brodelte es. Die Menschen gingen in den Städten Ostdeutschlands auf die Straße. Die westdeutschen Botschaften in den kommunistischen Nachbarländern der DDR waren voll von Flüchtlingen. Es gründeten sich mit dem "Neuen Forum" und der sozialdemokratischen "SDP" neue Parteien, mit deren Vertretern die alten Kader der SED sich nun an einen "Runden Tisch" setzen mußten. Jetzt trauten sich die eingebildeten Kronprinzen der SED aus der Deckung. Am 18. Oktober mußte Erich Honecker zurücktreten, und Egon Krenz trat als Staats- und Parteichef an seine Stelle. Aber auch er war zu spät gekommen. Im Eiltempo der Revolution verlor er seine Ämter, und wie sein alter Vorgänger flog er obendrein aus der Partei. Hans Modrow, neuer Ministerpräsident der DDR und Rechtsanwalt Gregor Gysi waren im Dezember 1989 die Männer der Stunde. 2700 Delegierte, die über zwei Millionen Parteimitglieder repräsentierten, waren nach Berlin gekommen, um die Frage zu entscheiden, ob die SED aufgelöst werden sollte. Modrow und Gysi kämpften gegen die Auflösung. Gysi beschwor die Delegierten: "Die Auflösung der Partei und ihre Neugründung wäre m.E. eine Katastrophe für die Partei. All jene, die sich in den letzten Wochen im ganzen so engagiert haben für die Erneuerungen ihrer Partei, würden wir enttäuschen. Sie wollen doch unsere und nicht irgendeine Partei retten. Mit welchem Recht sollten wir uns alle einer politischen Heimat berauben?" Die Tatsache, daß die PDS aus der SED hervorgegangen ist und keine Neugründung war, wurde ihr in der Folgezeit von den politischen Gegnern vorgehalten. Angesichts der "Sünden" der SED sprach man der PDS die demokratische Satisfaktionsfähigkeit ab. Die Wahlerfolge der Partei behinderte das jedoch nicht. Für die Mehrzahl der zwei Millionen Mitglieder vom Dezember 1989 blieb die PDS in den kommenden Jahren nicht die "politische Heimat" für das Parteibuch, wohl aber für den Stimmzettel. Ob dieser Erfolg auch im Falle einer Neugründung gekommen wäre, ist offen. Gegner der Partei behaupten, Modrow und Gysi hätten die Kontinuität deshalb nicht abgebrochen, weil man das erhebliche Parteivermögen retten wollte. Daß daran etwas war, offenbarte sich im Jahre 1990, als aufgedeckt wurde, daß hohe PDS-Funktionäre versucht hatten, Parteivermögen beiseite zu schaffen. Immerhin: Gysi betonte, getäuscht worden zu sein und bot seinen Rücktritt an, der allerdings von der Partei nicht angenommen wurde. Aber viele Mitglieder verließen zu dieser Zeit die Partei. Wie sehr die PDS Teile der Bevölkerung der früheren DDR ansprach, hatten schon die Volkskammerwahlen im März 1990 gezeigt, als die Partei 16,4% der Stimmen bekam und damit den Platz drei hinter der CDU und der 50 Der Tagesspiegel, 5.3. 1996, S. 12, Jugend zieht eher zu SPD und CDU 51 Der Spiegel, Nr. 3 1996, S. 40 ff 52 Zum folgenden s. Heinz Beinert (Hg.), Die PDS – Phönix oder Asche?, Eine Partei auf dem Prüfstand, Berlin 1995 48 SPD einnahm. Bei der ersten gesamtdeutschen Wahl im Dezember 1990 hätten die CDU/CSU, die SPD und die FDP die PDS liebend gerne durch die Fünfprozentgrenze aus dem Deutschen Bundestag ferngehalten, doch das Bundesverfassungsgericht verordnete – wie berichtet – die Sperrgrenze jeweils getrennt für Ost- und Westdeutschland. Die PDS zog aufgrund ihrer elf Prozent im Osten (Bundesdurchschnitt 2,4%) in den Bundestag ein, wo man ihnen – ähnlich wie man es zu Beginn mit den Grünen gemacht hatte – prompt den Fraktionsstatus verwehrte. Nach dem Kutzmutz-Spektakel und anderen guten Wahlergebnissen zog die PDS 1994 mit 30 Abgeordneten gegenüber bis dahin 17 in den Deutschen Bundestag ein. Zwar hatte die Partei bundesweit 4,4% der Wählerstimmen erhalten, doch die nun für das gesamte Deutschland geltende Fünfprozentgrenze übersprang die Partei, weil sie im Osten Berlins vier Direktmandate errungen hatte. Der Öffentlichkeit wurde die innere Vielfalt der PDS auf ihrem 4. Parteitag im Januar 1995 gewahr. Ein Parteitagsbeobachter schreibt: "Im Foyer des Konferenzgebäudes glaubte man sich auf einen Jahrmarkt versetzt, im Tagungssaal in ein APO-Teach-in der späten sechziger Jahre."53 Inhaltlich machte vor allem die Kommunistische Plattform von sich reden, die den alten DDR-Dogmatismus verklärte und in Sarah Wagenknecht die Freund und Feind genehme Repräsentantin fand. Die alten Genossen freuten sich über die Prinzipientreue der Enkelin, und für die Gegner der PDS war die "attraktive Philosophiestudentin im Rosa-L.Outfit"54 das geeignete Vorzeigeobjekt: alter Dogmatismus hinter hübscher Maske. Gysi und der neue Parteivorsitzende Lothar Bisky, zugleich Vorsitzender der Brandenburgischen PDS-Fraktion, verhinderten die Wahl der Rosa-Inkarnation in den Vorstand durch ein Ultimatum: "entweder sie oder wir". Aber in Talk-Shows des deutschen Fernsehens wurde die junge dogmatische Sarah/Rosa zum gern präsentierten Medienstar. An der Spitze ist das Bild der PDS bunt. Es gibt zahlreiche Plattformen und Arbeitskreise zu allen Politikthemen. Doch an der Basis sind es vor allem die rüstigen Rentner, alte Kader zumeist, die voller Energie und für die Partei umsonst Stadtteilarbeit leisten, womit sie die Erfolge der Partei gerade in den Berliner Bezirken Hellersdorf und Marzahn vorbereiten. So konnte die PDS bei den Berliner Wahlen 1995 im Osten der Stadt erneut triumphieren. Aber den alten Kämpfern wächst niemand nach, und das Schicksal der Partei hängt mit davon ab, wie lange diese noch die Kärnerarbeit leisten können. Ähnlich wie Manfred Stolpe bei der SPD in Brandenburg so hat auch Gregor Gysi alle gegen ihn gerichteten Vorwürfe, er sei Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes gewesen, abgewehrt. Er spricht von einer Kampagne, bei der sich die Gauck-Behörde, die CDU/CSU und die Bürgerrechtler um Bärbel Bohley verbündet hätten. Immerhin wird die Bürgerrechtlerin und spätere SPD und dann CDU-Politikerin Angelika Barbe mit den Worten zitiert: "Der muß im Bundestag mit Zwischenrufen fertig gemacht werden." Solche Versuche, die DDR-Vergangenheit zu bewältigen, nützen allerdings der PDS mehr als daß sie ihr schaden würden: Sie binden in einer Art Allianz des Trotzes Anhänger an die Partei. Die Stasi-Vorwürfe haben Gysi bei seinen Wählern – hierin ähnlich Stolpe – nicht geschadet. Er selber ist ein großer politischer Kommunikator und eines der wenigen politischen Talente aus dem Osten Deutschlands. Daher sagt er, man wolle ihm schaden, um die PDS zu schwächen. Das provoziert allerdings die Frage, ob die PDS auf so tönernden Füßen steht, daß ihr Erfolg überwiegend einem einzigen Politiker zu verdanken sei. Die PDS hofft, sich als neue, sozialistische Partei im Parteienspektrum der Bundesrepublik etablieren zu können. Dem stehen zwei Hindernisse entgegen: 53 a.a.O.,, S. 18 54 ebenda 49 1. Die rigorose Ablehnung der SED-Nachfolgepartei durch die anderen Parteien. Für die nach wie vor vom Westen beherrschte politische Klasse der Bundesrepublik ist die PDS schlicht nicht gesellschaftsfähig. Da man dort offensichtlich davon ausgeht, daß die PDS ohnehin eine vorübergehende Erscheinung ist, wird sich so bald nichts daran ändern, daß diese Partei geschnitten wird – jedenfalls von der Union, der FDP, der Mehrheit der SPD, auch von vielen Grünen. 2. Mit der Ablehnung durch die politische Klasse korrespondiert die mangelnde Wählerakzeptanz im Westen Deutschlands. Für die Bürgerschaftswahlen in Bremen im Mai 1995 hatte sich die PDS vorgenommen, den ersten Schritt aus der Ost-Diaspora zu tun, und sie engagierte sich dort erheblich. Dennoch erhielt die Partei an der Weser nur 2,3% der Stimmen. Die PDS blieb ostdeutsche Regionalpartei, und eine Frage auf ihre Zukunft ist, ob sie sich jemals aus dieser Begrenzung befreien kann. Jeder Schritt in den Westen gefährdet den Stand im Osten, wo die PDS aufgrund der regionalen Befindlichkeit Zulauf hat. Immerhin: Bei den Abgeordnetenhauswahlen 1995 in Berlin erzielte die PDS im Bezirk Kreuzberg 5,3% der Wählerstimmen und schaffte damit zum erstenmal den Sprung in eine Bezirksverordnetenversammlung des ehemaligen West-Berlins. Doch der soziale Brennpunkt Kreuzberg inmitten der Stadt ist in jeder Weise ein Ausnahmefall. Den wichtigsten Ausbruch aus der parteipolitischen Ächtung schaffte die PDS Mitte 1994 in Sachsen-Anhalt, als sie die Wahl einer rot-grünen Regierung unter Reinhard Höppner unterstützte. Mit dieser Tolerierung wurde in Magdeburg die von der CDU und der Bundes-SPD favorisierte Große Koalition verhindert. Der "Sündenfall" von Magdeburg war für die CDU Anlaß für heftige Polemiken vor allem gegen die SPD, und natürlich geisterte dabei auch das Volksfront-Gespenst durch die Lande. Die SPD fühlte sich in die Enge getrieben und erklärte Magdeburg zur Ausnahme. Aber von sozialdemokratischen Politikern in Schwerin und Potsdam war seitdem immer wieder einmal zu hören, daß man sich eine engere Zusammenarbeit mit der SED-Nachfolgepartei vorstellen könne. Und nicht viel später setzte bei den Grünen eine Diskussion darüber ein, ob die Regierung von Union und FDP mithilfe einer Kooperation von SPD, Bündnisgrünen und der PDS gestürzt werden könne. Es ist nicht auszuschließen, daß die Ächtung der PDS regional durch Kooperationen vor allem mit der SPD im Osten Deutschlands aufgelockert wird. Dadurch würden die innerparteilichen Differenzen zwischen den Reformern und den Dogmatikern in der PDS stärker in das Bewußtsein rücken. Deren Streit ist nicht ausgestanden. Die eigentliche Hypothek der PDS sind die verbliebenen alten Genossen, die nach wie vor den "Klassencharakter der BRD" als Ursache allen Übels sehen, den Pluralismus der PDS für falsch halten und behaupten, die Leistungen der DDR würden durch den antikommunistischen Zeitgeist im vereinten Deutschland zu Unrecht negiert. Es sind jene Leute, die Rang und Status als Teil der DDR-Elite verloren haben, darüber verletzt sind und dies kompensieren, indem sie sich aufführen, als verfügten sie allein über die Wahrheit. Als 1995 38 Mitglieder der PDS – "Intellektuelle" aus DDR-Zeiten – ein Papier unter die Parteimitglieder brachten, das sie mit "In großer Sorge" überschrieben, wehte den Lesern der rüde Geist der einst Mächtigen entgegen. Bleiben diese Gruppen, die zusammen mit den verrenteten Sozialarbeitern vor Ort der Partei Kraft geben, so werden sie deren Gegnern immer wieder als Demonstrationsobjekte der Häßlichkeit der Partei dienen. Verlassen sie wegen eines in ihren Augen überbordenden Pluralismus und ihnen unerträglichen Pragmatismus die Partei, wird es für deren Organisation eng, wenn sie die Bewohner der Plattenbauten in Hellersdorf und Marzahn bei der Stange halten will. Solange die Partei sich nicht an Regierungen beteiligt, was in den Jahren nach der deutschen Vereinigung ihre offizielle Politik war, hat sie trotz ihrer inneren Unausgewogenheiten Erfolge. Sie kann die Gefühlswelt ostdeutscher Wähler ansprechen, die hohe Arbeitslosigkeit beklagen, den Frieden beschwören und den 50 Sozialabbau verteufeln, ohne sich mit praktischer Politik in Widersprüche verwickeln zu müssen. Sie ist in der Opposition und wird im Deutschen Bundestag als Schmuddelkind behandelt. Im Falle einer Regierungsbeteiligung in einem der ostdeutschen Länder oder im Bund müßte sie sich offenbaren, und sie würde dabei entweder ihre Koalitionspartner oder einen Teil ihrer Wählerschaft verprellen. Die Parteiführung will trotz aller Schwierigkeiten die Öffnung der Partei nach Westen. Je mehr Kooperationen – schließlich auch Koalitionen – mit den Altparteien sie erreicht, so ist das Kalkül, desto eher wird der Bann von ihr fallen, und dann hätte sie die Chance, durch fortschreitende innere Vereinigung sinkende Wähleranteile im Osten durch steigende im Westen zu kompensieren. Ein Schritt in diese Richtung war der erste PDS-Parteitag, der nicht in Berlin tagte, sondern auf dem Wege nach Westen, in Magdeburg. Dort wurde das ersehnte Terrain vorsichtig in Augenschein genommen. Der Parteivorsitzende Lothar Bisky sprach davon, es könne "künftig Wahlergebnisse geben, die sowohl eine rechnerische Mehrheit für eine schwarz-rote Koalition als auch eine rechnerische Mehrheit diesseits der Union zulassen". Noch sei es zu früh, schon klar Kurs auf Regierungsbeteiligungen zu gehen, befand Bisky mit Rücksicht auf die innerparteiliche Opposition. Aber ausschließen solle man das auch nicht. "Wir sollten uns hüten, jetzt für alle möglichen Konstellationen der Zukunft Beschlüsse auf Vorrat zu schaffen." Der Parteitag folgte diesem Kurs, der langsam wegführen soll von der ausschließlichen Oppositionsrolle der PDS hin zu einem Partner der SPD und der Grünen, um ein Politikmodell möglich zu machen, das "aus dem altbundesrepublikanischen Rahmen fällt." 55 Dieses Politikmodell ist der Versuch einer Synthese zwischen west- und ostdeutschen Werten, wobei es im Zweifel wegen der dortigen Wähler auf die ostdeutschen ankommt. Doch es ist eben ein Versuch, aber es wird keine Synthese, wenn beispielsweise klassische Staatsbürgerrechte und soziale Menschenrechte gleichwertig nebeneinander gefordert werden. Zur ersten Kategorie gehören die Grundrechte, zur zweiten das Recht auf Arbeit und auf eine Wohnung. Der Eindruck ist, die PDS verbeuge sich notgedrungen vor dem Grundgesetz, während ihr Herzblut doch der DDR-Ideologie gehört. Weiterhin wird der Parlamentarismus zwar hingenommen, aber gleichzeitig dessen prinzipielle Umgestaltung vorgeschlagen. Harmlos, vielleicht etwas opportunistisch ist die Forderung, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Aber die geforderte 3. Stimme bei allgemeinen Wahlen für eine ständische "Bundeskammer für soziale Bewegungen", wovon Gregor Gysi spricht, würde die Prinzipien des Parlamentarismus aushebeln. 56 Die PDS müßte schon sehr stark werden, wollte sie derlei verwirklichen können. Wird es die PDS schaffen, der Formateur eines neuen Parteiensystems – wenigstens im Osten - der Berliner Republik zu werden? Angesichts ihrer Wahlerfolge traut sie sich offensichtlich diese Rolle zu. Als die Kampagne der PDS gegen die von der Potsdamer Landesregierung und dem Berliner Senat mit viel Aufwand vorbereitete Länderfusion in Brandenburg und in Ost-Berlin für die Partei erfolgreich war und sowohl Stolpe als auch Diepgen als Verlierer dastanden, strotzte die PDS vor Kraft. Es wurden Stimmen laut, daß man nun in die Regierungen drängen solle. Vorsichtige Genossen warnten. Sie wissen, wie wenig ihre Programme umsetzbar sind. So wird die PDS im Osten Deutschlands Sammelbecken derer bleiben, die ihr Verliererdasein betrauern oder solcher, die sich über die Machtübernahme durch den Westen ärgern. Daß es ursprünglich der Osten war, 55 Diese Bemerkung bezieht sich auf Deutschland. Neonationale auch in der FDP sagen, die Entwicklung in Osteuropa und im früheren Jugoslawien zeuge von einer Renaissance des Nationalismus. Jedoch ist hier der Nationalismus ideologischer Rettungsanker gegen den Werte- und Statusverlust ganzer Völkerschaften nach dem Niedergang des Sowjetsystems. Dieser Vorgang ist mit Westeuropa und Deutschland nicht zu vergleichen. 51 der die Einheit wollte, wird längst verdrängt. Wie es aussieht, wird die ökonomische Basis solcher Stimmungen noch lange bestehen bleiben. Die eigentliche Gefahr für die PDS ist die ihr drohende innere Vergreisung. Die Probe für ihre Überlebensfähigkeit wird erst kommen, wenn PDS-Politiker wie Angela Marquardt oder Petra Pau auf sich gestellt – ohne die plumpen oder sublimen DDR-Nostalgiker – die Partei führen müssen. Die alten DDR-Geschichten werden keine Rolle mehr spielen. Aber es ist möglich, daß sich einige Merkmale der Ostmentalität wie das etatistische Sicherheitsdenken in die nächste Generation vererbt. Wenn die PDS dies politisch ausdrücken kann und die anderen Parteien dabei versagen, könnte diese Partei über längere Zeit als ostdeutsche Regionalpartei bestehen bleiben. Allerdings muß sie dafür neue Mitglieder gewinnen, die den natürlichen Rückzug der alten "roten Socken" kompensieren. Ob die PDS „entzaubert“ wird, ist nicht entschieden, nachdem sie über Jahre hinweg in MecklenburgVorpommern und im Land Berlin mit der SPD regiert hat. Es scheint, noch 15 Jahre nach der Vereinigung ist vielen Bürgern der „neuen“ Länder das gefühlte ostdeutsche Milieu so wichtig, dass sich die PDS noch lange Zeit als 3. Kraft im Osten Deutschlands halten wird. 7. Gedenken a) Die bleibende Last Auschwitz ist das Symbol und der Beweis dafür, daß der Staat einer hochentwickelten Gesellschaft die Moral verlieren und zur Organisation des Verbrechens werden kann. Die Nationalsozialisten hatten sich zu Herren über Freiheit und Unfreiheit, über Leben und Tod von Menschen und Völkern in Europa aufgeschwungen. Für den Apparat, mit dem sie das durchführten, ist das Sprachkürzel “KZ” bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Die Einrichtung von Konzentrationslagern war von Hitler lange vor 1933 angekündigt worden. Sofort nach der Machtergreifung entstanden die ersten “wilden” Konzentrationslager - noch unter der Regie der SA. Von Dachau aus und dann über Sachsenhausen errichtete ab Mitte der dreißiger die SS das System der Konzentrationslager. Mit der wachsenden Hybris des nationalsozialistischen Terrors über Europa wucherte dieses System exponentiell und brachte vor allem in Osteuropa die Apokalypse der Vernichtungslager hervor. Die Namen der Konzentrations- und Vernichtungslager, die überall in Europa entstanden, sind uns heute schrecklich geläufig: Dachau, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Theresienstadt, Auschwitz. Die Konzentrationslager und ihre Außenlager befanden sich häufig direkt neben den Arbeits- und Wohnorten der “Zivilbevölkerung”. Wie eine böse Krebskrankheit legte sich das KZ-System über Europa. Und wie bei einer solchen Krankheit wußten oder ahnten die meisten Menschen davon, schwiegen oder verdrängten es jedoch zu allermeist. Die Nazis indes versuchten noch in den Tagen des Untergangs infolge des verlorenen Krieges, das Ungeheuerliche ihre KZ-System vor der Weltöffentlichkeit zu verbergen. Vor den anrückenden Truppen der Sieger trieben sie die verbliebenen und marschfähigen Häftlinge auf Todesmärsche zu Orten, wo diese heimlich ermordet werden sollten. Bei diesen Todesmärschen sind noch einmal Tausende von Menschen ums Leben gekommen. Durch die Befreiung der Lager wurde die Menschheit über das KZ-System informiert. Ein weltweiter Schock war die Folge. Das ist jetzt 60 Jahre her. Nach Kriegsende nutzten die Siegermächte einen Teil der ehemaligen Lager der Nationalsozialisten als Internierungslager. Die Grundlage hierfür war eine Richtlinie im Potsdamer Abkommen von 1945 über die 56 s. Gero Neugebauer/Richard Stöss, Die PDS, Geschichte. Organisation. Wähler. Konkurrenten, Opladen 1996, S. 70ff 52 Inhaftierung Deutscher. Die Amerikaner taten das beispielsweise in Dachau. In der sowjetischen Besatzungszone wurden unter anderem in Sachsenhausen und Buchenwald Internierungslager eingerichtet. Während die Amerikaner die Gefangenen bald vor Gericht stellten oder sie entließen, blieben die Lager in der sowjetischen Besatzungszone - häufig versehen mit dem Kürzel des sowjetischen Geheimdienstes “NKWD” - bis 1950 bestehen. Es war ihren Insassen bei Androhung schwerer Strafen verboten, über das Lagerleben zu sprechen, auch nach der Entlassung. In diesen Internierungs- und Speziallagern kamen Tausende von Menschen infolge von Unterernährung und Krankheit, aber auch als Opfer der Lagerherren, um. Noch nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums war das Thema für viele Menschen, die damit zu tun hatten, tabu. Die Furcht saß tief. Gedenkstätten zur Erinnerung an die Konzentrationslager der Nationalsozialisten wurden sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland in den fünfziger und sechziger Jahren errichtet. Die politischen und ideologischen Voraussetzungen hierfür jedoch waren in beiden Teilen Deutschlands sehr unterschiedlich. Hatten die Siegermächte zunächst beispielsweise durch die Kriegsverbrecherprozesse gemeinsam mit einer Aufarbeitung des Nationalsozialismus begonnen, so trennten sich die Wege doch sehr bald. In Westdeutschland bemühten sich vor allem die Amerikaner durch ein “Reeducation”-Programm um eine demokratisch-liberale Sozialisation der Deutschen. Im Osten etablierten die Sowjets eine Diktatur nach ihrem eigenen Muster mit Hilfe deutscher Gefolgsleute. Die Sowjetzone und spätere DDR begriff sich offiziell als “antifaschistisch”, und dadurch gab es wenig Veranlassung zu einer inneren Auseinandersetzung mit der eigenen Nazi-Vergangenheit. Der “verordnete Antifaschismus” verhinderte bei der “normalen” Bevölkerung eine eigenständige Beschäftigung mit der Zeit von 1933 bis 1945. Zu gerne zog man aus der offiziellen Staatsdoktrin den Schluß, selber mit dieser Zeit nichts zu tun zu haben und nunmehr auf der richtigen Seite zu stehen. In der Bundesrepublik dagegen fand eine - wenn auch ambivalente - innere und nach außen gerichtete Auseinandersetzung statt. Einerseits leistete die Bundesrepublik materielle “Wiedergutmachung” in beachtlichem Umfang, andererseits waren hier ehemalige Funktionäre des Nazis-Regimes an entscheidenden Stellen des Verwaltungs- und Regierungsapparates tätig. Die bürgerlichen Parteien bemühten sich um eine Integration ehemaliger Parteigänger in die neue gesellschaftliche Ordnung. Die Frage der Verjährung nationalsozialistischer Verbrechen wurde mehrmals kontrovers und gelegentlich auf hohem Niveau diskutiert. Innerhalb der DDR dagegen hatte es derartiges nicht gegeben. Mit der Antifaschismus-Ideologie glaubte man offensichtlich, sich an der Geschichte “vorbeimogeln” zu können. Die Errichtung von KZ-Gedenkstätten hatte noch weitere Bezüge. In den Konzentrations- und Vernichtungslagern hatten Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus gelitten. Insgesamt waren es mehr Ausländer als Deutsche. Die Nationalsozialisten hatten Juden ermordet, um das ganze Volk “auszurotten”. Ebenso geschah es den Zigeunern - Sinti und Roma wurden allein wegen ihrer Volkszugehörigkeit getötet. Auch tatsächliche und vermeintliche politische Gegner wurden verfolgt, gequält und ermordet. An den Völkern des Ostens, Polen und Russen zumal, versündigten sich die Nazis aufgrund ihrer bornierten Rassenideologie, indem sie auch diese schunden, “minderwertiger” behandelten als die eigene angeblich “nordische” Rasse. In Sachsenhausen machte man sich nicht einmal die Mühe, die Tausenden ermordeter sowjetischer Soldaten namentlich zu registrieren. Die Einrichtung von Gedenkstätten an den Orten früherer KZ`s richtete sich gegen das Vergessen. Es gab aktive Bürgergruppen wie die “Aktion Sühnezeichen”, die aus moralischer und politischer Überzeugung an die Zeit von 1933 bis 1945 gemahnen wollte. Ehemalige Häftlinge und ihre Angehörigen, ihre zahlreichen Verbände und Komitees vor allem erzeugten zusammen mit solchen Bürgergruppen in den fünfziger und sechziger Jahren erheblichen öffentlichen Druck zur Errichtung für die Gedenkstätten und gegen das fortschreitende Tilgen der 53 einstigen Folterplätze. Das geschah in beiden Teilen Deutschlands gleichermaßen. Die offizielle Politik der Bundesrepublik führte die Gedenkstätten im Rahmen ihrer Wiedergutmachungspolitik ein. Eine wichtige Rolle in der politischen Kultur der Bundesrepublik hatten sie nicht. An bestimmten Gedenktagen wie dem 20.Juli wurden sie von Politikern aufgesucht. Oder man ging dorthin in der Begleitung von Staatsgästen, wenn diese das gewünscht hatten. Den meisten Bürgern indes waren die Gedenkstätten wohl nur von den Hinweisschildern an den Autobahnen bekannt. Einzelne Gruppen jedoch kümmerten sich sehr intensiv darum, insbesondere viele Menschen unterschiedlichsten Alters aus dem Ausland. In der DDR andererseits wurden die Gedenkstätten in das Herrschaftssystem eingebaut. An diesen Orten sollte gezeigt werden, daß es eine Form des heroischen und schließlich siegreichen Widerstandes gegeben habe, den der Kommunisten. Ihrer Helden wurde bei feierlichen Anlässen wie der Jugendweihe oder der Vereidigung der Volksarmee gedacht. Die deutschen Gedenkstätten im Osten waren auch Orte für Massenveranstaltungen des kommunistischen Systems. Entsprechend waren sie konzipiert, mit Aufmarschalleen, großen Plätzen und monumentalen Statuen. Während man nach der Wiedervereinigung die originalgetreue Rekonstruktion verbliebener Anlagen anstrebte, hatte man in der DDR die Anlagen nach eigener Philosophie überbaut und auch so den Sieg des Sozialismus über den Faschismus demonstrieren wollen. Auch bei der Darstellung der Geschichte - in Ausstellungen und Filmen - kam es mehr auf die richtige Lehre als auf die historische Genauigkeit an. Von solcher staatlichen Erhöhung waren die Gedenkstätten im Westen nicht belastet. Sie konnten sich allerdings mit bescheidenen Mitteln - um die geschichtliche Wahrheit bemühen. Die große Öffentlichkeit nahm davon wenig Notiz. Unter Schulbürokraten und Lehrern herrschte Uneinigkeit über Verbindlichkeit und Sinn von Schülerbesuchen in Gedenkstätten. West-Berlin konnte sich nie darauf verständigen, Schülerfahrten zu Gedenkstätten obligatorisch durchzuführen. Widerstand kam vor allem aus der Schulbürokratie. Die KZ- Gedenkstätten lagen in der DDR oder in der Volksrepublik Polen, und der Antikommunismus vieler Bürokraten war offensichtlich stärker ausgebildet als das Bedürfnis, der Jugend die Verbrechen der Nazis vor Augen zu führen. Gedenkstätten wie zum Beispiel Plötzensee gerieten darüber hinaus in Gefahr, zu Alibiorten der Bundesrepublik zu werden, wenn es galt zu zeigen, daß man “aus der Geschichte gelernt” habe. Für die Opfer und ihre Angehörigen haben die Gedenkstätten in Ost und West immer einen sehr hohen persönlichen Wert. Diese Menschen wollen ihrer toten Leidensgenossen, Verwandten und Freunde gedenken und die deutsche Gesellschaft mahnen, daß sie auf der Hut sei, ähnliche Entwicklungen wie in der dreißiger Jahren zu vermeiden. Diese Menschen und ihre Organisationen finden großes Gehör in allen Ländern West- und Osteuropas, in den Vereinigten Staaten und natürlich in Israel. Sie machen deutlich, daß die Gestaltung der Gedenkstätten keine deutsche Angelegenheit allein ist. Seit der deutschen Wiedereinigung erscheinen die Gedenkstätten in neuem Licht, und es tun sich neue Probleme auf. 1. In der deutschen Bevölkerung gibt es eine weit verbreitete Reserve gegen Gedenkstätten - sowohl im Osten als auch im Westen. Geradezu im Gegensatz dazu existieren jedoch verschiedene Gruppen, welche Gedenkstätten für notwendig und nach der deutschen Wiedervereinigung für ausbaubedürftig halten. Normalerweise formulieren die Menschen ihre Zurückhaltung den Gedenkstätten gegenüber eher in privaten Gesprächen - öffentlich sind sie nicht aktiv. Es dürfte wohl die Mehrheit der Deutschen sein, die Gedenkstätten und eine entwickelte Gedenkkultur ablehnen, und diese Skeptiker sind in allen Schichten zu vermuten. Die 54 Befürworter der Gedenkstätten dagegen sind sehr aktiv und entsprechen den Normen der offiziellen politischen Korrektheit. In latente und manifeste Konflikte geraten sie immer wieder mit Einwohnern jener Orte, an denen sich Gedenkstätten befinden. 2. Ausländische Persönlichkeiten, andere Staaten und internationale Organisationen achten seit 1990 mehr als früher auf die Entwicklungen in der Gedenkkultur Deutschlands. Für sie ist der Umgang des nunmehr größeren Deutschlands mit den Mahnmalen der nationalsozialistischen Vergangenheit ein Indikator dafür, ob das vereinte Deutschland eines Tages wieder geneigt sein könnte, sich zum Richter über andere Völker und Staaten aufzuzwingen. 3. Infolge der Überbetonung des kommunistischen Widerstandes in der untergegangenen DDR wurde in den östlichen Gedenkstätten die Entwicklung neuer Arbeitskonzepte erforderlich. Der Zentralrat der Juden in Deutschland, der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma, christliche, sozialdemokratische, gewerkschaftliche Opfergruppen, Schwuleninitiativen, Zeugen Jehovas und viele andere wollen nun, daß in den Gedenkstätten des Ostens auch der Leiden ihrer Gruppen gedacht wird. Zugleichen haben sich Wissenschaftler - Historiker zumal aufgemacht, die Geschichte der KZ`s gründlich zu erforschen, denn die Wissens- und Materiallücken hierüber sind erstaunlich groß. Dabei ist eine schwierige Diskussion innerhalb der Gedenkkultur entstanden: Die Nationalsozialisten hatten sich vor allen das Ziel der “Ausrottung” der Juden gesetzt. An diesen haben sie sich vergangen, und sie haben dem jüdischen Volk größte Schmerzen zugefügt. Wie aber soll der Opfer gedacht werden, die keine Juden waren? Mußten nicht die Sinti und Roma das gleiche Schicksal erleiden wie die Juden, und welchen Unterschied macht es, daß ihr Volk kleiner und weniger einflußreich ist? Ein schwieriger Streit auch zwischen den Opfergruppen - ist entstanden. Wer sollte ihn schlichten? Gedenkstätten und andere Institutionen des Gedenkens werden in Zukunft mehr Offenheit und Kontroversen bei sich dulden müssen. Nur so können sie glaubwürdig sein, auch wenn sie dabei etwas von ihrer weihevollen Würde verlieren. 4. Die Internierungslager der Sowjets nach 1945 müssen beachtet und gewürdigt werden. In diesen Lagern waren ehemalige Nationalsozialisten, zufällig Denunzierte und politische Gegner des sowjetischen Systems gefangen. Auch Jugendliche um die Fünfzehn waren unter den Häftlingen. Daß diese Lager eingerichtet wurden, ist offensichtlich eine Folge des Nationalsozialismus und seiner Niederlage. Wieder wurden Menschen ohne rechtsstaatliche Verfahren gefangen, gequält, getötet. Zwar geschah das nicht in dem industriell angelegten Vernichtungssystem der Konzentrationslager - aber durch Zusammenpferchen, bewußt herbeigeführten Mangel, durch Epidemien und Drangsalierungen wurden Menschen terrorisiert und zerbrochen. Wie nun soll in Gedenkstätten wie Buchenwald oder Sachsenhausen, wo auf die Konzentrationslager die Internierungslager folgten, die Nachkriegsgeschichte dargestellt werden? Wie soll der Opfer der sowjetischen Lager gedacht werden, von denen doch einige Mitläufer oder sogar Täter bei den Nationalsozialisten gewesen waren? Das sind Fragen, die mehr die deutsche als die internationale Öffentlichkeit angehen. Sie betreffen jedoch ein wichtiges Kapitel der Geschichte der DDR und berühren die persönlichen Schicksale Tausender von Menschen. Viele wehren sich gegen Gedenkorte für die Internierungslager an den Orten, die auch KZ-Gedenkstätten sind. Der Opfer und möglicher Täter könne nicht zugleich und am gleichen Ort gedacht werden, so wird argumentiert. Doch die Geschichte muß gezeigt werden, wie sie war. Ist es nicht wichtig zu wissen, daß in Sachsenhausen beispielsweise die KZ-Baracken nach 1945 als Lager fortgenutzt und daß man sich der Funktionsräume wie etwa einer Küche vor und nach Kriegsende gleichermaßen bediente? 5. Weiterhin sind die Gedenkstätten, wie sie aus der Bonner Republik und der DDR überkommen sind, selber ein Stück deutscher Geschichte. Da der deutsche Vereinigungsprozeß sich insgesamt an den Maßstäben des Westens 55 orientierte, hätte man vermuten können, daß auch bei den Gedenkstätten alle Spuren in Gestaltung und Darstellung, wie sie aus der DDR gekommen waren, getilgt worden wären. Dieser Weg ist aber nicht gegangen worden - in Buchenwald nicht und schon gar nicht in Sachsenhausen und Ravensbrück. Die jeweils Beteiligten waren sich grundsätzlich einig, die Gestaltung der DDR-Gedenkstätten behutsam zu verändern und im Falle der Beseitigung einzelner Ensembles zu musealisisieren und dokumentieren. Wichtig ist es, heute die monumentale Gestaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten zu erläutern und das Gedenkstättenwesen in der DDR als Teil des Herrschaftsapparates des untergegangenen Systems zu studieren. 6. Heikel ist das Thema des räumlichen Umfanges und der Anzahl der KZ-Gedenkstätten und der Gedenkorte. Der Stadtteil Sachsenhausen von Oranienburg beispielsweise ist durch SS-Bauten, die alle einen unmittelbaren Bezug zum KZ-System haben, geprägt. Die Gebäude - Kasernen, Verwaltungs- und Produktionshäuser - wurden in DDR-Zeiten von Institutionen wie der Nationalen Volksarmee, ihren Angehörigen - aber auch der “HO” (“Handelsorganisation”) - genutzt. Heute residieren dort das Finanzamt Oranienburg, der Polizeipräsident Oranienburg, die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Die anrainenden Wohnhäuser waren für das SSPersonal errichtet worden und werden nun zum guten Teil von ehemaligen NVA-Leuten genutzt. Über die städtebauliche Nutzung des trotzdem weitgehend brach liegenden Areals haben die Landesregierung und die Stadt einen Wettbewerb veranstaltet, der aber auch den nicht gewünschten Effekt gebracht hat: Seitdem die Absicht der Gedenkstättenstiftung bekannt ist, das gesamte Areal unter Bereichsschutz zu stellen, gibt es heftige Bürgerproteste von Anwohnern dagegen, und auch Konflikte zwischen den wenigen Gewerbetreibenden in der Nähe und der Gedenkstätte sind nicht ausgeblieben. Doch damit nicht genug: Im Kernbereich der Stadt Oranienburg war 1933 von der SA eines der ersten “wilden” KZ`s errichtet worden. Neben anderen wurde hier der Anarchist und Schriftsteller Erich Mühsam ermordet - in der Nacht vom 9. zum 10. Juli 1934. Nach 1990 sollte fast an gleicher Stelle ein Polizeigewahrsam ausgebaut werden. Würde das möglich sein? Die Liste solcher Probleme an den Originalorten des nationalsozialistischen Terrors könnte verlängert werden. Große Teile der Verwaltung der Stadt Berlin beispielsweise müßten sich nach neuen Behausungen umsehen, wollte man sämtliche von den Nazis errichteten oder genutzten Bürogebäude für tabu erklären. Die Kunst des Handelns kann nur darin bestehen, einige besondere Orte als Gedenkstätten zu bewahren und andere belastete Gebäude für das allgemeine Gesellschaftsleben zur Verfügung zu stellen. Dabei spielt allerdings die Art der Nutzung ebenso eine Rolle wie geklärt werden muß, wo welche Hinweise - etwa in der Form von Tafeln angebracht werden sollten. Dabei gibt es Grenzen: Es ist nicht vorstellbar und wäre sinnwidrig, ganze Städte mit Gedenktafeln zu übersäen. 7. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden Gedenkstätten besonders im Osten Deutschlands zu Orten rechtsradikaler Aktionen. Daß die Sicherheitsvorsorge der Gedenkstätten auch in Kooperationen mit der Polizei daraufhin verbessert wurde, schützt Deutschland vielleicht vor peinlichen Zwischenfällen, löst aber das Problem des wiederentstehenden Rechtsradikalismus nicht. Vor Asylheimen, in den S- und U-Bahnen, in Jugendclubs und Gaststätten und leider auch bei der Bundeswehr breiten sich Rechtsradikale aus, werden brutaler und dreister. Daß sie auch in die Gedenkstätten ziehen, dort Hakenkreuze malen, den “Hitlergruß” zeigen und sogar Feuer legen, belegt, daß die Tabuwirkung der authentischen Orte des Terrors begrenzt ist. Auch ist zu beobachten, daß in den Gedenkstätten selber eine gewisse Hysterie entsteht, wodurch Falsche in den Verdacht des Rechtsradikalismus geraten können. Eine Debatte darüber, ob und was die Gedenkstätten zum Erhalt einer liberalen politischen Kultur beitragen können, hat nicht stattgefunden. 56 8. Auffällig ist, daß die Gedenkkultur mehr und mehr von einer begrenzten Schicht bürgerlicher Intellektueller getragen wird, die geradezu den Idealtypus politischer Korrektheit verkörpern. Diese “Szene” löst die alte Garde der ehemalgen Häftlinge ab, die sich für den Erhalt vor allem der baulichen Überreste der Konzentrationslager als weihevolle Mahn- und Gedenkorte eingesetzt hat. Die Inszenierungen der “Ehemaligen” wirken heute emotional überfrachtet und - wie bei den immer wiederkehrenden Fahnenzeremonien - altväterlich. Etwas im guten Sinne Dilettantisches haftet den Ergebnissen ihrer Arbeit an. Die Träger der Gedenkkultur in der neuen Generation dagegen sind stärker ästhetisch, musealisch und wissenschaftlich orientiert. Sie lösen sich von den authentischen Orten und der “oral history”, wollen neue Denkmäler, Ausstellungen und Museen schaffen. Die besten Künstler der Welt sollen ihnen dazu die Entwürfe liefern. In einem schlechten Sinne sind sie Professionelle, denn anstelle eines Holocaust-Museums oder -Denkmals könnten sie auch die Entwürfe für ein Kunstgewerbe-Museum oder Karajan-Denkmal besorgen. Mit den Widrigkeiten der authentischen Orte draußen im Lande wollen sie sich nicht abgeben - ihre Arbeit soll in den Metropolen sein, möglichst in der Hauptstadt und dort unmittelbar im Regierungsviertel. Den tapferen Kameraden des Überlebens folgen Chicki-Mickis des Gedenkens! 9. Durch die Verlegung der Hauptstadt von Bonn nach Berlin erhalten die aktuellen West-Berliner Gedenkstätten Auftrieb. Von der “Topographie des Terrors” bis zum “Holocaustmahnmal” wurden hier Projekte entwickelt, die der einstigen Insel West-Berlin hatten helfen sollen, unter anderem als Geschichts- und Museumsort der alten Bundesrepublik eine Überlebensfunktion zu finden. Nach der Wiedervereinigung entstehen in der Hauptstadt so viele Gedenkorte wie nirgendwo sonst in Deutschland. Quantitativ wird Berlin Gedenkhauptstadt. Sollten sich die einzelnen Gedenkstätten künftig zu einem inhaltlichen Arbeitsverbund finden, so wird dem auch eine entsprechende Qualität folgen. 10. Bleibt die Frage nach den Aufgaben der Gedenkstätten im vereinten Deutschland. Zu allererst sollen sie Orte der Erinnerung und des Ehrens der Opfer sein. Sie können darüber hinaus als Originalorte - “steinerne Zeugen”einiges beitragen zur Veranschaulichung des Wirkens der SS und des KZ-Systems. Weiterhin sind sie national und international gesehen Zeichen des offiziellen deutschen Willens, die Verbrechen in der eignen Geschichte nicht zu verdrängen. Damit dieses Zeichen bleibt, werden die Gedenkstätten aus öffentlichen Kassen finanziert. So aber werden die Gedenkstätten Anhängsel von Politik und Verwaltung. Sie sind gewissermaßen die für die Bewältigung der Vergangenheit zuständige Sparte des deutschen Verwaltungs- und Regierungssystems. So kommt es, daß nicht sie die Diskussion über die Gedenkkultur in Deutschland bestimmen, sondern die historisch und museal ambitionierte Szene der Gutmenschen des Gedenkwesens und deren politische Sprachrohre. Es ist daher notwendig, die Arbeit der Gedenkstätten, ihr Verhältnis zueinander und ihre Einbindung in die gesamte Gedenkkultur zu überdenken. Im Innern muß einiges reformiert werden, und trotz des organisatorischen Egoismus jeder einzelnen Gedenkstätte muß ein Verbund zwischen ihnen allen geschaffen werden. Die Gedenkstätten müssen ihre Aufgabe darin sehen, mit ihren Darstelllungen tiefer als bisher in die Gesellschaft hineinzuwirken. Es ist auffällig, daß in Brandenburg, dem Bundesland mit den meisten KZGedenkstätten, Rechtsextremismus bei Jugendlichen mit den besten Nährboden in der Republik hat. Obwohl die Gedenkstätten gerade für die Potsdamer Landesregierung Teil des speziellen “Brandenburger Weges” sind, geht von ihnen offenbar keine die Gesellschaft humanisierende Wirkung aus. Die Gedenkstätten müßten in die Lage versetzt werden, selber aktiv jene Zielgruppen anzusprechen, die sich ihnen bisher entzogen haben. Dazu ist eine Kooperation mit Trägern der politischen Bildung und vor allem der Wissenschaft - den Universitäten zumal - notwendig. Künstlerische Mittel und moderne Kommunikationstechnik sollten verstärkt in der 57 Gedenkstättenarbeit eingesetzt werden. In den USA und in Israel ist das Realität. Die Gedenkstätten müssen sich ein Mandat erkämpfen zur Parteinahme in öffentlichen Diskussionen, insbesondere da, wo es um Fragen des Rechtsextremismus , des Schutzes von Minderheiten und um die Geschichte geht. Die heutigen Gedenkstätten können das personell nicht leisten. Daher brauchen sie die Blutzufuhr aus den Universitäten, Schulen und Bildungsstätten. Sie müssen geöffnet werden für berufliche Mobilität. Vor allem wird es wichtig sein, daß die Gedenkstätten der Bevormundung durch ängstliche und dienerisch der jeweils angesagten politischen Linie hinterher hechelnde Verwaltungsmitarbeiter entzogen werden. Zu viele Verwaltungen im Bund und den Ländern fühlen sich für das Gedenkwesen zuständig. Doch aus keinem Ministerium ist je ein großer Wurf für ein Projekt gekommen, sondern nur dienerisches Bemühen um angepaßt politische Korrektheit. Wenn die Bürokraten die Gedenkstätten weiterhin bei der Kandare halten, sollte man den Steuerzahler lieber von der Finanzierung dieser Einrichtungen befreien. Geist, Witz, Wagemut scheitern immer an der Bürokratie, und so brauchen die Gedenkstätten im vereinten Deutschlands vor allem eins: Freiheit des Geistes ihrer Entscheidungsträger. Gedenken und Gedenkstätten sind im vereinten Deutschland zu einem öffentlichen Thema geworden. Das ist kein Spezialthema für Karrierehistoriker - auch Politiker, Diplomaten, Künstler, Sozialwissenschaftler haben in dem Diskurs um die Zukunft des Gedenkwesens Wichtiges mitzuteilen. Vor allem die politischen Parteien sollten sich bei der Entwicklung der Gedenkkultur in Deutschland engagieren und das Feld nicht anderen überlassen. Ein politischer Diskurs etwa, der sich um die Ablehnung eines Gedenkprojektes durch eine politische Partei ranken würde, ist allemal demokratischer als den mittleren Rängen der Ministerien freie Bahn zu lassen. So gesehen ist der Gedanke richtig, nicht den Bundeskanzler oder die Regierung über ein Holocaust-Mahnmal entscheiden zu lassen, sondern den Deutschen Bundestag - nach gehörigem Diskurs dort. Das Land braucht nach den vielen Expertentreffs eine allgemeine parlamentarisch-politische Debatte über Sinn und Form des Gedenkens. Über fünfzig Jahre nach der Befreiung ist es an der Zeit, über die deutschen Grenzen zu schauen, um zu erkennen, welchen Stellenwert die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anderswo hat. Mit Yad Vashem in Jerusalem und dem Holocaustmuseum in Washington sind Institutionen entstanden, welche die Frage in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt haben, wie aus einer Kulturnation die größten System- und Staatsverbrechen des Jahrhunderts werden können. Mehr und mehr wird diese Frage nicht nur historisch, sondern auch sozialwissenschaftlich untersucht: Was kann - kann überhaupt etwas - getan werden, um Wiederholungen hier oder anderswo zu verhindern? Die Rassenkrawalle von Los Angeles haben der Supermetropole, haben ganz Amerika wieder einmal vor Augen geführt, wie dünn das Eis der Zivilisation ist. Die Verbrechen des Nationalsozialismus werden mehr und mehr zum Studienobjekt als Beispiel eines absoluten Werteverfalls. Daraus möchte man Schlußfolgerungen ableiten für die Möglichkeiten der Immunisierung der heutigen Gesellschaften gegen erneuten Terror, gegen Mord und Genozid. Zunehmende Bedeutung gewinnen dabei Erkenntnisse wie die, daß Worte die Welt nicht nur zum Guten, sondern oft viel schneller, zum Bösen verändern können. Das Abgleiten in die Unkultur beginnt mit geringschätzigen und feindlichen Bemerkungen über Minderheiten oder mit rassistischen Sprüchen im privaten Bereich. Es scheint, daß die deutschen Gedenkstätten ebenso wie die deutschen Wissenschaften immer noch nicht den Anschluß an die internationale Diskussion über die Immunisierung unserer Kulturen gegen Barbarei gefunden haben. Über fünfzig Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus aber sollte man ausgehend von den Originalstätten des Staatsterrors in Deutschland einschwenken auf die Erforschung von Sicherheiten für die 58 Existenz unserer Kulturen. Gerade in einer Welt rasanter wirtschaftlicher und politischer Veränderungen, in einem vereinten Deutschland mit über fünf Millionen Arbeitslosen und einem immer krasser werdenden Gegensatz zwischen Vermögenden und Verarmten ist es aktuell, nach Antworten zu suchen auf die Frage, wie sich die Gültigkeit von humanitären Werten festigen ließe. In einem Bundesland wie Brandenburg, wo brutale Überfälle von unorientierten Jugendlichen auf Ausländer zum Alltag gehören, sind solche Antworten geradezu lebenswichtig. Wohl ausbleiben konnte nicht, daß in dem halben Jahrhundert nach 1945 unter Intellektuellen das Thema einer Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen aufkam. Wissenschaftler - auch Politiker - versuchten, die Motive der massenhaften Täter mit der Methode des wertfreien Verstehens zu erklären. Die Gewichtungen der großen Verbrechen des Jahrhunderts wurden mit gelehrten Worten gegeneinander abgewogen. Dabei wurde der Nationalsozialismus als Reaktion auf den Bolschewismus gesehen. Auf einem anderen Niveau wurde versucht, mit quasi technischen Gutachten darüber zu streiten, ob sechs oder wie viel Juden ermordet wurden - ja sogar, ob Vergasungen in Auschwitz überhaupt hatten stattfinden können. Auf einer Primitivebene politischer Debatten wurde am Ende der Genozid gänzlich geleugnet: “Holocaust-deny” ist in den USA zum festen Begriff geworden. Die Gedenkstätten in Europa sind gegenüber diesen Entwicklungen auf wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen und politischen Feldern wichtige Zeugen dafür, wie ungeheuerlich diese Relativitätsbemühungen sind. An der “Station Z” in Sachsenhausen wie an vielen anderen Orten kann man sehen, welche Grauen da relativiert und “verstanden” werden sollen. Die Gedenkstätten provozieren ein Tabu gegenüber allzu kaltem Drang nach Erklärungen für Taten und Täter. In Deutschland, wo sich der Kulturverfall ereignet hatte, gibt es mit den früheren Konzentrationslagern Orte, die von den Folgen der Rassen- und Machtideologie zeugen. Es ist ein Versäumnis, daß aus diesen Zeugen nicht mehr gemacht worden ist. Es mag zynisch klingen: Dort, wo der Genozid stattgefunden hatte, besteht nicht nur eine besondere Pflicht, gegen Wiederholungen zu arbeiten - nein, die Möglichkeiten hierfür sind besser als dort, wo man nur künstliche Gedenkstätten schaffen kann. b) Jahrestage 1995 war das Jahr der öffentlichen und umfassenden Erinnerung an den Sieg über den Nationalsozialismus und die Befreiung Deutschlands von ihm. Durch die Erinnerungen selber sind in Deutschland einige Entwicklungen forciert worden: Das Problembewußtsein über institutionalisiertes Gedenken wurde geschärft; neonationale Strömungen versuchten, ihre Positionen zu etablieren, und ehemalige KZ-Häftlinge legten vor der Geschichte Zeugnis ab über ihre Leiden. Aber die Beschäftigung mit der Vergangenheit kann im Falle des Nationalsozialismus kein Selbstzweck sein. Auch von der Politikwissenschaft müssen stärkere Anstrengungen übernommen werden, die vor fünfzig Jahren wiedergewonnene politische Kultur in Deutschland immer erneut zu festigen. Als das Vergehen des Gedenkjahres 1995 nahte, kam die Sorge auf, daß seine Wirkung - die öffentliche Reflexion über Ursachen, Ereignisse und Folgen des Nationalsozialismus - nicht lange anhalten würde. Um dem entgegen zu wirken, soll das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin bald geschaffen werden. Auch wollte man in den folgenden Jahren wenigstens einen Gedenktag haben. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte vorgeschlagen, an einem Tag des Jahres des Holocausts besonders zu erinnern. Daraus wurde der 27. Januar als offizieller - aber nicht arbeitsfreier - Gedenktag. 59 Die Gefahr lag darin, daß auch an einem Wochentag Sonntagsreden gehalten werden, daß der 27. Januar angesichts neonationaler Tendenzen zu Problemverschiebungen in der Gesellschaft genutzt wird und eine Alibifunktion erhält. Der Tag wurde kein wirksames Mittel , die Erinnerungen an den Völkermord zu verfestigen – in Brandenburg wurde die DVU, in Sachsen die NPD stark. Die rechten Parteien begannen zu kooperieren. Und die Mehrheit der „demokratischen“ meinte daraufhin, den liberalen Rechtsstaat wieder ein Stückchen aushöhlen zu müssen. Das Denkmal in Berlin sollte - nach dem Willen der Auslober: des Förderkreises um Lea Rosh, des Berliner Senats und der Bundesregierung - 1999 errichtet werden. Seit 1995 sind Zweifel immer wieder geäußert geworden, ob ein derartiges Werk jemals überhaupt die beabsichtigte politische Wirkung wird haben können. Es ist zu hoffen, daß es nun – nachdem es fertig gestellt ist - nicht das Schicksal so vieler anderer Denkmäler teilen muß: Daß man es nicht bemerkt... Die unterschiedlichen Veranstaltungen zum 50. Jahrestag des Kriegsendes hatten in Deutschland eine spezielle Diskussion ausgelöst: Eine Auseinandersetzung darüber, ob der 8. Mai 1945 für Deutschland wirklich ein Tag der Befreiung war. Provoziert wurde diese Diskussion durch eine Anzeige in der Tagespresse: "8. Mai 1945 Gegen das Vergessen": "Einseitig wird der 8. Mai von Medien und Politikern als "Befreiung" charakterisiert. Dabei drohte in Vergessenheit zu geraten, daß dieser Tag nicht nur das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft bedeutete, sondern zugleich auch den Beginn von Vertreibungsterror und neuer Unterdrückung im Osten und den Beginn der Teilung unseres Landes." Zu den Unterzeichnern gehörten Mitglieder vom im Bundestag vertretenen Parteien, auch der FDP. Der Aufruf war zwielichtig formuliert. Zwar wurde mit dem Hinweis auf die "neue Unterdrückung im Osten" der Terror der Kommunisten äußerlich nicht mit dem der Nationalsozialisten gleichgesetzt; hintergründig jedoch wurde dieser Eindruck der Gleichsetzung erweckt. Es ist die Methode, die schon seit Jahren von der rechtsradikalen Presse in Deutschland bekannt ist: Nach den Buchstaben der Texte bewegt man sich noch im Konsens des Grundgesetzes, aber der Geist der Aussagen zwischen den Zeilen verrät neonationale Gesinnung. Diejenigen, die es angeht, verstehen es recht. Wie wenig man aus den Diskussionen von 1995 gelernt hatte, wurde offenbar, als die Verordnetenversammlung eines großen Berliner Bezirks – Steglitz-Zehlendorf – mit den Stimmen der CDU und der FDP 2005 eine Resolution verabschiedete, die den gleichen Tenor hatte wie die Anzeige zum 8. Mai aus dem Jahre 1995. Die Initiatoren des Aufrufs wollen nach wie vor im sich wandelnden Parteiensystem der Bundesrepublik eine neonationale bis rechtsradikale Perspektive eröffnen. Neben dem "linken" Block von SPD und Grünen stellen sie sich einen rechten Block der Union zusammen mit einer rechtsradikalen Partei vor. Für eine derartige Partei hätten sie gerne den Firmenmantel der krisengeschüttelten FDP ergattert, um im seriösen Gewand als Partner der Union Politikern wie Rita Süßmuth oder Heiner Geißler und deren Politik den Garaus machen zu können. Entsprechende Versuche in Hessen und Berlin scheinen jedoch gescheitert zu sein. Umso eifriger wird daran gearbeitet, eine originär rechtsradikale Partei zu gründen, die bundesweit und langfristig erfolgreich ist. Dieses Projekt ist noch nicht gescheitert. Mittels Initiativen wie der Anzeige zum 8. Mai, einem "Berliner Manifest" oder Publikationen wie dem Sammelband "Die selbstbewußte Nation" 57 wollen die Neonationalen das geistige Fundament für ein Bündnis weit rechts von der Mitte schaffen, das sich im deutschen Parteiensystem fest 57 Heimo Schwilk/Ulrich Schacht (Hg.), Die selbstbewußte Nation. "Anschwellender Bocksgesang" und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte, Frankfurt/M. - Berlin 1994 60 etablieren soll.58 Eine Folge davon wäre, daß die Erinnerung an den Nationalsozialismus auch aus der offiziellen Politik heraus zurückgedrängt würde. Anläßlich des Jahres 50 nach dem Untergang des Nationalsozialismus hatte es die unterschiedlichsten Erinnerungs- und Gedenkveranstaltungen gegeben. Diese verschiedenen Veranstaltungen - meist mit ausführlicher Berichterstattung in den Massenmedien - waren für viele der damals Beteiligten Anlaß zur erneuten Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensgeschichten und den traumatischen Ereignissen darin. Wir haben die alliierten Veteranen gesehen, die noch einmal die Landung in der Normandie exerzierten, den Rhein überquerten und sich bei Torgau trafen. Dabei waren 70-jährige Amerikaner im Habitus der Sicherheit, den richtigen Job getan zu haben, und voller Überzeugung, heute seien die Germans o.k.. Beeindruckend waren ehemalige Sowjetsoldaten, die den "großen vaterländischen Krieg" gewonnen hatten und nun den Verfall der Siegermacht Sowjetunion miterlebten, verbunden mit ihrem persönlichem sozialen und materiellen Absturz vor dem Hintergrund eines wiedervereinigten und für ihre Verhältnisse nach wie vor wohlhabenden Deutschlands. Ehemalige deutsche Soldaten dagegen wirkten wie Menschen, die aus einer ihnen fremden Welt berichteten und sehr bedacht waren auf ihren heutigen Status mit seinen Symbolen: Geschichtslose Menschen scheinbar. Frühere Täter hatten sich nicht ins Bild gedrängt, aber aufgesucht wurden sie offensichtlich auch selten. So können wir nur mutmaßen, welche Rolle sie noch spielen und wie sie den Jahrestag empfunden haben: Leben sie voller Scham oder uneinsichtig? Wahrscheinlich sind sie in ihrer Verdrängungsarbeit so weit fortgeschritten, daß sie den 50. Jahrestag gut überstehen konnten. Für Opfer, die überlebt hatten, ehemalige Häftlinge der KZ`s zumal, war der 50. Jahrestag ein elementares Ereignis. 70- und 80-jährige Frauen und Männer aus Polen, Rußland, Frankreich, der Ukraine, aus den USA, aus Israel und vielen anderen Ländern dieser Erde waren im April 1995 in Deutschland, um sich ein halbes Jahrhundert nach der Befreiung der KZ`s an den Orten ihrer Qualen wiederzutreffen. Viele kamen zum ersten Mal wieder. Sie wollten sehen, wie es heute im vereinten Deutschland aussieht. Sie waren voller Angst, Mißtrauen und mit aufgestauten Emotionen gekommen. Die meisten dieser ehemaligen Häftlinge verließen das Land in einem völlig veränderten Gemütszustand. Sie hatten einen guten Eindruck von ihrem Gastland gewinnen.59 Aus der Sicht der Geschichtswissenschaft erfolgte der Besuch der ehemaligen Häftlinge zu einem psychologisch optimalen Zeitpunkt. Es ist bekannt, daß viele der überlebenden Opfer der Nationalsozialisten über ihre Zeit im KZ nachher nicht geredet haben, nicht in der Familie, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Zu groß war die Scham über das Erlebte, zu mächtig das Bedürfnis nach Verdrängung. Hinzu kam, daß in einigen Ländern sich niemand für das KZ-Schicksal interessierte und in anderen - zum Beispiel in der Sowjetunion - die Tatsache der KZ-Haft geradezu als Menetekel des Versagens der davon betroffenen Menschen gesehen wurde. Jetzt, 1995, aber wollen viele reden. Am Ende ihrer Tage wollen sie Vorsorge treffen, daß das Erlebte nicht mit ins Grab genommen wird. Es bedurfte nur eines Anstoßes, daß sie Zeugnis ablegten. Die Treffen an den Plätzen der früheren Lager waren ein solcher Anstoß für die überfälligen Zeugenaussagen - über das eigenen Leben und den Charakter des Nationalsozialismus mit seinem KZ-System. Die 50. Jahrestage waren auch die große Chance für die "oral history". 58 Jürgen Dittberner, Neuer Staat mit alten Parteien? Die deutschen Parteien nach der Wiedervereinigung, Opladen/Wiesbaden 1997, S. 241ff 61 Bleibt die Frage, ob der Nationalsozialismus im Selbstverständnis der deutschen Nation auch in der Berliner Republik in den nächsten fünfzig oder hundert Jahren weiterhin seinen epochalen Stellenwert als der schlimmste Kulturverfall der deutschen Geschichte behalten wird. War der 50. Jahrestag der Schlußstrich unter dem Kapitel Nationalsozialismus oder der Beginn einer instrumentalisierten Hervorhebung dieses Geschichtsabschnittes? Immerhin wurde 2005 alles wiederholt: In den KZ-Gedenkstätten erinnerte man sich wie 10 Jahre zuvor an die Befreiung nun 60 Jahre nach Kriegsende. Doch die ehemaligen Häftlinge waren weniger geworden. Und die Öffentlichkeit hatte sich an gesamtdeutsche Jahrestage gewöhnt. Die Lage ist unklar und verworren. Einen nationalen Grundkonsens über die Haltung zum Nationalsozialismus gibt es offenbar nicht. Während sich die offizielle und die der politischen Korrektheit folgende Gedenkkultur verfestigt, eruptieren immer wieder rechtsradikale Aktionen - in den neuen Bundesländern, bei der Bundeswehr, aber auch in Städten wie Solingen oder Lübeck. Der Streit über den Nationalsozialismus und seine Folgen wird weitergehen, wobei vieles gar nicht ausgesprochen wird. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten, authentische Zeugnisse zu erleben, abnehmen. Die ehemaligen Opfer der Nationalsozialisten werden in den nächsten zehn, zwanzig Jahren nicht mehr sein. Die Gebäudereste der früheren KZ`s in Sachsenhausen und Ravensbrück beispielsweise drohen zu verfallen. In Dachau spürt jeder Besucher eine unterschwellige Stimmung in der Stadt gegen die Gedenkstätte, und in Buchenwald werden bittere Rechtfertigungskämpfe über die Rolle der Kommunisten unter den ehemaligen KZ-Häftlingen ausgetragen.60 An die Stelle der Häftlinge und der authentischen Orte als Mahner aus der Vergangenheit werden mehr und mehr Institutionen wie Stiftungen und Ausstellungen treten - abhängig vom politischen und fiskalischen Tagesgeschäft. Diese werden eine politisch-bürokratische "Zuständigkeit" für die Vergangenheit übernehmen. Weiten Kreisen in Deutschland ist klar, daß es in diesem Land nach Auschwitz nicht nur Denkmäler geben kann, die an ruhmvolle Abschnitte der eigenen Geschichte erinnern, sondern auch solche, welche die Erinnerung wach halten sollen an die Staatsverbrechen des Nationalsozialismus. Über das "Wie" dieser Erinnerungsstätten aber gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen, besonders in Berlin. In der deutschen Hauptstadt und ihrem Umland befinden sich Originalstätten der Staatsverbrechen: Die Wannsee-Villa, die Stauffenberg-Straße, das Prinz-Albrecht-Palais, die früheren Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück. Diese Orte existieren als Gedenkstätten, teilweise mehr schlecht als recht und ziemlich unsystematisch nebeneinander. Eine integrale Darstellung der Planung, Organisation und des Vollzugs des Staatsverbrechens am Ort des damaligen und zukünftigen politischen Zentrums in Deutschland erfolgt jedoch nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Die vom Förderkreis, dem Land Berlin und dem Bund getragene Diskussion über ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas läßt auch nach dem zweiten Anlauf mehr Fragen offen als sie beantwortet. Nach dem ursprünglich ausgewählten Entwurf für eine monumentale Grabplatte werden Ende 1997 vier weitere Entwürfe favorisiert, gegen die es mittlerweile ebenfalls wieder zahllose Einwände gibt. Verstärkt sind Stimmen zu hören, die sagen, der Schmerz über den Genozid könne nicht Ausdruck finden in einem Denkmal, selbst wenn es zum Kunstwerk geriete. Wichtiger als ein Denkmal sei deswegen eine Diskussion hierüber. Diese würde verstummen, sobald ein Werk errichtet worden ist. Die Scham würde sich in Baumaterial verfestigen und vergehen. Aber ein Denkmal könnte doch nur gerechtfertigt sein, wenn sich auch nachwachsende Generationen davon angesprochen 59 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg; Erinnerung und Begegnung. Gedenken im Land Brandenburg zum 50. Jahrestag der Befreiung, Potsdam 1996 62 fühlen würden. Seit Beginn des Jahres 1998 wird der Entwurf von Eisenmann/Serra - eine Landschaft aus 4000 Betonpfeilern, die man nur individuell durchqueren kann - favorisiert. Die Verwirklichung dieses Entwurfs fällt in eine Zeit, in der Deutschland bei der UNO um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat kämpft und in eine Zeit, in der das geplante „Parallel-Denkmal“ für die Zigeuner nicht errichtet werden kann, weil der „Zentralrat der Sinti und Roma“ im Unterschied zu anderen Betroffenen stur an der Kunstbezeichnung für sein Volk festhält, während es unstrittig ist, dass die Nazis Zigeuner verfolgt und ermordet hatten. Die Vorgänge um das Jüdische Museum innerhalb des Stadtmuseum Berlins offenbaren ebenfalls nur Unsicherheiten: Zwar soll die Geschichte des Judentums innerhalb der Stadt Berlin dargestellt werden, aber wie und von wem und mit welcher Botschaft, das blieb strittig. Was ist davon zu halten, daß der Senat von Berlin die Ratlosigkeit personalisierte, indem er einem Diplomaten und Geschäftsmann aus den USA mit deutsch-jüdischer Vergangenheit als Moderator des Museumsaufbaus bestellte? Ist es Zufall, daß dieser One-Dollar-Mann in der ersten Pressekonferenz erklärte, er habe noch gar kein Konzept für das Museum, welches er nun aufbauen soll? Ist es Zufall, dass nun ein architektonisches Wunderwerk errichtet wurde, dessen Inhalt weit hinter die Form – die Hülle – zurückfällt? Schon gar nicht bedarf es eines künstlich geschaffenen Holocaust-Museums in Deutschland. Der Vorschlag, in Berlin wie in Washington oder in Jerusalem ein solches Museum zu schaffen, ist noch in der Welt. Dabei wird übersehen, daß die Juden in Jerusalem für ihre Toten einen Platz und einen Namen geschaffen haben und daß in Washington ein Museum in der Hauptstadt eines Landes der Zuflucht vor dem Staatsverbrechen errichtet wurde. Nichts von dem läßt sich nach Deutschland, dem Land der Täter, übertragen: Hier geht es nicht ohne Verweise auf die so nahe gelegenen authentischen Orte! Hier ist es angemessen, die Originalstätten zu erhalten, zu dokumentieren und zu musealisieren - wenn man die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sucht! Die Originalstätten des Terrors von der Wannsee-Villa über Dachau und Buchenwald bis zum Prinz-Albrecht-Palais sollten unter der Verantwortung des Bundes und der Sitzländer koordiniert werden, wobei die Individualität der einzelnen Gedenkorte zu beachten wäre. Wichtig ist, daß dieser Verbund der Gedenkorte einerseits deren innere Pluralität schützt, andererseits parteipolitische Unabhängigkeit garantiert. Optimal wäre das zu erreichen, wenn man eine Stiftung für den Betrieb des Holocaust-Denkmals gründete und die einzelnen Gedenkstätten hier vertreten wären. Als Finanziers kommen die Öffentliche Hände infrage, aber auch Wirtschaftsunternehmen, deren Vorgänger an der Zwangsarbeit in den KZ`s profitiert hatten. Ein von den Parlamenten des Bundes und der Länder bestimmtes Kuratorium müßte über die demokratische Legitimität der Institution wachen. Ihre Anbindung sollte diese Stiftung auch bei den Universitäten der Region finden, die somit zur fortwährenden Beschäftigung mit dem Thema Nationalsozialismus veranlaßt wären. Das ist ein Organisationsmodell, welches auch die Gedenkstätten schützt vor dem Drang des Hineinregierens, wie es bei Politikern und Bürokraten des Bundes und der Länder in der Vergangenheit zu beobachten war. Das wissenschaftliche und museale Niveau bei all diesen in der Denkmalsstiftung vertretenen Gedenkstätten müßte gleichwertig sein mit dem Holocaustmuseum in Washington, dem Toleranzmuseum in Los Angeles und Yad Vashem in Jerusalem. Darauf wird das vereinte Deutschland wohl nicht verzichten können. Die Originalstätten bedürfen des museologischen und wissenschaftlichen Standards der USA und Israels. 60 Jürgen Dittberner/Antje von Meer (Hg.), Gedenkstätten im vereinten Deutschland. 50 Jahre nach der Befreiung der Konzentrationslager, Berlin 1994 63 Es ist wahrscheinlich, daß der Nationalsozialismus mit seinen Folgen in den nächsten Jahren in den Hintergrund des öffentlichen Bewußtseins gerät. Das muß nicht bedeuten, daß Deutschland wieder der Barbarei verfallen wird. Aber das Tabu vor Rassenhetze und Minderheitenausgrenzung wird schwächer werden, seinen moralischen Anker verlieren. Schon seit 1990 wird es dumpf und brutal immer wieder verletzt. Daher sollten neben den Historikern die Sozialwissenschaftler den Nationalsozialismus ins Zentrum ihrer Arbeit rücken. In den USA erforscht man gezielt, wie es kommen konnte, daß aus einer hochentwickelten und zivilisierten Gesellschaft ab 1933 der größte Kulturverfall des Jahrhunderts werden konnte. Wie konnte die Demokratie abstürzen in staatlichen Terror und Genozid? In Amerika sieht man, daß dieses Problem auch eines der USA unserer Tage ist. Die Rassenkrawalle von Los Angeles beispielsweise haben dort die aufgeklärte Öffentlichkeit wachgerüttelt. Man will Rezepte entwickeln, wie ein Absturz der politischen Kultur verhindert werden kann. An dieser Forschung über den Erhalt der Demokratie sollte sich auch die deutsche Sozialwissenschaft beteiligen. Es gibt dazu allen Anlaß. Denn niemand wird wohl behaupten, das Eis der Demokratie sei in den USA dünner als in Deutschland. Das Engagement von Sozialwissenschaftlern und auch Psychologen in den Gedenkstätten Deutschlands ist viel zu schwach. Historiker und Museumsfachleute geben hier den Ton an. Wenn aber die Gedenkstätten stärker hineinwirken sollen in die Gesellschaft der Gegenwart, muß dort interdisziplinär gearbeitet werden. Der Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin und die Errichtung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas dort könnte zum Anlaß einer angemessenen Reform des disparaten Gedenkwesens in Deutschland werden. Notwendig ist es vor allem, die wichtigsten Originalstätten des nationalsozialistischen Terrors zu erhalten, mit den heutigen Möglichkeiten zu musealisieren und die Forschung über sie den Universitäten mit ihren vielfältigen Disziplinen aufzutragen. Die bislang unerforschte Komplexität des Lagerlebens in den KZ`s beispielsweise wird nur zu analysieren sein, wenn Historiker, Sozialwissenschaftler und Psychologen gemeinsam daran arbeiten. Von den USA und von Israel lernen sollte man hierbei zweierlei: Einerseits die Methoden der Darstellungen mithilfe des Einsatzes moderner Medien. Auch an den Originalstätten wird man diese Medien einsetzen, wenn man junge Menschen ansprechen will: Es ist die ihnen vertraute Art der Artikulation. Andererseits sollte die Zielrichtung übernommen werden, wie man sie derzeit an vielen Orten vor allem in Amerika findet: Antworten zu suchen auf die Frage, ob und wie man einen Kulturverfall wie 1933 in Deutschland künftig vermeiden kann hier und anderswo. Wir müssen eine Lehre von der Kunst des Bewahrens demokratischer Kultur entwickeln. Der Rückstand, den wir da gegenüber Amerika haben, ist kompensierbar durch die Tatsache, daß hier die Originalorte des Studienobjektes sind, die Akten und anderen Zeugnisse, denen sich nun auch die Sozialwissenschaften und die Psychologie widmen sollten. Überall wird heute interdisziplinär gearbeitet. Auch in den deutschen Gedenkstätten ist das notwendig. Sollte nicht wenigstens die Tatsache, daß der Genozid der deutschen Kultur entwuchs, diese heute mehr als andere Kulturen mit der Sorge vor Wiederholungen versehen? 8. Leitkultur oder Multikulti, und was wollen die Rechten a) Politfloskeln 64 “Leitkultur” ist ein weißer Schimmel, ein Pleonasmus: Kultur, bezogen auf`s Zusammenleben der Menschen ist Maßstab, Orientierung, Leitung. Vielleicht wurde der in der Union seit einiger Zeit kursierende Begriff erdacht, weil “Kultur” schlicht verbunden mit dem Adjektiv “deutsche” erwarten läßt, daß Teile des Publikums nur reflexartig reagieren, wenn sie das hören. Die Vorsichtsmaßnahme half nicht durchgängig: Friedrich Merz, der den Pleonasmus gebrauchte und eine Debatte auslöste, hallten vielfach Vorwürfe wie “Rassismus ” entgegen. Das machte Teile der Debatte grell und abstoßend. Aber es blieb nicht bei verbalen Keulenschlägen. Argumentiert wurde auch. Die deutsche Kultur gebe es nicht mehr, war von einer Seite zu hören. Unsere Gesellschaft sei vielmehr multikulturell. Die deutsche Kultur, so kam es aus anderer Richtung, sei längst vom Geist der 68er vernichtet worden. Jede ihrer Hervorbringungen sei auf 1933 gepreßt worden. Selbst Goethe und Schiller habe man von den Sockeln gestoßen, indem man auch sie als geistige Ahnherren Adolf Hitlers sezierte. In dieser Debatte wimmelt es vor Mißverständnissen: Kultur im sozialen Sinne ist nicht die Welt jener Leute, die in der DDR “Kulturschaffende” hießen. Es ist nicht die Welt der Dichter, Sänger, Maler, Schauspieler, Intendanten und Kultursenatoren - jedenfalls nicht deren Welt allein. Kultur wie hier gemeint ist die Welt aller: der Angestellten, Arbeitslosen, Beamten, Unternehmer, der Politiker, Schüler und Rentner, der In- und Ausländer. Sie alle werden durch Ziele, Konventionen und Kommunikation in Freundschaft und Feindschaft mehr oder weniger beieinander gehalten. Dieser Kitt, der sie verbindet, ist die Kultur der Gesellschaft. Da die deutsche Gesellschaft offensichtlich existiert, existiert auch eine deutsche Kultur. Ihre Ziele mögen profan sein und “Geld”, “Gesundheit”, “Spaß”, vielleicht auch “Freiheit” heißen. Ihre Konventionen sind u.a. Rechtsverkehr, die Arbeit, die Feiertage - allen voran Weihnachten mit seinem unchristlichen Konsumdruck. Das wichtigste Medium der Kommunikation dieser Kultur ist die deutsche Sprache und noch nicht die englische. Die deutsche Kultur gibt es, wie es das Wetter gibt. Wer von außen hierher kommt, spürt das stärker als eingewöhnte Ansässige, und er wird um so eher integriert sein, desto mehr er sich dieser Kultur bedient. Ausgerechnet bei dieser Binsenweisheit fangen deutsche Probleme an: - Die Orientierung an der vorherrschenden Kultur, sagen viele, sei eine Zumutung an Menschen aus anderen Kulturkreisen. Die deutsche Kultur könne nicht der Maßstab für ganz Europa sein. Dabei geht es nicht um Europa, sondern um einen Teil davon, genannt Deutschland. - Hier werde eine “Zwangsgermanisierung” gefordert, wird weiterhin beklagt. Abgesehen davon, daß es lustig ist, wie auf einmal die alten Germanen aus dem Dunkel der Geschichte auftauchen, wird bei dieser Argumentation aus einer banalen Tatsache - eben daß die Berücksichtung der herrschenden Kultur die Orientierung erleichtere - der Vorwurf eines bösen Zwanges. Im Hinterkopf entsteht das Bild von Heerscharen unschuldiger und dunkelhaariger Fremdkulturler, die von blonden germanischen Peinigern wie von KZWächtern zu ihresgleichen umgepolt werden sollen. Welch ein Alptraum ohne jeden Realitätsbezug! - Schließlich kommt der stärkste Angriff gegen das Bewußtsein einer vorherrschenden Kultur in Deutschland: Diese deutsche Kultur habe den Nationalsozialismus hervorgebracht und werde deshalb von hier lebenden Fremden mit einem besonderen moralischen Recht ignoriert. Ja, war der Nationalsozialismus nicht auch aus einer tiefgehenden geschichtlichen und sozialen Umbruchsituation hervorgegangen und hat sich seit 1945 in Deutschland gar nichts geändert? Steht der Nazismus vor der Tür, eben weil er aus der deutschen Kultur folgt? Wenn dem so wäre, müßten alle Freiheitsliebenden sofort das Land verlassen. Der Erfolg und die Anziehungskraft der Bundesrepublik beruhen hingegen darauf, daß sie einen demokratischen Weg gegangen ist. 65 Der führte zu einer Resistenz gegen Extremismus, die mit derjenigen in anderen demokratischen Kulturen wie Frankreich oder Großbritannien mittlerweile äquivalent ist. Das hat unter anderem damit zu tun, daß hierzulande eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Zeit von 1933 bis 1945 stattfindet - eine Auseinandersetzung, die ihren sichtbarsten Ausdruck in der Errichtung des Holocaustmahnmals in Berlin haben wird. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, das die dunkelsten Epochen seiner Geschichte öffentlich beklagt. Deutschland tut es. Man weiß, daß eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheit im deutschen Namen geschehen ist. Aus diesem Wissen erwächst der Wille, Vergleichbares nie wieder zuzulassen. So ist es zu erklären, warum in der Öffentlichkeit seit einiger Zeit eine tiefgehende Debatte über die richtige Art, den objektiv eher marginalen Rechtsextremismus zu bekämpfen, geführt wird. Das alles, obwohl kein einziger Rechtsextremist im Deutschen Bundestag sitzt. Das Gedenken ist ein Element der deutschen Kultur. Davon nun halten insbesondere die verbalen Gegner derselben sehr viel. Sie finden das sogar vorbildlich! - Wo man ansetzt: Die gesamte Debatte über “deutsche Leitkultur” oder “multikulturelle Gesellschaft” ist verbale Schaumschlägerei, allerdings mit ideologischem Hintergrund. Tatsache ist, daß es nun einmal in dieser Region in der Mitte Europas ein Volk gibt, die Deutschen, die über die Jahrhunderte hinweg eine eigene Kultur entwickelt haben. Es gibt eine gemeinsame Sprache, eine sehr wechselvolle gemeinsame Geschichte einschließlich des Einbruchs der Kultur 1933 und einen mittlerweile auf ein Minimum säkularisierten Bestand gemeinsamer Werte. Diese “deutsche” Kultur wurde, das weiß jeder, stets durch Einflüsse von außen mitgeformt: Da war der Beitrag der Juden, der stete Zustrom aus Frankreich und den Niederlanden, da waren Impulse aus Polen und anderen Teilen Osteuropas. Dieser stets einen inneren Wandel bewirkende Zustrom von außen hat sich seit den sechziger Jahren rasant beschleunigt: Italienische, spanische, türkische und andere Lebensformen sind heute präsent und prägen die Wirklichkeit. Über allem weht hier wie in Toronto und Tokio der heftige Wind der Globalisierung und schleift die nationalen Kulturen insgesamt ab, so daß diese immer ähnlicher werden: “Leistung” und schneller “sozialer Wandel” werden Elemente einer entstehenden allgemeinen Weltkultur. Was von den nationalen Kulturen übrig bleibt, dient immerhin noch der alltäglichen Orientierung in den Ländern. Es ist unsinnig, eine Vielfalt kultureller Kreise auf dem Territorium einer jeweiligen Nation zu etablieren. “Multikulti” als ernst genommenes Leitbild würde Selbstbezoghenheit und Erstarrung der ethnischen Gruppen bewirken. Inselkulturen im See der jeweiligen Nation würden entstehen. Konflikte zwischen der Mehrheit und den Minderheiten müßten die Folgen sein. Das Erbe der Mehrheiten und das Eingebrachte der Minderheit sollten sich doch besser gegenseitig befruchten und so eine Konvergenz der Kulturen bewirken. Kein Bayer muß seine regionalen Eigenheiten aufgeben, kein Türke seine Herkunft verleugnen, aber sie und die anderen machen sich das Leben leichter, wenn sie die Grundelemente der vorherrschenden hiesigen Kultur akzeptieren: die deutsche Sprache, die wenigen verbliebenen Werte und die allgemeinen Regeln des Alltagslebens. Ansonsten tut einer Gesellschaft immer die Neugier für kulturelle Anregungen gut. “Deutsche Leitkultur” und “multikulturelle Gesellschaft” müssen als Begriffe zurückgezogen werden. Sie stiften nur Verwirrung. Statt dessen täte es uns allen gut, wenn wir uns auf die Bezeichnung und das Ziel einer “offenen Kultur” einigen könnten. Eine offene Kultur bietet Minderheiten Chancen des Einflusses und eröffnet der Mehrheit die Perspektive des sozialen Wandels.” 2005 kam das Wort von den „Parallelgesellschaften“ auf, auch ein politischer Kampfbegriff. Zwar gibt es viele in Deutschland lebende Ausländer, die mit der hiesigen politischen Kultur und Sprache nicht vertraut sind, aber 66 traditionelle Strukturen der deutschen Gesellschaft haben sich ohnehin aufgelöst zugunsten disparater Milieus. In der Gesellschaft existieren nebeneinander Szenen der verschiedensten Art. Dazu zählen auch sehr unterschiedliche Ausländergruppen. In einer offenen Gesellschaft kommt es darauf an, dieses zusammen zu halten mit den Werten des Grundgesetzes und mit dem Beherrschen der deutschen Sprache. Werden die Parteien sich auf diesen Minimalkonsensus einigen? b) Was wollen die Rechten? Bei Kommunalwahlen in Hessen hatten die Rechten einst über 6 % der Wählerstimmen erhalten. Im Landtag von Baden-Württemberg waren die „Republikaner“ vertreten. In Brandenburg sitzt die DVU schon zum zweiten Mal im Landtag, und in Sachsen sprach mit NPD-Abgeordneter vom „Bomben-Holocaust“ auf Dresden. Versuche der Rechten, sich im Parteiensystem zu etablieren, bleiben der Berliner Republik nicht erspart. Zwischen fünf und 15 % der Wähler in unserem Lande haben ein rechtsextremes Weltbild, sagen die Wahlforscher. Zwar waren die Wahlerfolge der Rechten in der Bundesrepublik im internationalen Vergleich bescheiden: In den Jahren 1990 bis 1993 erzielten sie hier im Schnitt 2,4 %, dagegen in Belgien 6,6 %, in Dänemark 8,3 %, in Frankreich 12,4 % und in Italien 14,1 %. Mit seiner nationalsozialistischen Hypothek ist Deutschland für die Rechten schwierig. Doch aufgegeben haben sie gerade nach der deutschen Vereinigung nicht. Es werden zwei Wege probiert, sich parlamentarisch zu verankern - die Übernahme einer etablierten Partei einer- und der schließlich doch noch erhoffte Erfolg einer neugegründeten Partei andererseits. Was wollen die Rechten eigentlich? Ihre „Programmatik“ läßt sich in sechs Komplexen zusammenfassen. Rechte Parteien und Gruppierungen behaupten: 1. Die Verbrechen der Nationalsozialisten würden benutzt, Deutschland international in Schach zu halten und das deutsche Volk als Paria der Weltgemeinschaft abzustempeln. Dabei würden die Nazi-Verbrechen übertrieben, andere Völker hätten Vergleichbares getan, und nach über 50 Jahren müsse Schluß sein mit der Vergangenheitsbewältigung. 2. Es würde zu viele Ausländer in Deutschland geben, und diese seinen überwiegend Parasiten des Wohlfahrtsstaates. Deutschland könne nicht die Probleme der restlichen seien. 4. Klassisches Thema der Rechten ist das Schüren von Furcht vor Kriminalität. Dem Staat wird vorgeworfen, gegenüber der Kriminalität - besonders von Ausländern und "Terroristen" - zu lasch zu sein. Unter dem Einfluß der Grünen, der SPD und den liberalen Flügeln von Union und FDP lasse sich der Staat von der organisierten Kriminalität an der Nase herumführen. Gangsterbanden aus Osteuropa und terroristische Vereinigungen könnten in Deutschland schalten und walten, wie sie wollen, weil der Staat insbesondere der Polizei die rechtlichen Handhaben und technischen Möglichkeiten verweigere, mit Nachdruck gegen sie vorzugehen. Die Furcht vieler Bürger vor Kriminalität und Verbrechen wird verknüpft mit einer grundsätzlichen Kritik am liberalen Rechtsstaat. 5. Ambivalent ist das Verhältnis der Rechten zum Sozialstaat. Den eigenen Anhängern möchte man schon soziale Sicherheit gewähren, nicht aber denen, die man als Feindbild braucht. Da ist die Rede von Faulenzern, Schmarotzern, Wirtschaftsasylanten, Kriminellen. Denen sollen soziale Leistungen entzogen werden. Eine Perversion des Sozialstaates wird diagnostiziert. Man habe keine Vorurteile gegen Ausländer, aber diese sollten wie die Deutschen in der jeweiligen Heimat leben und diese lieben. Der Zorn der Rechten geht gegen die Ideologie der "multikulturellen Gesellschaft". 67 3. Mehr und mehr dringt das Thema einer "europäischen Integration" ins Zentrum der neonationalen Argumentation. Die Ziele von Maastricht und deren angeblich mangelnde Legitimation bei der deutschen Bevölkerung durch die hier unterbliebene Volksabstimmung werden ins Visier genommen. Insbesondere wird die verbreitete Furcht vor der Einführung einer europäischen Währung geschürt. Der "Euro" werde niemals so stabil sein wie die DM. Ein weiteres Argument gegen Europa ist, daß die Entscheidungsprozesse in Brüssel unüberschaubar, bürokratisch und nicht kontrollierbar Seit längerem gehört die Kritik am übertriebenen Sozialstaat nicht nur zum Repertoire der Rechten, sondern auch weiter Kreise der "bürgerlichen" Parteien CDU/CSU und FDP. Aber in der drastischen Formulierung angeblich ungerechtfertigter Empfänger von Sozialleistungen sind die Rechten radikaler mit Begriffen wie "Absahner", "arbeitsscheue Elemente" oder "kaltblütige Wirtschaftsflüchtlinge". 6. Ein Modethema ist die Übernahme der Kritik an der "Political Correctness" wie sie in den USA verbreitet ist: Für Deutschland haben die Rechten haben ein linkes Meinungskartell ausgemacht, das Form und Sprache angepaßter Politik in der Bundesrepublik vorschreibe. Der Zwang zu politischer Korrektheit führe zu einer Verschleierung sozialer Mißstände, löse Negatives in schwammiges Wohlgefallen auf. Zum Diktat politischer Korrektheit gehöre auch der "Auschwitz-Hammer", der stets zuschlage, wenn jemand in den Verdacht gerate, sich rassistisch, nationalistisch oder judenfeindlich geäußert zu haben, was allerdings Rechten weitaus häufiger passiert als anderen. Für diese Thesen sind, wie gesagt, bis zu 15 % der Deutschen empfänglich. Das Potential ist da. Die DVU, die „Republikaner“ und andere Rechtsparteien haben darüber hinaus immer wieder Organisationsvermögen an den Tag gelegt, und in Berlin will man gar die Organisation einer etablierten Partei entern. Dennoch ist es den Rechten bisher nicht gelungen, sich im politischen System auf allen Ebenen zu etablieren. Nach dem Nationalsozialismus ist in Deutschland die Hemmschwelle vor extrem nationalen und rechten Politikfeldern groß. Es hat sich bisher auch kein „großer Kommunikation“ gefunden, der die Rechten sammeln könnte. Schließlich ist das Innenleben der meisten rechten Gruppierungen von geistiger Armseligkeit und Zerstrittenheit beherrscht, was selbst Sympathisanten fern hält. Aber in Österreich, auch mit dem Nationalsozialismus belastet, hat es ein Populist geschafft. Die etablierten Parteien in Deutschland sollten auf der Hut sein. Dabei ist es sicher nicht klug, wenn ausgerechnet ein Repräsentant eines umkämpften Landesverbandes der FDP den Populisten aus der Alpenrepublik hierzulande durch Diskussionen hoffähig macht. Wirksamer ist es da schon, wenn die demokratischen Parteien durch Kontroversen über gelegentlich stramme Sprüche aus den eigenen Reihen rechtsanfällige Wähler am Abdriften hindern. Doch ist das alles nur Taktik, solange der Arbeitsmarkt einem großen Teil der Bevölkerung verschlossen bleibt. Wenn sich das nicht ändert, wird ein großes rechtes Potential als Bedrohung der Berliner Republik bleiben. c) Gegen rechts: Therapie oder Administration? Wird in Deutschland darüber debattiert, wie Gesellschaft und Staat sich zu politischem Extremismus verhalten sollen, dann kristallisieren sich zwei grundsätzliche Positionen heraus: Der Staat müsse alle administrativen und rechtlichen Möglichkeiten gegen den Radikalismus einsetzen, sagen Verfechter der einen Position. Notfalls, so fügen besonders harte Verfechter dieses Standpunktes hinzu, notfalls müßten eben auch die Gesetze geändert werden, um der Justiz, der Polizei und den Verwaltungen zusätzliche Waffen in die Hand zu geben. 68 Man solle den sozialen und psychischen Ursachen des Extremismus auf den Grund gehen, halten die Protagonisten der anderen Position dagegen. Dann sei es Aufgabe sozialarbeiterischer Therapie und Prophylaxe, die verirrten Extremisten “dort abzuholen, wo sie leben”. Das ist der Ratschlag vor allem um politische Korrektheit Bemühter. Freiere Geister schlagen dagegen vor, vor allem die sozialen Ursachen des Extremismus zu bekämpfen. Die müssen allerdings aufpassen, daß sie nicht selber zu Extremisten gestempelt werden. Die erste Position mit ihren Spielarten läßt sich etatistisch, die zweite therapeutisch nennen. Solange die Bundesrepublik besteht, gibt es politischen Extremismus, der seine Ziele gegen die im Grundgesetz formulierte Ordnung des Gemeinwesens durchsetzen will. Welche offizielle Gegenposition sich jeweils durchsetzt, hängt vom Zeitgeist ab. In den fünfziger Jahren war das verheerende Ende des nationalsozialistischen Extremismus noch ebenso gegenwärtig wie sich im Zuge des Kalten Krieges zum Kommunismus ein Feind-Verhältnis aufgebaut hatte. Folglich ging die Regierung Konrad Adenauers gegen die neonazistische SRP ebenso wie gegen die kommunistische KPD mit der schärfsten etatistischen Waffe vor: Dem Gang zum Bundesverfassungsgericht, um die Handhabe für Parteienverbote zu bekommen. Karlsruhe stellte die Verfassungswidrigkeit beider Parteien fest, und die Verwaltung löste diese auf. Als später dann in den sechsziger Jahren die NPD erstmals die politische Szene betrat, Landtagswahlen gewann und in den Deutschen Bundestag einzuziehen drohte, reagierte vor allem die CSU auf die den Erfolg der NPD speisenden ökonomischen Ängste in weiten Kreisen der Bevölkerung und ging auf ihre Befürchtungen beschwichtigend ein. Die CSU grub so den “Nationaldemokraten” das Wasser ab. Wirtschaft war damals das Kredo der Republik, und wirtschaftspolitische Argumente eigneten sich als Rezept gegen die seinerzeitige NPD. Die Studentenbewegung hernach hat die Gesellschaft gelehrt, daß auch politische und ideologische Motive einflußreich werden und eine traditionelle Ordnung - wenigstens scheinbar - gefährden können. Die Etablierten in Politik und Verwaltung glaubten jedenfalls an diese Gefährdung, und sie schufen sich neue administrative Waffen gegen die “APO”: Radikalenerlaß, Kontaktsperregesetz und Stammheim sollten die “FdgO” genannte freiheitlich-demokratische Ordnung schützen, spornten aber gleichzeitig einen schlimmen Terrorismus an. Zehn Jahre nach der Wiedervereinigung nun macht rechter Extremismus dem Lande zu schaffen. Lange Zeit kam die öffentliche Debatte nach den Mitteln gegen diesen Extremismus nicht in Gang. In Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Lübeck und Solingen kam es zu Mord und Totschlag gegen Minderheiten. In MecklenburgVorpommern bildeten sich rechtsfreie Gebiete heraus. In Brandenburg wurden Asylbewerber zu Tode gehetzt. Gleichzeitig zogen die “Republikaner” zweimal hintereinander mit guten Stimmenergebnissen in den Stuttgarter Landtag ein. In Schleswig-Holstein war die DVU einmal erfolgreich, und heute sitzt diese rechtsradikale “Partei” des Verlegers Frey in den Landtagen von Sachsen-Anhalt und von dem die Hauptstadt Berlin umschließenden Land Brandenburg. Dann marschierten auch noch NPD-Funktionäre in Springerstiefeln, mit Bomberjacken und Glatzen am Vorabend des “Tages der Machtergreifung” durchs Brandenburger Tor. Aber alle diese und weitere Ereignisse lösten keine Dahatte über die Gegenwehr aus. Den rechtsradikalen Vorkommnissen folgten routinierte Rituale auf dem Fuße. Gutmenschen zeigten Betroffenheit, politische Autoritäten besonders im Osten Deutschlands entschuldigten und relativierten. Die liberale Öffentlichkeit empörte sich - mehr oder weniger stark - über Vorkommnisse, ging aber spätestens eine Woche nach dem Ereignis wieder zur Tagesordnung über, indem sie sich auf ein neues aktuelles Ereignis stürzte - seien es Kohls Spendenaffaire, die Eskapaden des Prinzen von Hannover oder die Kampfhunde. 69 Der Rechtsradikalismus wurde im vereinten Deutschland lange nicht das beherrschende Thema, trotz ermordeter und verletzter Opfer, trotz öffentlicher Auftritte von Extremisten, trotz der Wahlerfolge der Rechtsparteien und trotz der offensichtlichen Hinwendung der “Partei” NPD zum Nationalsozialismus. Die therapeutische Grundposition beim Kampf gegen Extremismus auch gegen rechts war allenthalben so dominierend, daß die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft das Thema an tatsächliche oder vermeintliche Experten delegierten. In rechte Jugendtreffs wurden öffentliche Mittel gegeben, um die verirrten Schafe einzusammeln. An Gedenktagen gegen den Nationalsozialismus wurden schön anzuhörende moralisierende Reden von dafür zuständigen Politikern wie Rita Süßmuth oder Wolfgang Thiersee gehalten. Jedes Bundesland und viele noch so kleine Gemeinden legten sich “Ausländerbeauftragte” zu, die zu gegebener Zeit ermahnende Worte sprachen. Ignatz Bubis wurde der Status einer obersten informellen moralischen Autorität der Republik zuerkannt, und er scheiterte darin tragisch , weil er im Innersten ein Etatist und kein Therapeut war. Die staatlichen Verfassungschützer auf der anderen Seite rieten den Verantwortlichen ab, rechtsextreme Organisationen aufzulösen, weil sie dann die Szene nicht mehr beobachten könnet. Das ging so weit, daß sogar davor nicht zurückschreckten, erwiesene Extremisten als staatliche Kundschafter einzusetzen. Und schließlich waren da Kommunalpolitiker, Polizeibeamte und andere Funktionsträger auf der unteren und mittleren Ebene, die noch jeden rechtextremen Exzeß relativierten, erklärten, vertuschten und entschuldigten, wenn er auf ihrem Terrain stattfand. Diese Art von Therapie interpretierten die Extremisten als klammheimliche Sympathie der Etablierten mit ihrem Tun. Sie machten weiter. Da explodierte im Sommer 2000 in Düsseldorf eine Rohrbombe und verletzte ausschließlich Zuwanderer aus Rußland, die meisten davon Juden. Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei nicht ermitteln, doch die Öffentlichkeit nahm diesen Vorfall zum Anlaß, nunmehr die längst fällige Generaldebatte über den Rechtsextremismus zu eröffnen. Die Medien brauchen offensichtlich den Zeitpunkt, die richtige Geschichte und die geeigneten Bilder, bevor sie etwas ganz oben auf die Tagesordnung setzten. Nun flammte erneut die bekannte Debatte um die beiden Grundpositionen auf. Anfangs waren die Therapeuten noch die Meinungsführer. Vor Ort bis in das Zentrum der Staatsmacht in Berlin wurden Betroffenheitsgesten gezeigt. Die unvermeidlichen Sprecher der Arbeitgeberschaften sprachen ihrerseits von der Gefährdung des Standortes Deutschland. Alles schien zu sein wie immer seit zehn Jahren. Da forderte der bayerische Innenminister ein Verbot der NPD. Und wie in dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern fielen vielen die Schuppen von den Augen: Tatsächlich, da existierte eine politische Partei, die seit einiger Zeit Anleihen bei den Nationalsozialisten nimmt. Nun wurde die etatistische Position verstärkt wahrnehmbar. Ein Parteienverbot, das hatte es nur zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben, zuletzt 1956. Was da im Grundgesetz steht, daß die privilegierten politischen Parteien nicht einfach durch Regierung und Verwaltung aufgelöst werden können, sondern daß es für diesen Schritt einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes bedarf, hatte lange Zeit als anachronistisch gegolten: Der politische Extremismus müsse politisch bekämpft werden, lautete dreißig Jahre lang ein Dogma der deutschen Politik. Viele Hilfsargumente wurden bemüht, um das Dogma zu stützen: Eine starke Demokratie könne Extremisten rechts und links ertragen, verkündeten die einen. Man dürfe die Extremisten nicht kriminalisieren, lautete es menschenfreundlich. Nicht verbotene Organisationen ließen sich besser observieren, versicherten die Dienste, deren Erkenntnisse zugleich auch nicht immer besonders nahe an der Realität waren. Überhaupt seien Parteienverbote ja illiberal, ließen sich schließlich börsenverliebte Yuppies ein, die sich nicht 70 vorstellen können, wie schnell Leute vom Schlag der NDP-Kader mit dem freiheitlichen Yuppiegefühl Schluß machen würden, wenn sie nur könnten. Daß ein Parteienverbot Ende des zwanzigsten Jahrhunderts als Steinzeitwaffe angesehen wurde, hat damit zu tun, daß die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus nach über fünfzig Jahren verblaßt sind - allen Gedenkfeiern und Mahnmaldiskussionen zum Trotz. Vergessen sind auch die Gründe, warum die politischen Parteien im Grundgesetz 1949 hervorgehoben wurden und warum ausdrücklich festgehalten wurde, daß sie an der “politischen Willensbildung” mitwirken: Nur ein System von demokratischen Parteien - das hatten Weimar und das “3. Reich” gelehrt - kann eine Massendemokratie am Leben erhalten. Doch in der Bundesrepublik zur Jahrhundertwende verging mehr und mehr Menschen die Lust, sich an Wahlen zu beteiligen, gar in den Parteien zu engagieren, und das Wort von der “Parteienverdrossenheit” machte die Runde sowohl in den Zirkeln des renommierten Staatsrechtsprofessors als auch über dem sprichwörtlichen Stammtisch. Bis in die Zentren der Parteien hinein machten Menschen sich Gedanken, wie sie das Wirken der politischen Parteien beispielsweise durch weitgehende Plebiszite eindämmen können. Die Forderung etwa, den Bundespräsidenten direkt durchs Volk wählen zu lassen, galt bei Modernen und Liberalen als sehr schick, und zum Hinweis aus die Rechtsparteien, daß die dergleichen auch forderten, wurde locker gesagt, deswegen sei diese Forderung noch nicht falsch. Dabei ist es so, daß sich die Rechten wohl präziser erinnern, wie wenig segensreich der vom Volke gewählte Staatspräsident in Deutschland Anfang der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts gewirkt hat. Es mußten offensichtlich Asylheime brennen, Fremde durch Provinzstädte gehetzt werden und Glatzen durchs Tor marschieren, bis ein relevanter Teil der deutschen Öffentlichkeit erkannte: So dick ist das Eis nicht, auf dem sich Liberalität und Demokratie in diesem Lande bewegen, und wie vor siebzig Jahren, kann es auch jetzt oder später noch einmal einbrechen. Und um das zu verhindern, reichen Pädagogik, Sozialarbeit und Moralisieren offensichtlich nicht aus; es bedarf auch der administrativen Repression. Und so kam es denn, daß eine Staatssekretärskonferenz ersthaft die Chancen eines Verbotsantrages gegen die NPD prüfte, daß erneut über die Bannmeile in Berlin-Mitte nachgedacht wurde und daß Polizisten ernst einschritten, wenn Extremisten im Lande wieder einmal von sich reden machen wollten. Die etatistische Position bei der Bekämpfung des Extremismus ist wieder hoffähig, weil mittlerweile genügend Verantwortliche erkannt haben, daß ein erneuter Einbruch der politischen Kultur nicht ausgeschlossen ist. Doch diesmal wäre es falsch, bei der Wahl der Mittel gegen den Rechtsextremismus im “Entweder-OderDenken” zu verharren. Neben Verboten, Einengungen und schärferen Bestrafungen, bedarf es weiterhin der politischen Bildung, der Sozialarbeit und der moralischen Verurteilungen durch Autoritäten vor allem der mittleren und unteren Ebene. Hierbei kann manches fortgeführt und anderes verbessert werden. Es bedarf aber auch einer gründlichen Debatte über die Ursachen für den Rechtsextremis und die Anfälligkeit vor allem Jugendlicher hierfür. Da wird es heikel. Denn der Extremismus ist auch ein Indikator für Schwachstellen unserer Gesellschaft. Eine dieser Schwachstellen ist, daß die neue Ökonomie zum Motor der gesellschaftlichen Entwicklung geworden ist. Die neuen Techniken, die Urbanität, die neuen Jobs und die unermeßlichen Einkommenquellen gehören zur Sonnenseite dieser rasanten Entwicklung; zur Schattenseite aber gehören die Chancenlosigkeit vieler und die soziale Kälte, mit der sie abgespeist werden. Es kann doch einer Demokratie nicht nützen, wenn die alte Mittelschichtengesellschaft auseinanderdriftet, oben Geld, Prestige und Elitebewußtsein akkumuliert werden, unten aber Stütze, Trost- und Perspektivlosigkeit sich ausbreiten. Wieviel “VIP-Longues” hält ein Fußballstadion aus, wieviel Milliarden die Lizenz- und Übernahmepolitik der Firmen, wieviel überbezahlte 71 “Promis” der Unterhaltungsbranche die Demokratie? Wie wirkt sich der frühe Reichtum der “Oli P`s”, der “Slatko`s”, aber auch der “Jauch`s” und “Effenberg`s” auf die Motivation der Unbegabten und Ungefragten aus, sich anzustrengen, damit sie es im Leben einmal “zu etwas bringen”? Es kann doch selbst für die gut Begabten und Ambitionierten nur frustrierend auswirken, daß in den Profiteams des Sportes noch qualifiziertere Ausländer ihnen vorgezogen werden, daß die Computer von “Indern” programmiert werden müssen, damit die Companies noch mehr scheffeln und weitere Börsengänge vorbereiten können. Überall gehen Halt, Maß und das Gefühl verloren, daß es einen Zusammenhang gibt zwischen erbrachter Leistung und erhaltenem Lohn. In solchem Umfeld gibt es einige, die ihren Frust in Gewalt gegenüber solchen umsetzten, derer sie habhaft werden und die nicht zu ihnen gehören. Und ihnen biedern sich jene Ideologen an, die behaupten, das einzig mögliche Gegenmodell sei der Nationalsozialismus. Die Frustrierten und obendrein Gewaltbereiten werden nur in die Arme jener Ideologen getrieben, wenn sie spüren, daß sich die “Promis” nennende herrschende Klasse gegen sie wendet, weil sie - wie es schon immer in der Welt war - um ihre Pfründe fürchtet. Derartiges auszusprechen ist - wie gesagt heikel. Doch dazu muß es kommen in der Debatte über die richtigen Mittel gegen den Extremismus. Eigentlich ist es nicht möglich, daß die Bundesregierung jetzt Steuermittel zur Verfügung stellt für Projekte gegen rechts. Die Gefahr der Mitnahme ohne Effekt ist hoch. Geld sollte vielmehr ausgegeben werden für Forschungen und politische Diskurse über die Frage: “Können in der modernen Gesellschaft Leistung und Gerechtigkeit verbindliche Maßstäbe sein?” Das Volk beklagt in allen Befragungen, die Reichen würden immer reicher und die Armen immer ärmer. Nur eine Minderheit ist deswegen unzufrieden. Aber wie lange noch? Sollten weitere Bevölkerungskreise radikal werden, werden diese sich wohl überwiegend nicht auf der linken Seite des politischen Spektrums wiederfinden, sondern auf der anderen. Mit dem Ende des Weltkommunismus ist der linke Extremismus unglaubwürdig, nicht attraktiv. Umso größer die Gefahr, daß auf der rechten Seite noch mehr zusammenbraut als was wir heute kennen. Um das zu verhindern, muß die Politik dem öffentlichen Leben wieder Maß geben, damit Leistung und Gerechtigkeit zusammen gehen und der Gesellschaft jenen Halt geben, den die Politikwissenschaftler “Legitimation” nennen. 9. Transatlantische Entfremdung a) Der 11. September Der 11.September 2001 war einer jener Tage, die das politische Bewusstsein der Menschen prägen. Und damit ändert sich die Welt. Das Datum 11. September 2001 ist einschneidend wie der 13. August 1961, der Tag des Mauerbaus. Wieder hat man das Gefühl, die Menschheit halte den Atem an. So war das auch am 22. November 1963, dem Tag als John F. Kennedy ermordet wurde. Solche Tage haben weltgeschichtliche Aura, und alle spüren es sofort. Meist lösen diese Tage Furcht und Entsetzen aus, seltener Freude und Euphorie. Der letzte Freudentag dieser Dimension war der 9. November 1989, als die Mauer fiel. Wie ändert sich die Welt an Tagen mit weltgeschichtlicher Aura? Der 11. September 2001 wirkte wie die Kriegserklärung der ärmeren, fundamentalistischen gegen die reichere, liberal-demokratische Welt. Auch im so euphorisch begrüßten neuen Jahrhundert also ist die Zivilisation aufs höchste gefährdet. Waren es im vorigen Jahrhundert politische Religionen - vor allem der Kommunismus und der Nationalsozialismus - , die Abermillionen Menschen in die Gaskammern, in die Gulags, auf die Schlachtfelder und dort in den Tod trieben, 72 so scheinen es im neuen Jahrhundert religiös verbrämte politische Ideologien zu sein, aus denen der Terror entsteht, der wiederum taufende Menschenleben kostet. Es ist Terror gegen Toleranz, gegen eine offene Welt gegen jede Form aufgeklärter politischer Kultur. Diesen Terror findet man auch vor unserer Haustür, und er hat nicht immer etwas mit moslemischem Extremismus zu tun: In Nordirland jagen angebliche Christen erbarmungslos heulende Schulkinder aus purer Rechthaberei durch eine Gasse der Gewalt und Bösartigkeit. Das geschient im Namen der Konfessionen, und der Papst begibt sich ebenso wenig wie höchste protestantische Kreise leibhaftig dorthin, um Einhalt zu gebieten. Auf dem Balkan verjagen sie sich gegenseitig, morden und vergewaltigen im Namen ihrer unterschiedlichen Nationen und Religionen. In ihrem Bemühen, dem Einhalt zu gebieten, verstrickt sich die westliche Welt derweil in einem Dickicht von Hass, Egozentrik und Unerbittlichkeit. Um dem auf diesem Boden heranwachsenden Terroristen etwas entgegen zu stellen, züchtete der Westen Strukturen heran, aus denen heraus sich der Terror schließlich gegen ihn selber richten kann. Im Nahen Osten kämpfen Juden und Araber alttestamentarisch um ihr Land: "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Das Tempo dabei bestimmen religiös aufgeputschte Fundamentalisten. Sogenannte Gottesmänner säen Hass in die Seelen "heiliger Krieger", und auf der anderen Seite pochen Orthodoxe unerbittlich auf den alleinigen Besitz von Wahrheit, Recht und Moral. In den Lagern der Palästinenser wachsen seit Generationen das eigene Leben und das anderer verachtende Selbstmordkrieger heran. Bei den Juden errichten unerbittliche Orthodoxe Barrieren gegen die Vernunft und den Friedenswillen des eigenen Volkes. Sie und ihre kongenialen Gegner bei den Moslems haben der gesamten Region ein Klima der Gewalt, der Rechthaberei und des Todes gebracht. Weiter weg in Afghanistan ist eine Gruppierung an die Macht gekommen, die sich auf den Islam beruft und Menschen, welche nicht ihren Vorstellungen entsprechen, drangsaliert, verfolgt und vernichtet. Frauen werden gehalten wie unmündiges Vieh. In diesem Land, seit dem Überfall der Sowjetunion geschunden, zerstört, materiell und geistig ruiniert sollen von einem reichen Araber die Fäden gesponnen worden sein für den Angriff auf Amerika am 11. September. Seit die Flugzeuge mitsamt ihren zu Gefangenen gewordenen Passagieren und ihren selbstmörderischen Entführern in die Twin Towers gerast sind, ist in der westlichen Welt das Urvertrauen in die Sicherheit ihrer Zivilisation dahin. Was sich diese Zivilisation in ihrer hemmungslosen Unterhaltungswut als virtuellen Nervenkitzel schon ausgedacht hatte, ist wie nach dem Prinzip der self fulfilling prophecy Wirklichkeit geworden. Es ist wie in den von Hollywood ausgedachten Horror-Filmen - und doch schlimmer: Die Wolke von Staub und Rauch blieb wie ein infernalischer Stempel über der Superstadt kleben als bezeugte sie das jüngste Gericht. Wer kann sich tausendfach ausmalen, welches Elend und welche Qualen die unter den Trümmern Begrabenen erlitten haben? Es scheint, als komme das Dunkle aus dem Hellen, der Terrorismus aus der Zivilisation - das nicht nur wegen der zuvor produzierten Hollywood-Bilder. Einige der Attentäter haben sich in Florida - des Präsidenten politische Heimat - ausbilden lassen, einer hat in Hamburg auf den Einsatz gewartet. Unter anderem in Boston der Wiege der amerikanischen Demokratie - haben sie sich eingecheckt. Sie nutzten die Hightech der modernen Welt, um ihr einen tiefen Stoß zu versetzen. Diese Terroristen spielten virtuos auf der Klaviatur der modernen Medienwelt, in der Bilder und Symbole zählen. New York und Washington, die Metropolen der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Macht des Westens wurden angegriffen. Der Landsitz des Präsidenten war offensichtlich ein weiteres Ziel. Mit dem 73 Doppelschlag gegen die Handelstürme wurde die Traumkulisse Manhattans in einen Alptraum verwandelt. Und als hätten die Attentäter noch dabei Regie geführt: Die Fernsehstationen dieser Erde wiederholten die apokalyptischen Bilder wieder und wieder. Der Präsident der USA sprach von einem Krieg des "Guten" gegen das "Böse". Das "Gute" werde gewinnen. „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns." Das erinnert an das Western-Schema. Dabei definiert sich das "Böse" durch das "Gute" und umgekehrt. Für das "Böse" selber ist Amerika der Feind schlechthin, der Weltenverderber. Auf der anderen Seite braucht das sich als "gut" Definierende offenbar das "Böse", sonst verliert es die Orientierung. Diese scheint ein Jahrzehnt nach dem Untergang des Ostblocks und dem Verlust des alten Bösen wieder da zu sein. Es sieht so aus, als ob sich das neue Feindbild auf den moslemischen Fundamentalismus fokussiert. Die westliche Welt - genauer gesagt: Amerika - wird reagieren auf den 11. September. Doch ein wenig schwankt sie noch zwischen dem strikten Freund-Feind-Schema und einem stärkeren InterdependenzDenken. Das sucht die Ursachen des internationalen Terrorismus und vermutet sie in den Ungerechtigkeiten dieser einen Welt: - Die ganz Elenden in Afrika bäumen sich global nicht auf. Viel zu schwach sind sie. Regional allerdings kommt es dort immer wieder zu Ausbrüchen. Diese sind infernalisch, doch sie treffen die westliche Welt nicht. - Trotz terroristischer Strukturen auch in den USA selber oder in Europa: Der Hauptangriff kommt in der Tat aus dem Gürtel der moslemischen Staaten im Süden der "weißen" Länder - von Westafrika bis nach Fernost. Dort gibt es eine gewachsene Kultur, eine nicht wie in Afrika einst zerstörte Infrastruktur und eine aggressiv aufladbare Religion. Setzte man hier mit tätiger Hilfe tatsächlich an, so meinen viele, könnte dem internationalen Terrorismus langsam der Boden entzogen werden. Dazu aber müsste der Westen einen Teil seines Reichtums wirklich opfern. Bisher hat er - gegenteiligen Bekundungen zum Trotz - stets akkumuliert. Wo es nicht anders geht, muss er selber die Verhältnisse massiv so ordnen, daß das Leben der Menschen in den Regionen Ziel und Maß erhält. Alsbald wäre dazu vonnöten eine große Balkankonferenz Europas und der USA und die Umsetzung eines Modus vivendi in Israel ähnlich wie ihn der Präsident Clinton kurz vor seinem Amtsende vorgeschlagen hatte. Es scheint, als sei das Freund-Feind-Denken in den USA stärker verbreitet, das Interdependenz-Denken dagegen mehr in Europa. Doch haben beide Richtungen Verfechter auf beiden Kontinenten, und auch die amerikanische Administration kennt nicht nur das Freund-Feind-Schema. Handeln nach dem interdependenten Denken wird zudem das Bemühen um Strafe für die Verursacher des 11. September nicht ausschließen. Nur scheint es besser zu sein, Strafe zu fordern und nicht Rache, denn Strafe könnte Wiederholer anschrecken, Rache würde neue auf den Plan holen. Die historischen Ereignisse lehren: Die Menschen meinen zwar, daß sich etwas ändern wird, aber ihre konkreten Erwartungen gehen oft in die falsche Richtung. Beim Mauerbau dachten viele, Berlin, Deutschland und Europa würden nun auf ewig geteilt bleiben. Dabei war der Bau der Mauer der Anfang vom Ende der Teilung. Als John F. Kennedy ermordet wurde, sah das Publikum die amerikanische Demokratie gefährdet und den Rassismus auf dem Vormarsch. Der Rassismus ist mittlerweile in den USA wenigstens formal allgemein geächtet, Amerika ist noch stärker geworden, und die älteste Demokratie funktioniert nach wie vor - wenn auch manchmal wie bei der Präsidentschaft Nixons oder den jüngsten Wahlen mehr schlecht als recht. Zu gut schließlich ist in Erinnerung, daß die deutsche Vereinigung die erwarteten "blühenden Landschaften" beileibe nicht gebracht hat. Aber im großen und ganzen ist doch ein friedliches und demokratisches Deutschland mit einer neuen Hauptstadt daraus geworden. Der 11. September wird nicht vergessen werden wie viele andere Ereignisse. Die an diesem Tage deutlich gewordene Fragilität der Zivilisation wird bewußt bleiben. Es ist zu hoffen, daß alle Beteiligten nach 74 Strategien zur Festigung dieser Zivilisation suchen und weise genug sind, dabei nicht deren kulturelle Untermauerung aus Toleranz, Freiheit und Demokratie zu zerstören. Denn sonst hätten die terroristischen Massenmörder von New York und Washington am Ende doch noch gewonnen. Wie die Welt sich nunmehr ändert, weiß niemand, selbst der amerikanische Präsident nicht: Sollte es gelingen, den Terrorismus zu besiegen, so hätten wir eine neue Weltordnung. Weniger die UNO, mehr die USA wären der Friedensrichter der Erde. Gelingt der „Feldzug" nicht, bleibt er stecken in den Fallen und Dickichten dieser Erde, so sind wohl regionale Kriege, Aufstände, Migrationen die Folge.. Beginnen die Industriestaaten, die Welt jetzt umzubauen und Gerechtigkeit zu globalisieren, so veränderte das nicht nur die Weltordnung , sondern auch das Alltagsleben – bei den bisher Armen ebenso wie bei den bisher Reichen.„Wie ändert sich die Welt?" Niemand weiß eine Antwort. Aber ändern wird sie sich - dramatisch! b) Die deutschen Parteien nach dem 11. September Beim Erscheinungsbild der politischen Parteien in Deutschland nach 2001 wurde die Perspektive bestimmt durch die Terroranschläge in den USA vom 11. September sowie durch die daraus folgenden Kriege in Afghanistan un im Irak. Der Anschlag auf das World Trade Center und das Pentagongebäude wird verstanden als Angriff auf die westliche Zivilisation insgesamt und damit auch auf den Kern des politischen Systems in Deutschland. Formell kommt das darin zum Ausdruck, dass die NATO - deren Mitglied Deutschland ist - den Beistandsfall festgestellt hat. So kann Deutschland jederzeit zur aktiven Kriegpartei in Asien werden. Gleichzeitig meint man nach den Ereignissen von New York und Washington, auch in Deutschland eine Gefährdung der inneren Sicherheit für möglich halten zu müssen. Es steigert offensichtlich die Plausibilität einer solchen möglichen Gefährdung, dass ein Teil der Attentäter sich als sogenannte „Schläfer“ in Deutschland vorbereitet hatten. Alle bis zum 11. September aktuellen Themen der deutschen Innenpolitik wie die stockende Konjunktur, das aus den Fugen geratende Gesundheitswesen, die Bundestagswahl 2002 oder die zweifelhafte Qualifikation des Bundesverteidigungsministers sind in den Hintergrund getreten gegenüber je einer innen- und einer außenpolitischen Hauptfrage: 1. Werden deutsche Soldaten bei militärischen Vergeltungsschlägen eingesetzt? 2. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen können Terroranschläge in Deutschland verhindert werden? In dieser Situation hat die SPD die Rolle der Führungspartei übernommen. Der SPD-Vorsitzende und Bundeskanzler Gerhard Schröder ist zum über den Parteien stehenden Staatsmann mutiert. Er ist nicht nur formell, sondern auch faktisch als der Sprecher Deutschlands legitimiert. Seinem Innenminister Otto Schily ist eine entsprechende Mutation auf seinem Gebiet nicht geglückt: Mit seinen Konzepten zur inneren Sicherheit bleibt er wie beispielsweise bei der Forderung nach einem Einsatz der Bundeswehr in Innern im Meinungsstreit der Parteien. Die beabsichtigte Verwischung von Polizeibefugnissen und Aufgaben der Nachrichtendienste stößt auf Widerstand von Verfassungsjuristen im Bundesjustizministerium. Dennoch erweckt der von den Grünen gekommene Law-and-Order-Mann den Eindruck sicherheitspolitischer Kompetenz, die seiner derzeitigen Partei, der SPD, zugute kommt. Das Bild des Kanzlers und seines Ministers verstellt somit nicht nur den Blick auf die Fehlbesetzung Rudolf Scharping, sondern auch weitere inneren Schwächen der SPD. Noch vor ein paar Wochen hatte der Generalsekretär der SPD, Franz Müntefering, die Verweigerer eines Militäreinsatzes in Mazedonien unter den sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten harsch gerügt und damit deutlich gemacht, wie sehr es 75 die Koalitionsführung schmerzte, dass sie im deutschen Parlament außenpolitisch keine eigene Mehrheit gehabt hatte. Für die SPD trifft nunmehr die These zu, dass in Krisenzeiten die Regierung und die sie tragenden Parteien gestärkt werden. Bei der kleinen Regierungspartei, Bündnis 90/Die Grünen, lässt sich das nicht behaupten. Obwohl diese Partei mit dem Bundesaußenminister Josef Fischer einen der beliebtesten deutschen Politiker stellt, leidet sie in der Öffentlichkeit unter Anerkennungsproblemen. Die Grünen befinden sich in einem Rollenkonflikt zwischen Koalititionsräson und Grundsatztreue. Dass sie sich in dieser Situation jetzt wie schon in vorhergehenden Fällen meist für die Koalitionstreue entscheiden, sichert ihnen zwar den Verbleib in der Regierung, verunsichert aber ihre Basis bei den Mitgliedern und Wählern. Eine Quelle der Grünen - wenngleich nicht die einzige - war der Pazifismus. Nun wird von ihnen verlangt, dass sie Militäreinsätzen der Bundeswehr weit außerhalb des eigenen Landes zustimmen. Vorschläge wie die von Claudia Roth, eine Feuerpause in Afghanistan einzulegen, werden vom Kanzler und offensicht auch seinem Außenminister als Kindereien abgetan. Immer mehr Bundestagsabgeordnete dieser Partei entsprechen dem Verlangen, Kriegseinsätze grundsätzlich zu befürworten. So müssen die Grünen bangen, große Wählergruppen zu verlieren, und sie können nur darauf setzen, Traditionswähler zu halten und Wählerströme von anderen Parteien auf sich zu lenken. Letzteres ist ihnen offensichtlich bisher nicht gelungen, wie die Serie von Wählerverlusten bei den vergangenen Landtagswahlen zeigt. Zusätzlich prekär ist die Situation der Grünen dadurch, dass ihr schärfster Konkurrent unter den politischen Parteien, die FDP, sich der SPD als Ersatzpartner in der Bundesregierung anbietet. Die Oppositionspartei FDP sagt, sie möchte mit dieser Linie ihre Eigenständigkeit unterstreichen. Sie wolle nicht länger Anhängsel einer der großen Parteien sein. Dennoch bietet sie sich der SPD an, oberflächlich betrachtet aus rechnerischen Gründen, faktisch aber auch inhaltlich: In der Außenpolitik stellt sie dem Kanzler praktisch einen Blankoscheck aus. Ihre Korrektivfunktion möchte sie in der Innenpolitik deutlich machen. Das zeigt sich am Beispiel der innenpolitischen Thesen der Bundestagsfraktion, die einen großen Teil des innenpolitischen Programms Schilys - wie die Fingerabdrücke oder die Kronzeugenregelung - billigen, aber beim Inlandseinsatz der Bundeswehr noch - widersprechen. Im Unterschied zu den Grünen befindet sich die FDP im elektoralen Aufwind, und ihrer Politik des Sich-Anbietens bei der SPD im Bund schadet es offenbar nicht, wenn sie in Hamburg gleichzeitig eine Koalition mit der CDU und der rechtspopulistischen Schill-Initiative vorbereitet. Die andere kleinere Oppositionspartei, die PDS , hat sich mit ihrer Ablehnung der Militäreinsätze der USA und demzufolge einer möglichen deutschen Unterstützung dieser Einsatz aus dem Kreise der übrigen Parteien entfernt. Das liegt weniger am Ergebnis ihrer Entscheidung und mehr an deren Zustandekommen und offensichtlichen Motivation. Die Parteiführung hatte ja durchaus versucht, eine Unterstützung von Bundeswehreinsätzen für die PDS nicht grundsätzlich auszuschließen. Aber damit ist sie bei der nach wie vor von alten DDR-Kadern durchsetzten Basis nicht durchgedrungen. Das hat eine lange schon spürbare Führungsschwäche insbesondere der Parteivorsitzenden Gabi Zimmer allgemein erkennbar gemacht. Es nährt zudem die Vermutung der Gegner der Partei, die PDS lehne die Militäraktionen in Asien nicht aus pazifistischen, sondern aus antiamerikanischen Motiven ab. Der Bundeskanzler verstärkt diesen Eindruck, indem er die PDS als einzige Bundestagspartei nicht zu seinen vertraulichen Informationsgesprächen über die weltpolitische Lage einlädt. Die CDU/CSU trägt noch immer die Last der Spendenaffaire ihres einstigen Vorsitzenden und Bundeskanzlers Helmut Kohl mit allen Nebenaspekten wie etwa dem hessischen. In ihrem tiefen Innern ist diese Affaire eine 76 Führungskrise nach dem Zusammenbruch des Systems Kohl im Jahre 1998. Die Diadochenkämpfe sind im vollen Gange. Ein Ausdruck der Führungskrise ist die offene Frage der Kanzlerkandidatur zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber für die Bundestagswahl im Jahre 2002. Aber auch die Rivalitäten zwischen der CDU-Vorsitzenden und den “Granden” der Union wie Friedrich Merz, Volker Rühne oder auch Horst Seehofer von der CSU sind unübersehbar. So kann die um ihre Stellung kämpfende Vorsitzende der CDU dem fest im Sattel sitzenden Kanzler nicht ebenbürtig entgegentreten. Sie muß ihm das Primat überlassen und sich einordnen in einen größeren Kreis, der zum Empfang im Kanzleramt Zugelassenen. Das schwächt das Bild der CDU, zumal die regierende SPD sich gerade mit klassischen Unions-Themen - Bündnistreue in der NATO und innere Sicherheit - in Szene setzt. Die CSU versucht, sich als bayerische Regional- und Bundespartei von der CDU-Krise fern zu halten. Der CSUVorsitzende und Ministerpräsident Edmund Stoiber agiert aus seiner Staatskanzlei in München und über den Bundesrat so als sei er der Gegenregent zu Gerhard Schröder. Wenn Schröder auch nach Stoibers Meinung gut ist, so will Stoiber noch besser sein. Den Worten des Bundesinnenministers Schily lässt Stoiber gemeinsam mit seinem medial zu bundespolitischer Kompetenz aufgestiegenen Innenminister Günther Beckstein Taten folgen und legt für Bayern ein millionenschweres Sicherheitsprogramm auf. Für Bayern soll der Kanzlerbonus an Stoiber gehen, und die CSU sichert sich so in der gegenwärtigen Krisensituation die Vormacht im Freistaat und die bundespolitische Schlagkraft zugleich. In dieser bundespolitischen Lage wurde die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 21. Oktober 2001 für alle Parteien zu einem aufschlussreichen Test. Anlass dieser vorgezogenen Wahlen war das Milliardendefizit der als “Milchkuh” des Stadtstaates gedachten Bankgesellschaft Berlin. Die Berliner SPD nutzte unter Anleitung Klaus Wowereits die in der Stadt seit Jahren bekannte Ämterhäufung des CDU-Politikers und Bankers Klaus Landowsky als Vehikel, um den langjährigen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen von der CDU aus dem Amte zu entfernen und Neuwahl des Abgeordnetenhauses durchzusetzen. So sollte die SPD in Berlin wieder zur stärksten Partei gemacht werden, was sie unter bekannten Bürgermeistern wie Ernst Reuter, Otto Suhr und Willy Brandt einst war. Nach der Duldung der sozialdemokratisch geführten Regierung Höppner in Sachsen-Anhalt und der SPD/PDSKoalition in Mecklenburg-Vorpommern ist die PDS beim Berliner Machtwechsel an einer landespolitisch zentralen Stelle ins Spiel gekommen, indem sie zusammen mit der SPD und den Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus den Diepgen-Senat der Großen Koalition abgewählt und den rot-grünen Minderheiten-Senat Wowereit installiert hat. Diese als “Übergangssenat” bezeichnete Landesregierung wird von der PDS toleriert. Der Einbruch der PDS in die Landespolitik ist in Berlin bedeutend, weil es a) die Bundeshauptstadt ist und weil b) in der Zeit der Teilung der Stadt West-Berlin seine politische Identität als “Bollwerk” gegen jene Kommunisten entwickelt hatte, deren Nachfolger heute als PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus agieren. Würde die PDS durch den Berliner Machtwechsel Regierungspartei in der Stadt, wäre das ein Signal für die Bundespolitik, dass auch dort die PDS koalitionsfähig werden könnte. Entsprechende Ankündigungen hatte es seitens der SPD-Führung gegeben. Die PDS hat im Osten Berlins eine starke Basis, und im Berliner Wahlkampf wollte sie ihre Position ausbauen, indem sie ihren früheren Bundesvorsitzenden Gregor Gysi zum Spitzenkandidaten kürte - trotz oder gerade wegen dessen mittlerweile bekannt gespanntem Verhältnis zu seiner eigenen Partei. Gysi ist einer der talentiertesten Medienpolitiker der Republik. Im Berliner Wahlkampf ist es ruhig um ihn geworden - große stadtpolitische Impulse gingen nicht von ihm aus, und die Außenseiterposition 77 seiner “Antikriegspartei”schien nicht attraktiv zu sein für solche Wähler, die durch Gysi zum PDS-Stamm hinzugewonnen werden sollten. In Umfragen lag die PDS eineinhalb Wochen vor der Wahl bei 16%. Zwar schloss die Landes-SPD eine Koalition mit der PDS nicht aus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Konstellation kommt, schien zu sinken - je näher der Wahltag kam und je länger der Krieg in Asien dauerte. Das Signal für die Bundespolitik “Rot-rot ist möglich” würde- so vermutete man vor der Wahl - ausbleiben. Nachdem die PDS 22,6% der Stimmen geholt hat, sie es wieder anders aus. Als Option ist die SPD/PDSKoalition im Senat wieder vorhanden. Die PDS ist nun eindeutig die Partei des Berliner Ostens, wo sie 48% der Stimmen geholt hat. Sie dürfte aber auch bei vielen Wählern als einzige konsequente Antikriegspartei angekommen sein, was die verantwortlichen Bundespolitiker zur Reaktion zwingen wird. Die CDU überholt hatte die SPD in Berlin schon vor der Wahl eindeutig. Mit 36% lag die SPD eineinhalb Wochen vor dem Ereignis zehn Prozent vor der CDU. Ein Ziel des Berliner Wendemanövers war erreicht. Mit ihrem Spitzenkandidaten Klaus Wowereit haben die Sozialdemokraten den Führungsanspruch in der Stadt, den ihnen einst Richard von Weizsäcker, Eberhard Diepgen und Klaus Landowsky entrungen hatten, zurückgewonnen. Dabei kam der SPD zugute, dass stadtpolitische Themen im Berliner Wahlkampf kaum noch eine Rolle spielten - als Folge der Dominanz innen- und außenpolitischer Erfordernisse nach dem 11. September. Was die Berliner vor Monaten auf die Barrikaden getrieben hatte - die Bankenkrise mit ihren Milliardenverlusten - war nun ein Thema von gestern. Dass die SPD beispielsweise durch ihre frühere Finanzsenatorin am Zustandekommen der Bankenkrise mitgewirkt haben mußte, hatte keine politische Bedeutung mehr. Wichtig war, ob der Minderheitssenat die innere Sicherheit der Stadt garantieren und deren kulturelle Ausstrahlung erhalten konnte, während die schlechte ökonomische Situation Berlins kaum noch ein Wahlkampfthema war. Mit dem Einsatz von 200 Grenzschutzpolizisten und den Vertragsabschlüssen mit renommierten Künstlern wie Simon Rattle und Daniel Barenboim hatte der Übergangs- und Minderheitssenat Zeichen gesetzt und eine gewisse Kompetenz, die sich im Wahlergebnis möglicherweise ausgewirkt hat, entwickelt. Der Schachzug Wowereits, seine Homosexualität vor seiner Wahl zum Bürgermeister zu bekennen um “Enthüllungen” zuvor zu kommen, war richtig und hat ihm - Hoffnungen von Gegnern zum Trotz - nicht geschadet. Die SPD mußte versuchen, die kurz vor der Wahl fehlenden drei bis vier Prozent der Wählerstimmen noch zu bekommen, die ihr für eine Mehrheit von “Rot-grün” noch fehlten. Dieses Ziel hat die SPD mit ihren 29,7% nun bei weitem nicht erreicht, so dass die Berliner Wahl aus sozialdemokratischer Sicht keine völlig geglückte geglückte Generalprobe für die Bundestagwahl ist, zumal die Partei nun die unangenehme Debatte über eine Senatskoalition mit der PDS führen muß . Die Bankenkrise und die CDU-Parteispendenaffaire hängt der Berliner CDU an. Sie gilt als Schuldige an der Misere- wohl auch deswegen, weil sie über Jahre hinweg den Senat geführt hatte. Aber ihre Mitglieder waren es auch, die in diesem Feld durch unseriöse Geschäfte und unkorrekte Parteispenden auffielen. Dennoch war die Bankenkrise nur das Medium, mit dem ein Wunsch nach einem Wechsel in der Stadt realisiert wurde. In Hamburg hat es die Dauerregenten von der SPD getroffen, in Berlin die CDU. Das Absacken der CDU hat einerseits mit dem unklaren Erscheinungsbild der Union auf Bundesebene und andererseits mit landespolitischen Zusammenhängen zu tun. Neben der Bankenkrise schadete der CDU die Art der Nominierung und das Agieren des Spitzenkandidaten Frank Steffel. Dass Steffel Wolfgang Schäuble als Spitzenkandidaten vorgezogen wurde, galt insbesondere der veröffentlichten Meinung als Beleg für die Provinzialität des Landesverbandes. Mit ungeschickten Auftritten um die Rechtfertigung politisch nicht korrekter Äußerungen aus seiner Jugend und dem Bekenntnis seiner Liebe zu München hat Steffel sich zwar in der Stadt bekannt, aber eben auch weitgehend 78 unbeliebt gemacht. Die Berliner und die Bundespolitiker der CDU gaben die Berliner Wahl schon vorher verloren. Aber der Absturz auf 23,7% ist dramatisch und vermutlich mit der Berliner Landespolitik allein nicht erklären: Der Druck auf Angela Merkel und ihr Regiment hat sich verstärkt. Profiteur der Krise der CDU ist offensichtlich die FDP - auf der Bundes- wie auf der Landesebene. In Berlin ist die Partei seit zwei Legislaturperioden nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten. Nach einer “Figaro-Affaire” ihrer Partei- und Fraktionsvorsitzenden Carola von Braun waren die Berliner Liberalen aus der Politik abgewählt worden. Ihr Niedergang ging einher mit dem Niedergang der FDP im gesamten Osten Deutschlands, wo die Partei derzeit nicht in einem einigen Landtag vertreten ist und wo die FDP mit dem Motto von der “Partei der Besserverdienenden” die Kampfparole gegen sich selber formuliert hatte. Nach den Vorstellungen des neuen Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle und des Erfinders des Autosuggestionsprojektes “18", Jürgen W. Möllemann, sollte der Test für die neue eigenständige FDP in Berlin erfolgen. Mit ihrem Spitzenkandidaten Günter Rexrodt, der nicht weiß, ob er nach der Wahl in die Landespolitik wechseln oder lieber Bundestagsabgeordneter bleiben soll, haben die Berliner Liberalen eine große Werbekampagne aufgezogen, die ihnen in Umfragen schon 10 % eingebracht hatte. Allerdings schien die Koalition in Hamburg mit der SchillPartei der FDP in Berlin zu schaden, jedenfalls gingen die Voten zurück, und die FDP wurde eineinhalb Wochen vor der Wahl bei 7 % gesehen. Der Einzug ins Abgeordnetenhaus erfolgte schließlich mit 9,9% - auch, weil die Berliner FDP ihre inneren Flügelkämpfe offensichtlich überwunden und wieder Beachtung in den Medien gefunden hat ,was den derzeitigen Höhenflug der Partei ermöglichte. Der Hauptgrund für den Erfolg der Partei ist aber die Abwanderung der CDU-Wähler: 83000 Wähler gingen diesmal von der CDU zur FDP. Die direkte Konkurrenzsituation der FDP zu den Grünen ist in der Berliner Politik weniger spürbar. Die FDP wollte in der Stadt die Grünen nicht aus dem Senat verdrängen, sondern sich zu ihnen als Koalitionspartner der SPD hinzugesellen - allerdings als die stärkere Kraft. Die Grünen sind in der Großstadt Berlin eine fest verankerte politische Kraft, der besonders die SPD keine Wähler abjagen kann. Mit der Bundesministerin Renate Künast haben die Berliner Grünen eine populäre Politikerinnen in ihren Reihen, und es war für die Partei kein besonderes Problem, dass ihre Spitzenkandidatin Sybill Klotz nicht besonders brillierte. Die Grünen wurden vor der Wahl bei bis zu 10% der Wählerstimmeneingeschätzt. Bekommen haben sie 9,1%. Die Grünen wollen nun die Koalition mit der SPD erneuern. Dazu brauchen sie die FDP, die sie aber in der Wählergunst überholt hat. Das ist keine günstige Lage für die Grünen, auch bundespolitisch nicht. So ist die augenblickliche Situation des deutschen Parteiensystems gekennzeichnet durch eine weltpolitische Überlagerung der Bundespolitik. Der Vorteil daraus geht auf der Bundesebene offensichtlich an den Bundeskanzler und seine SPD - weniger eindeutig in den Ländern, wie der 21. Oktober gezeigt hat. Insofern sind die Berliner Wahlen begrenzt als Test für den bundesweiten Urnengang im Jahre 2002 zu sehen. Aber dreierlei ist aus diesen Wahlen abzulesen: 1. Die CDU/CSU muß sich besser aufstellen, will sie bei der Bundestagswahl überhaupt eine Chance haben. 2. Die Partei des Ostens ist die PDS, der SPD ist es nicht gelungen, ihr hier das Wasser abzugraben. 3. Die anderen Parteien müssen überdenken, ob sie allein der PDS die Artikulation der in der Bevölkerung verbreiteten Antikriegsstimmung überlassen wollen. c) Der Krieg ist da: Die Amerikaner marschieren ohne Votum der UNO im Irak ein In den letzten Stunden, Tagen, Wochen, Monaten kamen Zweifel auf, ob die Menschheit hinzulernen kann. Das Wissen über die brutalen Folgen des Krieges gehört zu den Kollektiverfahrungen des deutschen Volkes. Mir hat 79 sich 1945 für mein Leben als Sechsjährigem das Bild des Infernos auf einer Straße in Berlin eingeprägt: brennende und schwelende Ruinen, herunterhängende Straßenbahnoberleitungen, auf dem Pflaster liegende tote Pferde mit aufgerissenen Augen und daneben getötete Landser in ihren grauen Uniformen. Andere haben Entsprechendes erlebt oder durch Familienmitglieder davon erfahren. Es sind nicht die hochmächtigen Staatsmänner, die sich konkret solchen Elends annehmen, sondern das tun Hilfsorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Nachbarn. Nach dem Inferno des II. Weltkrieges haben wir geglaubt, die Menschheit hätte sich fortentwickelt. Die UNO sollte dafür sorgen, daß Recht vor Stärke geht. Die nordatlantische Gemeinschaft würde Krieg als Mittel der Konfliktlösung tunlich vermeiden. Europa würde sich zu einer der Freiheit, dem Frieden und dem Wohlstand verpflichteten Wertegemeinschaft hin entwickeln. Nun ist das alles infrage gestellt. Liegt nur eine kurze Periode der Aufklärung hinter uns und steht von nun an die Gewalt über dem Recht? Wenn eine der stabilsten und ältesten Demokratien der Welt robust auf Gewalt setzt und die Verantwortlichen sich dabei nicht nur das Recht, sondern auch ihren Gott selber machen, dann besteht die Gefahr, daß die Dämme der liberalen politischen Kultur allüberall brechen. Es ist doch zu befürchten, daß andere Staaten, daß Institutionen und letztlich die Menschen sich untereinander ebenso verhalten. Vielen scheint es, als habe Amerika den amerikanischen Traum zerstört. Warum nur wurde das weise Prinzip der Checks und Balances faktisch ausgehebelt? Aber die Hoffnung, daß die inneren Ereignisse der USA seit der letzten Präsidentschaftswahl dort sehr bald politisch, publizistisch und wissenschaftlich analysiert werden, ist berechtigt, weil es große intellektuelle und moralische Kräfte im amerikanischen Volke gibt. Diese sind gefordert. Schon während das Zerstörungswerk geplant wurde, sorgten sich viele um den Wiederaufbau des Irak. Zugleich jedoch muß daran gearbeitet werden, daß zwischen den Staaten und in ihnen das Recht über die Gewalt gesetzt wird. Daran sollten sich auch unsere führenden Parteipolitiker orientieren, anstatt kleinlich irgendwelche Schuldzuweisungen zu formulieren. Unser Gemeinwesen muß die freiheitliche und gewaltvermeidende Demokratie praktizieren, sie dadurch fortentwickeln und verteidigen. Auch in Deutschland gibt es eigenständige Gefahren wie die unsägliche jüngste Diskussion über die Folter gezeigt hat. Daß es Verantwortliche gibt, die den Einsatz von Folter erwägen, beunruhigt und zeigt, wie dünn das Eis der liberalen und sozialen Kultur ist, auf dem wir uns bewegen. Wir trauern um die Opfer des jetzt geführten Krieges. Jedes Opfer ist eines zuviel. Die Administration Bush sagt, sie wolle nach dem Sieg über den Irak dort eine Demokratie installieren wie in Deutschland nach 1945. Dabei hatte Deutschland eine eigene demokratische Tradition spätestens seit 1848. Darauf ließ sich mit Unterstützung der westlichen Alliierten aufbauen. Entsprechendes gibt es im Irak nicht. Wo sind dort die erfahrenen und untadeligen demokratischen Politiker vom Schlage Konrad Adenauers, Kurt Schumachers oder Thomas Dehlers? Der Eindruck besteht, daß im Irak ein Projekt begonnen hat, das politisch nicht zu einem befriedigenden Abschluß geführt werden kann. Die Welt wird niemals ohne Konflikte sein. Diese müssen ausgetragen werden, wenn es sein muß, hart und kontrovers in der Sache aber fair – die Integrität des Kontrahenten achtend - im Stil. Diese Methode bedarf der ständigen Übung, Verinnerlichung und Verbreitung so weit wie möglich. Denn das ist jene Methode, die es jetzt verstärkt durchzusetzen und zu sichern gilt für die großen Auseinandersetzungen auf dieser Erde. Gäben wir die Hoffnung mit diesem Ziel auf, verlöre alles politisches Tun der Demokraten seinen Sinn. 80 10. Berlin-Brandenburg: Was tut sich in der Region? a) Brandenburg neu erfinden (2001) „So richtig “Stolpe-Land” war Brandenburg zwischen dem 10. September 1994 und dem 5. September 1999. In dieser zweiten Legislaturperiode verfügte die SPD über die absolute Mehrheit im Landtag - sie hatte 54,14 Prozent Wähler für sich gewinnen können. Vorher, nach der Wiedergründung des Landes Brandenburg im Jahre 1990, war Manfred Stolpe als Persönlichkeit und als Ministerpräsident zwar die dominierende Figur der Landespolitik, aber da war er eher der Wanderführer auf dem “Brandenburger Weg” mit einer wundersamen “Ampelkoalition” aus SDP, Bündnis 90 sowie FDP an der Regierung und einem märkischen Wir-Gefühl, das auch die Oppositionsparteien CDU und PDS beherrschte. Im Landtag erkannte man häufig noch keine Parteien: Regine Hildebrandt spendete dem Oppositionsredner Lothar Bisky von der Regierungsbank her Beifall, und während dessen saß Manfred Stolpe unten im Plenum neben dem Fraktionsvorsitzenden Peter-Michael Diestel, offensichtlich in ein grundsätzliches Gespräch vertieft. Ab 1994 war Stolpe vorwiegend nicht mehr zwischen den Reihen zu finden, sondern er saß als Ikone an der Spitze des Projektes Brandenburg. Dorthin hatten ihn “seine Brandenburger” gestellt, weil sie die jahrelangen Attacken vor allem westlicher Medien auf seine möglichen Stasiverwicklungen als Angriffe auf ihre eigenen “Ostindentität” bewerteten. Brandenburg, von außen vielfach als “die kleine DDR” verspottet, wollte sich seinen Landesvater nicht vermiesen lassen. Stolpe wurde zu einer Schimäre: Zum Teil Erich, zum anderen Teil Friedrich. Alles andere, die nach dem Ausscheiden von Bündnis und FDP übrig gebliebenen Parteien, die Minister - mit Ausnahme von Regine Hildebrandt - blieben demgegenüber Staffage. Stolpe war Brandenburg, die SPD-Brandenburg war Stolpe, und davon profitierte sie. Die Ernüchterung kam im Mai 1996. Bei der Abstimmung über die Fusion zwischen Berlin und Brandenburg verweigerten die meisten seiner Brandenburger dem Landesvater die Gefolgschaft. Nur 36,6 Prozent stimmten mit “ja”: Das reichte nicht. Die Fusion war an Brandenburg gescheitert - nicht an Berlin, wo es immerhin 53,6 Prozent Befürworter gegeben hatte. Keiner hatte das Projekt “Berlin-Brandenburg” mit so viel Verve vertreten wie Manfred Stople, und keinen schmerzte das Ergebnis so sehr. Die Abstimmung war auch ein Dämpfer für die SPD: Selbst in ihren Hochburgen erreichte sie nur 36 Prozent Befürworter. Als Sieger stand die PDS da, die gegen die Fusion agitiert und damit die Stimmung der Brandenburger besser getroffen hatte als der Landesvater. Nicht nur die Länderfusion war gescheitert, sondern auch Manfred Stolpe war auf seinem Olymp gestoßen worden. Den Brandenburger Weg gab es nicht mehr, seit die PDS erfolgreich Front gegen die Regierung gemacht hatte. Die SPD mußte erkennen, daß das Land Brandenburg nicht automatisch ihr Eigentum war, und es überrascht, wie überrascht die SPD war, als sie 1999 wieder auf ihr Wählerreservoir von 1990 zurückfiel. Zwar hatte die Partei gegenüber 1994 fast 15 Prozent der Stimmen verloren, aber sie landete mit 39,33 Prozent immerhin dort, wo sie gestartet war (38,21 Prozent). Nach 1999 verfügt auch Brandenburg über ein System konkurrierender Parteien, in dem zwar die SPD die stärkste Gruppierung ist, die beiden anderen großen Parteien CDU und PDS aber zumindest danach streben können, einmal die Mehrheit zu gewinnen. Die beiden kleineren Partner der “Ampel”, Bündnis 90 und die FDP, sind wie in den anderen ostdeutschen Bundesländern auch seit 1994 im Status von Splitterparteien. Anfang 2001 ist nicht abzusehen, wie und wann sie diese Situation ändern können. 81 Ein Menetekel ist die Anwesenheit der DVU im Brandenburgischen Landtag seit 1999 (5,28 Prozent). Hier zeigt sich auf der parlamentarischen Ebene die häßliche Seite Brandenburgs mit seinen starken rechtsextremen Einsprengseln. Es ist die zweite große politische Enttäuschung Manfred Stolpes, daß er im Jahre 2000 endlich eingestehen mußte, er habe die Gefahr des Rechtsextremismus in seinem Land unterschätzt. Daß rechtsextreme Vorkommnisse in diesem Land bis dato immer wieder heruntergespielt, verschleiert, vertuscht und entschuldigt wurden, ist zwar nicht das direkte Verschulden der Landesregierung, aber eine geistige Führerschaft hiergegen ist vom Kabinett bis ins Jahr 2000 hinein nicht ausgegangen. Stets bat man zu bedenken, daß die Täter doch Landeskinder wären und daß man sie zurückholen müsse in den märkischen Hort. Schien die SPD Brandenburgs 1990 und besonders 1994 vor allem Stolpes Wahrkampfmaschine zu sein, so ist sie 2001 ein ganz normaler ostdeutscher Landesverband einer der beiden Großparteien in der Bundesrepublik. In der ersten Hälfte des Jahrzehnts hatte es Theorien gegeben, die besagten, besonders im deutschen Osten würden die Parteien sich nicht an Interessenlagen orientieren, sondern an charismatischen Führungsfiguren. Neben Manfred Stolpe sei Kurt Biedenkopf in Sachsen der Beleg dafür: Ohne ihn wäre die CDU in Dresden nicht so stark. Doch auch in Sachsen hat sich eine Parteiorganisation mit eigenen Strukturen und eigener Dynamik entwickelt. Schon heben einige Unvorsichtige unter den dortigen Parteifreunden die Köpfe und fragen nach der Zeit ohne “König Kurt”. In Brandenburgs SPD - in ihrem Verständnis damit zugleich im gesamten Land - ist der Kronprinz schon präsent. Matthias Platzeck, von der Parteiführung 1998 als Oberbürgermeister in Potsdam gegen den glücklosen Genossen Horst Gramlich installiert, soll Stolpe auf dem Fuße folgen. Dazu wurde der andere “Kronprinz”, Steffen Reiche, im Sommer 2000 vom Amte des SPD-Vorsitzenden entbunden, so daß Platzeck nun auch offiziell als Anwärter auf das Amt des Ministerpräsidenten dasteht, wenn Manfred Stople dieses aufgeben und die SPD weiterhin hierüber verfügen sollte. Eine Besonderheit ist die Kür eines Kronprinzen in einer demokratischen Partei schon. Konrad Adenauer hatte sich immer dagegen gewehrt, Ludwig Erhard als Kronprinzen ausrufen zu lassen: “Wissen Se, Kronprinzenfragen sind unangenehme Fragen...” Und zu gut ist erinnerlich, daß der von Helmut Kohl benannte “Kronprinz” Wolfgang Schäuble es dann doch nicht geworden ist. Über Nachfolgefragen entscheiden die Wähler und die Parteimitglieder trotz aller Vorabüberlegungen immer erst zur gegebenen Zeit. Da diese Erkenntnis keineswegs originell ist, läßt sich die sozialdemokratische Festlegung in Brandenburg nur als Ausdruck der Tatsache sehen, daß einiges von der Vorstellung vom Brandenburger Sonderweg noch immer in dieser Partei steckt: Das Land ist unser, und wenn der regierende Monarch abtritt, werden wir rufen: “Der König ist tot, es lebe der König!” Ob es zu kommen wird, hängt zum einen davon ab, wieviel Widerstände gegen Stolpe und Platzeck in der Partei unter der Decke schlummern und ob die Konkurrenten der SPD es schaffen werden, sich in Positur zu bringen. Da hat es in Brandenburg vor allem die CDU schwer. Bis 1999 war sie die Skandalnudel unter den märkischen Parteien. Partei- und Fraktionsvorsitzende wechselten sich so schnell einander ab, daß die Beobachter gar nicht mehr mitkamen. Die Fraktion intrigierte gegen den Landesvorsitzenden, dieser gegen die Fraktion. Kaum war jemand in ein Amt gewählt worden, machte sich ein Trupp daran, diesen zu demontieren. Die Partei war zerrissen zwischen dem munteren Fortwirken der alten Blockflöten und Erneueren aus West und Ost. So mußte sie sich 1994 mit 18,72 Prozent zufrieden geben - sie hatte ihr Ergebnis von 1990 (29,45 Prozent) um über zehn Prozent unterboten - eine gerechte Strafe für einen zerstrittenen Haufen. Da brachte der ehemalige Bundeswehrgeneral mit märkischer Heimat, Jörg Schönbohm, 1999 die Partei auf Linie. Als Innensenator Berlins hatte Schönbohm vergeblich am Thron von Eberhard Diepgen gerüttelt und wurde von der dortigen CDU 82 mit Freuden ins Brandenburgische weitergereicht. Dort reüssierte er und brachte seine CDU auf 26,55 Prozent. Dem Bruder und Genossen Landesvater schien sich mit dem General ein quirligerLandesonkel an die Seite zu drängen. Theoretisch hätten 1999 in Brandenburg auch die SDP und die PDS eine Koalition bilden können. Diese Option der Regine Hildebrandt hätte Brandenburg sehr weit weg geführt von der Hauptlinien bundesdeutscher Parteienpolitik. Was in Mecklenburg-Vorpommern offiziell und in Sachsen-Anhalt informell möglich ist, wäre in Brandenburg - dem der Bundeshauptsstadt umlagernden Bundesland sehr degoutant. Außerdem hätte es die Stasi-Diskussion um Manfred Stolpe erneut entfacht, wenn dieser Ministerpräsident einer SPD/PDS-Koalition geworden wäre. Zum Zeichen, daß die SPD und die CDU in Brandenburg Sonderwege endgültig verlassen wollen, schied die Jean d`Arc des deutschen Ostens aus der Politik aus, und an der Stelle von Frau Hildebrandt nahm nun General Schönbohm Platz an der Seite Stolpes. Die CDU schien nun die treibende Kraft im Lande zu sein. Von ihr kamen Anregungen zur Länderfusion, zur Gemeinde- und Polizeireform sowie zur inneren Sicherheit. Die tapfere Fraktionsvorsitzende Beate Blechinger hielt dem General den Rücken frei. Doch es zeigte sich bald, daß die Union in Brandenburg in Wirklichkeit zu schwach war für die Regierung - jedenfalls für eine Option auf die erste Geige dort. Keiner der vier CDU-Minister war und ist brandenburgisches Eigengewächs. Im Herbst 2000 wurde offenbar, daß Wolfgang Hackel als Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur eine Fehlbesetzung war. Und nur mit Hilfe von außen gelang es, Hackel im Kabinett zu ersetzen - mit einer Ministerin, die Manfred Stolpe mindestens ebenso genehm ist wie Jörg Schönbohm. Weiterhin im Amte bleibt Justizminister Kurt Schelter, obwohl er das Vertrauen der Justiz verloren hat. Mit dem Oberbürgermeister von Cottbus, Waldemar Kleinschmidt, schien die CDU über lange Zeit wenigstens eine kräftige einheimische politische Begabung in ihren Reihen zu haben. Cottbus schien vor Potsdam und all den anderen märkischen Schwestern die Wende am besten zu bewältigen. Doch Ende 2000 wurden alte Seilschaften sichtbar, mit denen die Stadt in der Lausitz durchzogen ist. Das Ansehen der Stadt, ihre Magistrats und ihres Bürgermeisters sank, und Kleinschmidt stand da als Repräsentant einer sehr alten CDU. So bleiben trotz der fortlaufenden Aktivitäten Schönbohms der Substanzmangel und der schwelende Konflikt zwischen den Altgedienten und den seit der Wende Hinzugekommenen strukturelle Schwächen der märkischen CDU. Ist die märkische PDS eine Alternative? Dieser Landesverband war ein Pfeiler der gesamten Nachfolgeorganisation der SED. Nicht von ungefähr wurde der Brandenburger Lothar Bisky Bundesvorsitzender der PDS. Es sprach für die Bodenständigkeit und Solidität der brandenburgischen PDS, daß der Vorsitzende sein Mandat im Landtag behielt und dieses neben seinen bundespolitischen Verpflichtungen auch wahrnahm. In der ersten Legislaturperiode wirkten Bisky und die PDS im Landtag wie die heimliche Reserve Stolpes. Augenzwinkernd schien die PDS dem “Landesvater” beizustehen, wenn es galt, die wahren brandenburgischen Interessen gegen die arg westlastige FDP oder die doch sehr bürgerrechtsorientierten Grünen zu verteidigen. Die Abkühlung setzte ein, als die PDS gegen Stolpes Fusionspläne mit Berlin öffentlich Front machte. Den Sozialdemokraten kamen bange Fragen auf: War Brandenburg vielleicht tatsächlich doch die “kleine DDR” und die PDS ihr idealer Repräsentant? Die PDS wurde fortan als hartnäckiger Konkurrenz um Wählerstimmen gesehen. Tatsächlich ist die Wählerentwicklung der PDS seit 1990 für diese Partei überaus positiv: Sie steigerte ihren Stimmenanteil bei den Landtagswahlen kontinuierlich von 13,4% 1990 über 18,71% 1994 auf 23,34% 1999. Daß im Jahre 2001 und danach der Knick auf dieser Geraden nach oben kommen muß, dafür gibt es drei Gründe: 83 1. Nach den Koalitionsentscheidung der SPD 1999 gegen die PDS kann diese nicht mehr als Brandenburgs “stille Reserve” gesehen werden, sondern eher als irgendwie noch immer mit der alten DDR verbandelte Partei, die zwar einen guten Mitglieder- und Wählerzulauf hatte, an Havel und Spree jedoch den Zugang zur Macht wohl nicht schaffen wird. Von den Sozialdemokraten muß sie in zunehmenden Maße als Konkurrenz und Gegner und nicht als strategischer Partner gesehen .Auch wenn der Landesvorsitzende diese Option öffentlich nicht aufgeben möchte, kann sie doch nur als innergouvernementale Geste zur Bändigung des wirklichen Koalitionspartners verstanden werden 2. In der Öffentlichkeit ist mittlerweile bekannt, daß die brandenburgische PDS Führungsprobleme hat und stark von innerparteilichen Kontroversen geprägt ist. 3. Generell ist die PDS in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild geschwächt, seitdem 2000 die populären Führer der Partei, Gregor Gysi und Lothar Bisky die Fraktions- und Parteiführung verlassen hatten. In der Medienlandschaft Deutschland hat die ostdeutsche Regionalpartei ihr mediale Gesicht verloren. Hinzu kommt der Verlust von Michael Schumann, der als politischer Analytiker in Brandenburg über die Grenzen der PDS hinaus hohes Ansehen genossen hatte. Gleichermaßen kümmerlich sind die Existenzen der FDP und der Grünen in Brandenburg. Beide Bündnispartner Stolpes aus der ersten Legislaturperiode scheinen sich überhaupt zu regionalen Westparteien zu entwickeln, gewissermaßen als Gegengewichte zur PDS. Die FDP verfügt in Brandenburg - wie in den anderen Ländern Ostdeutschlands - über keine liberale Wählerschicht, die ihr gesellschaftlichen Halt geben würde. Der Vorstand um die landespolitisch weitgehend unbekannte Landesvorsitzende Claudia Lehrmann bemüht sich um liberales Profil, doch er scheint damit auf verlorenem Posten zu stehen. Da nützt es auch nichts, daß man sich bei öffentlichen Veranstaltungen der Prominenz von Jürgen Möllemann versichert: Brandenburg ist nicht NordrheinWestfalen, und die auch in der FDP angezweifelte Seriosität des Populisten wird für die brandenburgischen Wähler erst recht nicht erkennbar. Manche Beobachter vertreten die Auffassung, der Niedergang der Liberalen in Brandenburg komme daher, daß sie in der Ampelkoalition nur mit Ministern aus Westdeutschland vertreten war: Walter Hirche und Hinrich Enderlein. Auch der einzige liberale Staatsekretär aus dem Lande, Knut Sandler, sei unter ziemlich unwürdigen Umständen sehr bald in die Wüste geschickt worden. Schließlich habe die FDP dann ihre Verluste 1994 (2,2%) und 1999 (1,86%) unter dem “westdeutschen“ Vorsitzenden Hinrich Enderlein eingefahren. Aber niemand glaubt ernsthaft daran, daß bei der märkischen FDP nun ein Trendwende ins Haus stünde, weil Enderlein 1999 durch die Landestochter Lehmann ausgewechselt wurde. Die Grünen waren in der Ampel durch die prominenten “DDRler” Matthias Platzeck und Marianne Birthler am Kabinettstisch vertreten, und ihr Niedergang (1994: 2,89%, 1999: 1,94%) ist ähnlich katastrophal gewesen wie derjenige der FDP. An der Herkunft des jeweiligen Führungspersonals kann es also weder bei der FDP noch bei den Grünen gelegen haben. Für die Grünen gilt wie für die FDP: Sie gelten im Osten als Westpartei und haben keine Klientel bei der Wählerschaft, die mit ihnen durch dick und dünn ginge. Die Grünen haben gemeint, im Osten Deutschlands und somit auch Brandenburg Resonanz zu finden durch die Fusion mit der Bürgerrechtsgruppierung “Bündnis 90". Doch schon 1990 war die Mission der Bürgerrechtler in der DDR beendet: Durch ihre mutige Opposition hatten sie zum Zusammenbruch der DDR-Diktatur beigetragen. Die Neugestaltung in Richtung Wiedervereinigung welche die Bündnisgruppen so gar nicht gewollt hatten - übernahmen nun andere: Die Flüchtlinge in den Westen, die proletarischen Protestierer mit der Parole “Wenn die DM nicht zu uns kommen, kommen wir zur 84 DM.”, die führenden CDU-Politiker in Bonn und ihre Gefolgsleute in der Volkskammer und in der DDRRegierung. So erging es den Bürgerrechtlern nach 1990 wie es der Klassiker formuliert hatte: “Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen.” Die durch die Bürgerbewegung parlamentarisch sozialisierten prominenten “Ossis” gingen sehr verschiedene Wege: Güter Nooke landete in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf den vorderen Plätzen, Matthias Platzeck ging zur SPD, wurde Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Landesvorsitzender der Sozialdemokraten und “Kronprinz” Manfred Stolpes. Nur Marianne Birthler blieb der Grünen treu und streitet sich nun als Leiterin der Gauck-Behörde mit “ihrem” seinerseits von den Grünen zur SPD gewechselten Minister Otto Schily über die Herausgabe von Akten. Bei den Grünen Brandenburgs ist keiner und nichts aus der euphorischen Gründerzeit hängen geblieben. Wenn der Maßstab für politisches Gewicht einer Partei deren Repräsentanz im Parlament ist, dann müssen die Grünen und die FDP in Brandenburg auf absehbare Zeit als Parteien ohne politisches Gewicht eingestuft werden. Ob das nach der nächsten Landtagswahl auch für die DVU gesagt werden kann, ist offen. Auf jeden Fall wäre ein Wiedereinzug dieser rechtsradikalen Gruppierung eine Niederlage für die jetzige Regierung wie umgekehrt ein Scheitern der DVU eine Erfolg der Regierung wäre. Die DVU und der Rechtsradikalismus sind eine schwere Hypothek für Brandenburg. Das Land, das sich so gerne in der Sonne preußischer Toleranzedikte wärmt, erlebt seit Jahr und Tag rechtsradikale Jagdszenen in seinen Städten und auf seinen Straßen. Es ehrt Manfred Stolpe, daß er nach zehn Jahren Regierungszeit eingestanden hat, er habe die Brisanz des Rechtsextremismus in seinem Lande unterschätzt. Es bringt ihn und übrigens auch seinen Kronprinzen Platzeck - der sich ähnlich wie Stolpe eingelassen hatte -jedoch in Handlungszwang. Brandenburg geht den richtigen Weg, wenn es den Antrag auf Feststellung der Verfassungsfeindlichkeit der NPD beim Bundesverfassungsgericht unterstützt und neue Strafen für rechtsextreme Gewalttäter fordert. Die etablierten Partein und ihre Repräsentanten müssen aber auch jenen politischen Unterführern spürbar auf die Füße treten, die immer noch abwiegeln und den Rechtsextremismus im wesentlichen als übles Propagandainstrument westlicher Medien darstellen. Es ist ein Makel Brandenburgs, daß die DVU nun mit einer Fraktion im Landtag vertreten ist. Die wird zwar weitgehend isoliert, kann politisch wenig bewegen, aber sie verfügt über die ihr nach dem Recht zustehenden materiellen und politischen Ressourcen. Die aus München gesteuerte Partei hat ihr Wahlergebnis als “Triumph der DVU” gefeiert und nicht zu unrecht getönt, ihr Wahlerfolg sei eine “Warnung für die alten Parteien.” Hoffentlich haben diese das begriffen. Bei Lichte betrachtet hat Brandenburg ein Dreiparteiensystems. Die SPD ist die größte der etablierten Parteien, um ein Drittel kleiner sind die CDU und die PDS. Will die SPD die absolute Mehrheit wiedergewinnen, muß sie erhebliche Wählerpotentiale der anderen Parteien zu sich herüberziehen. Zwar ist die Wählerbindung an die politischen Parteien im Osten Deutschlands geringer als im Westen (wo sie jedoch gesunken ist), aber in zehn Jahren wird sich hier und da eine Identifikation aufgebaut haben. Die Instabilität des Brandenburgischen Parteiensystems liegt vor allem im politischen Desinteresse großer Teile der Bürgerschaft. Nur 54,30 % der Brandenburger haben sich überhaupt an den letzten Landtagswahlen beteiligt. Die geringe Mitgliederdichte der SPD und der CDU ist bekannt, und immer wieder stößt die Rekrutierung politischen Personals auf Schwierigkeiten, weil kein genügendes Auswahlreservoir vorhanden ist. Die brandenburgische Politik muß die politische Bildung im weitesten Sinne intensivieren, fördern und unterstützen. Ob LER oder konfessioneller Religionsunterricht: In den Schulen muß über diese und andere Fächer ein sicheres Gefühl über die Grundwerte, die Geschichte und die politische Kultur unserer Gesellschaft gefördert werden 85 Darüber hinaus ist es notwendig, möglichst viele geeignete Landeskinder, die nach der Wende ausgebildet wurden, in die Schulen zu bringen und das alte Personal zu ersetzen. Brandenburg muß sich neu definieren. Darum bemüht sich - das ist hinter allen Vordergründigkeiten erkennbar der Ministerpräsident seit zehn Jahren. Es kämpft gegen die geistigen Folgen von zwölf Jahren nationalsozialistischer Diktatur und 45 Jahren kommunistischer Indoktrination an. Von seinen Mitstreitern am Kabinettstisch 1990 sitzt heute nur noch Alwin Ziel als nach der Schmökel-Affaire angeschlagener Politiker an seiner Seite. Alle anderen Minister sind mittlerweile mindestens einmal ausgewechselt worden. Das zeigt den langen Atem Manfred Stolpes. Dennoch wäre es nicht verwunderlich, wenn auch seine Zeit nicht reichte, die Hauptaufgabe zu bewältigen und ein anderer den Stab übernehmen müßte. Ob der dieser Aufgabe gewachsen wäre, würde sich ohnehin erst zeigen, wenn er im Amte ist.“ b) Unheilbar unschuldig? (1999) „Die Unschuld vom Lande heißt „Brandenburg”. Die Halbwertzeit dieser Nachricht ist sicher überschritten: Letzthin hatten in Guben rechtsextreme und rassistische Jugendliche einen Menschen aus Algerien in den Tod gehetzt. Mit Autos als Waffen und Handys als Wegweiser hatten sie einen 28-jährigen solange durch die Grenzstadt gejagt, bis dieser durch eine Haustürscheibe flüchtete und sich dabei tödlich verletzte. Auf den Bildschirmen erschienen nach der Tat überforderte Kommunalpolitiker und jammerten, jetzt nähme der Ruf ausgerechnet ihrer Gemeinde Schaden. Es gesellten sich Repräsentanten der Landesregierung hinzu, die sagten, man dürfe das Geschehene nicht verallgemeinern, und Brandenburg sei hauptsächlich ein tolerantes Land. Am Tatort waren Betroffenheitsprofis zu sehen, die hielten rote Rosen in der Hand. Ein auch in diesem Land so genannter “Streetworker” kannte sich aus: Rechtsextrem seien eigentlich nur zwei Anführer der Täter - die anderen wären Mitläufer aus Langeweile und Arbeitslosigkeit und natürlich wegen nicht ausreichender Betreuungsdichte. Wieder - wie in zu vielen vorangegangenen Fällen - lautete die kaum verschlüsselte Botschaft: “Die Tat erscheint Euch draußen schlimmer als sie ist. In Wirklichkeit haben wir hier große Probleme, von denen Ihr nichts wißt. Außerdem tut uns das Geschehene sehr leid. Im übrigen gehen wir im Lande gegen den Rechtsextremismus angemessen vor: Wir haben ein Spezialtrupp der Polizei gebildet, eine Kommission zur Erkundung der Ursachen eingesetzt, und wir begehen artig jedes Jahr den 27. Januar. Ein mehrheitlich “rotes” Land kann nicht rechtsextrem infiziert sein. Man nennt uns doch sogar die “kleine DDR”.” Hier jedoch scheint das Problem zu liegen. In der Formel vom “Brandenburger Weg” schwingt auch DDRNostalgie mit und mentale Distanz zu westlichen Werten. In der Abstimmung über Berlin-Brandenburg war dieses Bewußtsein deutlich geworden: “Wir wollen uns von draußen nicht dreinreden lassen.” “Draußen”, das ist auch die Welt des Multikulti. Deren Probleme werden als nicht brandenburgisch gesehen und sollen hierher auch nicht importiert werden. Deswegen regt sich Widerstand gegen Asylheime, gegen Fremde. Natürlich geht der normale Brandenburger gegen das, was ihn bedrängt, nicht gewaltsam vor. Aber wenn entfesselte Jugendliche es tun, hindert sie selten jemand direkt daran. Viele der Älteren haben sogar ein gewisses Verständnis für ihre “Kids”. Die spüren den gesellschaftlichen Rückhalt in der Erwachsenenwelt: In diesem Element können sie sich bewegen. Die “kleine DDR” gibt Kindern und Eltern eben nicht jenen Halt, den sie brauchten, um wenigstens gegen das Quälen anderer Menschen gefeit zu sein. Der atheistische Staat Honeckers hatte den heutigen Eltern und Erziehern dereinst die christlichen Grundwerte der Brüderlichkeit ausgetrieben oder vorenthalten. Das neue 86 Bundesland mit dem uralten Namen läßt die Kirchen nicht in die Schulen, um Versäumtes nachzuholen. Die bürgerlichen Grundrechte andererseits wurden hier nicht zur moralischen Maßschnur. Das Grundgesetz wurde sogar gelegentlich als Gesetzbuch der “Sieger” aus dem Westen diffamiert. In den Schulen wirken noch immer Lehrer aus der richtigen DDR, und viele von ihnen beklagen den Verlust der “sozialistischen” Werte. Sie können nicht aus ihrer Haut: Diese Pädagogen denken und fühlen in alten Kategorien. Sie sind ungeeignet, neues aufzubauen. Man tat auch ihnen persönlich keinen Gefallen, als man sie im Schuldienst beließ. In den Elternhäusern und Schulen der neuen Länder tat sich nach der Wende ein Wertedefizit auf: Durch den “Sieg” des Westens war die bis dahin allein gültige sozialistische Moral des Arbeiter- und Bauernstaates für jeden sichtbar diskreditiert. Das entstandene Defizit konnte nicht ausgeglichen werden. Die politische Kultur der alten Bundesrepublik schien nicht geeignet, weil sie im Osten Deutschlands vielfach als formales Regelwerk des Westens und nicht als Fundus grundlegender Menschenrechte eingeführt und begriffen wurde. Die sicher nicht unproblematischen Kirchen sind immerhin mögliche Träger alter christlicher Werthaltungen; in Brandenburg wurden sie auf Distanz gehalten. Das vor allem bei jungen Bürgern dadurch unbeglichene Wertedefizit nahm man fatalistisch hin. So kommt es, daß heute Absolventen brandenburgischer Schulen - 20-jährig - auch in Seminaren der Universitäten sitzen und Verständnis zeigen für Deutschtümelei und Fremdenfeindlichkeit. Der Geist des Grundgesetzes hat sie nicht gepackt, und auch von christlicher Nächstenliebe haben sie in ihrer Sozialisation nichts erfahren. Nun nähern sich einige von ihnen - wenn auch längst nicht die meisten - dem Nationalismus und Rassismus. Rechtsextremistisches findet Anklang bei einer neuen Generation und bis hinein in die akademische Welt! Wer geglaubt hatte, der Rechtsextremismus würde wie die Wirren des Einigungsprozesses bald wieder vergehen, der hatte sich getäuscht. In Brandenburg wollen das viele nicht wahrhaben. Es sind die andern und die Medien, die verdrehen und aufbauschen. Da finden sie es im Lande der Unschuld am besten, wenn man nicht über sämtliche “Vorfälle” sogleich berichtet. Schließlich habe man doch auch eine Verantwortung für die jugendlichen Täter. Das Kehren unter die Decke jedoch erinnert an SED-Zeiten. Damals hatte man in Sachsenhausen an die Oberfläche kommende Spuren des kommunistischen Sonderlagers einfach wieder zugeschüttet. Doch die Wahrheit kam immer wieder zum Vorschein. Das sollte uns Heutigen eine Lehre sein. Aber auch jüngst aus Guben kamen wieder Relativierungen und Vertuschungen: Als der Algerier starb, waren seine Verfolger über 100 Meter von ihm entfernt, sagten Ermittler - die Verfolgung war eigentlich schon zu ende. Also ein tragischer Unfall? Es war üble Menschenjagd! Im übrigen, berichteten die Ermittler weiter, habe der Tote einen gefälschten Paß bei sich gehabt. Das rechtfertige natürlich nicht die Hatz auf ihn. Oder doch? In der Szene werden manche getönt haben, da habe man wieder einmal den Richtigen erwischt. Nach den Relativierungen fand das Reinwaschungsritual statt - nach bewährtem Muster: Die Offiziellen veranstalteten in Potsdam eine Trauerkundgebung. Der Ministerpräsident und eine Bundesministerin hielten Trauerreden, es folgte ein Gottesdienst, und in Potsdam wie in Guben läuteten Kirchenglocken. Die Inszenierung mit religiösen Symbolen erfolgte im säkularisiertesten Teil der Republik! Dabei wurde versprochen, mehr Personal in die Jugendarbeit zu geben und die Ursachen von Extremismus verstärkt zu erforschen. Sicher sprang für den einen oder anderen Jugendforscher auch ein Auftrag dabei heraus. Dann war alles vorbei. Brandenburg war wieder das unschuldige Land. Zwar haben sich seitdem Schläger in Velten über einen Angolaner hergemacht. Im benachbarten Hennigsdorf wurde ein Pakistani zusammen geprügelt. In Frankfurt an der Oder hatten sie zuvor einen Marokkaner mißhandelt. Aber wieder wiegeln Offizielle ab, werden Täter nicht gefaßt oder entschuldigt. 87 Derweil richtet die Ausländerbeauftragte des Landes eine “Antidiskriminierungstelle” ein. Und in Hennigsdorf veranstalten Gutmenschen eine Menschenkette. Ist dieses Land ist unheilbar unschuldig?“ c) Brüder einst – Brüder jetzt (2000) „Es ist in Mode gekommen, zu behaupten, die Ostdeutschen würden gegenwärtig über jenes Politikverständnis verfügen, dass die Westdeutschen in den fünfziger Jahren gehabt hätten. Wie damals die Wessis seien die Ossis heute autoritätshörig, an sozialer Sicherheit orientiert, und sie hätten vor allem noch keine „demokratische Streitkultur“ entwickelt. Gestützt wird diese Behauptung durch einige von Sozialwissenschaftlern in die Welt gesetzte Hypothesen. Und schon meinen viele, ein wohlfeiles Modell gefunden zu haben, mit dem sie die trotz Wiedervereinigung noch immer bestehenden politischen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland erklären können. Doch das Modell hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun: Die fünfziger Jahre im deutschen Westen waren geprägt durch die „Ära Adenauer“. Deren Hauptmerkmale waren Westintegration und wachsender Wohlstand. Das entsprach der politischen Befindlichkeit der Mehrheit: Die Menschen fühlten sich durch die Niederlage des NS-Systems betrogen. Das wollten sie nunmehr ausgleichen durch eine Abkehr von der öffentlichen Politik und Hinwendung zu privatem Wohlergehen. Politisch kompensierten die Menschen insgeheim empfundene Mitschuld am Geschehen zwischen 1933 und 1945 durch unbedingte Parteinahme für den Westen im Kalten Krieg: Noch einmal würde man nicht auf eine Diktatur hereinfallen und diesmal auf der Seite der Sieger stehen. Die heutigen Ostdeutschen dagegen haben ganz andere Probleme als die frühen Westdeutschen: Sie fühlen sich vom Westen, dem sie nun - allerdings durch Beschluss der Volkskammer! - anheim gefallen sind, bevormundet und reagieren störrisch - auch auf deren politische Kultur. Das hat seine Ursache darin, dass die Ostdeutschen als sie noch DDR-Bürger waren - ein idealisiertes Bild vom „goldenen Westen“ hatten. Der Realitätsschock fiel um so größer aus, weil die Ostdeutschen just zu jener Zeit in den Westen hineinwuchsen, als dieser durch die Globalisierung ohnehin in eine Krise manövrierte. Massenarbeitslosigkeit und Sozialabbau waren auch den Wessis fremd, aber eine Vielzahl der Ossis begann, diese Miseren dadurch zu kompensieren, dass Teilaspekte der DDR-Vergangenheit im Nachhinein idealisiert werden: Man trauert verklärt einer sozialen Sicherheit, einem verlorenen „Wir“-Gefühl und einer Egalität nach, die es objektiv gar nicht gegeben hatte. Der Zusammenbruch der DDR ist der Beweis. Die Unterschiede zwischen den fünftiger Jahren im Westen und den neunziger Jahren im Osten Deutschlands können nicht größer sein: Die frühen Bundesbürger wollten zum Westen gehören, die neuen haben Schwierigkeiten damit. Die einen fanden Befriedigung im „Wirtschaftwunder“, die anderen beklagen trotz der Verbesserung ihrer materiellen Lage den Tanz ums goldene Kalb. Früher war es selbstverständliche Staatsbürgerpflicht zur Wahl zu gehen, und man kam mit zweieinhalb Parteien gut aus. Heute halten viele das Wählen für nicht so wichtig und Zahlreiche sind bereit, auch Unseriösen ihre Stimme zu geben - nur so und aus Protest. In der frühen Bundesrepublik waren die Menschen brennend interessiert an der Fortentwicklung ihres neuen Staates, heute sagt und bedeutet der Staat so manchem nichts mehr. Die einen fühlten sich im unter alliiertem Protektorat stehenden Adenauerstaat behütet, die empfinden sich in der globalisierten Berliner Republik alleine gelassen. Hätte das Modell der fünfziger Jahre heute im Osten Gültigkeit, dann wäre die Frage, wie die zeitliche Lücke zwischen den beiden Teilen jemals geschlossen werden könnte. Würde der Osten noch einmal eine „Spiegel“- 88 Affaire, eine 68er Revolte, einen Flick-Skandal und gar eine „Rote-Armee-Fraktion“ durchleben müssen, um in der politischen Kultur auf „West-Niveau“ zu gelangen? Muß Rudolf Augstein noch einmal in den Kahn? Und soll der Westen solange warten, stillstehen, sich einfrieren, bei der Osten bei ihm angekommen ist? Wie absurd! Tatsächlich ist das politische Bewusstsein im deutschen Osten von den Erfahrungen in der DDR plus denen in zehn Jahren des vereinten Deutschlands geprägt und das im Westen entsprechend. Ein richtiges oder falsches Bewusstsein kann es nicht geben. Die Erfahrungen aus der Vorgeschichte der Berliner Republik werden immer mehr verblassen, und daraus wird allmählich die Angleichung zwischen Ost und West kommen. Es wird sich eine neue politische Kultur entwickeln - eine, die günstigenfalls geprägt ist durch europaverbindenene Erfahrungen mit dem „Euro“ oder ungünstigenfalls durch die Tatsache permanenter Massenarbeitslosigkeit. Die schöne alte Bundesrepublik und die olle graue DDR werden in den Geschichtsbüchern landen. Ob jemand Ossis oder Wessis als Vorfahren hat, das wird genauso wenig relevant sein wie die Frage, ob ein Berliner von heute rheinische oder polnische Vorfahren hat. Niemand weiß, wie lange es dauern wird, bis man in diesem Lande ungläubig zurückblickt auf die Kabbeleien zwischen Ost und West nach der Vereinigung. Aber eines ist ganz sicher: Man wird nicht verstehen, worum es eigentlich ging bei diesen Kabbeleien - außer vielleicht darum, dass die verstrittenen Brüder wechselseitig gewollt hatten, der andere möge gefälligst so werden wie er ist. Am Ende werden sie alle ganz anders sein.“ d) Neben dem Ministerpräsidenten (2004) „Als die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg noch miteinander um die Länderfusion verhandelten, zog Eberhard Diepgen von der CDU aus Berlin mit Manfred Stolpe von der SPD aus Brandenburg an einem Strang: Sie wollten das gemeinsame Land. Heute kann man sich nicht sicher sein, ob die Regierungschefs der Region wirklich den Zusammenschluss wollen. Mathias Platzeck hat das Projekt aufs Eis gelegt, weil er das Votum seiner Brandenburger fürchtet. Und Klaus Wowereit macht kesse Sprüche Richtung Potsdam. Ob er damit die Herzen der Märker erreichen kann und wirklich will, ist fraglich. Der neue Finanzminister Brandenburgs und Intimus von Platzeck, Rainer Speer, hat den Berlinern Überheblichkeit vorgeworfen. Da hat der alte Berlingegner Recht: Als die Landesregierungen noch miteinander verhandelten, trat beim Thema Kultur der Berliner Senator Volker Hassemer auf und erklärte den Potsdamer Kollegen: „Wir spielen in der Weltliga!“ Das ist genau der Ton, der die Brandenburger so „einnimmt“. Sie erinnern sich an die Privilegierung Berlins zu DDR-Zeiten und haben nicht vergessen, dass das zu Lasten des Umlandes geschah. Sie sehen eine Stadt in der Mitte ihres Landes, die Schulden noch und noch angehäuft hat und dennoch meint, sich alles leisten zu können. Und sie wissen: Bei den Berlinern redet das „Gescherr“ wie der „Herr“: Kurz nach der Öffnung der Mauer zogen Westberliner über die Insel in Werder und riefen den Leuten in den Gärten zu: „40 Jahre habt Ihr gepennt, jetzt sind wir da!“ So etwas nimmt ein für ein gemeinsames Land. Die Reaktionen der Brandenburger auf großmäulige Berliner sind entsprechend. Dann neigt der gemeine Märker zum Muffeln, wenn die aus der Stadt – die „Bouletten“ – einen Wunsch haben. So kann es einem kessen Hauptstädter passieren, dass seine Bitte nach der Speisekarte im Brandenburgischen mit der Bemerkung erwidert wird: „Könnse nich lesen: Draußen steht doch dran, wat dett jibt!“ Die Potsdamer Kollegen der Hassemers revanchierten sich, indem sie den Berlinern genüsslich vordeklinierten, wie es sein würde, wenn Berlin kreisfreie Stadt wäre: Was mit den Opernhäusern geschähe, entschiede ein Referatsleiter in Potsdam, und wenn der 89 Berliner Polizeipräsident sich zum 1. Mai mal wieder eine neue Taktik ausdächte, müsste er sich diese vom brandenburgischen Innenministerium genehmigen lassen... Dass der erste Anlauf am Votum der Brandenburger gescheitert ist, hätte auch im Roten Rathaus Anlass zur Einkehr sein können. Welcher Berliner Politiker aber bedachte, was sich an der Einstellung der Hauptstädter und vor allem ihrer Repräsentanten ändern musste, damit sie die Brandenburger überzeugten? Statt dessen wird jetzt von „Platzeck & Co.“ gesprochen und über die dummen Brandenburger gelästert, die ihre Chance ausgeschlagen hätten, ein wenig Hauptstadtglanz abzubekommen. Dass Berlin überschuldet ist, wird mit dem „Argument“ gekontert, auch Brandenburg sei arm. Wer soll so überzeugt werden? Eigentlich ist die Sache schon von der Überschrift her falsch aufgezogen: Warum soll das gemeinsame Bundesland „Berlin-Brandenburg“ heißen und nicht einfach „Brandenburg“? Berlin ist doch aus Brandenburg erwachsen! Fürchtet irgendjemand, die deutsche Hauptstadt könnte vergessen werden, wenn ihr Name nicht mehr im Reigen der deutschen Länder auftaucht? In Berlin sollte man sich ein Beispiel an Bayern nehmen. Das heißt nicht „München-Bayern“, und dennoch wird niemand behaupten, dass dies der Isar-Metropole irgendwie schade. Nicht dass Berlin und Brandenburg vereint werden, ist das Ziel. Vielmehr muss Berlin nach Brandenburg zurückkehren. Die gemeinsame Geschichte und Kultur sind der Kitt, den man nehmen sollte, um zusammenzuführen, was eigentlich zusammengehört. Für all das steht vor allem Theodor Fontane. Zwar wohnte der in Berlin, aber er war nicht einfach nur Berliner, sondern ein richtiger Brandenburger. Seine „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ wurden Kult. Ihn würde man nicht „Boulette“ titulieren. Jeder Ort im Lande, der irgendeinen Bezug zu dem Dichter herstellen kann, hat seine Fontanestraße. Oder der einstige Berliner Albert Einstein: Kurz nur nutzte er sein Sommerhaus in Caputh, aber darauf sind sie in dem Ort noch heute stolz. Der Einsteinturm auf dem Telegrafenberg ist eine Zierde der Landeshauptstadt Potsdam. Weitere Beispiele für die Verwobenheit Berlins mit Brandenburg waren Walter Rathenau in Bad Freienwalde, Bert Brecht und Helene Weigel in Buckow sowie die ganze Schar der Ufa-Stars in Babelsberg, auch Heinrich von Kleist in Wannsee – der dort seinem Leben ein Ende machte. Sie und viele andere sind Zeugen dafür, dass Brandenburg mit Berlin eine Kulturlandschaft ist. Der Alte Fritz fühlte sich in Berlin genervt und wich nach Potsdam aus. In Gransee haben sie der geliebten Königin Luise ein anrührendes Denkmal gesetzt, um an die Überführung ihres Sarges in die Hauptstadt nach ihrem frühen Tod zu gedenken. Und – ein ganz anderes Beispiel – zu westberliner Zeiten war es ein Luckenwalder, der die halbe Stadt in Aufruhr versetzte: Rudi Dutschke. Ob die Brandenburger für die Heimkehr Berlins in ihr Land reif sind, sei dahin gestellt. Die Berliner sind es sicher nicht: Alljährlich veranstaltet der Fusionsbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf einen Bezirkstag, an dem verdiente Ehrenamtler mit Bezirksmedaillen ausgezeichnet werden. 2004 fand die Feier im Rathaus Charlottenburg statt. Umständlich wurden tatsächliche und vermeintliche Bezirkshonoratioren begrüßt. Derweil irrte der Direktor der Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg durch die ersten Reihen. Für ihn - den Herren über Schlösser wie Sanssouci, Charlottenburg, Caputh und Grunewald - war kein Platz unter den Ehrengästen reserviert. So trollte er sich in die vorletzte Reihe. In Brandenburg hingegen sitzt er in der ersten Reihe - und wenn der da ist, neben dem Ministerpräsidenten! 90 Wie viele Berliner in einer Weltliga spielen, sei dahin gestellt. Dass aber zu viele Hauptstädter nicht den Stil beherrschen, der in Brandenburg ankommt, ist sicher. Wenn Berlin aufgenommen werden will in das Land seiner Herkunft, muss sich das ändern.“ e) Träumen von West-Berlin (2002) „Tatsächliche und eingebildete Verlierer der Einheit haben ihre Trostpflästerchen: Westdeutsche erinnern sich wohlig an die guten alten Bonner Zeiten. Fritz Walter und „Der Chef“ Sepp Herberger holten 1954 die Fußballweltmeisterschaft. Konrad Adenauer, „Der Alte“, verschaffte Deutschland in der westlichen Welt wieder Ansehen und durfte sich in Amerika als greiser Indianerhäuptling abbilden lassen. Ludwig Erhard schuf das „Wirtschaftswunder“. Später erfanden Karl Schiller und Franz-Josef Strauß als Bonner „Plisch und Plumm“ die konzertierte Marktwirtschaft. Willy Brandt symbolisierte mit seinem Kniefall von Warschau Demut als Voraussetzung für die Aussöhnung mit dem Osten. Helmut Schmidt konnte sich danach sogar „Weltökonom“ nennen lassen. Der „Kaiser“- bürgerlich: Franz Beckenbauer - holte die zweite WM. Selbst die Chinesen schauten „Derrick“, und die halbe Welt war scharf auf die DM: So schön hatten es die Westdeutschen ihrer Erinnerung nach gehabt. Die Ostdeutschen wollten sich durch die Wiedervereinigung ihre Biographien nicht nehmen lassen: Wie lustig und frivol war es doch bei der FDJ zugegangen. Gemütlich war es mit den Familien in den Datschen. Hin und wieder hatte man den Funktionären mit den „Bonbons“ am Revers ein Schnippchen geschlagen. Es gab zwar kaum etwas Vernünftiges zu kaufen, aber man konnte fast alles organisieren. Die Kindergärten, die Betriebsfrisöre und –Saunen standen ständig für jedermann offen. Freundschaft galt mehr als der Tanz ums goldene Kalb – das war ohnehin schon längst in den Westen geflohen. Mit der Nazi-Vergangenheit hatte man nichts zu tun, das war Sache der Westdeutschen. Die DDR proklamierte ständig ihre Freundschaft mit der ruhmreichen Sowjetunion, und die Werktätigen wähnten dadurch den Frieden gesichert für ihr kleines Glück in der Nischengesellschaft: So kommod hatten die Ostdeutschen gelebt nach der Erinnerung vieler von ihnen. 2002 - zur Zeit der Globalisierung, der hohen Arbeitslosenquoten, des Terrorismus, der Militärinterventionen und der Insolvenzen – pflegen West- wie Ostdeutsche ihre Legenden der Erinnerung, weil sie sich gerne in eine einfachere Welt wegträumen. Dabei gilt es als politisch korrekt, den einen ihre heile Republik und den anderen ihre Biographien zu belassen, wie sie sich diese durch verklärte Blicke zurück jeweils verschaffen. Nur einer Gruppe unter den Deutschen wird es übel genommen, wenn sie ihre Vergangenheit verklärt: den ehemaligen West-Berlinern. Bei denen ist sich die Nation nur in einem Punkte einig: Diese „Frontstädter“ waren keine Ost- und keine Westdeutschen, sondern eine Sondergruppe, „Insulaner“ halt. Alle – bis auf die Berliner sagen heute, diese West-Berliner hätten in ihrer Halbstadt auf der faulen Haut gelegen – darin ihren Vettern in der andern Stadthälfte ähnlich. Die gebratenen Tauben seien den „Spreeathenern“ aus Bonn kommend in die Münder geflogen. Mit dem Geld anderer Leute hätten sie geprasst, opulente Opern inszeniert, den Verwaltungsapparat aufgebläht. Von nichts hätten sie eine Ahnung gehabt, dafür aber bei allem ein großes Maul. Trainingsanzug und Goldkettchen, dazu Schultheiß-Bier und Currywurst wären ihre Markenzeichen gewesen. Das kann so nicht bleiben: Auch West-Berliner haben ein Recht, sich Legenden über ihre eigene Herkunft zu bilden, denn auch sie müssen wie alle anderen Deutschen die Gegenwart ertragen. Direkt in Saus und Braus hatte es sich in der „Frontstadt“ eigentlich auch gar nicht leben lassen. Da war die allgegenwärtige Mauer, die spätestens nach einer halbstündigen Fahrt durch die Stadt auftauchte. Erinnerlich sind die sowjetischen Düsenjäger, die über dem Häusermeer die Schallgrenze durchknallten. Auf den Straßen spielten die 91 wehrflüchtigen Kinder der westdeutschen Bürger Revolution und Häuserkampf. Bei Bundestagswahlen durften die Berliner nicht mitwählen. Die Flugzeuge mussten auf dem Wege nach Berlin „Korridore“ benutzen, in 3000 m Höhe. Lufthansa durfte gar nicht fliegen. Wer die „Insel der Freiheit“ auf dem Landwege verließ oder besuchte, musste sich von missgelaunten Grenzern der DDR schikanieren lassen: „Öffnen Sie die Kofferhaube!“ Das war der Alltag in West-Berlin, und viele verließen die Stadt. Spitz wurde Berlinern auf Reisen durch die Bundesrepublik – „Westdeutschland“, wie es an der Spree hieß – gesagt, man könne doch in einer eingemauerten Stadt nicht richtig leben. Jedem West-Berliner trieb es die Zornesröte ins Gesicht, wenn er gefragt wurde, ob er aus Ost- oder West-Berlin käme. Als ob ein Normalbürger aus der „Hauptstadt der DDR“ hätte nach Westdeutschland reisen dürfen! Kam ein westlicher Spreeathener weiter in den „Westen“, in die USA gar, so wuchs ihm allerdings ein Heldenstatus zu. Er wurde als Freiheitskämpfer gefeiert. Das kompensierte allemal den Ärger über die „unwissenden“ Westdeutschen. Doch das sind nicht Erinnerungen, aus denen Legenden entstehen. West-Berliner Legenden haben Namen wie Ernst Reuter und Willy Brandt, Herbert von Karajan und Boleslaw Barlog, Bubi Scholz und Harald Juhnke oder „Otto Otto“ und „Knautschke“. Beim letzten Paar handelte es sich um einen allgegenwärtigen Kapellmeister und um ein Nilpferd im Zoo. Das waren noch Zeiten, als alle am Radio saßen und dem „Regierenden“ lauschten, wenn er wöchentlich unter „Wo uns der Schuh drückt“ zu den Berlinern sprach. Da kommt der „Rias“ in Erinnerung mitsamt den „Insulanern“, dem sprudelnden Theaterkritiker Friedrich Luft und seiner sonntäglichen Viertelstunde: „Bitte, Herr Luft!“ All die Radiohelden werden wieder lebendig wie „Onkel Tobias“, Hänschen Rosenthal oder Ivo Veit („Das ideale Brautpaar“). „Straßenfeger“ hatte es reihenweise gegeben. Sendungen wie „Es geschah in Berlin“ oder die „Schlager der Woche“ fesselten die Berliner über die Radiowellen an zu Hause. Viele ehemalige West-Berliner kuscheln sich in eigene Legenden zurück: „Damals hat die halbe Welt auf uns geguckt.“ Genau so hatte es Ernst Reuter gewollt: „Ihr Völker der Welt...“ Waren nicht alle gekommen, um zu schauen? Die französischen Staatspräsidenten, die englische Königin und die amerikanischen Präsidenten waren in der Stadt. Der charismatische John F. Kennedy bekannte sich als „Berliner“. Wie hatte die Welt die moderne Architektur des Hansa-Viertels bewundert und die der Philharmonie Scharouns, der Nationalgalerie Mies van der Rohes oder des Hochhauses Corbusiers. Die West-Berliner waren „Insulaner“ und fühlten sich wie Weltbürger. Wie herzlich war der Kontakt der politischen Klasse zu den Schutzmächten, den Briten, Franzosen und Amerikanern. So manche Casinofête kompensierte die Unerreichbarkeit von Kyritz oder Cottbus bei weitem. Und Jahr für Jahr war die große Welt der Illusionen hier zu Gast, wenn in den Palästen am Kurfürstendamm die Filmfestspiele abliefen. Was waren die Berliner stolz auf ihre Stadtautobahnen: Weg mit den altmodischen Straßenbahnen! Wie in Los Angeles sollte es werden: die autogerechte Stadt. Hamburg oder München konnten da nur vor Neid erblassen. Autobahntangenten und –Ringe würden Berlin zu einem Paradies der Autofahrer werden lassen. War das nicht schön? Ehemalige West-Berliner erinnern sich mit Wohlgefühl. Ihre Repräsentanten waren kosmopolitisch. Die Berliner galten etwas in der Welt. Dass Berlinförderung und –Hilfe in die Stadt flossen, galt ihnen als Prämie für die Standorttreue nur als recht und billig. Wehmütig werden Träumer von heute, wenn sie an ihre einstigen Landesregierungen denken. Das waren noch Senatoren: Joachim Tiburtius, Ella Kay, Karl Schiller, Adolf Arndt oder Norbert Blüm. Welches Format hatten auch weitere Bürgermeister neben Ernst Reuter und Willy Brandt: Die tapfere Louise Schröder, der steife Otto Suhr, der vornehme Richard von 92 Weizsäcker oder der korrekte Hans-Jochen Vogel. Die Nostalgiker werden schwermütig, denken sie an aktuelle Besetzungen im Roten Rathaus. Wie war West-Berlin wirklich? Eingeengt war es, überaltert, gesellschaftlich ausgedörrt, vom Westen „gehalten“ aber trotz allem politisch und kulturell kreativ. Wie war die DDR wirklich? Sie war gesellschaftlich verödet, lag moralisch danieder, war eine Kolonie der Sowjetunion. Aber immerhin war sie bigott genug, den Bürgern eine Portion schlichten privaten Glücks zu lassen. Und wie war „Westdeutschland“? Es war materialistisch eingestellt, lebte ohne Bewusstsein über die Lage der gesamten Nation. Es hatte Schonzeit und konnte sich so als Bürgergesellschaft und leidlich funktionierende Demokratie entfalten. Diese hat sich nun in ganz Deutschland durchgesetzt. Die Gegenwart ist voller Probleme - wie jede Vergangenheit als diese noch Gegenwart war. Wird Gegenwart Vergangenheit, entstehen in den Köpfen und Herzen der Menschen Legenden. Die haben therapeutische Wirkungen, lassen die Gegenwart erträglicher erscheinen. Einst in schlimmen Zeiten hatten die Deutschen vom einem idealisierten Kaiser Barbarossa geträumt, der wiederkehren und die Dinge richten würde. So wurde die Wirklichkeit weniger deprimierend. Heute tragen viele ehemalige Ostdeutsche ihre DDR-Biographie wie ein Schutzschild vor sich. Altgediente Bundesbürger denken zurück an eine heile Republik. Da sollten alle es ertragen, wenn einstige West-Berliner von Zeiten schwärmen, in denen sie unter den Deutschen etwas besonderes gewesen wären.“ f) Theater in die Hauptstadt (2001) „Das Schillertheater sollte als Spielstätte der Bühnen der ostdeutschen Länder in der Hauptstadt genutzt werden. Die ostdeutschen Theater bekämen einen Ort, an dem sie ihre Produkte der überregionalen Presse und Öffentlichkeit präsentieren können. Da Berlin und die fünf Bundesländer sowie die Theaterstädte gemeinsam als Träger auftreten, sind die Kosten für alle Beteiligten gering. 1. Die Situation Das Schiller-Theater in Berlin-Charlottenburg, Bismarckstraße 110 ist seit seiner Schließung ein Mahnmal des Kulturabbaus im wiedervereinigten Deutschland und seiner Hauptstadt Berlin. Vor seiner Schließung durch den ersten gesamtberliner Senat nach 1990 war das Schiller-Theater eine der bedeutendsten Bühnen der Stadt, zeitweise das wichtigste Theater Deutschlands. Das Theater wurde 1905 bis 1906 vom Münchener Architekten Franz Littmann gebaut und bot 1350 Zuschauern Platz. Das Gebäude wurde im Kriege zerstört und 1950 neu gebaut wieder eröffnet. Große Intendanten wie Heinrich George und Boleslaw Barlog gaben der Bühne überregionale Ausstrahlung. Die Zahl der Spitzenschauspieler, die an diesem Orte wirkten - wie Gustav Gründgens, Gisela Uhlen, Johanna Maria Gorvin, Johanna von Koczian, Ernst Deutsch, Klaus Kammer, Ernst Schröder, Bernhard Minetti oder Boy Gobert - , ist groß. Unter Barlog war das Schiller-Theater die führende Theaterbühne im deutschen Sprachraum und das Spitzentheater Berlins. Noch als es geschlossen wurde, hatte das Theater eine Erfolgsinszenierung im Repertoire: “Hase Hase” mit Katharina Thalbach. Seit der Schließung fristet das Schiller-Theater ein kümmerliches Dasein als Gastspielbühne für Musicals, Unterhaltungsprogramme verschiedenen Niveaus und gelegentlich auch als schlichter Versammlungsraum. Bis zum Jahre 2000 wurde das Theater aus seinem kulturellen Dornröschenschlaf für kurze Zeit jeweils im Mai erweckt, wenn die Berliner Festspiele hier ihr Theatertreffen veranstalteten. Wenn das Schauspielhaus Hamburg 93 oder das Zürcher Schauspielhaus hier gastierten, lebte noch einmal die alte Atmosphäre auf, die jahrelang vom künstlerischen Glanz dieser Bühne ausgegangen war. Als im Jahre 2000 ein personeller, künstlerischer und organisatorischer Neuanfang der Berliner Festspiele beschlossen wurde und der Bund hierbei die Verantwortung übernahm, war damit auch die Entscheidung verbunden, das Gebäude der ehemals Freien Volksbühne in Berlin-Wilmersdorf, Schaperstraße als ständigen Spielort der Festspiele zu nutzen. Für den Erhalt des Kulturstandortes Schaperstaße war das eine wichtige Entscheidung, für das Schillertheater jedoch verhängnisvoll. Bei der Berliner Bezirksreform wurden die Verwaltungsbezirke Charlottenburg und Wilmersdorf ab 2001 zusammengelegt. Somit hat der neue Bezirk der Weststadt neben kulturellen Glanzpunkten wie der Schau- und Volksbühne sowie der Deutschen Oper eine kulturpolitisches Defizite. Dazu gehört neben dem Theater des Westens vor allem das Schillertheater. Aufgrund der überregionalen Bedeutung des Theaters in der deutschen Geschichte ist das kein kommunales oder landespolitisches Thema allein, sondern ein überregionales. Die jetzt vom Senat ins Spiel gebrachten Lösungen, das Schillertheater als Ausweichspielstätte für in Renovierung befindliche Häuser oder als Appendix des Theaters des Westens zu behandeln, sind unangemessen. 2. Das Projekt Ziel aller kulturpolitscher Bemühungen auf allen Ebenen vom Bezirk über das Land bis hin zum Bund muß es sein, das Schillertheater in Berlin als Theaterstandort zu sichern und anderweitige Nutzungen zu verhindern. Durch ihre Geschichte ist die Bismarckstraße 110 ein kultureller Ort sui generis. Die Wahl der Volksbühne für das jährliche nationale Theatertreffen weist für das Schillertheater die Richtung für einen Erhalt dieses Standortes: Während in der Schaperstraße die großen überregionalen Spitzenleistungen eine Theaterjahres im deutschsprachigen Raum gezeigt werden sollen, könnte das Schillertheater eine regionale Dependance hierzu werden. Es sollte der Ort für eine Präsentation des Theaterlebens im deutschen Osten sein und dabei insbesondere Nachwuchsproduktionen in Berlin präsentieren. Unter dem Motto “Theater in die Hauptstadt” sollten die Bühnen der neuen Länder im Schillertheater einen würdigen Ort haben, an dem sie ihre besten und interessantesten Produktionen zeigen könnten. Allzuoft werden gute Theaterleistungen in Cottbus, Schwerin, Leipzig oder Magdeburg nicht überregional bekannt, weil die Vermittlung durch dir großen Feuilletons ausbleibt. Dieses Manko läßt sich an der Bismarckstraße in Berlin ausgleichen. Möglich ist es, sowohl eine zeitlich begrenzte Präsentation in Form von Theaterwochen durchzuführen als auch eine über das Jahr verteilte Abfolge von ausgewählten Inszenierungen aus den verschiedenen Städten. 3. Die Träger Träger des Projektes sollten sein: a) Charlottenburg-Wilmersdorf, b) Berlin, c) der Bund, d) die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, e) die Theaterstädte der fünf Bundesländer, f) eventuell die EU, g) ein zu gründender privater Verein “Theater in die Hauptstadt”. 94 Der Beitrag Charlottenburg-Wilmersdorfs könnte darin bestehen, daß der Bezirk die Geschäftsstelle, den organisatorischen Anlaufspunkt, stellt. Insbesondere in der Vorbereitungsphase müßte ein hier zu bildendes Büro der Koordinierungsort sein. Das Land Berlin muß seine Erfahrungen im Kulturmanagement zur Verfügung stellen und sich zu einem Sechstel am Länderbeitrag beteiligen. Der Bund wird aufgrund seiner Verpflichtung zur Pflege des kulturellen Erbes im Osten Deutschlands einer der Träger des Projektes. Die fünf Bundesländer zahlen wie Berlin zu gleichen Teilen einen Zuschuß an “Theater in der Hauptstadt” und wirken an der Koordinierung dieser Institution mit. Ebenso wie die Länder beteiligen sich die Theaterstädte´ zu gleichen Anteilen an der Finanzierung mit geringeren Beträgen. Es ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang EU-Mittel für das Projekt eingeworben werden können. Ein Verein “Theater in der Hauptstadt” übernimmt Förderfunktionen. Durch die Vielzahl der an dem Projekt beteiligten Institutionen bleibt deren finanzieller Beitrag in jeweils bescheidenen Größen. “Theater in der Hauptstadt” beschäftigt zudem keine eigenes künstlerisches Personal, allenfalls - sofern diese Aufgabe nicht von einem Träger übernommen wird - ein Koordinationsbüro mit einem Geschäftsführer, einem Angestellten, einer Sekretärin und technischen Hilfskräften. Die in Berlin zur Aufführung kommenden Aufführungen werden von der jeweiligen Regionalpresse und dort zu bestimmenden Vertrauenspersonen ausgewählt. Die gastspielgebenden Theater organisieren ihre Tournee und die Durchführung der Gastspiele jeweils selber. Der Geschäftsführer wird in seiner Arbeit unterstützt von einem Beirat, in dem die Theaterreferenten der beteiligten Bundesländer und des Bundes sowie der für Kultur zuständige Stadtrat des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin versammelt sind. Einmal jährlich versammeln sich in Berlin die Intendanten der beteiligten Bühnen zu einer Konferenz. Die Rechtsform von “Theater in der Hauptstadt” muß definiert werden, denkbar ist die einer GmbH.“ 11. Sozialer Rückbau als „Reformen“, und wer reformiert die „Reformer“? a) Föderalismus Im Dezember 2004 scheiterte die Föderalismuskommission. Kann man den Föderalismus mit seinen eigenen Mitteln kurieren? Die vom Bundestag und vom Bundesrat eingesetzte Föderalismus- oder Bundesstaatskommission hat kurz vor Weihnachten erneut versagt. Schon im Herbst hatte sie es versäumt, einen Zwischenbericht vorzulegen. Diese „Kommission“ konstituierte sich am 7. November 2003. Ihr gehören 56 ordentliche und eine gleiche Zahl stellvertretender Mitglieder an. Der Name „Kommission“ ist hierfür wohl kaum treffend. Es ist eine Versammlung: 16 Vertreter des Bundesrats - damit ja auch jedes Bundesland dabei ist - und entsprechend 16 Mitglieder des Bundestages gehören ihr an. Dazu kommen Vertreter der Bundesregierung, der längst ins Abseits des Bundesstaates geratenen Landtage, der ebenfalls machtlosen kommunalen Spitzenverbände sowie 12 Sachverständige, unter denen sich so „unabhängige“ Experten wie die früheren Bundesminister Edzard SchmidtJortzig (FDP) und Rupert Scholz (CDU) befinden. Diese alle mußten ihre Vorschläge ständig vorbesprechen, Diskussionen in der „Kommission” wiederum rückkoppeln. Sie durften dabei die Interessen jener Institutionen nicht aus den Augen verlieren, die sie nominiert hatten. Es wurde eine „Kommission“ genannte Versammlung 95 eingesetzt, welche das Grundübel des bundesdeutschen Föderalismus – die vom Politikwissenschaftler Fritz W. Scharpf so genannte „Politikverflechtungsfalle” - mit der Methode eben der Politikverflechtung beseitigen sollte. Warum hatte die Bundesregierung – so fragten sich einige von Anfang an - keinen Entwurf zur Änderung des Grundgesetztes vorgelegt, um aus der Falle herauszukommen? Warum förderte die Regierung stattdessen die Einsetzung eines Monstergremiums wie die Bundesstaatskommission? Nach dem vorläufigen und vom Bundeskanzler geförderten Scheitern jeglicher Reformen scheint die Antwort klar zu sein: Die Regierung will eigentlich gar keine Reform. Für sie ist es nicht schlecht, daß sie auf den „Vetospieler“ Bundesrat hinweisen kann, wenn sie wieder einmal mit einem Vorhaben scheitert. Für die Bundesregierung sind die Beteiligung an „Gemeinschaftsaufgaben“ wie bei den Hochschulen, an Mischfinanzierungen wie bei der Kultur, an der Verantwortung für die innere Sicherheit nicht schlecht, denn da kann sie überall in die Länder hineinregieren. Und von diesen Möglichkeiten macht die Bundesregierung nicht erst seit dem Amtsantritt von Gerhard Schröder kräftigen Gebrauch. Das ist ein Paradoxon des gelebten Föderalismus in Deutschland: Daß die Ministerpräsidenten der Länder einerseits den Bundesrat als nationale Bühne benutzen und den Eindruck erwecken, als wären sie alle 16 große Staatsmänner und die Chefs von 16 Nebenregierungen auf gleicher Augenhöhe mit der Bundesregierung und daß die Bundesregierung andererseits über Gemeinschaftsaufgaben, Mischfinanzierungen und Rahmengesetze die Länder auf ihren eigenen Gebieten kujoniert. Die Leidtragen sind neben den nicht mehr durchschauenden Bürgern die Landesparlamente und der Bundestag. Denn die Landesparlamente haben in Bundesratssachen und bei Staatsverträgen praktisch nichts zu sagen, und der Bundestag kann beschließen, was er will: Wenn es dem bürokratisch abgeschirmten Bundesrat nicht paßt, ist das alles wertlos. So kommt es, daß die Ministerpräsidenten im Bundesrat das große Wort über Bundespolitik führen, während die Ministerialbürokratie des Bundes es einem Bundesland vorschreibt, ob es an der Universität X eine neue Fakultät aufmachen darf oder nicht. Selbst da, wo der Bund den Ländern Leine gelassen hat, hatte er sie als nützliche Idioten benutzt: Wo einige Länder aus purer Finanznot danach lechzten, die Rechte der Beamten zu beschneiden, ließ der Bund sie gewähren und ersparte sich den Ärger mit der entsprechenden Lobby. Was soll da eine Kommission? Regierung und Bundesrat sind schließlich als Verfassungsorgane dazu geschaffen, Reformen in Gang zu setzen, wenn diese notwendig sind! Also hätte die Bundesregierung eine Grundgesetzänderung initiieren können, welche die Aufgaben von Bund und Ländern säuberlich trennt, den Ländern Eigenverantwortung gibt, das Finanzaufkommen gerecht – das heißt auch an der wirtschaftlichen Leistungsstärke orientiert – verteilt und den Anteil der im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze auf das Allernotwendigste reduziert. Die Bundesregierung hätte vorschlagen können, die horizontalen und vertikalen Finanzströme zwischen den Ländern und dem Bund zurückzudrängen und einen Konkurrenzföderalismus zu schaffen, bei dem die stärkste Region die größten Vorteile hätte und die schwächste sich eben anstrengen müßte. Ja, die Bundesregierung hätte sogar noch weiter gehen können: Sie hätte anregen können, das auf dem ganzen Erdenball einmalige Unikum Bundesrat, wo Regierungsvertreter über Gesetze abstimmen, abzuschaffen und statt dessen eine wirkliche zweite Kammer einzusetzen, deren Mitglieder vom Volke zu wählen wären: Modelle dafür gibt es genug in der Welt. All das hat die Bundesregierung nicht getan. Sie hat es nicht getan, weil sie 1. vordergründig eine Reform des Föderalismus nicht will und weil 96 2. ihre Akteure - ebenso wie die Kollegen in den Ländern - nicht anders können als in den Kategorien der Politikverflechtung zu denken und zu handeln. Die Mitglieder unserer Bundesregierung und die Ministerpräsidenten: Sie sind Junkies des Gebens und Nehmens, des Konsenses unter Politikern, und sie scheuen den offenen Konflikt wie die Pest. Deshalb haben sie die Monsterkommission eingesetzt. Deshalb hat der Berg gekreist und noch nicht einmal eine Maus geboren. Diese Maus wenigstens schien im Wachsen, denn lange galt unter Experten als sicher, daß die Kommission nicht viel, aber immerhin dies beschließen würde: Änderungen oder Streichungen der Grundgesetzartikel 84 (Verfahrens- und Organisationsrecht der Länder), 75 (Rahmengesetzgebung), 91 a und b (Gemeinschaftsaufgaben), 23 (Europa) und 22 (Bundeshauptstadt Berlin). Durch den Einsatz der Hebammen Franz Müntefering und Edmund Stoiber schien daraus zu werden, daß der Bundesrat zurückgedrängt würde, den Ländern keine Kosten vom Bund oktroyiert werden könnten, das Beamtenrecht geändert, Zuständigkeiten und Finanzen neu geregelt, das Umweltrecht dem Bund zugeschlagen würde und die Länder zu einer EuropaSolidarität verpflichtet worden wären. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Viele erwarten, daß eine Maus solcher Art nach einem Moratorium doch das Licht der Welt erblicken werde. Manche wünschen, daß Bundespräsident Horst Köhler – der die Vorteile angelsächsischer Konfliktkulturen verinnerlicht hat – einen Weg weist. Wäre eine kleine Reform zu begrüßen oder zu befürchten? Zu begrüßen wäre sie, weil es einige notwendige Korrekturen an unserer Verfassungswirklichkeit gäbe. Zu befürchten wäre sie, weil die „politische Klasse“ genannte Gemeinschaft der Junkies des Politikverflechtung weiterhin ihren Stoff erhielte und Deutschland benebelte anstatt die Kräfte des offenen politischen Konfliktes und der ökonomischen Konkurrenz als Quellen von Innovation, Fortschritt und wachsendem Wohlstand frei zu setzen. b) Globalisierung Schon vor dem Zusammenfall des Sowjetimperiums waren die kleinen Tiger in Ostasien auf dem Sprung. HighTech-Produkte wurden dort in mindestens ebenso guter Qualität hergestellt wie in Deutschland. Aber die Kosten, insbesondere die heute berühmten Lohnnebenkosten, waren wesentlich geringer als daheim. Wer darüber hinaus in Hongkong oder Singapur eine Baustelle beobachtet hatte, konnte sehen, wie man auch bauen kann: Tag und Nacht, sonn- und feiertags, mit geringem technischen Aufwand, dafür mit dem billigen Einsatz von Menschen, Menschen und Menschen. Einfachere Waren wurden in dieser Zeit in den Schwellen- und Dritte-Welt-Ländern längst günstiger produziert als in Europa. So kam es, daß ganze Wirtschaftszweige wie die Textilindustrie zu Hause eingegangen waren und sich weiter südlich auf dem Globus angsiedelt hatten. Wir nahmen es gelassen hin. Auch hatten wir uns daran gewöhnt, daß andere technisch offensichtlich pfiffiger wurden als wir, die einst ihre Lehrmeister waren. Die Japaner expandierten auf dem Automarkt, übernahmen weitgehend die optische Industrie und die Unterhaltungselektronik. Ein Fotoapparat „Made in Germany“ ist heute ein Unikum, Anwärter auf das Museum für Verkehr und Technik. Dabei hatten wir noch Glück, daß der US-Dollar lange Zeit hoch bewertet war, sonst hätte unsere Automobilindustrie noch mehr zu kämpfen gehabt. Wer aber sich in den USA umsah, der konnte schon vor zehn Jahren feststellen: Auch hier ist das Produzieren von Waren billiger, auch hier sind die Lohnnebenkosten niedriger als in Deutschland. 97 Wir wußten das alles, und waren sogar stolz darauf. Wir hätten eben eine solide Mittelschichtengesellschaft, hieß es. Der radikale Gegensatz zwischen wenigen Reichen und vielen Armen sei uns wesensfremd. Bei uns würden die Menschen noch andere Werte kennen als nur Arbeit und Geld: Freizeit, Kultur, Sport und Bildung wären im Leben wichtig und hätten daher in Deutschland einen hohen Stellenwert. Vor allem waren wir stolz auf unser Gesundheits- und Sozialsystem. In England schon könne man fortwährend Menschen sehen, die mit Lücken im Gebiß herumliefen. In den USA würde man im Krankheitsfall nicht ausdauernd und gründlich behandelt, und in der Dritten Welt verendeten die Kranken auf den Straßen. Das alles gäbe es in Deutschland nicht, brüsteten wir uns. Die ungleiche Verteilung der Chancen auf der Welt wurde beim Blick über die Grenzen der kleinen Bundesrepublik zwar erkannt auch bedauert. Aber das geschah mit dem wohligen Gefühl, zu den Privilegierten zu gehören. Wenn Gleichheit in der Welt hergestellt werden sollte, dann auf dem westeuropäischen Niveau. Wir waren nicht ohne Bigotterie. Der Konflikt mit dem protektionistischen Sowjetsystem stabilisierte unsere Lage. Nun, nach seinem Zusammenbruch gilt nur noch Global Playing, und die Arbeiter sind nicht nur in Ostasien preiswerter, sondern schon in Polen. Microsoft und Internet sind Sprache und Schrift der eins gewordenen Weltwirtschaft. Da stört es nicht länger, daß auf der Erde nach wie vor tausende Kulturen siedeln. Wer weltweit operiert, für den sind die Kulturen wie Staaten keine Hindernisse: Er entwickelt und produziert dort, wo es betriebswirtschaftlich am günstigsten für ihn ist. Spiel ohne Grenzen! Erstaunlich ist, welchen Wandel dieses Spiel im deutschen Wertegefüge auslöste. Panikartig rennen wir der Globalisierung hinterher. Nun ist es nicht mehr unser Niveau, auf das die anderen gehoben werden sollen, sondern wir müssen uns den anderen, den wirtschaftlich erfolgreicheren, anpassen. Also runter mit den Lohnnebenkosten, was das Zeug hält und Aufknüpfen des sozialen Netzes, wo immer es geht! In der Sprache der jetzt allenthalben auftretenden Wirtschaftsjuppies heißt es: „Wir machen uns fit für den Weltmarkt.“ Die Menschen der Mittelschichten, auf die wir so stolz waren, müssen sich jetzt bewähren. Entweder sie schaffen es, oben in der Leistungsgesellschaft mitzumachen oder die sacken ab in untere Schichten. Wenige sehr Reiche und viele Arme wird es auch hier geben. Wir finden uns damit ab. Anders, so sagen uns die Apologeten der Global Players, gehe es nun `mal nicht. Würden wir uns abschotten, bekämen wir noch mehr Arbeitslose und soziale Probleme. Und wir sehen das ein. Welch ein Wandel in der Gesellschaftspolitik wird da schon den Bürgern der alten Bundesrepublik zugemutet. Die ehemaligen DDRler aber, die mit den Werten soziale Gleichheit und soziale Sicherheit aufgewachsen sind, müssen nun begreifen, daß in der von ihnen einst so ersehnten DM-Gesellschaft das genaue Gegenteil des verblichenen Realsozialismus gilt. Einst hieß es, wenn die DM nicht zu uns kommt, gehen wir zur DM. Jetzt ist die DM zwar da, aber schon im Gehen begriffen, um dem Euro Platz zu machen. Was die Westler als Veränderung der Werte erleben, stellt sich für die Ostler als glatte Kehrtwendung der Verhältnisse dar. Ist das alles Schicksal, gar Gottes Wille? Schon gehören die fleißigen Chinesen in Singapur ebenfalls zu den Privilegierten in unserer Welt. Die Japaner haben uns sowieso überholt, und die USA - wo die Menschen härter schuften als bei uns - sind die Weltmacht. Wenn wir uns fit machen für den Weltmarkt: An wessen Niveau wollen wir uns orientieren und anpassen? An das der Koreaner, der Marokkaner oder der Inder? Sie alle sind auf dem Weltmarkt und bieten an, was und wie sie es können. Es scheint, als hätten wir mit dem Wandel und der Verkehrung unserer Werte, mit dem Einfügen unserer Volkswirtschaft in die Weltwirtschaft eine Entwicklung losgetreten, an deren Ende wir tief unten landen könnten. Wo sind Sicherungen gegen diese Talfahrt? Die Politik 98 denkt bis zur nächsten Wahl. Wir setzen etwas in Gang, wissen am Ende aber nicht genau, wie es enden wird. Werden die vom Wohlstand Ausgeschlossenen resignieren oder rebellieren? Werden Arbeitslose und Elende ebenso über den Erdball irren wie die Global Players der Marktwirtschaft? Niemand weiß, was das Ende von dem sein wird, was wir jetzt beginnen. Falls auch hierzulande die Krankenkassen für viele zu teuer sein werden sollten, das Arbeitslosenheer anwachsen würde, Bildung und Kultur reiner Luxus würden, die Renten absackten und Alter zur Schande würde - Reiche alles und Arme gar nichts hätten - dann würden viele stöhnen: „Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werd´ ich nun nicht los!“ Aber dann wäre es zu spät. Wir brauchen eine Wende der Wende und zwar heute. Mag uns ein anderes Klassikerwort auf den Weg helfen: „Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Es ist fahrlässig, die Schleusen des Marktes so weit wie möglich zu öffnen, soziale Kostenträger davonzuspülen und abzuwarten, was daraus wird. Wir haben die Marktwirtschaft geerbt mit dem Beiwort „sozial“. Als Regulator des freien Marktes hatten wir den Staat akzeptiert. Er federte soziale Gegensätze zum Wohle aller ab. Nun verlieren die Staaten ihren wirtschaftlichen Einfluß weitgehend, weil das ökonomische Spiel weltweit ausgetragen wird. Die Epoche der Nationalökonomien ist zuende. Die Konsequenz daraus ist eigentlich klar: Den weltweiten ökonomischen Spielern muß ein globales Regulativ an die Seite gegeben werden. Für diese Aufgabe ist selbst die EU zu begrenzt. Es ist die Verantwortung der Vereinten Nationen. Dort muß Deutschland zusammen mit vergleichbaren Staaten sein Erbe der sozialen Marktwirtschaft als Grundidee einbringen. Wir benötigen ein Modell der sozialen Korrektur des reinen Weltmarktes. Es muß eine global wirksame Sozialtechnologie geben, in der unter den Bedingungen der Weltwirtschaft soziale Mindeststandards definiert und garantiert werden. Lassen wir uns nicht bedingungslos von der rein ökonomischen Globalisierungseuphorie mitreißen. Die Weltunternehmer schaffen ein neues ökonomisches Niveau der Menschheit, aber sie erzeugen zugleich globale soziale Probleme. Die zu vermeiden oder zu beseitigen, ist nicht ihr Beruf. Also müssen die Staaten - die ihre Ziele ohnehin neu definieren müssen - die Rolle der sozialpolitischer Global Players einnehmen. Das ist das Spiel vor allem derjenigen, die das Prinzip des Ausgleichs in den engeren Volkswirtschaften der vergangenen Epoche durchsetzen konnten. Es ist eine Frage der Zeit, daß in der Öffentlichkeit nach der sozialen Komponente weltweiten Zusammenlebens gefragt wird. Wenigstens, daß die „soziale Komponente“ nicht gewaltsam definiert wird, sollte das Ziel möglichst vieler sozialpolitischer Global Players sein. Sie müssen schleunigst aufs Spielfeld! c) Politikermoral Immer `mal wieder kommt die Frage auf: Wie viele zusätzliche Jobs darf ein dem ganzen Volke verpflichteter Abgeordneter neben seinem Amt haben? Und welche Jobs passen zum Mandat, welche hingegen nicht? Die Bundestagsabgeordneten sind – weil es das Bundesverfassungsgericht wollte - so gut bezahlt, daß sie die Kosten des alltäglichen Lebens mühelos aufbringen können. Die Diäten liegen derzeit bei 7900 Euro, dazu gibt es eine steuerfreie Kostenpauschale von 3417 Euro. Mit diesem Geld soll jeder Abgeordnete nicht schlicht „versorgt" werden, sondern er soll seinem hohen Amt als Mitglied des wichtigsten Verfassungsorgans Bundestag gemäß „ausgestattet" sein. Das heißt, den Beamten, den er zu kontrollieren muß, soll er im Status gleichwertig gegenübertreten. Die personellen und materiellen Ressourcen für sein Amt soll er aufbringen können. Dafür können die Wähler verlangen, daß er seiner politischen Auffassung folgend und sachkundig entscheidet, dabei 99 innerlich frei und seinem Gewissen verpflichtet bleibt. Gegenleistungen sind sowohl das solide Einkommen als auch die Befriedigung der Abgeordneten an der Teilhabe an der Macht oder wenigstens an der Nähe zu ihr. So wie die Stellung der Bundestagsabgeordneten geregelt wurde, ist in der Bundesrepublik möglich, was zu Beginn des vorigen Jahrhunderts vom Altmeister der Sozialwissenschaften, Max Weber, noch als nicht vereinbar beschrieben wurde: Daß Politiker nicht nur „für" die Politik, sondern auch „von" der Politik leben können. Auch derjenige, der nicht vermögend ist und keine „auskömmliche private Lebensstellung" hat, soll „für" die Politik leben können, weil er auf jeden Fall „von" ihr leben kann. Nun gibt es Abgeordnete, die neben ihrem auskömmlichen Mandat einem Beruf nachgehen, - wenn auch nur teilweise, denn die Wahrnehmung eines Mandats verschlingt viel Zeit. Das ist zu begrüßen, wenn ein Abgeordneter dadurch zweierlei erreicht: Daß er zum einen durch seinen außerpolitischen Beruf Kontakte zum „wirklichen Leben" außerhalb des „Raumschiffs Politik" wahrt oder daß er sich zum andern wie durch ein Trockentraining fit hält für eine Aufgabe außerhalb der Politik. Denn in einer richtigen Demokratie gehört es dazu, daß Abgeordnete nach einer Zeit ihre Mandate verlieren: Politik braucht den Wechsel, und ehemalige Abgeordnete brauchen einen ordentlichen Beruf. So weit, so gut. Es gibt jedoch Abgeordnete, die ihr Mandat als Angebot für neuerdings als „Beratung" bezeichneten „innerparlamentarischen Lobbyismus“ – ein sprachlicher Widersinn drückt eine politische Perversität aus feilbieten. Das ist nicht in Ordnung. Denn erstens kommt bei solchen Politikern der Appetit beim Essen: Sie begeben sich in immer mehr Beraterzusammenhänge, weil sie dadurch nach Einkommen und Prestige in höhere Ligen aufsteigen. Dort zu sein, macht wiederum süchtig nach noch mehr. Um diese Sucht zu befriedigen, brauchen die Abgeordneten das Mandat: immer wieder. Das Prinzip des Mandats auf Zeit wird infrage gestellt. Und zweitens wird das Mandat Mittel zu einem persönlichen Zweck: Die Abgeordneten machen sich zum innerparlamentarischen Agenten für Sachen, zu denen sie sich von gut zahlenden Auftraggebern vertraglich verpflichtet haben. Dabei geht es immer um „Sachen“, bei denen das Parlament Relevantes entscheiden kann – sonst hätte das Ganze keinen Sinn. Können jedoch solche Abgeordnete nur ihrem Gewissen verpflichtet für das ganze Volk arbeiten? Das ist zweifelhaft. Was ist zu tun? Helfen können Transparenz und Kontrolle. Transparenz: Mittlerweile sind die Bundestagsabgeordneten verpflichtet, Angaben über außerparlamentarische Einbindungen zu publizieren. Das ist gut, denn so kommt es gelegentlich heraus, wenn die Metamorphose eines Mandats in eine Beratungsagentur zu krass ist. Doch wer versteht schon die codierten Angaben mancher Abgeordneter über ihre sonstigen Verpflichtungen? Die Öffentlichkeit müßte konkret erfahren, in wessen Auftrag jemand in welcher Sache berät. Das würde sicher die Zahl der Aufträge verringern, was kein Schaden für das politische System wäre. Kontrolle: Die nächste Wahl naht. Die Parteien tragen die Verantwortung für ihre Kandidaten. Sie müssen Sensibilität dafür entwickeln, daß Mandate - jedenfalls im Bundestag - materiell und politisch selbsttragend sind. „MdB“ zu sein ist ein Wert an sich. Da bedarf es keiner Draufsattlungen. Gerade die ohnehin wenig angesehen Parteien müssen darauf achten, daß Mandate nicht zum Humus werden, auf dem mächtige Interessenten ihre Blüten treiben lassen. d) Direkte Demokratie 1. 100 Seit Jahren mehren sich Stimmen im Lande, die nach direkter Beteiligung der Bürger an Entscheidungen im politischen System rufen. Volksbegehren und Volksentscheide sollen die Macht der Parlamente begrenzen; Mitgliederbefragungen bei den politischen Parteien werden als Mittel gegen die Vorherrschaft der Funktionäre gesehen. In der deutschen Öffentlichkeit gibt es keinen Konsens mehr darüber, daß die Verfassung repräsentativ sein soll und Plebiszite zu vermeiden seien. Diesem Konsens hatte der Parlamentarische Rat entsprochen als er unter dem Eindruck der von Nazis herbeigeführten Katastrophe das Grundgesetz schuf. Nach 1945 war man sich weitgehend einig, daß Strukturfehler der Weimarer Republik es der NSDAP unter Adolf Hitler erleichtert hatten, die Macht zu ergreifen. Als derartige Strukturfehler wurden die fehlende Anerkennung der politischen Parteien, die schwache Stellung des Kanzlers gegenüber dem Reichspräsidenten und die zu weit gehende plebiszitäre Einfärbung der Verfassung - beispielsweise bei der direkten Wahl des Präsidenten - gesehen. Im Grundgesetz dagegen wurde ausdrücklich erwähnt, daß die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken, der Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmen sollte, und der Präsident des Staates wurde fortan von einem repräsentativen Gremium - der Bundesversammlung - gewählt. Die Parlamente von Bund und Ländern sollten für die Zeit ihrer Mandate Entscheidungen treffen ohne jeweils beim Wahlvolk nachfragen zu müssen. Die repräsentative Struktur des Grundgesetzes war eine der Ursachen für den Erfolg, die politische Stabilität der Bundesrepublik. Sie bewirkte aber auch, daß sich eine Schicht von Berufspolitikern aller Parteien etablierte, die Herrschaft als ihr Privileg betrachtete und zusehends verdrängte, daß sie nur auf Zeit in ihre Ämter berufen war. Dagegen wandten sich Bürgeriniativen und Alternativbewegungen. Die auf diesem Boden ins etablierte Parteiensystem eingedrungene Partei der Grünen ist mittlerweile nicht nur ebenso verfestigt wie ihre Konkurrenten, sondern diese haben sich auch der einstigen alternativen und grünen Themen bemächtigt. So konnte es geschehen, daß die altehrwürdige SPD ihren Kanzlerkandidaten eines Tages per Mitgliederbefragung erkor und daß die Parlamentspartei par excellence, die FDP, es als angemessen empfand, bei sich Mitgliederbefragungen abzuhalten. Daß die Parteien sich auch für ihr eigenes Innenleben plebiszitären Verfahren öffnen, hat mehrere Gründe. So glauben sie, für die Wähler durch die Spektakel der Befragungen attraktiver zu sein als mit althergebrachten Parteitags- oder Vorstandsbeschlüssen. Weiterhin können Vorstände sich mit der Mitgliederbefragung als der Klemme befreien, wenn sie entscheidungsunfähig sind: Auf diesem Wege wurde Rudolf Scharping Kanzlerkandidat. Oder die Vorstände hebeln mit einer Mitgliederbefragung unliebsame Parteibeschlüsse aus. Das war bei der Befragung der FDP-Mitglieder über den “großen Lauschangriff” der Fall. In der allgemeinen Politik sind Volksbefragung oder Volksentscheid schwierige Instrumente. Sie können einmal zum Erfolg führen, dann wieder nicht. Richard von Weizsäcker und die CDU schafften es 1981 mithilfe der Alternativen Liste, durch Unterschriftensammlung das Abgeordnetenhaus zur vorzeitigen Auflösung zu veranlassen. Aber der Nachfolger von Weizsäckers als Regierender Bürgermeister, Eberhard Diepgen, konnte auch Arm in Arm mit Manfred Stolpe beim Wahlvolk keine ausreichende Mehrheit für ein gemeinsames Bundesland erzielen. Das Mißtrauen gegen Plebiszite in der Politik ist gesunken, weil die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus aller Gedenkkultur zum Trotz ein halbes Jahrhundert nach seinem Ende den politisch prägenden Einfluß verlieren. Durch die Wiedervereinigung gab es neue plebiszitäre Impulse, weil revolutionsgeprägte Politiker aus der DDR die repräsentativen Strukturen der alten Bundesrepublik mit eigenen repressiven Erfahrungen 101 verwechselten und weil ihnen die Kultur des Runden Tisches ein noch freieres Deutschland als die alte Bundesrepublik verhieß. Daß der Wert verantwortlicher Diskussionen - das Ideal des rationalen Diskurses - mit Entscheidungen in Parlamenten und Regierungen gesunken ist, haben die politisch Verantwortlichen auch sich selbst zuzuschreiben, weil sie nach langen Debatten und Diskussionen häufig zu keinen Kompromissen und Entscheidungen gelangen. So entsteht die merkwürdige Situation, daß die einen nach mehr Demokratie durch Volksbegeheren und -entscheide rufen und das auch - wie in Brandenburg- in Verfassungstexte schreiben, während andere durch weniger Parteien sowie weniger Bundesländer schnellere Entscheidungen zur Deregulierung im Lande herbeiführen wollen. Weil das für die internationale Wettbewerbsfähigkeit notwendig sei, so wollen es höchste Wirtschaftsführer, soll die Beteiligung zu vieler Parteien und zu vieler Bundesländer an den Entscheidungen abgeschafft werden. Während auf der einen Seite der Ruf nach Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheid ertönt, kommt von der anderen Seite die Forderung nach einer Konzentration der Macht. Es wäre gut, beidem mehr Grundgesetztreue entgegen zu setzen. Bei lokalen Entscheidungen mag es ja hin und wieder sinnvoll sein, die Bürgerschaft direkt einzubeziehen. Es lassen sich Konflikte vermeiden, wenn bei begrenztem Etat statt der Gemeindevertretung die Bürgerschaft darüber abstimmt, ob die Schule ausgebaut oder eine Straßenbegradigung vorgenommen wird. In der Bundespolitik sind Plebiszite unangebracht. Statt des politischen Kalküls, statt des Interessenausgleichs und der Folgenabschätzung, auch des Experteneinflusses in den Parlamenten wären beim Plebiszit die Vorurteile und Meinungen, die Stimmungen und Launen relevante Kriterien von Zufallsmehrheiten, die über Fragen der Ausländerpolitik, des Strafrechts oder des Steuerwesens entschieden. Verantwortlichkeit und Berechenbarkeit in der Politik würden nicht mehr bestehen, und es ist gut, daß für die Grundfragen der Bundespolitik Plebiszite nicht möglich sein. Wenn es nur darum geht, die Meinungen der Bürger zu erfahren, steht den Parteien und der gesamten Öffentlichkeit ohnehin die Umfrageforschung zur Verfügung. Aber innerhalb der Parteien kommt es immer wieder zu problematischen Mitgliederbefragungen - in Sach- und Personalfragen. Dabei weiß jeder, daß die Parteimitgliederschaft nur ein kleiner Ausschnitt aus der Bevölkerung ist: Die rund vier Prozent organisierten Parteimitglieder in Deutschland rekrutieren sich aus den höheren Mittelschichten und sind keineswegs repräsentativ. Was würde es also bedeuten, wenn - um an die Größenordnung des letzten Mitgliederentscheids dieser Partei anzuknüpfen - sich von den rund 80.000 Mitgliedern der FDP 35.000 an einer Abstimmung für oder gegen die Abschaffung der Wehrpflicht beteiligten und 20.000 von ihnen votierten für die Berufsarmee? Niemand wüßte, nach welchen Kriterien die einzelnen Mitglieder sich entschieden haben, und diese selbst würden auch keinerlei Konsequenzen aus dem Abstimmungsverhalten zu ziehen haben. Die Entscheidung wäre urwüchsig da: Parteitag, Fraktion und auch das Parlament müßten sie als Tatsache hinnehmen ohne sie eigentlich diskutiert zu haben. Das unrepräsentative und verantwortungsfreie Votum von 20.000 Bürgern hätte den Mitgliedern dieser Gremien ein Stück ihres Mandats genommen. Die Mitgliederbefragung in politischen Parteien verwischt die Verantwortlichkeit der Abgeordneten. Sie ist eine überflüssige PR-Maßnahme, denn sie lockt - wie sich gezeigt hat -keine neuen Mitglieder in die Parteien. Nirgendwo ist geregelt, ob und wie aus dem Ergebnis einer solchen Befragung konkrete Politik werden soll. Die Sache paßt nicht zum politischen System der Bundesrepublik. Besonders bedenklich ist, daß die Mitgliederbefragung bei etablierten politischen Parteien das Plebiszit hoffähig macht, mithin einen Weg der 102 Entscheidungsfindung, von dem der Parlamentarische Rat nach 1945 erkannt hatte, daß er zum Untergang der Weimarer Republik beigetragen hatte! Das innerparteiliche Plebiszit bringt nicht mehr Demokratie, sondern durch die Verwischung von Verantwortlichkeit weniger. Es ist daher Wasser auf den Mühlen derjenigen Wirtschaftslenker, denen unser politisches System ohnehin zuviel Parteiendiskussion und zuviel Föderalismus enthält. Diese Propagandisten für mehr Entscheidungsklarheit übersehen, daß es Ausdruck politischer Klugheit war, dem starken Kanzler und dem mächtigen Bund Gegengewichte in der herausgehobenen Stellung der Parteien sowie in der föderalistischen Gewalt der Länder entgegen zu setzen. Allmacht ist demgegenüber eindeutig weniger Demokratie und sie zu fordern, damit Entscheidungen schneller getroffen werden, ist gefährlich in einem Lande mit der Geschichte Deutschlands. Das Gerede vom Parlament als “Quasselbude” und das Gejammer über das entzweiende “Parteiengezänk” haben der Weimarer Republik die demokratische Substanz entzogen. Demokratie als zeitlich und institutionell begrenzte Macht sollte seitdem als Wert anerkannt sein und nicht zugunsten vermeintlicher Effektivität infrage gestellt werden. Das entbindet die politischen Verantwortlichen freilich nicht davon, notwendige Entscheidungen auch tatsächlich zu treffen. Sie haben ihr Mandat, um politische Fragen öffentlich zu erörtern, aber auch zu entscheiden und diese Entscheidungen dann bei der nächsten Wahl zu verantworten. Darum drücken sich mittlerweile zu viele, weil sie permanent dran bleiben wollen und verdrängen, daß sie für die Bürger da sind und nicht umgekehrt. Wir brauchen keine bundespolitischen Plebiszite, wir müssen auch keine Parteien und nicht die Länder abschaffen, sondern auf allen Ebenen mehr Verantwortlichkeit und eine dienende Einstellung zum Gemeinwesen entwickeln. Dann werden wir mit unserem Grundgesetz - das immer noch die beste Verfassung der deutschen Geschichte ist - weiterhin gut fahren. Auch die Wirtschaft wird dabei profitieren.. 2. Vor allem die Politiker sind noch nicht reif für die direkte Demokratie. Das Volk soll gefragt werden. Alle Parteien haben sich mittlerweile dazu durchgerungen, der direkten Demokratie in der Bundespolitik irgendeine Bresche zu schlagen. Die Parteien tun das, weil die Forderungen nach direkter Demokratie in der Öffentlichkeit lauter werden und weil sie zurecht um ihren Rückhalt im Volke fürchten. Findet eine Wahl des Bundespräsidenten statt, ertönt von vielen Seiten der Ruf nach Direktwahl des Staatsoberhauptes. Soll eine europäische Verfassung kommen, verlangen nicht wenige, das Volk solle darüber abstimmen. Geht es um den Türkei-Beitritt zur EU, fordern vor allem Gegner dieses Projektes Unterschriftenaktionen oder ein Referendum. Auffällig ist, daß sich Befürworter und Gegner direkter Demokratie in der Bundespolitik jeweils danach sortieren, welche politische Rolle sie gerade einnehmen: Regierung oder Opposition. So sind die SPD und besonders die Grünen von ihrer politischen Grundausrichtung her eher Befürworter direkter Demokratie, während die „Bürgerlichen" - Union und FDP – eigentlich Verteidiger der repräsentativen Demokratie sein müßten. Aber als Regierungsparteien haben Rot und Grün da so ihre Bedenken im Einzelnen: „Jetzt den Bundespräsidenten vom Volke wählen zu lassen, wäre wohl etwas überstürzt!“ – „ Eine Abstimmung über die europäische Verfassung läßt das Grundgesetz nicht zu!“ - „Über den Türkei-Beitritt kann man vielleicht in 15 Jahren abstimmen!“ In der CDU/CSU dagegen kann man sich ein Erforschen des Volkswillens speziell in der Türkei-Politik durchaus schon früher vorstellen. Da macht es gar nichts, daß man eigentlich von direkter Demokratie wenig zu halten vorgibt: Die Aktion könnte nach hessischem Muster Wählerstimmen bringen. 103 Die FDP machte sich geradezu zur Lobbyistin für die Direktwahl des Bundespräsidenten. Mit treuem Augenaufschlag wird bei der vereinigten Opposition darüber diskutiert, wie es wäre, wenn man forderte, die europäische Verfassung vom Volke legitimieren zu lassen: Das könnte doch der Regierung lästig werden... Da es mittlerweile zur politischen Korrektheit gehört, für direkte Demokratie zu sein, sinken auch die Parteien dahin: im Prinzip haben sie immer weniger dagegen. Aber jede Partei denkt taktisch. Die Union könnte mit einer „privaten“ Befragung – „Unterschriftensammlung“ genannt - der Regierung in der Türkei -Politik eins auswischen. Die Regierung fürchtet sich in dieser Frage vor Volkes Meinung: Also verteufelt die neu-alte Parteivorsitzende der Grünen eine mögliche Unterschriftenaktion. Der Herr Westerwelle mußte vor der Bundespräsidentenwahl 2004 wissen, daß die Bundesversammlung kurzfristig gar nicht durch das Volk ersetzt werden konnte. Gerade wegen der zu erwartenden Folgenlosigkeit seiner Reden konnte Westerwelle sich daher ruhig auf die allgemeine Popularitätswoge setzen und die Direktwahl des Präsidenten fordern. Das Problem ist: Die Politiker denken, Volksabstimmungen und -Befragungen seien mittlerweile „in", also reden sie dafür, bringen Gesetzesentwürfe im Bundestag ein. Aber ihre Politik wollen sie sich durch Volkes Meinung nicht nehmen lassen. Also gehen sie mit den Plebisziten in der Theorie großzügig um, bei Abstimmungen im einzelnen aber sind sie pingelig. Ihre Haltung ist: „Wasch mir den Pelz, aber mach` mich nicht naß!" Das Volk soll abstimmen, aber die Parteipolitiker wollen weiterhin entscheiden. Sie wollen alles in der Hand behalten. Da war nach 1945 der Schöpfer des Grundgesetzes - der Parlamentarische Rat – in seiner Art weiser. Nach Diskussionen über dieses Thema entschied er sich konsequent gegen direkte und für repräsentative Demokratie: Das auf Zeit vom Volk gewählte Parlament sollte Ort der Entscheidungen sein. Daß die Weimarer Republik in die Hitler-Diktatur gerutscht war, habe auch mit einem Zuviel an direkter Demokratie zu tun gehabt, glaubte man damals. Und man hatte vor Augen, wie die Nazis die Zusammenlegung der Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten ebenso wie den „Anschluß" Österreichs plebiszitär untermauert hatten. Schlecht ist die alte Bundesrepublik mit ihrer repräsentativen Ausrichtung nicht gefahren. Erst in den 80er Jahren und dann im Zuge der Wiedervereinigung wurde der Ruf nach direkter Demokratie lauter. Drei Argumente wurden dafür angeführt: - Das Volk sei mittlerweile reif genug, wichtige Fragen der Nation verantwortlich zu entscheiden. - Bürgerrechtler aus der DDR schütteten das Kind mit dem Bade aus und meinten 1990, das „Bonner" System sei ebenso wenig zeitgemäß wie die abgewirtschaftete Gerontokratie Ostberlins. Die „friedliche Revolution" habe mit direkter Demokratie und runden Tischen den Weg in die Zukunft gewiesen, auch bei den politischen Verfahren. - Schließlich gab es in der alten Bundesrepublik auf Länder- und Kommunalebene bereits direkte Demokratie - interessanter Weise vor allem im „CSU-Staat" Bayern. Es sei dahin gestellt, ob das medienabhängige Volk 2004 wirklich politisch um vieles reifer ist als 1949. Auch ist es evident, daß sich ein großer Industriestaat auf die Dauer nicht mit runden Tischen organisieren läßt. Schließlich sind die Erfahrungen mit der direkten Demokratie in Ländern und Kommunen nicht durchweg so, daß das Volk seine Möglichkeiten tatsächlich wahrnähme und dichter dran wäre an der Politik als im Bund. Daß in der Bundespolitik über direkte Demokratie viel geredet, sie aber nicht praktiziert wird, liegt jedoch vor allem daran, daß die führenden Politiker dafür nicht reif sind. Sie fürchten um ihre Macht. Wenn sie sicher sein könnten, daß sie jedes Referendum über den Beitritt der Türkei zur EU bestehen würden, wären die leitenden Damen und Herren von Rot-Grün für eine Volksabstimmung. So sind sie dagegen – zum jetzigen Zeitpunkt 104 jedenfalls, wie sie sagen. Wenn er erwarten müßte, eine Flut direkter Demokratie komme auf die Bundesrepublik zu, würde der Vorsitzende der FDP aus Eigeninteresse vorsichtiger sein bei seinem Rufen nach Volkes Stimme. Wenn ihr jemand garantieren könnte, daß die politischen Gegner der CDU keine Unterschriftenaktion gegen ihre Gesundheitspolitik in Gang setzen, würde sie Unterschriftensammlungen vielleicht nicht nur fordern, sondern auch praktizieren. Und wenn sie wüßten, daß das Volk einer EU-Verfassung sein Plazet geben würde, wären auch die Grünen für eine Volksabstimmung hierüber. Die Parteien und die Parlamente in Deutschland haben mittlerweile ein Legitimationsproblem. Höchstens zwei Prozent der Bevölkerung beteiligen sich aktiv an der Arbeit in den Parteien. Zu allgemeinen Wahlen gehen manchmal mehr als 50% der Berechtigen gar nicht hin, und wenn eine Wahlbeteiligung bei 70% liegt, dann gilt das als guter Wert. Der Parlamentarismus braucht eine Ergänzung und Auffrischung durch direkte Demokratie, durch Volkes Wort auch während der Legislaturperioden. Wenn alle Bereiche der Gesellschaft sich reformieren müssen, dann auch die Parlamente und die Parteien. Davor fürchten sich die führenden Politiker. Es wird ihnen nichts helfen. Früher oder später werden Referenden zur Demokratie in Deutschland gehören wie in Frankreich, in Skandinavien und sogar gelegentlich im Mutterland des Parlaments, Großbritannien. Die Politiker hierzulande müssen ihre taktische Einstellung zu den Plebisziten aufgeben und von ihren Kollegen in Westeuropa lernen, daß die Kunst des Politikers nicht nur aus Kungeln in kleinen Runden besteht, sondern daß auch die Fähigkeit zum Dialog mit dem Volk dazu gehört – auch zwischen den Wahlen. Wenn Rot-Grün von der eigenen Türkei-Politik überzeugt ist, muß es den Willen zeigen, die Bevölkerung direkt davon zu überzeugen. Wenn die FDP wirklich die Direktwahl des Bundespräsidenten will, muß sie jetzt, spätestens 2006 eine große Verfassungsreform anregen, bei der die Gewichte zwischen Präsident, Kanzler und Bundestag neu justiert werden. Und wenn die CDU eine Gesundheitsreform mit „Kopfpauschalen“ durchsetzen will, dann muß sie im Volke so viele Anhänger dafür werben, daß sie ein Referendum hierüber nicht fürchten brauchte. Die Zeit ist reif für Dialoge der Politik mit dem Volke auch über Angelegenheiten von nationaler Bedeutung. Dazu müssen die Politiker eine neue Dimension ihres Beruf erschließen: Die Dimension des bundesweiten Gesprächs mit denen, die in ihrem Jargon immer noch die „Menschen draußen im Lande“ genannt werden. Wenn diese Menschen da draußen reinkommen in die Politik, werden auch sie dadurch hinzulernen, „reifer“ werden eben. Eines allerdings ist klar: Bei keinem Referendum wird es eine Erfolgsgarantie für irgendjemand geben. Man kann eine Abstimmung gewinnen, aber auch verlieren. Das muß ein Politiker akzeptieren. Deswegen sollte Politik ja das Geschäft von verantwortlichen und wegweisenden Persönlichkeiten sein und nicht von nach Sicherheit suchenden Karrieristen. 12. Flucht vor der Verantwortung Wenn wir selbst aus der Nachkriegsgeschichte nicht lernen können, wie sollen wir überhaupt aus der Geschichte lernen? Im Mai 1991 wurde bekannt, dass in Ravensbrück an der „Straße der Nationen“, die von Häftlingsfrauen errichtet worden war, ein Supermarkt der Firmengruppe „Tengelmann“ eröffnet werden sollte. Die „Straße der Nationen“ führt zur Gedenkstätte Ravensbrück auf dem Gelände des nationalsozialistischen Frauen-KZ Ravensbrück. Der Protest schwoll an. Er kam aus dem In- und Ausland. Der brandenburgische 105 Ministerpräsident Manfred Stolpe eilte nach Fürstenberg - jener Stadt, von der Ravensbrück ein Ortsteil ist. Stolpe schwor die Politiker der Stadt und des Landkreises ein: An jenem Ort kann der Supermarkt – den die Fürstenberger sich kurz nach der Wende so sehr gewünscht hatten – nicht eröffnet werden. In einer Besprechung tags darauf mit allen Beteiligten in Potsdam wurde festgelegt, dass Fürstenberg am anderen Ende des Orts einen Supermarkt bekommen sollte. So geschah es. Alle Welt konnte sehen: Eine Gedenkstätte und ihr Umfeld sind tabu für Profannutzungen. Im Januar 2005 wurde bekannt, dass in Berlin nördlich des Bahnhofs Grunewald auf dem ehemaligen Gütergelände der Bahn Luxushäuser errichtet werden sollen, um so die Villenkolonie Grunewald an die Bahntrasse und die AVUS heran zu ziehen. Die Zugangsstraße werde direkt jenen Ort passieren, von dem aus zwischen 1941 und 1945 Zehntausende Berliner Juden in die Vernichtungslager des Ostens deportiert wurden. Der Güterbahnhof Grunewald, für so viele damals das Tor zur Todesfahrt nach Auschwitz, wird als Grund und Boden vorgesehen für das traute Heim betuchter Berliner im wiedervereinigten Deutschland! Diese Planungen wurden ausgearbeitet in Kenntnis der historischen Belastung des Ortes: Am Bahnhof Grunewald selber befindet sich seit 1987 eine Bronzetafel mit hebräischer Überschrift: „Zum Gedenken an die Opfer der Vernichtung. Zum Gedenken an Zehntausende jüdischer Bürger Berlins, die ab Oktober 1941 bis Februar 1945 von hier aus durch die Nazi-Henker in die Todeslager transportiert und ermordet wurden.“ Neben dem Bahnhof wurde 1991 eine Betonmauer mit Negativabdrücken von menschlichen Körpern errichtet: ein beeindruckendes Mahnmal. Und die Deutsche Bahn AG hatte 1998 auf den Verladebahnsteigen rechts und links der Gleise Metallplatten anbringen lassen, auf denen Zielorte und Daten der Deportationszüge dokumentiert sind. Die gesamte Mahnstätte Grunewald ist so zu einem sakrosankten Ort geworden. Nach jüdischem Brauch liegen Steine auf der Rampe - wie auf Friedhöfen. Blumen werden niedergelegt. Es kommen Besucher und verharren. Von den Verladebahnsteigen aus blicken sie auf das überwucherte Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs. Es erinnert an jene Landschaften, in welche die Todeslager eingebettet waren und bedrückt mit dem Widerspruch zum pittoresken Gebäude des Bahnhofs Grunewald. Ein Eindruck entsteht von Bildern, welche die hierher getriebenen Opfer der Nationalsozialisten in den letzten Tagen ihres Lebens gesehen haben. Dieser Ort in Grunewald, wie er sich 2005 präsentiert, ist tabu. Hier soll der Mensch nichts mehr verändern. Doch die Energie der Planer ist groß. Aus einer Brache soll eine Geldquelle werden. Das täte auch der Bahn gut. Den Parteien des Bezirks wird eingeredet, dass diejenigen, die hier herziehen werden, Stabilität und Wohlstand in den Ortsteil bringen würden. In den bürgerlichen Parteien macht sich manch einer Hoffnung auf Zulauf bei künftigen Wahlen. Bei solchen Aussichten verdrängen viele den Wohnungsleerstand in der Stadt. Die Enge der Straßen in der Villenkolonie wird ebenfalls verdrängt: Ein Verkehrschaos sei nicht zu erwarten. Das Leben neben Bahntrasse und AVUS könne dank eines Schutzzaunes zum Vergnügen werden. Den Platz vor dem Bahnhof werde der Projektentwickler neu gestalten – auf „eigene“ Kosten! - , und das beliebte Restaurant „Floh“ – ja, das muss eben weichen. Schließlich das noch: Auch ein Supermarkt wird entstehen! Die Planer tun, als hätten sie es mit einem beliebigen Bismarckdenkmal zu tun. Doch es ist ein authentischer Ort der Schoa. Der Bezirk muss den Plänen erst noch zustimmen. Dort hält man sich für klug und „sieht das politische Problem“. Also, sagen einige Kommunalpolitiker, werde man mit „der Jüdischen Gemeinde“ reden. Die soll das Wohnungsprojekt quasi „koscher schreiben“. Welch eine Flucht vor der Verantwortung! Die Nachfolger der Opfer sollen Politikern sagen, wie nahe sie einem Ort des Erinnerns an die Schoa kommen dürfen. Bedarf es eines klareren Beweises dafür, dass selbst „Führungskräfte“ in Deutschland kein Gefühl dafür 106 haben, welche Verantwortung für das Geschehene auf diesem Land lastet? Alle eingespielten Gedenkrituale bewirken offenbar wenig. Nach dem 27. Januar 2005 geht man zur Tagesordnung über und werkelt an dem Plan, an einem Ort des Erinnerns an den Tod Zehntausender Kapital zu schöpfen. Warum gibt es so viele in Deutschland, die verdrängen und vorbei manövrieren wollen, wenn sich Zeugen der Naziverbrechen ihren Planungen in den Weg stellen? Warum geschieht das immer wieder: 1991 und 2005? Dass nicht stille Trauer und innere Scham die Haltung der meisten „Leistungsträger“ hierzulande ist, erscheint alarmierender als dumme Sprüche parlamentarischer NPDler in Sachsen. 107