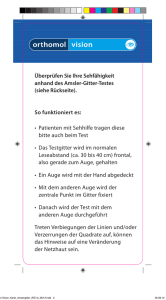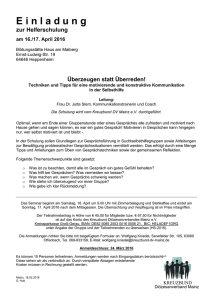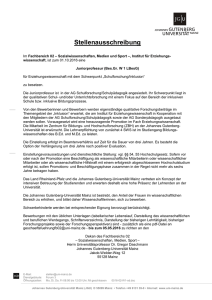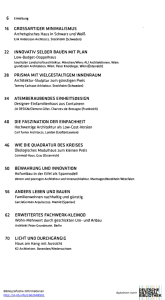Mittelrhein. - Enrico Santifaller
Werbung

Mittelrhein | 01 Andernach Pfarrkirche St. Albertus Magnus Beethovenstraße, 56626 Andernach Rudolf Schwarz 1954 Rudolf Schwarz ist der Architekt, der ohne Zweifel die wichtigsten – theoretischen wie praktischen – Beiträge für die Neuformulierung des Kirchenbaus im 20. Jahrhundert geleistet hat. Seine Aachener Fronleichnamskirche aus dem Jahre 1930 ist in erster Linie zu nennen, aber auch seine 39 wiederaufgebauten, umgestalteten oder neu errichteten Gotteshäuser nach 1945, die nach Wolfgang Pehnt größtenteils Exempel setzten. Eines davon ist die St. Albertkirche in Andernach. Bereits 1937 war ein Kirchenbauverein aus der Rheinstadt an den Architekten herantreten, der Entwurf konnte aber nicht realisiert werden, weil man keine Genehmigung bekommen hatte. 1952 wurden die Entwurfsarbeiten – allerdings für ein anderes Grundstück – fortgesetzt. Die in Bruchsteinen errichtete Kirche ruht auf den Resten des Äbtissinnenhauses eines ehemaligen Augustinerinnenklosters, das eine französische Revolutionsarmee bereits 1794 zerstört hatte. Das Barockportal des alten Gebäudes wurde unverändert als dritter Eingang in die neue Kirche eingebaut. Der einfache, trotz schiefergedecktem Satteldach kubisch wirkende Baukörper mit seinen insgesamt fünf raumhohen Fenstern ist lang und schmal (51,8 × 14,5 Meter). Im Innenraum dominiert der siebenstufige Altarberg mit seinem mächtigen, geradezu monumentalen Altar. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Sängerpodest, im Zwischenraum sammelt sich die Gemeinde. St. Albert ist für Schwarz’ sakrales Œuvre typischer als die von ihm umgestaltete Liebfrauenkirche in Trier. Eine Wegkirche, die 400 Personen Platz bietet. Einfach, bescheiden, asketisch. Die Wände sind verputzt und weiß gestrichen, der Boden ist aus Schieferplatten, einziger Schmuck sind die sakralen Geräte wie Tabernakel und Kreuz – oder die stählernen Türen. Eine Kirche, die eher an eine religiöse Vernunft denn an das Gefühl appelliert. Die von Wilhelm Geyer verantwortete Gestaltung der Fenster kam erst später hinzu. Weil sich im Zeichen des allgemeinen Rückgangs der Gottesdienstbesucher die Gemeinde nicht mehr wohl in ihrer Kirche fühlte, wurde das Gebäude nach einem lange währenden Diskussionsprozess – mit der Beratung von Rudolf Schwarz’ Witwe Maria und des Bonner Liturgikers Albert Gerhards – in den Jahren 2001 und 2002 umgebaut. Ergebnis der Arbeiten ist ein „orientierte Versammlung“ benannter Raum, in dem sich die Gemeinde – in zwei Halbovale geteilt – um Altar und Ambo sammelt. (en) Literatur: Johannes Krämer: Gemeinschaftlich orientiert, in: Communio-Räume, hrsg. von Albert Gerhards, Thomas Sternberg und Walter Zahner, Regensburg 2003, S. 191–196. Lutz Schultz: Dem Glauben Raum geben – Erfahrungen eines Gemeindeweges, in: ebd., S. 197–199. 25 024-077archifuehrer.indd 24-25 27.10.2005 17:21:09 Uhr Mittelrhein | 02 Bad Neuenahr-Ahrweiler Sonderschulzentrum Bad Neuenahr (heute: Don-Bosco-Schule bzw. Levana-Schule) St.-Pius-Straße 23 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Reinhard Voss mit Armin Marschner, Koblenz 1965 „Diese aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangene Sonderschule verdient eine Auszeichnung aufgrund der einfühlsamen Sorgfalt, mit der die Planung auf die spezifischen Probleme behinderter Kinder eingeht und diesen ein Gesamtmilieu der Geborgenheit und der Identifikation gibt, welches den pädagogischen Erfolg mit den Mitteln der Architektur unterstützt.“ Mit diesen Worten begründete 1976 eine von Max Bächer geleitete Jury ihre Entscheidung, dem Bad Neuenahrer Sonderschulzentrum eine Auszeichnung in der Konkurrenz „Vorbildliche Bauten in Rheinland-Pfalz“ zuzuerkennen. Die „einfühlsame Sorgfalt“ der Planung ist auch heute noch zu spüren, auch wenn sich die Kenntnisse über eine behindertengerechte Architektur inzwischen vielfach erweiterten. Reinhard Voss, der Entwurfsverfasser, hat auch Einfühlsamkeit gegenüber dem Ort und dem baulichen Umfeld bewiesen, indem er nicht einen großen, alles unterbringenden Riegel plante, sondern das Schulzentrum in eine Reihe von gestaffelten Pavillons auflöste, die sich, höchstens zweigeschossig, mit der grünen Parklandschaft längs des Ahrufers vielfältig und vieleckig verzahnen. Damit nahm er die kleinteilige, eher niedrige Bebauung auf, die im Bad Neuenahrer Stadtteil Bachem ortsbildprägend ist, und schuf darüber hinaus mit Veranden, Arkaden und überdeckten Terrassen den Schülern ebenso großzügige wie geschützte Räume im Freien. Die Betonung der Horizontalen – etwa durch die kupfernen Attiken der Flachdächer – verstärkt den Eindruck der breiten Lagerung des Gebäudes in kleine, überschaubare Einheiten. Die Backsteinwände – Voss: „Ziegel erzieht zu Einfachheit“ – geben zusammen mit den Holzdecken auch in den Klassenräumen und den breiten Fluren bei aller orthogonalen Strenge ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme. Die Gestaltung der Details – Oberlichter über den Türen und in den Eingangshallen, geräumige Wandschränke, Nischen als Ruhepunkte in den Gängen – und der disziplinierte Materialeinsatz erhärten den Eindruck der eingangs zitierten Sorgfalt und darüber hinaus auch Sorgsamkeit. Besagte Jury lobte denn auch die „wohltuende Häuslichkeit“ des Schulzentrums und empfahl, dass diese „als künftige Forderung an die Planung von Bauaufgaben dieser Art verstanden werden“ sollte. (en) Hinweis: Das ebenfalls preisgekrönte Altenheim des Evangelischen St. Martin-Stifts (Mittelrhein 36) in Koblenz integrierte Reinhard Voss in einem mit alten Bäumen gesäumten Park – auf ähnliche Weise wie in Bad Neuenahr. Breite Balkone und tiefe Loggien unterstützen eine wohnliche, kommunikative Atmosphäre. Der Fortschritt der Medizin und die Änderungen der Sozialgesetzgebung haben freilich eher negative Spuren auch an diesem Gebäude hinterlassen. 27 024-077archifuehrer.indd 26-27 27.10.2005 17:21:14 Uhr Mittelrhein | 03 Bad Neuenahr-Ahrweiler Wohngruppe am Eichenweg Eichenweg, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Architekturwerkstatt AC, Bad Neuenahr 1987 (1. Bauabschnitt) 1989 (2. Bauabschnitt) Die Wohnanlage am Eichenweg in der grünen Parklandschaft der Ahraue vermittelt den Eindruck von verträumter Idylle und wilder Romantik. Die Siedlung kündet vom Aufbruchsgeist einer sich etablierenden Alternativ- und Ökologiebewegung, die neue Wege auch in der Architektur beschritten hatte: partizipative Bauherrengemeinschaften, kostensparende, ressourcen- und energieschonende Bauweisen, baubiologisch unbedenkliche und recyclingfähige Baustoffe, Sammlung von Regenwasser, vielfältige Bepflanzungen und eine betont individualistische Ästhetik, die sich schon äußerlich vom naturzerstörenden Bauwirtschaftsfunktionalismus des Massenwohnungsbaus als auch vom flächenfressenden Einfamilienhausbau unterscheidet. Die insgesamt neun zweigeschossigen Wohnhäuser der Anlage sind U-förmig um eine Jugendstilvilla angeordnet, die man in ein Mehrfamilienhaus umwandelte. Weil sich Parkplätze und Garagen außerhalb des U befinden, ist die gemeinsame Verkehrs- und Erschließungsfläche mit einem mittigen, kommunikationsfördernden Platz weitgehend autofrei. Um die Bauherrengemeinschaft auch mit jungen und kinderreichen Familien zu erweitern, die wegen geringen Einkommens Mittel des öffentlich geförderten Wohnungsbaues beantragen konnten, beschloss man eine ganze Reihe von kostensenkenden Maßnahmen: Verwendung eines vorgefertigten Holzbausystems, Einsatz standardisierter Bauteile, Verzicht auf Kellerräume und einen hohen Anteil an Eigenleistung, der allein die Kosten um bis zu 18 Prozent reduzierte. Trotz dieser Maßnahmen wurde mit vorgehängten Erkern und Balkonen, Vor- und Rücksprüngen, verschie- denen Fensterformaten und Farben, Nischen und Wintergärten eine äußere Formenvielfalt mit hoher architektonischer Qualität erzielt, die der inneren Vielfalt an Räumen und Grundrissen – jedes Einzelhaus wurde nach den Bedürfnissen der Bewohner individuell geplant – entspricht. „Es entstand ein kleinteilig gestalteter Bereich, der eine heitere Wohnatmosphäre vermittelt,“ urteilte 1988 eine vom Finanzministerium Rheinland-Pfalz eingesetzte Jury und zeichnete die Wohngruppe mit dem Staatspreis aus. (en) Hinweis: Mit dem Staatspreis für Architektur und Wohnungsbau 2000 wurde die „Siedlung an der alten Ziegelei“ (Mittelrhein 31) ausgezeichnet. Die insgesamt 65 Doppel- und Reihenhäuser des vom Architekturbüro hks nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten geplanten Wohngebiets zeichnen sich durch hohe Nutzungsflexibilität und gestalterische Qualität aus. Literatur: Ursula Baus: Holz auf Steinen, in: db (deutsche bauzeitung), 8/1992, S. 54–57. 29 024-077archifuehrer.indd 28-29 27.10.2005 17:21:20 Uhr Mittelrhein | 06 Bad Neuenahr-Ahrweiler Ausstellungsraum für einen Floristen Nordstraße oder Heerstraße 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Hans-Jürgen Mertens, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2000 Der Behälter, schreibt der Stadttheoretiker Dieter Hoffmann-Axthelm, ist der Rationalisierungslogik kapitalistischer Ökonomie geschuldet, ist deren Erfindung, ist deren bauliches Vokabular: kompatibel zu jeder Nutzung, eigenschaftslos, teil- und stapelbar. Seriell, repetitiv und industriell herstellbar. Und doch sind einige Architekten – HansJürgen Mertens beispielsweise – begabt, mit einer nüchternen, aber durchdachten Box so etwas wie Poesie zu zaubern. Seinem Bauherrn, dem international renommierten Floristen Gregor Lersch, wollte Mertens kein X für ein U vormachen. In seinem Entwurf jedoch teilte der Architekt die sechs Flächen des Ausstellungsbehälters in zwei Hälften: Boden, Rückwand und Decke aus Brettstapelholz bilden das erste liegende U, die beiden Stirnseiten und die Fassade aus Glas das zweite, wobei die Schenkel dieses Us ein wenig kürzer sind. Beide Hälften, ineinander geschoben, formen das minimalistische Gebäude, das Mertens mit einem niedrigen Betonkubus ergänzte, in dem sich Abstellraum, eine Teeküche und Toiletten befinden. Schon ein paar Jahre vorher baute Mertens für Lersch in unmittelbarer Nähe ein Werkstatt- und Seminargebäude aus – inzwischen ziemlich verwitterter – Seekiefer: eine Holzkiste ohne jeden Schnörkel, die ihre Entstehungsbedingungen – gerade mal 40.000 Euro Baukosten – mit Ruppigkeit und einfachen Details unmissverständlich zeigt. Und dennoch mit einem durchgehenden, etwas hervorstehenden, zerbrechlich wirkenden Fensterband – gedacht als Ausstellungsvitrine für Seminarteilnehmer – dem Behälter jenes architektonische Surplus gibt, das ihn vom bloßem Container unterscheidet. Die 4 mal 2 Meter großen Glasscheiben des Schauraumes, dessen Entstehungskosten unwesentlich höher waren, stecken in verzinkten Stahlrahmen, von denen jeder zweite verschiebbar ist. Dass die auf vier Punktfundamenten lagernde Ausstellungshalle den Eindruck erweckt, als ob sie einen halben Meter über dem Boden schwebt, macht sie zur Bühne, zum zurückhaltend nüchternen Hintergrund einer Inszenierung, bei der sich die floralen Kompositionen Lerschs mit ihrem eher schwelgerischen Charakter umso wirkungsvoller darstellen können. Der Behälter erhält Charakter, wird damit selbst Teil einer größeren Komposition – und bietet freien Ausblick und Zugang zu Lerschs herrlichem Garten. Das Gebäude wurde mit dem Architekturpreis RheinlandPfalz 2001 ausgezeichnet. (en) Hinweis: Ziegel, Holz, weißer Putz: Die unprätentiöse Schönheit von großen Flächen mit diesen Materialien zeigt Hans Jürgen Mertens bei seinem Wohnhausanbau (Mittelrhein 29) in der Kreuzstraße 45 in Bad Neuenahr. Literatur: Christof Bodenbach: Wer im Glashaus sitzt, in: db, 8/2001, S. 34–37. 35 024-077archifuehrer.indd 34-35 27.10.2005 17:21:40 Uhr Mittelrhein | 09 Boppard Kirchenzentrum Buchholz Heidestraße 53, 56154 Boppard Walter Maria Förderer, Schaffhausen 1975 „Die Kirche ist mehr als nur Kirche: Kristallisationspunkt von allerhand dörflichen Tätigkeiten und Notwendigkeiten.“ Dies schrieb Walter Maria Förderer zu der Kirche von Hérémence, mit der der Architekt auf einen Schlag berühmt wurde. Das Kirchenzentrum in der Gemeinde Buchholz, die zur Stadt Boppard gehört, ähnelt nicht nur seiner Architektur wegen ein bisschen dem Gotteshaus in dem Gebirgsort im Wallis. Das Wohngebiet Buchholz-Mitte, das den Ortsteil Bahnhof mit dem alten Dorfkern verbindet, wurde Anfang der 70er Jahre gleichsam über Nacht aus dem Boden gestampft. In 25 Jahren verdreifachte sich die Einwohnerschaft Buchholz’, nur dem Ortsteil Mitte fehlte eine Mitte, ein städtebauliches Zentrum. Da kam Förderer ins Spiel. Beim bereits 1969 ausgelobten Wettbewerb zum Bau einer neuen Kirche wurde sein Entwurf mit dem 1. Preis bedacht. Und wenn dieser nur bald genug ausgeführt worden wäre, dann könnte sich Buchholz mit dem Titel schmücken, das erste ökumenische Pfarrzentrum Deutschlands in seiner Gemarkung zu wissen. Doch erst im Juli 1974 konnte der Grundstein gelegt, die erste Messe zu Weihnachten 1975 gefeiert werden (und der Titel ging an Lüneburg, wo das ökumenische Gemeindezentrum St. Stefanus im neuen Stadtteil Kaltenmoor im September 1974 eingeweiht wurde.) Zwar sind in Buchholz die katholische Pfarrkirche St. Sebastian und die evangelische Kirche rechtlich und räumlich getrennt, doch verbindet sie ein gemeinsames Holzdach, das Sammelbecken und Vorbereitungszone zugleich und, so der Besucher von der Heidestraße kommt, auch das dominierende Element ist. Das Kirchen- zentrum selbst ist ein typischer Förderer: eine Großplastik mit zahllosen Winkeln, Schrägen, Kanten, Stufen, Hohlräumen, Durchbrechungen und Durchdringungen, wobei die unzähligen Öffnungen scheinbar spielerisch aus der Fassade heraus gebrochen wurden. Der Autodidakt Förderer, der seine Bauten stets am Modell entwickelte (der Kalifornier Frank O. Gehry hat es mit einer ähnlichen Methode ein paar Jahre später zu Weltruhm gebracht), schuf für das sonst eher gesichtslose Buchholz ein Wahrzeichen. Die skulpturale Figur scheint freilich mit dem Grundstück zu verschmelzen. Den Räumen, die den katholischen Kirchenraum wie ein Ring umgeben, gab Förderer teilweise ganz pragmatische Funktionen: ein Raum, in dem Druckereiarbeiten verrichtet werden konnten, ein Jugendraum, eine Bibliothek etc. Und so konnte auch das ökumenische Zentrum in Buchholz Kristallisationspunkt für allerhand dörfliche Tätigkeiten werden. (en) 41 024-077archifuehrer.indd 40-41 27.10.2005 17:21:56 Uhr Mittelrhein | 10 Cochem Pfarrkirche St. Remaclus Valwigerstraße 5, 56812 Cochem Emil Steffann mit Heinz Bienefeld 1968 Wolfgang Pehnt, Nestor der deutschen Architekturkritik, beschreibt Emil Steffann als den „Essenzialisten“ unter den Kirchenbaumeistern hierzulande. Wie kein zweiter suchte der nahe Bielefeld als Sohn eines Arztes geborene Protestant, der 1926 während eines längeren Aufenthaltes in Assisi und unter dem Eindruck franziskanischer Theologie zum Katholizismus konvertierte, nach der archetypisch gültigen Form des Sakralbaus. Armut und Anmut waren ihm, der sich stets als Suchender begriff, gerade nach dem Trauma des 2. Weltkrieges eins. Obwohl Steffann sich im Einklang mit der Tradition verstand und die Vorbilder seiner Architektur in den baulichen Formen des Frühchristentums und der mittelalterlichen Stadt fand, war er es, der erstmals in Deutschland den Gedanken umgesetzt hatte, die Gemeinde um den zentral positionierten Altar zu versammeln. Die schwierige topographische Situation des Baugrundstücks im Cochemer Stadtteil Cond nutzte der Architekt geschickt aus, indem er mit einem Mauerwerk aus ortsüblichen rötlich-braunen Bruchsteinen erst den Steilhang abfing und dann den kompakten, sich über einem griechischen Kreuz erhebenden Baukörper der Kirche formte. Diese Glaubensburg setzte Steffann als Kontrapunkt zur gotischen Reichsburg am anderen Moselufer. Den Vorhof, die 47 Treppen zum Gotteshaus, weitere Vor- und Zwischenplätze, von denen Wege zur Sakristei, zum Pfarrhaus und zur Werktagskirche abgehen, kommen einem allmählichen Aufsteigen in die Sphäre des Glaubens gleich. Das von drei großen Rundfenstern beleuchtete Kircheninnere mit seinen weiß geschlämmten Ziegelmauern, der ungezierten Stahlkonstruktion für die Empore und den simplen, an Kabeln hängenden Glühlampen ist schmucklos und kontemplativ. Von der gleichen spröden Schlichtheit ist der auf einer dreistufigen Insel ruhende Altar, der im Zentrum der Kirche steht. Um ihn versammelt sich die Gemeinde in sechs Gestühlsblöcken, der stählerne Lichtkranz betont die Mitte und die Gemeinschaft der Gläubigen um den Opfertisch. Es war die besondere Gabe Steffanns, durch die asketische Bescheidenheit seiner Kirchenräume spirituellen Reichtum zu vermitteln. Wobei St. Remaclus sein letztes Werk war: Zwei Monate nach der Konsekrierung des Gotteshauses starb der Architekt im Juli 1968 an den Folgen eines Autounfalls. (en) Hinweis: Steffanns einstiger Mitarbeiter Heinz Bienefeld schritt konsequent den Weg seines Meisters fort, verband aber dessen herbe Strenge – wie in Pfarrkirche St. Willibrord in Mandern-Waldweiler (Trier – Eifel – Hunsrück 29) zu sehen – mit ornamentalen Wandstrukturen und Materialfarbigkeit. 43 024-077archifuehrer.indd 42-43 27.10.2005 17:21:59 Uhr Mittelrhein | 13 Freirachdorf Umbau einer Scheune zu einem Wohnhaus Hauptstraße 3, 56244 Freirachdorf Christoph V. Wissmann, Wuppertal (Planung), Hans H. Heydorn, Dierdorf (Ausschreibung und Bauleitung) 1996 Dass sie diese Scheune in ihrer ursprünglichen Gestalt weitgehend erhalten haben, dafür, erzählen Andreas Poenitsch und Irmgard Oehry, seien die meisten Einwohner von Freirachdorf dankbar. Hatte doch der Bau, der als Remise, als Abstellraum, in den letzten Weltkriegstagen sogar als Kerker diente, seit Jahren leer gestanden und wurde nur – erzählt man sich – bisweilen als geheimes Liebesnest genutzt. 1995 erwarben Poenitsch und Oehry das schlichte Wirtschaftsgebäude und bauten es – geplant von Christoph V. Wissmann – zum Wohnhaus um. Die Eingriffe sind knapp, aber kalkuliert und – wie die Fensterschlitze an der Giebelseite – deutlich erkennbar. Das Eingangstor für landwirtschaftliche Fahrzeuge auf der Straßenseite blieb, obwohl mit Wandscheibe, Glasfugen und Kamin geschlossen, im Charakter weitgehend unverändert. Auf der Hofseite dagegen wurde der Ausschnitt zitiert und das Haus mit einem großformatigen Fenster zur herben Landschaft hin geöffnet. Die Bruchsteine der bis zu 60 Zentimeter dicken Mauern – aus blaugrauem Westerwälder Trachyt – blieben unverputzt. Die Stürze der alten Öffnungen wurden mit Sichtziegeln ausgemauert, für die neuen Öffnungen wurde dagegen Industriestahl verwendet. Die verzinkten Rohre der Installationen sind sichtbar verlegt. Sie markieren ebenso wie die ganz in weiß gehaltenen neuen Gipskarton-Wände die Umnutzung. Deren Höhepunkt ist der Wohnraum: lichtdurchfluchtet, mit offenem Dachstuhl und Firstoberlicht. 4 Meter breit, 10 Meter lang und 10 Meter hoch. Der zwischen Alt und Neu changierende Raum, in dem sich auch Treppen und Galerien der Obergeschosse befinden, bildet das architektonische und atmosphärische Zentrum des Hauses und erreicht eine geradezu sakrale Anmutung. Alles in allem wurde ein Stück Heimat, an das sich vielfältige Erinnerungen knüpfen, das aber ohne die Intervention der Bauherrn wohl einem dieser typischen Fertighäuser samt Vorgarten gewichen wäre, gerettet und mit bedachter und gestalterischer Raffinesse in die Gegenwart transformiert. (en) 49 024-077archifuehrer.indd 48-49 27.10.2005 17:22:15 Uhr Mittelrhein | 15 Hasselbach Haus für die Kunst 57635 Hasselbach Georg A. Schütz, Bad Neuenahr, mit Stephanie Diederichs, Bad Breisig, und Erwin Wortelkamp, Hasselbach 1997 Nach Worten seines Architekten Georg A. Schütz lebt das „Haus für die Kunst“ genannte Gebäude „von dem, was nicht da ist.“ Dieses Nicht-Existente bedeutet vor allem das Weglassen alles Überflüssigen, die radikale Reduktion auf das unbedingt Notwendige: vier bloße Mauern aus Sichtbeton, ein Pultdach aus Blech mit Oberlichtern, eine Tür je Langseite des Gebäudes, eine kleine, als Sitzbank dienende Leiste an der Straßen-, ein horizontaler Fensterschlitz in Hüfthöhe an der Gartenseite. Wobei diese scharfkantigpräzise Öffnung wirkt, als hätte man sie mit dem Laser aus dem Beton herausgeschnitten. Schließlich: ein Raum. Kein Fassadenschmuck, keine Gliederung – bis auf diesen wild wuchernden Wein, der langsam über das Gebäude wächst –, keine Perspektiven, Enfiladen, räumlichen Verschränkungen und keine Details. Das Gebäude ist eine Gebrauchskiste, roh, ruppig und rau – ähnlich den Bauernschuppen, die allenthalben die Felder des Westerwaldes säumen. Das Haus für die Kunst ist ein Haus, das der Kunst dient – und sich nicht selbst darstellt. Es wird – 170 Quadratmeter groß und bei Veranstaltungen Platz für 100 Personen bietend – als Ausstellungs- und Seminarraum sowie als Atelier benutzt. Und bildet gleichzeitig einleitendes Entree für die Skulpturenlandschaft „Im TAL“, die Erwin Wortelkamp seit 1986 auf einem 10 Hektar großen Areal realisiert. Der mehrfach preisgekrönte Bildhauer hat nach und nach den Bauern der Umgebung Land abgerungen und Künstler, Architekten, Landschaftsarchitekten sowie Literaten eingeladen, um Landschaft zu gestalten, neu zu schaffen. Einen behutsamen Dialog zwischen Kunst und Landschaft zu ermöglichen. Ein einzigartiges Projekt in Europa, wobei Wortelkamp keinen Freizeitpark, sondern einen Ort der Stille schaffen will. Unter den bisher 40 Skulpturen, Installationen und Environments befindet sich beispielsweise die „Eremitage“ der Künstlerin Gloria Friedmann, eine innen blutrot gestrichene Erdkammer, in der man, Schweigsamkeit vorausgesetzt, einen pochenden Puls hören kann. Für das Werk des Fotografen August Sander, der gute 20 Jahre im Westerwalddorf Kuchhausen lebte, errichtete der Südtiroler Architekt Hanspeter Demetz im TAL ein kleines Museum. „Wir müssen wieder lernen mehr zu schauen und weniger zu reden“, sagte Sander einmal – ein Satz, der für das ganze Projekt gelten kann. (en) 53 024-077archifuehrer.indd 52-53 27.10.2005 17:22:25 Uhr Mittelrhein | 18 Koblenz Wohn- und Geschäftshaus Mainzer Straße 75, 56068 Koblenz Wolfgang Schumacher 1965 Einer Überlieferung nach soll sogar der entlang des Rheins reisende Richard Neutra von dem Gebäude in Koblenz’ Mainzer Straße so begeistert gewesen sein, dass er dessem Architekten prompt einen Besuch abstattete. Atmete doch das von Wolfgang Schumacher entworfene Haus jenen konstruktiv-rationalistischen Geist, mit dem der 1923 in die USA ausgewanderte Österreicher Neutra in die Architekturgeschichte einging: eine streng gerasterte, blau lackierte Stahlkonstruktion, bei der die Fassadenfelder mit Bimsbeton ausgefacht sind, geschosshohe Fenster, vorgesetzte Balkone aus StahlbetonFertigteilen, gläserne, fast zarte Brüstungen und raumgreifende horizontale Überstände, die bei dem hohen Sonnenstand im Sommer die Räume vor allzu starker Einstrahlung schützen. Ein purifiziertes Gebäude, präzise, klar und schnörkellos – und in der Mitte der 60er Jahre im rechtschaffen-biederen Koblenz ein avantgardistisch-funktionalistischer Fremdkörper mit Details – etwa die statt Regenrohren verwendeten, die Adhäsionskraft nutzenden Eisenketten –, die Jahrzehnte später von ökologisch engagierten Architekten wieder entdeckt wurden. Zu viel der Avantgarde für die Bauaufsicht: Schumacher hatte etwa des Flachdaches halber einige Konflikte durchzustehen. Und doch ist das viergeschossige, später um ein Staffelgeschoss erhöhte Wohn- und Geschäftshaus ein früher Vertreter eines reflektierten Regionalismus: Die das Erscheinungsbild mitbestimmenden Materialien stammen aus der Region. Der Architekt verkleidete die geschlossenen Fassadenfelder mit großformatigem Moselschiefer aus dem nahen Mayen, die Stirnseiten mit einer vertikalen Verschalung, deren Holz aus dem Westerwald kommt. (en) 59 024-077archifuehrer.indd 58-59 27.10.2005 17:22:41 Uhr Mittelrhein | 19 Koblenz Verwaltungsgebäude AWK August-Horch-Straße 10a, 56070 Koblenz Kersten Martinoff Struhk, Braunschweig, Raimund Herms (Landschaftsarchitekt) 1982 Das Verwaltungsgebäude der AWK Aussenwerbung stellt einen äußerst wichtigen Beitrag in der Geschichte des deutschen Bürobaus dar. Denn in diesem Gebäude wurden nicht nur neue Wege in der Organisation von Büros beschritten, sondern auch nach neuen Lösungen hinsichtlich des Raumklimas, des Energiesparens und der Haustechnik gesucht. Beides mit Erfolg. Beides ist inzwischen Standard, obgleich leider nicht überall verwirklicht – wie man auch im Industrie- und Gewerbegebiet an der Bundesstraße B9 bei Koblenz-Kesselheim sehen kann. Dort, einst Rübenacker und Streuobstwiesen, hat Hans Struhk mit Raimund Herms eine Oase – einen grünen Entspannungs- und Erlebnisraum – geschaffen, die das Gebäude wie ein Schutzwall gegen den Lärm, den Staub und die ästhetischen Grausamkeiten der Umgebung abschirmt. Die dicht an den zweigeschossigen Bau gesetzten Bäume, Sträucher und Rankgerüste mit Kletterpflanzen machen zusätzlich Sinn, indem sie im Sommer Schatten spenden (im Winter Sonneneinstrahlung zulassen) und die Luft filtern. Das Gebäude selbst bietet ein ebenso differenziertes wie vielfältiges Raumgefüge, wobei auf individuelle Zellen- und Großraumbüros zugunsten von Gruppenbüros verzichtet wurde. Wobei diese auf zueinander versetzten und mit Halbgeschosstreppen verzahnten Ebenen locker verteilt wurden. Ein räumlicher Zusammenhang ist dennoch spürbar, was durch die zweigeschossige Halle mit großzügigem Oberlicht und einer muldenförmigen Absenkung betont wird. Interessant ist die Konstruktion: Das Gebäude setzt sich aus einer Addition von Konstruktionseinhei- ten zusammen, die aus einem Wandscheibenpaar – alternativ eine Gruppe von vier Stützen – und einer darauf ruhenden Stahlbetonkassettendecke besteht und deren Rastermaß 1,20 Meter beträgt. Das Tragwerk ist höchst flexibel, auch Zellenbüros können, so gewünscht, eingerichtet werden. Alle Büroflächen sind mit Ausnahme der klimatisierten EDV-Abteilung natürlich belüftet, die abgeschirmten Arbeitsplätze über Fenster, Oberlichter und Lichtschächte natürlich belichtet. Die Decken wurden nicht abgehängt und können damit als Temperaturspeichermasse benutzt werden. Besonderen Charme besitzt das Gebäude durch die unprätentiös-freundliche Gestaltung, wobei die Originalgemälde und -zeichnungen von berühmten Künstlern an den Wänden ihm zusätzlichen Reiz geben. Das AWK-Gebäude wurde als vorbildlicher Bau in RheinlandPfalz 1983 ausgezeichnet. (en) 61 024-077archifuehrer.indd 60-61 27.10.2005 17:22:48 Uhr Mittelrhein | 24 Neuwied Landesschule für Blinde Feldkirchener Straße 100, 56567 Neuwied Otto Buhr 1980 Das der Gesundheit förderliche Gebäude, das seinen Bewohnern Luft, Licht und Sonne bietet, war eine der großen Forderungen des Neuen Bauens der 1920er Jahre. Auf die Verknüpfung von Architektur und gesundem Körper berief man sich nach Beatriz Colomina, Professor für Architekturgeschichte und -theorie in Princeton, das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Und so nimmt es kein Wunder, dass moderne Architektur auch für auf den ersten Blick so schwierige Bauaufgaben wie einem Gebäude für Behinderte kluge Lösungen findet. Wobei Otto Buhr für seine Schule für Blinde und Sehbehinderte nach seinem Wettbewerbsgewinn 1971, so wird berichtet, „unzählige Gespräche mit Blindenlehrern“ geführt hatte und deren Erfahrungen in die Planung einbrachte. Da ist zum Beispiel die Frage, wie der Ersatz für die visuelle Orientierung beschaffen sein muss. Buhr, der nicht nur sensibler Architekt, sondern auch renommierter Maler war, setzte auf klare Strukturen, Orthogonalität der Erschließungswege sowie auf taktile, akustische und sogar olfaktorische Wahrnehmung. Ein leise plätschernder Brunnen markiert zum Beispiel den Schuleingang. Vor Beginn einer Treppe und an deren Ende verändert sich der Bodenbelag: Das Linoleum der Gänge, der Kunststein der Stufen wechselt sich mit einer weichen Gummimatte ab. Das Mittel kontrastreicher Farbgebung wurde zusätzlich für sehbehinderte Schüler eingesetzt: Das Linoleum ist wie der Kunststein hellbeige, die Gummimatte schwarz, die Treppenkanten wurden mit schwarzen Streifen beklebt. Auch bei Türen und ihren Rahmen wurde auf starke Kontraste großen Wert gelegt. Die Wege auf dem insgesamt 12 Hektar großen Areal vor den Toren des Neuwieder Stadtteils Feldkirchen sind an den Kreuzungspunkten oder vor Eingängen anders gepflastert, vor den Bäumen im Schulhof steigt das Pflaster leicht an. Auf dem weitläufigen, parkähnlichen Gelände, in das Buhr seine höchstens dreigeschossigen Bauten gesetzt hat – neben der Schule auch Kindergarten, Turnhalle, Schwimmhalle, große Aula, Wirtschaftsgebäude, Kantine und insgesamt sechs Internatsgebäude – wird selbst der Geruchssinn zur Ortsbestimmung eingesetzt. Duftende Beete mit Rosen, Flieder oder anderen Sträuchern kennzeichnen Partien der Freiräume und umgeben die Gebäude. Die mit schwarzem Kunstschiefer gedeckten, stets vertikal überstehenden Treppentürme gliedern die Gebäudegruppen zusätzlich. Die Blindenschule wurde 1985 mit dem Staatspreis für Architektur und Kunst des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. (en) 71 024-077archifuehrer.indd 70-71 27.10.2005 17:23:14 Uhr Trier-Eifel-Hunsrück | 09 Lorscheid Dorfsaal Hauptstraße, 54317 Lorscheid Architektur 9+, Trier 2002 Der Dorfsaal auf dem Lorscheider Festplatz ist eine dieser kleinen Erfolgsgeschichten, welche Architektur trotz jahrelanger Bauflaute dann doch zu schreiben in der Lage ist. Und dies trotz sehr bescheidener Finanzmittel. Das etwas von der Straße zurückgesetzte Gemeindehaus besteht aus drei Baukörpern, die mit einem umlaufenden, kräftig roten Bretterband zusammengefasst werden: der eigentliche, lichtdurchflutete Dorfsaal, der sich in Volumen und Satteldachneigung in etwa den traditionellen Häusern des Dorfes anpasst, trotzdem in Konstruktion, Material und Detaillierung ein unmissverständlich modernes Gebäude ist, eine Einheit mit Funktionsräumen wie Küche, Garderobe und Sanitärzellen sowie eine verbindende, als Foyer dienende Glasfuge mit Theke, Anrichte und ebenso schön gestalteten wie praktischen Wandschränken. Vor Fuge und Funktionseinheit befindet sich ein einladender Innenhof, darunter die Gemeindebibliothek und ein Jugendraum, deren StahlbetonKonstruktion – eigentlich handelt es sich um eine schlichte, die Hanglage ausnutzende Unterkellerung – auch sichtbar ist. Die Breitseite des Dorfsaales, der bei Konzerten etwa 150 Personen Platz bietet, aber auch als Gymnastiksaal und Turnhalle fungiert, öffnet sich mit drei doppelflügligen Fenstertüren zum Festplatz, eine Holzterrasse schafft eine Übergangszone. Bei der Kirmes oder anderen Gemeindefesten kann damit der ganze Dorfsaal einbezogen werden, bei Familienfesten im Gemeindehaus lässt sich auch der Festplatz benutzen. Holz ist nicht nur der vorherrschende Baustoff und das dominierende Gestaltungselement, sondern auch das Heizmaterial: Von einer Holzhack- schnitzelanlage werden sowohl der Dorfsaal als auch der benachbarte Kindergarten und das Feuerwehrhaus beheizt. (Jährlich betragen die Heizkosten für alle drei Gebäude 1000 Euro.) Schon an der Entstehung des Gebäudes nahmen die Dorfbewohner regen Anteil, ihre Eigenleistungen – Verschalung, Elektroarbeiten, Anstrich, Verfliesen – senkten die Baukosten um etwa 140.000 Euro. Seit der Fertigstellung des Dorfsaales ist er fast ununterbrochen mit Aktivitäten besetzt, neue Gruppen – Chor, Theater- und Gymnastikgruppen – haben sich gebildet. Obwohl am Rand von Lorscheid gelegen, ist der 2002 als vorbildlicher Bau im Landkreis Trier-Saarburg ausgezeichnete Dorfsaal zur neuen Mitte geworden. (en) 111 094-123archifuehrer.indd 110-111 27.10.2005 17:26:12 Uhr Trier-Eifel-Hunsrück | 13 Trier Synagoge Kaiserstraße 25, 54290 Trier Alfons Leitl 1957 Der Neubau der Trierer Synagoge zwölf Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs und der Shoah ist primär eine Symbol der Versöhnung. Eine Geste der ausgestreckten Hand trotz aller Opfer – von Seiten der Opfer. Dass der – retrospektiv wohl heikle – Auftrag an Alfons Leitl vergeben wurde, kann damit erklärt werden, dass Leitl als ebenso äußerst kenntnisreicher wie diskurswilliger Herausgeber der renommierten Zeitschrift „Baukunst und Werkform“ und gefragter Architekt über allen architekturtheoretischen Fronten stand und Tradition und Moderne mit einigem Erfolg verband. Obwohl Autodidakt, arbeitete er als verantwortlicher Stadtplaner in Rheydt und Wesel, später als Stadtbaurat in Trier und hinterließ nach seinem Tode 1975 ein vielfältiges Œuvre von über 100 realisierten Bauten und Wettbewerbsprojekten. Leitl konzipierte die Synagoge als von der Umwelt abschottenden, kargen und konzentrierenden Versammlungsraum einer sich um und für Gott sammelnden Gemeinde – unabhängig von der konkreten Religionszugehörigkeit. Entsprechend stattete Leitl den Bau bewusst mit jüdischen und christlichen Elementen aus. Die Eingangssituation der Synagoge etwa – eine Freitreppe sowie das halbrund gebogene Vordach – hatte Leitl schon zuvor bei christlichen Sakralbauten geplant. Ähnlich wie für seine Dorfkirchen wählte Leitl für den jüdischen Betsaal eine sehr klare und stereometrisch einfache Form: ein längsrechteckiger Kubus mit einer Außenhaut aus behauenem Eifeler Sandstein und Fenstergewänden aus Betonwerkstein. Unterhalb des Flachdaches gliedert ein Fries die geschlossene Fassade an den Längsseiten, wobei die alternierend nach oben und unten gerichteten Fensterdreiecke als Teilformen des Davidsternes wahrgenommen werden können. Auch die kupfergedeckte, „sarazenische“ Lichtkuppel über dem Thoraschrein oder die Assoziationen als assyrische Ornamente weckende Reihung von Dreieckselementen mit kleinen Rundöffnungen an den Querseiten rufen den historistischen Synagogenbau des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ins Gedächtnis. Mit Synagogen im maurischen Stil erinnerte das selbstbewusst gewordene deutsche Judentum an eine Epoche, in der Juden und Christen friedlich und zu gegenseitigen Frommen und Nutzen zusammenlebten. (en) Hinweis: Von den vielen Kirchen, die Leitl in Rheinland-Pfalz, aber auch in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Wien gebaut hat, sei auf die Pfarrkirche Heilig Kreuz in Neuwied (Mittelrhein 40) verwiesen, die auf einen Viertelkreis aufgebaut ist und mit einem nadelförmigen Turm im Stadtbild für Aufmerksamkeit sorgt. Zu Leitls größten Profanbauten gehört der fünfgeschossige Kubus der Trierer Stadtbibliothek (Trier-Eifel-Hunsrück 37) mit seinen quadratischen Betonornamentfeldern. Der Bau wurde später verändert und entstellt. Literatur: Johannes Busmann: Die revidierte Moderne – Der Architekt Alfons Leitl 1909–1975, Wuppertal 1995. 119 094-123archifuehrer.indd 118-119 27.10.2005 17:26:32 Uhr Trier-Eifel-Hunsrück | 16 Trier Wohn- und Geschäftshaus Sternstraße 1, 54290 Trier Heinrich Otto Vogel 1960 Als der Bund Deutscher Baumeister im Juni 1951 in Trier tagte, hielt auch der ehemalige Trierer Stadtbaumeister Heinrich Otto Vogel einen Vortrag. Darin findet sich die kryptische Forderung: „Wir sollten uns hüten, im Wiederaufbau unserer Altstadt Architekturdogmen zu frönen, sondern das Primat des Einanderdienens anerkennen.“ Vogel war weder Anhänger der umfassenden Rekonstruktion der im Krieg zerstörten Altstädte, noch eines Neubaus auf Grundlage der gegliederten, aufgelockerten Stadt. Was er unter „Einanderdienen“ verstand, lässt sich an dem Beispiel eines Eckhauses in einer sehr prominenten Lage demonstrieren: an seiner Ostseite am Domfreihof gelegen, die Nordseite an einer der Hauptmagistralen der Trierer Altstadt, versuchte Vogel bei diesem Neubau traditionelle und zeitgenössische Motive zu verschmelzen, indem er sich bei der Fassadengestaltung in die jeweiligen Straßenfluchten einordnet. Der vorspringende, fünfachsige Mittelrisalit an der Sternstraße mit seinem breiten Giebel und seiner reichen Gliederung erinnert bewusst an das Fachwerkhaus in der Nachbarschaft. Und doch ist die streng orthogonale, auf das Tragwerk hinweisende, in hellem Grau gehaltene Betonstruktur lange nicht so kleinteilig wie die des Fachwerkes, wo dem mit Ochsenblut gestrichenen Holz eine Schmuckfunktion zukommt. Auch Vogel dekorierte seine Brüstungsfelder – mit zwar figürlichen, aber in der Technik modernen Bildern des Malers Werner Persy, die die Karfreitagsprozession durch die Sternstraße darstellen. Deutlich schlichter zeigt sich das Haus dagegen zum Dom hin gewandt: Die fast geschlossene Wand aus gelblichen Tuffplatten gliederte Vogel mit nur drei schmucklosen Fenstern und einem ebenso einfachen Hauseingang. Vis-à-vis der Domwestfassade hielt Vogel sich zurück, nur die fast spielerisch verteilten Bossensteine wecken Assoziationen an historische Fundstücke. Typisch für die 50er Jahre indes ist die Asymmetrie des Baukörpers, mit der Vogel sehr elegant gleich mehrere Aufgaben erfüllte. Zum einen konnte er das Haus in die Platzflucht des Domfreihofes stellen, zum zweiten ein deutliches Zeichen gegen die unter den Nazis bevorzugten Achsensymmetrie setzen – und zum dritten die Nutzfläche vergrößern. (en) Literatur: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): Architektur und Städtebau der 50er Jahre, Mainz 1992, S. 96–97. 125 124-153archifuehrer .indd 124-125 27.10.2005 17:27:31 Uhr Trier-Eifel-Hunsrück | 24 Trier Klosterkirche St. Maximin Maximinstraße, 54292 Trier Dieter G. Baumewerd, Münster, Gottfried Böhm, Köln, Alois Peitz, Trier 1995 Das Verhalten, das der neudeutsche Begriff Recycling umschreibt, ist keine moderne, auf die Umweltbewegung zurückgehende Erfindung. Gebrauchte Dinge, ob nun Gebäude oder Materialien, haben bereits unsere Vorfahren wieder verwendet. Das wird spätestens klar, wenn man das unter der ehemaligen Klosterkirche St. Maximin liegende Grabfeld besucht – der größten frühchristlichen Nekropole nördlich der Alpen. In die Fundamente wurden Basen von antiken Säulen, korinthische Kapitelle, mit Arabesken dekorierte Schlusssteine vermauert – ohne große Umschweife, mit wenig Respekt vor dem Historischen. Das Gotteshaus selbst wurde mehrmals zerstört, immer wieder aufgebaut, diente als Werkstatt und Handwerksschule, den Preußen dann ab 1815 als Kaserne. Nur ein paar Jahrzehnte später hatten die Preußen eine Hälfte des Baus wieder zur Garnisonskirche umfunktioniert (die andere diente weiter als Kaserne). Nach 1945 hatte St. Maximin die Aufgabe als Ausweichquartier für Gymnasien zu erfüllen. Heute, nach einem weiteren Umbau, dient das Gebäude vor allem als Sporthalle einer nahen Haupt- und Realschule und als Konzertsaal – und bisweilen auch als Raum für Gottesdienste. Der Umbau ging in zwei Abschnitten vor sich: Zuerst stand die statische Grundsicherung, der Abbruch der Kaserneneinbauten sowie die Rekonstruktion der barocken Fenster zur Gewinnung eines einheitlichen Erscheinungsbildes auf dem Programm. 1988 dann lobte das Bistum einen beschränkten Wettbewerb aus, um die Gestaltungsideen für die weitere Nutzung zu klären. Die punktuellen Eingriffe, die die nach dem Wettbewerb sich bildende Arbeits- gemeinschaft Baumewerd, Böhm und Peitz geplant hatten, sind reversibel. Die Kirchenraum in seinen monumentalen Dimensionen ist jetzt wieder erlebbar, kann aber mit seitlichen Schienen einer Fahrbrücke und aufrollbaren Textilien je nach Bedarf geteilt werden. In der Apsis befindet sich nun eine Bühne, die durch ein großes Schaufenster den Blick auf das Grabfeld freigibt. Als Bodenbelag wurde ein Schwingboden aus Eiche und Fußbodenheizung ausgewählt, wobei die Anschlüsse für Sportgeräte ebenso wie die für Elektrogeräte versenkt sind. Die Spuren der wechselvollen Nutzungen von St. Maximin blieben erhalten, ein ottonischer Torbogen etwa, neogotische Maßwerke oder die barocke Polychromie an den Schlusssteinen. Wegen und trotz seiner neuen Nutzung kann sich diese eindrucksvolle Kirche nach dem sensiblen Umbau als dreidimensionale Geschichtscollage präsentieren. (en) Literatur: Bauwelt 11/1990, S. 503–511. Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Trier: Die ehemalige Abteikirche St. Maximin in Trier, Geschichte Renovierung Umnutzung, Trier 1995. 141 124-153archifuehrer .indd 140-141 27.10.2005 17:28:13 Uhr Trier-Eifel-Hunsrück | 29 Mandern-Waldweiler Pfarrkirche St. Willibrord Hauptstraße/Ringstraße 54429 Mandern-Waldweiler Heinz Bienefeld 1968 Architektur beginnt da, wo zwei Backsteine aufeinander gesetzt werden, sagte Ludwig Mies van der Rohe einmal. Heinz Bienefeld hat viele Backsteine auf- und nebeneinander gesetzt. Er hat sie auf die Stirn-, auf die Flach- und auf die Längsseite gestellt, sie vertikal, diagonal, horizontal im Fischgrätmuster oder im wilden Verband geschichtet und gefügt, sie heraus gedreht, gekippt, gestuft. Und nicht aus industriell gefertigten, ebenso genormten wie perfekten, aber optisch leblosen Klinkern, sondern solchen aus ausgesuchten Ziegeleien, die noch nach altem Verfahren ihre Steine backen. Und auch nicht als Dekor, als vorgeblendetes Mauerwerk vor gedämmter Betonwand, sondern als sinnlich-körperhafte Mauern. Die Mauern, die in Waldweiler die Kirche St. Willibrord über polygonalem Grundriss formen, sind einen ganzen Meter dick. Außen wirken sie wie Stadtmauern, im dämmrigen Inneren des Gotteshaus wie Fassaden, die einen steinernen Platz umschließen, in dessen Mittelpunkt der durch eine quadratische Laternenöffnung im Dach beleuchtete Altar steht. Asketisch und gleichzeitig vertraut wie eine franziskanische Basilika aus dem Mittelalter, stark und standfest wie ein vernarbter Aquädukt aus der Antike, und doch durch das ornamentale Mauerwerk verspielt, zart und verletzlich und gleichzeitig wie eine Höhle bergend, ist diese Kirche eines der Schmuckstücke moderner Architektur in Rheinland-Pfalz. Sie rührt die Seele, und ist doch Ehrfurcht gebietend monumental. Und erfüllt wie selbstverständlich sowohl die Ansprüche der veränderten Liturgie nach dem zweiten Vatikanum wie die in den späten 60er Jahren aufkommenden Forderungen nach Gemeinderäumen. Darüber hinaus wies Bienefeld einen Weg, wie der Bestand zu integrieren ist: Zwischen dem zentralen Altar und einer angedeuteten Apsis platzierte der Architekt den Rest eines gotischen Chores der Vorgängerkirche, der nun – freistehend und selbst wie eine Reliquie wirkend – als Sakramentskapelle dient. Das Gotteshaus wurde 1977 als vorbildlicher Bau in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. (en) Hinweis: Der posthum mit dem großen BDA-Preis geehrte Heinz Bienefeld baute seine erste, dem heiligen Remaclus geweihte Kirche als Mitarbeiter von Emil Steffann in Cochem (Mittelrhein 10). Literatur: Manfred Speidel: Die heilige Stadt unter den Menschen, in: Heinz Bienefeld 1926–1995, hrsg. von Wolfgang Voigt, Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen 1999. 151 124-153archifuehrer .indd 150-151 27.10.2005 17:28:40 Uhr Rheinhessen-Nahe | 12 Klein-Winterheim Büro-Atriumhaus Sysgo Am Pfaffenstein 14, 55270 Klein-Winterheim INDEX Architekten, Ulrich Exner und Sigrun Musa, Frankfurt am Main 2000 Gemessen an der Zahl der Patentanmeldungen ist Rheinhessen, schreibt die Zeitschrift „Chip“, eines der kreativen Zentren europäischer Softwareindustrie. Leider verstecken sich allzu viele dieser Unternehmen – von Spiele-Programmierern bis zu Webdesignern – in biederen Bauten. In der im wahrsten Sinnes des Wortes abgehobenen Holzkiste der Firma Sysgo klingt dagegen das Provisorische und Temporäre an. Sie erinnert an die kalifornische Leichtigkeit des Seins, an ideenreiche Garagenfirmen, die der Entwicklung der EDV enormen Aufschub gegeben hatten. „Work on the wilde side“ war das Motto der Architekten, und die diese Idee erläuternde Fotomontage zeigt eine Wiese, um die fünf Jungs sitzen und ihre Laptops bearbeiten. In Architektur umgesetzt hieß dies, einen grünen Innenhof zu schaffen, um den über breite Galerien erschlossene Büros angeordnet werden, die durch gläserne Schiebetüren stets Blickkontakt zu diesen haben. Der mit Sträuchern und Bäumen bepflanzte und von einem abgewinkelten Glasdach gekrönte Innenhof zitiert das antike Atrium, dient aber gleichzeitig als klimatischer Puffer und reguliert den Temperatur- und Feuchtehaushalt des Gebäudes. Er stellt sich damit in den Dienst einer minimierten Haustechnik, die durch Regenwassernutzung zur Atriumbewässerung und Niedrigenergie-Standard konsequent auf Ressourcenschonung und Energieeinsparung ausgerichtet ist. Der innere Hausgarten ist darüber hinaus kontemplatives Zentrum, in dem angestrengte Augen – und Seelen – Ruhe finden. Wie dieser ruht auch die zweigeschossige Kiste mit ihrer Hauptlast auf einem 2,25 Meter hohen Betonsockel, der sich aus einer künstlichen Mulde erhebt, die als Parkebene fungiert. Von außen wirkt die Glasfassade mit ihrem signalrot lackierten Rahmen wie ein Monitor, im Inneren bewirkt sie, dass die Mitarbeiter, weil der Blick nicht durch Autos verstellt ist, gleichsam mitten im Grünen sitzen. Die Holzlamellen geben den Bildschirmarbeitsplätzen den notwendigen Blendschutz. Farben und Material, Pflanzen und Transparenz befördern eine entspannte, kommunikative, aber auch produktive Atmosphäre. Insgesamt hat eine neue, postfordistische Ökonomie einen angemessenen Ausdruck in einer anspielungsreichen Architektur gefunden, die – siehe das Atrium – Tradition ins 21. Jahrhundert transformiert. (en) Literatur: Hans-Peter Schwanke: Ressourcensparen zwischen Rezeption und Progression, Büro-Atriumgebäude, Klein-Winternheim bei Mainz in: DAM Architektur Jahrbuch 2001, München 2001, S. 52–55. 193 170-207archifuehrer.indd 192-193 27.10.2005 17:35:40 Uhr Rheinhessen-Nahe | 13 Mainz / Oppenheim MAN-Stahlhäuser An der Goldgrube 33, 35, 41, 43 55131 Mainz; Friedrich-Ebert-Straße 75 55276 Oppenheim Heinz Bauer 1951–53 Dornier, Messerschmitt und MAN, im 3. Reich vielbeschäftigte Rüstungsbetriebe, mussten sich nach 1945 nach anderen Betätigungsfeldern umsehen. Die Unternehmen, erfahren in Großserienanfertigung, Leichtbau und Montage, produzierten Fertighäuser, die wegen der riesigen Wohnungsnot in den Nachkriegsjahren einen reißenden Absatz versprachen. Das MANStahlhaus wurde auf Anregung des Ingenieurs Heinz Bauer im Stammwerk Augsburg entwickelt und im Werk Mainz-Gustavsburg von 1948 an in Serie produziert. Der Grundtyp hatte eine Fläche von 8 mal 8 Metern, konnte aber bis zu 8 mal 16 Metern auf Kundenwunsch ausgebaut werden. Die lichte Höhe der Räume betrug 2,45 Meter, das mit Asbestzementplatten gedeckte Satteldach sorgte für ein in Teilen begehbares Dachgeschoss. Eine Variante mit ausgebautem Dachgeschoss mit weiteren Schlafräumen und einem Bad wurde zusätzlich angeboten. Auch Doppelhäuser waren im MAN-Angebot. Doppelschalige, vertikal kannelierte Stahlplatten bildeten die Außenwände und zusammen mit einem Unter- und einem Obergurtrahmen sowie dem als Scheibe wirkenden Dach eine selbsttragende Konstruktion. Zur Dämmung wurde Glaswolle eingesetzt, die Innenwände bestanden aus Einbauschränken, die mit Holzfaserplatten gefertigt wurden und von den Bewohnern auch heute noch geschätzt werden. Die Räume waren mit Schiebefenstern, die Küchen mit Hängeschränken ausgestattet. Für den Bodenbelag konnten die Käufer zwischen Gasbetonplatten und Steinholz wählen, die Decken bestanden aus Holzplatten. Zwar konnte das Stahlhaus nach einem Baukastensystem von ungelernten Arbeitskräften an einem Tag errichtet werden, der Preis mit umgerechnet 7.500 Euro war für damalige Verhältnisse dennoch hoch. Und nicht viel günstiger als konventionelle Mauerwerkhäuser, wovon sich in der Anmutung die Stahlhäuser nicht viel unterschieden. 1953 stellte MAN die Produktion aufgrund von Nachfragemangel ein. Nach RheinlandPfalz wurden etwa 120 dieser Fertighäuser verkauft. Viele davon sind inzwischen demontiert, zur Unkenntlichkeit verändert oder mit Erkern, Aufbauten oder Vordächern erweitert. Über die Wohnbauten hinaus wurden in Mainz ein Geschäfts- und ein Ausstellungshaus aus Stahl, letzteres am Theater, errichtet. (en) Hinweis: Der Mangel an Baumaterialien in der Nachkriegsepoche war ein Nährboden für Experimente in der Architektur. Ein Beispiel ist die Lutherkirche (Rheinhessen-Nahe 41) in der Mainzer Wilhelmiterstraße aus dem Jahre 1949, die dem von Otto Bartning entwickelten Notkirchenprogramm entstammt. Eine typisierte, in Serie fabrizierte Holzkonstruktion in Kombination mit Mauern aus Trümmersteinen verknüpft industrielle Produktionsweisen mit dem Ort. 195 170-207archifuehrer.indd 194-195 27.10.2005 17:35:45 Uhr Rheinhessen-Nahe | 15 Mainz Heilig-Kreuz-Kirche 55131 Mainz, Schlesische Straße 23 Richard Jörg mit Bernhard Schmitz, Mainz 1954 Richard Jörg hat den Wiederaufbau des ursprünglich von Georg Moller 1833 als Zweckbau errichteten, im 2. Weltkrieg schwer beschädigten Theaters in Mainz geleitet. Ob er sich von diesem Gebäude bei seinem Entwurf für die Heilig-Kreuz-Kirche inspirieren ließ, ist nicht bekannt. Doch die Ähnlichkeiten sind frappant. Beide Architekten beschritten mit diesen Bauten neue Wege, und für beide brauchte es mutige Verantwortliche – wie der Mainzer Bischof Albert Stohr, der Heilig-Kreuz genehmigte. Während der Mollerbau mit seinem eher schmucklosen Halbrund als einer der wichtigsten Theaterbauten des 19. Jahrhunderts gilt, so ist das Gotteshaus der erste katholische Zentralbau in Deutschland in der Neuzeit. Dominierendes Element ist die kreisrunde, dreistufige Altarinsel, die von einer dreifach gestuften Schale – ein Baldachin in Jörgs Intention – überspannt wird. Die Gemeinde schart sich in einem Halbkreis um den Altar. In den Freiraum hineinragend komplettiert das Kreisrund eine Wand mit hochformatigen, schlanken Fenstertüren, auf denen zwölf Engel eingraviert sind und symbolisch die Gemeinde vervollständigen. Jörg wagte freilich nicht nur in der Form Neues, sondern auch in der Konstruktion. Zwei Paare von Betonstützen tragen den obersten Ring dieser lichtdurchfluteten Betonkuppel, die Paul Meyer-Speer in leuchtenden, der Bauidee dienenden Farben kongenial ausgemalt hatte. Die nächsten beiden, breiter werdenden Ringe mit Glasbausteinen sind vom obersten Ring abgehängt. Der sich anschmiegende Gemeinderaum wird mit einem flachen Pultdach gedeckt, wobei die tragenden Binder außen sichtbar sind. Die Umfassungswände des Gemeinderaums laufen in den Freiraum und bilden eine trapezförmige beruhigte Vorzone. Besagte Fenstertüren konnten früher ganz geöffnet werden, so dass – etwa an Kirchenfesten – ein Gottesdienst in großer Gemeinschaft auch im Freien gefeiert werden konnte. 2004 erfolgte durch die Mainzer Architekten Welschof + Schneberger die komplette Sanierung und Restaurierung des Gotteshauses mit dem Ziel, das durch Ingenieureinbauten und Übermalungen entstellte Erscheinungsbild des Sanktuariums wiederherzustellen. Entscheidend dabei war der Wiesbadener Künstler Eberhard Münch mit einer Interpretation der ursprünglichen Ausmalung von Schale und Ringen. Im Herbst 2005 wird der seit den 60ern offenliegende Bitumenestrich im Gemeinderaum mit bruchrauem Schiefer belegt, darüber hinaus soll die Beleuchtung entwurfsgerecht optimiert werden. Der Heilig-Kreuz-Kirche wohnt trotz leichter Veränderungen nach wie vor ein klare Ordnung und eine große Harmonie inne. Sie zeugt darüber hinaus vom Mut der 50er Jahre. (en) Literatur: Hugo Schnell: Die neue Kirche Hl. Kreuz in Mainz von Richard Jörg, in: Das Münster 1955, Heft 1/2. 199 170-207archifuehrer.indd 198-199 27.10.2005 17:35:55 Uhr Rheinhessen-Nahe | 17 Mainz Gutenberg-Museum Liebfrauenplatz 5, 55116 Mainz Rainer Schell, Wiesbaden Erweiterung: Rossmann + Partner, Karlsruhe 1962 (Erweiterung: 2000) Am Anfang standen zwei RenaissanceGebäude in der Nachbarschaft zum Mainzer Dom: der „Römische Kaiser“, der seit 1930 das Gutenberg-Museum beherbergte, und der „König von England“. Beide Häuser wurden im Krieg erheblich zerstört. Rainer Schell gewann mit einem additiven Konzept den Wettbewerb um den Wiederaufbau des Gutenberg-Museums. Die zerbombten Teile des „Römischen Kaisers“ baute er wieder auf. Den „König von England“ ersetzte er mit einem schmalen Trakt, wobei er den neuen Mauern noch verbliebene Relikte wie rotsandsteinerne Konsolen und Säulenportale vorblendete. Rechtwinklig zum Verbindungstrakt positionierte der Architekt einen kompromisslos modernen, freilich in Volumen und Höhe gegenüber den Altbauten sich zurückhaltenden Neubau. Ein Sockel aus grobkörnigem Beton, ein gläsernes Zwischengeschoss sowie weiß geäderte graue Marmorplatten in den beiden oberen Etagen verhüllten ein damals revolutionäres EinraumMuseum: Statt für übereinander gestellte Ausstellungsgeschosse entschied sich Schell für drei gegeneinander versetzte Ebenen. Mit dem Ergebnis eines unerwartet großzügigen Raumes und milder Übergänge zwischen den einzelnen Ausstellungsbereichen. Darüber hinaus erhielten auf diese Weise Empfangshalle und Vortragssaal eine angemessene Höhe. Wegen des Mangels an Ausstellungs- und Depotflächen lobte die Stadt 1989 einen Wettbewerb um einen Erweiterungsbau aus, den das Büro Rossmann + Partner gewann. Dem projektleitenden Partner Bernhard Schorpp gelang es dabei, mit seinem Entwurf – einem zweischiffigen Baukörper – ein städtebauliches Problem zu lösen und gleichzeitig die Modernität des Schellbaues sensibel, aber eigenständig weiterzuführen. Das eine gedeckte Schiff schließt den Baublock – bis dato ein ungestalteter Hinterhof, der sich mit Brandwänden und Rückwänden dem Liebfrauenplatz und dem Dom öffnete – und ordnet sich mit einem äußerst steilen Satteldach in die Umgebung ein. Das zweite Schiff dagegen setzt die Konturen und die Trauflinie des Schellbaus fort, mit dem es über die Seilerpassage durch eine Brücke verbunden ist. Auch im Material, in den zurückhaltenden Farben sowie in der Dachform ist dieses Schiff dem „Altbau“ verbunden, wobei es – klar ablesbar durch einen Holzlamellenvorhang – mit neuen Ausstellungsflächen in den Obergeschossen und einem Druckladen im Erdgeschoss verschiedene Nutzungen erfährt. Darüber hinaus optimierte Schorpp mit neuen Toren den Innenhof und setzte dem Schell’schen Verbindungstrakt eine gläserne Schicht vor, die nun dessen Nutzung als Café möglich macht. Die Erweiterung heilt eine städtebauliche Wunde, macht öffentlichen Raum erlebbar und zudem die Geschichte der Stadt als Abfolge und Überlagerung von Schichten sichtbar. Ein „Glücksfall“ schrieb die FAZ dazu. Zu Recht. (en) Literatur: Rainer Schell: Gutenberg Weltmuseum der Druckkunst, Mainz, in: Baumeister 11/1965. Edda Kurz: Erweiterung des Gutenbergmuseums, in: Bauwelt 24/2000. Dieter Bartetzko: Seid umschlungen, Ruinen, in: FAZ 17. 04. 2000. 203 170-207archifuehrer.indd 202-203 27.10.2005 17:36:10 Uhr Rheinhessen-Nahe | 18 Mainz Evangelische Auferstehungsgemeinde Ecke Am Fort Gonsenheim/Wallstraße 55122 Mainz Hans-Joachim Lenz, Mainz 1962 „Die Kirche ist Herzstück der Anlage sowohl in der grundrisslichen Funktion wie gegenüber den Gebäuden für die außer-gottesdienstlichen Aufgaben, wie auch in der äußeren Erscheinung.“ So lautete 1959 das – sprachlich etwas bemühte – Urteil einer von der Auferstehungsgemeinde eingesetzten Jury zu dem Entwurf von Hans-Joachim Lenz und sprach diesem den 1. Preis zu. Lenz hatte die angesprochene Anlage aus insgesamt acht Teilen arrangiert: dem Pfarrhaus, dem Gemeindehaus, dem Kinderhaus, einem frei stehenden Kirchturm, einer breiten Freitreppe, einer Glasfassade und einem Dach. „Kirche“, erläuterte der Architekt, „ist kein Gehäuse neben Gehäusen, Kirche als Gebäude ist nicht existent“. Und so baute Lenz auch keine Kirche, sondern formte einen Kirchenraum aus Teilen der Anlage: Jeweils eine Wand der längsrechteckigen Häuser (Pfarrhaus usw.) dient als Wand für die Kirche; wo massive Wände fehlen, werden sie durch solche als Glas ersetzt, und über allem thront ein auf vier Stahlbeton-Pfeilern ruhendes Dach: „Das weitausladende Dach“, so Lenz, „schwebt wie der göttliche Wille über dem menschlichen Bereich und fügt alle Dinge in gottgewollte Ordnung.“ Eine formvollendete Komposition: nüchtern, sachlich, sehr rational und doch mit einem Händchen für die Wirkungen von Geometrie, von Symmetrie und Topographie. Das jeweils vier Meter auskragende Stahlbeton-Dach ist quadratisch, was durch quadratische Deckenfelder betont wird. Auch der Grundriss des Kirchenraumes ist quadratisch, die querrechteckige Altarinsel dagegen hat der Architekt nicht symmetrisch an die Nordwand gestellt, sondern um genau ein Deckenfeld in Richtung des Gemeindehauses verschoben. Die sich vor dem Altar versammelnden Gläubigen stehen deshalb im geometrischen Zentrum der gesamten Anlage, die Freitreppe führt – mit Absätzen zum Sich-Sammeln unterbrochen – axial auf die Gemeinde hin. Wobei sich auch die Kunst vortrefflich in die Komposition fügt – der umlaufende, das spätmittelalterliche Motiv der Bilderbibel aufnehmende Betonfries von Heinz Hemrich und die Glaswände von Robert Seyfried, die mit eher kühlen, aber fein abgestimmten Farben dem Raum Leben und Licht geben. Lenz hat einen kleinen Tempelberg geschaffen, ein zur Entstehungszeit vielbeachtetes, heute allerdings hinter Gesträuch verstecktes und deshalb meist links liegen gelassenes Kleinod. (en) Literatur: Kunst und Kirche, 4/63, S. 159–162. 205 170-207archifuehrer.indd 204-205 27.10.2005 17:36:15 Uhr Rheinhessen-Nahe | 24 Mainz Frankfurter Hof Augustinerstrasse 55, 55116 Mainz Funk + Schröder, Darmstadt 1991 „Ein ähnliches, dem geselligen Vergnügen gewidmetes Lokal besitzt Mainz noch nicht, es übertrifft an Ausdehnung alle hier vorhandenen, und was man von der inneren Einrichtung jetzt und künftig zu erwarten hat, dafür sprechen die geschmackvollen Verzierungen der Decke, die geräumige, rings um den Saal laufende Galerie und die höchst zweckmäßige Einteilung des ganzen.“ Dies schrieben die Mainzer Unterhaltungsblätter am 10. November 1841 über den Frankfurter Hof. Doch schon bald sollte der Saal nicht mehr nur als „Unterhaltungstempel“, sondern auch als politisches Veranstaltungslokal fungieren. Im März 1848 traf sich hier ein revolutionäres „Bürgercomité“, einen Monat später zum ersten Mal der Arbeiterbildungsverein, kurz darauf wurde der „Demokratische Verein“ gegründet – natürlich im Frankfurter Hof. 1863 hielt Ferdinand Lassalle eine Rede, die in der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins münden sollte, und wieder kurze Zeit später geriet das Gebäude unter den Einfluss des Mainzer Bischofs Wilhelm Emanuel von Ketteler, wo er zum Hort des deutschen Sozial- und Vereinskatholizismus wurde. Der Saalbau sollte sich als Ort, an dem die Mainzer Demokratie praktizierten, in den 1980er Jahren noch mal bewähren. Die Stadtverwaltung hatte beschlossen, das „desolate Gemäuer“ abzureißen, da konstituierte sich eine Bürgerbewegung, um den Frankfurter Hof zu retten – mit Erfolg. Alois Funk und Paul Schröder, deren Entwurf den Wettbewerb gewann, hatten also nicht nur baufälliges Gemäuer zu modernisieren, sondern einen Traditionsort, den Mainzer stolz Rheinhessische Paulskirche nennen. Das Konzept war, den Altbau an der Augustinerstraße und den eigentlichen Saalbau zu erhalten, den Verbindungstrakt abzureißen und ihn durch einen neuen zu ersetzen, wobei Alt und Neu deutlich sichtbar zu trennen waren. Die neobarocke Schaufront, eine Zutat von 1885, wurde sorgfältig restauriert. Der gerahmte Zugang zum neuen Kulturzentrum fügt sich in die wiederhergestellten Arkaden sensibel ein. Das neue Foyer ist außen durch eine gelb-grau gestreifte Natursteinfassade und ein Rundfenster ablesbar, im Inneren wirkt es seiner edlen Materialien, der Galerie und der freischwingenden Treppe sowie des dreischiffigen Grundriss’ wegen etwas sakral. Das Konzept, den Verbindungstrakt als einen durch eine Glashülle geschützten Außenraum erscheinen zu lassen, ist aufgegangen. Die „geschmackvollen Verzierungen“ des alten Saalbaus haben die Architekten mit Kristallkapitellen und opulenten Deckenleuchten zeitgenössisch zitiert. Durch die Eingriffe hat der Frankfurter Hof, wie Dieter Bartetzko schrieb, „die ihm gemäße architektonische Gestalt“ bekommen. Er ist zugleich einer der wenigen wirklichen gelungenen Beispiele der Postmoderne in Rheinland-Pfalz. (en) Literatur: Dieter Bartetzko: Der Frankfurter Hof in Mainz, in: Bauwelt 40/1991. Kulturdezernat der Stadt Mainz in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Frankfurter Hof: Der Frankfurter Hof 1841–1991. Mainz 1991. 217 208-245archifuehrer.indd 216-217 27.10.2005 17:39:01 Uhr Rheinhessen-Nahe | 27 Mainz Wohnsiedlung Gustav-Mahler-Straße, 55127 Mainz Steidle + Partner, München, Klaus Bierbaum, Mainz (Landschaftsarchitekt) 1997 „Die Anlage stellt einen zeitgemäßen und positiven, in die Zukunft weisenden Beitrag für eine umweltgerechte Wohnumfeldgestaltung und für die Entwicklung des Wohnungsund Städtebaus im urbanen Kontext dar.“ So urteilte eine Jury, welche die allgemein als Papageiensiedlung bekannte Wohnanlage auf dem Mainzer Lerchenberg 1995 mit dem Staatspreis Architektur und Städtebau auszeichnete. Die vom 2004 verstorbenen Otto Steidle unter Mitarbeit seiner Architekturklasse an der Kunstakademie München geplante Wohnsiedlung ist in der Tat eines der wenigen gelungenen Mainzer Beispiele im sozialen Wohnungsbau, obwohl der die Westzeile und das angrenzende Verwaltungsgebäude einbeziehende Entwurf, mit dem Steidles Büro in einem Gutachterverfahren den 1. Preis errang, eine städtebaulich weitaus schlüssigere Gesamtlösung vorsah. Unterschiedliche, zu insgesamt vier Wohnzeilen geformte Haustypen umfassen ein quadratisches Feld, wobei zwei achtgeschossige Wohntürme mit ihren kräftigen Farben einerseits als Erkennungszeichen dienen, zum anderen die Siedlung in die von Wohnhochhäusern geprägte nähere Umgebung eingliedern. Im funktionalen Zentrum der Siedlung formulieren die beiden Mittelzeilen einen gepflasterten, mit einer strengen Baumallee aufgewerteten Platz, der durch Verbindungsbrücken im 2. Obergeschoss gerahmt wird. Neben eher öffentlichen Wegen gibt es auch Grünräume, die mit vorgelagerten Mietergärten verbunden sind. Während die viergeschossigen Mittelzeilen in zwei, auch von außen sichtbare Zonen mit Familienmaisonetten aufgeteilt sind, wurde in der fünfgeschossigen Nordzeile zwischen diese Zonen eine Etage mit Zwei-ZimmerWohnungen geschoben. Im Osten wurden die aus Nord- und Mittelzeile bekannten Haustypen zu einer Doppelzeile mit Innenhof kombiniert. Beeindruckend ist der gelungene Versuch, den Bewohnern trotz der hohen Bebauungsdichte ein hohes Maß an Individualisierung zu bieten. Dazu tragen stimmige Details wie Oberlichter in den Eingangsnischen, eine reiche, aber niemals aufdringliche Materialvielfalt und die sensible Farbgestaltung des Berliner Künstlers Erich Wiesner bei. Das Mainzer Büro Infra, einer der 2. Preisträger beim genannten Verfahren, plante die Westzeile mit behindertengerechten Altenwohnungen. Der Entwurf für das erwähnte Verwaltungsgebäude für den Pharmakonzern Novo Nordisk im Osten der Siedlung stammt von den Kopenhagener Architekten Dissing + Weitling. (en) 223 208-245archifuehrer.indd 222-223 27.10.2005 17:39:25 Uhr Rheinhessen-Nahe | 32 Mainz Hotel Quartier 65 Wormser Straße 65, 55130 Mainz Max Dudler, Berlin 2001 „Assimilierter Exot“ hat Dieter Bartetzko in der FAZ das Quartier 65 genannt, „mediterrane Skulptur“ und ein seltenes „Juwel jenes Bauens im Bestand, das die vornehmste, dabei fortwährend missachtete Aufgabe unserer Tage ist“. Ein hohes Lob, das freilich in der Fachwelt auf Resonanz stieß. Die Architekturzeitschriften berichteten positiv über das Gebäude, und beim BDA Architekturpreis Rheinland-Pfalz 2003 erhielt es eine Auszeichnung. Anwohner dagegen kritisierten den Bau, eine Lokalzeitung schrieb gar von einer „ultramodernen Hütte“. Nun ist der Bau, der alles Überflüssige gleichsam abgestreift, alles Unnötige verbannt hat, alles andere als gewöhnlich und ragt in der historischen Rheinfront der ehemaligen, denkmalgeschützten Schifferhäuser im Mainzer Stadtteil Weisenau durch seine Gestaltung heraus. Wobei sich das giebelständige Haus mit seinen stehenden Fenstern, wie eine vom BDA eingesetzte Jury urteilte, „rücksichtsvoll zu seiner Umgebung“ verhält. Das mit weißgrauem portugiesischen Granit verkleidete Gebäude – auch das Dach ist mit diesem Material bedeckt – ist die Essenz eines Hauses. Max Dudler hat auf einer gerade 6 Meter breiten Parzelle eine Art Urhütte entworfen und diese erinnert ein wenig an das Haus im Haus, das sein ehemaliger Lehrer Oswald Mathias Ungers im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt gebaut hat. Dieses wie jenes erhält durch die radikale Abstraktion etwas Erhabenes, eine fast sakrale Stimmung, die in Weisenau durch den pathetischen Vorplatz betont wird. Das Innere – Frühstückscafé und Bar, die gleichzeitig als Rezeption dient, jeweils zwei Zimmer in den insgesamt drei Obergeschos- sen sowie ein meditativer Innenhof – ist ähnlich reduziert. Aber in seiner Askese perfekt bis ins Detail. Die Fugenschnitte stimmen, Türzargen und Fußleisten sind wandbündig und Armaturen präzise platziert. Im Großen wie im Kleinen: Das Haus ist schlüssig – in einer Konsequenz, wie es sie sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Hotelgewerbe äußerst selten gibt. (en) Literatur: Dieter Bartetzko: Winzling mit Riesenkraft, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 07. 2003, S. 38. 233 208-245archifuehrer.indd 232-233 27.10.2005 17:39:54 Uhr Rheinpfalz | 18 Ludwigshafen Café Laul Ludwigsplatz 13a, 67059 Ludwigshafen Stadtbauamt Ludwigshafen 1952 Allein schon diese Schrift über dem Dach: geschwungen und gekurvt, fein, fast filigran und fließend – wie von zarter Mädchenhand geschrieben. Die Schrift drückt wie das Gebäude und das Mobiliar jenes Lebensgefühl der „swinging fifties“ aus, das unter der politischen Formel „Keine Experimente“ nach neuen Wegen und ästhetischen Experimenten suchte. Nach der tief finstren Nacht des 3. Reiches das Morgenrot des bundesdeutschen Wirtschaftswunders, nach den monumentalen, streng symmetrischen Klötzen des Nationalsozialismus das Leichte und Organische einer internationalen Architektur. 1952 wurde das Café Laul gebaut – als eleganter Höhepunkt und Abschluss der parkartigen Anlage des Ludwigsplatzes mit seinen mächtigen Platanen und mit freiem Ausblick auf den Winterhafen. Zwischen elegantem Strandpavillon und provisorischem Kiosk changierend – ein Stückchen Rimini am Rhein. Auf der Nordseite des leicht und organisch anmutenden Gebäudes befand sich ein Verkehrsbüro, in dem nicht nur Billets für Straßenbahn und Bus, sondern auch Eintrittskarten für Konzerte und Fastnachtsveranstaltungen erhältlich waren. Die Südseite nahm ein kleines Café auf, das sich mit einer Terrasse in die Gartenanlage integrierte. Der freistehende Baukörper, das weit überstehende Dach, die bleistiftdünnen Stützen, die schlanken Profile bei Fenstern und Türen, das umlaufende Fensterband mit den nach außen kippbaren Oberlichtern, all das stellt Bezüge nach draußen her. Die äußere Ovalhälfte des Cafés findet seine Entsprechung in einer elliptischen Wand im Inneren, wobei auch die Sitzbänke, die Tische wie die Schränke und der Tresen ge- bogen sind. Seit 1992, in diesem Jahr wurde auch der Ludwigsplatz neu gestaltet, steht das „Laul“ unter Denkmalschutz. Seit 1998 wird es nach einer vom Innenarchitekten Ulrich Jarczyk, Grünstadt, geleiteten Sanierung nur noch als Café (heute Bistro) genutzt. Der vorher winzig kleine Gastraum wurde sensibel erweitert, in den Räumen des Verkehrsbüros – die zwischenzeitlich als Geschäftsstelle der örtlichen FDP dienten – wurde eine Küche und eine Toilettenanlage eingebaut und die Haustechnik auf neuesten Stand gebracht. Die herrliche Aussicht auf den Rhein allerdings – heute wäre das Standortqualität – ist lange verschwunden. Bereits 1957 hatte man den Winterhafen zugeschüttet und in der Folge den östlichen Platzrand – nicht immer sehr gelungen – bebaut. (en) 349 314-385archifuehrer.indd 348-349 27.10.2005 17:16:37 Uhr Rheinpfalz | 21 Ludwigshafen Friedrich-Engelhorn-Haus Carl-Bosch-Straße 44, 67063 Ludwigshafen Helmut Hentrich und Hubert Petschnigg 1957 „Symbol des Aufbauwillens“, „höchstes Haus Deutschlands“, „Industrie-Walhall in Ludwigshafen“: So tönten die Zeitungen am 22. März 1957, nachdem einen Tag zuvor das Friedrich-Engelhorn-Haus im Beisein allerlei Prominenz eingeweiht wurde. Während Werner Bockelmann, damals Oberbürgermeister Ludwighafens, die BASF zum „ersten richtigen Hochhaus der Bundesrepublik“ beglückwünschte, blieb die putzigste Schlagzeile der in Innsbruck erscheinenden, geographisch wenig kundigen „Tiroler Tageszeitung“ vorbehalten. Ihrem Bericht über das BASF-intern „E 100“ genannte Gebäude gab sie den Titel: „moderne bauten als zeugen kultureller schöpferkraft in baden-württemberg“. Nun, Schöpferkraft haben die Architekten Helmut Hentrich, Hubert Petschnigg und ihre Partner, Gewinner eines eingeladenen Wettbewerbs, wirklich benötigt: War doch in Deutschland solch ein Haus in damals gigantisch erscheinenden Dimensionen – 101,60 Meter hoch, 27 Meter breit, 55 Meter lang – ohne Vorbild. Die Düsseldorfer Architekten verarbeiteten Anregungen vom 1954 fertiggestellten LeverHouse in New York und Mailands kurz darauf folgendem Pirelli-Hochhaus zu einem originären Beitrag. Der Grundriss zum Beispiel – jeweils an den Fassaden die Bürozeilen und in der Mitte zwei Flure, acht Aufzugsschächte plus Nebenräume – galt zu jener Zeit in Deutschland geradezu als revolutionär. Ebenso die durchgehende Klimatisierung und Lüftung der Räume (die Klimaanlagen wurden erst 2004 ausgewechselt). Oder die Fassaden, die an den Längsseiten statt des zeittypisch vorstehenden Betonrasters ein einheitliches, violett schimmerndes Kleid aus venezianischem Glasmosaik aufwiesen (bevor es 1996, nachdem der Untergrund schadhaft wurde, von einer mit KeramikSiebdruck beschichteten Alu-Glas-Vorhangfassade ersetzt wurde). Indes, die größte Tat von Hentrich und Petschnigg war das immerhin 68.000 Tonnen schwere Gebäude leicht, beinahe fragil aussehen zu lassen. Die gläserne Cafeteria im 21. Stockwerk mit ihrem auskragenden Flugdach trägt zu diesem Eindruck bei, auch die teilverglasten Giebelseiten, die den Bürofluren natürliches Licht geben, sowie die von einem verwegen geschwungenen Dach gekrönte Eingangshalle, die im spitzen Winkel zum Gebäude steht. Hauptursache für die fast schwebende Anmutung jedoch sind die schräg abgewinkelten Stahlbetonstützen, die ein vollverglastes Erdgeschoss ermöglichten. Eine politische Geste, gerichtet gegen die steinstarre Monumentalität des Nationalsozialismus – wichtig gerade bei einem wieder aus dem IGFarben-Verbund entlassenen Unternehmen. Werner Bockelmann übrigens vertauschte noch 1957 den Ludwighafener Oberbürgermeister-Sessel mit dem von Frankfurt, wo er entscheidende Weichen stellte, damit aus Hessens größtem Dorf „Mainhattan“ werden sollte. (en) Literatur: BASF (Hrsg.): Das Hochhaus der BASF. Planung – Ausführung – Erfahrungen, Stuttgart 1958. 355 314-385archifuehrer.indd 354-355 27.10.2005 17:16:54 Uhr