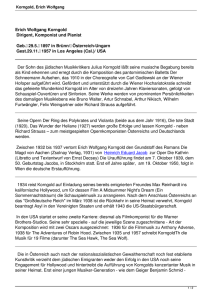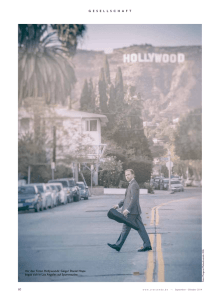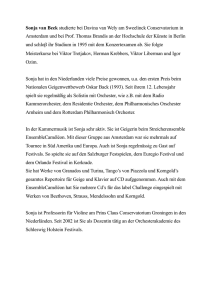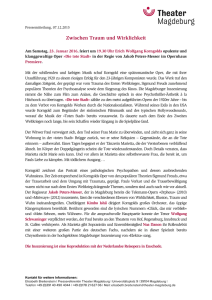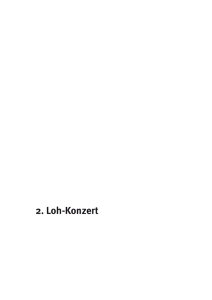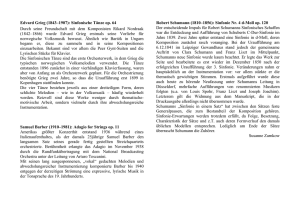programmheft - Ensemble Kontraste
Werbung
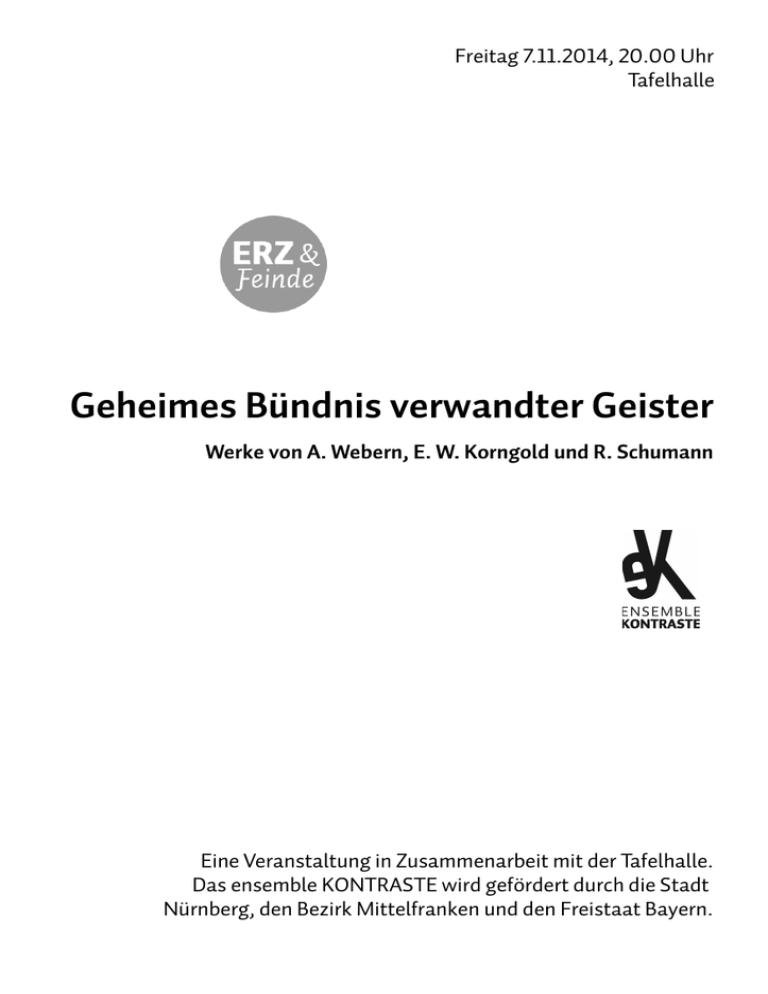
Freitag 7.11.2014, 20.00 Uhr Tafelhalle Geheimes Bündnis verwandter Geister Werke von A. Webern, E. W. Korngold und R. Schumann Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Tafelhalle. Das ensemble KONTRASTE wird gefördert durch die Stadt Nürnberg, den Bezirk Mittelfranken und den Freistaat Bayern. Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957) Suite für zwei Violinen, Cello und Klavier (linke Hand) op. 23 (1930) Präludium und Fuge Walzer Groteske Anton Webern (1883 - 1945) Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier op. 11 (1914) Mäßige Achtel Sehr bewegt Äußerst ruhig Erich Wolfgang Korngold Suite für zwei Violinen, Cello und Klavier (linke Hand) op. 23 (1930) Lied Rondo. Finale Pause Robert Schumann (1810 - 1856) Klavierquintett Es-Dur op. 44 (1842) Allegro brillante In Modo d’una Marcia. Un poco largamente Scherzo. Molto vivace Allegro ma non troppo Sornitza Baharova - Violine Makiko Odagiri - Violine Christian Sauer - Viola Cornelius Bönsch - Violoncello Stefan Danhof - Klavier Paul Wittgenstein – der einarmige Pianist Am Beginn des ersten Weltkriegs war die Kriegsbegeisterung bei vielen Menschen groß, gerade bei den „gebildeten“, die Musiker machten da kei­ ne Ausnahme: „Ich war stolz, zu den Waffen gerufen zu werden, und als Soldat tat ich alle meine Pflichten als begeisterter Anhänger des Hauses Habsburg“ (Arnold Schönberg). Mit seinen schätzungsweise mehr als neun Millionen Gefallenen beendete der Krieg auch viele Musikerkarrieren durch Tod oder Verletzung. Eine Reihe von Pianisten kam einarmig aus dem Krieg zurück, für fast alle war es das Ende öffentlichen Musizierens. Nicht so für Paul Wittgenstein (1887 - 1961), der ein Jahr vor Kriegsbeginn mit einem durchaus beachteten Konzert in Wien debütiert hatte und dann zu Beginn des Krieges seinen rechten Arm verlor. Der Pianist entstammt der Wiener Großindustriellenfamilie Wittgenstein. Das Elternhaus war nicht nur reich, sondern auch äußerst kunstsinnig. Es wurde auf hohem Niveau musiziert, Kunst und Künstler erfuhren großzü­ gige Förderung, alles, was Rang und Namen hatte, ging bei Wittgensteins ein und aus, ein prominentes Beispiel ist Johannes Brahms. Nur: Selbst Künstler zu werden, das war tabu, der Vater nannte es „Prostitution“. Dieser Vater, Karl Wittgenstein, war ein gnadenloser Patriarch, die Kinder lebten in einer Atmosphäre von Zwang, Disziplin und Leistung. Drei von acht Geschwistern begingen Suizid! Wer diese Familie überlebte und wie Paul sogar seinen Berufswunsch Pianist durchsetzte, der musste neben pianistischem Können einen unbeugsamen Willen haben. Dass herkunfts­ bedingt auch Geld und Beziehungen da waren, kam höchst förderlich hin­ zu. All dies wurde jedenfalls Voraussetzung für eine beispiellose Karriere als einarmiger Pianist. Dazu erweiterte Paul Wittgenstein – übrigens älterer Bruder des berühmten Philosophen Ludwig Wittgenstein – nicht nur das Repertoire an „Kompositionen für die linke Hand“ durch eigene Bearbei­ tungen, sondern vor allem vergab er äußerst großzügig dotierte Komposi­ tionsaufträge, für Werke, die er meist auch selbst zur Uraufführung brach­ te. Die Liste der engagierten Komponisten liest sich fast wie ein „Who’s who“ der damaligen Musikwelt: Richard Strauss, Franz Schmidt, Paul Hin­ demith, Sergei Prokofjew und Maurice Ravel schufen Werke für Wittgen­ stein – Ravels Klavierkonzert D-Dur für die linke Hand (1930) ist wohl die bekannteste dieser Kompositionen – und natürlich Erich Wolfgang Korngold, schließlich war er damals einer der Stars der Klassikszene. Erich Wolfgang Korngold – das konservative Wunderkind Das Etikett „Wunderkind“, das den Komponisten von Jugend an begleite­ te, hatte seine Berechtigung. Er war eine der erstaunlichsten Frühbega­ bungen der Musikgeschichte, durchaus vergleichbar mit Mozart, und Gu­ stav Mahler nannte ihn ein Genie. Prägend für Korngold waren die spätro­ mantischen Größen seiner Zeit wie Mahler, Strauss oder Zemlinsky, aber auch die frühen Werke Debussys und Strawinskys. Sein rigoroser Vater (!) sorgte als strikter Schönberg-Gegner dafür, dass Korngold die Tonalität in der Musik nicht verließ – auch wenn er die musikalische Komplexität, die hochartifizielle Kunst der Spätromantik gewissermaßen ins Extrem stei­ gerte. Sein berühmtestes Werk komponierte er bereits mit 23 Jahren: Die Oper Die tote Stadt wurde ein durchschlagender Welterfolg, ein Renner auf den Opernbühnen der Welt. Korngold hatte keine Berührungsängste gegenüber „unterhaltender Mu­ sik“, etwa der Operette, und so kam es, dass er dank des emigrierten Re­ gisseurs Max Reinhardt Verbindung zu Hollywood bekam und 1934 in die USA ging. Er stieg zu einem renommierten Filmmusik-Komponisten auf, schrieb die Musik für rund 20 Filme und erhielt dafür gleich zweimal den Oscar! Eine Rückkehr nach Europa war für den jüdischen Komponisten allerdings erst nach Ende der Nazi-Ära möglich, doch er konnte nicht mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen. Korngolds Kompositionsweise galt nun als hoffnungslos antiquiert. Erst in den letzten Jahrzehnten beginnt man sich dieses Komponisten zu entsinnen und seine Werke wieder aufzuführen. Für Paul Wittgenstein komponierte Korngold 1924 sein Opus 17, das Kla­ vierkonzert für die linke Hand. Der Pianist war davon so angetan, dass er ein weiteres Werk bei ihm in Auftrag gab, die heute erklingende Suite Opus 23, die 1930 in Wien zur Uraufführung kam, mit dem Rosé-Quartett und Paul Wittgenstein am Klavier. Übrigens: Auch Paul Wittgenstein musste wegen des jüdischen Großva­ ters vor den Nazis in die USA fliehen. Und noch etwas verbindet ihn mit Erich Wolfgang Korngold: eine eher konservative Grundhaltung. Wittgenstein lehnte manche der für ihn komponierten Werke als zu modern ab, beispielsweise das Klavierkonzert Hindemiths. Korngold: Suite für zwei Violinen, Cello und Klavier (linke Hand) op. 23 Die etwa halbstündige Suite zeigt kammermusikalisch Korngolds spätro­ mantische Musiksprache, seine emotionale Expressivität und spätroman­ tische Üppigkeit des Klangs, seine reiche Harmonik, die die Musik in allen Farben glänzen lässt, seine Gabe zu melodischer Erfindung und seine ver­ schlungenen Kantilenen. Aber: „Bei aller Opulenz erweist die Suite mit ih­ ren klanglichen Härten und ihrer kantigen Polyphonie Korngold als Zeitge­ nossen eines Paul Hindemith oder Igor Strawinsky“ (Bayer. Rundfunk). Das fünfsätzige Werk, beginnend mit Präludium und Fuge, setzt mit ei­ nem energischen Solo des Klaviers ein, das dann von den Streichern auf­ gegriffen wird. Mehrere Themen werden schließlich dramatisch zur Tonart D-Dur des folgenden Satzes geführt, „Walzer“ betitelt. Brendan G. Car­ roll, Autor einer Korngold-Biographie, schreibt: „Die Art und Weise, wie Korngold hier vorgeht, erinnert an die „Scherzi“ bei Mahler, die immer auch Wehmut vor der verlorenen Zeit ausdrücken. Die so erzeugte elegi­ sche Atmosphäre wird im folgenden eigentlichen Scherzo ins Groteske verzerrt, und so hat der Komponist den dritten Satz denn auch bezeich­ net.“ Der vierte Satz, „Lied“, nimmt das kurz zuvor entstandene Was du mir bist auf, das erste der Drei Lieder für hohe Singstimme und Klavier op. 22, als Lied von geradezu lastender Intensität, hier in Fis-Dur, bezeichnenderweise Korngolds Lieblingstonart. Abschließend das Rondo-Finale, wo nach dem Klavierauftakt das Cello eine „typisch Korngoldsche“ Melodie einführt, die dann durch eine Reihe von Variationen geführt wird – und auch die Melodie des vorangegangenen Lieds scheint wieder auf. Anton Webern – der radikale Neuerer Webern ist zwar beinahe 14 Jahre älter als Korngold, doch musikalisch ist er der weitaus „Jüngere“. Während Korngold ganz der Musik auf tonaler Basis verpflichtet blieb, gehörte Webern zu jener relativ kleinen aber wirk­ mächtigen Gruppe um Arnold Schönberg – als „Zweite Wiener Schule“ be ­ kannt –, die schon zu Beginn des Jahrhunderts keine Zukunft in den tra­ dierten Kompositionstechniken sah und stattdessen nach neuen Wegen suchte: Arnold Schönberg (Stichwort „Zwölftonmusik“), Alban Berg und Anton Webern, der Radikalste, der schon um 1910 von spätromantischen Anfängen zu konsequenter Atonalität wechselte. Webern wandte sich zunächst von den großen Formen und Besetzungen ab und schuf stattdessen kurze, manchmal fast wie Fetzen wirkende hochkonzentrierte Stücke – einige sind nur wenige Takte lang! Die Musik­ sprache wird knapp und kompakt, es soll jede einzelne Note eine eigene Gewichtung und Dynamik erhalten; dementsprechend zahlreich sind die Anweisungen an die ausführenden Künstler. Melodischer Ausgangspunkt sind oft die Intervalle „kleine None“ und „große Septime“, um gleich jegli ­ che „versteckte Tonalität“ zu vermeiden. Große Tonhöhensprünge kenn­ zeichnen oft diese Musik, und es gibt kaum Wiederholungen – alles „Überflüssige“ sollte vermieden werden. Beim breiten Publikum hatte Webern mit seiner radikal „anders“ klingen­ den Musik keinen großen Erfolg, und das ist so geblieben, obwohl seine Musik immer wieder in den Konzertprogrammen vertreten ist. Dafür hatte er unter den Hauptvertretern der „Zweiten Wiener Schule“ die größte Nachwirkung auf spätere Komponistengenerationen. Denn er dehnte die Ideen von Schönbergs Zwölftonmusik auf weitere Parameter wie Rhyth­ mus und Klangfarbe aus und wurde so zum „Vater“ der seriellen Musik, die die 50er- und 60er-Jahre dominierte (Beispiel Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen). Der Komponist Ernst Krenek nannte ihn „den Propheten ei­ nes neuen musikalischen Kosmos.“ Webern: Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier op. 11 Verdichteter, konzentrierter und kürzer können Musikstücke kaum sein – das letzte umfasst gerade 11 Takte, alle drei Stücke zusammen dauern rund zwei Minuten! Doch die haben es in sich: „Fast jede Note des Klavier­ parts weist unterschiedliche Dynamik oder unterschiedliche Anschlagsar­ ten auf, und jede Phrase des Celloparts verlangt andere Spielweisen wie Flageolett, am Steg, Pizzicato, Bogenführung über dem Griffbrett. Daraus ergibt sich ein beständiger Farbwechsel, aber auch der Eindruck gespann­ tester Unruhe“ (Harenberg Kammermusikführer). Man hat die aphoristische Kürze der Webernschen Kompositionen mit der japanischen Gedichtform des Haiku verglichen, denn auch dieses ist oft schon vorbei, ehe man den Inhalt recht erfasst hat. Selbst der Musiktheo­ retiker Theodor W. Adorno meinte, es bedürfe bei Opus 11 einer verviel­ fachten Aufmerksamkeit. Webern war sich im Klaren darüber, dass das Werk nicht sehr massentauglich sei. In einem Brief riet er 1939 von einer Aufführung der drei Stücke ab: „Die lieber gar nicht ... sie würden nur ganz missverstanden. Die Spieler und die Hörer können nur schwer damit et­ was anfangen.“ Lassen Sie sich also überraschen, vielleicht widerlegen Sie ja Weberns Skepsis! Schumanns Klavierquintett – Erfolg von Anfang an Robert Schumann, der „Romantischste der Romantiker“, bedarf kaum ei­ ner Vorstellung. „Ich sehe, wo hinaus Sie wollen, und ich versichere Ihnen, da will ich auch hinaus, es ist die einzige Rettung: Schönheit“ – so schrieb Richard Wag­ ner, der sich das Quintett begeistert gleich zweimal hatte vorspielen las­ sen, an den Komponisten. In der Tat fand Schumanns Quintett von An­ fang an nicht nur bei Komponistenkollegen Beifall, sondern auch beim Pu­ blikum kamen die Unmittelbarkeit und Eingängigkeit des thematischen Materials, die Energie, der Schwung und die Lebendigkeit des Werkes an. Der Komponist widmete das Klavierquintett seiner Frau Clara, und er schuf ihr, der erfolgreichen Pianistin, mit der Komposition einen brillanten Auftritt. Dem Klavier steht das Streichquartett gegenüber, und die Art, wie Schumann die fünf Instrumente verband und einsetzte, wurde zum Muster für ein Jahrhundert an Klavierquintetten. Der erste Satz beginnt gleich mit dem feurig-impulsiven Hauptthema, das mit fast orchestraler Wucht einsetzt und im Satz beherrschend bleibt, ob­ wohl bald eine Wendung hin zu lyrischer Gesanglichkeit erfolgt – beson­ ders schön der vom Cello und der Bratsche vorgetragene Seitengedanke. Man hat in dem Gegensatz der Stimmungen eine absichtsvolle Darstel­ lung von Schumanns Selbstbildnis-Erfindungen gesehen: „Florestan der Wilde, Eusebius der Milde“, wie Schumann die Pole seines Wesens charak­ terisierte. Ein größerer Gegensatz als zwischen dem lebensbejahend voranstürmen­ den ersten und dem zweiten Satz, dem Herzstück des Werks, ist kaum denkbar. Tschaikowsky meinte, in dem Adagio spiele sich „eine ganze Tra­ gödie“ ab. Ein stockender Trauermarsch in c-Moll dominiert den Satz und wird mehrmals wiederholt. Dazwischen eine Aufhellung in C-Dur, ein inni­ ger Gesang der Violine, gelegentlich sogar als „Gebet“ bezeichnet. In der Mitte des streng symmetrisch gebauten Satzes steigert sich der Trauer­ marsch zu einem trotzig erregten Agitato in f-Moll. Der abschließende Quintfall des Marcia-Themas taucht übrigens im Quin­ tett immer wieder auf, wie generell vielfältige thematische Bezüge das ganze Werk durchziehen – es war Schumann wichtig, so eine „innigere Verbindung und Beziehung zwischen den Sätzen“ zu schaffen. Der dritte Satz nimmt im Scherzo-Teil mit auf- und abwärts jagenden Ska­ len die lebensfrohe Stimmung des ersten Satzes wieder auf. Das musikali­ sche Perpetuum mobile wird von zwei Trios unterbrochen, das erste ein freundlich wiegender Kanon von Violine und Cello, das zweite erregt durch die Tonarten treibend. Den vierten Satz eröffnet ein markant schreitendes Klaviermotiv, das ak­ kordisch pochend von den Streichern begleitet wird. Im kunstvollen Fort­ gang weitere Themen, Kontrapunktierungen und häufig imitatorische Setzweise; ein wundervoller E-Dur-Gesang der Violine sticht heraus. Schließlich mündet das Werk in eine Doppelfuge aus dem Hauptthema des letzten und des ersten Satzes. Diese Wiederaufnahme des Anfangs rundet nicht nur den furiosen Satz, sondern das gesamte Werk in wunder­ barer Weise ab. Robert Schumann – der „deutscheste der deutschen Komponisten“ Der heutige Abend, in der Themenreihe „Erz und Feinde“, steht im Kon­ text des ersten Weltkrieges und stellt im ersten Teil Werke des 20. Jahr­ hunderts vor. Robert Schumann starb 1856, hat also vordergründig nichts mit diesem Jahrhundert zu tun. Doch im Umfeld der Themenreihe ist ein Blick auf die Veränderungen des Schumann-Bildes im 20. Jahrhundert in­ teressant, der Leipziger Musikwissenschaftler Helmut Loos hat dies in seinem Aufsatz „Der deutsche Schumann. Wandlungen eines Künstlerbil­ des“ getan – eine Facette der sozusagen „geistigen“ Katastrophen des letzten Jahrhunderts! Schumann ist um 1900 eher unterschätzt, man sieht zwar den großen Ly­ riker, doch beklagt man das Fehlen jener „heroischen Kraftnatur“, die sei­ ne „Doppelnatur“ hätte bändigen können – Schumanns spätere geistige Erkrankung wird auch als „Scheitern“ gesehen. Doch parallel zum wachsenden Chauvinismus ändert sich das Bild Schumanns, zunehmend verbindet sich sein Name mit dem Adjektiv „deutsch“. So äußert sich Julius Korngold, der Vater des Komponisten, 1906 zur Frage, ob Schumann vergessen sei: „Deutscher Frühling, deutsche Liebe, deutsche Romantik veralten nicht.“ Der erste Weltkrieg bringt dann endgültig die Wende hin zum „deutsches­ ten Komponisten“, parallel dazu avanciert Schumanns Frau Clara, die be­ rühmte Pianistin des 19. Jahrhunderts, zur „deutschesten aller Künstlerin­ nen“. Und natürlich rückt man Schumann immer mehr in die Nähe Wag­ ners, Schumanns Freundschaft mit dem Juden Mendelssohn wird dagegen als bedauerlicher Irrtum gesehen. Kaum nötig zu erwähnen, dass dann im Dritten Reich all dies kulminiert, Schumanns Selbstbeschreibungen („Florestan der Wilde und Eusebius der Milde“) werden zu „nordischen“ und „ostischen“ Wesenskomponenten, er ist endgültig der „deutsche Komponist“, man versucht gar, Mendels­ sohns populäres Violinkonzert durch dasjenige Schumanns zu ersetzen, das bis dahin als nicht besonders geglückt galt. M. und R. Felscher