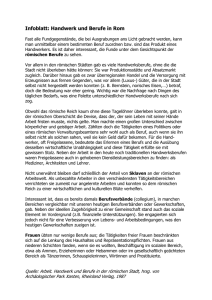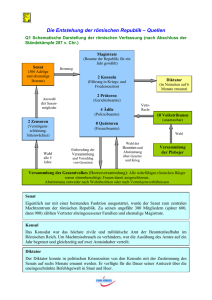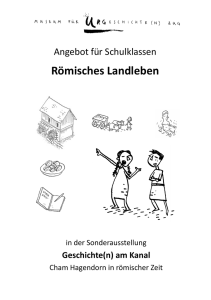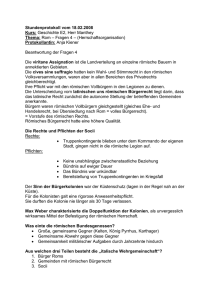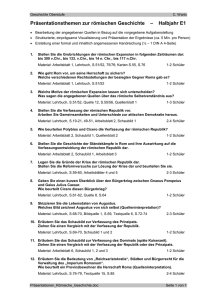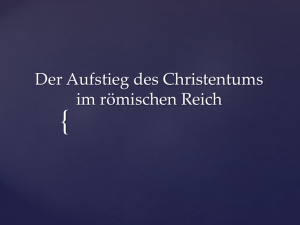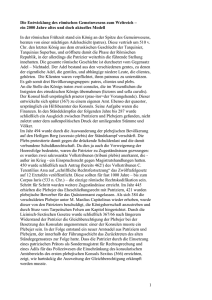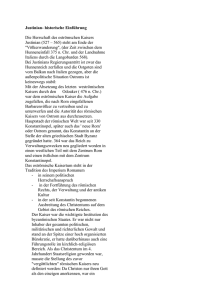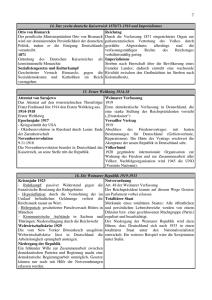diskutiert
Werbung

Donald Trump mit Frau Melania und Sohn Barron zu Hause: Trumps Flair fürs Cä wohl schon erkennen lassen, bevor er in die Politik einstieg. (New York, April 2010 / GeTTY IMAGES) • 1 • 2 Trump ante portas Wäre die amerikanische Verfassung stark genug, um einen Präsidenten Trump zu zähmen? Oder wiederholt sich die Geschichte des antiken Roms? Von Benjamin Straumann Handelt es sich bei Donald Trump um einen Cäsar? Könnte er, einmal gewählt und gestützt auf den vermeintlichen Volkswillen, die bestehenden Institutionen beseitigen und sich der durch die Verfassung vorgesehenen rechtlichen Hemmungen mit autoritärer Geste entledigen? Winken unter Trump der Zusammenbruch der verfassungsmässigen Rechtsordnung und Despotismus? Diese Fragen werden derzeit in den USA heftig diskutiert. Dabei geht es nicht darum, die Frage zu klären, ob Trumps politische Ideen stichhaltig, lächerlich, paranoid oder gefährlich sind, sondern vielmehr darum, ob ein Präsident Trump der Verfassungsordnung, also dem Fundament der politischen Ordnung der Vereinigten Staaten, zur Gefahr werden könnte. Trump wird sowohl von seinen Anhängern als auch seinen Gegnern als begabter Demagoge und autoritärer Machtpolitiker wahrgenommen. Seinen Anhängern hat er unter anderem versprochen, seine Kontrahentin Clinton im Fall seiner Wahl ins Gefängnis zu stecken. Während ihm seine offen zur Schau getragene Ungeduld mit den prozeduralen Feinheiten der amerikanischen Verfassung in den Augen seiner Anhänger nur zum Vorteil gereicht, ruft sie bei seinen Gegnern Ängste hervor. Und diese Ängste werden von den verschwindend wenigen Intellektuellen, die Trump unterstützen, mit Enthusiasmus geschürt. Ein unter dem römischen Pseudonym «Decius» in einer weit zitierten Internet-Zeitschrift schreibender Trump-Apologet etwa würde einen Umsturz des Systems durch Trump begrüssen, da er die bestehenden Institutionen für illegitim hält. Trump als dem Volkswillen verpflichteter «Retter», als mit revolutionärer Autorität ausgestatteter «Cäsar» sei geeignet, die verrotteten Institutionen zu ersetzen. Degenerierte Republik Sowohl die pseudogelehrten römischen Anspielungen als auch die Behauptung, die politische Ordnung der USA sei schon seit geraumer Zeit illegitim, sind typisch für die Auseinandersetzungen, die seit der Kandidatur Trumps geführt werden. Viele seiner Anhänger stellen sich auf den nostalgischen Standpunkt, die Institutionen der Republik seien degeneriert. Spätestens seit den 1930er Jahren und Präsident Roosevelts «New Deal» sei das politische System nicht mehr länger von der ursprünglichen Vision der Verfassungsväter gedeckt – die Elite regiere somit ohne Autorität. Auch das Operieren mit römischen Beispielen und insbesondere mit dem warnenden Beispiel Cäsars als Totengräber der Republik ist typisch und hat in den Vereinigten Staaten Tradition. «Decius» scheint sich auf Publius Decius Mus beziehen zu wollen, der sich – wie nachmals sein Sohn und Enkel – auf dem Schlachtfeld für die römische Republik geopfert haben soll (wenn man Livius Glauben schenken darf). Während es sich beim heutigen «Decius» um ein Leichtgewicht handelt, haben bereits die Verfassungsväter Madison, Hamilton und Jay die Ratifizierung der eben erst in Philadelphia verabschiedeten Verfassung 1787–88 unter einem römischen Pseudonym, «Publius», empfohlen. Mit diesem Namen spielten sie auf den sagenhaften Gründer der römischen Republik, Publius Valerius Publicola, an. Die damaligen Gegner der Bundesverfassung, die sogenannten «Anti-Federalists», hantierten ebenfalls mit römischen Pseudonymen: «Cato» und «Brutus», Namen, die geeignet waren, die neue Verfassung als tyrannisch zu brandmarken. Doch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der römischen Republik ist nicht bei den Pseudonymen stehengeblieben, sondern hat die Gründung der Vereinigten Staaten und die Diskussionen um den Verfassungsentwurf von 1787 tiefgreifend beeinflusst. Dies ist hinsichtlich der Frage, ob Trump der Verfassung gefährlich werden könnte, sehr relevant. Die Väter der Verfassung haben sich direkt an der frühen römischen Republik orientiert. Sie galt als tugendhaft und kernig. Vor allem Plutarchs Biografien sowie Joseph Addisons Drama «Cato» hätten dieser Tugendnostalgie Vorschub geleistet und ein Staatsverständnis gefördert, das sich in Opposition zum korrumpierenden Kommerz definierte und einen freien bäuerlichen Bürgerstaat vor Augen hatte. Näher besehen zeigt sich allerdings, dass das römische Tugendideal vor allem von den «Anti-Federalists» – also gerade von den Gegnern der neuen zentralistischen Bundesverfassung – beschworen wurde, um diese Verfassung als antirepublikanisch und tyrannisch zu diskreditieren. Für die Befürworter der Verfassung hingegen, die «Federalists», war ein anderer Aspekt der römischen Republik ungleich wichtiger. «Federalists» wie John Adams, Alexander Hamilton und James Madison konzentrierten sich auf die Krisen und den Kollaps der römischen Republik. Sie betrachteten den Untergang der römischen Republik als historisches Laboratorium. In einer Welt monarchischer Territorialstaaten waren die Verfassungsväter daran interessiert, zu garantieren, dass ein republikanisch verfasster, also nichtmonarchischer Staat das Schicksal der römischen Republik nicht unbedingt teilen und nicht zwangsläufig im Despotismus enden müsse. Als Antwort auf die Verfassungskrisen der späten Republik hatte bereits Cicero (106–43 v. Chr.) eine Verfassungslösung entwickelt. Ohne sich auf die Tugend der Bürger oder der Elite zu verlassen, konzentrierte er sich sowohl in seinen Reden als auch in seiner politischen Theorie auf eine institutionelle Antwort auf den Zusammenbruch der Republik. Diese Antwort beruhte auf der Ausarbeitung eines Verfassungsbegriffs, der zwischen Gesetzen und höherrangigem Recht unterscheidet und Letzteres als Grundlage der politischen Ordnung bestimmte. Zu retten vermochte dieser genuin römische Ansatz des Verfassungsdenkens die Republik bekanntlich nicht. Er lebte aber im Rechtsdenken der Kaiserzeit fort und begründete eine Tradition, die seit der Renaissance von Autoren wie dem oft als Absolutisten missverstandenen Jean Bodin und später auch von Montesquieu aufgegriffen worden ist. Politik als Wissenschaft Die amerikanischen «Federalists» betonten zu Recht die Originalität ihrer Bundesverfassung, in der sie eine «neue Wissenschaft der Politik» verwirklicht sahen. Für diese Leistung griffen sie allerdings explizit auf die römische Tradition zurück. Ihr Denken kreist immer um die Verfassungskrisen der späten Republik, und der von ihnen auf dem römischen Fundament errichtete Konstitutionalismus darf als Antwort auf den Fall der römischen Republik verstanden werden. Der militärische Despotismus eines Cäsar wurde in dieser Tradition als Konsequenz einer Republik ohne verbindliche Verfassungsordnung gesehen und von den Gründervätern der USA als Gefahr für ihr eigenes republikanisches Projekt erkannt, der sie ganz bewusst mit den in der Bundesverfassung von 1787 vorgeschriebenen Verfassungsmechanismen entgegenzutreten trachteten. John Adams, zweiter Präsident der Vereinigten Staaten und einer der einflussreichsten Gründerväter, hat die Ursachen für den Kollaps der römischen Republik in einem Mangel an expliziten, unabänderlichen Verfassungsgrundsätzen gesehen. Dieser Mangel habe dazu geführt, dass die römischen Volksversammlungen, die Komitien, sich als hemmungsloser Souverän etabliert hätten. Cäsar mit den ihm anvertrauten Sondergewalten sei eine typische, unverhüllte Kreatur der Komitien gewesen – woraus Adams den Schluss zieht, dass es einer Verfassungsordnung bedürfe, die der Kompetenz der Komitien Grenzen auferlegt und damit einen Cäsar und die Selbstzerstörung der Republik verunmöglicht. Eine solche Ordnung hatte Adams selbst mit der – nach wie vor in Kraft stehenden – Verfassung des Teilstaates Massachusetts von 1780 mitgeschaffen. Die zentralen Elemente dieser Rechtsordnung, die für die spätere amerikanische Bundesverfassung Modellcharakter hatte, bestanden in einem Zweikammerparlament, verfassungsmässigen Rechten, einer unabhängigen Judikative und einer starken Exekutive. Der amerikanischen Verfassung wurde die Auseinandersetzung mit dem Fall der römischen Republik also eingebaut, der Cäsarismus antizipiert. Die heute verbreiteten Ängste vor dem Cäsarismus sind in aller Regel Ängste vor einer zu stark erscheinenden Exekutive. Die stete Ausdehnung der exekutiven Gewalt im Zuge einer zusehenden Zentralisierung seit der industriellen Revolution hat zu starken Bedenken gegenüber einer «imperialen Präsidentschaft» (Arthur Schlesinger Jr.) geführt. Es sind diese Bedenken, die die Furcht vor dem Cäsarismus heute nähren. Und sie sind nicht unberechtigt. Die Kompetenzen des Präsidenten haben infolge zahlreicher Delegationen vom Kongress und einer vor allem im 20. Jahrhundert expandierenden Bürokratie sehr stark zugenommen. Relativ freie Hand Ein Präsident Trump hätte relativ freie Hand, so der an der Universität Chicago lehrende Eric Posner, staatsvertragliche Verpflichtungen der Vereinigten Staaten im Alleingang aufzukündigen, was im Bereich des Freihandels oder der Klimaabkommen weitreichende Folgen hätte. Desgleichen wird die Inanspruchnahme exekutiver Ausnahmegewalten im Rahmen des «Kriegs gegen den Terror» von der Judikative, zumindest kurzfristig, respektiert. Trump wäre es auch gegeben, auf die künftige Verfassungsinterpretation mittels der Nominierung freundlich gesinnter Richter für den Obersten Gerichtshof Einfluss zu nehmen. Die starke Stellung der Exekutive ist aber bereits im Verfassungsentwurf angelegt und lässt sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass die Verfassungsväter unter dem Eindruck des römischen Beispiels die Notstandsgewalt des römischen Diktators in die Kompetenzen der Exekutive integriert wissen wollten. Spezielle Ausnahmezustandsgewalten, die auf eine Suspendierung der Verfassung hinauslaufen, sind nicht vorgesehen. Zugespitzt gesagt: Wo immer der amerikanische Präsident die Freiheiten eines «Diktators» geniesst, geniesst er sie als Diktator von Verfassungs Gnaden. Allerdings sind diese exekutiven Befugnisse längerfristig vielerlei Kontrollen unterworfen. Einerseits insofern, als sowohl finanzielle Aufwendungen (wie etwa die von Trump geforderte Mauer entlang der mexikanischen Grenze) als auch Notstandsgewalten die Zustimmung des Kongresses erfordern; andererseits werden grundrechtliche Garantien von der Judikative aufrechterhalten. Insbesondere eine Unterminierung der Pressefreiheit, wie sie Trump verschiedentlich angedroht hat, würde mit Sicherheit an den Gerichten scheitern. Eingriffe in die ordentlichen Haftprüfungsverfahren (habeas corpus), seien sie auch demokratisch legitimiert, würden mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Obersten Gerichtshof als verfassungswidrige Suspendierung eines Grundrechts interpretiert, selbst im Fall von Ausländern. Doch die stärkste Kontrolle wird wohl durch die Bürokratie der Bundesbehörden ausgeübt, die ironischerweise oft als Indiz einer imperialen Präsidentschaft gilt; verfassungswidrige Anordnungen des Präsidenten würden gar nicht oder widerwillig ausgeführt, und die Exekutive könnte schnell zur Zielscheibe beabsichtigter Indiskretionen gegenüber der Presse werden. Anders als in der späten römischen Republik sind Krisen hier also nicht «ohne Alternative». Ihnen kann aufgrund der in die Verfassung integrierten römischen Erfahrung begegnet werden. Diese Ordnung stellt auf lange Sicht einen rechtlichen Massstab der auf die Krisen gegebenen politischen Antworten dar. Die Internierung amerikanischer Bürger japanischer Abstammung während des Zweiten Weltkriegs, die Verweigerung von Verfahrensrechten an GuantánamoHäftlinge durch die Bush-Regierung, selbst die Suspendierung von habeas corpus durch Präsident Lincoln im amerikanischen Bürgerkrieg: Keiner dieser Versuche, die Grenzen der exekutiven Gewalt zu testen, vermochte längerfristig der Überprüfung auf Verfassungsmässigkeit standzuhalten. Schlechte Chancen Gerade die von Trump geringgeachteten Verfahrensgarantien haben sich sowohl in der römischen Republik als auch im amerikanischen Verfassungsrecht (habeas corpus) immer wieder als der zentrale Punkt der Auseinandersetzungen erwiesen; das von den «Federalists» gewählte Pseudonym, «Publius», referiert auf Publius Valerius Publicola nicht bloss als den Gründer der Republik, sondern auch als den legendären Urheber des römischen Verfahrensgrundrechts, der provocatio. Trump hat eben nicht zuletzt darum schlechte Chancen, weil er zu offenkundig mit der Verfassung auf Kriegsfuss steht. Diese Verfassungsfeindlichkeit gereicht ihm selbst bei vielen sonst rechtsgesinnten Wahlbürgern zum Nachteil und lässt seine Wahl zusehends unwahrscheinlich erscheinen. Die parareligiöse Verehrung, die der Verfassung in der amerikanischen politischen Kultur zuteil wird, ist Trumps Chancen abträglich. Eine Verfassungsordnung, die aus dem Kollaps der römischen Republik ihre Lehren gezogen hat, würde eine Präsidentschaft Trumps wohl aushalten – selbst wenn man dem grotesken Geschäftsmann eine Kombination der Fähigkeiten Cäsars mit der Gerissenheit und Umsicht eines Augustus zu unterstellen gewillt wäre. Es ist ein durchaus krisenfester Konstitutionalismus, der nicht bloss Richard Nixons kriminelle Energie, sondern auch den amerikanischen Bürgerkrieg überdauert hat. Fast wünschte man sich, die Probe aufs Exempel zu machen und dem historischen Laboratorium ein weiteres Fallbeispiel hinzufügen zu können – Trumps politische Vorschläge sind jedoch zu unappetitlich, um den Erkenntniswert, den ein Experiment mit dem Möchtegern-Cäsar im Weissen Haus bringen würde, tatsächlich zu rechtfertigen. Benjamin Straumann ist Althistoriker und Senior Fellow an der New York University School of Law und Autor. Zuletzt erschien von ihm «Crisis and Constitutionalism. Roman Political Thought from the Fall of the Republic to the Age of Revolution» (Oxford University Press, 2016).