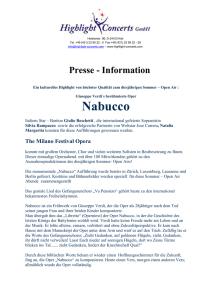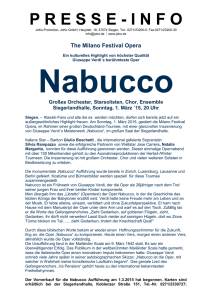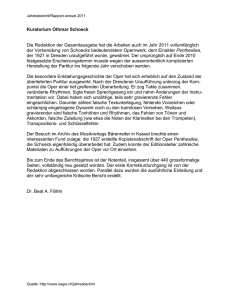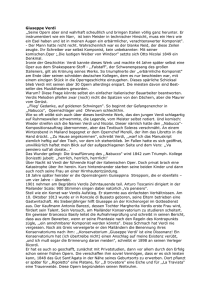Eine letzte Reise Großes Lob ans Publikum „Peter Pan muss fliegen
Werbung

4 STAATSTHEATER Eine letzte Reise Der Protagonist ist aber mehr als nur ein Reisender, der von den Errungenschaften des medizinischen Fortschritts profitiert. Sein Name, Johannes, erinnert an den berühmten Humanisten und Religionsforscher Johannes Reuchlin, der in der Stuttgarter Leonhardskirche begraben ist. Johann Wolfgang von Goethe nannte Reuchlin ein ,Wunderzaichen‘, daher der Titel der Oper. „wunderzaichen“ ist eine Art „metaphysischer Roadtrip“. Ich habe mir vorgestellt, Johannes Reuchlin würde heute als alter Mann eine letzte Reise ins Heilige Land unternehmen, um nach Gott und den Spuren von Jesus von Nazareth zu suchen. Am Flughafen Ben Gurion wird Johannes die Einreise verwehrt, er muss im Transitbereich bleiben und begegnet dort einer Frau, die sich Maria nennt. Johannes ist als Hauptfigur übrigens der einzige Schauspieler, ich wollte ihn in eine andere Zeitkategorie versetzen. Während alle anderen Rollen gesungen werden, ist sein Part rhythmisch und melodisch frei, das verleiht ihm eine gewisse Zerbrechlichkeit. Sie sind während der Vorarbeiten zur Oper zur Recherche nach Israel geflogen. Wonach haben Sie dort gesucht? Ich habe besondere Orte aufgesucht, die für Jesus von Nazareth, aber auch für das Judentum wichtig sind. Johannes Reuchlin hat als einer der ersten Nicht-Juden die Kabbala und die hebräische Sprache erforscht. Auf unserer Reise waren wir in der Grabeskirche, an der Klagemauer, in Synagogen, in Emmaus und in der Wüste. Ich wollte die Be- Wie lassen sich die Spuren, nach denen Sie suchen, aufnehmen? Jede Kirche hat eine eigene Akustik, und auch das Geräusch des Windes klingt in der Wüste anders als in einer Stadt. In der Grabeskirche haben wir mit mehreren Mikrofonen den – fast stillen – Raum aufgenommen. Die Grabeskirche hat den Grundton „e“. Außerdem sind dort noch andere Klangtypen sehr präsent, die den Raum prägen. Aus diesem Material ist die harmonische Grundstruktur des letzten Teils von „wunderzaichen“ entstanden, der nicht mehr im Flughafen, sondern im Jenseits spielt. Ich habe aber auf meiner Reise auch nach anderen Spuren gesucht, die Jesus vielleicht hinterlassen hat. Ich gehe davon aus, dass die Orte, die er besucht hat, noch heute etwas Besonderes ausstrahlen. Zum Beispiel habe ich in der Synagoge, an der Jesus gelehrt hat, in mir selbst Schwebungen gespürt. Diese Schwebungen habe ich anschließend metrisch notiert. Ich spreche nicht von objektiven Realitäten, sondern von persönlichen Erfahrungen. In der Oper sind häufig rhythmische Schwebungen zu hören, die unmittelbar auf diese Erfahrungen zurückgehen. Die Übergänge zwischen realen und surrealen, inneren und äußeren Räumen – Sie sprechen von „Faltungen“ – sind ein zentrales Motiv Ihrer Arbeit. Haben diese Vorstellungen einen Einfluss auf das räumliche Konzept Ihrer Oper? Zu Beginn wird sich alles auf der Bühne und im Orchestergraben abspielen. Später, wenn sich die Handlung ins Metaphysische wendet, ändert sich auch der theatralische Raum. Die wichtigste kompositorische Aufgabe und Herausforderung liegt für mich darin, das Verschwinden des Jesus von Nazareth in Emmaus oder während der „Noli me tangere“-Episode klanglich darzustellen und zu entfalten. Ich bin gespannt, wie wir das zusammen mit Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Viebrock umsetzen werden. Die Fragen stellte Martina Seeber. Der Komponist Mark Andre Frank Hilbrich ortet in Stuttgart die Lust am Risiko D Neue Klangwelten an der Oper G eneralmusikdirektor Sylvain Cambreling hat sich eingelebt und will an der Oper Stuttgart die Tradition weiterführen und ein kleines Stück Musikgeschichte schreiben. Herr Cambreling, wie fällt die Bilanz Ihrer ersten Spielzeit aus? Ich bin sehr zufrieden. Ich liebe die Stimmung hier im Haus. Und es gibt ein sehr gutes, konzentriertes Publikum. Ich glaube auch, dass vieS. Cambreling le Zuschauer nicht nur wegen der schönen Stimmen kommen, sondern um bestimmte Stücke zu sehen, sie haben keine Angst, mit Überraschungen konfrontiert zu werden. Was ich mir aber wünschen würde, wäre mehr Neugierde für Stücke wie „Der Schaum der Tage“. Denisovs „Der Schaum der Tage“ war Ihre erste Neuproduktion. Warum wird dieses Stück so selten gespielt? Die Uraufführung 1986 in Paris war ein totaler Misserfolg, danach gab es in Deutschland zwei Produktionen und eine weitere in Russland. Aber dann wurde „Der Schaum der Tage“ völlig vergessen, was auch daran liegt, dass diese Oper nicht leicht zu realisieren ist. Ich glaube, wir haben eine Lösung gefunden, die gut funktioniert. Nicht ohne Grund ist die Inszenierung ausgezeichnet worden mit dem International Diaghilev Award! Sollte man so eine gelungene Inszenierung nicht häufiger zeigen? Das Problem ist, dass nach acht Vorstellungen das potenzielle Publikum das Stück gesehen hat. Leider ist das kein Selbstläufer wie „La Bohème“ oder „La traviata“. Und jede Vorstellung kostet Geld, und wir müssen die Balance zwischen Kosten und Einnahmen abwägen. Ist es nicht unbefriedigend, sich als Künstler solchen wirtschaftlichen Zwängen unterwerfen zu müssen? Man muss auf die Zeit vertrauen und Geduld haben. Warten wir ab, wie die Vorstellungen im September angenommen werden. Man 5 „Peter Pan muss fliegen“ Foto: Borggreve Mit einem Flughafen haben Sie für „wunderzaichen“ einen ungewöhnlichen Schauplatz gewählt. Ist es ein bestimmter Flughafen oder ein symbolischer Ort? „Wunderzaichen“ spielt konkret am Flughafen Ben Gurion von Tel Aviv, also an einem realen Schauplatz. Zugleich ist der Flughafen aber auch ein Symbol für die Themen der Oper, nämlich für den Übergang von einem Land oder auch Dasein in ein anderes und das Problem der Identität. Bei den Passkontrollen wird ja gefragt: Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Wohin wollen Sie? Und warum kommen Sie ins Heilige Land? In eine solche Passkontrolle gerät auch die Hauptfigur der Oper. Ihn bringt die Frage nach seiner Identität in Schwierigkeiten, denn er trägt nach einer Transplantation ein fremdes Herz in sich. sonderheiten dieser Orte aufnehmen, die akustischen, aber auch die metaphysischen. Foto: Privat S STAATSTHEATER Donnerstag, 19. September 2013 Großes Lob ans Publikum Mark Andre über „wunderzaichen“ ieben Jahre nach dem „Pilotprojekt Wunderzeichen“ in der Leonhardskirche bringen Jossi Wieler, Sergio Morabito und Anna Viebrock am 2. März 2014 Mark Andres neues Musiktheater „wunderzaichen“ auf die Bühne: ein „metaphysischer Roadtrip“ über den frühen Humanisten Johannes Reuchlin. Donnerstag, 19. September 2013 Ausgezeichnet mit dem International Diaghilev Award: Die Stuttgarter Opernproduktion „Der Schaum der Tage“ von Edison Denisov muss aber immer wieder Werbung für solche außergewöhnlichen Stücke machen. die Musik eröffnet dem Zuhörer eine völlig neue Klangwelt. Ist es dann nicht riskant, in dieser Spielzeit zwei Uraufführungen zu zeigen? Ich finde, es ist die Aufgabe eines Opernhauses wie Stuttgart, eine Balance zwischen Repertoirestücken, modernen Werken und Uraufführungen zu finden. Das Publikum und wir Künstler müssen wach und neugierig sein, neue Stücke kennenzulernen. Außerdem gehört es zur Tradition der Stuttgarter Oper. Natürlich investieren wir bei einem Stück wie „wunderzaichen“ von Mark Andre viel Zeit, Energie und Geld. Aber damit schreiben wir ein kleines Stück Musikgeschichte. Was bedeutet das? Es gibt zwar Chor, Orchester und Solisten. Aber die Hauptfigur ist eine Sprechrolle. Dazu werden die Musiker überall verteilt, auch im Zuschauerraum. Manches wird durch Mikrofone verstärkt, überhaupt spielen elektronische Klänge eine wichtige Rolle. Die Musik wird dadurch in vielen Momenten so filigran, dass man als Zuhörer zum Beispiel nicht mehr weiß, ob der Herzschlag, den man hört, aus dem Orchester, von der Elektronik oder aus dem eigenen Inneren kommt. Worum geht es in diesem Stück? Es geht um die menschliche und kulturelle Identität, um die sehr philosophische Frage: Wer bin ich? Ist das formal eine traditionelle Oper? Das ist keine Oper, sondern das sind theatralische Situationen, die musikalisch extrem verinnerlicht sind, ohne große, äußerliche Effekte. Im Gegenteil, die Musik ist sehr diffizil, oft an der Grenze zur Hörbarkeit. Und Die erste Premiere wird Verdis „Falstaff “ sein – als Gegengewicht zu „wunderzaichen“? „Falstaff “ ist ein wunderbares Ensemblestück, in dem Verdi alle seine Kenntnisse zusammenbringt und sich selbst ironisiert. Vordergründig ist es eine Komödie, aber darin blitzt die bittere Sicht eines alten Mannes auf die Welt durch. Am Ende der Spielzeit machen Sie dann Wagners „Tristan“. Das war ein Wunsch von mir. „Tristan“ ist ein GMD-Stück, und ich wollte das gerne mit diesem Orchester machen. Natürlich ist das eine Herausforderung für jedes Opernhaus, weil man die entsprechenden Sänger braucht. Wie findet man den Tenor für die Hauptpartie? Im Gegensatz zu einem Siegfried kann man den Tristan schon als relativ junger Sänger studieren. Bei uns wird Erin Caves diese Partie singen, und für ihn wird es das erste Mal sein. Er bereitet sich schon seit einem Jahr darauf vor und wir werden auch schon sehr früh, im November, mit den Proben beginnen. Dann unterbrechen wir bis zum Juni. Dadurch verhindern wir, dass er durch eine lange Probenzeit in der Premiere müde ist. Gerade für ein Wagner-Rollendebüt ist das sehr sinnvoll. Im 1. Sinfoniekonzert machen Sie etwas Ungewöhnliches, Messiaens „Et Exspecto Resurrectionem Mortuorum“ von 1964 und Ihre Bearbeitung von Haydns „Die sieben letzten Worte“. Das ist ein sehr altes Projekt, das ich schon mit dem SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg gemacht habe. Der Ausgangspunkt war Haydns wunderbare Musik, von der er selbst fünf verschiedene Fassun- Foto: A.T. Schaefer gen gemacht hat. Obwohl jeder einzelne Satz schön ist, ist das Problem, dass sie in der Summe für den Zuhörer eine Herausforderung sind. Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie man dieses Stück unterbrechen und mit etwas anderem kontrastieren kann. Bei Messiaen ist die Situation ähnlich. Und so entstand dieses Programm. Dann wird die Bühne aber sehr voll, wenn Sie hier mit zwei unterschiedlichen Besetzungen musizieren. Das stimmt. Deshalb entstand der Gedanke, dass nur die Messiaen-Besetzung auf der Bühne ist und die Streicher im Zuschauerraum verteilt werden. Aber wie bekommt man ein ganzes Streichorchester in den Saal? Also habe ich auf die Idee von Haydn zurückgegriffen, der eine Fassung für Streichquartett geschrieben hat. Wir machen das jetzt mit vier Streichseptetten, die an verschiedenen Stellen des Saals postiert werden, dazu ein Solo-Cello mitten im Raum. Um dem Publikum einen besseren Zugang zu ermöglichen, gibt es den Text von Martin Mosebach, ein Dialog zwischen einem Mann und einer Frau über das Grabtuch von Turin. Das passt perfekt! Die Fragen stellte Markus Dippold. Neue Wege zu einem Altbekannten Ein Wochenende ganz im Zeichen des Jubilars Giuseppe Verdi E in neuer Blick auf Verdi? Wie kann ein neuer Blick auf einen Komponisten aussehen, der zentral in den Spielplänen aller Opernhäuser weltweit ist, dessen Stücke bekannt und beliebt sind und dessen Melodien Ohrwurmcharakter haben? Für Sergio Morabito, Chefdramaturg der Stuttgarter Oper, liegt genau in dieser Popularität und dem Erfolgsmodell Verdis das Problem: „Ich halte Verdi für einen der sperrigsten und schwierigsten Komponisten überhaupt. Seine Opern sind ‚Selbstläufer‘; in ihrer auf Erfolg getrimmten dramaturgischen Form und Eigendynamik sind sie auch ein Korsett, in dem für Fragen und Bedürfnisse der Interpreten wenig Raum vorgesehen ist. Deswegen stellen wir die Frage, ob und wie wir Verdi für uns heute entdecken können.“ Angesichts einer regelrechten Flut von Verdi-Inszenierungen landauf, landab, nicht nur im langsam zu Ende gehenden Jubiläumsjahr, erscheint dieser Gedanke im besten Sinne „unzeitgemäß“. Gleichwohl hatte Verdi trotz dieses neuen Werkcharakters Einfluss auf Sänger und Gesangstechnik, mit ihm entsteht beispielsweise ein völlig neues Stimmfach, der VerdiBariton: „In ‚Nabucco‘ ist erstmals der Bariton der Protagonist, und in ‚Falstaff ‘ ist er es wieder. In einem Sonderkonzert mit drei Vertretern dieses Stimmfachs, das der Musikwissenschaftler und Stimmenexperte Thomas Seedorf moderieren wird, soll untersucht werden, wie sich der Typus VerdiBariton etabliert und entwickelt hat.“ WISSENSCHAFT UND PRAXIS Foto: A.T. Schaefer Damit verknüpft Sergio Morabito einen weiteren wichtigen Aspekt des Verdi-Wochenendes: „Wir schauen über den eigenen Tellerrand, da es für uns am Theater wichtig ist, nie den Bezug zu dem zu verlieren, was in der Musik- und Theaterwissenschaft passiert, zu welchen fachwissenschaftlichen Erkenntnissen man an den Universitäten kommt.“ Deshalb sollen Interpreten, Dramaturgen, Regisseure und Wissenschaftler in einer Gesprächsrunde versuchen, die Frage zu diskutieren, ob und wie Giuseppe Verdi heute aufgeführt werden kann: „Ich finde es vermessen zu sagen, man wüsste, wie man sich Verdi heutzutage zu nähern hat. Ich finde ihn einen der spannendsten Musiktheaterkomponisten überhaupt. Aber ich zweifle aktuell an seiner Aufführbarkeit“, meint Sergio Morabito, der noch einen Schritt weiter geht in seinem Zweifel an einem der bedeutendsten Komponisten der Operngeschichte: „Ich kenne auch nur ganz wenige VerdiProduktionen, die mich überzeugt haben, etwa die wunderbare Berghaus-Inszenierung von ‚La Traviata‘, die wir in dieser Spielzeit wieder zeigen.“ Markus Dippold ger: „Für die Interpreten bedeutet das, dass sie teilweise nur noch Erfüllungsgehilfen eines Erfolgsmodells sind. Bei Verdi kann sich der Sänger keine Freiheiten, zum Beispiel für eigene Verzierungen, nehmen, wie das im Belcanto selbstverständlich war.“ L Das Verdi-Wochenende findet vom 25. bis zum 27. Oktober statt. Neben Aufführungen von „Falstaff “ (26.10.) und „Nabucco“ (27.10.) gibt es eine Gesprächsrunde (25.10.), Vorträge (26./27.10.) und ein moderiertes Sonderkonzert (27.10.). DER BARITON ALS PROTAGONIST Drei Tage lang wird das Opernhaus Ende Oktober ganz im Zeichen Giuseppe Verdis stehen. Ausgangspunkt seien, so Morabito, die beiden Neuproduktionen „Nabucco“, der in der vergangenen Spielzeit Premiere hatte, und „Falstaff “, der am 20. Oktober auf die Bühne kommen wird: „Zunächst einmal haben wir uns konzeptuell langfristig entschieden, den ‚Nabucco‘ aus Verdis früher Schaffensphase und sein Alterswerk ‚Falstaff ‘ zu kontrastieren. Wir können so Verdis unglaubliche Entwicklung nachvollziehen und gleichzeitig staunen, wie er sich dennoch treu geblieben ist. An der Entwicklung des Opernwesens in diesen 50 Jahren hat er natürlich einen entscheidenden Anteil.“ Verdi sei ein wichtiger Brennpunkt des Prozesses der Opernentwicklung im 19. Jahrhundert gewesen, sowohl was die Strukturierung und Dramaturgie von Musiktheater betrifft als auch hinsichtlich des Umgangs mit Sängern. „Komponisten vor Verdi, also etwa Donizetti und Bellini, haben noch für konkrete Sänger und deren stimmliche Atalla Ayan als Ismaele und der Staatsopernchor Stuttgart in Verdis „Nabucco“ Möglichkeiten geschrieben.“ Im Extremfall konnte das bedeuten, dass ganze Arien geopfert oder ersetzt wurden. Mit Verdi, so Morabito, habe sich ein viel stärkerer Werkgedanke entwickelt; das Stück wurde wichtiger als der einzelne Sän- er Regisseur kommt von der Probe – und ist heiser. Ist ihm die brütende Sommerhitze auf die Stimme geschlagen? Nein, dafür seien die Proben mit den Kindern verantwortlich, bei denen er mitgesungen habe, versichert Frank Hilbrich, der wohl auch ohne Heiserkeit kein lauter Typ ist. Wobei man die Gelassenheit, die der gebürtige Bremer an den Tag legt, nicht falsch einschätzen sollte: Hilbrich weiß, was er will, und ist auch jenseits der vierzig nicht der Routine anheimgefallen: „Ich werde immer anspruchsvoller, besonders für die Theaterleiter“, sagt er. Derzeit bereitet Frank Hilbrich die Uraufführung von „Peter Pan“, einem Musiktheater des Briten Richard Ayres, vor. Während „Peter Pan“ in Stuttgart, dem Konzept der Jungen Oper gemäß, für Zuschauer „von neun bis neunzig“ gespielt wird, wie Hilbrich sagt, soll das Werk später an der Komischen Oper Berlin überwiegend für Kinder angeboten werden, und die ebenfalls beteiligte Welsh National Opera in Cardiff plant im Gegensatz dazu ausschließlich Abendvorstellungen. Für ihn als Regisseur sei das eigentlich kein Problem, sagt Frank Hilbrich: „Oper soll plastisch sein, sie soll sinnlich erfahrbar gemacht werden“, erläutert er – dabei sei es nicht die Frage, was Kinder verstehen könnten und was nicht. Sehr abstrakte Lösungen strebt Hilbrich für „Peter Pan“ allerdings nicht an, und eines sei klar: „Peter Pan muss fliegen.“ Um das zu garantieren, treibt die Oper Stuttgart einigen Aufwand. In Bregenz traf Hilbrich den eigens engagierten Flugchoreografen Ran Arthur Braun zum Vorgespräch und zu ersten praktischen Übungen mit den Sängern. Dass der zuständige Bühnenoberinspektor Michael Zimmermann mitgereist war und alles tut, um die komplizierte Herausforderung zu bewältigen und die fliegerischen Anforderungen zu erfüllen, findet der Regisseur typisch für die Stuttgarter Verhältnisse: „Es gibt dort eine Tradition der Neugier, große Aufgeschlossenheit und die Lust am Risiko“, schwärmt Hilbrich, der in den späten 1990ern Regieassistent in Stuttgart war und sich auf viele Wiederbegegnungen freut. Er habe an der Stuttgarter Oper „gelernt, was Regie eigentlich ist“, resümiert der inzwischen weithin gefragte Regisseur, der nach einer festen Station in Schwerin seit über einem Jahrzehnt freiberuflich arbeitet und mit Regietaten wie Wagners kompletten „Ring“ in Freiburg, der Wiederentdeckung von Aubers „Das bronzene Pferd“ in Berlin und Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ in Hannover für Aufsehen gesorgt hat. Dabei misst Hilbrich seine Wirkung nicht an Buhs oder Bravos. Wichtig sind ihm Authentizität der Perso- Regisseur Frank Hilbrich schätzt an der Oper Stuttgart die Tradition der Neugier und eine große Aufgeschlossenheit. Foto: Hansjörg Michel nenführung und die Erkennbarkeit einer gesellschaftlichen Relevanz seiner Inszenierungen, die nicht aus Prinzip provozieren sollen – aber doch „irritieren“, meint Hilbrich, denn das rege zum Nachdenken an. Zu seinem Beruf kam Frank Hilbrich nicht auf den gewöhnlichen Wegen. „Ich habe ja keine Berufsausbildung“, sagt er gelassen und erzählt von den frühen Erfahrungen im Jugendclub des Bremer Theaters und der Begegnung mit dem damaligen Schauspieldirektor Günter Krämer, der viele Probenbesuche ermöglicht habe und für alle Fragen offen gewesen sei. „WIR SPIELEN, WAS WIR NICHT KAPIEREN“ „Das war ein ganz großes Glück“, resümiert Hilbrich, der inzwischen Gesangsstudenten an Hochschulen in Berlin und Basel Schauspielunterricht gibt und wohl auch sich selbst meint, wenn er in diesem Zusammenhang davon spricht, man müsse „die Fantasie trainieren, sonst kommt man nicht voran“. Hilbrich ist ganz gut vorangekommen, doch manchmal treibt er mit dem Thema Karriere einen hintergründigen Spaß. „Eigentlich ist das ja schrecklich, dass ich jetzt schon 25 Jahre an Profitheatern arbeite“, sagt er dann und erzählt, dass seine einzige berufliche Alternative die Ornithologie gewesen sei. Lugt in solchen Momenten etwa Peter Pan, das ewige Kind, aus dem erfahrenen Theatermacher hervor? Nein, diese Sehnsucht empfinde er nicht, sagt Hilbrich und lächelt vieldeutig: „Ich darf ja spielen“. Wie bitte? Ja, Theaterleute verhielten sich doch wie Kinder: „Wir spielen, was wir nicht kapieren“. Aber man dürfe gerade „Peter Pan“ ohnehin nicht als reines Kinderthema missverstehen. Gerade in Großbritannien werde die 1902 von J. M. Barrie erfundene Figur viel abgründiger verstanden. „Es ist ein großer Stoff über das Kindsein ebenso wie über das Erwachsensein“, erklärt Hilbrich, und das Buch sei voller „hinreißend schöner Bilder für die seelische Befindlichkeit“. Allein von dem Kuss, den Mrs Darling in ihrem Mundwinkel für später aufbewahrt, kann der Regisseur ganz begeistert schwärmen. Eine Abenteuergeschichte, möglichst sinnlich zu erzählen, sei „Peter Pan“, und die Musik von Richard Ayres führe tief in die Figuren hinein, spreche von unerfüllter Liebe, von Gewalt, aber auch von der göttlichen Aura, die den Titelhelden umgebe. Als Frank Hilbrich für ein Interview des Schweizer Radios die Zwischenmusiken aussuchen konnte, wählte er neben Wagner auch Nina Hagen und den kubanischen Sänger Bola de Nieve. Die Berliner Punkerin sei „nicht weit entfernt von der Intensität Richard Wagners“, begründete er die Auswahl, und für Lateinamerika hege er seit langem eine starke Zuneigung. Dort gebe es „ehrliches Pathos“, erzählte Regisseur Hilbrich und gab zu, dass auch ihm der Gegensatz zwischen „himmelhoch jauchzend“ und „zu Tode betrübt“ vertraut sei. Er frage sich oft, ob man wirklich immer Ausgeglichenheit suchen solle, ob „das Leben als Achterbahnfahrt“ nicht eigentlich besser sei. Wer das Theater kennt, der weiß, wie anstrengend diese Achterbahnfahrt ist. Aber die „Lust am Risiko“, die Frank Hilbrich gerade in Stuttgart ortet, ist eben nicht im Ohrensessel zu gewinnen. Jürgen Hartmann