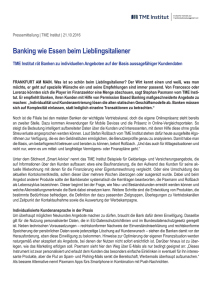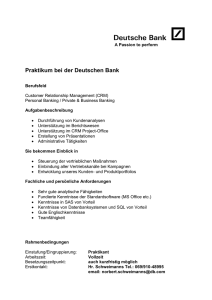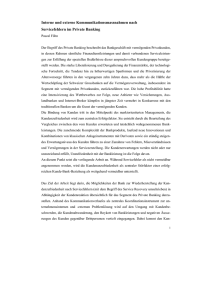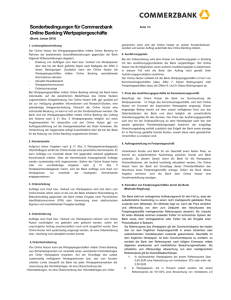TME Publikationen 2016
Werbung

Digital Banking Risk & Regulatory Transformation Management TME Publikationen 2016 Aktuelle Themen Richtlinien Modelle Vorgehensweisen Institut Institut für Vertrieb und Transformationsmanagement e.V. 1 Wissen kompakt – Whitepaper des TME Instituts 2016 Digital Banking, Risk & Regulatory und Transformation Management – auch im Jahr 2016 hat das TME Institut für Vertrieb und Transformationsmanagement e.V. wieder zahlreiche Whitepaper sowie ein Factbook zu seinen Kern­ themen herausgebracht. In diesem Booklet sind alle Veröffentlichungen aus 2016 zusammengefasst. Digital Banking Seite 3-21 Risk & Regulatory Seite 22-31 Transformation Management Seite 32-38 § TME PUBLIKATIONEN 2016 2 Digital Banking Innovative, mobile Zugangskanäle und digitale Angebote: Kunden fordern heute neue Lösungen und disruptive ­Geschäftsmodelle sowie digitale Leistungen. Banken müssen ihre Geschäftsmodelle entsprechend überarbeiten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wichtigstes Stichwort in diesem Zusammenhang ist das Digital Banking, das Aktivitäten im Mobile Banking (Connec­ ted Devices), Social Banking (Soziale Netzwerke und Features) und Plattform Services Banking (modulare Kernleis­ tungen und Produkte) umfasst. Vom Bezahlen über das Anlegen und Verwalten bis zum Finanzieren (Kredite) sind digitale Innovationen gefragt. Zahlreiche FinTechs haben das erkannt und zwingen die etablierten Banken zur eige­ nen Aktivität. Die TME AG berät ihre Kunden ganz gezielt im Sinne eines integrierten Digital Banking Beratungsansatzes mit dem Ziel sichtbarer und schneller Erfolge. Die Begleitung erfolgt in allen Phasen der Digital Banking Transformation. In 2016 hat das TME Institut dazu folgende Publikationen verfasst: Digitalisierung im Private Wealth Management Whitepaper, Januar 2016, 4 Seiten Autoren: Holger Boschke, Volker Errolat, Miomir Tomovic 5-8 Schneller, günstiger und häufig kundenorientierter: Immer mehr FinTechs machen den Banken in ihrem ­Kerngeschäft Konkurrenz, wobei ein Trend zu stets komplexeren Angeboten zu beobachten ist. Auch die Vermögensberatung ist zunehmend davon betroffen. Das Whitepaper befasst sich damit, welche Entwicklungen diesen Bereich bestimmen und welchen Herausforderungen sich gerade Privatbanken dabei stellen müssen. Bundesrat verabschiedet Novellierung des Bausparkassengesetzes Whitepaper, Januar 2016, 2 Seiten Autoren: Jan Franz, Julia Tanasic 9-10 Änderungen wie die Anhebung der Beleihungsgrenze von 80 auf 100 Prozent des Immobilienwertes oder die ­Erlaubnis, liquide Mittel in Aktien anzulegen, schaffen ein Hybrid aus Bausparkasse und Immobilienbank. Das ­bedeutet neue Chancen für die Unternehmen. Um das Bausparen nachhaltig zukunftsfähig zu machen, muss jedoch eine Einbettung in neue digitale Ökosysteme rund um das Thema Bausparen gelingen. InsurTech: Wie Start-ups die Wertschöpfungskette der Versicherungen revolutionieren Whitepaper, August 2016, 3 Seiten Autoren: Stefan Roßbach, Lisa Hilberg 11-13 Der Versicherungsmarkt befindet sich im Wandel. Nach Jahren ohne nennenswerte Neuerungen bei den ­Geschäftsmodellen gibt es jetzt einen deutlichen Weckruf für die Branche: Immer mehr junge Unternehmen ­revolutionieren mit innovativen Lösungen sämtliche Bereiche der Versicherungswertschöpfungskette. 3 Permission Based Marketing trifft Mehrwert-Banking auf ausdrücklichen Wunsch Whitepaper, Oktober 2016, 4 Seiten Autoren: Stephan Paxmann, Jan Franz 14-17 Der Finanzsektor befindet sich derzeit in einem bedeutsamen Umbruch. Die früher statischen und transaktions­ orientierten Geschäftsmodelle der Banken wandeln sich zu einem komplexen, individuellen und kundenzentrierten Modell. Vordergründiges Ziel ist es, dem Kunden oder Interessenten maßgeschneiderte Produkte und Leistungen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Umfang zur Verfügung zu stellen. Dabei sind Hintergrundinfor­ mationen über den jeweiligen Kunden oder Interessenten das Kapital, denn mit ihrer Hilfe können relevante Hinwei­ se zur Optimierung der individuellen Finanzsituation gegeben werden. Mehr digitaler Wettbewerb bei Banken und Finanzdienstleistern durch PSD2 Whitepaper, Dezember 2016, 2 Seiten Autoren: Stefan Roßbach, Thomas Büttner 18-19 Am 12. Januar 2016 trat die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) in Kraft. Anschließend hat die EBA (Eu­ ropean Banking Authority) die „Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure com­ munication under PSD2“ (kurz RTS) im Entwurf vorgestellt. Diese Anforderungen an eine technische Schnittstelle wurden aus der PSD2 abgeleitet und sollen die Basis für die Regelung des digitalen Kontozugriffs durch Dritte bilden. Derzeit bestehen jedoch in vielen Punkten noch Unklarheiten. Innovative Geschäftsmodelle im Digital Wealth Management Factbook 2016, 112 Seiten Bank-Verlag & TME Institut Autoren: Stephan Paxmann, Stefan Roßbach 20-21 Die Zahl der Neugründungen im Digital Wealth Management wächst seit 2014 stark an. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Geschäftsmodelle in den Kategorien Research Tools, Online Brokerage, Social Communities, Robo ­Advisory und Crowdinvesting. Steht das Private Banking nun also vor einer Zeitwende? Die persönliche Beratung wird zwar unverzichtbar bleiben, jedoch durch digitale Unterstützung schon bald ein Vielfaches für neue Kunden­ gruppen leisten können. Das Factbook stellt über 70 Geschäftsmodelle im Digital Wealth Management vor, die ins­ besondere durch ihren Mehrwert für den Kunden, den Innovationscharakter der Lösungen sowie die Bedeutung für den Markt eine Referenz für die anstehende Entwicklung in der Vermögensverwaltung sind. 4 TME Institut | Januar 2016 Digitalisierung im Private Wealth Management Schneller, günstiger und häufig kundenorientierter: Immer mehr FinTechs machen den Banken in ihrem Kerngeschäft Konkurrenz, wobei ein Trend zu immer komplexeren Angeboten zu beobachten ist. Auch die Vermögensberatung ist davon zunehmend betroffen. Welche Entwicklungen bestimmen diesen Bereich und welchen Herausforderungen müssen sich gerade Privatbanken dabei stellen? Ende 2015 war es soweit: Mit paydirekt gehört auch das Internet Payment Processing zu den üb­ lichen Geschäftsaktivitäten einer Großbank. Mit über 230 Millionen Konten in 193 Nationen und 25 Währungen wird dieser Bereich aktuell von PayPal dominiert. In 2015, 15 Jahre nach der Gründung, wurde PayPal mit einer Markt­ kapitalisierung von rund 35 Mrd. € an die Börse gebracht. Bemerkenswert ist dies aus zwei Gründen: Zum einen zeigt es, wie schnell sich ganze Segmente durch die Digitalisierung verändern. Zum ande­ ren aber auch, wie lange die deutschen Banken gebraucht haben, um mit paydirekt das Bedürf­ nis ihrer Kunden nach einem sicheren und be­ quemen Bezahlverfahren im Internet zu bedie­ nen. Wesentlich attraktiver, und ein Bereich in dem die Banken in der Vergangenheit noch relativ risikofrei Geld verdienen konnten, ist hingegen der Bereich der Vermögensberatung. Auch wenn mehr und mehr Bankdienstleistungen inzwischen online angeboten werden, ist das Thema Finanzplanung und Vermögensanlage über Onlinemedien noch immer relativ neu. Eine ganze Reihe digitaler Innovationen zeigen jedoch, dass auch hier noch grundsätzli­ che Veränderungen zu erwarten sind. Digital Wealth Management (DWM) - mehr als Online Banking für Vermögende? Grundsätzlich lässt sich das Digital Wealth Management in 7 Kategorien einteilen: 1 - Daily Banking Unter Daily Banking fallen Online Angebote wie Bestandsabfragen, Überweisungen und die Ver­ waltung einfacher Anlageprodukte. Darüber hin­ aus bieten einige Banken Personal Finance- und Aggregationstools an, die für die Konsolidierung einzelner Reports und eine ganzheitliche, auch institutsübergreifende, Beratung genutzt werden können. Fotoüberweisungen, Authentifizierung per Fin­ gerabdruck und Pulsmessung oder der Daten­ abgleich per Near Field Communication (NFC) gehören dabei noch zu den neueren und innova­ tiveren Lösungen. Diese Angebote sind regelmäßig Teil des Multikanalangebots der meisten Großbanken, unterscheiden sich aber in einzelnen Punk­ ten noch ganz erheblich. Zu nennen wären hier Sicherheitsstandards, Informationstiefe, Transaktionsfähigkeit, Datensynchronisation, Einbindung sozialer Medien, Nutzerfreundlich­ keit (unter Berücksichtigung etwaiger Medien­ brüche) sowie die Optimierung der Inhalte und Funktionen für Tablets und Smartphones. Gerade die auf vermögende Privatkunden spe­ zialisierten Privatbanken und Asset Manager haben hier z.T. noch Nachholbedarf, der sich mit den wandelnden Kundenbedürfnissen in den nächsten Jahren weiter erhöhen dürfte. 2 - Informationsmanagement Dazu gehören einfache Analysetools, Webinars zu besonderen Finanzthemen sowie regelmäßi­ ge Marktkommentare und Ad Hoc Analysen, die eine gute Möglichkeit bieten, mit Kunden in den Dialog zu kommen. Die Idee dahinter ist relativ einfach: Besser in­ formierte Kunden sind aktiver, gerade auch im Bereich der Vermögensanlage. Ausgewählte FinTechs aus Deutschland 5 Schaut man sich jedoch einmal die meistbesuchten Finanzseiten im Netz an, finden sich darunter erstaunlich wenige Banken. Wer sich im Web auf die Suche nach Finanz­ marktdaten und Finanznachrichten begibt, landet dabei eher auf den Seiten von Internetfirmen wie Yahoo (mit rund 70 Millionen Besuchen jeden Monat die größte Finanzseite der Welt), Microsoft (MSN), Google oder auch CNN, Reuters und Bloomberg. 3 - Online Brokerage Hier handelt es sich um den Handel von Wert­ papieren, ohne dass in diesem Zusammenhang eine Beratung erfolgt (Execution Only). Eine Sonderform ist dabei das Discount Brokerage für Privat- und Geschäftskunden (z.B. unabhängigen Vermögensverwaltern) mit besonders hohem Orderaufkommen. Brokerage gibt es in Deutschland seit Ende der 80er Jahre, und viele Direktbanken haben dort ihren Ursprung. Zunehmend erwächst den Groß­ banken hier auch im Bereich der Vermögens­ beratung Konkurrenz, da die Direktbanken die Möglichkeiten der Digitalisierung verstärkt dazu nutzen, ihre eigenen Geschäftsmodelle weiter auszubauen. 4 - Geschlossene Anlageprodukte Obwohl lange Zeit ein wesentlicher Ertragsbringer für Banken und eine gute Möglichkeit, sich durch entsprechend exklusive Produkt angebote vom Wettbewerb zu unterscheiden, ist diese Produktgattung gerade auch im Zuge der Finanzmarktkrise immer stärker in Verruf geraten. Aufgrund diverser produktspezifischer Probleme und entsprechend hoher Haftungsrisiken sind viele Banken inzwischen dazu übergegangen, sich vertrieblich auf Family Office und besonders vermögende Privatkunden zu fokussieren. Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, ins­ besondere des sogenannten Crowdinvestings, könnten Investitionen in geschlossene Anlage­ produkte auf Execution Only Basis jedoch wieder deutlich an Attraktivität gewinnen. 5 - Social Community / Soziale Netzwerke Unter diese Kategorie fällt zum einen die Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook, Whatsapp oder Twitter zu Kommunikationszwecken. Zum anderen existieren hier spezielle SocialTrading-Plattformen wie Ayondo, eToro, Wikifolio oder ZuluTrade, bei denen erfahrene Anleger ihre Trades und Tradingstrategien offenlegen, so dass auch andere Kunden von den Tipps bzw. der „Schwarmintelligenz“ des Netzwerkes profitieren können. Auch wenn der kooperative Gedanke in den sozi­ alen Medien durchaus erstrebenswert ist, ist das Thema „Front-Running“ hier nicht ganz unkri­ tisch. Manch einer wird sich noch an die wilden Blogs zu Zeiten der Dotcom Blase erinnern, als man in Deutschland australischen Penny-Stocks hinterherjagte. 6 - Online Beratung Darunter ist zum einen die Beratung von Kun­ den unter Einbindung und Zuhilfenahme neuer Medien, z.B. mit Hilfe von Screen Sharing oder Online Chats, zu verstehen. Zum anderen aber auch online bereitgestellte Empfehlungen im Wertpapiergeschäft - bis hin zur Online Vermögensverwaltung. 7 - Online Vermögensverwaltung1 Der Bereich Vermögensverwaltung, bei welcher der Kunde online und auf Basis vordefinierter Kriterien ein diskretionäres Mandat zur Verwal­ tung eines bestimmten Vermögens erteilt, bzw. ein fertiges (eher weniger individualisiertes) Vermögensverwaltungsprodukt auf Basis Execu­ tion Only erwirbt, ist noch immer relativ neu. Im angelsächsischen Raum hat diese Form der Vermögensverwaltung, auch Robo Advisory genannt, durch Firmen wie Wealthfront und Betterment (gegründet 2008 und 2009) jedoch bereits einen echten Schub erhalten. In Deutschland gibt es seit 2013 mit Firmen wie vaamo2 oder auch easyfolio3 (gegründet 2014) erste Anbieter in diesem Segment. Auch wenn sich die Angebote der Robo Advisors bisher noch nicht explizit an vermögende Privat­ kunden richten, und viele dieser Firmen noch vergleichsweise klein und wenig profitabel sind, ist dennoch absehbar, welche Veränderungen diese Geschäftsmodelle auch für das Wealth Management (WM) mit sich bringen. Durch die weitgehend automatisierte Portfolioallokation, den Einsatz besonders kostengünstiger Fonds sowie geringer Transaktions- und Verwaltungskosten können diese Firmen ihre Dienstleistungen deutlich günstiger anbieten als viele der etablierten Marktteilnehmer. ______________ 1 Für weitere Ausführungen zu diesem Thema siehe auch TME Factbook „Innovative Geschäftsmodelle im Banking“ bzw. TME Whitepaper „Robo Advisory“ 2 https://www.vaamo.de 3 https://www.easyfolio.de Die Robo Advisors werden sich aber neben den allgemeinverbindlichen Vorgaben durch MiFID perspektivisch auf zusätzliche regulatorische Vorgaben einstellen müssen. Auch wenn die Auf­ sichtsbehörden in der automatisierten Beratung durchaus Vorteile für Verbraucher sehen (u.a. niedrigere Kosten und mehr Konsistenz in der Beratung), listet das aktuelle „Discussion Paper“ der ESAs „on automation in financial services“ (Konsultation bis 4.3.2016) nicht weniger als 13 kundenspezifische Risiken auf. Darunter interes­ santerweise auch fehlende menschliche Interak­ tion sowie potentielle Softwareprobleme. Dennoch: das Potential für derartige Angebote scheint riesig: Alleine für die USA werden in einzelnen Studien Ertragsausfälle i.H. von bis zu 90 Mrd. US$ prognostiziert, sollten sich die etablierten Anbieter auf diesen Preiskampf einlas­ sen. Mensch vs. Maschine Nicht ganz zu Unrecht weisen Kritiker jedoch darauf hin, dass insbesondere im Wealth Management das persönliche Vertrauensverhält­ nis zwischen Kunde und Berater ein entscheiden­ der Erfolgsfaktor, gerade auch bei der Akquisition von Neugeldern, ist. Auch wenn der Bankberater inzwischen nicht mehr unbedingt der erste und alleinige Ansprechpartner in Vermögensfragen ist: Das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Berater wird und sollte auf absehbare Zeit tatsächlich nur schwer zu ersetzen sein. Gleichwohl darf es niemanden verwundern, wenn auch Wealth Management Kunden zuneh­ mend höhere Anforderungen an die digitalen Fähigkeiten ihrer Vermögensberater stellen. Die Entwicklung der Online Vermögensverwaltung am Beispiel Asien In Asien, einem der am schnellsten wachsenden Märkte in diesem Bereich, gehen lt. RBS WM 82% der Reichen (ohne Japan) davon aus, dass in fünf Jahren die Kundenbeziehung in der Vermögensverwaltung hauptsächlich auf digitalen Kanälen erfolgen wird. Zudem zeigt die Studie, dass gerade jüngere und wohlhabende Asiaten die digitale Kommunikation via Internet, Mobile und E-Mail dem direkten Kontakt vorziehen. Besonders alarmierend ist jedoch die Feststellung, dass 65% der Befragten vorhaben, ihren Anbieter zu verlassen, wenn dieser ihnen keine integrierte, kanalübergreifende Serviceerfahrung bieten kann. Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Entwicklungen, die verdeutlichen, warum das Thema Digitalisierung auch im Wealth Management nicht mehr außen vor bleibt. Regulatorische Vorgaben Bereits heute stellen die regulatorischen Vorga­ ben im Beratungsgeschäft insbesondere durch MiFID (I) und die entsprechenden Vorschriften im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) enorm hohe Ansprüche an die IT. Mit MiFID II, das Anfang 2017 in Kraft treten wird, sollen die bestehenden Regelungen sogar noch einmal verschärft und neue Regeln in Bereichen eingefügt werden, die bisher noch nicht reguliert waren. Insbesondere die Dokumentationsanforderun­ gen an die Eignung einer Anlageempfehlung im Kontext der Markterwartungen und des Risiko­ profils sowie des Erfahrungs- und Verständnishorizontes eines Anlegers sind dabei eine besondere Herausforderung. Das Beratungsprotokoll als Innovations- bzw. Digitalisierungstreiber In der Praxis ist durch die Einführung der Beratungsprotokolle seit längerem ein Trend hin zu standardisierender, risikovermeidender Beratung und entsprechenden Produkten zu erkennen. Dies hat dazu geführt, dass sich mit der Vermögensverwaltung auf der einen und dem Execution Only Geschäft auf der anderen Seite zwei Pole herausgebildet haben, die es den Banken erleichtern, die mit diesem Geschäft verbundenen Anforderungen und Risiken besser zu managen. Hingegen ist das Thema Beratung inzwischen so komplex geworden, dass es ohne vernünftiges Datenmanagement kaum noch zu bewältigen ist. Eine der größten Herausforderung liegt dabei darin, den Berater in seiner täglichen „Emp­ fehlungsarbeit“ so zu unterstützen, dass er den steigenden Kunden- und regulatorischen Anforderungen auch wirklich gerecht werden kann. Gerade im Wealth Management können intel­ ligente Systeme dabei helfen, die zunehmend komplexen Prozesse besser zu managen, um die Effizienz und Qualität der Beratung sowie der Regelüberwachung zu erhöhen. Z. B. könnten Berater mit ihren Kunden online über Portale kommunizieren und im Zuge der Beratung die notwendigen Dokumente in die Beratungsdokumentation einfließen lassen. In der Praxis stehen solchen Lösungen jedoch noch immer IT-Strukturen gegenüber, die Daten in unterschiedlichen Systemen halten und so eine direkte Verknüpfung, Aggregation und Aus­ wertung erschweren. 6 Aber auch mit geringerem Aufwand und unter Einbeziehung des für den Kunden verantwort­ lichen Beraters könnte die Datenqualität in den vorhandenen Systemen oftmals verbessert werden, um zusätzliche Potentiale für eine ziel­ gerichtete Produkt- und Empfehlungslogik zu generieren. In manchen Banken, hier sind insbesondere die Schweizer Institute zu nennen, stehen derartige Systeme dem Berater bereits heute zur Verfü­ gung. Deren Anbindung an die eigene Internet­ plattform und entsprechende Apps ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Zunehmender Preisdruck Durch das Auftreten der Onlinebroker und Direktbanken gibt es auf der Execution Only Seite bereits seit längerem einen intensiven Preiskampf. Auch im Bereich der Vermögens­ verwaltung ist dieser Trend inzwischen zu be­ obachten und wird verstärkt durch unabhängige Vermögensverwalter, die Banken und Discount­ broker lediglich als Buchungsplattform nutzen. Hinzu kommt, dass die Banken auch aufgrund der sich verändernden regulatorischen Vorgaben im Bereich Vertriebsvergütung zunehmend un­ ter Druck stehen und Kunden in Zeiten niedriger Zinsen und volatiler Börsen besonders preissensitiv agieren. Robo Advisors, die mit ihren aggressiven PricingStrategien den Kundenerwartungen an Transpa­ renz und niedrige Kosten entsprechen, werden diesen Trend weiter befeuern. Honorarberatung und alternative All-In-Fee Preismodelle tun sich als Antwort darauf hin­ gegen noch immer schwer, insbesondere auch deshalb, weil für den Kunden ein echter Mehr­ wert häufig nicht zu erkennen ist; wurde doch die Beratung früher (vermeintlich) auch ohne gesonderte Bepreisung erbracht. Um einen sichtbaren Mehrwert gegenüber dem Execution Only zu schaffen, müssen daher im Rahmen systematischer Analyseprozesse ent­ sprechende Handlungsempfehlungen generiert werden. Als besonders gutes Beispiel hierfür kann sicherlich das Beratungsmodell „UBS Advice“, mit ca. 15 Mrd. € unter Verwaltung, genannt werden.4 Voraussetzung dafür sind entsprechend umfang­ reiche Portfolioanalysen und Prozesse, die ohne technische Unterstützung jedoch kaum darstell­ bar sind. Wer sich jedoch zu stark von reinen Kostenüber­ legungen und den notwendigen regulatorischen Anforderungen leiten lässt, kann dabei auch schnell Kunden und Berater aus den Augen ver­ lieren. Die neue Technik kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie komplementär und konsistent mit den vorhandenen Systemen dabei hilft, einen echten Kundenbedarf zu bedienen. Denn am Ende sind es die Kunden, die über die Akzeptanz neuer digitaler Angebote (auch im Vergleich mit Wett­ bewerbern) entscheiden. Kunden sollten daher insbesondere auch dann eingebunden werden, wenn es darum geht, neue Produkt- und Service­ lösungen zu entwickeln. Die größte Anforderung liegt jedoch eher selten darin, Kundenwünsche zu erfüllen, oder die neue Technik zu implementieren, sondern vielmehr darin, die internen Prozesse an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Beispiele für die Digitalisierung Private Wealth Management im Individuelle Festlegung der Investmentstrategie: Ermittlung des finanziellen Hinter­ grundes, insbesondere des Ertragsbedarfs im Verbindung mit der Risikotragfähigkeit des Kunden (Suitability).5 Vermögensverwaltung: Steigerung der Transparenz durch die zeitnahe, digitale Kommunikation von Entscheidungen. Beratung: Unterstützung bei der täglichen Analyse von Portfolios und Bereitstellung/ Prüfung kundenportfoliospezifischer Emp­ fehlungen.6 Beratungsprotokoll: Automatische Bereit­ stellung aller relevanten Informationen zum Kundenhintergrund und der Empfehlungen bzgl. anlage- und anlegergerechter Begrün­ dung. Bei der Frage, wie man sich auf diese, sich zum Teil gegenseitig verstärkenden Entwicklungen einstellt, stehen die jeweiligen Marktteilnehmer zum Teil ganz unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Struktureller Anpassungsbedarf Sinkende Einnahmen, das schwierige Zinsumfeld und regulatorisch bedingte Mehraufwendungen werden die Banken zu weiteren strukturellen Anpassungen ihrer Kostenbasis zwingen. Gerade die IT und die effiziente Nutzung neuer Tech­ nologien müssen dabei einen wichtigen Beitrag leisten. ______________ 4 https://www.ubs.com/microsites/ubs-advice/ de/index.html 7 FinTechs / Robo Advisors Die meisten Analysen sind sich darin einig, dass das Robo Advisory im Retail Banking nachhal­ tige Spuren hinterlassen und auch im Private Banking zunehmend an Bedeutung gewinnen ______________ 5 www.scalable.capital 6 www.in2experience.com wird. Inwieweit dieses Modell jedoch ohne weitere Anpassungen auch auf das Wealth Management übertragbar ist, bleibt abzuwarten. Die größte Herausforderung für Start-Ups im Bereich Vermögensanlage ist sicherlich der Umstand, dass nur wenige Kunden bereit sein werden, Firmen Großteile ihres Vermögens anzuvertrauen, die erst seit kurzem am Markt sind bzw. noch keinen langfristigen Erfolgsnach­ weis beim Thema Anlage vorweisen können. Bereits etablierte Anbieter haben es da deutlich einfacher. Das zeigt auch das Beispiel von Charles Schwab in den USA, die mit einem vergleichba­ ren Angebot in der gleichen Zeit deutlich mehr Assets einwerben konnten als die noch relativ unbekannten Robo Advisors. Vor diesem Hinter­ grund ist zu erwarten, dass auch andere Anbieter diesem Beispiel folgen, und mit entsprechenden Angeboten an den Markt gehen werden. Aus Sicht der Robo Advisors könnte es daher sinnvoll sein, die Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern zu suchen. In Deutschland ist easyfolio, die seit Oktober 2015 mit der ING DiBa kooperieren, ein gutes Beispiel dafür. In den USA haben Wealthfront und Betterment, die beiden größten und bekanntesten Robo Advisors, diesen Weg gewählt. Beide koope­ rieren inzwischen mit großen Asset Managern (Vanguard und Fidelity), die so die Möglichkeit nutzen, das eigene Angebot aufzupeppen und sich neue Vertriebswege zu erschließen. Und BlackRock, der weltweit größte Fondsmanager, hat gerade die Firma FutureAdvisor gekauft, offenbar nicht nur, um damit sein ei­ genes Direktangebot für Kunden zu stärken, sondern auch, um die Technologie im Vermitt­ lungsgeschäft einsetzen zu können. Was auf jeden Fall bleiben wird, sind die von den FinTechs propagierten technischen Möglichkeiten, egal ob in der Vermögensverwaltung oder als Beratungstool für Vermittler. Auch erste Hybrid-Modelle sind so bereits ent­ standen, z.B. das des US Anbieters Personal Capital, der seinen Kunden neben zahlreichen kostenlosen Analyse-Tools ab einem Anlagevo­ lumen von 100.000 US$ auch eine persönliche Beratung anbietet. Großbanken und Asset Manager Aufgrund der Tatsache, dass Kunden immer seltener in der Filiale anzutreffen sind, aber immer öfter online, arbeiten viele Großban­ ken seit Jahren daran, ihr Onlineangebot kontinuierlich auszubauen. So gibt es kaum eine Bank, die heute nicht mehr oder weniger „multikanal­ fähig“ ist. Für die Großbanken ist die Digitalisierung jedoch kein einfaches Thema. Denn Wachstumschancen in neuen Bereichen wahrzunehmen heißt auch, gegebenenfalls bereit zu sein, alte Geschäftsmodelle zu kannibalisieren und dem internen Wettbewerb auszusetzen. Das Beharrungsver­ mögen der Großbanken hat sich jedoch schon in der Vergangenheit als echte Wachstums- und Innovationsbremse erwiesen. Ein ganz entscheidendes Kriterium ist zudem das Thema der Geschwindigkeit (Time-to-Market), mit der neue Anwendungen und IT Lösungen adaptiert werden. Statt mit aufwendigen Eigenentwicklungen versuchen viele Banken daher, über Beteiligungen und Kooperationen Anschluss an die Marktentwicklung zu halten. Bei einer in der Branche nicht ungewöhnlichen Vergütung von 1% p.a. des Anlagevermögens errechnet sich bei einer Anlage von einer hal­ ben Million € eine jährliche Vergütung von 5.000 € oder knapp 420 € im Monat. Das ist gerade auch unter Berücksichtigung des mit der Beratung verbundenen Aufwands und der noch immer hohen Personalkosten in diesem Bereich nicht sonderlich viel. Dies erklärt auch, warum viele Häuser dazu übergegangen sind, sich in diesem Bereich verstärkt auf besonders vermögende Privatkunden zu fokussieren. Gerade im ländlichen Bereich und in kleineren Filialen ist es aufgrund der rechtlichen Anforde­ rungen inzwischen relativ schwierig geworden, eine vernünftige Beratung zu gewährleisten. Von daher werden sich viele Banken die Frage stellen müssen, ab welcher Größenordnung das Bera­ tungsgeschäft in der bisherigen Form noch trag­ fähig ist bzw. ob man dieses Geschäft - mit Hilfe der Digitalisierung - nicht auch anders organisie­ ren kann und so vergangene „Kundenselektionsi­ nitiativen“ ad-absurdum führt. Privatbanken und Vermögensverwalter Für viele Privatbanken ist die größte Herausforderung noch immer Wachstum. Trotz guter Startvoraussetzungen ist es den wenigsten bis­ her gelungen, in dem noch immer stark fragmen­ tierten Markt überproportional zu wachsen. Gerade hier könnte die Digitalisierung die Möglichkeit schaffen, regionale Beschränkungen aufzuheben und Probleme bei der Integration von Kundensegmenten zu lösen, z. B. auch Neukunden, die die Bank mit einem kleineren Teil ihres Anlagevermögens testen und eigentlich nicht in das bisherige Zielportfolio passen. Dabei spielt die aktuell zu beobachtende Verlagerung dieses Geschäftes in sogenannte Kompetenzzentren den Privatbanken eigentlich in die Kar­ ten, da diese ähnlich organisiert sind und sich seit langem auf das Thema Vermögensanlage spezialisiert haben. Wirklich mehr Convenience durch Online-­ Medien ist noch immer selten, denn gerade kleinere Banken tendieren dazu, größere Initia­ tiven im Bereich Digitalisierung zurückzustellen und sich auf andere Werttreiber ihres Geschäftes zu konzentrieren. Viele Vermögensverwalter verlassen sich dabei zudem weitestgehend auf die digitalen Angebote der jeweiligen Depotbanken und versäumen es so, die eigene Marke digital aufzuwerten. Auf Dauer dürfte ein weiteres Abwarten, auch das zeigt das Beispiel PayPal sehr deutlich, jedoch wenig nachhaltig sein. Je länger damit ge­ wartet wird, aktiv auf die hier genannten Trends zu reagieren, desto schwieriger dürfte es wer­ den, Anschluss an diejenigen zu finden, die sich dem Thema bereits angenommen haben. Autoren: Holger Boschke, Volker Errolat, Miomir Tomovic 8 TME Institut | Januar 2016 Bundesrat verabschiedet Novellierung des Bausparkassengesetzes Durch die Änderung entsteht ein Hybrid aus Bausparkasse und Immobilienbank. Dies eröffnet neue Chancen für die Bausparkassen. Um das Bausparen nachhaltig zukunftsfähig zu machen, muss eine Einbettung in neue digitale Ökosysteme rund um das Thema Bausparen gelingen. Der Finanzsektor ist im Umbruch. Dabei sind Bausparkassen ebenfalls betroffen. Ca. 30 Mio. Bausparverträge besitzen die Deutschen. Das Bausparen ist in Deutschland Tradition und wird schon seit vielen Jahren häufig in Kombi­ nation zum Annuitätendarlehen der Bank als Verbundprodukt verkauft. Jedoch funktioniert das Bausparen nicht mehr in Zeiten von extrem niedrigen Zinsen, zumindest nicht im aktuellen Entwurf des Bausparkassengesetzes. Hier soll die neue Gesetzesänderung Abhilfe schaffen. Die be­ schlossene Gesetzesänderung vom 18. Dezem­ ber 2015 trat im Januar 2016 in Kraft. Kerninhalte der Gesetzesänderung: • Ausweitung der Kreditvergabe der Bausparkassen • Anhebung der Beleihungsgrenzen von 80% auf 100% des Beleihungswerts • Erlaubnis zur Emission von Hypothekenpfandbriefen • Anlage von liquiden Mitteln in Aktien (erst ab 2017) Die weitere Detaillierung der Gesetzesänderun­ gen werden noch über die Finanzaufsicht BaFin durch eine Anlageverordnung veröffentlicht. Der Verband der privaten Bausparkassen begrüßt die Novellierung. Bei Bausparkassen handelt es sich um spe­ zielle Kreditinstitute, die aufgrund der bei­ spielsweise im deutschen Bausparkassengesetz geregelten Geschäftskreisbeschrän­ kung im Wesentlichen nur die Wohnbaufinanzierung über Bausparverträge betrei­ ben. Durch das Bausparkassengesetz ist die Geschäftstätigkeit von Bausparkassen regu­ liert. Es wurde letztmals 1990 neu gefasst. Die Gesetzesänderung soll die Reaktions­ möglichkeiten von Bausparkassen auf die veränderten Rahmenbedingungen erwei­ tern. Welche Risiken können durch die regulatori­ schen Änderung des Bausparkassengesetzes entstehen? • Kontrolle: Die regulatorischen Änderungen sind der Erste und ein wichtiger Schritt um die Widerstandsfähigkeit der Bausparkassen 9 insbesondere gegen die von der Europäischen Zentralbank verordnete Niedrigzinspolitik zu erhöhen bzw. dieser standzuhalten. Zusätzli­ che Kontrollen sollten auf die neuen Anlage­ möglichkeiten der liquiden Mittel, resultierend aus der Erweiterung des Bausparkassengesetzes, gesetzt werden. Durch das erweiterte Risikomanagement können die Risiken der neuen Anlagemöglichkeiten und erweiter­ ten Beleihungsgrenzen gehemmt und gesteu­ ert werden. • Risikoreichere Finanzierungs­möglichkeiten: Die Erweiterung der Beleihungsgrenzen von 80% auf 100% ist grundsätzlich mit höheren Risiken verbunden. Das erhöhte Risiko resultiert aus der Ausweitung der Beleihungsgrenze. Die Beleihungsgrenze einer Immo­ bilie ist der Wert bzw. der Prozentsatz bis zu welchem Kreditinstitute maximal Kredite aus­ geben dürfen. Die Beleihungsgrenze ist bei Verwertung der Immobilie (Kreditsicherheit) der angenommene Erlös der nicht unter­ schritten wird. Erhöht sich die Beleihungs­ grenze, so steigt ebenfalls das Risiko. Die Kreditsicherheit deckt folglich nicht mehr das volle Kreditvolumen ab. Dies ist vom Marktbzw. Verkehrswert der Immobilie bei Veräußerung abhängig. Positiv zu werten ist, dass die Bezugsgröße der Beleihungswert und nicht der Verkehrswert der Immobilie ist. Falls sich der Immobilienboom eines Tages umkehren bzw. negativ entwickeln sollte, ist eine Risikomitiga­ tion dadurch jedoch nicht gegeben. • Sicherer Hafen: Bei der letzten Finanzkrise waren die Bausparkassen so gut wie nicht betroffen, da sie aufgrund ihres Status als Spezialkreditinstitut viele Geschäfte nicht machen durften. Andere Marktteilnehmer herkömmliche Universalbanken - dürfen diese Geschäfte schon längst wahrnehmen und ge­ nau diese wurden den Banken zum Verhäng­ nis. Der Kern des Bausparens ist Sicherheit und Stabilität (vertraglich abgesicherter Zins). Mit risikobehafteten Investments entsteht die Gefahr diese Leistungsversprechen zu unter­ wandern. Durch die Gesetzesnovellierung werden die Bau­ sparkassen nicht mehr „speziell“ sondern unspe­ zifisch: ein Hybrid aus Bausparkasse und Immo­ bilienbank. Welche Chancen ergeben sich für die Bauspar­ kassen? • Aktive Steuerung: Die Gesetzesnovellie­ rung verspricht mehr Freiheiten und damit auch mehr Unabhängigkeit. Denn durch die größere Auswahl an Anlagemöglichkeiten ist mehr Spielraum gegeben. Hier können Bausparkassen einen Puffer schaffen, um Niedrigzins Verträge oder einen niedrigen Kollektivtopf ausgleichen zu können. • Neue Produkte: Gleichzeitig besteht die Mög­ lichkeit aus den gewonnen Freiheiten neue Produktvariationen zu konstruieren. Klassische Produkte (abgesicherter Zins) könnten nun gepaart mit innovativen Produkten (Niedrig­ zins & Aktienrendite) verkauft werden. Der Kunde entscheidet somit selbst wie viel Risiko er in seinem Produkt eingehen möchte. • Neue Märkte, neue Kunden: Mit der Hybrid-Sonderstellung erhöhen Bausparkassen ihre Reichweite und begegnen neuen Absatzmärkten mit neuen Kundengrup­ pierungen. Zum einen ermöglicht dies einen Fokus auf Neukundengewinnung, zum anderen bietet es eine größere Bandbreite von Produkten für bestehende Kunden an. Dies kann maßgeblich zur Kundenbindung beitra­ gen („alles aus einer Hand“). Bausparkassen werden flexibler in der Ausgestaltung ihrer Produkte bzw. Zielgruppen und positionieren sich noch gezielter für das Thema „Immobilie“. Welche Fähigkeiten werden benötigt, damit Bau­ sparkassen im Zuge einer digitalen Welt diese Neuerungen für sich nutzen können? • Gesellschaftstransformation und damit verbundene, neue Kundenbedürfnisse erkennen: Die Digitalisierung verändert Gesellschaft und Generationen. Eine immer digitaler wer­ dende Gesellschaft ändert die Relevanz zu Planbarkeit und Häuslichkeit. Bisher geht es im klassischen Bausparen nicht um kurzfristige Zinsoptimierung, sondern um langfristige Planbarkeit. Es ist jedoch zu beobachten, dass heranwachsende, jüngere Generationen aber auch bestehende Kundengruppen in Teilen flexibler auf Zeit und Besitz reagieren. Anfor­ derungen an das Bausparen werden indivi­ dueller. Konkrete Use-Cases für verschiedene Segmente sind zu entwickeln, die nicht nur das Alter der Kunden (GenY), sondern insbeson- • dere auch Anforderungen an Besitz, Flexibilität und Risikobereitschaft berücksichtigen. • Digitalen Vertrieb verstehen: Bausparen muss als integraler Bestandteil im Ökosystem Erwerb und Betrieb einer Immobilie stärker verankert und durch digitale Zugangswege das Produkt „Bausparen“ erlebbarer werden. Mögliche Beispiele sind direkter Abschluss mittels App, Push-Nachrichten bei Erreichen bestimmter Sparschwellen oder Darstellung des Status/Füllstand der Ansparphase bzw. des verfügbaren Kredits. So kann das Bausparprodukt weg von einem Push-Produkt (das nur über die Filiale oder die eigene Website ver­ trieben wird), hin zu einem Pull-Produkt (das aktiv vom Kunden nachgefragt wird) entwi­ ckelt werden. • Neue digitale Wertschöpfungsketten schaffen: Erfolgreiche Internetgeschäftsmodelle leben von der Einbindung in das digitale Ökosystem. Eine stärkere Einbindung des Bausparprodukts (z. B. durch Sparanrei­ ze), Verankerung des Bausparens in „Immobilienwelten“ (Airbnb, Ikea, Baumärkte, Gartengestalter/Wintergärten, etc.) würde nicht nur eine größere Reichweite erzielen, sondern auch Cross-Selling Potenziale heben. Bausparen wird somit nicht isoliert, sondern als integraler Bestandteil des konkreten Immobi- lienziels betrachtet. Voraussetzung ist dabei die richtige Wahl der digitalen Partner und Partnersysteme, um eine WIN-WIN Situation zu schaffen. • Alte Wertschöpfungsketten transformieren: In einer digitalen Welt sind neue und ande­ re Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt. Schnelligkeit (Zugriff), Effizienz (Abwick­ lung) und Transparenz (Informationsklarheit) spielen dabei entscheidende Rollen. Diesen Änderungen sind als Bausparkasse Rechnung zu tragen, um sich zukunftsfähig - insbesondere gegen wachsende digitale Konkurrenz zu positionieren. Hierbei sind folgende Kern­ fragen zu beantworten: Fazit: Allein die Gesetzesnovellierung wird je­ doch nicht dazu führen, dass Bausparkassen sich mit dem bisherigen Produkt „Bausparen“ zukunftsfähig positionieren. Erst die Anpassung an die digitalen Anforderungen, ob durch Gesell­ schaft, Kunde, Vertrieb, Partner oder Prozesse ebnet den erfolgreichen Weg in ein langfristiges Ökosystem rund um das Thema Immobilie. Denn Bausparkassen müssen vor allem in der digitalen Welt - in der die wirtschaftliche Wertschöpfung bereits stattfindet und sich digitale, branchen­ fremde Player im Bereich Immobilie erfolgreich platzieren - mithalten können. Die Novellierung sorgt dafür, dass das Spielfeld nun größer wird, aber erst mit der richtigen digitalen Strategie kann dies vielversprechend genutzt werden. Welche Geschäftstätigkeiten können digital effizienter aufgesetzt werden, um das Kundenasset (Spargeld) erfolgreich im Markt einzusetzen und Gewinne erwirtschaften zu können? Welche Fähigkeiten müssen wir gezielt aufbauen und entwickeln, um die neuen Anforderungen zu bedienen? Digitale Anforderungen - auch im Backend - sind einzubeziehen und die dafür notwendigen Fähigkeiten langfristig in der Organisation zu verankern. Autoren: Jan Franz, Julia Tanasic 10 TME Institut | August 2016 InsurTech: Wie Start-ups die Wertschöpfungskette der Versicherungen revolutionieren Der Versicherungsmarkt befindet sich im Wandel. Nach Jahren ohne nennenswerte ­Innovationen am Geschäftsmodell der Versicherungen erfährt die Branche einen deutlichen Weckruf. Es ­entstehen vermehrt junge Unternehmen, die mit innovativen Lösungen sämtliche Bereiche der Versicherungswertschöpfungskette revolutionieren. Globale Versicherungsindustrie ­Herausforderungen steht vor „The industry is in the stone age”. Dieses Zitat von Mark Wilson, CEO von Aviva, dem fünftgrößten Versicherungsunternehmen der Welt, bringt das Problem der weltweiten Versicherungs­branche auf den Punkt. Eine niedrige Innovations­ geschwindigkeit, verglichen mit anderen Indus­ trien wie der Reise- oder Medienbranche, führt dazu, dass die Versicherer schon seit mehre­ ren Jahrzehnten mit einem kaum veränderten ­Geschäftsmodell arbeiten. Doch aktuell kämpfen Versicherer mit stagnierenden bzw. teils sogar sinkenden Beitragseinnahmen, dem aktuellen Niedrigzinsumfeld und unverändert hohen ope­ rativen Kosten. In diesem Umfeld bedrohen ins­ besondere die Digitalisierung und die dadurch bedingten neuen Wettbewerber das klassische Versicherungsmodell. deren Industrien jedoch unterdurchschnittlich.¹ Dies liegt beispielsweise an einer geringen ­Interaktion der Versicherungen mit ihren Kun­ den. In vielen Fällen herrscht nach Vertrags­ abschluss jahre­lange Funkstille zwischen beiden Parteien und die Kunden fühlen sich demzufolge von ihrer ­Versicherung bei zwi­ schenzeitlich aufkommenden Fragen nicht hin­ reichend betreut. Daher ist die Markenloyalität gegenüber ihrer Versicherung oftmals gering. Definition InsurTech Das Wort „InsurTech“ setzt sich aus den Wörtern Insurance und Technology zusam­ men und bezeichnet Start-ups im Versiche­ rungsbereich, die neue Dienstleistungen und / oder Geschäftsmodelle entwickeln. der nächste immense Markt mit einer globa­ len Marktgröße von knapp 4 Bio. US-$² wer­ den, der sich einer Disruption entgegensieht. Definition Disruption Der Begriff „Disruption“ entstammt dem englischen Wort „disrupt“ („zerstören“, „unterbrechen“) und bezeichnet eine Inno­ vation, die das Potenzial hat, bestehende Technologien, Produkte oder Dienstleistun­ gen abzulösen oder teilweise vollständig zu verdrängen. Zwar ist die Zahl der weltweiten InsurTech Start-ups mit ca. 500 ­aktiven Unterneh­ men im Vergleich zu der Größe des Marktes noch gering, allerdings wurden über 50 % dieser Start-ups nach 2012 gegründet und sind demnach weniger als 4 Jahre alt.³ Dies bedeu­ tet, dass es sich im Start-up Umfeld um einen noch recht jungen Bereich handelt, jedoch in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum zu erwarten ist.⁴ Dies bestätigt auch ein Blick auf die ­Investitionen der Venture-Capital-Gesell­ schaften: Weltweit wurden in 2015 rund 2,7 Mrd. US-$ in InsurTech Start-ups investiert, mehr als 3,5-mal so viel wie im Jahr zuvor.⁵ ­Dabei floss der Großteil der Venture Capital (VC)-­ Gelder in InsurTechs aus dem Gesundheits- und Automobilbereich sowie in Start-ups, die Versi­ cherungsmarktplätze anbieten.⁶ Bislang lag der Schwerpunkt der Risikokapitalinvestitionen aller­ dings in den USA, nur 1 % aller VC-Gelder flossen bislang nach Deutschland.⁷ Ursächlich für den bislang niedrigen Innova­ tionsdruck in der Versicherungsindustrie waren zum Großteil die hohen Markteintrittsbarrieren. Diese waren bedingt durch strenge regulatori­ sche Anforderungen, einen hohen Kapitalbedarf und eine, für die Berechnung der Versicherungs­ prämien notwendige, fundierte Datenbasis. Doch technologische Neuerungen wie die verbrei­tete Nutzung von Smartphones und der steigende Einsatz von Wearables im Alltag führen nun dazu, dass die Markteintrittsbarrieren durch die Erfassung fundierter Daten sinken und neue Wettbewerber diese Technologien nutzen. Hinzu kommt die Verbreitung von Internet of Things (IoT)-­Lösungen und die massive Verfügbarkeit von Daten sowie die Möglichkeit, diese nutzen­ bringend auszuwerten. Doch nicht nur die Kundenerwartungen verän­ dern sich, sondern auch das tatsächliche Kunden­ verhalten. Beispielsweise erfreut sich das Prinzip der „Sharing Economy“ seit einigen Jahren einer wachsenden Beliebtheit: Der Trend geht weg vom zwangsläufigen Besitzen von Produkten hin zur reinen Nutzungsmöglichkeit. Außerdem spielen Communities im alltäglichen Leben vie­ ler Menschen eine immer wichtigere Rolle. Dies spiegelt sich auch bei Produktempfehlungen ­wider, da Vergleichs- und Bewertungsportalen beim Kauf eines Produkts bzw. der Inanspruch­ nahme einer Dienstleistung eine hohe Bedeu­ tung bei­gemessen wird. Das sich wandelnde ­Kundenverhalten führt zu einem Bedarf an neuen Produkten, auch auf dem Versicherungs­ markt. Durch die zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen und die rasante Verbreitung von mobilen Endgeräten haben sich auch die Kundenerwartungen an Produkte und Dienst­ leistungen gewandelt. Kunden erwarten heut­ zutage Einfachheit, Transparenz, Mobilität und Geschwindigkeit bei allen zu tätigenden Trans­ aktionen. Gerade in der Versicherungsbranche ist die Kundenzufriedenheit im Vergleich zu an­ Marktüberblick InsurTech Die fehlende Innovationskraft der traditionellen Versicherungsunternehmen, das technologie­ bedingte Sinken der Markteintrittsbarrieren im Versicherungsmarkt sowie sich ändernde Kundenbedürfnisse führen dazu, dass aktu­ ell vermehrt neue Wettbewerber, sogenannte InsurTechs, die etablierten Versicherer her­ ausfordern. Der Versicherungsmarkt könnte Um die verschiedenen Geschäftsmodelle und Dienstleistungen der neu entstandenen und entstehenden InsurTechs zu illustrieren, lohnt ein Blick auf die (vereinfacht dargestellte) Wert­ schöpfungskette der traditionellen Versiche­ rungsindustrie, die von den Start-ups an diversen Punkten angegriffen wird (siehe Abbildung 1). __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ¹ Laut einer Studie von Morgan Stanley „Insurance and Technology: Evolution and Revolution in a Digital World“, 2014. ² McKinsey Insurance Industry Report, 2015. ³, ⁴ VentureScanner „The State of Insurance Technology in Ten Visuals”, 2016. ⁵,⁷ Versicherungsmagazin “Investoren nehmen deutsche Insuretechs ins Visier”, 2016. ⁶ VentureScanner „The State of Insurance Technology in Ten Visuals”, 2016. 11 Neue Geschäftsmodelle entlang der Versicherungswertschöpfungskette Neue Produkte / Services Versicherungswertschöpfungskette Produkt / Service Entwicklung • Research • Distributionskanäle • Produktentwicklung / • Marketing neue Produkte • Cross Selling & • Risikomanagement • • Schadenmanagement Transaktions- • Schadenregistrierung abwicklung • Schadenfeststellung • Pricing • Schadenregulierung Up Selling • Zahlungsprozess • Betrugsmanagement Targeting von • Vertragsänderungen / verschiedenen / neuen -kündigungen Kunden-Gruppen / Märkten Regulatorische Anforderungen P2P-Insurance Vergleichsplattformen Big Data & IoT On Demand Insurance Cyber Risk Insurance Insurance Management v Schadenmanagement Betrugsmanagement Abbildung 1: InsurTechs entlang der Wertschöpfungskette; TME Research 2016 Neben der Entwicklung von neuen Produk­ ten und Dienstleistungen versucht eine wei­ tere Gruppe von InsurTechs, das traditionelle Distributionsmodell der Versicherungen, das oftmals noch nach dem klassischen Makler­ modell funktioniert, neu zu denken. Start-ups wie ­Moneysupermarket und Check24 sowie vie­ le weitere bieten den Nutzern Vergleichsplatt­ formen, um den oftmals sehr undurchsichtigen Versicherungsmarkt für die Nutzer transparenter zu machen. Diese InsurTechs bilden die zahlen­ mäßig größte Gruppe aller Start-ups im Versiche­ rungsumfeld. Dies liegt insbesondere daran, dass die regulatorischen Anforderungen an eine Ver­ sicherung durch Richtlinien wie beispiels­weise Solvency II sehr hoch sind, was es für Start-ups erschwert, als Anbieter einer eigenen Versiche­ rungsdienstleistung in diesen Markt einzudrin­ gen. Beispielsweise implizieren die Solvency II-­ Bestimmungen gewisse Mindestkapitalanforde­ rungen an eine Versicherung, die es erfordern würden – wie im Falle des Start-ups Oscar – bereits in einem sehr frühen Status der Unter­ nehmensentwicklung Kapital von VC-Gesell­ schaften in Höhe mehrerer Hundert Mio. US-$ einzusammeln. Daher konzentrieren sich vie­ le InsurTechs auf Vergleichsplattformen und Marktplatzlösungen, da dort derlei hohe regu­ latorische Anforderungen nicht gelten. Neben der ­digitalisierungsbedingten Veränderung klas­ sischer Distributionskanäle entstehen außerdem neue Märkte, die von Versicherungen abge­ deckt werden können. Das Thema „Cyber Risk ­Insurance“ ist in diesem Zusammenhang ein sehr aktuelles Thema. Es wird erwartet, dass sich der Markt für Versicherungen in diesem Segment bis 2020 verdreifachen wird ¹² und bringt daher in letzter Zeit auch vermehrt InsurTech Start-ups wie das junge Unternehmen BitSight hervor. __________________________________________________ __________________________________________________ ⁸ https://www.appsichern.de/ ⁹ https://www.friendsurance.de/ ¹⁰ https://www.hioscar.com/ ¹¹ Crunchbase ¹² PricewaterhouseCoopers, „Insurance 2020 & beyond“, 2015. Marketing / Sales Vertragsverwaltung Marketing & Sales Unternehmensinfrastruktur (Finanzen, IT, Risk Management, HR) Angriff der Wertschöpfungskette durch InsurTechs Vor allem auf der Produktseite werden durch aufkommende InsurTechs neue Lösungen ent­ wickelt, die auf das sich verändernde Konsu­ mentenverhalten angepasst sind. Längst sind Unternehmen, die sich auf die ausschließliche Versicherung aller Art elektronischer Geräte wie Smartphones oder Tablets spezialisieren, gang und gäbe. Zudem entstehen durch den anhal­ tenden Trend der Sharing Economy neue Ver­ sicherungsprodukte, die sich den wandelnden Be­ dürfnisse der Nutzer anpassen. ­Start-ups wie die Situative GmbH mit ihrem Produkt ­„Appsichern “⁸ bieten ihren Kunden ­einen flexiblen, nutzungs­ bedingten Versicherungsschutz für ausgewähl­ te Situationen und einen befristeten Zeitraum. Beispielsweise bietet das junge Unternehmen eine Schadenversicherung für die Nutzung von Carsharing-Angeboten, die im Falle eines Unfalls die sonst vom Nutzer zu zahlende Selbstbeteili­ gung übernimmt. Des Weiteren gibt es immer mehr junge Unternehmen, die den Community-­ Gedanken in den Vordergrund stellen und das Thema P2P-Versicherungen adressieren. Ein Bei­ spiel ist das deutsche ­Start-up Friendsurance⁹, das 2010 in Berlin gegründet wurde. Das Ge­ schäftsmodell von Friendsurance funktioniert folgendermaßen: Mehrere Versicherte schlie­ ßen sich zu einer Gruppe zusammen und zahlen die Versicherungsbeiträge, die gemeinsam in einen Topf fließen. Bleibt die Gruppe schaden­ frei, erhält jedes Gruppenmitglied einen Teil des Versicherungsbetrags zurückerstattet. Die Versi­ cherungen profitieren von einer höheren Scha­ denfreiheit und die Versicherungsmitglieder von einer laut Angaben des Start-ups bis zu 40 %-igen Rückzahlung ihres Beitrags. Einen völlig neuen Ansatz im Bereich der Krankenversicherung bie­ tet Oscar¹⁰, ein US-­amerikanisches Start-up, das im Jahr 2013 gegründet wurde und bis heute be­ reits mehr als 700 Mio. US-$ Wagniskapital ein­ sammeln konnte.¹¹ Oscar bietet seinen Kunden eine innovative Krankenversicherung und rückt dabei das Kundenerlebnis in den Vordergrund. Dabei ist Oscar eine 100 % Onlineplattform, die es Kunden unter anderem ermöglicht, innerhalb weniger ­Minuten der Versicherung beizutreten, per Google Maps einen geeigneten Arzt mit ent­ sprechenden Referenzen in der Nähe zu suchen sowie gebührenfreie Telefonate mit Ärzten aus dem Netzwerk von Oscar führen zu können. Vertragsverwaltung Ein weiterer Bereich, der sich aufgrund der ge­ ringeren Regulierungsproblematik wachsender Beliebtheit erfreut, ist das Geschäftsmodell des Versicherungsmanagers. Unternehmen wie das Schweizer Start-up Knip, das im Jahr 2013 ge­ gründet wurde, bieten dem Nutzer die Möglich­ keit, die eigenen Versicherungen übersichtlich und vollständig digital in einer App zu verwalten und auf Wunsch die Tarife optimieren zu las­ sen. Während neue Technologien einen Einfluss auf alle Bestandteile der Versicherungswert­ schöpfungskette haben werden, wird einer der größten Effekte auf die gesamte Versicherungs­ landschaft zukünftig von Big Data- sowie IoT-­ Lösungen ausgehen, die insbesondere die Art verändern werden, wie Risiken gemessen und schließlich bepreist werden. Bislang basierten die Risikomodelle der Versicherungen auf statis­ tischen Modellen, die Daten von vergangenen Ereignissen einbeziehen und darauf aufbauend Zukunftsprognosen für Risiken erstellen. Durch die Nutzung von Big Data-Lösungen werden in Zukunft jedoch nicht nur vergangenheits­basierte Daten zur Risikoanalyse zum Einsatz kommen, sondern auch neue Datenströme, die beispiels­ weise durch Connected Devices generiert wer­ den, und eine genauere Risikoeinschätzung er­ lauben. 12 Schadenmanagement Das Schadenmanagement ist der Teil der Wert­ schöpfungskette einer Versicherung, der zum größten Unmut bei den Kunden führt. Doch auch hier gibt es innovative Lösungen von ­InsurTech Start-ups wie Claimable. Durch eine cloud-­ basierte Software wird es den Versicherungen erleichtert, Schäden zu managen, und dadurch Zeit und Kosten zu reduzieren. Außerdem wird die Kundenzufriedenheit erhöht, da Kunden sich ebenfalls auf der Plattform von Claimable einlog­ gen und den Fortschritt der Versicherung bei der Bearbeitung ihres Schadens verfolgen können. Viele Anrufe beim Customer Support bleiben so erspart. Auch beim Thema Betrugsmanagement lässt sich ein weiteres Anwendungsfeld für Big Data-Technologien erkennen: Die Auswertung komplexer Daten ermöglicht es, Versicherungs­ betrug schneller zu erkennen bzw. sogar gänz­ lich zu verhindern. Auf dieses Feld konzentriert sich beispielsweise das Start-up Shift Technology. In Bezug auf IoT-Technologien ist Telematics die derzeit am weitesten entwickelte IoT-Appli­ kation im Versicherungsumfeld. Start-ups wie ­Insurethebox nutzen Telematics in Autos, um gefahrene Kilometer sowie das Fahrerverhalten zu tracken und so eine genauere Grundlage für die Bepreisung der Versicherungspolice zu erhal­ ten. In Zukunft ist eine Ausweitung von IoT-Tech­ nologien im Versicherungsumfeld zu erwarten. Insbesondere besteht großes Potenzial durch die vermehrte Nutzung von Wearables, beispielswei­ se im Gesundheitsbereich, sowie die Verbreitung von Smart Home-Lösungen. Empfehlungen und Ausblick Die Wertschöpfungskettenanalyse hat gezeigt, dass InsurTechs mit ihren innovativen Lösungen die traditionelle Versicherungsbranche ernsthaft Autoren: Stefan Roßbach, Lisa Hilberg 13 herausfordern. Doch wie können sich Versiche­ rungsunternehmen zukunftsfähig aufstellen? Omni-Channel Ansatz: Kunden erwarten auf sie zugeschnittene Lösungen, auf die sie bequem überall und zu jeder Zeit zugreifen können. Ver­ sicherungsdienstleistungen sind an diese verän­ derten Kundenbedürfnisse anzupassen und der Kunde ist dort abzuholen, wo er sich gerade be­ findet. Dieser Prozess findet dabei nicht erst auf der Versicherungswebsite oder beim Versiche­ rungsmakler statt, sondern beginnt bereits bei der Suche des Kunden nach einer Versicherung, beispielsweise bei einer Vergleichsplattform. Zusammenfassend geht es darum, den Kunden kanalübergreifend an diversen Touch Points ab­ zuholen und diese nahtlos aufeinander abzustim­ men. Customer Experience: Eng damit verbunden wird auch das Thema „Customer Experience“ in Zukunft eine immer größere Rolle spielen, gerade auch, um die Markenloyalität der Kun­ den gegenüber ihrer Versicherung zu erhöhen. Die intensivere Interaktion mit ihren Kunden und die Schaffung einer sinnvollen Kombination von offline- und online-Kanälen ist dabei Grund­ voraussetzung. Dabei werden insbesondere ­Online-Kanäle wie Video-Beratungen sowie Chatfunktionen eine zunehmend wichtigere Rolle einnehmen. Außerdem sind die typischen „Pain Points“ für den Kunden, die insbeson­dere im Bereich Schadenmanagement liegen, auf Ver­ sicherungsseite zu reduzieren, beispielsweise durch eine höhere Transparenz und eine bessere Informationsgrundlage für den Kunden. Steigerung von Effizienz und Effektivität: Um dem steigenden Kostendruck in der Versiche­ rungsbranche standhalten zu können, ist ein starkes Augenmerk auf die höhere Effizienz von Back-End Prozessen zu legen. Durch die Auto­ matisierung von Schadenmanagement- und ­anderen Prozessen sowie durch die Bereitstel­ lung eines größeren Angebots an Self-Service Leistungen für Endkunden lassen sich Zeit und Kosten einsparen. Investition in Zukunftstechnologien: Bezogen auf die technologischen Neuerungen, die den Versicherungsmarkt in Zukunft grundlegend verändern werden, sind die Themen Big Data sowie Internet of Things in den Fokus ihrer ­Investitionsüberlegungen einzubeziehen. Diese Technologien haben das Potenzial, Versiche­ rungskernbereiche wie Risikoanalyse, Pricing, Kundensegmentierung sowie Betrugsmanage­ ment signifikant zu verbessern. Ob die Versiche­ rungen diese Technologien selbst entwickeln, Kooperationen mit InsurTechs eingehen oder Start-ups akquirieren, bleibt jeder Organisa­ tion selbst überlassen. Aktuell sind vermehrt ­Acceleratoren-Programme zu beobachten, die von Versicherungen wie der Allianz ins Leben gerufen werden sowie Corporate Venture ­Capital Fonds wie der neu aufgelegte Fonds der AXA. Nennenswerte Eigenentwicklungen sind noch nicht erkennbar. Förderung von Innovationen innerhalb der Organisation: Unabhängig davon, wie sich die Ver­ sicherungen im Kontext dieser „Make or Buy“Fragestellung entscheiden, wird es wichtig sein, eine Umwelt zu schaffen, die Innovation inner­ halb der Organisation fördert und eine ­aktive Kollaboration auch zwischen den verschiedenen Unternehmenseinheiten und Funktionen ermög­ licht. TME Institut | Oktober 2016 Permission Based Marketing trifft Banking Mehrwert-Banking auf ausdrücklichen Wunsch Der Finanzsektor befindet sich derzeit in einem starken Umbruch. Die früher statischen und­ ­transaktionsorientierten Geschäftsmodelle der Banken wandeln sich zu ­einem ­komplexen, ­individuellen und kundenzentrierten Modell. Das vordergründige Ziel dieses ­Modells ist es, dem ­Kunden oder Interessenten maßgeschneiderte Produkte und Leistungen zur ­richtigen Zeit, am ­richtigen Ort und im richtigen Umfang zur Verfügung zu stellen. Dabei sind­­ Hintergrundinformationen über den jeweiligen Kunden oder Interessenten das Kapital und der Treiber, um dem Kunden ­relevante Hinweise zur Optimierung seiner Finanzsituation zu geben. ¹ Gyaneshwar Singh Kushwaha , Shiv Ratan A ­ grawal, 2016 Smart Data vs. Big Data Hypothese Sammeln und aggregieren aller verfügbarer Daten A/B-Tests Kundenakzeptanz Datenanalyse mit großer Rechnerintensität Algorithmen für konkrete Anwendungen Unerwartete Korrelationen Flexible Dateninfrastruktur „nach Maß“ A/B-Tests Sammeln der erforderlichen Daten Big ip _______________________ Nutzer fühlen sich verstanden und lesen mit mehr Interesse, ob es nicht noch bessere, rinz a-P Dat Permission Based Banking muss sich als Zielset­ zung mit dem "Lieblingsitaliener" vergleichen. Dieser weiß, welchen Wein seine Kunden am liebsten trinken und welche Essensvorlieben sie Beim Permission Based Marketing geht es in der Regel darum, Interessenten oder Kunden durch bedarfsgerechte Informationen einen hohen Nutzen zu bieten. Der Nutzen stellt sich durch konkrete Inhalte und Informationen über Pro­ dukte oder besondere Preisvorteile dar, die dem Benutzerprofil sehr nahekommen und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, angesehen zu werden. Durch große Datenmengen und Ansammlung spezifischer Kundenaktivitäten („Big Data“) ­haben Anbieter die Möglichkeit, über verschie­ dene Analysemethoden wertvolles Wissen über die Kunden aufzubereiten. „Es kommt nicht auf das Datenvolumen an, sondern auf die richti­ gen Daten in der richtigen Varianz“². Intelligente ­Algorithmen wählen der Situation entsprechend, also medium-, inhalts- und nutzerabhängige ­Informationen (Smart-Data-Prinzip, siehe Grafik) aus, und verteilen diese auf die relevanten Inter­ aktionspunkte (Touchpoints). art Ein weiteres Beispiel einer digitalen Anwen­ dung, die Hintergrundinformationen nutzt, um dem Kunden einen Mehrwert zu generie­ ren, ist Foursquare, welches durch Ortungs­ dienste einem Nutzer regional und situations­ bedingt Informationen seiner Umgebung anzeigt. Hierbei erhält der Nutzer Hinweise über­­ z. B. das beste Restaurant, die nächste Tankstelle oder einen freien Parkplatz in der Nähe. Permission Based Marketing als gegenteiliger Effekt einer breiten Werbung Die aktuelle Entwicklung des Nutzerverhaltens zeigt ein Interesse an individuellen Ansprachen und den, aus der Sicht des Kunden, Mehrwert­ nutzen durch gezielte Analysen und Empfehlun­ gen. Sm Um diese Hintergrundinformation zu nutzen, muss der Nutzer zunächst seine Einwilligung zur zielorientierten Auswertung seines Profils ertei­ len. Insbesondere im Social Media wird dies frei nach dem Motto „Wenn schon Werbung, dann aber bitte sinnstiftend und bedarfsgerecht“ sehr häufig akzeptiert. Sind Nutzer von der Sinnhaf­ tigkeit dieses Marketing-Tools überzeugt, führen Produktplatzierung überdurchschnittlich häufig auch zum Kauf des Artikels.¹ Das Vertrauen des Kunden oder Interessenten zu gewinnen ist somit eine der Hauptaufgaben des Permission Based Banking. ip Der Kunde weiß am besten was er benötigt – und in den Momenten, in denen er es nicht weiß, kann ihn ein System oder Tool unterstüt­ zen, es herauszufinden. Nach diesem Motto ist im ­Retail-Geschäft schon seit langer Zeit ziel­ gerichtete Werbung geschaltet. Amazon, der Online-Händler mit dem größten Marktanteil weltweit, nutzt dieses Prinzip beispielsweise durch ausgewählte Werbeeinblendungen in den Rubriken „Andere Kunden haben gekauft…“ oder „Ähnliche Produkte“. Diese Werbemaßnah­ men zielen auf ein bestimmtes, im Vorfeld durch ­Ansehen oder Kaufen eines Artikels, aufgenom­ menes Interesse des Kunden ab. Jeder Kunde er­ hält hierdurch eine individualisierte und auf ihn zugeschnittene Werbung, die lediglich Angebote seines Interessengebietes zulässt. haben. Gerne kommt man als Kunde wieder, da auf persönliche Wünsche eingegangen und auf Empfehlungen vertraut wird. inz -Pr a t Da Mehrwert durch Mehrwissen Lösung Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bloching, Björn; Luck, Lars; Ramge, Thomas, 2015 _______________________ ² Bloching, Björn; Luck, Lars; Ramge, Thomas, 2015 14 günstigere oder inhaltstiefere Angebote gibt, die noch genauer auf ihr persönliches Anforderungs­ profil passen. Ein Vorteil der Individualisierung von Werbe­ maßnahmen ergibt sich auch auf der Seite des ­Werbenden: Durch die Verringerung von Streuverlusten können Werbekosten minimiert werden, da Kundengruppen, die nicht in die Zielgruppe der Werbemaßnahmen passen, von vornherein nicht angesprochen werden.³ Zielgruppenabdeckung und Streuverluste Marketingzielgruppen Medienpublikum Zielgruppenabdeckung Streuverluste Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hofsäss / Engel, 2003 Permission Based Marketing im Banking Der Banking-Vertrieb findet, analog zum ­Retail-Vertrieb großer Handelsketten, vermehrt über Online-Medien statt. Zwar ist die ­Filiale derzeit noch der wichtigste Vertriebskanal. An zweiter Stelle der am häufigsten genutzten ­Vertriebskanäle steht jedoch schon die eigene Onlinepräsenz, über die Informationen eingeholt und zum Teil auch Vertragsabschlüsse gemacht werden. Ein Ausbau der eigenen Plattformen mit integrierter Onlinepräsenz, Anwendungen für Mobile ­Devices sowie Präsenz in Online-­ Vergleichsportalen wird also ein immer wichtige­ rer Teil des M ­ arketings im Banking-Bereich. Somit unterscheidet sich die Ansprache der Kun­ den nicht maßgeblich von der eines Online-Shops oder einer Vergleichsplattform. Neben der ­Onlinepräsenz erwartet der Kunde jedoch auch eine 100%ige Anpassung und Individualisierung des Angebots an seinen Bedarf. Kunden­daten müssen präzise aufgearbeitet werden, um das Vertrauen des Kunden nicht zu verlieren.⁴ In diese Richtung tendieren auch die Vermö­ gens- und Finanzpläne, die viele Banken ihren Kunden seit Jahren anbieten. Die Erhebung der aktuellen Situation soll Finanzlücken oder finan­ zielle Risiken aufdecken und der Bank die Mög­ lichkeit geben, dem Kunden ein speziell darauf ausgerichtetes Produkt anzubieten. Die logi­ sche Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten ­Betreuung und Beratung des Kunden ist, das ­Permission Based Marketing im Banking auch in Alltagssituationen, z. B. im Online Banking oder bei Bezahlvorgängen im Internet einzubinden. Mögliche Kundenszenarien für Permission ­Based Banking Permission Based Banking kann auf Basis der Kundendaten zum Beispiel Geldanlage- oder Versicherungsangebote unterbreiten, die auf die ­individuellen Risikoneigungen der Kunden­ bedürfnisse zugeschnitten sind. Zur Unterstüt­ zung von Kundenbindung und -zentrierung muss das Stichwort lauten: "Smart Advice". ³ Hofsäss, Michael; Engel, Dirk, 2003 ⁴ Schwarz, Torsten 2005 15 • Wie erreiche ich neue Kunden und wie bewe­ ge ich diese zum Opt-In? • Wie hebe ich mich von der Konkurrenz ab? ­ ifferenzierung wird immer schwieriger, da D der Kunde seine neue Macht, den transparen­ ten Markt, ausnutzt. Wie generiere ich Allein­ stellungsmerkmale? • Welche Maßnahmen müssen ergriffen wer­ den, um Bestandskunden zu halten? • Der Bestandskunde bekommt über sein per­ sönliches Online Banking ein individuelles ­Angebot einer Baufinanzierung. Dieses wurde automatisch im Hintergrund über die vorhan­ denen Informationen des Kunden (Netto-Kalt­ miete, Stromkosten sowie weitere Immobi­ lien-nahe Informationen) ­kalkuliert. Unter dem Motto „Sie zahlen aktuell X-Betrag an ­Ihren Vermieter und könnten mit dem gleichen Aufwand eine 3-Zimmer ­Eigentumswohnung ganz in ihrer Nähe schon heute Ihr Eigentum nennen.“ • Analyse der Ausgaben (z. B. über ein Personal Finance Manager Tool) mit dem Zweck dem Kunden hinterher darzulegen, dass er eine ­Unfallversicherung bei dem Anbieter X zu bes­ seren Konditionen erhält. • Bestandskunden wird automatisch eine Um­ schuldung des Kontokorrentkredits ange­ boten, wenn dieser über mehrere Wochen ­dauerhaft überzogen bzw. ausgereizt ist. So wird dem Kunden wieder finanzieller Freiraum zu günstigeren Konditionen angeboten. Neben Situationen im Online Banking lässt sich das Prinzip leicht weiter auf verschiedene Pro­ dukte adaptieren. Welche Aspekte sind zu beachten? Anhand des Lebenszyklus lassen sich die Kern­ fragen für eine Bank ableiten, wie Permission ­Based Banking im Sinne des Kunden eingesetzt werden kann. Bei der Beantwortung der Fragen sollte der Slogan „Permission ­Based Banking – Ansprache nur auf ausdrücklichen Wunsch“ beim Betrachter immer präsent sein. 1. Neukunden / Bestandskunden (Opt-In) 5. Auswertung / Analyse Lebenszyklus Quelle: TME AG Research, 2016 2. Informationen / Produkte entwickeln • Welche Bedürfnisse gilt es mit welchen Pro­ dukten zu bedienen? • Es gilt, ein Ziel des Angebotes zu definieren, um die Aktion später besser auswerten zu kön­ nen. 3. Zielgruppendefinition • Wer gehört zu welcher Zielgruppe? Möchte ich bestimmte Altersgruppen ansprechen oder Kunden mit gleichen Produkten und Kondi­ tionen? Dadurch werden die Produkte auf die Abonnenten der angestrebten Kampagne ­fokussiert. 4. Zielgruppenansprache • Definition des Vertriebskanals, auf welchem die Zielgruppe angesprochen werden soll. • Festlegung, welcher Ansprachetypus in wel­ chem Kanal und zu welchem Zeitpunkt am sinnvollsten ist (visuell, textlich, animiert, ­contentbezogen, situationsbezogen, etc.). 5. Auswertung / Analyse • Die Auswertung erweitert den Wissenspool bei der Neu- oder Weiterentwicklung der ­Werbekampagnen sowie den Prozessen und Funktionen. • Des Weiteren lassen sich Best-Practice-Ansät­ ze für die nächste Kampagne herauskristalli­ sieren. • Neustart des Zyklus anhand der Erkenntnisse. Da es im stark umkämpften Bankensektor schwierig ist, Kunden zu gewinnen bzw. zu bin­ den, können Banken durch Nutzung dieses ­Marketing-Tools einen Vorsprung generieren. Das gelingt jedoch nur, wenn Werbung nicht gleich Werbung bleibt, sondern Werbung in "smart A ­ dvice" konvertiert wird. Lebenszyklus 4. Zielgruppen ansprechen _______________________ 1. Neukunden / Bestandskunden (Opt-In) 2. Informationen / Produkte entwickeln 3. Zielgruppendefinition Voraussetzungen des Permission Based ­Banking Die „Werbe-Ansprache“ ist in Deutschland im ­Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) von 2004 geregelt. Gemäß ­§ 7 Abs. 2 UWG stellt es für den Verbraucher eine unzumutbare Belästigung dar, wenn er ohne seine vorherige ausdrückliche Einwilligung Werbung per E-Mail oder Telefon erhält. Kontaktiert der Werbetrei bende einen Verbraucher ohne dessen Werbe­ einverständnis („Opt-In“) stellt dies eine Wett­ bewerbsverletzung dar. Dies gilt sowohl für den E-Mail- als auch den Telefonkanal. Für den Post­ weg ist kein Werbeeinverständnis erforderlich. Beim Permission Based Marketing gibt der ­Kunde seine ausdrückliche Erlaubnis, in bestimmten Angeboten und Informationen personalisierte Werbung zu erhalten. Nur wenn der Kunde vor­ her „ja“ gesagt hat, können weitere Aktionen ­anlaufen (Opt-In- / Double-Opt-In-Verfahren). Die Aufgabe besteht nicht nur aus Einholen, Verar­ beiten und Ausbau dieser Einwilligung, sondern insbesondere auch aus einer rechtskonformen Nachweisbarkeit der individuellen Einwilligung. Dies muss beispielsweise durch technische ­Prozesse im Rahmen eines ­IT-gestützten Daten­ nutzungsmanagements sichergestellt werden und persönliche Daten müssen rechtskonform gespeichert sowie auf Kundenwunsch jederzeit gelöscht werden können. So ist der Kunde eigenverantwortlich und kann selbst steuern, ob er die Angebote erhalten oder in Zukunft diese Leistung nicht mehr in Anspruch nehmen möchte. Es zählt die klare Kommunika­ tion, wofür die Bank die individuellen Daten analysieren will und was daraus der konkrete und verständliche Mehrwert für den Kunden ist. Nur dann wird ein Kunde der Nutzung auch ein­ willigen. Er akzeptiert Hinweise zur Optimierung ­seiner Finanzsituation, und nicht Produktange­ bote, die er zusätzlich "kaufen" soll.Dabei ist es auch essentiell, nicht nur das Werbemedium „E-Mail“ zu wählen. Die Überschwemmung mit Spam- und Phishing-Mails hat diese Form der Kundenansprache maßgeblich verschlechtert. Vielmehr muss eine Ansprache der konkreten aktuellen Bedarfssituation des Kunden angepasst und diese auf diverse Medien verteilt werden. Nutzung persönlicher Daten Bankgeschäfte sind mehr als alle anderen The­ men mit den Aspekten Vertraulichkeit und ­Datenschutz verbunden. Diese Merkmale kön­ nen und müssen Banken bewusst als Stärke ein­ setzen, um Kunden zu gewinnen und zu halten. Banken müssen schon dann an den Datenschutz denken, wenn sie neue Produkte entwickeln. Sie sollten ihren Kunden eine angemessene Gegen­ leistung bieten, sie über die Verwendung ihrer Daten informieren und selbst kontrollieren las­ sen, was mit ihren persönlichen Informationen geschieht.⁵ Trotz des Potenzials, welches Per­ mission Based Banking bietet, schrecken viele Banken davor zurück, Kundendaten für maßge­ schneiderte Vertriebslösungen einzusetzen. Mit Permission Based Banking kann die Bank mit den schon vorhandenen Daten und Informationen im gesetzlichen Spielraum für neue Geschäfts­ modelle und Produkte werben. Nicht nur die Werbeansprache, auch die Nut­ zung personalisierter Daten ist nur mit Einwilli­ gung des Kunden rechtssicher möglich – „Legal Big Data“. Verankert sind diese Regularien in der EU-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), in der EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kom­ munikation (2002/58/EG) sowie national im Bundesdatenschutzgesetz. Werden personen­ bezogene Daten, definiert in § 3 Abs. 1 BDSG, zum Zwecke der Werbung verwendet, muss nach­ § 28 Abs. 3 BDSG dafür auch die ausdrückliche Einwilligung des Nutzers vorliegen (Opt-In). ­Hinzu kommt, dass die Unternehmen und Banken das höchste Vertrauen der Kunden erhalten, wenn sie freiwillig die wichtigsten Datenschutzrichtlini­ en ermitteln und umsetzen. Damit sichert man sich nicht nur juristisch ab, sondern signalisiert dem Kunden auch ein klares Statement, welches einen Wettbewerbsvorteil vor anderen darstellt.⁶ Erfolgsgarantie durch individualisiertes Marketing E-Mail und Newsletter scheinen nur bedingt das ideale Medium für Permission Based Banking zu sein. E-Mail-Marketing erlaubt zwar als einziges ­digitales Marketing-Instrument, einen langfris­ tigen, nachhaltigen, personalisierten und damit besonders wertschöpfenden Dialog entlang des ­gesamten Customer Life Cycle zu führen. Außer­ dem ist es für die Verbraucher per E-Mail beson­ ders einfach, sich bei den für sie interessanten Angeboten „einzuklinken“ bzw. diese bei Nicht­ gefallen wieder zu verlassen. Der große Nachteil der personalisierten Ange­ botsbereitstellung per E-Mail liegt jedoch in der hohen Anzahl an missbräuchlich genutzten E-Mails. Laut dem IT-Spezialisten Kaspersky konn­ ten im 1. Quartal des Jahres 2015 59,2 % aller versendeten E-Mails als Spam verbucht werden. Dies bedeutet zwar einen Rückgang um etwa­ 6 Prozentpunkte, verglichen mit den Zahlen zum Vorjahr, jedoch ist die Akzeptanz der Kunden ge­ genüber Werbe-E-Mails weiterhin niedrig. Stattdessen kann heute über bereits installier­ te Applikationen auf dem Smartphone und die individuell festgelegten Push oder Standort-­ Notifications, ein Mehrwert für den Kunden generiert werden. Die Grafik "Push-Notification-­ Einstellungen nach Branchen" zeigt, dass über alle Industrien hinweg Push Notifications ange­ wendet werden. Diese zeigen gerade im Banken­ sektor die höchste Effektivität. Dies wäre der neue Weg, Permission Based ­Banking zu betreiben, ohne auf die in Verruf ge­ ratenen E-Mails zurückgreifen zu müssen. Gegenüberstellung Die Pro-Contra-Argumentation aus Sicht der Ban­ ken soll dem Entscheidungsträger bei der _______________________ Push-Notification-Einstellungen nach Branchen @ 12 12 E-Commerce 14 Social Media 25 Nahrungsmittel 30 Taxi & Car Sharing 26 19 Unterhaltung 28 Reisen Sport 40 Financial Services Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an eine Auswertung von Kahuna in % I­mplementierung eines Permission-Based-­ Banking-Instruments unterstützen. Neben den Kosten, die für eine Marketing-­ Kampagne anfallen, sollten weitere Aspekte be­ achtet werden. So eignet sich nicht jedes Produkt für eine Werbemaßnahme im Permission Based Banking. Sehr wohl kann aber anstatt ­einer ­Werbemaßnahme auf ein persönliches Bera­ tungsgespräch oder eine Vergleichs-Empfehlung hingewiesen werden. Darüber hinaus muss bei der Konzeptionierung auf die Aufrechterhaltung des Images eines ­Unternehmens Wert gelegt werden. Nicht selten kommt es zu einer Verärgerung des Kunden auf­ grund von Werbung oder Ansprachen, die nicht in das Profil des Kunden passen. Auf der anderen Seite bieten sich neue Interak­ tionsmöglichkeiten mit dem Kunden. Im Detail bedeutet dies, dass eine individuellere Anspra­ che der Zielgruppe erfolgen kann. Ein gutes Gefühl beim Kunden, nicht mit Werbung über­ schwemmt zu werden, sondern individuell digital und smart beraten zu werden, stärkt die Reputa­ tion des Unternehmens. Zudem bekommt die Bank die unmittelbare Resonanz des Kunden und kann durch verschiedene Analysen eine sofortige ­Erfolgskontrolle beginnen. Daher gilt: Wer sein Angebot aus den Fluten an Werbebotschaften hervorheben möchte, hat mit ⁵,⁶ Morey, Timothy; Forbath, Theo; Schoop Allison, 2015 16 zielgerichteter Ansprache über digitale Devices im Gegensatz zum Massenversand von Werbung und E-Mails wesentlich bessere Chancen, die (verdiente) Aufmerksamkeit zu erlangen. Es zeigt sich, dass Permission Based Marketing im Banking sowohl auf Seiten des Werbenden als auch auf der Seite des Nutzers aufgrund der dar­ gestellten Thematiken einen enormen Mehrwert und Nutzen bietet. Ausblick Die verbreitete Digitalisierung in allen Branchen verändert Märkte, Nutzer, Angebot, Nachfrage und damit verbunden auch die Spielregeln der Marketingaktivitäten. Beispielsweise zeigt sich, dass auch im ­Healthcare-Bereich Veränderungen durch neue Marketing-Tools bevorstehen. Verschiedene Krankenkassen interessieren sich schon heute für Informationen von verschiedenen Fitness­ trackern, von Wearables wie der Apple Watch oder digitalen Informationen aus dem Fitness­ studio. Anhand dieser Information lässt sich auch in dieser Branche das Instrument ­Permission Based Marketing hervorragend anwenden und Gesundheitsempfehlungen, unterstützende ­Gesundheitsprodukte, Arztbesuche bei auffälli­ gen Gesundheitswerten bis hin zur maßgeschnei­ derten Krankenversicherung angeboten werden. Im Finanzsektor ist das Thema Permission Based Marketing generell noch recht neu. Da jedoch die Vorteile, Bankgeschäfte und Produkte ziel­ kundenorientiert anzubieten, überwiegen und sich der Nutzer durch maßgeschneiderte Werbe­ platzierung im Retail-Geschäft an eine solche Form des Marketings gewöhnt hat, wird eine Digitalisierung in diesem Bereich nicht die letzte Ausbaustufe des Permission Based Banking sein. Mit der im Oktober 2015 erweiterten Zahlungs­ diensterichtlinie (PSD2), die eine rechtliche Grundlage für die Schaffung eines EU-weiten Binnenmarkts für den Zahlungsverkehr bietet, nimmt sich auch bereits die EU diesem The­ ma an. In der Richtlinie wird unter anderem der EU-Zahlungsverkehrsmarkt für sogenannte ­„Zahlungsauslösedienstleister“ und „Kontoinfor­ mationsdienstleister“ weiter geöffnet. Dahinter verbergen sich Dienstleister, die Zahlungsdiens­ te für Verbraucher oder Unternehmen auf der Grundlage des Zugangs zu Informationen über das Zahlungskonto und einzelne Transaktio­ nen erbringen wollen. Zudem werden über die ­Novellierung der Richtlinie die Verbraucher­ rechte gestärkt und die Berechnung von Auf­ schlägen (z. B. zusätzliche Kosten für Kartenzah­ lungen) untersagt. Die PSD2-Richtlinie muss bis zum 13. Januar 2018 in allen EU-Ländern umge­ setzt werden.⁷ Ein guter Zeitpunkt, um auch das eigene Bank­ angebot im Sinne von PBB-Ansätzen zu überden­ ken. _______________________ ⁷ European Commision, 2015 Autoren: Stephan Paxmann, Jan Franz 17 Literatur Bloching, Björn; Luck, Lars; Ramge, Thomas, 2015: SMART DATA – Datenstrategien, die Kun­ den wirklich wollen und Unternehmen wirklich nützen European Commision, 2015: Europäisches Parla­ ment nimmt Vorschlag der Europäischen Kom­ mission für mehr Sicherheit und Innovation bei europäischen Zahlungen an Gyaneshwar Singh Kushwaha , Shiv Ratan ­Agrawal, 2016: „The impact of mobile marketing initiatives on customers’ attitudes and behaviou­ ral outcomes“, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 10 Iss: 3, pp.150 – 176 Hofsäss, Michael; Engel, Dirk, 2003: Verringe­ rung von Streuverlusten durch personalisiertes Ansprechen von potentiellen Kundengruppen, Seite 193 Kuhuna: Push Notification Engagement by indus­ try http://andrewchen.co/new-data-on-push-no­ tification-ctrs-shows-the-best-apps-perform-4xbetter-than-the-worst-heres-why-guest-post/ Morey, Timothy; Forbath, Theo; Schoop Allison (HARVARD BUSINESS MANAGER), 2015: Wann Kunden Ihre Daten preisgeben Torsten Schwarz, 2005: Leitfaden Permission Marketing: Werbung die ankommt TME Institut | Dezember 2016 Mehr digitaler Wettbewerb bei Banken und ­Finanzdienstleistern durch PSD2 - Wichtige ­Details zur ­Kontoschnittstelle lassen noch auf sich warten Am 12. Januar 2016 trat die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) in Kraft. Ein Jahr ­später plant die EBA (European Banking Authority) nun Anfang 2017 mit den „Regulatory ­Technical ­Standards on strong customer authentication and secure communication under PSD2“ – kurz RTS, die daraus abzuleitenden Anforderungen an eine technische Schnittstelle nachzureichen. Der ­digitale Kontozugriff durch Dritte soll so zukünftig geregelt werden. Derzeit bestehen jedoch in vielen Punkten noch Unklarheiten. PSD2 - Die neuen Vorschriften bringen ­unter anderem folgende Änderungen:¹ • Es werden strenge Sicherheitsanforderun­ gen für die Auslösung und Verarbeitung elektronischer Zahlungen und den Schutz der Finanzdaten der Verbraucher einge­ führt; • der EU-Zahlungsverkehrsmarkt wird für so­ genannte „Zahlungsauslösedienstleister“ und „Kontoinformationsdienstleister“ ge­ öffnet; das sind Dienstleister, die Zahlungs­ dienste für Verbraucher oder Unternehmen auf der Grundlage des Zugangs zu Informa­ tionen über das Zahlungskonto erbringen; • die Verbraucherrechte werden in zahlrei­ chen Bereichen gestärkt, etwa durch die Verringerung der Haftung für nicht autori­ sierte Zahlungsvorgänge und die Einführung eines bedingungslosen Erstattungsrechts bei Lastschriften in Euro (ohne dass Fragen gestellt werden) und • die Berechnung von Aufschlägen (zusätz­ liche Kosten für das Recht, z. B. mit einer Karte zu bezahlen) wird untersagt, und zwar unabhängig davon, ob das jeweilige Zah­ lungsinstrument in einem Geschäft oder ­online genutzt wird. Warum ist ein Standard Bankdienstleistungen im Kontext PSD2 überhaupt notwendig? Zahlungsauslösedienst Deckungsabfragedienst Dridienst Shop Käufer Einige Anbieter ermög­ lichen bereits heute den Zugriff auf das Online ­Banking des Kunden in dessen Auftrag. Jedoch gibt es hier immer wieder Diskussionen über Sicher­ heit, Haftung und Umfang des Zugriffs. Zudem versu­ chen einige Banken dies zu PSD 2 - XS2A unterbinden. Das soll sich nun ­ändern. Der Gesetzge­ ber reguliert nach Inkraft­ treten Art und Umfang des Zugriffs und verpflich­ tet Banken zukünftig auf Quelle: TME Research, 2016 ­europäischer Ebene den Dritten diese „virtuelle Tür“ zum Online Banking über eine technische • Deckungsabfragedienst – z. B. beim Einsatz einer Karte eines Drittemittenten am Point of Schnittstelle zu öffnen, wenn diese Dritte durch Sale (PoS) den Kunden dazu bemächtigt wurden. Ziel ist ein gesteigerter Wettbewerb unter den digitalen ­Finanzdienstleistern. Der Zugang muss diskri­ minierungsfrei ermöglicht werden. Es darf also keine zusätzliche Hürde geben, wenn der Kunde einen Drittdienst beauftragt, die Bankdienstleis­ tung im Online Banking der Bank auszuführen. Um welche Bankdienstleistungen handelt es Der Zugang zu all diesen Diensten muss grund­ sätzlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt wer­ den. Die zugehörige Schnittstelle hierfür ist durch das kontoführende Kreditinstitut bereitzustellen, die somit auch die ­Kosten für die Entwicklung trägt. Drittanbieter müssen sich lediglich zertifi­ zieren lassen. sich dabei genau? Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch viele Fragen Die EBA unterschiedet hier grundsätzlich ­zwischen drei verschiedenen Diensten für die sich ein Dritter zertifizieren lassen kann: offen • Kontoinformationsdienst – z. B. zum Abruf von Umsätzen des Zahlungskontos über eine Kontostands-App, Push Notifications bei Zah­ lungseingängen, Multibanking-Aggregation oder digitales Haushaltsbuch • Zahlungsauslösedienst – z. B. zum Einreichen ¹Europäische Kommission, Okt 2015 Kontoinformaonsdienst Käuferbank Die Novellierung der Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) sieht vor, dass kontoführende Finanzin­ stitute sogenannten dritten Zahlungsdienstleis­ tern aus der gesamten europäischen Union den Zugang zu Bankdienstleistungen ermöglichen müssen. In Artikel 98 der PSD2 wird angekündigt, dass hierzu entsprechende technische Standards für eine sichere Authentifizierung und Kommuni­ kation entwickelt werden sollen. Die EBA selbst stellt hier jedoch nur die Anforderungen. Die technische Spezifikation des Standards obliegt im Anschluss dem Markt. einer Zahlung beim E-Commerce Shopping Die EBA hat in einer mehrmonatigen Konsulta­ tionsphase Marktteilnehmer aufgefordert, den Entwurf der RTS zu kommentieren. Über 260 Interessenvertreter aus allen Bereichen der ­Finanzbranche (u. a. Banken, FinTechs, Zahlungs­ dienstleister, Verbände, technische Dienstleis­ ter) nutzten diese Möglichkeit und reichten ihre ­Anmerkungen bei der EBA ein. Im Ergebnis zeigt sich, dass verschiedenste ­Punkte im Konsultationspapier noch sehr viel 18 I­nterpretationsspielraum bieten. Dies gilt es nun in den nächsten Wochen aufzulösen. • Wie gestaltet sich der Zugriff auf das ­Online-Konto genau? • Wird Screen Scraping zukünftig noch möglich sein? • Wird es eine europaweit einheitliche Schnitt­ stellen-Lösung geben oder kocht jedes konto­ führende Institut, jedes Mitgliedsland, jeder Bankenverband sein eigenes Süppchen? • Wie wird die Sicherheit der Zugangsdaten ­gewährleistet? • Welche Authentifizierungs-Verfahren (2FA) werden akzeptiert und sind diese überhaupt sinnvoll über alle Kanäle anwendbar, z. B. am Smartphone? • Wie genau ist die Haftungsregelung im ­ etrugsfall? B Finanzinstitute – warten jetzt also gespannt auf das finale RTS Dokument. Denn die wesentliche Arbeit beginnt für die Banken erst im Anschluss. Es muss innerhalb von 18 ­Monaten nach Ver­ öffentlichung eine Schnittstelle entwickelt wer­ den, um Dritten den Zugriff zu den Kundenkonten zu ermöglichen. Zwar gibt es bereits länderüber­ greifende Allianzen einzelner Verbände und auch erste technische Dienstleister werben um den Auftrag zur Entwicklung einer Schnitt­stelle, aber die Entscheidung für eine gemein­same Entwick­ lung ist bislang noch nicht getroffen. Einen Vorteil haben am Markt existierende Dritt­ anbieter, die bereits heute den Kontozugriff in ihrem Geschäftsmodell verankert haben. Ihnen gewährt die EBA über die 18 Monate hinaus eine Übergangsfrist von weiteren 6 Monaten bis sie den Datenzugriff nur noch gemäß der neuen ­Regularien vornehmen dürfen. Ausblick – wie sieht das digitale Banking der Zukunft aus? Screen Scraping Der Begriff Screen Scraping beschreibt ein Verfahren zum Auslesen von Texten auf Web­ seiten. Drittanbieter nutzen diese Technologie um über das browserbasierte Online Banking auf das Kundenkonto bei der jeweiligen Bank zuzugreifen. Mittels eines Scripts wird auto­ matisiert die Login Seite aufgerufen und der Zugriff mit den vom Kunden erhaltenen Zu­ gangsdaten ausgeführt. Nach Auslesen der gewünschten Daten/Durchführung der Trans­ aktion wird die Sitzung wieder beendet. Die Zeit für die EBA zur Beantwortung dieser ­Fragen drängt. Die detaillierten Anforderungen an den Zugriff sollen eigentlich im Januar 2017 veröffentlicht werden. Hier zeichnet sich mög­ licherweise eine Verschiebung ab. Interessant wird vor allem, ob alle offenen Punkte tatsäch­ lich geklärt werden und wo es dem Markt selbst überlassen wird, sich zu regulieren. Alle Bran­ chenvertreter – allen voran die kontoführenden Verkommen kontoführende Institute zukünftig nun zu reinen Datenlieferanten und verlieren den Kontakt zu ihren Kunden über das eigene Online Banking, die eigenen Kanäle? Nicht zwin­ gend. Neben den regulatorischen Anforderun­ gen zur Bereitstellung eigener Kontodaten bietet die PSD2 natürlich auch Chancen, die es nun zu nutzen gilt. Es besteht z. B. die Möglichkeit ana­ log die Umsatzdaten von Fremdbankkonten in die eigenen Prozesse und Dienste zu integrie­ ren. So kann z. B. bei der Online-Kredit-Vergabe an einen Neukunden mit Gehaltskonto bei einer Fremdbank durch Zugriff auf Kontoumsätze der Kreditentscheidungsprozess maßgeblich opti­ miert werden. Scoring und Kundenidentifikation können mit Hilfe der Information schneller und einfacher gestaltet werden. Weitere Ansatz­ punkte sind die Verwendung von Umsätzen un­ terschiedlichster Bankkonten ­eines Kunden, ins­ besondere für eine ganzheitliche ­Finanzplanung oder Vertragsinformationen für vereinfachten Versicherungswechsel. Zeitrahmen von der Verabschiedung der PSD2 bis zum endgültigen Inkrafttreten Verabschiedung der PSD 2 RTS KonsultaonsPhase Verabschiedung der PSD2 im europäischen Gesetzgebungsverfahren Veröffentlichtung der PSD2 im EU-Amtsbla Veröffentlichung RTS Diskussions-Papier über Authenfizierung und sichere Kommunikaon Veröffentlichung RTS Konsultaons-Papier 2015 2016 Quelle: TME Research, 2016 19 Veröffentlichung Inkrateten der der RTS PSD2 Deadline zur Veröffentlichung der finalen RTS April - Annahme der RTS durch die EU Kommission 2017 Deadline für die naonale Umsetzung der Vorschrien aus der PSD2 in den Mitgliedsstaaten Ende der Übergangsfrist Ende der Übergangsfrist für bestehende Teilnehmer Inkratreten der RTS 2018 PSD2 - Artikel 98 Absatz 2 - Technische Regulierungsstandards für die Authentifizierung und die Kommunikation:² (2) Die Entwürfe technischer Regulierungs­ standards gemäß Absatz 1 werden von der EBA mit folgender Zielsetzung ausgearbei­ tet: a) Sicherstellung eines angemessenen ­Sicherheitsniveaus für Zahlungsdienst­ nutzer und Zahlungsdienstleister durch die Festlegung wirksamer und risiko­ basierter Anforderungen, b) Gewährleistung der Sicherheit für die Gelder und die personenbezogenen ­Daten der Zahlungsdienstnutzer, c) Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs zwischen allen Zahlungsdienstleistern, d) Gewährleistung der Neutralität im Hinblick auf die Technologie und das ­Geschäftsmodell, e) Ermöglichung der Entwicklung benut­ zerfreundlicher, allgemein zugänglicher und innovativer Zahlungsmittel Die fortschreitende Digitalisierung in der Bran­ che wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass vorhandene digitale Bankdienstleistungen zwingend erweitert werden müssen. Eine ein­ fache tabellarische Umsatzübersicht und Über­ weisungsformulare sind hier nicht mehr zeit­ gemäß. Die PSD2 bietet den Banken also einige Chancen, die es nun auch zu nutzen gilt. Genau dies bezweckt die EU auch mit der PSD2. Mehr Wettbewerb fördert die digitale Weiterentwick­ lung der Branche. Quellen: Europäische Kommission – Pressemitteilung, 2015, Internetquelle: http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-15-5792_de.htm Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates, 2015 Internetquelle: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=DE ² Richtlinie (EU): 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates, 2015 2019 Autoren: Stefan Roßbach, Thomas Büttner TME Institut | September 2016 Factbook: Innovative Geschäftsmodelle im Digital Wealth Management Die Zahl der Neugründungen im Digital Wealth Management wächst seit 2014 stark an. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Geschäftsmodelle in den Kategorien Research Tools, Online Brokerage, Social Communities, Robo Advisory und Crowdinvesting. Steht das Private Banking nun also vor einer Zeitwende? Die persönliche Beratung wird zwar unverzichtbar bleiben, jedoch durch digitale Unterstützung schon bald ein Vielfaches für neue Kundengruppen leisten können. Das Factbook stellt über 70 Geschäftsmodelle im Digital Wealth Management vor, die ­insbesondere durch ihren Mehrwert für den Kunden, den Innovationscharakter der Lösungen sowie die ­Bedeutung für den Markt eine Referenz für die anstehende Entwicklung in der ­Vermögensverwaltung sind. Analysierte Geschäftsmodelle Reseach Tools Robo Advisory BörseGO Estimize Intelligent R ­ ecommendations LikeFolio Motley Fool StockPulse Stock Rover Trendlink WeInvest.net Yukka Lab Addepar Assetbuilder Betterment Cashboard Charles Schwab easyfolio Financial Guard fintego Folio Investing FUNDAmental Capital Ginmon Hedgeable Investify iQuantifi JustETF LearnVest LIQID MarketRiders maxblue Anlagefinder Mydepotcheck NestEgg Vanare Nest Wealth Nutmeg Personal Capital quirion Scalable Capital SigFig Smart401K True Wealth United Signals Vaamo Vanguard Personal Advisor Online Brokerage Algofast Financial.com Motif Investing Rizm Robinhood Social Community collective2 Family Bhive Tiger 21 Sharewise SumZero StockTwits twindepot collective2 eToro WIKIFOLIO Ayondo VisualVest Wealthfront Whitebox Zen Assets Crowdinvesting AngelList CircleUp DealMarket Fundbase FundersClub Gust Kapilendo Venture Liquid Equity Prodigy Network RealtyMogul Das Factbook ist u. a. über den ­Online-Shop des Bank-Verlags erhältlich: Zum Online-Shop Die digtale Version des Factbooks können Sie über die TME Instituts-App erwerben: 20 Auszug aus dem Factbook: SCALABLE CAPITAL Anbieter eines automatisierten P ­ ortfolio-Managements FACTS Gründungsjahr: Produktiv: Länder: Eigentümer / Investor: Strategische Partner: 2014 Ja Deutschland, Österreich, Großbritannien Florian Prucker, Erik Podzuweit, Adam French, Patrick Pöschl, Prof. Dr. Stefan Mittnik Keine GESCHÄFTSMODELL ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter mit einer BaFin-Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz sowie einer FCA-Erlaubnis für den britischen Markt. Scalable Capital verwaltet für seine Klienten individuell angepasste, risikoadjus­ tierte und global diversifizierte ETF-Portfolios für den langfristigen Vermögens­ aufbau. Je nach Anlageziel, Finanzsituation und individueller Risikotoleranz wird jeder ­Klient einer von 23 Risikokategorien mit einem konkreten Verlustrisiko zugeordnet. Scalable Capital wählt die besten und kosteneffizientesten ETFs vollkommen unab­ hängig für seine Klienten aus. Eine eigens entwickelte Risikomanagement-Technologie überwacht alle Portfo­ lios rund um die Uhr und führt automatisch Umschichtungen durch, wenn eine ­Verletzung der individuell festgelegten Risikokategorie droht. Das Anmeldeverfahren erfolgt online in wenigen Minuten. Die Identifikation ­erfolgt durch Videoident- oder Postident-Verfahren. Der Klient hat jederzeit Einsicht in sämtliche Portfoliodetails oder angefallene Gebühren auch via App. Die Mindestanlagesumme beträgt 10.000 €. GEBÜHRENMODELL ■■ ■■ Scalable Capital erhebt eine All-in-Gebühr i. H. v. 0,75 % auf das tagesdurch­ schnittlich verwaltete Vermögen Die Kosten für die ETFs belaufen sich auf ca. 0,25 % p. a. MEHRWERT KUNDE ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 21 Individuelle Vermögensverwaltung für klassische Privatanleger Faire und kosteneffiziente Gebührenstruktur ermöglicht langfristigen Vermö­ gensaufbau Unabhängige Auswahl der besten ETFs Dynamisches Risikomanagement Transparentes und konstantes Verlustrisiko dank dynamischer Portfolioverwaltung Kategorie Research Tools Online Brokerage Social Community Robo Advisory Crowdinvesting Verfahren Anleger- und Risikoprofil Vermögensaufnahme Vermögensanalyse Portfolioberatung Vermögensverwaltung Anbieter FinTech mit Brokeranbindung reine Empfehlung Bank KAG § Risk & Regulatory Banken und Anbieter von Finanzdienstleistungen bewegen sich in einem Umfeld, das immer stärker reguliert wird. Die konsequente Ausrichtung an den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen einerseits und eine pragma­ tische Umsetzung im Sinne einer wachstumsorientierten Geschäftspolitik andererseits scheinen oft kaum vereinbar. Bei der Meisterung dieses Spagats hilft die TME AG mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Praxis. Gesetze und Vorschriften werden effizient umgesetzt, Optimierungs- und Synergieeffekte transparent gemacht. So entsteht ein Mehrwert für das Unternehmen, der dessen Wettbewerbsfähigkeit stärkt. In 2016 hat das TME Institut dazu folgende Publikationen verfasst: Die fünfte MaRisk-Novelle überführt die BCBS 239 in den Geltungsbereich aller deutschen Banken Whitepaper, Juli 2016, 4 Seiten Autoren: Stefan Bachinger, Thomas Arnsberg 23-26 Global und national systemrelevante Banken (G-SIB bzw. D-SIB) sind zur Beachtung und Erfüllung der Anforderun­ gen der BCBS 239 (Grundsätze zur ­Aggregation von Risikodaten und Risikoberichterstattung) verpflichtet. Die BCBS 239 stellen umfangreiche und weitreichende Anforderungen an die IT-­Infrastruktur und die Prozesse im Risikoma­ nagement von Banken. Institute können diesen neuen Auflagen mit einem 5-Phasen-Modell gegenübertreten. Der IFRS 9 strukturiert die Bewertung und Bilanzierung von Finanzinstrumenten neu Whitepaper, September 2016, 2 Seiten Autoren: Stefan Bachinger, Christian Behrens 27-28 Der vom IASB (International Accounting Standards Board) veröffentliche Standard IFRS 9 Finanzinstrumente resul­ tiert aus einer umfassenden Überarbeitung des IAS 39 (International Accounting Standards) und löst diesen zukünf­ tig ab. Der neue Standard muss ab dem 1. Januar 2018 verbindlich angewendet werden. Der IFRS 9 setzt sich aus den drei Phasen – Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte, Wertminderung finanzieller Vermögenswerte und Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen – zusammen. Es ist davon auszugehen, dass der neue Standard zu einer Erhöhung in der Risikovorsorgebildung führen wird. Auch bei FinTechs kommt es auf die Auswahl der richtigen Key Performance Indicator an Whitepaper, Oktober 2016, 3 Seiten Autoren: Thomas Deibert, Jochen Schneider 29-31 Im Zuge der Umsetzung der zahlreichen neuen Geschäftsideen im Finanzdienstleistungsbereich stellt sich zwangs­ läufig die Frage, wie das bisher Erreichte gemessen werden kann bzw. wie gegebenenfalls rechtzeitig erforderlicher Handlungsbedarf signalisiert wird. Auch speziell bei FinTechs kann ein adäquates und funktionierendes Key Perfor­ mance Indicator (KPI) System bereits in der Start-up-Phase wichtige Steuerungsimpulse geben und damit ein ent­ scheidender Baustein für einen erfolgreicheren Unternehmensaufbau sein. 22 TME Institut | Juli 2016 § Die fünfte MaRisk-Novelle überführt die BCBS 239 in den Geltungsbereich aller deutschen Banken Global und national systemrelevante Banken (G-SIB bzw. D-SIB) sind zur Beachtung und ­Erfüllung der Anforderungen der BCBS 239 (Grundsätze zur Aggregation von Risikodaten und ­Risikoberichterstattung) verpflichtet. Die BCBS 239 stellen umfangreiche und ­weitreichende ­Anforderungen an die IT-Infrastruktur und die Prozesse im Risikomanagement von Banken. ­Institute können diesen neuen Auflagen mit einem 5-Phasen-Modell gegenübertreten. Mit der fünften MaRisk-Novelle (Entwurf vom 18.02.2016) werden die ­Inhalte des Baseler ­Papiers BCBS 239 in die deutsche, regulatorische Praxis übernommen (siehe Abb. 1). Inhalte der Grundsätze I. Gesamtunternehmensführung & Infrastruktur sowie II. Risikodaten Aggregation werden für große und komplexe Institute ein­ geführt. Große und komplexe Institute ­definieren sich dabei über eine Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro. Dieses Kriterium erfüllen ­aktuell 35 Banken in Deutschland.¹ Die Inhalte des Grundsatzes III. Risikoberichterstattung werden an alle deutschen Institute unabhängig des Bilanzvolumens adressiert. Der Anwendungsbereich des Baseler Papiers BCBS 239 wird somit durch die MaRisk zum einen auf 35 Banken in Deutschland ausgeweitet, und zum anderen auch für alle weiteren Banken relevant. Die Inhalte des Grundsatzes III. Risikoberichterstattung werden durch die ­5. MaRisk Novelle für alle deutschen Institute relevant. Der Umsetzungshorizont wird im Konsultations­ papier der MaRisk nicht ­benannt. Jedoch wird im Rahmen der Stellungnahmen über eine Umset­ zungsfrist von drei Jahren - analog der BCBS 239 Vorschriften - diskutiert. Die MaRisk / BCBS 239-Anforderungen stellen weitreichende Anforde­rungen an die Organisa­ tion, Prozesse und IT einer Bank. Für die Errei­ chung der Compliance ist daher essentiell, den individuellen Handlungsbedarf zu identifizieren, um darauf aufbauend ein Implementierungs­ projekt planen zu können. Hierzu sind eine voll­ ständige Identifikation des Handlungs­bedarfs und eine Reduktion von Komplexität notwendig.² Um die individuellen Compliance-Lücken zu iden­ tifizieren, und Maßnahmen zur Erreichung der Compliance zu definieren, wird ein fünf­stufiges Vorgehensmodell empfohlen (siehe Abb. 2). Mithin ergibt sich aus dem vorgestellten Ansatz eine strukturierte Vorgehensweise, die die Kom­ plexität ­reduziert und somit Unsicherheit aus Abbildung 1: Übernahme der BCBS 239 Anforderungen in die 5. MaRisk Novelle _______________________ _______________________ ¹ die Bank (08.2015 Seite 10): „Die hundert größten deutschen Kreditinstitute“ ²gi Geldinstitute (04/2015, S. 37): „BCBS 239 – Die Moderni­ sierung der Risikosteuerung“ 23 der ­Planung und dem Umsetzungsprojekt für die Compliance entnimmt. Die Basis des Vorgehensmodells bildet eine klas­ sische Gap-Analyse, die die Lücken zwischen der aktuellen Compliance einer Bank und der von der Bankenaufsicht geforderten Anforderungen identifiziert. Vorgehensmodell Um die Abweichung zwischen Ist- und Soll-Com­ pliance zu bestimmen ist es notwendig, eine umfassende Problemdiagnose der Bank in ­Bezug auf die aktuelle Compliance durchzuführen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass das Zielbild (Soll-Compliance) durch die MaRisk / BCBS 239 formuliert ist, jedoch mit den individuellen Bank­ zielen in Einklang gebracht werden muss. Das in Abbildung 2 dargestellte, fünfstufige ­Vorgehensmodell führt von der Problem­stellung bis hin zur Identifizierung der Handlungs­felder und den damit verbundenen Lösungsan § Abbildung 2: Das 5 Phasen Vorgehensmodell zur Compliance Roadmap sätzen zur Erreichung der MaRisk- / BCBS 239-Compli­ance. Die fünf Phasen werden im Weiteren schlüssig abgegrenzt und mit prakti­ schen ­Methoden für die Problemanalyse und die Pro­blemlösung unterlegt. Das Vorgehensmodell macht es möglich, die komplexe Problematik vollständig zu erfassen und einen Handlungspfad zur Lösung aufzu­ nehmen und somit die vorhandene Komplexität zu reduzieren. Phase 1: Problembewusstsein Ziel der ersten Phase ist es, ein einheitliches Ver­ ständnis der BCBS 239 Anforderungen zu schaf­ fen, sowie die fachliche und technische ­Relevanz zu bestimmen. Hierfür werden die BCBS 239 umfassend mit den relevanten Stakeholdern aus den Bereichen Risikomanagement, Finanzen und IT in Workshops diskutiert und die konsoli­ dierten Ergebnisse entsprechend dokumentiert. Entscheidend ist die frühzeitige Einbindung aller relevanten Stakeholder. Auf diese Weise werden zum einen die unterschiedlichen Sichten auf das Zielbild vereint. Zum anderen wird durch das gemeinsame Verständnis und die frühzeitige Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichten späteren Missverständnissen vorgebeugt. Aufbauend auf dem gemeinsamen Verständnis können die relevanten (Risiko-)Berichte identi­ fiziert werden. Auf Basis der relevanten Risiko­ berichte lassen sich die betroffenen Risiken, Kennzahlen und damit auch die betroffenen Sys­ teme ableiten. 1 identifizierten relevanten Systeme entwi­ ckelt. Durch Abgleich der Ist-Architektur mit der ­Referenzarchitektur werden die IT-seitigen Hand­ lungs- und Problemfelder identifiziert und gleich­ zeitig ­Lücken zu einer vollständigen Compliance aufgezeigt. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Dokumentation der relevanten Prozesse, Metho­ den, Systeme und Daten, die für die Risikodaten­ aggregation und das Reporting relevant sind. Je nach Umfang des IT-technischen Handlungs­ bedarfs ist es notwendig, taktische Lösungen zur Zielerreichung zu implementieren, die später durch strategische Lösungen abgelöst werden. Praxistipp: Tool-basiertes Self-Assessment Die MaRisk / BCBS 239 stellen vielfältige, komplexe und weitreichende Anforderun­ gen an die unterschiedlichen Bereiche einer Bankorganisation. Um alle Anforderungen sinnvoll, effektiv und effizient bewerten zu können, bietet sich die Entwicklung eines Tools an. Das Tool enthält Fragen zu den einzelnen Anforderungen der BCBS 239 und bietet die Möglichkeit, die Compliance in ­Bezug auf jede wesentliche Risikoart ein­ schätzen zu können. Auf diese Weise kann die Compliance pro Risikoart und Anforde­ rung individuell und differenziert bewertet werden. Gleichzeitig bietet die toolbasierte Ermittlung eine gute Möglichkeit zur Ana­ lyse, Auswertung und Dokumentation. Phase 2: Technische Ist-Analyse Phase 3: Fachliche Ist-Analyse In dieser Phase wird ein tieferes Verständnis der technischen Ist-Situation aufgebaut, sowie eine Referenzarchitektur auf Basis der in ­Phase In der 3. Phase des Vorgehensmodells wird die aktuelle Abdeckung der ­MaRisk / BCBS 239 An­ forderungen mittels eines Self-Assessments er­ _______________________ mittelt. Den Rahmen des Self-Assessments bil­ den die Ergebnisse aus Phase 1 – die relevanten Risikoarten und Kennzahlen – und Phase 2 – die technischen Handlungsfelder. Die Bewertung der Compliance wird hierbei nach den unterschiedlichen Risikoarten und unter­ schiedlichen Anforderungen vorgenommen, um ein detailliertes Bild der Ist-Situation abzubilden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Anforde­ rungen aus den relevanten Blickwinkeln betrach­ tet werden (siehe Abb. 3). Im Ergebnis wird die aktuelle Compliance-­ Abdeckung der Bank auf die unterschiedlichen Risikoarten und Grundsätze projiziert, um ein ­Gesamtbild der aktuellen Compliance darzu­ stellen. Ebenso kann an dieser Stelle auf die veröffentlichten Self-Assessments der G-SIBs zurückgegriffen werden.³ Diese bieten eine Ver­ gleichsmöglichkeit mit Best-Practices, um ein besseres Verständnis der eigenen Compliance im Verhältnis zum Marktumfeld zu gewinnen. Phase 4: Sollkonzeption Die 4. Phase identifiziert die Abweichung zwi­ schen der strategischen Zielsetzung durch die MaRisk / BCBS 239 und dem durch die Ist-Analy­ se dargestellten Status Quo. Die Praxiserfahrung zeigt, dass meist eine Vielzahl unterschiedlicher, voneinander abhängiger und komplexer Compli­ ance Gaps vorliegen. Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, die Com­ pliance Gaps zu strukturieren und in Handlungs­ felder einzuteilen. Die Handlungsfelder stellen übergreifende Anforderungen und Anpassungen dar und nehmen somit den einzelnen Compli­ ance Gaps die Komplexität. Die Praxis zeigt, dass dieses Vorgehen das Aufsetzen eines Umset ³ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich - BIS (Dez. 2013): „ Progress in adopting the principles for effective risk data aggregation and risk reporting“, BCBS 268, URL: http://www.bis.org/publ/ bcbs268.pdf und Bank für Internationalen Zahlungsausgleich - BIS (Jan. 2015): „ Progress in adopting the principles for effective risk data aggregation and risk reporting“, BCBS d308, URL: http://www.bis.org/bcbs/ publ/d308.pdf 24 § Abbildung 3: Identifizierung der aktuellen MaRisk / BCBS 239 Compliance zungsprojektes erheblich vereinfacht und die Projektziele innerhalb der Organisation besser transportiert werden können. Innerhalb der Sollkonzeption werden für die ein­ zelnen Handlungsfelder ebenso übergreifende Lösungsansätze entwickelt (siehe Abb. 4). Ähn­ lich der Phase 1 ist es an dieser Stelle vorteil­ haft, alle relevanten Stakeholder einzubeziehen. Dadurch werden alle Anforderungen der unter­ schiedlichen Bereiche in den Projektzielen und Lösungsvorschlägen reflektiert. Zusätzlich entwi­ ckeln auf diese Weise alle Stakeholder nicht nur ein gemeinsames Verständnis der Anforderun­ gen, sondern auch des Lösungsansatzes. Abbildung 4: Identifikation der Compliance Gap 25 Phase 5: Realisierungs-Planung Im Rahmen der Realisierungs-Planung werden die identifizierten ­Compliance Gaps, Handlungs­ felder und übergeordneten Lösungsansätze nochmals im Detail betrachtet, strukturiert so­ wie im Gesamtkontext der Bank analysiert. Ziel dieser Phase ist es, den Scope des Umsetzungs­ projektes klar zu definieren, Maßnahmenkatalo­ ge zu entwickeln und das Umsetzungsprojekt zu planen (siehe Abb. 5). Die Praxiserfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist, den Scope des Umsetzungsprojektes weitestgehend zu reduzieren. MaRisk / BCBS 239 Umsetzungs­ projekte stellen hohe, vielfältige und komplexe Anforderungen an die unterschiedlichen Berei­ che des Unternehmens. Ein konkret und fokus­ siert definierter Scope hilft dabei, das Umset­ zungsprojekt beherrschbar zu machen. Mögliche Ansatzpunkte zur Reduzierung des Scopes sind z. B. Verlagerungen in bestehende Projekte. Bereits laufende Projekte gehen even­ tuell auf Anforderungen der MaRisk / BCBS 239 ein und können die Anforderungen entspre­ chend mit aufnehmen. Zusätzlich ist es möglich, die einzelnen Anforderungen und Handlungs­ felder unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten zu betrachten und als nicht relevant einzustufen. Diese Möglichkeit bieten sowohl die BCBS 239 als auch die MaRisk (Wesentlichkeitsgrundsatz, vgl. Textziffer 23, 43 und 56 des BCBS 239, sowie MaRisk - AT 2.2 Risiken). § Um das Zielbild zu erreichen und somit die strategische und opera­ tive Lücke zu schließen, werden für die verbleibenden Themen Maßnahmen­kataloge zusammen­ gestellt. Im Anschluss werden detail­ lierte Pläne erarbeitet, um die iden­ tifizierten Maßnahmen umzusetzen. Dazu sind die notwendigen Ressour­ cen (finanziell wie personell) sowie die Auswirkungen auf bestehende ­­Organisationseinheiten (Bereiche) zu bestimmen und direkt in die Planung mit einzubinden. Anhand dieser Ana­ lysen können die Ziele und Strategien bestehender Bereiche angepasst und die Auswirkungen der Maßnahmen in den einzelnen Bereichen berück­ sichtig werden. Abschließend wer­ den die Ziele, Strategien und Maß­ Abbildung 5: Entwicklung und Inhalt der Realisierungs-Planung nahmen endgültig zusammengeführt. Fazit Für viele Institute bedeutet somit die Übernah­ Die Realisierungs-Planung erzeugt einen me der BCBS 239 Anforderungen in die MaRisk Maßnahmenkatalog nach Handlungsfeldern Mit der Überführung von BCBS 239 Inhalten in vielfältige und komplexe Herausforderungen in (Schlüssel­themen) gegliedert, so dass anhand die MaRisk werden Teile der Anforderungen für den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und von Aufgabenpaketen, Meilensteinen (Road­ alle deutschen Institute relevant. Der Fokus liegt IT. Diese können auf Basis des beschriebenen map), Messgrößen, Verantwortlichkeiten und auf den großen und komplexen Banken, deren Vorgehensmodells strukturiert, analysiert und Endterminen die abgeleiteten Maßnahmen im Risikodatenaggregationsfähigkeit ­Informationen adressiert werden. Dabei fußt das Vorgehens­ folgenden Umsetzungsprojekt realisiert werden umfassend, genau und zeitnah für das Berichts­ modell auf der Methode einer klassischen Gap-­ können. Das Umsetzungsprojekt wird anhand wesen zur Verfügung stellen muss. Für kleinere Analyse. Den Meta-Rahmen zur Sicherstellung Institute gelten die Anforderungen an die Risiko­ der Handlungsfelder strukturiert und aufgesetzt. der Vollständigkeit und Reduktion der Komple­ berichtsprozesse. Um diese jedoch erfüllen zu Dabei liegt die Gesamtverantwortung stets beim können, ist auch von kleineren Instituten zu prü­ xität bildet ein mehrdimensionales Modell, das obersten Management der Bank, das in letzter fen, inwiefern Aggregationskapazitäten aufge­ die Autoren im Artikel „ BCBS 239 – Die Moderni­ sierung der Risikosteuerung“ vorgestellt haben.⁴ Konsequenz über sämtliche Maßnahmen zu ent­ baut werden müssen. scheiden hat. _______________________ ⁴ gi Geldinstitute (04/2015, S.37): „BCBS 239 – Die Moderni­ sierung der Risikosteuerung“ Autoren: Stefan Bachinger, Thomas Arnsberg 26 TME Institut | September 2016 § Der IFRS 9 strukturiert die Bewertung und ­Bilanzierung von Finanzinstrumenten neu Der vom IASB (International Accounting Standards Board) veröffentliche Standard IFRS 9 ­Finanzinstrumente resultiert aus einer umfassenden Überarbeitung des IAS 39 ­(International Accounting Standards) und löst diesen zukünftig ab. Der neue Standard muss ab dem­­ 1. Januar 2018 verbindlich angewendet werden. Der IFRS 9 setzt sich aus den drei Phasen ­Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte, Wertminderung finanzieller Vermögenswerte und ­Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen zusammen. Es ist davon auszugehen, dass der neue Standard zu einer Erhöhung in der Risikovorsorgebildung führen wird. Die späte bilanzielle Abbildung von Kreditaus­ fällen wurde im Zuge der Subprime Finanz­ marktkrise als wesentliche Schwäche in den bestehenden Regelwerken zur Rechnungslegung angemerkt. Zum einen wurde das prozyklische Vorgehen bei der Feststellung von Kreditaus­ fällen und die damit verbundene Bildung der ­Risikovorsorge und zum anderen der hohe ­Detaillierungsgrad, die Komplexität und die schwere Verständlichkeit des IAS 39 bemängelt. Vor allem die politische, aber auch die öffentliche Kritik erhöhte den Druck auf den IASB die Bilan­ zierung von Finanzinstrumenten zu reformieren. • Fair Value through Other Comprehensive Income (FVtOCI): Hierbei handelt es sich um eine erfolgsneutrale Bewertung der Schuld­ instrumente zum Fair Value, wobei Änderun­ gen im sonstigen Ergebnis erfasst werden Der IAS 39 basiert auf einem sogenannten ­Incurred-losses-Modell. Hierbei wird erst beim Eintritt eines Ausfallereignisses der Kreditausfall erfasst. Dies führt wiederrum zu einer Inkon­ gruenz zwischen Risikoaufschlag und erfasster Wertminderung. Das IFRS 9 Modell sieht vor, die Wertminderung anhand von zu erwartenden Kreditausfällen und Cashflows anstelle von histo­ rischen Ausfallereignissen zu bilden (Remaining Lifetime Expected Losses). Aufgrund seiner Kom­ plexität wurde das IFRS 9 Projekt in folgende drei Phasen gegliedert: Eine Umgliederung bzw. eine Reklassifizierung eines finanziellen Vermögenswerts auf der ­Aktivseite in eine andere Bewertungskatego­ rie ist ausschließlich bei einem Wechsel des ­Geschäftsmodells möglich. Die Klassifizierung auf der Passivseite ist weitestgehend unverän­ dert geblieben. • Fair Value through Profit or Loss (FVtPL): ­Ergebniswirksame Bewertung zum beizulegen­ den Zeitwert, wobei Änderungen ertrags- oder aufwandswirksam erfasst werden • Amortised Cost (AC): Bewertung zu fort­ geführten Anschaffungskosten Basierend auf dieser Logik ist für je­ des Instrument, welches in den Anwen­ dungsbereich des IFRS 9 fällt, zum Zu­ • Phase 2: Wertminderung finanzieller Vermögenswerte • Phase 3: Bilanzierung von Sicherungs-­ beziehungen Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte 27 • Schritt 1: Initiale Einstufung als Eigenkapi­ talinstrument, Derivat oder Fremdkapital­instrument • Schritt 2: Bestimmung des Geschäftsmodells • Schritt 3: Prüfung der Zahlungsstrom­- bedingung • Schritt 4: Ausübung von Bewertungs­ wahlrechten Ausschlaggebend für die Bilanzierung von ­Finanzinstrumenten und deren fortlaufenden ­Bewertung ist deren Klassifizierung. Unterneh­ men stehen daher zum einen vor der Herausfor­ derung die Ermessensentscheidungen sorgfältig zu treffen und zum anderen die Kategorisierung für jedes Finanzinstrument separat vornehmen zu müssen. Möglichkeiten der Kategorisierungsentscheidung von Finanzinstrumenten der Aktivseite • Phase 1: Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte Beim erstmaligen Bilanzansatz sind nach IFRS 9 die Halteabsicht des Vermögenswertes im Sinne einer Geschäftsmodelleinschätzung zur Steue­ rung sowie die vertraglichen Zahlungsströme zu analysieren. Aufbauend auf diesen Erkennt­nissen wird eine Klassifizierung in eine der folgenden drei Bewertungskategorien vorgenommen: gangszeitpunkteineKategorisierungsentscheidung vorzunehmen. Diese Entscheidung kann mittels einer vier Schrittfolge abgeleitet werden: Quelle: TME AG Research 2016 § Wertminderung Die Regelung zur Ermittlung der Risikovorsorge bezieht sich auf einen sogenannten Three-­StageApproach. Die Risikovorsorgebildung wird im ­Wesentlichen von einer signifikanten Erhöhung der Ausfallwahrscheinlichkeit vorangetrieben. Bei diesem Modell werden zu jedem Repor­ tingstichtag alle Geschäfte der impairmentrele­ vanten Grundgesamtheit in drei Stufen eingeord­ net (siehe Abbildung). Jedes Geschäft wird exakt einer Stufe zugeord­ net, kann aber im Rahmen der Folgebewertung, bei erhöhtem oder verringertem Kreditrisiko, ­innerhalb der Stufen transferiert werden. gebildet. Im Falle einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beinhaltet die Risikovorsorge den ­gesamten zu erwartenden Verlust. Zinserträge werden in Stufe 1 auf Basis ihres Bruttobuch­ werts ermittelt, wobei der ursprüngliche vertrag­ liche Effektivzinssatz verwendet wird. Einordnung in Stufe 2 „Underperforming“: Stufe 2 beinhaltet alle Geschäfte, die zum ­Reportingstichtag eine signifikante Erhöhung der Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen, bei wel­ chen jedoch noch kein Loss Event eingetreten ist. Für diese Geschäfte muss eine Risikovorsorge in Höhe der erwarteten Verluste für die komplette Restlaufzeit gebildet werden. Zinserträge werden Restlaufzeit zu unterlegen. Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen: Das vorrangige Ziel der Überarbeitung zur Bilan­ zierung von Sicherungsbeziehungen ist, gezielte Informationen über die Risikomanagement­ aktivitäten eines Unternehmens bereitzustellen und eine Vergleichbarkeit dieser Maßnahmen zu ermöglichen. Es soll den Adressaten ermög­ lichen, anhand der Rechnungslegung abzuleiten, welche Risikomanagementpolitik verfolgt wird und wie die angewendeten Sicherungsbeziehun­ gen dazu beitragen die Risiken zu minimieren. Im Vergleich zum IAS 39 gelten stärkere prinzi­ pienbasierte Vorschriften, welche wiederrum die Bandbreite an Sicherungsgeschäften für das Hedge Accounting erhöhen. Fazit Einordnung in Stufe 1 „Performing“: In Stufe 1 werden zum Reportingstichtag alle ­Geschäfte eingestuft, bei denen kein Loss Event (als Loss Event wird eine Verschlechterung der Kreditqualität bezeichnet, als Beispiel kann ein Verzug der Tilgungszahlungen genannt werden) im Sinne des IFRS 9 eingetreten ist. Die Risiko­ vorsorge wird in Höhe der erwarteten Verluste, die innerhalb eines Jahres eintreten können, ebenfalls in Höhe des ursprünglichen vertrag­ lichen Effektivzinssatz vereinnahmt. Einordnung in Stufe 3 „Credit Impaired“: In Stufe 3 sind alle Geschäfte enthalten, bei ­denen zum Reportingstichtag ein Loss Event ein­ getreten ist bzw. ein objektiver Hinweis auf einen Eintritt vorliegt. Diese Geschäfte sind mit ihrem jeweils zu erwartenden Verlust auf die gesamte Im Vergleich zum IAS 39 wurde der Anwen­ dungsbereich der Wertminderungsvorschriften deutlich ausgeweitet. Der IFRS 9 sieht vor, dass Unternehmen für alle Finanzinstrumente beim erstmaligen Bilanzansatz eine Klassifizierung durchführen. In Abhängigkeit der Klassifizierung muss für sämtliche Ausfallrisiken, die nicht er­ folgswirksam bewertet wurden, eine Risikovor­ sorge gebildet werden. Es ist davon auszugehen, dass der neue Standard zu einer Erhöhung in der Risikovorsorge führen wird. Als wesentliche ­Herausforderung ist festzuhalten, dass Unter­ nehmen nicht nur historische Daten berück­ sichtigen, sondern zusätzlich die Auswirkungen aktueller Gegebenheiten und Informationen verarbeiten müssen, um daraus objektive Hin­ weise auf Wertminderung ableiten zu können. Die sich hieraus ergebenden Ermessungsspiel­ räume müssen in Form von Angaben zu Annah­ men, Verfahren sowie Inputdaten im Abschluss erläutert werden. Autoren: Stefan Bachinger, Christian Behrens 28 TME Institut | Oktober 2016 § Auch bei FinTechs kommt es auf die Auswahl der richtigen Key Performance Indicator an Im Zuge der Umsetzung der zahlreichen neuen Geschäftsideen im Finanzdienstleistungsbereich stellt sich zwangsläufig die Frage, wie das bisher Erreichte gemessen werden kann bzw. wie ­gegebenenfalls rechtzeitig erforderlicher Handlungsbedarf signalisiert wird. Auch speziell bei ­FinTechs kann ein adäquates und funktionierendes Key Performance Indicator (KPI) System ­bereits in der Start-up-Phase wichtige Steuerungsimpulse geben und damit ein entscheidender Baustein für einen erfolgreicheren Unternehmensaufbau sein. Die FinTech-Branche hat sich in den letzten Jah­ ren rasant entwickelt. Mit dem Sammel­begriff FinTech – Financial Technologies – werden ­Geschäftsideen von Start-ups im Bereich Finanz­ dienstleistungen bezeichnet, die zunehmend die Bankenlandschaft in Bewegung bringen. Laut einer Auswertung des TME Instituts für Vertrieb und Transformationsmanagement gibt es derzeit schon mehr als 1.000 neue, digitale Geschäfts­ modelle auf dem Markt. Während der Aufbauphase der FinTechs den­ ken viele in erster Linie an Wachstum, Umsatz, Kunden­zahlen, etc. Langfristig zahlt es sich je­ doch aus, bereits in der frühen Phase des Unter­ nehmensaufbaus an die Implementierung eines angemessenen KPI-Systems zu denken. Ein funk­ tionierendes Steuerungssystem ist allein schon wegen der bestmöglichen Allokation des in der Regel knappen Kapitals wichtig. Das Manage­ ment sollte möglichst zeitnah wissen, welche Maßnahmen durchzuführen sind bzw. wie die beschlossenen Maßnahmen greifen. Auch bei der eigenen Unternehmensbewertung und an­ stehenden Finanzierungsrunden kann ein wirk­ sames KPI-System hilfreich sein. Nicht zuletzt wäre es inkonsequent, mit neuen, innovativen ­Geschäftsmodellen insbesondere die Entschei­ dungen des Kunden vereinfachen und beschleu­ nigen zu wollen, jedoch auf Seiten des eigenen Unternehmens für Steuerungszwecke keine ad­ äquate Entscheidungsgrundlage zu haben. Die Auswahl der KPI sollte allerdings mit Bedacht erfolgen, da durch ungeeignete KPI auch falsche Anreize gesetzt werden können, welche mögli­ cherweise weitreichende Folgen für das Unter­ nehmen haben können. Darüber hinaus kann sich die frühzeitige ­Abstimmung der Performance-Messung auf die im Aufbau befindlichen Geschäftsprozesse zeit- und budgetschonend auswirken. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die gegebe­ nenfalls für aufsichtsrechtliche Zwecke zu ermit­ telnden bzw. bereitzustellenden Geschäfts- und Risikokennzahlen umgekehrt auch die Geschäfts­ 29 Beispielhafte Darstellung eines zusammenhängenden KPI-Systems Abgleich Quelle: TME AG Research 2016 prozesse beeinflussen. Im Folgenden steht je­ doch die Gestaltung des KPI-Systems nach inter­ nen Anforderungen im Vordergrund. Auf kennzahlenbasierte Steuerungsinforma­ tionen sind grundsätzlich alle Stakeholder des Unternehmens (Management, Investoren, ­Kreditgeber, etc.) angewiesen. Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage der jeweiligen Stakeholder werden aber diverse Anforderungen an die Auswahl der KPI gestellt, so dass diese nicht immer ganz leicht ist. Die Herausforderung besteht ­darin, dass die ausgewählten Kennzahlen auch die jeweils ­individuellen ­Aspekte bestmög­ lich und gleich­zeitig verständlich abbilden. Die strategische Relevanz der KPI KPI dienen mehr als nur der kurzfristigen Kon­ trolle. Im Idealfall spiegeln sie auch die mittel- bis langfristige Unternehmens- und Produktstrate­ gie wieder. Deren spezifische Ausrichtung rich­ tet sich zunächst natürlich nach dem jeweiligen Banking-­Geschäftsfeld, in dem das FinTech tätig ist. Die derzeit auf dem Markt auftretenden ­FinTechs lassen sich folgenden fünf Banking-­ Geschäftsfeldern zuordnen: Bezahlen, Anle­ gen, Finanzieren, Verwalten und Absichern (vgl. auch Factbook des TME Instituts „Innovative Geschäftsmodelle im Banking“). Wie sich die je­ weilige geschäftsfeldspezifische Strategie auf die Festlegung der KPI auswirkt, lässt sich beispiels­ weise für den ­Bereich ­„Bezahlen“ verdeutlichen. ­Systembedingt steht hier das Potenzial der teil­ nehmenden Händler im Vordergrund. Dement­ sprechend ist dies durch verschiedene, geeignete KPI abzubilden. In den übrigen Geschäftsfeldern können hingegen andere KPI im Fokus stehen. Neben dem jeweiligen Geschäftsfeld prägt natür­ lich maßgeblich das unternehmensindividuelle Geschäftsmodell die Definition der strategisch relevanten KPI. KPI-Systeme – das Zusammenspiel ­verschiedenen KPI ist entscheidend der Die richtige Auswahl einzelner KPI für sich allein gewährleistet noch keine umfassende und er­ folgreiche Unternehmenssteuerung. Dazu müs § sen die KPI auch zu einem effizienten und kon­ sistenten Kennzahlensystem zusammengeführt werden. Weitverbreitet ist in diesem Zusammen­ hang die Balanced Scorecard. Diese kann grund­ sätzlich auch bei FinTechs eingesetzt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist immer auch das möglichst deutliche Sichtbarmachen der tatsächlichen Quellen des Geschäftserfolgs und die verursachungsgerechte Zuordnung der ent­ sprechenden Kosten. Im Gegensatz zu der vorher eher horizontalen Betrachtungsweise (verschie­ dene Perspektiven des KPI-Systems) steht hier die vertikale Sichtweise im Vordergrund, d. h. wie können die ermittelten Top-KPI in aussage­ kräftige und steuerbare Detailkennzahlen herun­ tergebrochen werden. In der Praxis werden diese zusätzlichen entscheidungsrelevanten Informa­ tionen durch Werttreiberbäume offengelegt. Das Ziel dabei sollte sein, praktisch eine „Sichtlinie“ von den Unternehmenszielen bis hinunter zu den operativen Tätigkeiten zu schaffen und das in ­einem möglichst zusammenhängenden System. Da sich das Marktumfeld schnell ändern kann, kommt den (richtigen) KPI zudem eine Art Frühwarnfunktion zu. Die Sicherstellung dieser Funktion ist unternehmensindividuell zu beurtei­ len und regelmäßig zu überprüfen. Implementierung eines KPI-Systems Was sind erfolgreiche Rahmenbedingungen für die Implementierung? Grundsätzlich gelten bei der Implementierung eines KPI-Systems die unten aufgeführten Rah­ menbedingungen. Rahmenbedingungen erfolgreicher ­Implementierung Steuerungswirksamkeit Anzahl der KPI Review Implemenerung KPI-System Datenverfügbarkeit Weiterentwicklung Management Aenon Quelle: TME AG Research 2016 • Steuerungswirksamkeit – Unterstützung der individuellen Geschäftsziele. Im Idealfall füh­ ren KPI dazu, dass die entscheidenden Erfolgs­ faktoren besser in das Blickfeld rücken und sich das Unternehmen gegenüber den Wett­ bewerbern behauptet. Mit den richtigen KPI erkennen das Management aber auch die Mit­ arbeiter, ob sie ihre Leistung optimal erbringen oder in welchen Bereichen sie besser werden müssen. Für jedes der zuvor genannten Ban­ king-Geschäftsfelder können unterschiedliche KPI zum Tragen kommen. Eine ­wesentliche Grundlage für deren Auswahl ist die jeweilige Geschäftsstrategie. Je detaillierter sie formu­ liert ist, desto besser lassen sich die individu­ ellen KPI ableiten. Gerade in der Aufbauphase eines FinTechs sind z. B. KPI, die den Erfolg bei der Kundengewinnung wieder­geben, wie beispielsweise die Konversionsrate nach Vertriebskanälen für Absatz fokussierte Ge­ schäftsmodelle oder Kennzahlen aus zeitlich gestaffelten Kohorten-Analysen, von besonde­ rer Bedeutung. Auch die Messung des ­bereits erreichten Wertes der Kundenbeziehung (Customer Lifetime Value) kann beispielsweise aus finanzieller Sicht wichtige Informationen für die Geschäftssteuerung liefern. Welche konkreten KPI letzten Endes wirklich relevant sind, ist aber immer individuell zu bestimmen. • Anzahl der KPI – Weniger ist mehr. Das Ziel­ konzept ist häufig sehr ambitioniert. Eine große Menge an KPI wird in der Konzeption als „sinnvoll“ erachtet. Spätestens in der Um­ setzung stellt sich heraus, dass das Ziel zu am­ bitioniert gesteckt war. Insbesondere im Hin­ blick auf die in der Anfangsphase eher knappe ­Ressourcenausstattung – personell wie tech­ nisch – kann die Erfassung und vor allem dau­ erhafte Beschaffung der KPI zum Teil zu auf­ wändig oder sogar schlichtweg nicht möglich sein. Um die Akzeptanz eines KPI-Systems von Beginn an sicherzustellen ist es daher wichti­ ger, schnell greifbare ­Ergebnisse vorliegen zu haben, als auf eine vollständige Ab­deckung ­aller möglichen ­Dimensionen und Perspek­ tiven abzustellen. Im ersten Schritt steht die Time to Market und die Umsetzung einer Lö­ sung nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ im Vordergrund. • Datenverfügbar­keit – Vorhandene Informationen nutzen. Viele Informationen sind im Unternehmen bereits vorhanden. Diese gilt es in erster Linie zu nutzen. In einem ­ersten Schritt ist Transparenz über mögliche Quellen oder möglicherweise bereits vorhandene Be­ richte zu schaffen. In einem weiteren Schritt sind Qualität und zeitliche Verfügbarkeit der Informationen zu prüfen, bevor sie final als Quellen herangezogen werden können. Die Nutzung der bereits vorhandenen Informa­ tionen ermöglicht es, in kurzer Zeit bereits sichtbare Erfolge vorzuweisen. Mit verhältnis­ mäßig geringem Aufwand entsteht der erste Pilot eines KPI-Systems. Darüber hinaus ist es wichtig, eher auf bereits bekannte KPI zu setzen, als auf absolute Exoten. Die „Exoten“ können zwar richtig und wichtig sein, aber aus Gründen der Akzeptanz, die vor allem schnell erreicht werden soll, eher Teil nachgelagerter Ausbau­stufen. • Management Attention – Einbindung der ­Geschäftsführung. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist generell der Management-Support. Die Führungskräfte sind frühzeitig mit ins Boot zu holen. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei auch die Dimension der individuellen Ziel­ vereinbarungen der Führungskräfte. Sind dort Ziele verankert, die nicht mit Zielwerten der Kennzahlen einhergehen, wird bei den Führungs­kräften keine Akzeptanz für eine nachhaltige Steuerung mit Hilfe der KPI entste­ hen. Mit zunehmender Leitungsspanne wächst daher die Bedeutung, eine von allen Verant­ wortlichen akzeptierte Lösung zu finden. Die Einbindung der Geschäftsführung dürfte bei einem ­FinTech keine besondere Anforderung sein, da diese situationsbedingt noch sehr nah an den Themen ist und damit unmittelbar auch auf Detailregelungen einwirken kann. • Weiterentwicklung – Die Kugel dreht sich weiter. Ohne die gefundene Grundstruktur wesentlich zu ändern, ist der Reifegrad der Lösung sukzessive in verschiedene Richtungen weiterzuentwickeln. Insbesondere ist zu prü­ fen, für welche Themenbereiche noch keine ausreichende Aussagekraft erreicht wurde. Für diese Bereiche sind neue KPI zu selektie­ ren und zu integrieren. Jedoch gilt es zu be­ achten, dass man sich weiter auf wenige KPI fokussiert und gegebenenfalls nicht aussage­ kräftige KPI herausnimmt, um das KPI-System am Ende nicht wieder zu überfrachten. Gerade am Anfang werden einige KPI sicherlich noch ­manuell zu ermitteln sein. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Aktualität, zur Vermei­ dung von Fehlern und Inkonsistenzen sowie von kostentreibenden manuellen Prozessen, sollte die Datenerfassung und -bereitstellung für erprobte KPI sukzessive automatisiert wer­ den. Für eine weitergehende Analyse und zur Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen ist die „Tiefe“ des KPI-Systems zu erweitern. • Review – Regelmäßige Überprüfung der ­Steuerungswirksamkeit. Die stetige Ver­ besserung des KPI-Systems kann durch die ­Integration in den jährlichen Planungsprozess sichergestellt werden. Dadurch wird auch ge­ währleistet, dass – wo nötig – Zielwerte auf die jeweiligen Planvorgaben angepasst werden und somit die Zielkongruenz sichergestellt ist. Drei elementare Bausteine der Implementierung Das Vorgehen der TME AG zur Entwicklung eines umfassenden KPI-Systems basiert generell auf drei iterativen und sich wechselseitig beeinflus­ senden Schritten. Diese sind in der folgenden Grafik dargestellt. 30 § TME-Vorgehensmodell für die Implementierung 1. Definition geschäftsspezifischer KPI Entwicklung von ReportingLösungen 3.Entwicklung von Reporting-Lösungen Zuschneiden auf Geschäftsprozesse und Organisationseinheiten 3. geschnitten. Bezüglich der Aufbauorganisation kann dies bedeuten, dass einzelne KPI von der Management-Ebene bis auf Abteilungs­ebene oder Team-Ebene herunterzubrechen sind. Denkbar sind aber auch KPI, die nur bis zu ­einer bestimmten Organisationsebene aggregiert werden (z. B. Anzahl der Kundengespräche im ­Bereich Key-Account). 2. Quelle: TME AG Research 2016 1.Definition geschäftsspezifischer KPI Im Vordergrund stehen hier Fragen wie, in wel­ chem geografischen Markt ist das ­FinTech tätig, was sind die Kundenzielgruppen, bzw. welche Produkte sollen über welche Vertriebswege angeboten werden. Wichtige Anhaltspunkte liefert dazu insbesondere ein aussagekräftiger Business­plan. Im Rahmen der Definition der ­individuellen KPI werden bereits auch die ver­ schiedenen Interessen der Stakeholder berück­ sichtigt. Darüber ­hinaus geht mit der Festlegung der KPI als ­oberste Schlüsselkennzahlen auch der Aufbau der dahinterstehenden Werttreiberbäu­ me einher. Ein Dashboard mit allen wichtigen Kennzah­ len hilft, sich auf das zu konzentrieren, was das ­Unternehmen ausmacht, die Motivation für das Kerngeschäft zu erhalten und dessen Wachstum voranzutreiben. Einsichten sollten einfach visua­ lisiert, flexibel für jeden Mitarbeiter erweiterbar und auch auf verschiedenen mobilen Endgeräten nutzbar sein. Eine Kombination von Transparenz, Effizienz und Flexibilität beeindruckt darüber hin­ aus auch Investoren. 2.Zuschneiden auf Geschäftsprozesse und ­­Organisations­­einheiten Im nächsten Schritt werden die KPI mit ihren Werttreiberbäumen auf die Geschäftspro­zesse und verschiedenen Organisationseinheiten zu­ Wie die Untersuchung gezeigt hat, gelten die generell gültigen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Implementierung eines KPI-Systems 31 Dashboard – Anzeige der Top-KPI auf verschiedenen Endgeräten Fazit Während der Aufbauphase eines FinTechs den­ ken viele in erster Linie an Wachstum, Umsatz, Kundenzahlen. Der gleichzeitige Aufbau einer adäquaten Unternehmensteuerung, zu der auch ein funktionierendes KPI-System gehört, wird demgegenüber eher als nachrangig behandelt bzw. als nachholbar gesehen. Mitunter kann sich diese Vernachlässigung jedoch negativ und bisweilen sogar existenziell auf die individuelle ­Unternehmensentwicklung auswirken. Autoren: Thomas Deibert, Jochen Schneider auch bei FinTechs. Gerade in der Anfangsphase einer Unternehmung sollte es auch ein vordring­ liches Ziel sein, möglichst schnell ein funktio­ nierendes System von KPI zu implementieren, welches auch von den Mitarbeitern verstanden und akzeptiert wird. Der konkrete Aufbau des KPI-­Systems kann immer nur individuell vorge­ nommen werden. Eine Weiterentwicklung und regelmäßige Überprüfung darf dabei selbstver­ ständlich nicht außer Acht gelassen werden. Mit seinen drei elementaren Bausteinen stellt das bewährte TME-Vorgehensmodell zur Implemen­ tierung ­eines KPI-Systems die adäquate Basis dar. Quelle: TME AG Research 2016 Transformation Management Das Management von Veränderungen ist eine zentrale Führungsaufgabe und zwar auf jedem hierarchischen ­Level. Wenn wir die strategische Dimension von aktiv geplanten Transformationsvorhaben betrachten, sehen wir den Top-Manager in einer erfolgskritischen Position. Er nimmt eine zentrale Gestaltungsrolle ein, die sich nicht ­delegieren lässt. Verändern heißt, initiieren, antreiben und vorangehen in das Zielbild. Hoch wirksam sind authen­ tisches Vorleben, transparente Kommunikation und vor allem die Einbindung der Mitarbeiter von Beginn an. Zudem sollte ein tragfähiges Commitment geschaffen werden und der Weg durch die typischen Herausforderungen eines Veränderungsvorhabens gemeinsam bewältigt werden. Irrtum ist ein inhärenter Bestandteil der Lernkurve. Eine Transformation ist nur erfolgreich, wenn vorher jeder Beteiligte einen aktiven Lernprozess durchlaufen hat. Die TME Berater sind Experten für innovative Geschäftsmodelle und erfolgreiche Business Transformationen. Von der Strategie über die Planung bis hin zur Umsetzung. Dabei sind die zwei wesentlichen Erfolgstreiber die konse­ quente Ausrichtung am Kunden und seinen Bedürfnissen sowie die Ausschöpfung von Digitalisierungspotenzialen für neue Wachstumschancen. In 2016 hat das TME Institut dazu folgende Publikationen veröffentlicht: Kundenwertmanagement im Private Banking: Modelladaption für eine schlafende Branche Whitepaper, September 2016, 4 Seiten Autoren: Volker Errolat, Tobias Liesenfeld 33-36 Das Vermögen von Private Banking-Kunden wächst. Und dennoch ist der Profitabilitätsdruck der Branche höher denn je, denn das Kundenverhalten im Private Banking hat sich seit der Finanzmarktkrise stark verändert. Zwar werden die Geschäftsmodelle durch Digitalisierung und Outsourcing kosteneffizienter, ein Ausgleich der Umsatz­ rückgänge konnte durch diese Verbesserung aber bislang noch nicht erzielt werden. Soll vor diesem Hintergrund die Effektivität der Berater im Private Banking gesteigert werden, ist eine Gleichbehandlung aller Kunden kontra­ produktiv. Bei gegebenen Ressourcen kann es vielmehr lohnend sein, besonders wertvolle Kunden zu identifizieren und differenziert anzusprechen. HR muss Teil der Transformation zum digitalen Wandel sein! Was muss HR dazu liefern und tun? Whitepaper, Dezember 2016, 2 Seiten Autoren: Stephan Paxmann, Marco Leist, Barbara Liebermeister 37-38 Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen werden sich kurz- bis mittelfristig nachhaltig verän­ dern. Unter anderem steigt der Kostendruck und werden die Regularien immer schärfer. Beides treibt die nötigen Veränderungen ebenso wie der demografische Wandel und die Digitalisierung. In dieser Situation muss HR unbe­ dingt in die Transformation eingebunden werden und sich dabei selbst transformieren. 32 TME Institut | September 2016 Kundenwertmanagement im Private Banking: Modelladaption für eine schlafende Branche „Kundenwertmanagement macht Unternehmen erfolgreicher!“ – so ein aktuelles Ergebnis ­einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2016. Im Sinne einer Effektivitätssteigerung der ­Berater-Aktivitäten im Private Banking ist also eine beinahe Gleichbehandlung aller Kunden ­kritisch zu hinterfragen. Bei ­gegebenen Ressourcen kann es vielmehr lohnend sein, besonders wertvolle Kunden zu identifizieren und dementsprechend diese auch differenziert a­ nzusprechen. Das Vermögen von Private Banking-Kunden wächst. Und dennoch ist der Profitabilitätsdruck der Branche höher denn je, denn das Kunden­ verhalten im Private Banking hat sich seit der Finanzmarktkrise stark verändert. Zwar werden die Geschäftsmodelle durch Digitalisierung und Outsourcing kosteneffizienter, ein Ausgleich der Umsatzrückgänge konnte durch diese Verbes­ serung aber bislang noch nicht erzielt werden. Die Cost-Income-Ratio wird also aller Voraus­ sicht nach weiter steigen. Hinzu kommen immer zahlreichere Regulierungen, notwendige Wei­ terentwicklungen von Preismodellen, eine neue Kundengeneration, wachsende Illoyalität und ein verändertes Rollenprofil des Private Bankers als zusätzliche Herausforderungen der Branche.¹ Die Herausforderungen an das Private Banking ändern sich Erfolgsfaktor Kundenwertmanagement Eine differenzierte Ansprache besonders wert­ voller Kunden kann eine Antwort auf die Frage geben, wie Private Banker auf diese Herausfor­ derungen reagieren können, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Was aber macht in diesem Zusammenhang einen Kunden „wertvoll“? Die Konzeption eines Kundenwertes und ein darauf aufbauendes aktives Kundenwertmanagement helfen bei der Beantwortung dieser Frage.² Kundenwertmanagement Unter Kundenwertmanagement wird die Planung, Steuerung, Implementierung und Kontrolle aller auf den aktuellen und ­potentiellen Kundenstamm gerichteten ­Aktivitäten mit dem Ziel, den Kundenwert aus Unternehmenssicht zu optimieren, ver­ standen.³ Wir zeigen in diesem Beitrag Anforderungen sowie den Status Quo verschiedener Methoden der Kundenwertberechnung im Private Banking. Dabei darf der Kundenwert als das Entschei­ dungskalkül für ein erfolgreiches Kundenwert­ Quelle: TME AG Research 2016, in Anlehung an privat banking magazin, 2014. management jedoch nicht nur einseitig aus der Perspektive des Private Bankers gesehen wer­ den. Denn aus Kundensicht wird Kundenwert als Werthaltigkeit oder Präferenz der erhal­tenen Bankleistung verstanden, wogegen sich mit Kundenwert aus Bankensicht der ökonomische Wert von Kunden, Segmenten bzw. Geschäfts­ beziehungen beschreiben lässt. Wir verstehen den Kundenwert deshalb als eine Kennzahl, wel­ che aus Sicht des Private Bankings den Vergleich zwischen den in eine Kundenbeziehung investier­ ten Ressourcen und dem daraus resultierenden Nutzen darstellt. Anforderungen an die Kundenbewertungs­ methode Bei der konkreten Modellierung des Kundenwer­ tes sind sieben wesentliche Anforderungen des Private Bankings an die Berechnungs­methode zu berücksichtigen. 1.Auf Ebene des einzelnen Private-BankingKunden müssen als Grundvoraussetzung die Bewertungskriterien mit den vorhandenen Datenerhebungsmethoden zugänglich und operationalisierbar sein. _______________________ _______________________ ¹ vgl. Spellacy/Patel, 2016, private banking magazin, 2014 sowie TME AG Research, 2016. ²vgl. Mengen/Liesenfeld, 2016. ³Wirtz/Schilke, 2004, S. 28. 33 2.Das Kundenwertmanagement erfordert die Akzeptanz der Berater. Deshalb sollte die Kundenbewertung möglichst transparent und ­damit nachvollziehbar erfolgen. 3.Neben monetären Größen müssen darüber hinaus auch nicht-monetäre Größen (z. B. ­Referenzpotential und Loyalität) in der Kun­ denbewertung Berücksichtigung finden, da sich Private Banking heute mehr denn je als ein Geschäftsfeld mit sehr hohem Ertrags­potential der Kunden versteht. 4.Um die ökonomische Effizienz der Kunden­ bewertungsmethode zu wahren, ist weiterhin die Wirtschaftlichkeit der Kundenwertanalyse sicherzustellen. 5.Ferner ist die Modellierung des Kunden­ wertes erst dann sinnvoll, wenn sich aus der Bewertungsmethode konkrete kundenwert­ steigernde Maßnahmen ableiten lassen. 6.Da der Diskretion im Private Banking nach wie vor ein großer Stellenwert beigemessen wird, sind die Kundenbewertungsdaten vor unbe­ rechtigten Dritten zu schützen. Es empfiehlt 1.sich, die Daten in einer Form zu erheben, die dem Kunden nicht unmittelbar eine Beurtei­ lung seiner eigenen Attraktivität offeriert. 2.Die herangezogene Bewertungsmethode ­sollte schließlich auf einem dynamischen ­Verständnis des Kundenwertes aufbauen und somit eine Prozesspflege und ein Controlling der relevanten Daten erlauben. Systematisierung verschiedener Kundenbewertungsmethoden Um den Kundenwert zu berechnen und zu prog­ nostizieren, sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Methoden vorgeschlagen worden. Bis heute fehlt es hierbei jedoch an einer einheit­ lichen Systematisierung dieser Methoden, da sie sich nach zahlreichen Kriterien differenzieren las­ sen. Wir schlagen deshalb eine ­Einordnung nach der Art sowie der Dimension der Bewertungs­ kriterien vor, wie in nachstehender Abbildung dargestellt. Monetäre Kundenbewertungsverfahren, welche insbesondere Größen wie Umsatz und Kosten berücksichtigen, übernehmen die Daten ­häufig ­direkt aus dem Reporting. Dem gegenüber­ gestellt verzichten nicht-monetäre Methoden auf eine exakte Quantifizierung der Wert­beiträge. Sie rücken stattdessen eine qualitative Bewer­ tung der Kundenbeziehung in den Vordergrund. Eindimensionale Verfahren beziehen sich in ­ihrer Bewertung auf eine zentrale Größe, ­wogegen mehrdimensionale Ansätze verschiedene ­Kriterien in die Berechnung mit einfließen lassen. Gegenüberstellung verschiedener bewertungsmethoden Kunden­ Die Kundenumsatzanalyse ist die wohl ­einfachste Möglichkeit, den Kundenwert auf Grundlage monetärer Größen zu berechnen. Im Private Banking werden dazu die Gebühren aus den erstellten oder vermittelten Finanzdienst­ leistungen innerhalb einer bestimmten Abrech­ nungsperiode verwendet. Andere Faktoren, wie bspw. notwendige Kosten in einen Kunden oder eine Kundenbeziehung bleiben unbeachtet. Im­ plizit unterstellt die Umsatzanalyse einen höhe­ ren Kundenwert in Folge eines höheren absolu­ ten Umsatzes des Kunden. Bei der Kundendeckungsbeitragsanalyse han­ delt es sich um eine kurzfristige, einperiodige Erfolgsrechnung. Dazu wird die verursacherge­ rechte Beitragshöhe an den Fixkosten durch den Absatz einer bestimmten Finanzdienstleistung oder eines Leistungsbündels ermittelt. Für das Private Banking heißt dies, dass die Ergebnis­ beiträge der einzelnen Konten eines Kunden zu addieren sind. Dies kann dazu führen, dass ein negativer Beitrag des einen Kontos den positiven Deckungsbeitrag des anderen Kontos übersteigt. Eine Kündigung des Kundenwert belastenden Kontos kann jedoch eine Gefährdung der gesam­ ten Kundenbeziehung nach sich ziehen. Deshalb sind bankpolitische Anpassungsmaßnahmen erst auf Basis der Kundenkalkulation, nicht aber auf Kontokalkulation sinnvoll. Durch die Methode des Customer Lifetime Value (CLV) werden Prinzipien der Investitions­ rechnung auf die Kundenbeziehung übertra­ gen. Er fußt in seiner originären Form auf der Kapital­wertmethode. Demnach besteht der Wert ­eines Kunden aus den abdiskontierten, direkt zu­ rechenbaren Einzahlungsüberschüssen über die gesamte Dauer der Kundenbeziehung (oftmals auch inkl. des old money). Dabei gilt es zu beach­ ten, dass im Rahmen des CLV der Kunde häufig isoliert betrachtet wird. Dadurch können Infor­ mationen über mögliche Verhaltenstendenzen im gesamten Kundensegment und Auswirkungen auf den Gesamt-Cash-Flow des ­Private Bankers verloren gehen. Der Risk Adjusted Lifetime Value (RALTV) be­ zieht neben dem gegenwärtigen und für die Zukunft geschätzten Cash-Flow einer Kunden­ beziehung auch die Auswirkung dieser Kun­ Kundenwertmodelle lassen sich anhand verschiedener Kriterien systematisieren denbeziehung auf den Risikograd eines Kun­ denportfolios mit ein. Kern des RALTV ist der Kunden-­Betafaktor. Dieser ist vergleichbar mit dem Betafaktor zur Bewertung des systemati­ schen Risikos von ­Aktien. Dadurch kann letztlich das Risiko-­Rendite-Verhältnis des Kunden und des Gesamtportfolios beurteilt werden. Durch die Loyalitätsleiter werden die aktuellen bzw. potentiellen Kunden nach ihrer Bindung in verschiedenen Sprossen – von Private Banker ist Hauptbankbeziehung und Multiplikator bis hin zu keine Kenntnis des Private Bankers – katego­ risiert. Zwar ist diese Methode in ihrem Ansatz intuitiv leicht zugänglich. Jedoch scheint insbe­ sondere die Datenerhebung problematisch: Es ist durchaus anzunehmen, dass ein Private-Ban­ king-Kunde mehrere Bankbeziehungen unterhält und nicht immer gewillt ist, über seine Hauptund Nebenbankbeziehung Auskunft zu geben. Die Kundenportfolioanalyse ist eine beson­ dere Form der Bewertung anhand bestimmter Kunden­merkmale. Dabei erfolgt die Bewer­ tung der ­Kunden im Hinblick auf ihre Investi­ tionswürdigkeit anhand zweier, möglichst ­differenzierter Dimensionen. In der Regel werden dazu die Kriterien Kundenattraktivität und eigene Wettbewerbsposition des Private Bankers herangezogen. Im Gegensatz zu den ­bereits vorgestellten Methoden ermöglicht die Kundenportfolio­analyse damit die direk­ te und gleichzeitige Bewertung von mehreren ­Private-Banking-Kunden. Diese werden häufig in einer Matrix gegenübergestellt. Weiterhin steht damit nicht die Bewertung des einzelnen Kun­ den, sondern vielmehr die Zusammensetzung der Kundenstruktur im Vordergrund. Status Quo: Nur selten berücksichtigen Private Banker zukunftsgerichtete Potentiale Insgesamt zeichnet sich in der Praxis bis heute ein klares Bild ab: Banken greifen überwiegend auf nach wie vor leicht verfügbare Kriterien wie Assets under Management zurück. Nur wenige Private Banker betrachten den Deckungsbei­ trag und beziehen damit auch die Kosten und Aufwände in die Kundenbewertung mit ein. Zu­ kunftsgerichtete Methoden, wie insbesondere der CLV, finden hier kaum praktische Beachtung. Dadurch bleiben oftmals große, in der Zukunft liegende Potentiale unberücksichtigt. Dabei braucht es nicht zwangsläufig der „theoretisch eleganten“ Lösung des CLV, welche un­ ter Umständen über die Umsetzungsprobleme in der Praxis hinwegtäuscht. Es kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass (nur) der Kundenberater seine Kunden und insbesonde­ re auch die damit verbundenen Potentiale am besten einschätzen kann. Daher bedarf es also ­einer Kundenbewertungsmethode, welche die­ Quelle: TME AG Research 2016. 34 sen selbst als Informationsquelle der Bewertung in den Mittelpunkt stellt. Zu empfehlen ist des­ halb die Entwicklung eines mehrdimensionalen ­Scoring-Modells für das Private Banking. Um zusätzlich auch den relativen Ertrag der Kun­ denbeziehung zu berücksichtigen, ist ferner der „Return on Assets“ als möglicher Indikator mit in die Kundenwertmodellierung aufzunehmen. Fokus: Umfassende Scoring-Methoden Denkbar ist auch, als weiteres Kriterium den „Durchschnittsumsatz je Bankauftrag“ heranzu­ ziehen, da die Preisgestaltung noch immer stark transaktionsbezogen ist. Bei dieser Kennzahl ist jedoch zwischen Anlageberatungs- und Vermö­ gensverwaltungsmandat zu unterscheiden, da nur bei Erstem der Kunde diese Kennzahl selbst beeinflussen kann. Eine umfassende Bewertung des Kunden setzt eine Berücksichtigung von monetären und nicht-monetären Kriterien voraus. Denkbar ist bspw. die Aufrechterhaltung einer Kundenbezie­ hung trotz negativem Deckungsbeitrag, da der Kunde als guter Multiplikator das Akquisitions­ potential des Private Bankers stark beeinflusst. Eine Methode, welche die Aggregation dieser beiden Kriteriumsausprägungen zulässt, ist das Scoring-Modell. Grundsätzlich werden im Rahmen dieser ­Methode Kriterien unterschiedlichster Art – also auch qualitative Aspekte – zunächst einzeln ­bewertet und über eine Gewichtung zu einem ein­ dimensionalen Kundenwert zusammen­gefasst. Es besteht jedoch die Gefahr, dass durch eine additive Verknüpfung viele unwichtige Kriterien mit hoher Wertung ein zentrales Kriterium mit schlechter Wertung überkompensieren. Diesem kann durch eine multiplikative Verknüpfung der gewichteten Merkmalsausprägungen und Wert­ treiber Abhilfe geschaffen werden. Dann könnte auch die Bewertung eines nicht vorhandenen Minimalwertes mit Null als Knock-Out-Funktion für den gesamten Kundenwert genutzt werden. Eine solche multiplikative Verknüpfung reagiert allerdings sehr stark auf Extrembewertungen, sodass im Rahmen der Kundenbewertung statt­ dessen eine besonders starke Gewichtung des entsprechenden Faktors in einer additiven Ver­ knüpfung nahezulegen ist. Die Herausforderung dieses Modells liegt in der Identifikation aller relevanten Werttreiber und Merkmale bzw. Indikatoren von Kundenbe­ ziehungen. Mehr als Einkommen, Alter und Vermögen Das empfohlene Scoring-Modell umfasst ­neben den monetären Werttreiber „gegenwärtige ­ finanzielle Beiträge“ und „Cross-Selling-­ Potential“ auch auf nicht-monetärer Ebene die Faktoren „Referenzpotential“, „Informations­ potential“ ­sowie „Garantiepotential“. An dieser Stelle sei ein etwas genauerer Blick auf die einzel­ nen Faktoren geworfen und mögliche Kennzah­ len des jeweiligen Werttreibers angesprochen.⁴ Gegenwärtige finanzielle Beiträge Viele Private Banker halten den „absoluten Umsatz des Kunden mit dem Private Banker“ für den zentralen monetären Bestandteil des Kun­ denwerts. Dies kommt auch durch die klassische ABC-Analyse der Kundenklassifikation zum Aus­ druck, denn sie basiert in der Regel auf genau dieser Größe. _______________________ ⁴ vgl. im Folgenden auch Foehn, 2006, S. 126ff. 35 Spannend ist die Betrachtung des „Share of ­Wallet“. Durch diese Kennzahl der Kundendurch­ dringung wird nämlich die Herausforderung der zunehmenden Illoyalität im Private Banking ­berücksichtigt. Cross-Selling Potential Das Cross-Selling Potential reflektiert den ­gegenwärtig vorhandenen Bedarf an Produktund Beratungsleistungen, welche zwar am Markt angeboten, aber noch nicht im eigenen Leis­ tungsangebot des Private Bankers berücksichtigt werden. Letztlich resultiert das Cross-Selling Potential dabei aus Merkmalen des Kunden, der Umwelt des Kunden, der Finanzdienstleistung, der Geschäftsbeziehung sowie des Anbieters. Sicherlich lassen sich vielzählige Kennzahlen ­heranziehen, um diese Merkmale zu erfassen. Um den Bedarf an zusätzlichen Finanzdienstleis­ tungen operationalisieren zu können, empfehlen sich daher die „Lebensphase des Kunden“ sowie die „zukünftige Entwicklung des Kundenvermögens“ als geeignete Indikatoren. Zu berücksichtigen ist dabei aber auch die Cross-Buying-Bereitschaft des Kunden. Diese Bereitschaft kann durch die Art der Geschäfts­ beziehung („Haupt oder Nebenbank“) und der „Risikobereitschaft des Kunden“ quantifiziert werden. Referenzpotential (Multiplikatorfunktion) „Your best salesman is a satisfied customer.“ Diese Feststellung beschreibt sehr treffend die Notwendigkeit der Berücksichtigung des ­Referenzpotentials. Dieses Potential bestimmt sich maßgeblich durch die „Zufriedenheit des Kunden“, welche er an die potentiellen Referenz­ empfänger („Anzahl“) in entsprechender „Referenzhäufigkeit“ weiter transportiert. Dabei ist jedoch auch die Berücksichtigung des „Vermögens der Referenzempfänger“ spannend, denn die sich aus dem Potential ergebende Chance für den ­Private Banker steigt mit zunehmendem Ver­ mögen der Referenzempfänger. Informationspotential Aus der Überlegung, den Kunden als Res­source des Private Bankers zu betrachten, wird eine Einbeziehung des Kunden bei der tendenziell komplexer werdenden Leistungserstellung nach­ vollziehbar. Letztlich weiß nur der Kunde, welche Leistungen er beim Private Banker nachfragen wird. Deshalb sind also seine Informationen bzw. Feedbacks zu berücksichtigen. Dabei wird ein Kunde umso wertvoller, je qualitativ hochwerti­ ger und je selbstständiger er Informationen zur Verfügung stellt. Das zu empfehlenden Scoring-Modell verknüpft verschiedene Kundenpotentiale zu einem ­Gesamtkundenwert Kundenwert-Scoring Beispielkunde Legende zur Bewertung 1 = sehr niedrig 5 = sehr hoch Gegenwärger finanzieller Beitrag + Cross-Selling Potenal + Referenzpotenal + Informaonspotenal Gewichtung [%] • Absoluter Umsatz des Kunden mit dem Private-Banking-Anbieter • Return on Assets • Share of Wallet • Neo-Neugeld in einer besmmten Abrechnungsperiode •… 7,6 7,6 7,3 8,9 Scoring-Werte zum gegenwärgen finanziellen Beitrag 31,4 • Private-Banking-Anbieter ist Haupt-, starke oder schwache Nebenbank • Lebensphase des Kunden • Risikobereitscha des Kunden • Zukünige Entwicklung des Kundeneinkommens/Kundenvermögens •… 7,4 7,4 8,1 7,8 Scoring-Werte zum Cross-Selling-Potenal 30,7 • Zufriedenheit des Kunden mit dem Private-Banking-Anbieter • Anzahl poteneller Referenzempfänger des Kunden • Vermögen und Einkommen der Referenzempfänger • Referenzhäufigkeit des Kunden •… 7,0 5,8 5,7 5,6 Scoring-Werte zum Referenzpotenal 24,1 • Häufigkeit von Kundeninformaonen/Feedbacks • Qualität der Kundeninformaonen/Feedbacks • Selbstständigkeit des Kunden in Bezug auf Informaonen/Feedbacks •… 5,4 4,2 4,2 Scoring-Werte zum Informaonspotenal Kundenpotenal * Garanepotenal Scoring-Wert Bewertung 0,23 0,15 0,22 0,89 4 2 4 5 0,30 0,15 0,32 0,39 5 2 3 3 0,35 0,12 0,17 0,17 4 3 4 0,22 0,13 0,17 1,49 1,16 0,81 13,8 0,52 100,00 • Dauer der Kundenbeziehung • Loyalität des Kunden zur Bank • Kooperaonsbereitscha des Kunden • Zukünige Zahlungswilligkeit des Kunden •… Scoring-Werte zum Garanepotenal Risikoadjuserter Kundenwert Quelle: TME AG Research 2016. 25,7 26,5 25,4 22,4 100,00 Gewichteter Kundenwert 3 2 3 1 3,98 1 4 3 4 0,26 1,06 0,76 0,87 2,95 11,74 Garantiepotential Das Garantiepotential kann auch als Risikowert der Kundenbeziehung verstanden werden. Im Mittelpunkt steht somit die Quantifizierung des Kundenbindungsgrades bzw. der Abwan­ derungswahrscheinlichkeit. Somit relativiert dieses Potential in der Verknüpfung mit den anderen Kundenwertfaktoren den berechneten Kundenwert. Die „Dauer der Kundenbeziehung“ reflektiert die Vertrautheit des Kunden mit dem Private Banker, was letztlich die Wahrscheinlichkeit der Fortset­ zung der Geschäftsbeziehung positiv beeinflusst. Neben dieser rein quantitativen Messgröße werden durch die Loyalität des Kunden und die ­Kooperationsbereitschaft des Kunden auch qua­ litative Aspekte der Einstellungsdimension und der Handlungsdimension zusammengeführt. Der Herausforderung der zunehmenden Preis­ sensitivität des Kunden wird schließlich durch die „zukünftige Zahlungswilligkeit des Kunden“ mitberücksichtigt. Ausblick: Kundenwert gemessen. Und jetzt? Die Bewertung von Kunden mündet in einem auf den Kunden ausgerichteten Dreiklang von Private-Banking-Team, Kanal der Kunden­ ansprache sowie angebotenen Produkte bzw. Beratungsleistungen. Die sich daraus ableitbaren konkreten Maßnahmen (bspw. stärkere Ansprache über ­online-Angebote) führen damit zu einer Effektivitätssteigerung der Aktivitäten im Private Banking und letzt­ lich zu einem erhöhten Deckungsbeitrag. Da­ bei resultiert die Kundenbewertung und die daraus ergebende konsequente und stetige Steuerung der Kunden auch in einer Objekti­ vierung der Kundenaffinität der Berater. Dies ist insbesondere aus Sicht des Controllings höchst interessant, denn dadurch eröffnen sich vielseitige Kontroll- und Steuerungs­ möglichkeiten des Private Bankings. Durch die geschickte Integration in bestehende IT-Systeme bleibt das Kundenwertmanage­ ment dabei transparent und erleichtert den Arbeitsalltag des Private Bankers wesentlich. Fazit Aktives Kundenwertmanagement macht Un­ ternehmen erfolgreicher. Es kann den Private ­Bankern dabei helfen, auf die sich stark ändern­ den Herausforderungen, insbesondere das neue Rollenprofil, zu reagieren. Bei der Bewertung von Kunden ist eine Betrach­ tung von rein monetären Größen nicht weit ge­ nug gedacht. Vielmehr sollten auch qualitative Aspekte in die Bewertung mit einbezogen wer­ den. Denn erst dadurch werden Potentiale auf­ gedeckt und können genutzt werden. Es braucht dabei nicht zwangsläufig die hoch­ komplexe Bewertungsmethode, welche am Ende des Tages nicht mehr als eine erhöhte ­Pseudo-Genauigkeit suggeriert. Vielmehr ist der Kundenberater zentraler Dreh- und Angelpunkt der Bewertung: Keiner kennt seine Kunden bes­ ser als er selbst. Das vorgestellte Scoring-Modell berücksichtigt in seiner Bewertung neben monetären Größen auch qualitative Potentiale des Kunden. Darüber hinaus überzeugt es durch seine hohe Trans­ parenz. Wesentlicher Vorteil ist aber die relativ einfache Umsetzbarkeit dieses Modells in der Praxis. Und das bei vergleichsweise sehr gerin­ gen Kosten. Literatur Foehn, 2006: Kundenwert im Private Banking, Zürich. Mengen/Liesenfeld, 2016: Logistische Regressi­ onsanalyse: Erfolgreich mit Kundenwertmanage­ ment, in: Controlling, Oktober. private banking magazin, 2014: Die sechs größten Herausforderungen für das Private Banking (online unter: https://www.priva­ te-banking-magazin.de/studie-die-sechs-groess­ ten-herausforderungen-fuers-private-ban­ king-1402997314/?page=1). Spellacy/Patel, trends. 2016: wealth management Wirtz/Schilke, 2004: Ansätze des Kundenwert­ managements, in: Wirtz/Göttgens (Hrsg.): Inte­ griertes Marken- und Kundenwertmanagement, Wiesbaden. Autoren: Volker Errolat, Tobias Liesenfeld 36 TME AG | November 2016 HR muss Teil der Transformation zum digitalen Wandel sein! Was muss HR dazu liefern und tun? Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen werden sich kurz- bis ­mittelfristig ­nachhaltig verändern. Ja, zum einen sind die ­Unternehmen gezwungen, sich aufgrund des enormen Kostendrucks sowie der ­steigenden ­Regulatorik durch die Politik zu verändern. Zum anderen sind aber die fehlende ­Attraktivität ­verschiedener Branchen, der demografische Wandel, sowie der globale Druck durch das ­Zusammenwachsen der digitalen Welt, Treiber dieser Veränderungen. Digitale Transformation: Zu berücksichtigende Themenfelder und Fragen im Rahmen der Transformation des HR-Bereiches Speziell bei Fragen der Unterstützung von ­neuen, oftmals digitalen Herausforderungen, ist es aus personalpolitischer Sicht wichtig, eine ab­ gestimmte digitale HR-Strategie aufzusetzen. Wie viel „Digitales“ ist denn realistisch wirklich ­gefordert und wie „digital“ sind die Bereiche, Führungskräfte und Mitarbeiter. Wer definiert also, was zukünftig benötigt wird, und zwar nicht nur aus fachlicher Sicht, sondern im Hinblick auf methodische Fähigkeiten. • Digitale HR-Strategie abgeleitet aus Unternehmensstrategie • Anteil der HR-Strategie in der Unternehmensstrategie • Zukunsfie Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikaon • Benögte digitale Tools und Systeme für Mitarbeiter zur Weiterentwicklung HR-Leistungsporolio • Bewusstsein über Bedürfnisse der Kunden • Bewusstsein über gewünschte Dienstleistungen / Produkte im HR von Seiten der Kunden • Bewusstsein über angebotene, anzubietende und benögte Dienstleistungen / Produkte im HR-Bereich Was muss HR jetzt liefern? Die wichtigste Herausforderung für HR ist jetzt die Transformation, weg von einer stark operativ geprägten Personalarbeit, hin zur Bereitstellung von strategischen Entscheidungsgrundlagen, ­basierend auf einem an der Unternehmensstra­ tegie und den Kundenanforderungen ausge­ richteten HR-Leistungsportfolio. Darüber ­hinaus bilden personalwirtschaftliche Kennzahlen die Grundlage, auf denen die Geschäftsleitung ­zukunftsweisende Entscheidung trifft. Was muss HR jetzt tun? HR muss sich hinterfragen, ob das von HR ange­ botene Leistungsportfolio, an der Bedarfsstruk­ tur der internen und externen Kunden ausge­ richtet ist? Bei den internen Kunden ist es unter anderem wichtig, die richtigen Qualifizierungs­ maßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter ­zukunftsgerichtet am digitalen Wandel anzubie­ ten. Für externe Kunden müssen die Instrumente attraktiv sein, um das Unternehmen am Markt zu positionieren und als interessanter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Folgende Fragen zu den einzelnen Themen sollten Sie im Rahmen der Transformation des HR-Bereiches beantworten können. Fragen zur Strategie: • Haben wir eine digitale HR-Strategie, die sich aus der Unternehmensstrategie ableitet? 37 Personalwirtschaliche Kennzahlen Strategie • Kennzahlenbasierte Personalarbeit verfügbar • Richge Informaonen zum richgen Zeitpunkt für strategische Entscheidungen und die operave Steuerung verfügbar Prozesse • Geschäsmodell für Kunden klar strukturiert und Verantwortlichkeiten klar definiert • Klare Zuständigkeiten innerhalb des Verantwortungsbereiches • Grad der Standardisierung und Automasierung der eigenen Prozesse Quelle: TME AG Research, 2016 • Wie viel Anteil der HR-Strategie steckt in unse­ rer Unternehmensstrategie? • Sind unsere Mitarbeiter(-innen) zukunftsfit und entsprechend qualifiziert? Fragen zu Prozessen: • Ist unser Geschäftsmodell für den Kunden klar strukturiert und weiß er, welcher Verantwort­ liche bei welchem Thema anzusprechen ist? • Welche digitalen Tools und Systeme benötigen • Haben wir klare Zuständigkeiten innerhalb des unsere Mitarbeiter zur eigenen Weiterent­ wicklung? Fragen zum HR-Leistungsportfolio: Verantwortungsbereiches? • Inwiefern sind unsere Prozesse schon standar­ disiert und automatisiert? • Kennen wir die Bedürfnisse unserer Kunden? Fragen zu personalwirtschaftlichen Kennzahlen: • Wissen wir welche Dienstleistungen / ­Produkte • Verfügen wir über eine kennzahlenbasierte sich unsere Kunden von HR wünschen? Personalarbeit? • Wissen wir welche Dienstleistungen / ­Produkte • Stehen wir als HR-Bereich unseren Kunden anbieten, ­anbieten müssen und anbieten sollten und welche Produkte unser Kunde nicht benötigt, wir ihm aber trotzdem anbieten? uns die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt für unsere strategischen Entscheidungen und die operative Steuerung zur Verfügung? Unsere Unterstützung für Ihr HR Die TME AG, als Spezialist im Bereich des Trans­ formationsmanagements, unterstützt Sie bei der Beantwortung dieser Fragen, entwickelt mit ­Ihnen ein an den Kundenbedürfnissen bedarfs­ gerecht ausgerichtetes HR-Leistungsportfolio und zeigt Ihnen auf, welche Prozesse im Sinne des digitalen Wandels standardisiert und auto­ matisiert werden können. Wir helfen Ihnen dabei, HR als strategischen Partner des Business zu platzieren. • Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung ­einer erfolgreichen und nachvollziehbaren HR-­ Strategie (Mission, Vision, strategische Agenda der Personalarbeit), die sich aus der Unterneh­ mensstrategie ableitet • Wir entwickeln mit Ihnen ein an den Kunden­ bedürfnissen angelehntes Geschäftsmodell • Wir analysieren Ihre Prozesse im Hinblick auf • Wir Standardisierung und Automatisierung • Wir finden heraus, welche Bedürfnisse Ihre Kunden tatsächlich haben, welche Dienstleis­ tungen Sie sich von HR wünschen, welche HR anbieten muss und welche nicht benötigt wer­ den • Wir optimieren Ihr HR-Leistungsportfolio ziel­ gruppengerecht, indem wir sämtliche Leistun­ gen die HR anbietet aufnehmen und diese auf Ihre Wirksamkeit und Nutzen am Kunden hin bewerten • Wir entwickeln mit Ihnen ein passendes per­ sonalwirtschaftliches Kennzahlensystem von ausgewählten KPI Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei nach­ folgenden Themen, die konsequenterweise bei der HR-Transformation mitberücksichtigt ­werden müssen: legen mit Ihnen eine neue HR-Aufbau­ organisation fest, um effizient und effektiv Ihre Strategien umzusetzen und Ihren Mehrwert zu steigern • Wir begleiten Sie professionell in der Vorbe­ reitung von Gremienverhandlungen und ent­ wickeln eine geeignete Gremienstrategie / Verhandlungsstrategie • Wir begleiten Sie in Ihrem Veränderungs­ prozess mit entsprechenden Workshops / ­Coachings und Kommunikationsmaßnahmen Ihr HR trägt mit der richtigen Strategie, dem rich­ tigen Geschäftsmodell, motivierten und gut qua­ lifizierten Mitarbeiter(-innen) entscheidend zum Unternehmenserfolg bei! Autoren: Stephan Paxmann, Marco Leist, Barbara Liebermeister 38 TME Institut für Vertrieb und Transforma­t ionsmanagement e.V. Das TME Institut für Vertrieb und Transformationsmanagement e.V. ist eine Plattform für Forschung und Entwicklung und ­spezialisiert auf Vertrieb und Transformationsmanagement in den Bereichen Digital Banking, Risk & Regulatory, insbesondere zu regulatorischen Anforderungen im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen sowie Transformation Management. Ziel des TME Instituts ist die Entwicklung von Anwendungsmodellen und Lösungsansätzen für konkrete Fragestellungen aus der Praxis. Diese werden über das TME Institut publiziert und in Veranstaltungen vorgestellt und diskutiert. Der zunehmende Mitgestaltungsanspruch von Kunden zeigt die Bedeutung kundenzentrierter Vertriebsmodelle. Entscheidend für den Erfolg bei der Neuausrichtung des Vertriebs im Banking ist die Transformation in ein ganzheitlich am Kunden ausgerich­ tetes Geschäftsmodell. In Enger Zusammenarbeit mit der TME AG führt das Institut Studien zu innovativen Geschäftsmodellen und Digital-Banking-Lösungen durch. Das TME Institut positioniert sich hierbei als führendes Netzwerk zur Verzahnung der Erkenntnisse aus universitärer Forschung mit „Best Practices” sowie etablierten Beratungsmethoden aus den Branchen. Das TME Institut wurde im Dezember 2011 in Bad Soden gemeinsam von Branchenexperten und erfahrenen Beratern aus dem Bereich Banking gegründet. Stephan Paxmann ist Gründer und Vorstand der TME AG sowie 1. Vorsitzen­ der des TME Instituts für Vertrieb und Transformations­management e. V. Zuvor war er als ­Director im International Banking der Allianz SE in München und Paris sowie in der strategischen Konzern­entwicklung der ­Commerzbank AG in Frankfurt tätig. Für die IMG St. Gallen betreute der Wirtschafts­informatiker zudem diverse Projekte im Retail Banking, zuletzt als Co-Leiter der Business Unit „Banking“ DACH. Seine fundier­ te Expertise im Digital Banking baute er u. a. als Managing Director für eConsilium in London sowie als Global Programme Manager bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt und New York auf. E-Mail: [email protected] Stefan Roßbach ist Gründungspartner der TME AG und sitzt im Management Board. Er ist Mitglied im Vorstand des TME ­Instituts. Mit seiner über 20-jährigen Expertise in der Financial-Service-Industrie liegt sein Fokus auf der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle im ­Direct and Digital Banking. Zuvor stellte der er­ fahrene ­Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann sein Können bei internationalen Management­beratungen unter Beweis, wo er u. a. das Beratungsgeschäft für ­Retail Banking der IMG St. Gallen in Deutschland aufbaute. E-Mail: [email protected] 39 IMPRESSUM: TME AG | Hamburger Allee 26-28 | 60486 Frankfurt am Main | Tel: +49 (0)69 7191 309 – 0 | Fax: +49 (0)69 7191 309 – 30 E-Mail: [email protected] | Internet: www.tme.ag | Gesetzlicher Vertretungsberechtigter: Stephan A. Paxmann (Vorstand)| Aufsichtsrat: Holger Boschke (Vorsitzender), Andreas Povel, Markus Becker-Melching Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main | Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 99000 Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Rundfunkstaatsvertrag: TME AG | Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. TME Institut für Vertrieb und Transformations­ management Eine Plattform für ­Forschung und ­Entwicklung im Bereich Financial Services www.tme-institut.de Institut 40 Institut für Vertrieb und Transformationsmanagement e.V. www.tme-institut.de