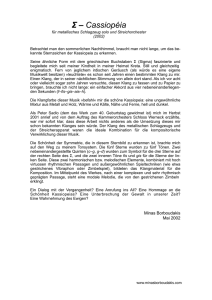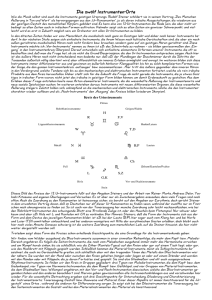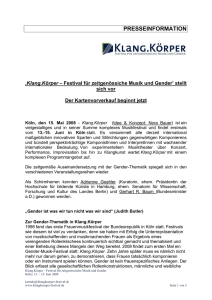Das Dreieck SKN. - von Ralf Beiderwieden
Werbung

Das Dreieck S-K-N. Auge und Ohr. Schüler, Klang und Notenbild Von Ralf Beiderwieden Immer wieder geht es darum, SCHÜLER, KLANG und NOTENBILD zusammenzubringen. „W“ Ein Musikunterricht mit Tafel und Kreide über irgendwelche Dreiklangsumkehrungen ist Unfug, wenn nicht darüber gesprochen wird, wie sich die Umkehrung auf den Klang auswirkt. Selbst wenn sich an so eine Theorie-Sitzung eine Gehörbildungs-Aufgabe anschließt, bleibt es verabsolutierte, sinnlose graue Theorie, wenn nicht gezeigt wird, an welcher Stelle des Musikstückes diese Umkehrung musikalisch bedeutsam wird. Und weil ich im engen musikunterrichtlichen Sinne dafür keine bedeutsame Stelle finden kann, würde ich vermuten: Unterricht über Dreiklangs-Umkehrungen ist fast immer Unfug. Ob da oben im Violinschlüssel g-c-e oder c-e-g oder e-g-c steht, ist musikalisch schnuppe, darum ist die Ausführung im Generalbass ja auch freigestellt. Wichtiger schon kann allerdings sein (und korrekterweise bezeichnet dies der Sachverhalt der Umkehrung), ob der Grundton im Bass liegt oder die Terz, manchmal auch die Septime, selten die Quinte. Der schwebende, noch offene Zustand der meisten Rezitativanfänge, verglichen mit dem schließenden Quintfall der Kadenz im selben Rezitativ, die kraftvollen, ruhigen, farbenreichen Linien der Bassführung in einer Händel-Arie nutzen den Reichtum, der durch die Umkehrbarkeit von Dreiklängen entsteht. (Wobei Händel und die meisten Zeitgenossen damals vom Bass aus gedacht haben und nicht vom Grundton aus; aber eben auch nicht als Dreiklangs-Umkehrung, sondern als Sextakkord über dem Basston.) Oder Intervall-Lehre. Nicht zu fassen, wieviel Unterrichtszeit verschwendet wird, um, ziemlich oft ziemlich wenig kompetent, auch in theoretischer Hinsicht, Schülern einzutrichtern, wieviele Halbtonschritte welche Intervalle haben. Oder so manche arbeitsteilige Gruppenarbeit, in der die Schüler irgendwelche „Parameter“, Melodik oder die Dynamik oder die Rhythmik in Schublädchen stopfen. – Dass hier der „Parameter“-Begriff auch fachlich und didaktisch entwertet wird, dass diese ganzen „Parameter“-Schubläden Quatsch sind, ist an anderer Stelle deutlich genug angemerkt worden (Kapitel „Parameter“ in „Musik unterrichten“). In diesem Zusammenhang hier ist entscheidend, ob die Kinder da, womöglich nach über-minutiösen Teilaufgaben, irgendwelche Sachverhalte auf dem Papier untersuchen – oder ob sie überhaupt versuchen, eine lebendige klangliche Vorstellung zur Sprache zu bringen. In diesen und allen ähnlich gelagerten Fällen lautet die Frage: Ist das, was hier untersucht wird, überhaupt wichtig für den Klang der Musik? Gelingt es hier überhaupt, das, was in der Musik lebendig erklingt, zur Sprache zu bringen? Wenn nicht, ist es schlecht. Dasselbe gilt aber ziemlich bald auch umgekehrt. Wenn das Unterrichtsgespräch über unverbindliches Geplauder, womöglich in stereotypen Vokabeln wie „ruhig, getragen, abgehackt, fröhlich, dramatisch, melodiös, dissonant“ hinauskommen soll, muss genauer hingehört werden. Und von einer bestimmten Genauigkeit an heißt hinhören: In den Notentext schauen. Sehr bald wird zur Sprache kommen müssen, wie sich ein Thema verändert, wenn es von Dur in Moll verwandelt wird. Die Frage „Welche Instrumente spielen mit?“, „Welche Instrumente setzen neu ein?“ werden bald ins Spiel kommen. In Ravels Bolero werden wir nur die allerersten Themen-Einsätze mit dem Ohr bestimmen können. Schon den Einsatz des (klassisch angeblasenen) Saxophons wird kein Schüler-Ohr mehr bestimmen können, die ganze Klangverdichtung, den Einsatz von Quintparallelen, Misch-Klängen, Mixturen müssen wir im Notentext nachvollziehen. Oder die Lehrerin sagt es vor. Wer nicht lesen lernt, muss viel glauben. Emanzipatorische Erziehung muss aber heißen: Befähigen, die Sache selbst nachzustudieren. – All dies sind ganz geläufige Inhalte der Unterstufe. Inhalte der Oberstufe, womöglich aufs Abitur hin zielend, sind damit noch kaum angesprochen. Ein verdecktes Leitmotiv im dritten Akt des Siegfried aufspüren; die Verwandtschaft zwischen Haupt- und Seitenthema im ersten Satz einer Beethoven-Klaviersonate zeigen; polyphone und homophone Passagen in der Bach-Motette vergleichen. Sich fragen, warum Artusi eigentlich über Monteverdis Dissonanzbehandlung so gemeckert hat; oder wie in Schuberts Lindenbaum jene „Eddies“ zustandekommen, diese Stellen, in die der Hörer hineintritt und bei denen er plötzlich nicht mehr weiß, wo er wieder herauskommt und was ihm gerade widerfahren ist, kompositorisch betrachtet. Oder auch, wie, gerade jenseits des Notentextes, sich musikalische Interpretationen voneinander unterscheiden. Inwiefern Simon Rattle denselben Beethovensatz doch so ganz anders klingen lässt als Furtwängler, vielleicht auch Karajan: Wenn das über allgemeine Anmutungs-Äußerungen oder unterschiedliche Metronomangaben hinausgehen soll, müssen wir über agogische Freiheiten sprechen und darüber, wie flächig der eine gestaltet und wie filigran die Begleitfiguren beim anderen herauskommen. – Selbstredend, dass ich mit meinen Schülern über Kategorien wie „Notentext-Treue“, also „Werk-Treue“, zentrale Kategorien der Interpretation, überhaupt erst sprechen kann, wenn wir uns intensiv mit dem Notentext beschäftigt haben. Das macht den „W“-Unterricht über Pop-Musik, über Jazz, oft auch Musical oder Filmmusik oft so schwierig, schwimmend, spekulativ, haltlos: dass die Möglichkeiten fehlen, das, was im Klang passiert, im Notentext wiederzufinden. Also, vorläufig zusammenfassend: Meine Aufgabe als Musiklehrer ist es, Schüler zur Musik zu bringen, hier: im Musik Hören und im Sprechen über Musik. Dazu muss ich die Schüler zum Klang der Musik bringen, aber das fordert früher oder später, aber doch eher früher, das Einsteigen in den Notentext. Sonst wird das alles nichts. Dafür brauchen die Schülerinnen und Schüler Lesefähigkeit, das heißt auch: ein gewisses Rüstzeug an Theorie und Begrifflichkeit. Aber theoretisches Rüstzeug und Begrifflichkeit im Notentext bleiben tote Materie, solange sie nicht im Klang wiedergefunden werden, und das muss bald, sehr bald heißen: im Klang der real lebendigen Musik. S – K – N: Schüler, Klang und Notenbild zusammenbringen. Das ist es, worum sich alles dreht in einem ernst gemeinten Musikunterricht. „M“ Im „M“-Unterricht (also: im Musizier-Unterricht, im Unterricht über musikalisches Gestalten) gilt genau dasselbe analog. Ich kann gewisse Patterns im Live-Arrangement oder im Vorspielen-Nachspielen vermitteln. Aber schon bei behutsamen Annäherungen an größere komponierte Musik enden diese Möglichkeiten. Spielen in einem Symphonieorchester, auch im Symphonieorchester einer Schule, geht nicht ohne sicheres Notenlesen, in diesem Fall tatsächlich: des Umsetzens von Noten in Klang in Echtzeit. Wer das didaktisch nicht mitdenkt, lehrt Bergsteigen im Flachland. Aber schon in den Anfangsgründen, in der Streicherklasse, der Bläserklasse, schon im einfachsten Songarrangement für das Klassenmusizieren läuft fast nichts mehr ohne geschulte Noten-Lesefähigkeit. Auch hier gilt aber auch das Umgekehrte: Für den Schüler ist musikalisch nichts, aber auch gar nichts gewonnen, wenn er weiß, wo er auf dem keyboard drücken muss, wenn da ein g steht. Es muss am Gestalten von Klang und von Klängen und von Verläufen in Klängen gearbeitet werden, darüber, wie aus denselben Noten verschiedenste Schattierungen im Klang erzeugt werden können oder was wir tun müssen, damit im Chorsatz die Altstimme rund genug klingt oder wie die Männer den Sprung in die Falsett-Lage hinbekommen, um die Tenorstimme singen zu können. Drücken, pusten, zupfen, streichen bleibt leeres Geklingel, wenn nicht Klang gehört und geformt wird. Da, freilich, stoßen die Keyboards und die Xylophone und die verbreiteten rudimentären Arrangements mit Gitarre und Bassgitarre schnell an ihre Grenzen. Streicherklassen, Bläserklassen, einfach schönes Singen im Klassenverband kommen eine ganze Ecke weiter, wollen aber auch aktiv weiter geführt werden. Immer mal wieder kommen zu mir Referendare ins Fachseminar und sagen mir: Unsere (immer gleichen) Dozenten in der Uni haben uns gelehrt, dass Schüler ohne Instrumentalausbildung auch keine Noten zu lernen brauchen. Das sind dann später meistenteils die Lehrerinnen und Lehrer, die die allermeiste Zeit mit fruchtlosem Theorieunterricht zubringen. In Abwandlung des Kantschen Satzes gilt, ziemlich früh jedenfalls: Klang ohne Notenbild ist taub. Notenbild ohne Klang ist blind. S-K-N: Immer wieder und in allen Feldern des Musikunterrichts gilt es Schüler zu befähigen, Klang und Notenbild in ihrer Vorstellungskraft zusammenzubringen.