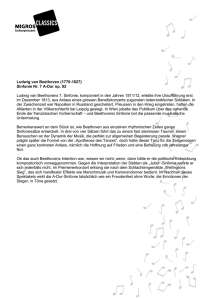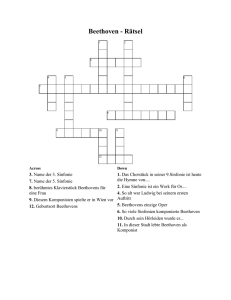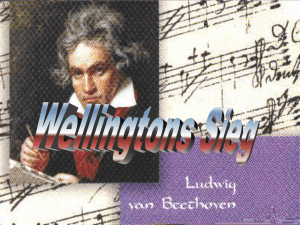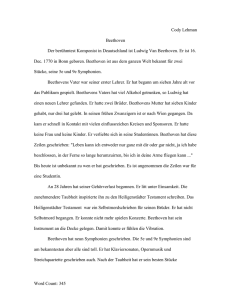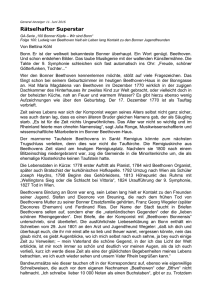Aber, lieber Beethoven
Werbung

Ewald Lucas Seminar: “Die Missa Solemnis” Herr Prof. Dr. A. Gerhard Institut für Musikwissenschaft Bern WS 1998/ 99 Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht? Beethovens C-Dur-Messe, Op. 86: Ein autonomes Kunstwerk zur persönlichen Andacht in aristokratischem Rahmen. Inhalt Seite 1. Einleitung 2 2. Die Geschichte der C-Dur-Messe 2 3. Das historische, soziale und gattungsgeschichtliche Umfeld 6 4. Die Textvertonung vor Beethoven 9 5. Analyse der C-Dur-Messe 12 5.1 Traditionelles in Beethovens Messkomposition 13 5.2 Die Arten der Textvertonung bei Beethoven 15 5.3 Vermittlung von Gefühlswerten im Kyrie und im Benedictus 16 5.4 Strukturelle Dramatisierung des Textes 18 5.5 Gloria und Credo 20 5.6 Sanctus und Agnus Dei 26 6. Widersprüche in der C-Dur-Messe 29 7. Schlusswort 31 8. Bibliographie 33 1 1. Einleitung “Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht?” Mit diesen Worten soll sich Fürst Nikolaus II von Esterházy nach der Uraufführung von Beethovens C-Dur-Messe an den Komponisten gewandt haben. Neben diesem Ausspruch gibt es verschiedene andere Belege dafür, dass Beethovens erster Vertonung des liturgischen Messetextes zu Beginn kein Erfolg beschieden war. Es dauerte auch einige Zeit, bis die Partitur - bezeichnenderweise ohne Einzelstimmen - im Druck erschien. Später, und dies gilt auch noch heute, stand das Op. 86 sowohl in der Aufführungspraxis als auch in der musikwissenschaftlichen Beschäftigung mit Beethovens Messen im Schatten der weit bekannteren, beliebteren und bewunderten Missa Solemnis, die Beethoven selbst als sein gelungenstes Werk bezeichnete. Während Die Missa Solemnis den Zuhörern und Betrachtern noch heute zahlreiche Rätsel aufgibt und ihre Monumentalität und Machart manch einen verstört und auf Unverständnis stösst, könnte man die Beschäftigung mit der C-Dur-Messe dagegen schon fast als Erholung empfinden. Dennoch erweckte die Komposition offensichtlich das Missfallen von Nikolaus II. In der vorliegenden Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, welche signifikanten Neuerungen Beethovens Komposition, insbesondere im Vergleich mit den sechs späten, zwischen 1796 und 1802 geschriebenen und vom Fürsten hochgeschätzten Messen Haydns enthält, um die geringschätzige Reaktion Nikolaus’ hervorzurufen. Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehungsgeschichte von Beethovens Op.86, die erste Rezeption, frühe Rezensionen und Beethovens hartnäckige Bemühungen um eine Drucklegung des Werks. Daran schliesst sich ein Blick auf das historische, soziale und gattungsgeschichtliche Umfeld der Messe an. Von Interesse sind insbesondere die Neuerungen, welche die kirchlichen Reformen des Kaisers Josephs II in den 1780er Jahren mit sich brachten, und deren Auswirkungen auf den Umgang mit der Gattung Messe und mit der teilweise veränderten Situation bezüglich einer konkreten Funktionalität der Kirchenmusik. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle des Textes in Messvertonungen, die vor Beethovens Werk entstanden sind, und mit der Wichtigkeit, die das Eingehen auf den Ordinariumstext für die Komposition hatte, oder eben nicht hatte. Der darauf folgende, grössere Abschnitt ist der Analyse von Beethovens C-Dur-Messe gewidmet, zunächst den eher traditionellen Erscheinungen, dann den unterschiedlichen Arten der Textbehandlung in den verschiedenen Sätzen des Messzyklus’, zwischen direkter Gefühlsvermittlung und starker Dramatisierung der Vorlage durch die individuelle Vertonung der einzelnen Texteinheiten. Im Zusammenhang mit Beethovens Op. 86 ergeben sich schliesslich zahlreiche Widersprüche und Missverständnisse, auf die im sechsten Kapitel eingegangen wird. 2. Die Geschichte der C-Dur-Messe Der Hof in Eisenstadt pflegte den Namenstag seiner Fürstin Josepha Maria Hermengild (geborene Liechtenstein), der Gattin von Fürst Nikolaus II von Esterházy, festlich zu begehen. In den Jahren in denen dieser Tag - der 8. September (Mariä Geburt) - nicht auf einen Sonntag fiel, fand die Feier jeweils am darauffolgenden Sonntag statt. 1807 war dies der 13. September. Nikolaus II beauftragte nun Ludwig van Beethoven mit der Komposition einer Messe, die an diesem Tag aufgeführt werden sollte. Aus demselben Anlass hatte bereits Joseph Haydn zwischen 1796 und 1802 seine letzten sechs Messen komponiert. Beethoven hatte aber weder eine enge Beziehung zum Eisenstädter Hof, noch besass er einen Ruf als Komponist geistlicher Musik. Eine Messe hatte er bis dahin noch keine komponiert. Möglicherweise verhalf ihm die Vermittlung seines früheren Lehrers Joseph Haydn oder seine Reputation als Komponist zu diesem Auftrag. Die Messe in C-Dur Op. 86 war zwar nicht Beethovens erstes kirchliches Werk, aber doch sein erstes für den gottesdienstlichen Gebrauch. Einen ersten Hinweis auf dessen Komposition finden wir in einem Brief Beethovens an den Fürsten Nikolaus. Der Komponist entschuldigt sich in seinem Schreiben vom 26. Juli 1807 aus Baden für die Verzögerung bei der Fertigstellung der Messe, verspricht aber, das vollendete Werk bis zum 20. August zu übergeben, so dass noch 2 genügend Zeit bleiben würde, es einzustudieren. Im selben Brief kommt auch sein Respekt vor den Messkompositionen Haydns zum Ausdruck, denn er schreibt, er werde die Messe “mit viel Furcht” übergeben, da der Fürst ja gewohnt sei, die “unnachahmlichen Meisterwerke” Haydns zu hören 1. Tatsächlich hielt Nikolaus II sehr viel von Haydns Musik, und Fürst Ludwig Starhemberg, einer seiner Gäste, die 1802 zu den Festlichkeiten eingeladen worden waren, bezeichnet in seinem Tagebuch die bei dieser Gelegenheit aufgeführte “Harmoniemesse” Haydns als “Messe superbe, nouvelle musique excellent du fameux Haydn” 2. Beethovens Aufgabe war also nicht leicht, obwohl ihm Nikolaus II am 9. August antwortete, dass er sich sehr darüber freue, die Messe zu erhalten, dass er sich sehr viel davon verspreche und die Besorgnis um den Vergleich mit den Haydnschen Messen den Wert seiner Messe nur erhöhe 3. Ende Juli kehrte Beethoven von Baden nach Heiligenstadt zurück und machte sich dort an die Vollendung der C-Dur-Messe. Am 13. September fand schliesslich die Uraufführung in der Eisenstädter Bergkirche statt. Es war offenbar Brauch, dass sich nach dem Gottesdienst die anwesende musikalische Elite in den Gemächern des Fürsten einfand, um mit diesem die aufgeführten Werke zu besprechen. Beim Eintritt Beethovens, soll nun Nikolaus II die bereits zitierte Frage an ihn gerichtet haben: “Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht? 4” Ausserdem soll Beethoven gesehen haben, wie der neben dem Fürsten stehende Kapellmeister Johann Nepomuk Hummel gelacht habe. Wie tief ihn die Messe enttäuscht und verärgert hatte, geht deutlich aus einem privaten Brief des Fürsten hervor: “La messe de Beethoven est insuportablement ridicule et detestable, je ne suis pas convaincu qu’elle puisse meme paroitre honnêtement: j’en suis colère et honteux. 5” Er empfand die Messe demnach nicht nur als vom Traditionellen und Gewohnten abweichend, sondern gar als unerträglich lächerlich und abscheulich. Die Frage nach den Gründen für dieses vernichtende Urteil lässt sich sicherlich nicht zweifelsfrei beantworten. Es ist davon auszugehen, dass eine mangelhafte Aufführung dabei eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Einem Brief des Fürsten an seinen Vize-Kapellmeister, geschrieben am 12. September 1807, ist nämlich zu entnehmen, dass die Probe- und Arbeitsdisziplin der Sängerinnen und Sänger sehr zu wünschen übrig liess. Diese scheinen oft grundlos den Proben und sogar den Auftritten ferngeblieben zu sein, so dass Nikolaus seinem Vizekapellmeister androhte, ihn zur Verantwortung zu ziehen, falls dieser nicht strengstens auf Besserung achte. In Anbetracht dieser Zustände würde es nicht erstaunen, wenn die Qualität der Aufführung unbefriedigend ausgefallen wäre, zumal Beethovens Messe doch bedeutende Schwierigkeiten bietet, zum Teil sicher noch grössere als eine Messe von Haydn. Von Beethoven selbst, der einige Proben und die Aufführung dirigiert hatte und zu diesem Zeitpunkt noch gut hörte, erfahren wir diesbezüglich aber nichts. Entgegen ersten Überlieferungen 6 hat Beethoven zwar Eisenstadt nicht noch am Tag der Aufführung verlassen 7, doch scheint er auch noch Jahre später mit grosser Erbitterung von diesem Misserfolg gesprochen zu haben. Es versteht sich von selbst, dass er die Widmung an Nikolaus II zurückzog und sie nach mehreren Änderungen schliesslich auf Fürst Kinsky übertrug. Die erste öffentliche Aufführung einzelner Teile der Messe (Gloria, Sanctus und Benedictus) fand am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien statt. Die Wiener Zensurbehörde verbot zwar “lateinische Worte aus dem Kirchentext auf den Anschlagzetteln […], im Theater aber” durften sie “ohne Anstand gesungen werden. 8” Die Messsätze bildeten allerdings nur einen kleinen Teil eines, wie damals üblich, enormen Programms, in dem unter anderem auch die fünfte und die sechste 1 Thayer, Alexander Wheelock: Ludwig van Beethovens Leben. Band 3, Leipzig (Breitkopf & Härtel), 1923, S. 34 ff. Riethmüller, Albrecht/ Dahlhaus, Carl/ Ringer, Alexander L.: Beethoven: Interpretationen seiner Werke. Band II, Laaber 1994, S. 2 3 Thayer, Band 3, S. 35 4 Thayer, Band 3, S. 37 5 Friesenhagen, Andreas: Die Messen Ludwig van Beethovens. Studien zur Vertonung des liturgischen Textes zwischen Rhetorik und Dramatisierung, Köln-Rheinkassel (Christoph Dohr), 1996, S. 32 6 Thayer, Band 3, S. 37 7 Friesenhagen, S. 32 8 Kinsky, Georg: Beethovens thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen, München (Henle), 1955, S. 240 3 2 Symphonie, das Klavierkonzert in G-Dur und die Chorfantasie erklangen. Johann Friedrich Reichardt, der als Ohrenzeuge zugegen war, bezeichnete die Aufführung der “Hymnen” als missglückt und verfehlt 9. Wie im Konzertsaal, so hatte Beethoven auch bei den Verlegern kein Glück mit seiner ersten Messe. Am 8. Juni 1808 schrieb er an Breitkopf & Härtel einen Brief, in dem er die Messe, zusammen mit den Symphonien fünf und sechs sowie der Cellosonate Op. 69 für 900 Gulden anbot 10 . Rückblickend könnte man meinen, Beethoven habe schon beim Verfassen dieses Schreibens befürchtet, nur mit grosser Mühe die Veröffentlichung der Messe zu erreichen. Denn, anders als die anderen Werke, pries er dieses besonders nachdrücklich an, mit dem vielzitierten Satz: “Von meiner Messe […] glaube ich, dass ich den Text behandelt habe, wie er noch wenig behandelt worden.” Ausserdem flunkerte Beethoven, die Messe sei schon an mehreren Orten günstig aufgenommen worden und habe “unter anderem auch bei Fürst Esterházy” in Eisenstadt “viel Beifall” erhalten. Er gab sich überzeugt, dass die Partitur und der Klavierauszug einträglich sein würden. Dazu ist allerdings zu sagen, dass die Komposition einer solchen Messe als Dienst angesehen wurde, die Werke meist an einen bestimmten Anlass und Auftraggeber gebunden und nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. In den nun folgenden Verhandlungen liess Beethoven nichts unversucht, den Verlag zum Druck des Werkes zu bewegen. Am 16. Juli erhielt der Verlag, der offenbar an der Messe nicht interessiert war, auf seine Gegenofferte Beethovens Antwort 11. Neben den bereits erwähnten Werken bot dieser zusätzlich noch zwei Klaviersonaten oder eine Symphonie an, alles zum Preis von 700 Gulden. Doch weder dieses Entgegenkommen, noch ein kleiner Erpressungsversuch (“die Messe müssen Sie nehmen, sonst kann ich Ihnen die andern Werke nicht geben”), noch andere Überzeugungsversuche nützen etwas. Beethoven meinte, er schaue nicht nur darauf, was nützlich, sondern auch was rühmlich sei und schlug vor, die Messe in einem Konzert aufzuführen, worauf gleich eine grosse Nachfrage entstehen würde. Um eine grössere Verbreitung zu ermöglichen, könne man den Klavierauszug mit deutschem Text versehen. Zudem gab Beethoven eine persönliche Erfolgsgarantie und erklärte sich bereit, im Notfall selbst Subskribenten zu gewinnen. In einem weiteren Brief schrieb der Komponist schliesslich, er mache die Messe Breitkopf & Härtel zum Geschenk und würde sogar selbst die Kosten der Schreiberei übernehmen 12 . Er begründete sein Beharren auf der Drucklegung dieses Werks damit, dass es ihm “vorzüglich am Herzen liegt” und schmeichelte dem Verlag, der es mit seinen “Notentipen für gedruckte Noten” leichter als andere Verleger verstehe, Partituren zu drucken. Anstelle der zwei Klaviersonaten beinhaltete sein Angebot nun zwei Klaviertrios, der Gesamtpreis betrug 600 Gulden. Beethoven fügte jedoch an, dass er anderswo genausoviel für diese Werke bekommen könnte. Am 14. September 1808 holte Härtel die Werke zum Preis von 100 Dukaten persönlich in Wien ab. Die Schenkung der Messe war aber offensichtlich nicht angenommen worden, so dass Beethoven auch mit Simrock in Bonn zu verhandeln begann 13. In Briefen vom 5. April und 26. Juli 1809 an Breitkopf & Härtel verlangte Beethoven schliesslich für “Christus am Ölberg”, “Fidelio” und die CDur-Messe zusammen 250 Gulden, und am 19. September schrieb er endlich “die 3 Werke sind schon abgeschickt.” Spätere Erwähnungen der Messe in Briefen an den Verlag betrafen nur noch einige Korrekturen, die Ausarbeitung der Orgelstimme, die dann allerdings ausblieb, die deutsche Übersetzung des Textes und die Widmung. Der Druck der Partitur erfolgte erst im Oktober 1812, mit lateinischem und deutschem Text. Ein Nachdruck der Partitur erschien 1824 in Paris, ein Klavierauszug 1827 bei Breitkopf & Härtel. 1826 gab Simrock die Chorstimmen heraus. Bei Breitkopf & Härtel erschienen die Chorstimmen erst 1846, und ein Jahr darauf folgten die Orchesterstimmen. Neben den bisher angeführten Aussagen sind Zeugnisse über die Messe von Beethovens Zeitgenossen selten. Im “Journal des Luxus und der Moden” vom Januar 1808 erscheint ein “Auszug eines Briefes”, in dem der Schreiber verkündet, “dass unser Beethoven so eben eine 9 Thayer, Band 3, S. 39 Thayer, Band 3, S. 40 11 Thayer, Band 3, S. 41 12 Thayer, Band 3, S. 42 13 Kinsky, S. 237 10 4 ausserordentlich schöne, ganz seiner würdige Messe vollendet hat, welche am Feste Mariä bei dem Fürsten Esterházy aufgeführt werden soll. 14” Hier stellt sich allerdings die Frage, wie der Schreiber dieser Worte überhaupt ein Urteil über die eben erst vollendete Messe abgeben konnte, bevor diese erstmals gespielt worden war. In einer Kritik in der Allgemeinen musikalischen Zeitung ist 1815 zu lesen, Beethoven glänze auch auf dem Gebiet der Messkomposition als ein Stern erster Grösse 15. Der Schreiber lobt die “Originalität der Gedanken” und die “Edle Haltung, in der (kaum mit Ausnahme einiger Momente) nur das Heilige zur Erscheinung” komme. In der AmZÖ (Allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat) ist 1817 über eine Aufführung der Messe am 26. Oktober zu lesen, es handle sich um eine “wenig bekannte, ganz eigenthümliche und doch kirchliche Composition”, die der Feier angemessen gewesen sei 16. Im selben Jahr steht in der Allgemeinen musikalischen Zeitung: “Giebt man auf, was Jahrhunderte hindurch als Kirchenstyl anerkannt wurde: so muss man mehrere Sätze dieses Werks, besonders vom Credo an, hoch preisen. 17” 1828 erscheint in der RM (Revue Musicale) eine weitere Kritik. Der Verfasser François-Joseph Fétis schreibt, die Messe gehöre nicht zu den besten Kompositionen Beethovens 18. In ihr herrsche eine gewisse Verlegenheit und eine Unerfahrenheit in der Gattung. Die ausführlichste Rezension stammt aus der Feder E. T. A. Hoffmanns und erschien 1813 in der Allgemeinen musikalischen Zeitung. Hoffmann beurteilt das Werk als “ganz des genialen Meisters würdig” 19. Er gibt allerdings zu, “ein musikalischer Freigeist zu sein” und über Verstösse gegen den reinen Kirchensatz und die gegenwärtige Messtradition hinwegzusehen. Bereits vor einer näheren Betrachtung der C-Dur-Messe von Beethoven lässt sich also einiges darüber sagen. Beethoven hatte offenbar grossen Respekt vor seinem ehemaligen Lehrer Joseph Haydn, der ihm in mancherlei Hinsicht als Vorbild diente. Er war sich aber auch bewusst, dass seine erste Messkomposition viel Neues enthielt, dadurch mit der bisherigen Tradition brach und sich erheblich von den Messen Haydns unterschied. Dies beweist, dass Beethoven sich nicht einfach damit begnügte, der Gattung Messe ein weiteres Stück Dutzendware beizusteuern, sondern bemüht war, etwas Eigenständiges, vom als traditionell empfundenen Hasse-Wienerischen Kirchenstil Abweichendes zu schaffen. Beethovens Sorge um den unausweichlichen Vergleich seines Werks mit den Messen Haydns ist demzufolge nicht nur als Bescheidenheitsfloskel zu verstehen. Sie wurzelte sicherlich nicht unbedingt im Zweifel an der Qualität der C-Dur-Messe, sondern möglicherweise vor allem in der Erkenntnis, dass die von ihm angestrebten und umgesetzten Neuerungen - nur weil sie eben neu waren - schlecht aufgenommen werden könnten. Ursache dafür, dass sich diese Befürchtungen bestätigten, waren zu einem grossen Teil die missglückten Aufführungen. Es ist schwer zu sagen, ob Beethoven mit einer erfolgreichen Veröffentlichung der Messe nicht auch einfach diesen Misserfolgen entgegenwirken wollte, um seinen guten Ruf als Komponist zu bewahren. Es wäre aber sicherlich verfehlt, seine Anstrengungen und Äusserungen nur ökonomischen Gründen zuzuschreiben. Jedenfalls zeigt die Beharrlichkeit, mit der er sich um den Druck der Messe bemühte, dass sie ihm - wie er übrigens in seinem Brief an den Verlag selber schreibt - “trotz aller Kälte unseres Zeitalters gegen d.g.” “vorzüglich am Herzen liegt 20.” Aus einer anderen Aussage geht hervor, dass er am liebsten nur “grosse Symphonien, Kirchenmusik, höchstens noch Quartetten” geschrieben hätte 21. Zudem hatte er scheinbar auch die Absicht, eine zweite Messe in cis-Moll und ein Requiem 22 zu komponieren. Weder aus diesen beiden Werken, noch aus einer 1823 von Graf Dietrichstein vorgeschlagenen Messkomposition zur Annäherung an den Hof ist aber etwas geworden 23. 1823 schrieb Beethoven an Erzherzog Rudolph 14 Thayer, Band 3, S. 39 Kunze, Stefan: Ludwig van Beethoven. Die Werke im Spiegel seiner Zeit, Laaber 1987, S. 248 ff. 16 Kunze, S. 249 17 Kunze, S. 249 18 Kunze, S. 250 19 Kunze, S. 254 20 Thayer, Band 3, S. 42 21 Schnerich, Alfred: Messe und Requiem seit Haydn und Mozart. Wien-Leipzig (C. W. Stahn Verlag) 1909, S 62 (Fussnote) 22 Thayer, Band 3, S. 39/ Schnerich, S. 62 23 Frimmel, Theodor: Beethoven Handbuch. Erster Band, Leipzig (Breitkopf & Härtel) 1926,S. 406 5 15 - allerdings im Zusammenhang mit der Missa Solemnis - : “Schöneres gibt es nicht, als der Gottheit sich mehr als andere Menschen nähern und von hier aus die strahlen der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten. 24” In eben diese Richtung zielten, ganz im Sinne der Aufklärung, auch seine Bemühungen um eine deutsche Übersetzung des Textes, die der Messe und ihrer Aussage zu einer grösseren Verbreitung auch ausserhalb der Kirche, im Konzertsaal, verhelfen sollte. In einem Brief an Johann Andreas Steicher schrieb er 1824 ausserdem, allerdings bezüglich seiner Missa Solemnis: ”Ihrem Wunsche, [...] die Singstimmen meiner letzten grossen Messe mit einem Auszuge für die Orgel oder Piano an die verschiedenen Gesang-Vereine abzulassen, gebe ich hauptsächlich darum gerne nach, weil diese Vereine bey öffentlichen, besonders aber Gottesdienstlichen Feierlichkeiten ausserordentlich viel auf die Menge wirken können [...]. 25” Wie sich nun Beethovens Intentionen auf die Vertonung des Ordinariums auswirkten, welche Gründe neben der missglückten Aufführung das Missfallen des Fürsten von Esterházy hervorgerufen hat und ob der Schritt von Haydns Messen zu Beethovens Komposition tatsächlich so gross ist, soll in der Folge überprüft werden. 3. Das historische, soziale und gattungsgeschichtliche Umfeld In den Jahren nach 1780 änderten sich die Voraussetzungen für die Kirchenmusik zunächst in Wien, danach in ganz Österreich und in anderen Teilen des Kaiserreichs sehr stark. Ausschlaggebend für diese Veränderungen waren in erster Linie die Gedanken der Aufklärung, die den Erlassen des Kaisers Joseph II zugrundelagen. Die Kirchenmusik war insbesondere durch die Säkularisation der geistlichen Besitztümer und durch die gottesdienstlichen Reformen betroffen. Beides beeinflusste den Umfang und den Charakter der Kirchenmusik in grossem Masse. Dabei spielten sowohl ideelle als auch - als deren Konsequenz - materielle Faktoren eine wichtige Rolle. Diese Reformen blieben nach Josephs Tod 1790 weitgehend bestehen. Ausserdem trugen die französische Revolution von 1789 und die Napoleonische Zeit zur Popularisierung des dahinterstehenden aufklärerischen Gedankenguts bei. Im Zuge der sogenannten Josephinischen Reformen kam es zur Auflösung von “untätigen” Orden (ca. 1300 Klöster), die keine nützlichen Tätigkeiten wie Unterrichten oder Krankenpflege ausübten. Eine staatliche Priesterausbildung und -besoldung wurde eingeführt, die Macht der Bischöfe und anderer Kirchenfürsten wurde eingeschränkt, und die geistlichen Besitztümer wurden durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 säkularisiert. Weil diese Veränderungen natürlich auch den Fortfall des Pfründenwesens beinhalteten, verloren die fest angestellten Sänger und Instrumentalisten ihre wirtschaftliche Basis. Die Aufrechterhaltung aufwendig gestalteter Kirchenmusik und der damit verbundene Unterhalt grösserer Kapellen erforderte nun zusätzliche finanzielle Mittel, die vielerorts nicht mehr in genügendem Masse vorhanden waren. Derartige Ausgaben mussten von den jeweiligen Kirchenkassen getragen werden oder blieben den Fürstenhäusern vorbehalten. Ab dem 19. Jahrhundert begannen sich nun bürgerliche Kirchenvereine zu formieren, die - vor allem in städtischen Pfarrkirchen - anstelle der aristokratischen Kreise die Kirchenmusik zu tragen begannen. Die Ideale der bürgerlichen Förderer waren aber andere als die der gesellschaftlichen Oberschicht. Die Musik diente jetzt nicht mehr der herrschaftlichen Repräsentation. Auch beschränkte sich die Tätigkeit der Vereine ausschliesslich auf das sonntägliche Hochamt und fast nur auf die Form der Orchestermesse, die auch für die Fürsten begehrteste Form liturgischer Musik. Dadurch, dass die Kirchenmusik nun vermehrt auch von der bürgerlichen Schicht getragen wurde und gleichzeitig das öffentliche Konzertwesen stark im Aufkommen war, fehlte nicht mehr viel zu einer weitergehenden “Säkularisierung” der Kirchenmusik, nämlich deren vermehrte Aufführung im Konzertsaal. Nur die strenge staatliche Zensurbehörde stand einer häufigen Durchführung dieser - heute üblichen - Praxis noch im Weg. 24 Beethoven, Ludwig van: Briefwechsel Gesamtausgabe (Hrsg. Sieghard Brandenburg), Band 4, München (Henle), 1996, S. 446 25 Beethoven, Ludwig van: Briefwechsel Gesamtausgabe, Band 5, S. 363 ff. 6 Trotz der Unterstützung durch das Bürgertum war es aber nicht überall möglich, die Mittel für eine aufwendige musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes aufzubringen. So waren es neben den weiter unten beschriebenen ideellen Gründen zusätzlich finanzielle Einschränkungen, die zu einer starken Polarisierung innerhalb der Kirchenmusik führten. Die Änderung der aufführungspraktischen Gegebenheiten brachte eine Neubewertung der Gattung mit sich. Auf der einen Seite standen grosse Messkompositionen, Werke mit einem hohen künstlerischen Anspruch, individuellem Ausdruck und künstlerischer Originalität, Musik, die keine reine Gebrauchsmusik mehr war und auch keine Rücksicht mehr auf die verschiedenen äusseren Umstände mehr nahm. So hatte beispielsweise Haydn den Bläsersatz in seinen Messen noch den jeweiligen Verhältnissen in der Eisenstädter Hofkapelle angepasst, während Beethoven, davon unabhängig, bereits in der CDur-Messe durchgehend eine doppelte Bläserbesetzung vorsah. Auf der anderen Seite stand die schlichte Gebrauchsmusik, die überall dort gepflegt wurde, wo die finanziellen Mittel für grössere Projekte nicht vorhanden waren, und die von den örtlichen Gegebenheiten abhing. Zwischen den beiden Polen existierten allerdings noch immer die von Leuten wie dem Fürsten von Esterházy in Auftrag gegebenen Werke, die sich doch stark nach den zeremoniellen Vorschriften zu richten hatten und der höfischen Repräsentation dienen sollten. Die allgemeine Zuwendung zu einer einfacheren Musik hatte seinen Ursprung nicht nur in den fehlenden finanziellen Mitteln, sondern war ebenso durch eine Umdeutung der Funktion der Kirchenmusik begründet. Bereits im 18. Jahrhundert war die Gattung der Messe, als Teil des zentralen gottesdienstlichen Anlasses - der Eucharistiefeier -, die vornehmste innerhalb der Kirchenmusik. Neben der Eucharistiefeier gab es aber eine Vielzahl anderer liturgischer Anlässe wie Vespern, Andachten, Anbetungen, Prozessionen usw., für die jeweils eine eigene, den betreffenden Text vertonende musikalische Gattung existierte. Innerhalb der Messe erklangen neben dem Ordinarium zudem Propriumskompositionen, Motetten und Instrumentalsätze. Die musikalische Form und deren Ausgestaltung, sowie die Art und Grösse der Vokal- und Instrumentalbesetzung richtete sich nach liturgischen Rangstufen und strengen zeremoniellen Vorschriften. An Wochentagen wurde vor allem der Choral gesungen. Die instrumentale Figuralmusik war dementsprechend weniger umfangreich und kleiner besetzt. In der Advents- und Fastenzeit war Musik im stile antico, also a-capella-Musik, vorgeschrieben. An Hochfesten und zu besonderen Staatsakten wurden missae solemnes musiziert, aufwendige, umfangreiche und reich ausgestaltete Messkompositionen mit erweiterter Instrumentalbegleitung. Der Unterhalt grösserer Ensembles und Kapellen war allerdings schon damals mit hohen Ausgaben verbunden, die nur an (weltlichen und kirchlichen) Fürsten- und Adelshöfen, in Klöstern und Stiften vorhanden waren. Durch eine solche soziale Zuordnung der festlichen Kirchenmusik, erhielt diese nicht nur die Verherrlichung Gottes zur Aufgabe, sondern mit ihr verband sich ebenfalls die Funktion der höfischen und fürstlichen Repräsentation, des Herrscherlobs. Die Neuordnung der gottesdienstlichen Verhältnisse unter Joseph II veränderte nun die kirchenmusikalische Landschaft. Aller äusserliche Prunk und die damit verbundenen Kosten sollten möglichst vermieden werden. Die reichhaltige Kirchenmusik wurde immer mehr als luxuriöse, ablenkende und überflüssige Ausschmückung des Gottesdienstes empfunden. Der Gottesdienst sollte nicht mehr nur ein religiöses Schauspiel und ein sinnliches Vergnügen ohne aktive Beteiligung des einzelnen Gläubigen sein, sondern diesem zu einem individuellen Erleben, zu einer subjektiven Glaubenserfahrung verhelfen. Die Musik musste also so beschaffen sein, dass sie sich für die Erweckung der persönlichen Andacht eignete. Die Bindung der Kirchenmusik an das liturgischrituelle Zeremoniell oder an die Funktion feudaler Machtdarstellung war nicht mehr entscheidend. Aus didaktischen Gründen zog Joseph II zudem den deutschen Kirchengesang der lateinisch gesungenen Musik vor. Ausser der Messe durften alle liturgischen Formen, wie Vespern, Andachten usw., nicht mehr instrumental begleitet werden. Auch die Anzahl der Orchestermessen verringerte sich. An Wochentagen war instrumentalbegleitete Musik gänzlich verboten, während sie an Sonnund Feiertagen dem Hochamt vorbehalten war. Der Gemeindegesang mit Orgelbegleitung wurde zur Norm, während die aufwendige Orchestermesse ein besonderes Ereignis blieb. Die Abschaffung von verschiedenen Typen religiöser Verehrung, wie Prozessionen, Novenen, Heilig Grab- und Auferstehungsfeiern schränkte den Einsatz instrumentaler Musik noch mehr ein, so dass sich 7 zahlreiche kirchlich besoldete Musiker ihrer Existenzgrundlage beraubt sahen. Vielerorts blieben nur noch wenige Stellen besetzt, meist die der Organisten und Kantoren. Manche Zeitgenossen empfanden diese Entwicklung durchaus positiv. E. T. A. Hoffmann zum Beispiel macht sich in seiner Rezension der C-Dur-Messe Beethovens zunächst einige Gedanken allgemeiner Art zur Gattung der Messkomposition 26. In seinen Überlegungen verwirft er Musik, die in der Kirche “prunkenden Staat” treibe. Insbesondere ist ihm auch die Tendenz ein Dorn im Auge, “sich überall derselben Mittel des Ausdrucks zu bedienen”, so dass “in der Kirche Oratorien und Aemter nach Opernzuschnitt” zu hören seien. Ein Komponist dürfe sich “durch das Miserere, Gloria, Qui tollis u.s.w. nicht zum bunten Gemisch des herzzerschneidenden Jammers der zerknirschten Seele mit jubilierendem Geklingel verleiten lassen.” Hoffmann ist der Meinung, “dass man den Reichthum, den die Musik, was hauptsächlich die Anwendung der Instrumente betrifft, in neuerer Zeit erworben, […] auf edle, würdige Wiese anwenden könne.” Doch habe Kirchenmusik “selbst bey der Anwendung des figurirtesten Gesanges, des Reichthums der Instrumental-Musik, ernst und würdevoll, kurz, kirchenmässig zu bleiben!” Den Werken der Gebrüder Haydn und Mozarts zollt er zwar Lob und Bewunderung, gibt aber dem ursprünglichen, reinen, hohen und einfachen Kirchenstil der alten Italiener den Vorzug. An die Stelle des vor allem aufs Äusserliche gerichteten und höfisch-repräsentative Funktion besitzenden prunkvollen musikalischen Getöses zum Gottes- und Herrscherlob sollte nun also eine schlichte Musik treten, mit der Aufgabe, die innere Andacht des einzelnen Gläubigen zu fördern und ihm ein subjektives Glaubenserlebnis und persönliche Anteilnahme zu ermöglichen. Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts beliebte Pastoralmesse und die weit verbreitete Landmesse zeichneten sich beispielsweise durch eine volkstümlich-liedhafte, eingängige Melodik aus. Besonders die Landmessen waren so komponiert, dass sie in einer Kirche auf dem Land ohne grossen Aufwand gesungen und gespielt werden konnten. Sie wiesen in der Regel eine einfache Faktur auf und benötigten keine grossen Besetzungen. Da allerdings viele Chorleiter und Schullehrer für ihre eigenen Wirkungsstätten selbst solche Messen komponierten, die höheren ästhetischen Ansprüchen wohl kaum standhielten, wandten sich die Verfechter der “wahren Kirchenmusik” von dieser oft als plump empfundenen Musik ab. Die einzig würdige Art der musikalischen Umsetzung eines liturgischen Textes bot für sie der stile antico, der einerseits auf jeglichen Prunk und instrumentalen Luxus verzichtete und sich andererseits an der idealen a-capella-Musik des 16. Jahrhunderts orientierte. Erstmals war also mit der Kirchenmusik auch eine historisierende Komponente verbunden. Auf den ersten Blick scheinen die oben beschriebenen, die Kirche betreffenden Reformen Josephs II keinen Zusammenhang mit Beethovens Komposition der C-Dur-Messe zu haben. Zunächst einmal erhielt Beethoven den Auftrag zur Komposition von Nikolaus II von Esterházy, also von einem weltlichen Fürsten. Zudem war der Anlass zur Komposition der Namenstag der Fürstin und somit primär kein kirchlicher, sondern ein weltlicher mit repräsentatorischer Funktion. Hinzu kommt der bedeutende Umfang des Werks und der grosse materielle Aufwand - die Bläserstimmen sind durchgehend doppelt besetzt -, der für seine Aufführung benötigt wird. Verschiedene Punkte deuten aber darauf hin, dass Beethovens Intentionen gänzlich andere waren, als die des aufs Äusserliche gerichteten Gottes- und Herrscherlobes. Dazu gehören die schon erwähnten Bemühungen um eine deutsche Übersetzung, Aufführungen in Konzertsälen und eine rasche Drucklegung des Werks, das er nicht als untrennbar mit dem ursprünglichen Kompositionsanlass verbunden verstanden haben wollte. War bis anhin die Komposition einer grossen Festmesse ausschliesslich für einen bestimmten Anlass und den Auftraggeber bestimmt und von einer weiteren Verbreitung ausgeschlossen gewesen, so stand dies im Widerspruch zu den neuen Massstäben, nach denen die Komposition von Musik nicht mehr als Dienst verstanden wurde. Nicht mehr deren Einbindung in das liturgische Zeremoniell und deren Fixierung auf den herrschenden Fürsten stand im Zentrum, sondern die direkte Ausrichtung auf den subjektiv empfindenden Gläubigen. Die unzufriedene Reaktion Nikolaus’ beweist einerseits, dass Beethovens Absichten gerade den fürstlichen Erwartungen tatsächlich nicht entsprachen, und mag andererseits 26 Kunze, S. 253 ff. 8 seine Veröffentlichungs-Anstrengungen noch verstärkt haben, da nun auch die Widmung an Fürst Nikolaus wegfiel. In diesem Zusammenhang ist auch Beethovens besorgte Äusserung bezüglich eines Vergleiches seiner Messe mit den späten Haydn-Messen zu verstehen. Wie sich in der Folge zeigen wird, widerspiegelt seine Vorgehensweise bei der Vertonung des Ordinariumstextes eine Haltung, die sich gut mit den aufklärerischen Josephinischen Reformen in Einklang bringen lässt. Im Zentrum der Komposition stehen der gläubige Mensch, die Andacht des Einzelnen, die religiöse Innerlichkeit, die persönliche Anteilnahme am Wort und nicht mehr liturgische Beziehungen und die Erfüllung zeremonieller Vorschriften und repräsentativer Funktionen. Auch für Beethoven stellte die a-capella-Musik des 16. Jahrhunderts ein Ideal dar. Laut einem Musiklehrer Namens Freudenberg, der sich mit Beethoven darüber unterhalten hatte, müsste für diesen “reine Kirchenmusik […] nur von Singstimmen vorgetragen werden, ausser vielleicht ein Gloria oder ein anderer dem ähnlicher Text. Deswegen bevorzugte er Palestrina, doch sei es Unsinn, ihn nachzuahmen ohne seinen Geist und religiöse Anschauung zu besitzen. 27” Beethoven nähert sich somit dem Geist des 16. Jahrhunderts nicht einfach mittels der Übernahme der prima prattica der klassischen Vokalpolyphonie oder mittels deren Nachahmung durch den stile antico. Bei ihm steht jedoch, wie bei den Renaissance-Komponisten, allerdings in stark gesteigertem Masse, der Text und dessen Vermittlung im Vordergrund. Beethoven selbst spricht ja von einer neuartigen Behandlung des Textes 28, wobei “es bey Bearbeitung dieser grossen Messe meine Hauptabsicht war, sowohl bey den Singenden als bey den Zuhörenden, Religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen 29”. Alle Äusserlichkeit verliert an Bedeutung, so dass zumindest bei der Missa Solemnis, eigentlich aber auch schon in der C-Dur-Messe sogar die enge Verbindung mit der Liturgie nicht mehr zwingend ist, obwohl Beethoven eine Aufführung in diesem Rahmen für besonders wirkungsvoll befand 30. Die Komposition übernimmt gewissermassen selbst die Rolle der Eucharistiefeier. Wenigstens unterliegt das Werk nicht den herrschenden Konventionen der Zeit, das heisst vor allem einer auf die Liturgie ausgerichteten funktionalen Gestaltung. Zur strengen Berücksichtigung des Wortes kommt in Beethovens Komposition eine starke Betonung des vokalen Elements hinzu. War im Typ der Orchestermesse des 18. Jahrhunderts der orchestrale Anteil zum bedeutendsten werkgestaltenden Faktor geworden, verlagerte er das Gewicht deutlich zugunsten des Chores, ohne jedoch den Orchesterapparat grundsätzlich zu reduzieren. So ist die Instrumentalbesetzung in der CDur-Messe grösser als in jeder Haydn-Messe und erfährt in der Missa Solemnis noch eine Steigerung. Beethoven versucht also in seiner Messe in gewisser Weise die Andachtserweckung mit einem äusserst hohen Kunstanspruch zu verbinden. 4. Die Textvertonung vor Beethoven Die Betonung, und je nach Art der Betonung auch die Deutung eines bestimmten Textes oder Textteils war im 17. und 18. Jahrhunderts oft mit dem Verfahren der musikalisch-rhetorischen Figurenlehre verbunden. Bestimmte Affekte wurden mit Hilfe eines feststehenden Formelschatzes umgesetzt. Aufgrund der funktionalen Anforderungen der Gattung Messe und dem allgemeinen tendenziellen Konservativismus in der Kirchenmusik beschränkte sich diese Textbehandlung in erster Linie auf weltliche Vokalmusik, insbesondere auf die Oper. Schon deren dramatische Anlage, die im Text begründet ist, bietet sich für eine entsprechende musikalische Umsetzung förmlich an. Der Ordinariumstext hingegen ist weder dramatisch angelegt noch metrisch gebunden. Eine Darstellung von persönlichen Emotionen war schon von daher nicht ganz vereinbar mit der Vertonung des lateinischen, wesenhaft gleichbleibenden und unveränderlichen Textes. Hinzu kommt die von der Kirche an eine Messkomposition gestellte Forderung nach grösstmöglicher Objektivität, denn man verstand das Ordinarium als unantastbaren, allgemeingültigen Text, der sich 27 Thayer, Band 5, S. 224 vgl. Zitat S. 4 29 Beethoven, Ludwig van: Briefwechsel Gesamtausgabe, Band 5, S. 364. Diese Aussage Beethovens bezieht sich auf die Missa Solemnis, lässt sich aber ohne weiteres auch auf die C-Dur-Messe anwenden. 30 Vgl. Zitat S. 6 9 28 direkt auf die Messfeier bezog, keiner gefühlsmässigen und subjektiven Ausdeutung bedurfte und eine solche auch nicht erlaubte. Sehr wichtig war hingegen oft die Besetzung, Instrumentierung und Ausdehnung, einer Messkomposition, die mit dem höfischen Zeremoniell in Übereinstimmung gebracht werden musste. Die Einbindung in einen aristokratischen Rahmen verhinderte ebenfalls eine subjektive Texterfassung, so dass die Anwendung von figuralen Formeln und Symbolen die einzige Möglichkeit einer Textumsetzung war. Doch auch diese waren teilweise auf repräsentative Darstellung ausgerichtet: Als Beispiel sei hier der punktierte Rhythmus genannt, der zu Worten wie “Kyrie”, “Sanctus”, “Dominus”, “omnipotens”, “judicare” und ähnlichen sowohl die Majestät Gottes wie die des herrschenden Fürsten symbolisierte. Zusätzlich war dieser Rhythmus oft mit dem gleichzeitigen Einsatz von Pauken und Trompeten verbunden. Diese und ähnliche Symbole treten allerdings häufig auch ohne direkten Textbezug auf und waren somit eigentlich als Bedeutungsträger vom Text unabhängig und hatten nicht das Ziel Textinhalte zu vermitteln. Es war zwar also möglich, durch eine deklamatorische Vertonung oder durch melismatische Ausgestaltung bestimmte Worte hervorzuheben und sie mit Hilfe abbildhafter Topoi figural auszudeuten, doch durfte dies innerhalb eines geschlossenen Satzes nur ihm Rahmen eines einheitlichen Grundaffekts geschehen. Die Komponisten strebten demzufolge in ihren Messen nach einer Einheitlichkeit des Affekts und einer homogenen Ausgestaltung der einzelnen Sätze. Folgendes Zitat von Joseph Haydn widerspiegelt deutlich diese Haltung: ”Ich bat die Gottheit nicht wie ein verworfenener Sünder in Verzweiflung, sondern ruhig, langsam. Dabei erwog ich, dass ein unendlicher Gott sich gewiss seines endlichen Geschöpfes erbarme, dem Staube, dass er Staub ist, vergeben werde. Diese Gedanken heiterten mich auf. Ich empfand eine gewisse Freude, die so zuversichtlich ward, dass ich , wie ich die Worte der Bitte aussprechen wollte, meine Freude nicht unterdrücken konnte, sondern meinem fröhlichen Gemüte Luft machte und miserere etc. mit Allegro überschrieb. 31” “Allegro” ist in diesem Zusammenhang sicherlich nicht nur als Tempoangabe zu verstehen, sondern vor allem auch als Vortagsbezeichnung im Sinne von “heiter” oder “fröhlich”. Haydn wendet also gedanklich das vielleicht von einem reuigen Sünder in tiefster Verzweiflung ausgesprochene “miserere” ins positive und erlaubt so - beispielsweise in einem von Jubel geprägten Gloria-Satz - die Beibehaltung eines fröhlichen Grundaffekts. Es bestand also gewissermassen eine Scheu vor einer zu starken Dramatisierung des Textes, und die Komponisten mussten sich um eine klare Abgrenzung der Kirchenmusik zum affekt- und effektgeladenen Theaterstil bemühen. Die figurale Affektdarstellung einzelner Worte war zudem in der katholischen Messe weit weniger bedeutend als im protestantischen Umfeld. Eine Erklärung dafür ist sicherlich die Tatsache, dass das Gewicht im protestantischen Bereich auf dem verkündeten Wort lag, während sich der Katholizismus vielmehr als Kirche des Sakraments verstand. Erst im Zuge der aufklärerischen Reformen fand diesbezüglich eine Gewichtsverlagerung statt, die sich dann auch auf Beethovens erste Messvertonung auswirkte. Dass eine Wortausdeutung unter anderem mit Hilfe abbildhafter Figuren nicht wichtig war, zeigt die Tatsache, dass beispielsweise Haydn solche Floskeln eher selten, zwar meist an denselben Textstellen, aber nicht in jeder Vertonung, also eher willkürlich anwendet. Beispiele für solche Topoi sind eine Abwärtsbewegung zu “descendit”, eine Aufwärtsbewegung zu ”ascendit”, übermässige Intervalle und Chromatik zur Schmerzdarstellung bei “crucifixus” und “passus”, das Singen in hoher Lage zu “excelsis”, “coeli”, “altissimus”, “vivos” usw., die tiefe Lage zu “terra”, “mundi”, “mortuos” usw., Unisonogesang zur Symbolisierung von Einzigartigkeit und Einheit bei “Credo”, “in unum Deum”, “tu solus”, ”Deum verum” usw., die Imitation zu “lumen de lumine…”, die Wendung in eine nach Moll abgedunkelte Tonart zur Darstellung der Erniedrigung Christi bei “qui tollis”, “et incarnatus” und viele mehr. Der Vergleich von Haydns Messen mit Kompositionen anderer Meister bestätigt, dass die Anwendung solcher Figuren alles andere als verbindlich war. Sehr wohl als verbindlich angesehen werden, kann allerdings der Einsatz der Polyphonie. Die Polyphonie, insbesondere die Fuge, deren Anwendung am Ende des Gloria und des Credo zum Standard einer Messkomposition gehörte, war ein Mittel zum Ausdruck von Feierlichkeit. Sie galt als “kaiserlicher Stil”, als höchste Vollendung musikalischer Kunst. Da sie besonders von Adel und 31 Haydn, Joseph: Haydn Edition. Die 6 späten Messen. Plattenbeiheft, Telefunken-Decca Schallplatten GmbH, 1978, S. 4 10 Kirche gepflegt wurde, verbindet sich mit ihr auch eine soziale Komponente. Der polyphone Stil verhindert zudem eine stark affektgeladene und subjektivierende Vertonung. Dadurch, dass in ihm ein geistiges, rationales musikalisches Prinzip befolgt wird, entspricht er in seiner Art der Geistigkeit des Textes und ist zur textausdeutenden und gefühlsvermittelnden Umsetzung nicht geeignet. Sein theologischer Wert liegt in der grösstmöglichen Objektivität und Allgemeingültigkeit. Die vergeistigtste musikalische Form tritt bei Haydn im ersten Teil der “Nelsonmesse” auf, wo zwei jeweils in Oktaven geführte Stimmen einen Kanon (im Quintabstand) bilden. Eine musikalische Umsetzung der einzelnen Textworte nach dem Vorbild opernhafter Tonmalerei der weltlichen Vokal- (Theater-) Musik war in der Kirchenmusik also nicht erstrebenswert. Eine Polytextur, wie sie im ersten Credo-Teil der “Paukenmesse” vorliegt, verhindert zudem eine textdienliche und -deutende Vertonung vollends, zumal sie sich mit einem fugierten Satz verbindet. Es kommt auch vor, dass inhaltlich unterschiedliche Worte auf dasselbe Motiv gesungen werden, wie beispielsweise “gloria in excelsis” und “gratias agimus” im Gloria der “Nelsonmesse” und “simul adoratur”, “unam sanctam” und “mortuorum” im Credo der “Theresienmesse”. Der Einsatz und die Ordnung der Motive sind dort rein musikalisch begründet und vom Text unabhängig. Dasselbe gilt für Melismen, metrische, dynamische und satztechnische Akzente, die meist eher zufällig auf bestimmte Worte fallen. Die Verständlichkeit oder gar Betonung gewisser Worte und Textinhalte war nicht das Ziel. Vielmehr sollte der Text unangetastet bleiben und die Musik nur Ergänzung zum Wesentlichen, der Eucharistie, sein. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als an die Stelle kleinerer Teilsätze umfassendere, über weite Strecken durchkomponierte Sätze traten, stellte sich in einer Messvertonung zunehmend das Problem der Vereinheitlichung und Geschlossenheit. Gloria und Credo bestanden so beispielsweise bei Haydn nur noch aus drei verschiedenen Abschnitten, jeweils zwei bewegteren Randteilen und einem kontrastierenden, langsameren Mittelteil. Zur Lösung des Problems der formalen Organisation innerhalb der längeren Sätze, dienten unter anderem Übernahmen von Elementen der zeitgenössischen Instrumentalmusik. Dazu gehörte auch die Annäherung an symphonische Verfahren wie etwa die motivisch-thematische Arbeit. Die formalen und strukturellen Fragen sollten also vor allem auf der musikalischen Ebene gelöst werden. Damit verband sich aber ausserdem der Gedanke der Einheit des Affekts und somit eine homogene musikalische Gestaltung. Deshalb wäre es auch nicht zutreffend, die Kompositionsweise als wirklich symphonisch zu bezeichnen. Zwar lässt sich in Haydns Messen wohl ein gewisser Grad an motivischer Arbeit nachweisen, doch fehlt eine Gegensätzlichkeit der Bestandteile, Affekte und Impulse, welche die Dramatik der Form, das symphonische Prinzip der Sonatenhauptsatzform begründen. Gerade dieses klassische, von einer inneren Differenzierung geprägte Formverständnis bietet Beethoven später die Möglichkeit eines verstärkten Eingehens auf den Text. Der Text und seine Darstellung spielte für Haydn aber nur eine untergeordnete Rolle. Zudem war die instrumentale Komponente, das Orchester, der formbildende Faktor. Der Chor hatte sich dem kontinuierlichen Fluss des Orchestersatzes anzupassen. Haydn lehnte sich in seinen Messkompositionen noch stark an einen barocken Satzaufbau und dessen homogenisierende Formgestaltung und Fortspinnungstechnik an. Bereits vor Beethovens Komposition sind bei Haydn die beiden textreichen Sätze von einer weitgehenden Deklamation der Worte geprägt. Doch diese diente vor allem der Bewältigung der grossen Textmenge durch den Chor und war dem figurierten und motivisch-thematischen Orchester untergeordnet. Es fand also keine besondere Text-Vertonung statt, im Sinne einer Hervorhebung und Betonung der Worte, sondern angestrebt wurde eine weitgehende Homogenität innerhalb eines Satzes, ein einheitlicher Affekt und eine einheitliche, nach einer musikalischen Logik geordnete Form. Dies wurde zum Beispiel durch ostinate Begleitfiguren des Orchesters oder durch eine, meist vom Orchester getragene, eigenmusikalischen Gesetzen folgende Geschlossenheit erreicht. Damit verbunden war eine Sparsamkeit in der Bildung von neuen Motiven, eine möglichst grosse motivische Einheitlichkeit und Kohärenz, rhythmische und motivische Kontinuität, die Entwicklung und Wiederholung von Motiven. Hierfür gibt es viele Beispiele. Im Folgenden seien nur einige vorgestellt. 11 Durchgehende Begleitfiguren finden sich im “et incarnatus” der “Harmoniemesse” und im “qui tollis” der “Theresienmesse” (jeweils Achteltriolen in der ersten Violine), im ersten Credo-Teil der “Theresienmesse” (bis auf wenige Takte durchlaufende Sechzehntel in beiden Violinstimmen), im “qui tollis” der “Paukenmesse (durchgehende Achtel in den oberen drei Streichern oder im Bass) und im “et vitam” der “Heiligmesse”. An diesen Stellen sind die Begleitmuster am konsequentesten durchgehalten, doch treten sie auch andernorts ähnlich auf. Dabei ist es nicht einmal erforderlich, dass sich solche Figuren unverändert durch einen ganzen Satz ziehen, solange der musikalische Fluss nicht unterbrochen wird und sich der Grundcharakter nicht ändert. So geschieht es, dass im Gloria der “Schöpfungsmesse” sogar die Worte “qui tollis peccata”, die mit den dazugehörigen “miserere”-Rufen nicht gerade Festlichkeit ausdrücken, bei ihrem ersten Erscheinen noch im Fluss des vorangehenden fröhlichen Jubels und zudem mit einer ähnlichen Motivik gesungen werden. Erst allmählich, ausnahmsweise ohne deutlichen Einschnitt an dieser Stelle, leitet Haydn zum ruhigeren Mittelteil des Satzes über. Es lässt sich auch beobachten, dass bei zunehmender Abruptheit und Plastizität in der Chordeklamation gleichzeitig die Gleichmässigkeit in der Orchesterbegleitung zunimmt, wie zum Beispiel im Gloria der “Theresienmesse” zu “glorificamus te”. Das Orchester überlagert und verschleiert dort und andernorts die dramatischere Struktur der Chorstimmen und verleiht dem Ganzen eine homogene Gestalt. Wie oben schon dargelegt, besitzen natürlich alle Fugen und fugenähnlichen Stellen ebenfalls einen einheitlichen Ausdruck. Daneben spielt die Formbildung durch motivisch-thematische Ordnung eine bedeutende Rolle. Sehr auffällig geschieht dies im Gloria der “Nelsonmesse”. Das zu den Worten “Gloria in excelsis Deo” gehörende Kopfthema wird nicht nur im ersten Satzteil mehrmals fast identisch wieder aufgegriffen (zu “gratias agimus tibi” und “Domine fili unigenite”), sondern auch im dritten (“quoniam tu solus sanctus”). Dasselbe gilt für das “et in terra”-Motiv, das zu “Domine Deus”, “Filius Patris” und, vor dem abschliessenden Choreinsatz, von den Solisten zu “amen” wieder eingebracht wird. Ein so starker motivischer Zusammenhang, der sich nicht auf einen Satzteil beschränkt, sondern die beiden im Affekt ähnlich gelagerten Randteile miteinander verbindet, ist nicht in allen Messen Haydns vorhanden. Er lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass der Mittelteil dafür mit seinen unisono deklamierten, fast gesprochenen “miserere”-Einwürfen des Chors um so ausdrucksgeladener ist und in einen affektneutralen Rahmen gebettet sein will, welcher der dort aufkommenden Dramatik ausgleichend entgegenwirkt. Das Benedictus derselben Messe weist übrigens eine dem Gloria ähnliche Faktur und Motivik auf, so dass auch sinnfällige satzübergreifende Zusammenhänge entstehen. In der “Paukenmesse” lässt sich ein ähnliches Vorgehen zeigen. Hier ist es das “laudamus te”-Motiv, das zu “benedicimus te”, “adoramus te”, “Domine Deus”, “Agnus Dei”, “Filius Patri” und dann im dritten Satzteil zu “cum Sancto Spiritu”, “in gloria Dei Patris” und “amen” wiederkehrt. Im “quoniam”-Teil der Theresienmesse ist es das Motiv eines punktierten Viertels mit zwei folgenden Sechzehnteln, das die formale Gestaltung des Abschnitts bestimmt. Die Reihe liesse sich auch hier wieder mit zahlreichen Beispielen fortsetzen. Es ist nun sicher nicht davon auszugehen, dass die oben beschriebenen Begleitfiguren und motivischen Verwandtschaften bei Beethoven überhaupt nicht mehr anzutreffen sind, doch haben sie einerseits nicht dasselbe Gewicht und dienen andererseits teilweise einem anderen Zweck. 5. Analyse der C-Dur-Messe Hermann Kretzschmar schreibt in seinem “Führer durch den Konzertsaal” über Beethovens Erstlingswerk auf dem Gebiet der Messkomposition folgendes: “Tatsache ist, dass sich Beethoven mit dieser Cdur-Messe auf einen ganz anderen Boden stellte, als der war, auf welchem die Messen seiner Zeit, auch die Haydns und Mozarts, zu entstehen pflegten. 32” Dem steht die Auffassung Schnerichs gegenüber, der meint, “dass sich bei ihm [bei Beethoven, bezüglich seiner Messen] der Einfluss seines grossen Lehrers Josef Haydn ganz überwiegend zeigt. 33” Die Analyse soll nun 32 33 Kretzschmar, Hermann: Führer durch den Konzertsaal. Band II, 1, Leipzig (Breitkopf & Härtel), 1921, S. 205 Schnerich, S. 60 12 zeigen, dass Beethovens Werk sicherlich nicht ganz von der Tradition zu trennen ist und sich in ihm sehr wohl traditionelle Elemente finden, dass aber die hinter der Komposition stehende Idee und deren Umsetzung tatsächlich neu sind. Vergleichend sollen vor allem die letzten sechs Messen Haydns zugezogen werden. 5.1. Traditionelles in Beethovens Messkomposition Das Gewicht der fünf Ordinariumsteile Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus mit Benedictus und Agnus Dei ist, wie schon in Haydns Werken, relativ ausgeglichen. Die textreichen Sätze sind durch eine ziemlich konsequente syllabische Deklamation und durch ihre Gliederung in nur noch drei Abschnitte im Vergleich mit früheren Konventionen (Nummernmesse, Kantatenmesse) bereits bei Haydn gestrafft. Der weitgehende Verzicht auf virtuose, arienhafte Solopassagen zugunsten des Auftrittes der Solisten als Ensemble und einer grösseren Beteiligung des Chors ist in Beethovens Komposition ebenfalls nicht neu. Die Gesangssolisten werden ausserdem an bestimmten Stellen eingesetzt, die ihnen auch in der Tradition oft übertragen wurden. Beispiele dafür sind das “Christe”, “gratias agimus tibi”, “qui tollis peccata”, “suscipe”, “et incarnatus est” und “Benedictus”. Wie schon Haydn, verwendet Beethoven symphonische Elemente in seiner Komposition, allerdings zu einem grossen Teil, wie sich noch zeigen wird, nicht die selben und nicht demselben Zweck. Die für die Aufführung erforderliche Besetzung entspricht jener Haydns, die Holzbläser sind jedoch alle doppelt besetzt. Traditionell ist in Beethovens Messe auch der grossformale Aufbau, verbunden mit einer Art von Tonartenplan. Den ersten Satz bildet das Kyrie. Das durchgehaltene langsame Tempo ist zwar eher ungewöhnlich, findet sich aber auch in Haydns “Harmoniemesse”. Der in E-Dur stehende “Christe”-Teil entspricht ebenfalls herrschenden Konventionen, wonach die Harmonik dort meist aufgehellt wurde. Bei Haydn wird an dieser Stelle jeweils der Bereich der Dominante oder der DurParallele der Grundtonart erreicht. Beethovens Gloria scheint ein einziger geschlossener Satz zu sein, während Haydn seine zweiten Sätze in drei Abschnitte gliedert. Der erste Teil reicht meist bis vor “qui tollis peccata, manchmal auch nur bis vor “gratias agimus tibi”, der dritte Teil beginnt mit dem “quoniam tu solus”. In Beethovens Komposition sind zwar diese Teilsätze nicht durch Schlusskadenzen und -doppelstriche voneinander getrennt, die Übergänge erfolgen fliessend mit Hilfe instrumentaler Überleitungsfiguren. Auch bei ihm wechselt jedoch das Tempo (vom Allegro zum Andante), und das Metrum ändert sich (vom alla Breve zum ¾-Takt). Gleichsam als Sinnbild für die Erniedrigung Christi, der die Sünden der Menschen auf sich nimmt, findet zudem eine Verdunkelung der Tonart statt. In Haydns Messen stehen so die mittleren Abschnitte fast immer in der Unterdominante (“Harmonie-” und “Schöpfungsmesse”), in der Mollparallele (“Heiligmesse”), in der Mollparallele der Unterdominante (“Theresienmesse”) oder in einer Untermediante (“Nelsonmesse”). Beethovens Umsetzung beginnt in f-Moll und wendet sich dann nach As-Dur, einer Untermediante der Grundtonart C-Dur. Das Credo ist ebenfalls drei-, mit der abschliessenden “et vitam”-Fuge, wie bei Beethoven, oft sogar vierteilig angelegt. Der Abschnitt zu den Worten “et incarnatus” bis “sepultus est”, welche die Menschwerdung und Kreuzigung Christi zum Inhalt haben, hebt sich auf ähnliche Weise von den Rahmenteilen ab wie der langsame Gloria-Abschnitt. Das Sanctus steht in allen sechs Haydn-Messen in der Grundtonart und ist zweiteilig. Einem langsamen ersten Abschnitt folgt zu den Worten “pleni sunt coeli…” und “osanna…” ein bewegter zweiter. Beethoven komponiert seinen Satz dagegen in A-Dur, welches sich allerdings erst im jubelnden “osanna” wirklich stabilisiert. Das Benedictus ist ausser bei Beethoven auch in der “Nelson-” und “Harmoniemesse” zweigeteilt und greift das “osanna” aus dem Sanctus wieder auf. Tonartlich bewegen sich die Benedictus-Sätze der “Pauken-“, “Nelson-“, “Heilig-“ und “Schöpfungsmesse” in demselben Bereich wie die langsamen Mittelsätze von Gloria und Credo. In den beiden erstgenannten Werken findet dabei jeweils eine Aufhellung von Moll nach Dur statt, während in den zwei anderen die Unterdominante bestehen bleibt. Beethovens Benedictus beginnt in F-Dur, das “osanna” steht in A-Dur. Auch im Agnus Dei ist eine Zweiteiligkeit gegeben mit einem langsameren “Agnus Dei” und einem lebhafteren “Dona nobis pacem”. Bezüglich der 13 Tonarten lässt sich gleiches feststellen wie in den Benedictus-Sätzen. In Beethovens Op. 86 beginnt das Agnus Dei in c-Moll und hellt sich beim “dona nobis” nach C-Dur auf. Die aufgezeigten tonartlichen Verhältnisse entsprechen alten barocken Traditionen, wonach der Schritt zurück in Richtung der Moll- oder b-Tonarten zur Versinnbildlichung des herabsteigenden, leidenden und die Menschen erlösenden Christus diente. Die Anwendung der Kreuztonarten war dagegen mit der Auferstehung und dem Jubel verbunden. Wie weit Haydn und Beethoven mit der symbolischen Bedeutung dieser Anlage noch vertraut waren, lässt sich allerdings nicht sagen. Dasselbe gilt für die Anwendung rhetorischer Formen der barocken Affekten- und Figurenlehre. Die rhetorisch-abbildhaften Topoi, die schon bei Haydn nur eine kleine Rolle spielen und eher willkürlich eingesetzt werden, haben auch in der Messe von Beethoven für die Textausdeutung nur eine sekundäre Bedeutung. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Beethoven diese rhetorischen Mittel gezielt einsetzte, oder ob er sie einfach, ohne sich über deren Bedeutung voll bewusst zu sein, von der überlieferten Tradition übernahm. Als Beispiel gelte hier das dynamisch, harmonisch und in der Tonhöhe stark kontrastierende “adoramus” (Gloria T. 48 ff.), das ausser in der “Pauken-” und der “Nelsonmesse” in Haydns Werken vergleichbar, wenn auch nicht so zugespitzt, umgesetzt ist. Es ist fraglich, ob Beethoven (und auch Haydn) die Bedeutung dieser Zurücknahme kannte, als Sinnbild für den Priester, der an dieser Stelle der Liturgie demütig den Kopf neigte. Möglich ist an einigen Stellen genauso ein zufälliges Zusammentreffen der Figurenlehre mit dem davon unabhängig komponierten Notentext. Die Generalpause und die OktavAchtelketten am Anfang des Gloria könnten aus dieser Sicht beispielsweise einfach als klangliche Effekte und Mittel zur Dramatisierung gedacht sein und müssen nicht unbedingt als Darstellung von Ewigkeit und Allmacht verstanden werden. Andere Figuren wiederum sind so einsichtig, dass sie zu ihrem Verständnis keines theoretischen Überbaus bedürfen, sondern im Gegenteil sehr naheliegen. Dazu gehört beispielsweise die absteigende Linie zu “descendit” oder der Aufstieg zu “ascendit” im Credo. Historischen Indizien zufolge war das Verständnis der Figurenlehre und damit ein bewusstes rhetorisches Komponieren bereits seit 1750 im Abnehmen begriffen. Es erstaunt um so mehr, dass in der C-Dur-Messe deutlich mehr figurale Topoi zu finden sind als noch bei Haydn. Allerdings scheint sich Beethoven erst im Hinblick auf seine Missa Solemnis intensiv mit älterer Kirchenmusik auseinandergesetzt zu haben. In einer Notiz von 1818 ist zu lesen: “Um wahre Kirchenmusik zu schreiben - alle Kirchenchoräle der Mönche durchgehen auch zu suchen, wie die Absätze in richtigsten Übersetzungen nebst vollkommener Prosodie aller christkatholischen Psalmen und Gesänge überhaupt. 34” Auch eingehende Studien an Werken Bachs und Händels bildeten einen Teil der Arbeit an seiner zweiten Messe. Wie bereits erwähnt, spielte das Wort in der protestantischen Kirche eine grössere Rolle als in der katholischen, weshalb die Musik Bachs auch bedeutend mehr rhetorische Figuren enthält. Trotz dem häufigen Vorkommen dieser seit dem Barock tradierten abbildhaften Topoi, sind diese nicht essentiell für Beethovens Musiksprache. Traditionelle Gestaltungsmodi, zu denen alte Formen und die abbildhaften Figuren der Affektenlehre gehören, verloren ihre Bedeutung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also schon zur Zeit Haydns. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde nun bekanntlich eine klare Vergegenwärtigung des Textes und die direkte Vermittlung von Stimmungen und Gefühlen durch Musik, ohne den Umweg über nur rational erfassbare Topoi, immer wichtiger. Die in Beethovens Vertonung liegende direkte Emotionalität und innere Dramatik, welche den Hörer unmittelbar ansprechen, macht die überlieferten rhetorischen Mittel eigentlich überflüssig. Die erstaunliche Präsenz abbildhafter Typologie in Beethovens Op. 86 ist also nicht bestimmend für das Wesen der Komposition, weshalb im Rahmen dieser Untersuchung nicht näher darauf eingegangen wird. Insgesamt ist festzustellen, dass sich Beethoven in seiner ersten Messe deutlich von der Tradition und von den im vorangehenden Kapitel beschriebenen Bestrebungen nach grösstmöglicher Homogenität und formaler Ordnung löst. An dieser Stelle sei ein kurzer Seitenblick auf Beethovens zweite Messe erlaubt. Man kann sagen, dass die C-Dur-Messe in mancher Hinsicht progressiver ist als die D-Dur-Messe, die Missa 34 Thayer, Band 4, S. 130 14 Solemnis. Sie entfernt sich von traditionellen Mustern, enthält neue, von der Tradition unabhängige Ausdrucksvarianten und stellt das individuelle Glaubenserlebnis in den Mittelpunkt. In Beethovens zweiter Messe hingegen spielen die überlieferten Formen eine äusserst wichtige Rolle. Allerdings ist die Verwendung barocker Satzformen und Figuren, der starke Gebrauch des Kontrapunkts und anderer traditionsbefrachteter Elemente nicht einfach als Rückkehr zu einem konservativen Stil zu sehen. Das Gegenteil ist der Fall. In der Wiederaufnahme des Alten besteht gerade das Neue. Die Archaismen der Form, des Ausdrucks und des Stils sind als programmatische und historisierende Auseinandersetzung mit der Gattung zu verstehen, beruhen also auf einem bewusst reflektierten, gezielten Einsatz alter Elemente. Die auf diese Weise erfolgende Selbstreflexion der Gattung steht ausserdem in einem Spannungsverhältnis zum aktuellen, subjektivierenden Zeitstil, der sich durch seine Gefühlsästhetik und die Dramatisierung der Vorlage auszeichnet, und den Beethoven in seiner zweiten Messe ebenfalls wieder aufgreift. Der Komponist versucht also, in der Missa Solemnis mit allen möglichen Mitteln auf den Text einzugehen und ihn so aus der engen Verbindung mit der Liturgie zu lösen, gewissermassen der Komposition die Rolle der Liturgie zu übertragen. 5.2. Die Arten der Textvertonung bei Beethoven Nachdem durch die Josephinischen Reformen die Kirchenmusik nicht mehr nur funktionell an das äusserliche liturgische Zeremoniell und die repräsentative Machtdarstellung gebunden sein sollte, sondern die Erweckung der Andacht und persönlichen Religiosität des einzelnen Menschen zur Aufgabe hatte, änderten sich die Voraussetzungen für den Komponisten. Durch die Verlagerung von der Äusserlichkeit zur Innerlichkeit gewann einerseits der zu vertonende Text an Bedeutung, andererseits wurde von den Komponisten nun vermehrt eine Subjektivierung des Ausdrucks gesucht, eine Gefühlsästhetik, die zum Ziel hatte, auf direktem Weg spezifische Empfindungen hervorzurufen und dadurch die Distanz zum Hörer zu verringern. Die Musik sollte unmittelbar ansprechende Gefühle, Leidenschaft, Sehnsucht, Trauer, Freude usw. erregen. Das blosse Vorhandensein des Textes reichte also nicht mehr aus. Die Worte sollten vergegenwärtigt, das heisst fassbar und, wenn möglich, fühlbar gemacht werden. Anstelle feststehender Formen und formelhaftstatischer Formulierungen trat das Bemühen um einen individuellen, originalen Ausdruck, um noch nicht dagewesene Lösungen. Der Aspekt des Eigenständigen, Individuellen und Subjektiven zeigt sich unter anderem in der Abkehr von in der Tradition verhafteten Elementen, wie etwa figuralen Abbildungsfloskeln und Symbolen, die schon bei Haydn keine Rolle mehr spielten. So fand nun auch in der Kirchenmusik eine Entwicklung von stereotyper Gebrauchsmusik zu einer individuellen Kunstmusik mit hohem künstlerischem Anspruch statt. Damit rückte aber ebenso das Individuum der schaffende und nicht mehr dienende Komponist auf der einen, der subjektiv fühlende und denkende, urteilende, aufgeklärte Zuhörer auf der anderen Seite - stark ins Zentrum. Wenn der oben zitierte Kritiker bemerkte, dass Beethovens erste Messe nicht dem entspreche, was “Jahrhunderte hindurch” als “Kirchenstyl” gegolten habe, so dachte er dabei nicht nur an die damals traditionelle orchesterbegleitete Messe. Vielmehr bezog er sich auf die einer “würdevollen” Ordinariumsvertonung ziemende Objektivität, die in Beethovens Werk im Vergleich zur Tradition fehlt. An deren Stelle tritt der Ausdruck einer subjektiven, menschbezogenen Emotionalität und eine Anlage, die auf das direkte sinnliche Erleben des Zuhörers abzielt. Der Text des Messordinariums ist nun allerdings in sich kein dramatischer oder lyrisch gebundener. Er bietet ganz im Gegenteil, besonders in den Textreichen und prosaischen Sätzen Gloria und Credo, kaum Ansatzpunkte für eine dramatische oder gefühlsvernittelnde Vertonung. So gibt es zwei Möglichkeiten der Textbehandlung. Wo es möglich ist, steht für Beethoven ganz klar die Umsetzung der im Text liegenden Stimmung im Zentrum, um im Zuhörer dadurch direkt die betreffenden Gefühle zu erwecken. Geht das nicht, bemüht sich Beethoven um eine möglichst plastische, den Text in seiner Struktur wiedergebende und sich mit ihm zu einer Einheit verschmelzende Vertonung. Die Plastizität des Textes, die durch die individuelle Komposition jeder einzelnen Aussage entsteht, soll dem Hörer nun erlauben, sich selbst mit dem Text auseinanderzusetzen und dadurch ebenfalls zur persönlichen Religiosität zu finden. 15 Ein Mittel, womit in der Musik die erwünschte Plastizität und damit eine möglichst starke Annäherung an die gesprochene Sprache erreicht werden kann, ist die Deklamation. Diese geht von den Textworten aus, deren Rhythmus und Akzente sie korrekt und sprachnah wiedergibt. Dadurch erhält der Text ein grösseres Gewicht. Was die richtige Behandlung der Wortrhythmen und -akzente angeht, ist in Beethovens Op. 86 im Vergleich mit den Messen Haydns nichts wirklich Neues zu finden. Beide Komponisten haben den Ordinariumstext im wesentlichen syllabisch vertont. Es ist jedoch zu beobachten, dass bei Beethoven die Motivik noch stärker an die jeweilige Wortgestalt angepasst ist und mit ihr eine Einheit bildet. Dies führt besonders im Gloria und im Credo zu einer Motivgestalt, die charakteristisch, jedoch oft auf grundlegende Elemente reduziert ist. Die Motivik geht dadurch streng vom Wort und damit auch von den Vokalstimmen aus und ist nicht eigenständig. Die harmonische und motivische Gestaltung und Entwicklung, welche sonst die Form und die Struktur des Satzes nach immanent musikalischen Gesichtspunkten bestimmen, treten in ihrer Funktionalität hinter den Text zurück. Die höchste Stufe der sprachnahen Deklamation wird erreicht durch den Verzicht auf den nicht vokalen Anteil im a-capella-Satz, durch das Weglassen der harmonischen Komponente im Unisono und durch eine fehlende melodische Bewegung, also durch einen rezitierenden Stil. Die enge Verknüpfung zwischen Wort und Motiv führt, wie weiter unten näher erläutert, zu einer Abfolge gegensätzlicher Bewegungen und wechselnder Impulse und damit zu einer Dramatisierung des Satzes. Wie sich zeigen wird, kann diese Dramatisierung in gewissen Fällen ebenfalls Teil der Ausdrucksästhetik und mit der direkten Gefühlsvermittlung verknüpft sein, nämlich da, wo das dramatische Umfeld mit der Wortbedeutung und den auszudrückenden Emotionen übereinstimmt. Es ergibt sich fast von selbst, dass durch die starke Gewichtung des Textes und durch die dafür angewandten Mittel ebenso die Vokalstimmen, die diesen tragen, aufgewertet werden. So ist in Beethovens Op. 86 nicht mehr das Orchester form-, struktur- und motivbestimmend, sondern der Chor und die Gesangssolisten. Das Orchester tritt meistens hinter diese zurück und ist ihnen höchstens gleichgestellt. Dagegen treten die Singstimmen mehrmals a capella in Erscheinung. Auch auf dieser Ebene rückt also die dem Menschen eigene Stimme und damit der sich selbst äussernde und einbeziehende Mensch ins Zentrum des Interesses. Es ist sicher kein Zufall, dass Beethoven als einer unter vielen die a-capella-Musik des 16. Jahrhunderts, insbesondere die Musik Palestrinas, hoch schätzte und in ihr die reinste Form der Kirchenmusik sah. 5.3. Vermittlung von Gefühlswerten im Kyrie und im Benedictus Im Kyrie und im Benedictus findet die musikalische Umsetzung des Ordinariumstextes vornehmlich auf der Basis direkter Ausdrucksvermittlung statt. Das Kyrie in Beethovens erster Messe verkörpert in keiner Weise den Affekt des Majestätischen und Pompösen, mit dem die Ankunft des kirchlichen Fürsten (Jesus) und des weltlichen Herrschers dargestellt werden sollte, wie dies auch bei Haydn noch der Fall ist. In allen der letzten sechs Messen Haydns verwendet der Komponist den Topos des punktierten Rhythmus als Sinnbild für Herrschaft und Macht. Hinzu kommt der Einsatz von Pauken und Trompeten als herrschaftliches Symbol. Der Kyriesatz wird gewissermassen zu einer Festouvertüre. Die Pracht und der Festcharakter nehmen den Platz der vom Text und der Liturgie eigentlich vorgegebenen Demut, der Vorbereitung auf die Eucharistie, des Schuldbekenntnisses, der Busse und der Bitte um Erbarmen ein. Auch das von Beethoven gewählte langsame Tempo ist in den Zeitgenössischen Messvertonungen eher die Ausnahme. Wie wichtig dem Komponisten selbst das Einhalten des richtigen Zeitmasses war, widerspiegelt sich in der auffällig langen Tempo- und Vortragsbezeichnung “Andante con moto assai vivace quasi Allegretto ma non troppo”. Der langsame Satz des Streichquartetts in C-Dur Op. 59 Nr. 3 ist sehr ähnlich, nämlich mit “Andante con moto quasi Allegretto” überschrieben. Der Charakter des Kyrie lässt sich somit mit dem eines langsamen zweiten Satzes vergleichen, und nicht mit dem eines eher extrovertierteren Kopfsatzes. Haydn setzt nur in seiner “Harmoniemesse” den Kyriesatz in durchgehend langsamem Tempo. Das Kyrie der “Nelsonmesse” ist mit “Allegro moderato” überschrieben. Die vier übrigen Messen wechseln nach einer langsamen Einleitung ebenfalls ins 16 Allegro. Zur Vorstellung kirchlicher Erhabenheit gehörte aber ein langsames Zeitmass. Beethoven selbst schreibt über den ersten Satz der C-Dur-Messe: ”Der allgemeine charakter […] in dem Kyrie ist innige Ergebung, wahre Innigkeit religiöser Gefühle […]. Sanftheit liegt dem Ganzen zu Grunde […]. 35”. Die Bitte um Erbarmen ist verbunden mit einer freundlichen, zuversichtlichen Stimmung oder, wie E. T. A. Hoffmann schreibt, der “Ausdruck eines kindlich heiteren Gemüths, das, auf seine Reinheit bauend, gläubig der Gnade Gottes vertraut und zu ihm fleht, wie zu dem Vater, der das Beste für seine Kinder will und ihre Bitten erhört. 36” Ein anderer Rezensent der AmZ (Allgemeine musikalische Zeitung) bemerkt ebenfalls das “Erhebende, womit in dem Kyrie das Herz zur Andacht geführt wird. 37“ Diese Aussagen lassen sich aufs beste mit der oben genannten Vortragsbezeichnung in Einklang bringen: Das Erhabene mit dem “Andante”, die Freundlichkeit, Zuversicht und Heiterkeit mit “con moto assai vivace quasi Allegretto” und die Zurücknahme, die Verinnerlichung und Sanftheit mit “ma non troppo”. Beethoven setzt nun also in seiner Vertonung zu dem Wort “Kyrie” nicht homorhythmisch deklamierte Akkordblöcke ein, sondern lässt den Wortlaut kantabel, liedhaft-lieblich melodisiert von den in Terzen geführten Frauenstimmen vortragen. Während die Männerstimmen mit einem kurzen Orgelpunkt das Fundament bilden, erheben sich über ihnen die Oberstimmen. Die Punktierung im Bass ganz zu Beginn erinnert zwar vielleicht noch an deren traditionellen Einsatz, kommt aber hier kaum zur Geltung. Ungewöhnlich, aber in dieser Messe konstitutiv, ist, dass die motivische Ausgestaltung vom Chor und nicht vom Orchester ausgeht. Das Orchester ist in seiner Begleitung zudem nicht unabhängig, sondern stark an das vokale Thema gebunden, welches es mit Achteln umspielt. Die Getragenheit, die Vermeidung von Dramatik und die einfachen formalen und harmonischen Verhältnisse ziehen sich durch das ganze Kyrie. Dieses öffnet sich zum in Takt 37 beginnenden “Christe”-Teil in E-Dur. Hier steigert sich nun der Ausdruck durch die a capella einsetzenden Solostimmen, durch die Betonung einzelner Worte und durch einige Akzente, ohne dass dadurch allerdings der Fluss des Satzes unterbrochen wird. Über eine Scheinreprise in Takt 71 (“Kyrie eleison” noch in E-Dur), die ihren Höhepunkt in Takt 80 erreicht, wird in Takt 84 das Anfangsthema in C-Dur wieder aufgegriffen. Erst in den Takten 112 - 116 und 123 - 130 findet der Chor zu homorhythmischer Deklamation, während dem Orchester jeweils das Kopfmotiv übertragen wird, zunächst in seiner umspielten und danach in seiner originalen Form. Die Deklamation ist hier jedoch nicht eine extrovertierte Akklamation, wie in anderen zeitgenössischen Messen üblich, sondern im Gegenteil eine Zurücknahme, eine Reduktion auf Unisono, Rhythmus und Text im Piano und eine dadurch gesteigerte Verinnerlichung. Wie gesehen, basiert die musikalische Umsetzung im Kyrie zwar auf dem Text, beruht aber nicht auf der Vertonung der einzelnen Worte, sondern auf der Vermittlung des dahinterstehenden religiösen Gefühls und der Verbreitung einer erhebenden Atmosphäre. Das Benedictus weist einen dem Kyrie sehr ähnlichen Charakter auf, wie schon die Vortragsbezeichnung “Allegretto ma non troppo” andeutet. Der liturgischen Situation nach vollzogener Wandlung entsprechend, sollen hier erhebende, andächtige Gefühle geweckt werden. Die kurze und inhaltlich homogene Aussage bietet kaum Angriffspunkte für eine isolierende und ausdeutende Vertonung der Einzelworte. Wie im Kyrie, entsteht hier ebenfalls ein Stimmungsbild. Die Solostimmen, die zu Beginn des Satzes sogar a capella gesetzt sind, tragen gleichsam verkündend die Benedictus-Worte vor, die vom Chor ab Takt 69 ergriffen und deklamationsnah aufgenommen werden. Ähnlich wie im Kyrie findet sich in den Takten 90 ff., 114 ff. und 166 ff. jeweils eine Unisono-Deklamation des Textes durch den Chor, die gleichsam eine Erhöhung der inneren Andacht darstellt. Das Benedictus der “Nelsonmesse” von Haydn weist in dieser Hinsicht ganz ähnliche Züge auf. Beethovens Version dieses Satzes weicht denn in seinem Charakter auch am wenigsten von der Tradition ab. Obwohl das Benedictus aus liturgischer Sicht noch zum Sanctus gehört, setzt es Beethoven deutlich davon ab, zwar nicht durch einen Schlusstaktstrich, wie dies Haydn noch tat, aber doch immerhin durch eine Schlusskadenz mit darauffolgendem Tonartenwechsel. Im Gegensatz zum Kyrie ist im Benedictus auch der Topos des punktierten 35 Beethoven, Ludwig van: Briefwechsel Gesamtausgabe, Band 5, S. 176 Kunze, S. 254 37 Kunze, S. 249 17 36 Rhythmus und der Fanfarendreiklänge zu finden (T. 86 ff., T. 120 ff., T. 140 ff.: “in nomine Domini”). Als Anleihe aus der Instrumentalmusik liegt hier zudem eine Sonatensatzform vor, mit Einsatz des Seitenthemas in Takt 70 und der Reprise in Takt 98, allerdings ohne Durchführungsteil. Neu ist dies aber nicht. Das Benedictus in Haydns “Harmoniemesse” weist dieselbe Faktur auf. Trotz dieser Anlage spielt aber Beethoven die dramatischen Möglichkeiten nicht aus. War das Benedictus aber bis anhin ein konzertanter und instrumental dominierter Satz gewesen, in dem sich das Orchester mehr als andernorts unabhängig von den Vokalstimmen ziemlich frei hatte entfalten können, verkehrt dies Beethoven in seiner Komposition ins Gegenteil. Nur in den drei Takten, die zum Osanna überleiten, schweigen die Singstimmen. Andererseits gibt es mehrere Stellen, an denen sie unbegleitet eingesetzt sind (T. 49 ff., T. 67 ff., T. 89 ff., T. 122 ff., T. 158 ff. und T. 162 ff.) und den Text so plastisch in den Vordergrund rücken. Wohl liegt die musikalische Bedeutung und thematische Arbeit besonders während des Chor-Unisonos beim Orchester, doch ist dieses auch dort nicht völlig frei, sondern wird vom Ordinariumstext durchdrungen. Die vokale Dominanz geht mit der Omnipräsenz des Textes einher und ist durch sie begründet. Das Zurückdrängen des instrumentalen Anteils kann zudem als Annäherung des von Beethoven idealisierten a capella Satzes gesehen werden. 5.4. Strukturelle Dramatisierung des Textes Im Gegensatz zu den soeben besprochenen Abschnitten lässt sich in den textreichen, prosaischen Sätzen Gloria und Credo aufgrund der grossen Textmenge mit ihren aneinandergereihten unterschiedlichen Aussagen kein einheitliches, dem Text entsprechendes Stimmungsbild mehr aufbauen. Eine gefühlsvermittelnde Vertonung ist kaum möglich. Zudem ist es nicht die Absicht Beethovens, wie Haydn innerhalb eines Satzes oder Teilsatzes eine möglichst grosse Homogenität und Einheit des Affekts herzustellen. Die Nuancen, die gegensätzlichen Aussagen, sollen im Gegenteil differenziert ausgedrückt und nicht einfach nur als traditionelle Formen und abbildhafte Topoi unter einen in sich unveränderlichen Grundaffekt gestellt werden. Das Kyrie-ähnliche Motiv in Takt 180 ff. des Gloria (“miserere”) verliert so im zerklüfteten, dramatischen Umfeld seinen ehemaligen erhebenden Charakter und damit die Funktion der unmittelbaren Andachtserweckung, bildet also lediglich einen Kontrast zum Vorangehenden und Folgenden. An Stelle der direkt emotionalisierenden Musik tritt in der Vertonung der textreichen Sätze eine innere Dramatisierung. Beethoven führt in seiner Messkomposition den zeitgenössischen Instrumentalstil, der sich durch eine dramatische Musiksprache auszeichnet, auch in die Kirchenmusik ein. Das Gloria und das Credo der C-Dur-Messe übernehmen, wie das Benedictus, Elemente des Sonatensatzes. Allerdings nicht dessen Form oder eine durchgehende motivischthematische Arbeit, sondern die Prinzipien des Stils, zu denen die Heterogenität des Motivmaterials, die Diskontinuität, die Spannung, die Kontraste und die strukturelle Differenzierung gehören. Die Vielfältigkeit der musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten mit ihren Gegensätzen und alternierenden Bewegungen löst das lineare Denken ab. Dieser Stil wird nun von Beethoven nicht einfach mit dem Ziel angewandt, mittels musikalischer Mittel vordergründige Effekte zu erzielen, sondern er erweist sich als die ideale Basis für eine Umsetzung des Ordinariums, die auf der individuellen Hervorhebung und Vertonung der einzelnen Textworte beruht. Die Komposition und die Anordnung der Motive erfolgen dabei nicht aufgrund immanent musikalischer Ideen, sondern die musikalische Komponente verliert im Gegenteil ihren Selbstzweck und ihre Autonomie. Es sind vielmehr der Text und der Wunsch nach der direkten Vergegenwärtigung seiner sprachlichen und verbalen Qualitäten, der die musikalische Ausformung beeinflusst und bestimmt. Das Strukturgefühl des Instrumentalstils ermöglicht eine stärkere Durchdringung und plastischere Darstellung des Ordinariumstextes, in dem sich ebenso unterschiedliche Aussagen in aufzählender Art aneinanderreihen, wie im musikalischen Satz unterschiedliche Motive gegeneinander stehen. So findet sich in Beethovens C-Dur-Messe ein sehr ausgeprägtes Wort-Ton-Verhältnis, indem nämlich jede textliche Aussage musikalisch einem neuen charakteristischen Motiv zugeordnet wird. Die 18 Entwicklung alternierender Bewegungen, wechselnder Impulse und gegensätzlicher Motive bildet keine musikalisch logische Form, sondern widerspiegelt die prosaische Vorlage plastisch und sprachnah in ihrer Struktur, in der Wiedergabe der Verhältnisse ihrer Elemente und Aussagen zueinander, in ihrer Syntax und formalen Ungebundenheit. Die Musik nähert sich also der Gestalt des Textes an, nimmt teilweise auch sehr deklamatorische, sprachnah rezitierende Züge an, verschmilzt mit den Worten zu einer Einheit und wird gewissermassen selbst gesprochene Sprache. Genauso, wie Theatermusik auf Handlung und Gestik reagiert, folgt so die Musik der Messe immer dem Ordinariumstext. Die heterogene Motivik ist verknüpft und wird verstärkt durch den Einsatz verschiedener Satztechniken, die zur kontrastreichen und plastischen Vertonung des Textes beitragen. Dazu gehören homorhythmische, akkordische Blöcke, polyphone Abschnitte, Unisono-Stellen, Abschnitte, in denen der Chor in einen rauschenden Orchestersatz eingebaut ist, der häufige Einsatz von sprachhafter Deklamation bis hin zur Rezitation auf einem Ton, starke dynamische Kontraste, wechselnde Klangfarben, überraschende, unregelmässige harmonische Wechsel und abrupte Ausweichungen und ein ungleichmässiger Periodenbau. Hinzu kommen Akzente in Form von Sforzati, Synkopen oder besonderen motivischen Ausprägungen, wie zum Beispiel Oktavsprünge. Nicht alle angeführten Mittel und Ebenen der Textbehandlung, die natürlich auch, als eine Form der Steigerung, miteinander kombiniert auftreten können, wirken per se dramatisch. Durch die zahlreichen Wechsel, Kontraste und Härten auf relativ engem Raum wird jedoch ein durchgehender, homogener musikalischer Fluss immer wieder unterbrochen und verunmöglicht. Diese Art der Vertonung lässt ein heterogenes Gebilde aus einer Vielzahl von verschiedenen gegensätzlichen Verläufen und Ereignissen entstehen, die sich scheinbar regellos aneinanderreihen. Wichtig ist, dass die Instrumentalstimmen in diese Verfahrensweise einbezogen werden und mit dem Chor in Wechselwirkung stehen, wodurch die Gestaltung der Vokalstimmen erst hervortritt. Das Orchester hat nicht, wie bei Haydn, eine einheitsstiftende Funktion. Haydns Werke weisen durchaus Elemente einer kontrastierenden Vertonung auf, aber diese sind bei weitem nicht so konsequent durchgehalten, sondern im Gegenteil eher verschleiert und häufig auch textunabhängig. Beethoven begnügt sich dagegen nicht nur mit einem sporadischen und massvollen Einsatz der beschriebenen Mittel, um sie dann sogleich wieder abzuschwächen und durch um so strenger gehaltene Abschnitte auszugleichen. Aus einer Dramatisierung der Form , wie sie in der C-Dur-Messe vorliegt, erwächst nun die Gefahr, dass durch die starke Zergliederung der innere Zusammenhalt verloren geht. Dieser ist natürlich vor allem durch den Text gewährleistet. Des Weiteren hat schon Thayer bemerkt, dass in Beethovens Messe das Intervall einer Sexte ziemlich oft über die ganze Messe verteilt aufscheint 38. Es wäre aber übertrieben, diese Sexte als das dem ganzen Werk zugrundeliegende Hauptmotiv zu sehen, wie Thayer es tut. Man könnte sie höchstens als einen Gestus bezeichnen, der allen Sätzen gemeinsam ist und zwischen ihnen eine gewisse Verwandtschaft herstellt, denn eine motivischthematische Entwicklung geht davon nicht aus. Daneben gibt es auch andere Motive in den verschiedenen Sätzen, die sich kausal aufeinander beziehen, wie zum Beispiel das Kyriemotiv, das Gloria-Hauptmotiv, die Fortspinnung des “quoniam”-Motivs, das “cum Sancto”- und das “dona”Motiv. Einen engeren Zusammenhalt bewirken ausserdem die Beschaffenheit der zahlreichen motivischen Figuren und ähnliche Arten der Kontrastbildung an unterschiedlichen Stellen. Die Motivfiguren sind zwar an bestimmte Textworte und deren Sprachrhythmus gebunden und unterscheiden sich dadurch voneinander. Sie sind jedoch oft kaum mehr als melodisch amorphe Elemente des musikalischen Grundmaterials, wie Intervallsprünge, Dreiklänge und Skalenabschnitte, und sich deshalb relativ ähnlich. Im Gloria und im Credo ist die persönliche Andacht ebenso wichtig wie in Kyrie und Benedictus. Die strukturelle Zergliederung und Dramatisierung des Messetextes tragen jedoch nicht 38 Thayer, Band 3, S. 45 ff. Im Kyriethema durchlaufen die Oberstimmen dass Intervall einer Sexte. Das “Christe” steigt in T. 38 zur Sexten der Tonart auf und fällt dann wieder. Das Gloriamotiv erhebt sich in T. 9 auch bis zur Sexten. Das “qui tollis” erreicht in seiner zweiten Phrase in T. 146 ebenfalls dieses Intervall. Ebenso findet es sich im “cum Sancto Spiritu” (erstmals in T. 239) und an vielen anderen Stellen in allen Sätzen der Messe. 19 direkt zur Erweckung von Andacht bei, wie dies durch die emotionale Gefühlsvermittlung in den anderen beiden Sätzen geschieht. Nur an einzelnen Stellen entspricht die Dramatik auch gewissen hinter dem Text stehenden Emotionen, wie beispielsweise dem “adoramus” (Gloria T. 48 ff.) oder den verschiedenen “miserere” Rufen im Gloria und im Agnus Dei (am stärksten gefühlsmässig aufgeladen im Agnus Dei T. 77 ff.) Die eigenständige musikalische Vertonung der einzelnen Aussagen, die Übertragung des Sprachcharakters auf die Ebene der Musik und das Bemühen um die strukturelle Verschmelzung von Text und Musik zu einer Einheit belegen zwar eine intensive persönliche Beschäftigung des Komponisten mit der Vorlage und sein Bestreben, diese “würdig” umzusetzen. Ein subjektives Glaubenserlebnis ist dem Hörer allerdings nicht durch die direkte Wirkung der Musik, sondern erst nach eigener Auseinandersetzung mit dem auf diese Weise plastisch gestalteten Text möglich. Um so erstaunlicher ist es, dass E. T. A. Hoffmann, der in seiner Rezension von der Kategorie der Andachtserweckung auszugehen scheint, sich nicht negativ über Beethovens Verfahrensweise in diesen Messteilen äussert. 39 5.5. Gloria und Credo Schon im Übergang des langsamen und innigen Kyrieschlusses zum schnellen und dramatischen Gloriabeginn, der nun im Fortissimo stehend alle zur Verfügung stehenden klanglichen Mittel aufwendet, liegt ein starker Kontrast, anders als in den meisten Zeitgenössischen Werken, in denen ja bereits im Kyrie ein festlicher und majestätischer Charakter vorherrscht. Die ersten zwei Gloriatakte mit ihrem akkordischen “Gloria”-Ruf und den begleitenden Achtelketten unterscheiden sich nicht von traditionellen Mustern. Der Satzfluss wird aber danach durch eine fast zweitaktige Generalpause jäh unterbrochen. In T. 5 wiederholen sich die beiden ersten Takte auf der vierten Stufe, worauf auf die unbetonte Taxtzeit in den Frauenstimmen sogleich das Hauptmotiv des Satzes einsetzt, dessen Charakter sich vom Vorangehenden völlig unterscheidet, nur von den Violinen colla parte begleitet wird und dem Satz einen ganz neuen Impuls verleiht. Am nächsten kommt diesem Anfang von den sechs letzten Haydn-Messen die “Theresienmesse”. Auch hier pausiert der Chor nach dem ersten “Gloria” während eines Taktes und führt das zweite anders weiter. Dies geschieht aber ohne jeglichen Bruch und Charakterwechsel. Ausserdem wird der Chor von einer durchgehenden und vereinheitlichenden Orchestermotivik getragen. In T. 10 von Beethovens Op. 86 nimmt der Chorbass das Hauptmotiv auf. Die drei oberen Stimmen kommen akkordisch hinzu, ebenso das volle Orchester. T. 13 bringt wieder homorhythmische “Gloria”-Deklamationen mit rhythmischen Verkürzungen des Motivs. Diese führen zum Höhepunkt in den Takten 15 und 16, welche charakterlich dem Anfang entsprechen. Wieder wird der Fluss gestoppt durch den Eintritt des subito piano in T. 17 und die nur von den ersten Geigen und den Celli vorgetragenen, gewissermassen vom Himmel zur Erde hinabsteigenden Figuren, die zum “et in terra pax” überleiten. Diese Stelle kontrastiert auch in den Messen Haydns mit dem Vorangehenden und zeichnet sich durch eine Zurücknahme der Dynamik, eine Reduktion des Orchestersatzes und oft auch einen Tonartenwechsel aus. Beethoven reduziert die Beteiligung des Orchesters auf ein Minimum und setzt den Chor sprachnah deklamierend ein. Das folgende “bonae voluntatis” ist zwar auch noch homorhythmisch gesetzt melodisch aber viel bewegter und wieder mit etwas grösserer Orchesterbeteiligung. In T. 28 ändert sich das Satzbild erneut, indem die von Instrumenten verdoppelten Chorstimmen dieselben Worte nun in einer kurzen Imitation forte vortragen. Der nächste Einschnitt findet sich bereits in T. 37. Wieder im Piano und akkordisch gesetzt wiederholt der Chor, jetzt a capella und plastisch klar aus dem Satzzusammenhang gelöst, die Worte noch einmal. Daraufhin bricht das volle Orchester im Forte herein und steht im kontrastierenden Wechsel zu den aus dem musikalischen Fluss heraustretenden a-capellaAkklamationen des Chors “laudamus te” und “benedicimus te”. An dieser Stelle erfolgt der erste motivische Rückgriff auf das Hauptmotiv, allerdings nicht im Chor sondern im Orchester. Ausserdem stehen diese Akklamationen dem anfänglichen “gloria” inhaltlich nahe, so dass man 39 Kunze, S. 252 ff. 20 nicht von einem willkürlichen oder nur musikalisch-formal bedingten Einsatz des Motivs sprechen kann. In Haydns “Theresienmesse” greift das Orchester ebenfalls wieder das Anfangsmotiv auf, jedoch nicht als Kontrast, sondern ganz im Gegenteil, zur Beibehaltung eines einheitlichen Flusses. Beethovens Umsetzung nahe steht hingegen Haydns Version in der “Paukenmesse”, wo sich ebenfalls Orchester und a-capella-Chor abwechseln. Nach dem Forte-“benedicimus” folgt in der C-Dur-Messe, wiederum aus dem Satzzusammenhang gerissen, als abrupter Kontrast das schon erwähnte “adoramus te” im Piano, in bedeutend tieferer Lage und auf einem B-Dur-Klang. Ein Wiener Kritiker schrieb dazu: “Das demüthige Adoramus te nach dem rauschenden Benedicimus te und dem jubelvollen Laudamus te ging wie ein elektrischer Schlag unter die Betenden; sie alle fühlten, welche Anbethung in Demuth dem höchsten Wesen gebühre. 40” Dies zeigt, dass auch in einem zergliederten und dramatischen Umfeld die Vertonung gewisser Worte dem Inhalt entsprechende Gefühle hervorrufen kann. Das anschliessende “glorificamus”, das zunächst im Orchester, dann auch im Chor das Hauptmotiv sequenzierend wieder aufnimmt und fortspinnt, entspricht schliesslich doch eher wieder einer traditionellen Umsetzung des “Gloria”-Jubels. Wie gesehen folgen sich also auf engem Raum zahlreiche Brüche und neuansetzende Motive, die einen einheitlichen Grundimpuls immer wieder stören und verunmöglichen. Nicht nur, dass ein neuer Text auch eine neue Motivik und Satzgestaltung mit sich bringt, auch auf den gleichen Text, wie beim “bonae voluntatis”, können Impulswechsel stattfinden. Gerade diese Uneinheitlichkeit mag unter anderem Fürst Nikolaus II missfallen haben. Ausserdem droht eine solchermassen zergliederte Komposition bei einer mangelhaften Einstudierung und Aufführung, wovon im Falle des Op. 86 ausgegangen werden kann, um so stärker auseinanderzufallen. Es lassen sich auch Parallelen zu Beethovens Orchesterwerken erkennen. Die ersten drei Symphonien riefen verschiedenen Rezensionen zufolge bei den Hörern vor allem Befremden hervor. Man warf den Werken das Fehlen von Übersichtlichkeit und Mass vor. Sie hätten keine innere Struktur, seien regellos, ungeordnet und überladen, enthielten zu starke klangliche Reize und seien deshalb im Ganzen unverständlich 41. Wenn schon der weltlichen Gattung der Symphonie eine solche Kritik zuteil wurde, wie sollte denn auf eine solche Vertonung in der Kirchenmusik, die sich allen Neuerungen gegenüber konservativ verhielt, anders als mit Ablehnung reagiert worden sein? Die ersten Geigen leiten in T. 71 des Gloria von Beethovens C-Dur-Messe mit einer Figur, die etwas an jene in T. 17 erinnert, über zum “Gratias agimus”-Teil. Dieser ist formal sehr übersichtlich gestaltet. Das “Gratias agimus tibi...” und die drei “Domine Deus”- bzw. “Domine Fili”-Anrufungen bilden jeweils eine Einheit, in welcher der Solotenor als Vorsänger eingesetzt ist und der Chor, dieselbe Motivik aufgreifend, antwortet. Das Orchester begleitet die Gesangsstimmen mit fast durchgehenden, aber in einem durchbrochenen Satz vorliegenden Legato-Vierteln. Die musikalischen Einheiten entsprechen verbalen syntaktischen Gliedern und widerspiegeln dadurch den Satzbau, wobei die Kadenzen die Interpunktion vertreten. Neben den gleichbleibenden Orchestervierteln und dem Dialog zwischen Solotenor und Chor verdeutlicht auch die identische Rhythmisierung von “Domine Deus” und “Domine Fili” den Parallelismus zwischen den drei Anrufungen, während die unterschiedlich ausgeformte Melodik und der Wechsel der Harmonie auf die geänderten Inhalte hinweisen. Wiederum leiten gebundene Viertelnoten die Fortsetzung ein. Der Tradition folgend wechseln zu Beginn des “qui tollis” Tempo, Metrum und Tonart, doch fällt dies nach den früheren kontrastreichen Passagen nicht mehr aussergewöhnlich ins Gewicht. Die pochenden Viertel der Instrumentalbässe und die Synkopen der drei oberen Streicherstimmen verbreiten zu Beginn des Abschnitts eine aufgewühlte Stimmung. Darüber legt sich die kantable Melodie der Altstimme bis in T. 147 der Chor zuerst piano dann forte dazu kontrastierend die eindringlichen Worte “miserere nobis” deklamiert. Der Einschnitt ist hier allerdings noch nicht so stark wie später in diesem Satz 40 Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode Nr. 153 vom 23. Dezember 1819, S. 1265 f., zitiert nach Friesenhagen, S. 139 41 Schmitt, Ulrich: Revolution im Konzertsaal. Zur Beethoven-Rezeption im 19. Jahrhundert, Mainz, 1990, S. 22 ff., nach Friesenhagen, S. 237 21 und im Agnus Dei, doch scheint die dem Sprachgestus nachempfundene Umsetzung die gewünschte Wirkung erzielt zu haben. In der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode war am 23. Dezember 1819 zu lesen: “Das auffallende Miserere, Miserere ergriff um so mehr, da nicht leicht Einem die verwandten Töne unbekannt geblieben sind. 42” Ein Vorbild für diese Art der Vertonung fand Beethoven an der entsprechenden Stelle in Haydns “Nelsonmesse”. Dort fehlt aber die recht wirkungsvolle seufzerähnliche Dissonanz (T. 148 und 150). Die nun folgende Entwicklung des “qui tollis”-Motivs wird zunächst von den ab T. 160 einsetzenden “suscipe”-Seufzern abgelöst und schliesslich vom in T. 163 ff. plötzlich a capella rezitierenden Solistenquartett vollends unterbrochen. Nach einer variierten Wiederholung der Takte 160 ff. ändert sich der Charakter des Satzes in T. 176 von neuem. Der Chor erhebt sich mit einer majestätischen Dreiklangsmotivik im Unisono und wird von den Streichern concitato-artig begleitet. Der Höhepunkt ist in T. 179 mit dem Fortissimo und der Beteiligung aller Stimmen, ausser den Gesangssolisten, erreicht. Der markante Oktavsprung im Chor unterstützt von der eine Oktave durchlaufenden Zweiunddreissigstelfigur der Streicher und Bässe kann sicherlich als figural-rhetorische Darstellung des allumfassenden, allmächtigen und auch richtenden Gottes gesehen werden. Doch ist die Stelle auch ohne ToposVerständnis von überwältigender Wirkung, zumal sich daran sogleich im subito piano die dissonierenden “miserere”-Seufzer von T. 147 anschliessen. Diese werden hier abwechselnd vom Chor und von den Bläserstimmen vorgetragen. Die Ausdrucksintensität nimmt nun wieder etwas ab und anstelle der sprachhaften Deklamation tritt mit einem Anklang an das Kyrie-Thema in T. 188 eine melodischere Ausformung. Nach einer zunehmenden harmonischen Verdichtung ab T. 197 ertönen nun im Piano, zunächst nur noch von pochenden Streicher- und Bassvierteln begleitet, nochmals sprachhafte, ehrfurchtsvolle “miserere”-Bitten, gleichsam in einem Gebetstonfall, der die Bitte um Erbarmen nicht nur strukturell, sondern auch direkt emotional vermittelt. Die Überleitung zum “quoniam tu solus” erfolgt erneut durch Viertelfiguren, diesmal in den Holzbläsern. Dieser dritte Satzteil des Gloria ist durch seine Anlage und die inneren motivischen Verbindungen von bedeutend grösserer Kohärenz geprägt als die vorangehenden und nähert sich dadurch der Tradition stark an. Das Orchester nimmt während zehn Takten das “quoniam”-Thema des Chores vorweg, der es dann umfangreicher ausgestaltet aufgreift. Das Motiv in T. 229 spielt deutlich auf das Gloria-Hauptmotiv aus T. 8 an, womit ein struktureller Bezug zum ersten Satzteil gegeben ist. Die Einbindung des Chores in den Orchestersatz geschieht hier eher traditionell. In T. 238 beginnt das “cum Sancto Spiritu”, das nun eine Fuge einzuleiten scheint. Thematisch ist es klar mit dem “quoniam” verknüpft, ist doch das Motiv in T. 240 mit jenem in T. 230 identisch. Diese Motividentität lässt sich jedoch nicht nur musikalisch, sondern auch durch die sich nahestehenden Textinhalte rechtfertigen. Wer sich aber auf eine rauschende Schlussfuge gefreut hatte, wird bereits fünf Takte nach dem letzten Themeneinsatz im Sopran enttäuscht. In T. 254 setzt nämlich der Chorbass wieder mit dem “quoniam”-Thema ein und unterbricht die Entwicklung. Die folgenden Figuren zu “tu solus” sind Umkehrungen des “cum Sancto”-Dreiklangs, während gleichzeitig mehrmals der Anfang des “quoniam”-Themas im Orchester stufenversetzt und immer in einer anderen Stimme wiederholt wird und in den mittleren Chorstimmen in T. 270 ebenfalls wieder erklingt. T. 280 bringt darauf wieder das fugierte “cum Sancto Spiritu”. Das polyphone Gefüge reicht bis T. 314, wo der Chor plötzlich dazu kontrastierend in akkordischen halben Noten und in einer harmonischen Verdichtung von Pausen durchsetzte “amen” deklamiert. Nach Erreichen des Höhepunkts im Fortissimo, wechselt der Charakter des Satzes erneut. Die Frauen- und Männerstimmen tragen jeweils paarweise gekoppelt abwechselnd das variierte “quoniam” im Piano vor, bevor sie sich ab T. 330 wieder in homorhythmischer Deklamation zum Fortissimo steigern und in T. 332 gar überraschend vom Orchester unbegleitet auftreten. Die Aufnahme des “cum Sancto”-Themas, das den Rest des Satzes bestimmt, erfolgt in T. 335 wiederum in Stimmenpaaren. In T. 343 greift der Solosopran dasselbe Thema zum Wort “amen” auf und in Takt 350 singt der Chor auf die ersten drei, nun um das vierfache gedehnten, Töne des Themas denselben Text. Bemerkenswert ist hier der Kontrast zwischen dem ersten, im Piano vorgetragenen und nur von den den Chorbass stützenden Fagotten und Celli begleiteten “amen” und dem zweiten, das im Forte 42 Zitiert nach Friesenhagen, S. 139 22 steht und sämtliche Instrumente beschäftigt. Schon zwei Takte später findet sich erneut eine gegenteilige Lautstärke und der Chor ist während dreier Takte a capella gesetzt. In der Folge werden die Takte 342 bis 356 in variierter und etwas erweiterter Form wiederholt und der Gloria-Satz dadurch abgeschlossen. Bei Haydn ist das “quoniam tu solus” und besonders das “cum Sancto Spiritu” jeweils relativ kurz gehalten und, bis auf einige Takte in der Theresienmesse, durchwegs homorhythmisch gestaltet. Eine ausführlichere, polyphone, oft (ausser in der “Pauken-” und “Theresienmesse”) fugische Vertonung bleibt den Worten “in gloria Dei Patris” und “amen” vorbehalten. Obwohl nun Beethoven den gesamten Text des dritten Gloria-Teilsatzes in die Schlussbildung mit einbezieht, und obwohl sich dieser Abschnitt besonders durch eine grosse motivische Kohärenz auszeichnet und zahlreiche Rückgriffe und Kombinationen aufweist, entsteht darin kein einheitlicher Charakter. Die beiden dominierenden Themen sind zwar miteinander verwandt, aber doch klar ihren jeweiligen unterschiedlichen Textworten zugeordnet. Ausserdem führen die zahlreichen dynamischen, satztechnischen, harmonischen und klanglichen Kontraste und Wechsel eine gewisse Kleinteiligkeit herbei, die einen geschlossenen musikalischen Fluss verunmöglicht und dadurch auch den Zuhörer nicht zur Ruhe kommen lässt. Wie dass Gloria so ist das Credo aufgrund seines bekenntnishaften und prosaischen Charakters nicht für eine direkt emotionalisierende Vertonung geeignet, weshalb Beethoven zur Textvermittlung auch hier das Mittel der inneren Differenzierung und strukturellen Dramatisierung anwendet. Der Beginn des Credo-Satzes erinnert an die Praxis der Orchestermessen des 18. Jahrhunderts. Die Chorblöcke besitzen lediglich harmonische Funktion und sind ins instrumentale Geflecht eingebunden. Die Fagotte und Celli eröffnen das Credo im Piano mit einem DreiklangsAchtelmotiv, das im Verlaufe des ersten Teilsatzes als Begleitfigur immer wieder aufgenommen wird und vereinheitlichend wirkt. In T. 3 setzt der Chor mit einem Unisono-“Credo” ein. In T. 4 übernehmen die Violinen das Begleitmotiv im Pianissimo. Danach folgen drei weitere akkordische Choreinwürfe. Durch die Verkürzung der Pausen zwischen den Rufen, die rhythmische Diminution, die Beschleunigung der harmonischen Wechsel und das Crescendo vom Piano zum Forte erhält dieser Beginn einen sehr dynamischen Charakter und entwickelt sich auf ein Ziel hin, das in T. 9 erreicht wird. An diese spannungsvollen Anfangstakte schliesst sich ein eher statischer Abschnitt an. Den majestätischen, scharf punktierten Fanfaren der Bläser und der Pauke im Fortissimo antwortet der in den Orchestersatz eingebundene Chor mit den Worten “in unum Dominum” und “patrem omnipotentem”. Nach einem imitatorischen Motiv zu “factorem coeli et terrae” folgt zu instrumentalen Sforzati auf unbetonte Taktzeit das “visibilium omnium”, welches ab T. 26 homorhythmisch deklamiert vorgetragen wird. Durch eine kurze Generalpause abgetrennt singen die Chorstimmen darauf, in völligem Kontrast zum Vorangehenden, im Piano, unisono und nur von den gezupften Streichern verdoppelt “et invisibilium”. Das Bekenntnis zur zweiten göttlichen Person ist ab T. 31 wieder mit dem Achtelmotiv des Beginns verknüpft, wodurch die Einheit zwischen Gottvater, und -sohn auch musikalisch umgesetzt erscheint. Nicht nur die göttliche Einheit wird aber so dargestellt, sondern auch der Beginn einer neuen textlichen Einheit. Danach beginnt, immer noch in derselben Satzstruktur eine Modulation, die über a-Moll (T. 44) nach Es-Dur (T. 54) moduliert. In T. 49 folgen sich einige imitierende, majestätisch punktierte “ante omnia”-Rufe, die in T. 51 in ein Unisono des Chors münden, wobei das in T. 52 reduzierte Orchester nur noch colla parte begleitet. Drei markante ganztaktige Akkorde der Streicher und Fagotte kündigen im Piano den nächsten kontrastierenden Abschnitt an. Von den fp-Akzenten des Orchesters gestützt, singen die Chorstimmen in jeweils zweitaktiger, auch als abbildhafte Rhetorik deutbarer, Imitation “Deum de Deo” und “lumen de lumine”, bevor sie in T. 65 erneut im Unisono und von den fortissimo spielenden Streichern verdoppelt in Okavsprüngen “Deum verum” deklamieren. In schnellem Wechsel folgen sich darauf Orchestereinwürfe auf den unbetonten dritten Taktschlag und unbegleitete akkordische “genitum”-Rufe, an die sich in T. 71, in einer nochmaligen Zurücknahme der Satztechnischen Mittel, das durch eine Generalpause abgetrennte, a capella und unisono vorgetragene “non factum” reiht. Das anschliessende 23 neuansetzende “consubstantialem patri” beginnt imitatorisch, entwickelt sich aber rasch zu einem pausendurchsetzten akkordischen Satz und wird vom Orchester mit dem bekannten Achtelmotiv begleitet. Dessen Anwendung ergibt sich hier ebenfalls aus der Verknüpfung mit der göttlichen Person und aus dem Text, in dem auch der Relativsatz “per quem omnia...” direkt zu “patri” (T. 74) in Bezug steht. Den Höhepunkt dieses Abschnitts bilden die dem “Deum verum” ähnlichen Unisono-Oktavsprünge des “omnia” mit abschliessendem Dreiklangs-Abstieg. Das begleitende Achtelmotiv wirkt zwar, wie verschiedene Begleitfiguren bei Haydn auch, eher vereinheitlichend. Bei Beethoven bleibt der musikalische Fluss allerdings nicht über weite Strecken bestehen, sondern er wird durch die beschriebenen markanten Einschnitte unterbrochen. Das nun folgende “qui propter” bezieht sich nicht nur textlich durch den Relativsatz, sondern auch musikalisch durch die Rückkehr nach C-Dur auf “et in unum Dominum” (T. 33). Die ersten paar Takte besitzen mit ihrer im Piano vorgetragenen, kantablen Melodik einen gänzlich entgegengesetzten Charakter als das unmittelbar Davorstehende, um dann allerdings in T. 102 bereits wieder zum Fortissimo und einer auf Intervallsprünge beschränkten Motivik zurückzukehren. Zum vollen Orchester deklamieren die Männer- und Frauenstimmen jeweils paarweise gekoppelt abwechselnd und mit zunehmendem Ambitus “descendit” und finden dann bei “de coelis” wieder zu homorhythmischer Akkordik. Der Abschnitt von “qui propter” bis “de coelis” wird in Moll und etwas variiert wiederholt und moduliert nach B-Dur, der Dominante vom Es-Dur des mittleren Satzteils. Fast rhapsodisch im Charakter und an die verschiedenen Überleitungsfiguren im Gloria erinnernd, führt die Klarinette den Adagio-Teilsatz ein. Mit ihrem absteigenden Motiv verbindet sich, wie bereits mit der Moll-Wendung des “qui propter” und der Wahl einer dunkleren Tonart für das Adagio, das Bild der Erniedrigung Christi durch dessen Menschwerdung. Wie in allen HaydnMessen ist auch in Beethovens Komposition der Beginn dieses Mittelteils den Solisten vorbehalten. Begleitet wird das Solistenquartett von den gezupften Streichern. In den Takten 141 und 143 finden sich in der Klarinette und im Fagott bzw. in den Streichern bereits Chiasma-Motive als figurale Abbilder des Kreuzes. Der ruhige Charakter des Satzes verändert sich aber vorerst auch während des “et homo factus est” des Solotenors nicht. In T. 147 aber fällt der Chorbass dem Solisten gleichsam ins Wort. Das “crucifixus”, nun im Forte stehend, erhält durch die Concitato-Figuren der oberen Streicherstimmen, die Synkopen der Flöten und Oboen und durch zahlreichen Sforzati einen dramatischen Charakter. Die übrigen Chorstimmen nehmen die rhythmische Form des vom Bass vorgegebenen “crucifixus”-Motivs auf, variieren aber dessen melodische Komponente. Das folgende, fast sprachhaft deklamierte “sub Pontio Pilato” geht zwar aus diesem Motiv hervor, steht ihm aber durch die gegenteilige Dynamik, die chromatische, dem passus duriusculus ähnliche Linienführung, den Unisono-Satz und die colla-parte-Begleitung kontrastierend entgegen. In T. 155 findet sich bereits der nächste Einschnitt. In der Klarinette und im Fagott erklingt wieder ein Chiasma-Motiv, in dem sich mit je einer verminderten Quinte, Septime und Quarte gleich mehrere saltus duriusculi folgen, und das jeweils den letzten sonst unbetonten Achtel des Takts akzentuiert. Die Verwendung des Chiasma im Zusammenhang mit der Kreuzigung ist für die Kirchenmusik der Klassik völlig untypisch und lässt den Schluss zu, dass sich Beethoven nicht erst im Hinblick auf seine zweite Messe eingehend mit älterer Kirchenmusik, beispielsweise Bach, auseinandergesetzt hat. Zu diesem Motiv spielen die Streicher die unbetonten Taktachtel, wovon der erste jeweils piano, der zweite forte gesetzt ist. In dieses spannungsvolle Umfeld setzen nun auch die Solisten ein, mit ihren versetzten, teilweise synkopischen, im Piano gehaltenen Ausrufgesten zu “passus”. Spannungsverstärkend wirken auch die chromatischen Vorhalte in verschiedenen Stimmen. Zu den Worten “et sepultus est” scheint sich der Satz zu beruhigen, bevor in T. 164 plötzlich wieder das Forte hereinbricht und der Ausdruck und die Dramatik stark zunimmt, durch das Tremolo der zweiten Geigen, die Akkordbrechungen in den ersten Violinen und Bratschen, das Nebeneinanderstellen tonartlich entfernter, unaufgelöster verminderter Septakkorde und die erneuten, aus einem verminderten Septimensprung bestehenden Exklamationsmotive der Solisten, die zudem im Dialog mit dem akkordischen Chor stehen. Nach Erreichen des Fortissimo in T. 168 folgt eine Variante der Takte 155 und 156 mit dem Chiasma-Motiv. Daran schliesst sich als völliger 24 Gegensatz im Piano, zum Pianissimo hin abnehmend, das harmonisch stabile und diatonisch kadenzierende “et sepultus est” an. Die strukturelle Dramatisierung des Textes, die hier auch mit einer emotionalen einhergeht, zeigt, dass Beethoven die Textvorlage in jedem ihrer einzelnen Bestandteile ernstgenommen hat. Die inhaltlich differenzierten verbalen Glieder und die aufzählende Form des Textes finden in einer solchen kleinteiligen musikalischen Umsetzung ihre Entsprechung. Als äusserstes Gegenbeispiel lässt sich der schon erwähnte Mittelabschnitt des Credo aus Haydns “Harmoniemesse” anführen, in dem durch eine durchgehende Triolenbegleitung zugunsten eines starken Zusammenhalts jegliche strukturelle Dramatik vermieden wird. Aber auch in der “Nelsonmesse”, die bezüglich einer derartigen Vertiefung in den Text am weitesten geht, sind die Einschnitte bei weitem nicht so stark, so zahlreich und von einer so grossen Vielzahl kontrastierender Mittel geprägt wie In Beethovens Werk. Hier wird kein Zustand und kein statischer Affekt wiedergegeben, sondern eine inhaltliche Entwicklung, eine Dramatisierung durch innere Differenzierung. Es findet keine Gestaltung auf rein musikalischer Ebene statt, durch Ausbildung und Wiederholung fasslicher Motive. Motivrückgriffe sind immer Textbedingt. Doch die Wiederholung von Textworten ist nicht einfach mit dem Aufgreifen eines unveränderten musikalischen Motivs verbunden. Im Falle von “passus” und “et sepultus est” knüpft Beethoven in der Wiederaufnahme des Textes zwar an den jeweiligen Charakter, die Stimmung und die Motivik der beiden Aussagen an, jedoch in einer entwickelnden Art, die den Ausdruck und den Kontrast gesteigert wiedergibt. Von drei auftaktigen Achteln der Streicher eingeleitet, beginnt in T. 183 der dritte Teilsatz des Credo, Allegro ma non troppo, im -Takt, und in C-Dur. Es sei hier allerdings nochmals gesagt, dass die traditionelle Unterteilung des Satzes in drei Abschnitte aufgrund der durchgehenden starken Zergliederung nicht mehr dasselbe Gewicht hat wie noch bei Haydn. Der Solobass setzt auf der Doppeldominante der Tonart von den Streichern colla parte begleitet ein, mit einer Motivik, die durch ihren rezitativartigen Gestus den Charakter einer Verkündigung annimmt. Der Chor nimmt das Thema auf und steigert sich vom vollen Orchester begleitet in den Takten 195 ff. zu majestätischer Dreiklangsbrechung im Unisono. In T. 102 beginnt wieder ein kurzer, in eine Triolenbegleitung des Orchesters eingebetteter imitatorischer Abschnitt. Nachdem der Chor in T. 208 erneut zu akkordischem Gesang zurückgefunden hat, folgen einige Takte, die in ihrer Ausgestaltung dem “laudamus te” und “benedicimus te” im Gloria (T. 41 ff.) ähnlich sind. Die Fanfarenmotive der Blechbläser und der Pauke in den Takten 209 und 211 kündigen das hohe göttliche Gericht an und stehen im Wechsel mit dem unisono, a capella und sprachnah deklamierenden Chor in den Takten 210 und 212. In den folgenden Takten hebt ein Registerwechsel den Gegensatz zwischen “vivos” und “mortuos” hervor. Angesichts der Vertonung ähnlicher Gegensatzpaare, wie beispielsweise “visibilium” und “invisibilium” (T. 23 ff.), verwendet Beethoven hier allerdings schon fast bescheidene Mittel, zumal unter anderem die Dynamik und die durchlaufende Triolenbegleitung unverändert bleiben. Allgemein wirkt der dritte Credo-Teilsatz durch eine Zurücknahme der starken kontrastierenden Mittel über weite Strecken homogener als andere Abschnitte. Die nächste Chorimitation ab T. 216, immer noch von Triolen begleitet, gipfelt im Unisono der drei oberen Stimmen in T. 223 und dem abschliessenden Einklang aller Chorstimmen zu “non, non”. Ein Triller-Motiv in den Bässen und die durchbrochen weitergeführte Triolenbewegung führen zum solistisch vorgetragenen ”et in Spiritum Sanctum...”. Bemerkenswert ist die vom Fagott in T. 232 gespielte Figur, die hier fast leitmotiv-ähnlich auf das “cum Sancto Spiritu“ im Gloria (T. 240) anspielt. Von einem Trompeten- und Paukensignal eingeführt, verkündet der Chor in T. 247 ff. wiederum im Unisono und fast nur auf einem Ton rezitierend fortissimo “qui locutus est per prophetas”, noch immer in dieselbe Streicherbegleitung eingebunden und von Trompeten und Pauke skandierend gestützt. Die Takte 254 ff. entsprechen den Takten 226 ff. Wie schon im ersten Satzteil zu den Worten “Credo” und “in unum Dominum” (T. 31) widerspiegelt hier die motivische Wiederholung die Wiederholung der aufzählenden Textstruktur. Der unterschiedliche Sinngehalt des Textes wird dann durch die verschiedene musikalische Weiterführung verdeutlicht. Während diese in T. 230 ff. den Solisten vorbehalten war, so ist es jetzt der Chor, der plötzlich im Piano, fast unbegleitet und im Unisono in einer aufsteigenden Skala “et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam” vorträgt. Ausser in der “Pauken-“ und der 25 “Schöpfungsmesse“ ist dieser Text auch in Haydns Messen im chorischen Einklang gesetzt. In T. 268 findet sich der nächste, wieder etwas stärkere Einschnitt. Ähnlich wie in den Takten 41 ff. des Gloria und 209 ff. des Credo wechseln sich hier das volle Orchester und der unbegleitete Chor mit kurzen Forte-Einwürfen ab. Auf das dreitaktige imitierende “resurectionem” in T. 273 ff. folgt als Kontrast das in tiefer Lage im Piano gesungene “mortuorum”. Den Abschluss des Satzes bildet das “et vitam venturi saeculi, amen”. Wie im Gloria bleibt dem Zuhörer hier ebenfalls eine festliche Schlussfuge versagt. Noch vor dem letzten Themeneinsatz im Bass setzt der Sopran bereits wieder aus. Nachdem auch die Bassstimme den Themenkopf vorgetragen hat, sind zwei instrumentale Takte in kontrastierendem Piano eingeschoben, deren Motivik aus dem Fugenthema stammt. In T. 298 greifen die drei oberen Singstimmen das Thema in paralleler Stimmführung subito fortissimo wieder auf. Analog zu T. 296 folgen in T. 304 wieder instrumentale Zwischentakte im Piano, bevor das Fugenthema in der Stimme der Soloaltistin erscheint. Paarweise verbunden tragen die sich abwechselnden Männer- und Frauenstimmen des Chors zum Skalenmotiv aus der Fortsetzung des Themenkopfes (T. 284 ff.) das Wort “amen” vor, während die Orchesterbegleitung teilweise weiterhin von der Fugenmotivik bestimmt wird. Die Takte 318 ff. bringen eine Engführung des Themas im Forte, das sich zum Fortissimo steigert. Nach einer Fermate auf der Dominante in T. 332 nehmen die Gesangssolisten das Thema wieder auf, ebenso nach einem Unterbruch durch fortissimo skandierte “amen”-Rufe des Chors in T. 337 ff. In T. 343 beginnt dann die letzte Steigerung, die zum Abschluss des Credo im Fortissimo führt. Zur Schlussgestaltung in diesem Satz, ebenso wie im vorangehenden Gloria, ist zu sagen, dass hier, im Vergleich mit anderen Stellen, die musikalische Fassung gegenüber der Textübermittlung stärker an Bedeutung gewinnt und sich insofern einer traditionelleren Umsetzung nähert. Im Vergleich mit Haydn fehlt aber eine gewisse Grossflächigkeit und Nahtlosigkeit. 5.6. Sanctus und Agnus Dei Das Sanctus ist sowohl den gefühlsvermittelnden wie auch den strukturell dramatisierten Sätzen zuzurechnen. Anders als im Kyrie und im Benedictus ist es hier nicht die Erweckung von Andacht, die im Vordergrund steht, sondern eher ein Gefühl von Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Die Dynamik geht im ganzen Abschnitt nicht über das piano hinaus, nimmt im Gegenteil gegen Ende sogar zum dreifachen piano hin ab. Nach einer viertaktigen Orchestereinleitung nimmt der unbegleitete Chor dasselbe Motiv zunächst auf, um es dann deklamierend, gleichsam choralähnlich psalmodierend und enharmonisch wendend weiterzuführen. In Takt 10 setzt das Orchester wieder ein. In den Pauken und Bässen ertönt ein von auftaktigen ZweiunddreissigstelTriolen geprägtes Tremolomotiv, dessen bedrohliche Wirkung einzig durch die LegatoDreiklangsbrechungen der ersten Violinen etwas abgeschwächt wird. In Takt 13 bricht nun die düstere Stimmung vollends durch. Die Harmonie wechselt abrupt in die erniedrigte zweite Stufe, also nach B-Dur. Verstärkt wird der Bruch durch das subito piano, in der Pauke sogar pianissimo, nach vorangegangenem Crescendo. Der aus dem Triolenmotiv erwachsende Paukenwirbel wirkt äusserst fahl und angsteinflössend. Der den Text eindringlich deklamierende Chor wird nun nur noch von der Pauke begleitet, die den Sprachrhythmus skandiert und damit die Betonung der von den Stimmen “gesprochenen” Worte verstärkt. Der Chor schliesst mit einem phrygischen Schluss auf A-Dur, das sich in der Folge als Dominante des anschliessenden “pleni sunt coeli” herausstellt. Klarinetten, Fagotte und Hörner nehmen die Schlusswendung des Chores auf, während der Paukenwirbel im dreifachen Piano den Zuhörer noch einmal erschauern lässt. Die strukturelle Kurzgliedrigkeit, die starken Kontraste auf engem Raum, die sprachnahe Textdeklamation, die relative harmonische Instabilität, der sehr dünne Orchestersatz, die Zurücknahme der musikalischen Parameter und die düstere Stimmung erzeugen ein Gefühl der Atem-, Halt- und Hilflosigkeit. Die anfängliche Demut der ersten Sanctus-Rufe steigert sich zu höchster innerer Gefühlsintensität, zu erstarrender Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. Der Satz bildet somit einen klaren Gegensatz zum später folgenden, Erlösung verkündenden, sanften Benedictus. Er steht aber auch in völligem Widerspruch zur Tradition. Die Sanctus Sätze von Haydn besitzen alle einen feierlichen, 26 schreitenden teilweise fast majestätischen Charakter. Sie weisen eine homogene, undramatische Form und klare harmonische Verhältnisse auf. Durch die Zurücknahme der Dynamik an einigen Stellen und besonders am Ende (ausser in der “Harmoniemesse”) ist zwar bei Haydn ebenfalls eine demütige Haltung vorhanden, doch steigert sich diese nicht wie bei Beethoven dramatisch bis zur Erstarrung, sondern leitet den festlichen Jubel des “pleni sunt coeli” ein. Zudem ist in Haydns Sätzen die Beteiligung des Orchesters, dem in der Schöpfungsmesse sogar eine zehntaktige Einleitung übertragen wird, bedeutend grösser, und die Vokalstimmen sind gewissermassen in den Orchestersatz eingebettet. Im Gegensatz dazu steht in Beethovens Version, wie schon im Benedictus gesehen, die vokale Komponente, und mit ihr die Deklamation des Textes, klar im Vordergrund. Das Tremolomotiv kann zwar als Topos verstanden werden, als Zittern derer, die das Gericht erwarten, doch bedarf es zum Verständnis von Beethovens Sanctus des rationalen Überbaus der Figurenlehre wohl kaum. Beethoven muss sich der barocken rhetorischen Bedeutung des Tremolo nicht zwingend bewusst gewesen sein. Einzelne Elemente, die Beethoven in seinem Sanctus anwendet, sind im Agnus Dei von Haydns “Paukenmesse” und im Sanctus seiner “Schöpfungsmesse” zu finden. Das Sanctus von Hummels Es-Dur-Messe, Op. 80, weist ebenfalls gewisse Parallelen auf. In den genannten Sätzen von Haydn spielt die Pauke ein Motiv, das jenem Beethovens ähnlich sieht. Es fehlen aber die Steigerung zum erschauernden Wirbel und die den Text betonende Skandierung. Die Pauke erscheint ausserdem nicht so dominant und als einziges Begleitinstrument, sondern ist meist in den Orchestersatz eingebaut. Zwar tritt sie besonders in der “Paukenmesse” an einigen Stellen bedeutend hervor, ist dabei aber in einen grösseren, harmonisch ausgewogenen, Rahmen eingepasst, in dem insgesamt doch die melodisch kantabel ausgestalteten Vokalstimmen oder das motivischthematische Orchester vorherrschen. Es ist wohl kein Zufall, dass das Sanctus der “Schöpfungsmesse“ mit 35 Takten das bei weitem ausgedehnteste von Haydn ist. Bei Hummel ertönt nach den beiden ersten, noch vom Orchester gestützten Sanctus-Rufen jeweils ein Paukenwirbel. Danach trägt der Chor die restlichen Worte in einem lieblichen, stile-anticoähnlichen a-capella-Gesang vor, der, was die Stimmung angeht, eher Beethovens Benedictus gleicht. Auch hier herrschen stabile harmonische Verhältnisse vor. Beethoven übernimmt nun zwar die Elemente der Pauke und des a-capella-Satzes, verwendet sie aber, wie gesehen, viel zugespitzter und wirkungsvoller zur dramatischen Steigerung. Wie in Gloria und Credo liegt in diesem Sanctus eine dramatisierende Umsetzung des Textes vor. Die strukturelle Dramatik geht aber zusätzlich mit einer emotionalen einher, so dass der Satz, was die direkte Vermittlung von Gefühlen angeht, mit dem Kyrie und dem Benedictus verglichen werden kann. Auf das “pleni sunt coeli” und das “osanna”, das sich im Benedictus identisch wiederholt, wird hier nicht eingegangen, da die Abschnitte kaum von der überlieferten Tradition abweichen. Das lässt sich damit erklären, dass der durch den Text vorgegebene Jubelcharakter natürlich schon zur extrovertierten Festlichkeit eines Fürstenhofes sehr gut gepasst hatte und auch keiner Vertonung der Einzelworte bedurfte. Im Agnus Dei verbinden sich ebenfalls strukturelle und emotionale Dramatik. Im ersten Satzteil bis T. 35 werden dreimal die Worte “Agnus Dei...” gesungen, wobei Beethoven nach der ersten Anrufung das “miserere nobis” weglässt. Die Motivik ist in allen drei Abschnitten dieselbe, die einzelnen Worte sind denselben Figuren oder ihren Ableitungen zugeordnet. Die Sprachhaftigkeit steht gegenüber einer melodischen Ausformung stärker im Vordergrund als im anschliessenden “dona nobis pacem”. Die Anlage der drei Abschnitte ist trotz ihrer Parallelitäten alles andere als statisch. Die zahlreichen verminderten Akkorde, die sich ständig verändernde harmonische Grundlage, die sich entwickelnde melodische Gestalt, die schroffen Pausen, die Variierung der Phrasenlänge, der Rhythmik und der Motivelemente rufen eine grosse Spannung hervor, deren Ziel das erlösende, ruhigere und stabilere “dona nobis pacem” ist. Der Charakter des Teils entspricht dem eines fast verzweifelnden, eindringlichen, drängenden Hilferufs und einer Bitte um Erlösung. Die Tonart c-Moll etabliert sich an keiner Stelle des Satzteils als Zieltonart, sie ist nur Ausgangspunkt eines harmonischen Ganges, der bis zum Erreichen des C-Dur zu Beginn des zweiten Satzteils reicht. Lediglich in den ersten drei Takten breitet sich die Tonika als Klangfläche 27 aus. In taktweisem Aufbau erklingt in drängenden Achteltriolen zuerst nur der Grundton, dann die Mollterz dazu und schliesslich auch die Quinte, wobei in den zwei ersten Takten die erste Takthälfte jeweils den Klarinetten und Fagotten vorbehalten ist. Nach der Komplettierung des Tonikaakkords in T. 3 wird der harmonische Rhythmus gleichzeitig mit dem zum Forte crescendierenden Einsatz der Chorstimmen beschleunigt. Auf einen Dominantseptimakkord auf dem dritten Taktschlag folgt kurz ein Tonikaakkord, worauf der Satz auf einem unaufgelösten verkürzten Dominantseptnonakkord, der auf eine Fortführung gerichtet ist, vor einer Generalpause innehält. Es folgen, wieder im Piano, sequenzierte, nach Atem ringende “qui tollis”-Motive, mit Vorhalten auf “tollis”. In T. 8 wiederholt sich der Anfang variiert und gesteigert, nun von g-Moll ausgehend. Daran schliessen sich von neuen akkordbrechenden Motiven begleitete “miserere”Seufzer und -Rufe an, unterbrochen von den Triolenfiguren der während zweier Takte unbegleitet in Erscheinung tretenden und kadenzierenden Soloklarinette. eine variierte Form der Takte 1 ff und 8 ff., gekoppelt mit dem Akkordbrechungsmotiv in der Klarinette, leitet die dritte, wiederum gesteigerte, Anrufung ein. Zu dem Wort “peccata” setzt der Chor, vom ganzen Orchester begleitet, im Forte zu einem kurzen Fugato an, ehe in T. 32 das “miserere” verkürzt wiederaufgegriffen wird. Die Überleitung zum “dona nobis pacem”-Teil erfolgt mittels eines sequenzierten, “dolce” vorgetragenen und nur von einigen vorweggenommenen leisen “dona” akkordisch gestützten Triolenmotiv der Soloklarinette. Diese solistische Einlage scheint sogar E. T. A. Hoffmann verstört zu haben, der sonst fast nur lobende Worte für Beethovens Komposition findet. In der AmZ schreibt er 1813 dazu: “Ob aber Stellen, wie die folgende, welche auch schon bey dem Schluss des Agnus vorkommt, nicht zu opernmässig klingen, lässt Rec. dahin gestellt seyn; 43” Im Gegensatz zum vorangehenden Satzteil kehrt nun, ganz dem Text entsprechend, harmonisch Ruhe und Frieden ein. Die Tonika wird kaum je verlassen, und der Satz gliedert sich in eine Abfolge kurzer C-DurPerioden mit einer schnellen Kadenzierung fast jeder Motivgruppe. So beispielsweise in den Takten 43, 45, 49, 57, 61 und 65. Es liegt also eine harmonische Geschlossenheit vor, die eine dramatische Formkonzeption auf dieser Ebene verunmöglicht. Beethoven verlässt jedoch das Prinzip der Kontrastbildung im Dienste einer plastischen Herausstellung der Textworte nicht ganz. Es tritt aber nur stark abgeschwächt in Erscheinung. Die “pacem”-Einwürfe des Chors in T. 50 ff. fallen kaum auf. In diese unbeschwerte Stimmung bricht nun in T. 65 zur Wiederholung der Worte “Agnus Dei” mit aller Gewalt eine Episode von höchster emotionaler Intensität herein. Schon der gänzlich unliturgische Rückgriff auf den “Agnus Dei”-Text mitten im “dona”-Teil wäre Grund genug zur Kritik gewesen. Wie schon frühere Stellen gezeigt haben, ist eine Textwiederholung bei Beethoven aber zudem immer mit einer Steigerung des Ausdrucks verbunden. So beginnt der Abschnitt hier plötzlich wieder in c-Moll, mit Paukenwirbeln und Streichertremolo - teilweise in Akkordbrechung -, und steigert sich unter Beteiligung des gesamten Orchesterapparates und des Chores zum Fortissimo in Takt 73. Die Dramatik und die Spannung erhöhen sich noch durch die scharf akzentuierten Synkopen und den ab T. 71 während 12 Takten unaufgelösten, stellenweise zum Septnonakkord erweiterten, Akkord auf der Doppeldominante. Innerhalb dieses harmonischen Schwebezustandes ändert sich der Charakter der Musik in T. 77 erneut radikal. Das Orchester ist auf die pianissimo spielenden Bässe und Violinen reduziert, die, sich komplementär ergänzend, das pochende Metrum markieren. Das nach dem verzweifelten Aufschrei des vorangehenden “Agnus Dei” vom Chor rezitierte “miserere” gleicht nur noch einem angstvollen Flüstern und kommt der gesprochenen Sprache äusserst nah. Die Rückkehr zum “dona“ in T. 82 ff. geschieht, analog zur Überleitung in T. 36 ff., über die Triolen der Soloklarinette. Die folgen Takte sind praktisch mit dem ersten “dona”-Abschnitt identisch, bevor in T. 108 eine kurze Imitation einsetzt. Ganz der “laudamus te”-Stelle aus dem Gloria (T. 41 ff.) entsprechend, tragen die Fagotte und Hörner alleine das “dona”-Motiv vor, das im übrigen dem Gloriamotiv sehr ähnlich sieht, worauf der Chor, nur von den Streichern verdoppelt, antwortet. Dasselbe wiederholt sich sechs Takte später. Der Chor weicht allerdings kurz nach E-Dur aus um dann aber sogleich wieder nach C-Dur zu kadenzieren. Die Takte 132 ff. bringen die letzten 24 Takte in leicht veränderter Form wieder. Nach weiteren 12 Takten, in denen sich in den 43 Kunze, S. 263 28 Instrumentalstimmen teilweise sequenzierte Teile des “dona”-Motivs finden, und die Singstimmen schliesslich auf einem über drei Takte ausgehaltenen c liegenbleiben, nimmt Beethoven zum “dona”-Text das Kyriethema des Anfangs wieder auf und rundet damit den Zyklus ab. Übrigens zeigt sich in der direkten Gegenüberstellung des Hornmotivs in T. 178 und des Flötenmotivs in T. 179 die enge Verwandtschaft zwischen dem Kyrie- und dem “dona”-Thema. Das “dona nobis pacem” unterscheidet sich von der Tradition, ähnlich wie das Kyrie, durch den Verzicht auf einen festlichen, pompösen und majestätischen Affekt. Es verbreitet sich eher eine erhebende Stimmung, in welcher der Frieden verkündet und auch vermittelt wird. Ausserhalb der “Agnus Dei”-Episode spielen Pauken und Trompeten nur zweimal sieben Töne auf den ersten Schlag (T. 108, T. 132), mit der Anweisung “sempre piano”, während das ganze übrige Orchester und der Chor im Forte stehen. Der Satz, und damit die ganze Messe, endet im piano, mit der Reprise des innigen Kyrie-Themas. Die Schlussabschnitte der letzten sechs Messen Haydns enthalten zwar durch den Einsatz der Solisten oder durch eine Zurücknahme der Dynamik bis zum Pianissimo auch zurückhaltendere Stellen, enden aber schliesslich doch im rauschenden Forte. Die Wiederaufnahme des Kyriethemas im “Dona nobis pacem” war eine durchaus übliche Praxis. Ungewöhnlich ist bei Beethoven nur, dass dieses Thema lediglich in den letzten Takten wieder aufscheint, gewissermassen als Reminiszenz, während in der Tradition im Falle eines solchen, oft aus praktischen Gründen erfolgenden, Rückgriffs der ganze “dona”-Text zur Musik des Kyrie vorgetragen wurde. Die zuversichtliche Stimmung, von der die Bitte um Erbarmen im Kopfsatz geprägt war, überträgt sich hier auch auf die Bitte um Frieden. Insofern könnte das Kyrie auch als Prolog angesehen werden, der das Ende schon vorwegnimmt. 6. Widersprüche in der C-Dur-Messe Ausgehend von den bisherigen Ergebnissen lassen sich rund um die C-Dur-Messe von Beethoven eine Reihe von Missverständnissen, Widersprüchen und Paradoxa aufzeigen. Diese Widersprüche finden sich zwischen der Intention des Komponisten und der an ihn gestellten Erwartungen, zwischen der tatsächlichen und der erwarteten Wirkung des Werks, im Werk selbst und zwischen Beethovens Absicht und dem durch deren Umsetzung erzieltes Resultat. Die Intentionen, die Beethoven bei der Komposition seiner C-Dur-Messe umzusetzen versuchte entsprachen wie gesehen nicht den Erwartungen, die Fürst Nikolaus II von Esterházy, an die Komposition einer Festmesse stellte. Beethoven war sich dessen wohl bewusst und deshalb auch etwas besorgt 44. Das Erwecken von Andacht und eines persönlichen religiösen Empfindens passten nicht in einen Rahmen, in dem der höfische Prunk und die repräsentative Darstellung herrscherlicher Grösse im Vordergrund stehen sollten. Wohl war Nikolaus’ Auftrag der Anstoss zur Entstehung dieses Werks gewesen, doch scheint Beethoven bei dessen Ausarbeitung nicht besonders auf den Anlass Rücksicht genommen zu haben. Ganz ähnlich verhielt es sich ja auch mit der Missa Solemnis. Das ursprünglich für das Hochamt am 9. März 1820 anlässlich der Inthronisationsfeier des Erzherzogs Rudolph als Erzbischof von Olmütz geplante Werk vollendete Beethoven erst drei Jahre nach dem feierlichen Anlass. Zu seinem Vorteil hatte er dieses Werk aus eigenem Antrieb zu komponieren begonnen und war somit eigentlich nicht durch einen Auftrag an eine bestimmte Lieferfrist gebunden. In der Folge blieb zwar der Widmungsträger derselbe, die einstige Bestimmung der Messe geriet aber zur Nebensache. Die besonders in den textreichen Sätzen stark zergliederte Messe konnte allerdings die fürstliche Gesellschaft auch unabhängig von des Komponisten Aussageabsichten nicht zufriedenstellen. Es gibt kaum Momente, die dem festlichen Anlass auf gewohnte Art und Weise gerecht werden. Das Kyrie und das Benedictus stehen der Tradition zwar noch am nächsten. Insbesondere der Kyriesatz aber, der das festliche Hochamt angemessen eröffnen sollte, besitzt wohl einen feierlichen, jedoch eher innerlich erhebenden als majestätisch repräsentierenden Charakter. Nirgends in der ganzen Messe bietet sich dem Zuhörer die Möglichkeit, sich dem Genuss einer 44 vgl. S. 3 29 festlichen, rauschenden Musik und grossen, zusammenhängenden Klangflächen hinzugeben. Bruchstück folgt auf Bruchstück. Auch eine echte Fuge, der Höhepunkt aller musikalischen Kunst, sonst ein Muss in jeder Messvertonung, die als etwas gelten will, fehlt in Beethovens Op. 86. Die fugenartig ansetzenden Schlüsse der Messe könnten sogar als klägliche und misslungene Versuche des Komponisten missverstanden worden sein. Zudem mochten die übertriebenen, scharfen Kontraste und sprachhaften und emotionalisierenden Elemente dem Publikum wohl vulgär vorgekommen sein, denn aus Sicht der Kirche und des fürstlichen Auftraggebers hatte eine Ordinariumsvertonung nicht opernhaft-subjektiv zu sein, sondern musste eine der Materie würdige Objektivität bewahren. Auch in der Komposition selbst treten Widersprüche auf. Auf der einen Seite steht Beethovens Idee mit seiner Art der Textvertonung dem Gläubigen zu einem subjektiven Glaubenserlebnis zu verhelfen, in ihm “religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen”. Der Mensch steht im Zentrum und auf das Menschengeschlecht sollen mit Hilfe der musikalischen Umsetzung die vom Text ausgehenden “Strahlen der Gottheit” verbreitet werden. Diese Verbreitung soll zudem durch Aufführungen auch ausserhalb des Kirchenraumes und durch eine Druckausgabe des Werks begünstigt werden. Auf der anderen Seite steht der hohe Kunstanspruch des Werks. Der Komponist wird selbst zum Schöpfer eines Kunstwerks und ist nicht mehr nur Diener an der Schöpfung und am Wort Gottes. Beethovens subtile Textbehandlung ist nicht für jeden verständlich. Es fehlt über weite Strecken eine eingängige, volkstümlich-liedhafte Melodik wie sie beispielsweise in den sehr volksnahen Ruralmessen zu finden ist. Zudem ist eine Aufführung wegen des benötigten grossen Orchesterapparates immer mit grossem Aufwand verbunden, was einer wirklich grossen Verbreitung zu einer Zeit, als noch keine Tonträger existierten, im Wege stand. Die Puristen und Befürworter einer “wahren Kirchenmusik” hofften, gerade durch die Abkehr von grossen Orchestermessen zugunsten einer neuen Schlichtheit die Andachtserweckung steigern zu können und hatten damit im Grunde eigentlich dasselbe Ziel wie Beethoven. Von der geforderten Schlichtheit kann bei ihm allerdings nicht die Rede sein. So verständlich Beethovens Absicht nach der vorangehenden Analyse erscheint, so unverstanden blieb sie für seine Zeitgenossen und so entgegengesetzt fällt deren Wirkung aus. Für den Hörer, der sich nicht so intensiv mit Beethovens Textvertonung auseinandergesetzt hat, findet diese auf einer viel zu hohen geistigen Ebene statt. Zwar erhält jede Aussage ihre eigene musikalische Umsetzung, durch die sie in ihrer Eigenständigkeit hervorgehoben und wodurch die Struktur der Vorlage ersichtlich wird. Aber gerade diese angestrebte Einheit von Text und Musik, diese Übertragung der Heterogenität innerhalb des prosaischen Messetextes auf die musikalische Ebene, was eine stärkere Vergegenwärtigung des Textes und eine subjektive Auseinandersetzung mit demselben ermöglichen und bewirken soll, lenkt die Aufmerksamkeit des Zuhörers vom Text weg, hin zur Musik. Denn wurde der Text bis anhin auf eine homogene, im Affekt innerhalb grösserer Abschnitte nicht so stark und häufig wechselnde Musik gesungen, in der die wiederkehrenden Motive in musikalisch logischerer und verständlicherer Art geordnet waren, so konnte den Worten grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hier aber, wo die Musik in immer neue, gegensätzliche und nicht in einer musikalisch logischen Form angeordnete Affekte und Motive zergliedert ist, findet der Zuhörer keine stabile Basis vor, keine musikalische Umsetzung, die ihm einen gewissen Halt bieten könnte, der ihm eine stärkere Anteilnahme am Text ermöglichte. Freilich verhindert zwar Beethoven durch seine Art der Vertonung, dass sich der Zuhörer einem einheitlichen musikalischen Fluss geniessend hingeben kann, und entspricht dadurch wohl unbewusst den Forderungen der Gegner aufwendiger Kirchenmusik. Denn der Gläubige sollte schliesslich nicht zum Musikgenuss, sondern wegen des Gottesdienstes zur Kirche gehen. Die Ablenkung vom Wesentlichen, vom Text, ist aber durch die angewandten Mittel und die immer neu eintretenden musikalischen Ereignisse zu gross, obwohl diese ja gerade textbedingt sind. Man könnte sogar den Eindruck bekommen, Beethoven habe hier, ungeachtet der Gattung und des Textes, seine musikalischen Ideen zu verwirklichen gesucht und in den Vordergrund gerückt, er habe also gänzlich am Text vorbei komponiert. Beethoven erreicht also mit seiner Vorgehensweise in den textreichen Sätzen gerade das Gegenteil dessen, was er beabsichtigt. Tatsächlich war ja in den traditionellen Messkompositionen die Musik und vor allem deren instrumentale Komponente 30 form- und strukturbildend. Der Text wurde dabei nur sekundär berücksichtigt. Dadurch blieb er aber vom kompositorischen Geschehen weitgehend unangetastet und behielt somit eine gewisse Eigenständigkeit. Bei Beethoven nun steht der Text im Zentrum der Komposition. Die Musik hat sich nach ihm zu richten, ist also im Prinzip äusserst textdienlich. Durch die oben beschriebene Übertragung der Form, Struktur und Syntax des Textes auf die Musik strebt der Komponist eine grösstmögliche Verschmelzung der Wort- und der Tonebene an. Der Text wird so ein Teil der Komposition. Paradoxerweise verliert er gerade hier, wo er grössere Beachtung findet und sogar bestimmender Ausgangspunkt der Vertonung ist, seine Eigenständigkeit. 7. Schlusswort Als Fürst Nikolaus II von Esterházy Beethoven mit der Komposition einer Messe beauftragte, erwartete er wohl ein auf den betreffenden Anlass, den Namenstag der Fürstin, zugeschnittenes Werk. Durch seine Abweichung vom traditionellen “Kirchenstil” geht Beethoven in der Messe aber weit über die Erfüllung der Funktionalität hinaus. Ausgehend von seinen Absichten und Idealen begnügt er sich nicht mit der Reproduktion eines Typs, sondern wirkt einer Bewahrung von Konventionen entgegen. Er schreibt nicht ein an höfische Repräsentation oder andere ausserhalb liegende Faktoren und zeremonielle Vorschriften gebundenes und entsprechend gestaltetes Werk, sondern eines, das sich durch seine Authentizität und durch seine eigenschöpferische Natur als Original von der in der Tradition verhafteten Kirchenmusik abhebt. Anstelle eines Stücks Gebrauchsmusik schafft er also ein autonomes Kunstwerk, das zwar auch für einen Einsatz in der Liturgie vorgesehen ist, aber über diese dienende Funktion hinaus geht und ebenso ausserhalb des Kirchenraumes aufgeführt werden soll. Kaiser Joseph II hatte mit seinen kirchlichen Reformen unter anderem einen Gottesdienst angestrebt, der nicht mehr auf äusserlichen Prunk ausgerichtet sein, sondern den einzelnen Gläubigen zu einer persönlichen Anteilnahme am Wort Gottes und zu innerer Andacht verhelfen sollte. Dadurch gewann der liturgische Text an Bedeutung, was dessen musikalische Umsetzung beeinflussen sollte. Puristen forderten die Abkehr von der aufwendig gestalteten Orchestermesse und teilweise gar die Rückkehr zur einzig “wahren Kirchenmusik” nach dem Vorbild des 16. Jahrhunderts. Auch Beethoven war das starke Eingehen auf den Ordinariumstext wichtig. So ist in seiner Vertonung der Text der Zentrale Faktor, der die musikalische Komposition bestimmt, ohne dass der Komponist deshalb auf die Verwendung aller ihm zur Verfügung stehenden musikalischen Mittel verzichtet. Beethovens Absicht ist es, dem Publikum den Text so direkt wie möglich zu vermitteln. Er wendet sich ab von der Einhaltung einer objektiven Distanz, von der Beibehaltung eines einheitlichen Affekts, von einer weitgehenden Homogenisierung des musikalischen Satzes und von barocken Satzformen. Auch der Einsatz von abbildhaften Figuren ist unbedeutend. Beethoven behandelt den Text, wie er an Breitkopf & Härtel selbst schreibt, tatsächlich auf eine neue Art. In den Sätzen Kyrie und Benedictus geschieht dies ausgehend von einer Ausdrucks- und Gefühlsästhetik, deren Ziel es ist, die Textworte auf direktem emotionalen Weg zu vermitteln. In den textreichen Sätzen ist dies aufgrund des prosaischen, lehrhaft aufzählenden und reihenden Charakters der Sprache nicht möglich. Deshalb versucht Beethoven dort mit Mitteln des Kontrastes und der strukturellen Dramatisierung, durch die Ausprägung einer differenzierten Motivik und die Anwendung unterschiedlichster Satztechniken, die Heterogenität und den Sprachcharakter der Textvorlage in ihrer Struktur hervorzuheben. Die plastische Vergegenwärtigung des Ordinariums wird vom amorphen Text selbst bestimmt und unterliegt nicht der Formung nach einer eigengesetzlichen musikalischen Logik. Die Worte und die dazugehörige musikalische Umsetzung verschmelzen zu einer Einheit. Die dramatisierenden Kompositionsmittel, die ausserhalb der Kirchenmusik schon länger ihre Gültigkeit besassen, sind nicht grundlegend neu. Neu ist nur ihre Übernahme in die Messkomposition. Im Sanctus, im Agnus Dei und an einzelnen Stellen des Gloria und des Credo ist die auf diese Weise erfolgende Vergegenständlichung des Textes zudem ebenfalls mit einer unmittelbaren emotionalen Gefühlsvermittlung verbunden. Mit Hilfe der verschiedenen Ebenen der Textvertonung beabsichtigt Beethoven dem Hörer eine subjektive Auseinandersetzung 31 mit dem Text, eine persönliche Anteilnahme zu ermöglichen und “die strahlen der Gottheit unter das Menschengeschlecht (zu) verbreiten.” Man kann allerdings nicht leugnen, dass der grosse Aufwand, mit dem sich eine Aufführung des Werks verbindet, und die eher vom Text ablenkende, statt ihn vermittelnde Art der Vertonung die Erweckung von Andacht und das Erleben verinnerlichter Religiosität, ausser im Kyrie und im Benedictus, nicht gerade begünstigen. Freilich hat Beethoven für sein Werk gewisse Elemente im Bereich des Grossformalen von Haydn übernommen, und auch im Kleinen finden sich Anknüpfungspunkte. Bei Beethoven fehlt jedoch ein gewisses Gleichgewicht. Haydn erlaubte sich auch gewisse Freiheiten, wie zum Beispiel den Paukeneinsatz im Agnus Dei der “Paukenmesse”. Doch kommen derartige Extravaganzen bei ihm nicht so gehäuft und zugespitzt vor wie bei Beethoven. In der “Nelsonmesse”, wo sich wie gesehen eine der C-Dur-Messe von Beethoven ähnliche sprachhafte “miserere”- und “benedictus”Deklamation findet steht dem beispielsweise im ersten Teil des Credo als Gegengewicht ein nüchterner, völlig undramatischer Kanon gegenüber. An anderen stellen wird die den Vokalstimmen enthaltene Dramatik durch eine durchgehende Orchesterbegleitung verschleiert und abgeflacht. Insgesamt geht Haydn viel weniger weit, was eine Vermittlung von Gefühlen oder eine Dramatisierung des Textes betrifft, und wenn er sich an einzelnen Stellen doch in diese Richtung bewegt, so fehlt die bei Beethoven durchgehaltene Konsequenz. Die erfolglosen ersten Aufführungen in Eisenstadt und in Wien lassen sich nach diesen Ergebnissen durchaus erklären. Die Gründe für eine Ablehnung der C-Dur-Messe durch den Fürsten waren wohl letztlich in erster Linie der Mangel an Festlichkeit und Repräsentation, die fehlenden Klangflächen und Fugen, die allzu zahlreichen, als zu opernmässig empfundenen Freiheiten (insbesondere die “Agnus Dei”-Episode), die Bruchstückhaftigkeit und Formlosigkeit. Doch bei einer ernsthaften Vorbereitung, seriösen Einstudierung und qualitativ guten Aufführung hätte Fürst Nikolaus II vielleicht nicht ganz so abschätzig und erbost reagiert. Denn trotz, oder gerade wegen, der strukturellen Dynamisierung und Dramatik, der Zergliederung des Textes durch seine musikalische Umsetzung zur Erlangung hoher Plastizität, muss die Musik Zusammenhalt haben, zusammenhängend und fliessend vorgetragen werden, und nicht eine statische Aneinanderreihung der einzelnen Wort-Ton-Einheiten bleiben. Diese Schwierigkeit, die in dieser Messe zweifelsohne grösser ist als bei irgend einer Haydn-Messe, konnte die fürstliche Hofkapelle aber offensichtlich nicht überwinden. 32 8. Bibliographie Beethoven, Ludwig van: -Missa C major for four Solo Parts, Chorus, Orchestra and Organ, Op. 86, . Leipzig: Ernst Eulenburg, o.J. -Briefwechsel Gesamtausgabe (Hrsg. Sieghard Brandenburg), Bände 2, 4 und 5, München (Henle), 1996 Friesenhagen, Andreas: -Die Messen Ludwig van Beethovens. Studien zur Vertonung des liturgischen Textes zwischen Rhetorik und Dramatisierung, KölnRheinkassel (Christoph Dohr), 1996 Frimmel, Theodor: -Beethoven Handbuch. Erster Band, Leipzig (Breitkopf & Härtel) 1926 Gutsche, Susanne V.: -Der Chor bei Beethoven, Kassel (Gustav Bosse Verlag) 1995 Haydn, Joseph: -Missa Sti Bernardi von Offida. “Heiligmesse”, Kassel (Bärenreiter), 1962 -Missa in Tempore Belli. “Paukenmesse”, Kassel (Bärenreiter), 1967 -Missa in Angustiis. “Nelsonmesse”, Kassel (Bärenreiter), 1967 -Messe in B. Theresienmesse, Wien (Universal Edition, Philharmonia Partituren), o.J. -Messe Nr. 11. “Schöpfungsmesse”, München (Henle), 1967 -“Harmoniemesse”, Kassel (Bärenreiter), 1967 -Haydn Edition. Die 6 späten Messen. Plattenbeiheft, TelefunkenDecca Schallplatten GmbH, 1978 Kinder, Hermann: Hilgemann, Werner -dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Band 1, München (Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG) 1967 Kinsky, Georg: -Beethovens thematisch-bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen, München (Henle), 1955 Knapp, J. Merill: -Beethoven’s Mass in C Major, Op. 86, in: Beethoven Essays (Hrsg. Lewis Lockwood und Phyllis Benjamin), Cambridge, Massachusetts (Harvard University Press) 1984 Kretzschmar, Hermann: -Führer durch den Konzertsaal. Band II, 1, Leipzig (Breitkopf & Härtel), 1921 Kunze, Stefan: -Ludwig van Beethoven. Die Werke im Spiegel seiner Zeit, Laaber 1987 Leuchtmann, Horst: Mauser, Siegfried -Handbuch der musikalischen Gattungen. Band 9. Messe und Motette, Laaber 1998 Riethmüller, Albrecht: Dahlhaus, Carl Ringer, Alexander L. -Beethoven: Interpretationen seiner Werke. Band II, Laaber 1994 33 Schnerich, Alfred: -Messe und Requiem seit Haydn und Mozart. Wien-Leipzig (C. W. Stahn Verlag) 1909 Schreyvogl, Friedrich: -Joseph II, Emperor. In: Encyclopaedia Britannica, Bd. 10, Chicago 1979. Seidel, Elmar: -Die instrumentalbegleitete Kirchenmusik, in: Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Band II (Hrsg. Karl Gustav Fellerer), Kassel (Bärenreiter) 1976 Thayer, Alexander Wheelock: -Ludwig van Beethovens Leben. Bände 3-5, Leipzig (Breitkopf & Härtel), 1923 34