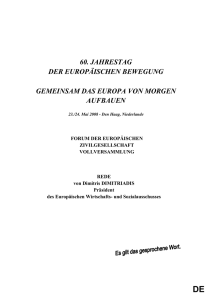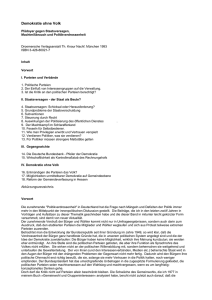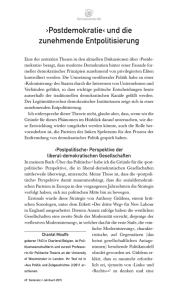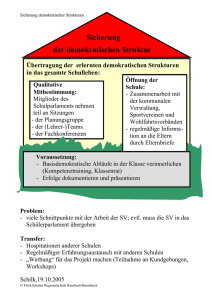2001: Demokratie in Europa – ein Volk oder das Volk?
Werbung

Andreas Fisahn Demokratie in Europa - ein Volk oder das Volk? I. Um was geht es? Der Begriff des Volkes und der Nation hat erneut Konjunktur. Einen Meilenstein in der neuen Diskussion um diese Begriffe bildeten vor nun zehn Jahren die Leipziger Montagsdemos, die den Anfang vom Ende der DDR einleiteten. Die Demonstranten skandierten am Anfang "Wir sind das Volk" und gingen später über zum "Wir sind ein Volk". Mit dem Auswechseln des einen Wörtchens war eine gewichtige Verschiebung des transportierten Inhalts verbunden. Zu Beginn wurde demokratische Teilhabe eingefordert, am Ende die Vereinigung der DDR mit der Bundesrepublik . Die demokratische Teilhabe setzte im Bewusstsein der Demonstranten keine Einheitlichkeit des Volkes voraus, sondern nur seine Existenz als Bevölkerung. Mit der zweiten Parole wurde die nationale Einheitlichkeit, eine Zusammengehörigkeit mit dem Volk der BRD betont, die demokratische Teilhabe war demgegenüber in den Hintergrund getreten und die Zusammensetzung der Demonstrationsteilnehmer hatte sich entscheidend gewandelt. Aber die Intuition der Demonstranten war richtig: die Betonung der nationalen Einheit oder der Einheitlichkeit des Volkes ist eine von der demokratischen Teilhabe geschiedene Fragestellung. Dies ist keineswegs eine verbreitete Einsicht. Darauf hat Dian Schefold hingewiesen, um den Begriff des Volkes, wie er in der deutschen staatswissenschaftlichen Literatur gepflegt wird, zu entmystifizieren.[1] Im Kontext der europäischen Einigung wird die Einheitlichkeit des Europäischen Volkes als Voraussetzung der Staatenbildung problematisiert. Dabei wird der Mangel an einer Einheit Volk von den einen genutzt, um die Zweifel an der Möglichkeit der Bildung einer europäischen Demokratie in Form eines Bundesstaates anzumelden.[2] Andere diskutieren, ob und wie eine (kulturelle) europäische Identität erzeugt werden oder sich herausbilden könnte.[3] Dass eine solche Identität, sei sie national oder kulturell, ein "Wir-Gefühl" ein "sense of belonging"[4] notwendig ist, wird oft als gegeben hingenommen. Die Einheitlichkeit des Volkes wird zu einer vorpolitischen Voraussetzungen der Demokratie, einer (europäischen) demokratischen Verfassung. Sie wird zu den Voraussetzungen, die sich ein demokratisches System - so die Annahme - nicht selbst schaffen kann, auf die es aber angewiesen ist.[5] Zu diskutieren ist die Frage, ob eine demokratische Verfassung auf vorpolitische Voraussetzungen wie ein nationales Wir-Gefühl angewiesen ist. Meine These lautet: Eine demokratische Verfassung einer politischen Einheit setzt "nur" die Existenz oder das Erlernen einer demokratischen Kultur voraus. Diese lässt sich charakterisieren durch das zivile Austragen von Konflikten nach demokratischen Regeln. Das ist gleichzeitig eine hohe wie eine niedrige Anforderung. II. Homogenität und Nationalgefühl - klassisch Zunächst sei ein Blick auf die Diskussion vorpolitischer Voraussetzungen in der klassischen Staatstheorie gewagt. Franz L. Neumann versuchte zu zeigen, dass die Klassiker demokratischer Staatstheorie eine homogene soziale Basis als Grundlage einer demokratischen Organisation der staatlichen Institutionen gefordert haben.[6] Voraussetzung des demokratischen Staates sei eine soziale Basis freier und gleicher Bürger, also eine ungefähre soziale Gleichheit der Staatsbürger, die es ermögliche, einen einheitlichen Willen zu bilden, Konflikte auszugleichen oder Interessen anzugleichen. Bei genauerem Hinsehen ergibt sich aber, dass die Klassiker diese soziale Basis nicht eingefordert haben, als herzustellende vorpolitische Voraussetzungen ihren staatsrechtlichen Überlegungen vorangestellt haben. Vielmehr hat die politische Philosophie bis Hegel eine solche soziale Basis einfach unterstellt, bzw. sie hat den (demokratischen) Staat als Staat der freien, ökonomisch unabhängigen, männlichen Bürger konstruiert und sowohl "das Gesinde" wie die Frauen außen vorgelassen.[7] Erst bei Hegel wird die soziale Spaltung der bürgerlichen Gesellschaft zu einem Problem. Er löst dieses Problem theoretisch durch den Staat, der die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft aufheben könne und über den die gespaltenen bürgerliche Gesellschaft zu einer allgemeinen, vernünftigen Sittlichkeit vereinigt werde.[8] Patriotische Gesinnung sei nicht Voraussetzung des Staates, sondern dessen Resultat.[9] Die Idee des Nationalstaates, der Übereinstimmung von staatlichem Territorium und Nation, war als Hegel die Rechtsphilosophie verfasste, erst am Beginn ihrer Erfolgsgeschichte und wurde insbesondere in Kreisen der nationalistischen Romantik kommuniziert[10], gegen die Hegel in der rationalistischen Tradition der Aufklärung Stellung bezog. Die nationale Idee äußerte sich früh in mehr oder weniger theoretischer Form in Herders Versuch, Volk über Sprache und Kultur zu definieren und zu konstruieren[11], oder in Fichtes berühmt, berüchtigten "Reden an die Deutsche Nation"[12]. Der Nationalismus gelangte zu großer ideengeschichtlicher Wirkung mit der französischen Revolution, die ihre Bürger gegen die Verschwörung der reaktionären Monarchen mobilisieren und in den Krieg schicken musste, und mit der amerikanischen Unabhängigkeit - auch hier die nationale Vereinigung als Abwehr gegen die Repressionen des monarchischen Mutterlandes. Aber es war die Idee der Demokratie, welche die territoriale Einheit erzeugte, ihr folgte die Nationenbildung. III. Die wirkmächtige Konstruktion der Nation Bei Hegel existiert das Verhältnis noch in der richtigen Reihenfolge. Nation und Nationalbewusstsein oder Patriotismus folgen dem Staat und gehen ihm nicht voran. Die Geschichtsschreibung scheint sich in diesem Punkte weitgehend einig[13]: Nationen werden durch staatliche Macht konstruiert und über Schule, Militär, Amtssprache u.ä. gebildet[14]. Erst durch diese Konstruktion werden sie zu wirkmächtigen geschichtlichen Faktoren. In den Worten Pilsudskis, des Führers des seit 1918 unabhängigen Polens: "Der Staat macht die Nation, nicht die Nation den Staat."[15] Dian Schefold hat - nicht zuletzt aufgrund des Schweizer Erfahrungshintergrunds - eindringlich darauf hingewiesen, dass es feststehende Merkmale zur Abgrenzung und Bestimmung einer einheitlichen Nation oder des Volkes nicht gibt. Für jede Behauptung es gebe ein unhintergehbares konstitutives Merkmal für die Nationenbildung gibt es Gegenbeispiele[16]: die amerikanische Nation ist das Gegenbeispiel für die Forderung nach ethnische Homogenität; kulturelle Homogenität ist angesichts vielfältiger Subkulturen und regionaler Kulturen von vornherein schwierig zu bestimmen: "Geschichtsklitterung als ein Werk von Intellektuellen ist die Grundlage der gemeinsamen identitätsstiftenden Kultur."[17] Und für die Notwendigkeit sprachlicher Homogenität ist Kanada[18] und die Schweiz das Gegenbeispiel. Und die Schweiz ist "alles andere als ein Sonderfall."[19] Aber diese Konstruktion wird wirkmächtig, ein bedeutender geschichtlicher Faktor, da es gelingt, sie fest in der symbolischen Ordnung der sich seit dem 18. Jahrhundert bildenden Nationalstaaten zu verankern. Dies ist im wesentlichen das Werk Intellektueller[20], denen es gelingt, eine hegemoniefähige Konstruktion der nationalen Identität zu etablieren und in der hegemonialen symbolischen Ordnung[21] zu verankern. Hegemoniefähig wird die Konstruktion der nationalen Identität oder des einheitlichen Volkes dadurch, dass sie an reale Erscheinungen, wie Sprache, Religion usw. anknüpfen kann[22], die jedoch allein noch nicht das Volk konstituieren und abgrenzen. Ein Verständnis des Volksbegriffs als Element der symbolischen Ordnung eröffnet die Möglichkeit, eine unterschiedliche Bedeutung, eine mehr oder weniger starke Dominanz der nationalen Identität in unterschiedlichen geschichtlichen Phasen anzunehmen und daneben die Existenz subversiver symbolischer Identitäten[23] zu platzieren, etwa den Internationalismus eines Teils der Arbeiterbewegung, die kollektive Identität über die Klassenzugehörigkeit bildete. Und die nationale Symbolik konnte sich, gerade weil die Anknüpfungspunkte diffus sind, in unterschiedlichen geschichtlichen Phasen mit anderen Symboliken, Politikmustern vereinen.[24] So war sie gelegentlich revolutionär und demokratisch, etwa in ihrer Entstehungsphase. Auch während der kolonialen Unabhängigkeitsbewegungen oder der russischen Revolution wurde auf die nationale Symbolik zurückgegriffen und diese mit revolutionären Zielen verbunden. Umgekehrt konnte die nationale Symbolik Bestandteil imperialer und kolonialistischer Strategien werden und sie konnte in Kombination mit der arischen Rassenideologie im deutschen Faschismus eine geschichtlich bisher unbekannte Vernichtung von Teilen der Bevölkerung und den "totalen Krieg" ideologisch stützen. Angesichts der Macht, die ein Wir-Gefühl als nationale Identität, wie irrational die Konstruktion auch immer gewesen sei, allein oder in Kombination mit anderen vergemeinschaftenden Symboliken geschichtlich entfalten konnte, stellt sich die Frage, ob es zur Verbindung mit der Idee der demokratischen Selbstgesetzgebung taugt. Der erste Reflex, den die Frage, so gestellt erzeugt, ist ein Schaudern: wieso soll eine Symbolik, die auch zu den abscheulichsten Verbrechen herhalten konnte, ausgerechnet Voraussetzung einer demokratischen Organisation der Gesellschaft sein? Gleichsam als Antithese auf dieses Schaudern kann man sich die Frage stellen, ob ein solches Wir-Gefühl nicht verbunden mit der demokratischen Idee geeignet ist, deren Umsetzung in die politische Wirklichkeit zu stabilisieren, die demokratische Gesellschaft zusammen zu halten. Umgekehrt kann die demokratische Idee dann als Element dienen, das die nationale Symbolik bindet, womit letztere zivilisiert und erstere stabilisiert wird. IV. Zurechnungseinheit Willensgemeinschaft - Herkunfts- und In der Tat scheint die Konstruktion nationaler Identität als Voraussetzung einer demokratischen Organisation der Gesellschaft z.T. als Zivilisierung der nationalen Symbolik gemeint zu sein. Ausgangspunkt dieses Versuchs der Zivilisierung ist zunächst das Volk als demokratische Zurechnungseinheit. Dian Schefold hat herausgestellt, dass eine demokratische Organisation der Gesellschaft eine Zurechnungseinheit benötigt, denn: Staatsgewalt und Volk bedingen einander. "Wenn jene vom Volk ausgehen soll, muss sie doch bestimmen, wer zum Volk gehört. Staatsangehörigkeit oder auch Bürgerrechte bedürfen rechtlicher Regelung."[25] Aber die Zurechnungseinheit, setzt keine Einheitlichkeit voraus, sie ist Zähleinheit, Grundmenge aller demokratischen Prozesse wie der demokratischen Willensbildung. Aber als Zähleinheit setzt sie kein "Wir-Gefühl", keinen "sense of belonging" voraus, muss also nicht als homogene Nation konstruiert werden. Als Versuch der Zivilisierung der nationalen Identität oder nationalen Homogenität im Kontext der spezifisch deutschen Diskussion kann man Böckenfördes - sehr einflussreiches - Unterfangen werten, die nationale Homogenität von der eher deutschen Herkunftsgemeinschaft auf die eher französische Willengemeinschaft umzustellen. "Im ersten Fall kann jeder Franzose sein, der sich die Prinzipien der Republik zu eigen macht, im zweiten Fall kann Deutscher nur sein, wer seine ethnische und kulturelle Herkunft nachweisen kann. Nach dem französischen Modell kann die Einheit von Staat und Nation mit ethnischer Heterogenität einhergehen, im zweiten Fall nicht."[26] Böckenförde knüpft explizit an die deutsche Tradition der Herkunftsgemeinschaft an und postuliert als vorpolitische Voraussetzung der demokratischen Gleichheit eine "relative Homogenität", die sich aus der nationalen Identität entwickele[27], wobei er Nation als "ethnisch und kulturell homogene Gemeinschaft"[28] versteht und sie als "Schicksalsgemeinschaft"[29] konstruiert. Sobald er jedoch seinen Ansatz verallgemeinert und nationale Identität als vorpolitische Voraussetzung jeder demokratischen Organisation der Staatsform - etwa am Beispiel der USA - diskutiert, greift er auf den Begriff der Nation als Willensgemeinschaft zurück, konstruiert Nation über ein bloßes Zugehörigkeitsgefühl, das vom Staat hergestellt wird[30], und fordert zusätzlich ein demokratisches Ethos, worunter Elemente einer demokratischen Kultur zusammengefasst werden[31]. In der Diskussion des konkreten Problems des rechtlichen Status und der demokratischen Teilhabe von Migranten in der Bundesrepublik führt das Festhalten am Herkunftsprinzip Böckenförde zu Problemen: Die Existenz mehrerer Millionen fest ansässiger Ausländer sei mit dem Prinzip ethnischer Homogenität nicht vereinbar, sie könnten in einer demokratischen Gesellschaft aber ebenso wenig "auf Dauer als 'Untertanen' oder bloße Schutzverwandte behandelt"[32] werden. Die Lösung liege in der Erleichterung der Einbürgerung, der Aufnahme in den Kreis der wahlberechtigten Staatsbürger, die eine "Bindung an das Volk als politische Schicksalsgemeinschaft" schaffe[33]. Dabei sei dieser Einbürgerungsanspruch ohne Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit zu schaffen[34], also die doppelte Staatsbürgerschaft rechtlich anzuerkennen. Dieses Postulat gerät entweder in Widerspruch zur Herkunftsgemeinschaft als vorpolitischer Voraussetzung der Demokratie, denn die unterschiedliche Herkunft ist auch nicht durch Assimilationsanforderungen[35] zu nivellieren - die Böckenförde auch nicht einfordert. Oder dieses Postulat bedeutet eine Zivilisierung der nationalen Homogenität durch "traditionsbewusste"[36] Umsteuerung der Herkunftsgemeinschaft auf die Willensgemeinschaft. An dieser Stelle gerät man aber vor allem in Probleme der Bestimmung der Staatsangehörigkeit, der Zurechnungseinheit Volk, die es zu definieren gilt. Auch mit der Willensgemeinschaft ist aber mehr gemeint als die Zusammenfassung zu einer Zurechnungseinheit, nämlich auch die Erzeugung von Einheitlichkeit, die begründungsbedürftig ist, wenn man sie zur vorpolitischen Voraussetzung der Demokratie macht. V. Klassenspaltung und nationale Vergemeinschaftung Das Postulat der (nationalen) Einheitlichkeit kann verstanden werden als Antwort auf Probleme, die sich für die Demokratie aus gesellschaftlichen Spaltungen ergeben. Während Hegel noch die Spaltung der bürgerlichen Gesellschaft durch den Staat überwinden wollte, kommt Marx zu ganz anderen Schlussfolgerungen: Die Spaltung der Gesellschaft schlägt direkt auf die politische Sphäre durch. Die Klassenwidersprüche führen bei Marx zu einer politisch instabilen Lage. Es entstehe über ein Klassengleichgewicht[37] ein politisches Machtvakuum, das es scheinbar neutralen Kräften erlaubt, die politische Macht an sich zu reißen und die Demokratie in eine Diktatur zu transformieren. So in Kurzform Marx berühmte Analyse des Bonapartismus, die spätere Faschismustheorien inspirierte. Wenn die (Klassen-)Spaltung der Gesellschaft sich auf die politische Form auswirkt, eine Gefährdung der demokratischen Konstitution impliziert, liegt es nahe, sich auf die Suche nach vereinheitlichenden Kräften zu suchen und diese theoretisch wie praktisch zur Vorbedingung der Demokratie zu machen. Für Marx liegt die Lösung in der Aufhebung der Klassenspaltung zwischen Bourgeoisie und Proletariat in einer sozialistischen Gesellschaft, die so gleichsam auch zur Vorbedingung der Demokratie wird. In dieser Tradition wird von Teilen der Weimarer Staatstheorie argumentiert: in der sozialdemokratischen Variante wird ein gewisses Maß an sozialer Homogenität, die durch soziale Grundrechte zu schaffen ist, zur Voraussetzung der Demokratie[38]; in der linkssozialistischen Variante blieb es dabei, dass die liberale Demokratie auf der Grundlage eines Klassenkompromisses prekär bleibt und erst die Aufhebung des Klassenantagonismus demokratische Selbstregierung ermöglicht[39]. Das Problem dieser Position liegt auf der Hand; sie wird leicht zu einem Ökonomismus, der nur die sozialen Unterschiede und Gegensätze als Konfliktstoff begreift oder umgekehrt alle gesellschaftlichen Konflikte auf soziale Konflikte reduziert, bzw. aus ihnen ableitet. Neben den sozialen Unterschieden existieren jedoch in Gesellschaften viele andere Unterschiede, Differenzen oder Gegensätze, die über eine entsprechende Symbolik und Ideologie zu unüberwindlichen Gegensätzen werden und das Handeln der Akteure bestimmen können. Dazu gehören religiöse oder ethnische Unterschiede, der kleine Unterschied der Geschlechter oder Fragen der Lebensführung, ökologische Fragen oder weltanschauliche Bekenntnisse. Es war ausgerechnet Lenin, der in einer frühen Schrift zur nationalen Frage mit Blick auf das Riesenreich Russland die Existenz und das Zusammenleben verschiedener Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen als möglichen Konfliktstoff neben dem Klassenwiderspruch akzeptierte. Er setzte weder allein auf die Überwindung von Klassengegensätzen, noch auf die nationale Homogenisierung der russischen Bevölkerung sondern seine Lösung der nationalen Frage "lautet: konsequenter Demokratismus", worunter er "absolut keine Privilegien für irgendeine Nation, für irgendeine Sprache" kurz gleiche Rechte und Minderheitenschutz verstand.[40] Die Praxis in der Sowjetunion sah bekanntlich anders aus, Stalin[41] begann eine unerbittliche Homogenisierung der Gesellschaft inklusive einer nationalen.[42] Die Einforderung nationaler Homogenität kann als Antwort auf die vorstehende Theorietradition gelesen werden. Prominent geworden ist Carl Schmitts Postulat der nationalen Homogenität als Voraussetzung der Demokratie. Schmitt konstruiert einen Gegensatz von Demokratie und Liberalismus, womit die national homogene Demokratie zum Gegenstück zur liberalen Menschheitsdemokratie aufgebaut und letztere gleichzeitig fundamentalistisch angegriffen wird. Jede Demokratie, meint Schmitt, "beruhe darauf, dass nicht nur Gleiches gleich, sondern mit unvermeidlicher Konsequenz, das Nichtgleiches nicht gleich behandelt wird. Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens - nötigenfalls - die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen."[43] Und die geforderte Homogenität wird als nationale Homogenität gedacht, nicht als Menschengleicheit, denn die Gleichheit der Menschen sei ein liberaler Gedanke und kein demokratischer, und es würde "die politische Gleichheit in demselben Maße entwertet, wo er (der Staat) sie der Menschengleichheit annähert," die Gleichheit verlöre ihre Substanz.[44] Der Gehalt dieser Substanz und ihrer Entwertung bleibt im Dunkeln. Unmissverständlich macht Schmitt aber klar, was er unter der Ausscheidung und Vernichtung des national Heterogenen versteht, nämlich einen Sachverhalt, den man heute als ethnische Säuberung bezeichnen würde. Er verweist als "positives" Beispiel auf die damalige Türkei mit ihrer Praxis der "radikalen Aussiedlung der Griechen und ihrer rücksichtslosen Türkisierung des Landes."[45] Sowohl für das Homogenitätspostulat wie für die Nation als Kriterium der Homogenität werden von Schmitt eher mystische Gründe angeführt. Was mit dieser Konstruktion intendiert wird, kommt eher nebenbei zum Vorschein. Durch einen Verzicht auf die nationale Homogenität würden die "substanziellen Ungleichheiten keineswegs aus der Welt und dem Staat verschwinden, sondern sich auf ein anderes Gebiet, etwa vom Politischen ins Wirtschaftliche zurückziehen und diesem Gebiet eine neue, unverhältnismäßig starke, überlegene Bedeutung geben."[46] Die politische Option wird deutlich: Soziale Auseinandersetzungen, die man mit Schmitt als Freund-FeindVerhältnis begreifen muss, werden durch ethnische, völkisch-rassische ersetzt. Die Vernichtung und Ausscheidung des Fremden, der Anderen, des national Heterogenen wird so zum bewusst genutzten Instrument, um andere Konfliktpotenziale in modernen Gesellschaften, insbesondere soziale Konflikte zu verdrängen. In der konkreten historischen Situation konnte so der Weg bereitet werden für eine Akzeptanz der Rassenideologie der Nazis in der Intelligenz, die sich diesen gegenüber bekanntlich wenig resistent zeigte. Schmitt formuliert so, dass die zitierten Passagen immerhin als Rechtfertigung der physischen Vernichtung eines Teiles der Bevölkerung, letztlich als Rechtfertigung des Holocausts gelesen werden kann, auch wenn sich dieser 1926 noch nicht abzeichnete. Aber diese Formulierungen Schmitts machen das Problem deutlich, dass mit dem Postulat der nationalen Homogenität als Voraussetzung der Demokratie verbunden ist: Nimmt man an, dass eine demokratische Verfassung gefährdet ist, wenn das Konfliktpotential einer Gesellschaft so groß ist, dass die jeweiligen Minderheiten sich demokratischen Mehrheitsbeschlüssen nicht beugen, erscheint das nationale Wir-Gefühl als Vehikel um Gesellschaften zusammen zu kitten. Aber dieser Kitt - sofern er denn wirkt, was historisch oft genug der Fall war - ist mit einem hohen Preis verbunden, eben mit der Abschottung nach außen und der potentiellen Aggression gegenüber dem Fremden, dem Heterogenen nach innen, die bis zur physischen Vernichtung gehen kann. VI. Soziale und nationale Integration Auch in den neueren Diskussion um die nationale Homogenität wird diese Gefahr nicht gebannt, wenn man sich die Gründe vor Augen führt, die für die Notwendigkeit eines nationalen Wir-Gefühls angegeben werden. Eine relative Homogenisierung sei erforderlich, meint Böckenförde, "damit die tendenziell atomisierte Gesellschaft zusammengehalten und - ungeachtet ihrer differenzierten Vielfalt zur handlungsfähigen Einheit verbunden wird." Diese Funktion übernehme das "nationale Bewusstsein", das vor "Rückfall in Tribalismus und Anarchie" sichere. Deshalb könne es nicht das Ziel sein, "nationale Identität zu überholen und zu ersetzen, auch nicht zugunsten eines menschenrechtlichen Universalismus".[47] Hören wir weitere des nationalen Chauvinismus ebenfalls unverdächtige Stimmen. Fritz Scharpf argumentiert unter Berufung auf die Notwendigkeit einer nationalen Identität gegen eine Vertiefung der europäischen Integration zu einem europäischen Föderalismus. Denn "notwendige Voraussetzung der demokratischen Legitimität ist also offenbar eine 'Wir-Identität' ..., welche es auch unterlegenen Minderheiten ermöglicht, das Mehrheitsvotum nicht als Fremdherrschaft, sondern als kollektive Selbstbestimmung zu verstehen."[48] Claus Offe begründet die Notwendigkeit einer Wir-Identität mit den Zumutungen der wohlfahrtsstaatlichen Umverteilung. Das nationale Wir-Gefühl, die Zugehörigkeit zu einer vorpolitischen Schicksalsgemeinschaft machten es verständlich, dass egoistische Individuen in staatlich auferlegte Umverteilungen einwilligten. Nur so habe sich der Nationalstaat entwickeln können zum "größten bekannten Sozialverband, der Umverteilungsopfer bisher zumutbar machen konnte."[49] Schließlich argumentiert Richard Münch, dass die Herausbildung des nationalen Wir-Gefühls notwendig wurde, weil der Staat im konfliktreichen Europa, "mit der Mobilisierung der ganzen wehrfähigen Bevölkerung in den kriegerischen Auseinandersetzungen die Loyalität jedes einzelnen Bürgers" beanspruchte.[50] Die Zusammenstellung dieser Argumente für die Notwendigkeit des nationalen Wir-Gefühls macht vor allem eins deutlich, dass dessen rationale Begründung jenseits der Schmittschen Mystik eher schwierig ist. Um so erstaunlicher ist es, wie unproblematisch diese vorpolitische Voraussetzung der Demokratie in vielen Diskursen angenommen wird und wie hartnäckig sie sich hält. Denn all diese Gründe sind erstens problematisch und zweitens unterkomplex. Die Mobilisierung des nationalen Wir-Gefühls spielte und spielt in den kriegerischen Auseinandersetzungen offenkundig eine bedeutende Rolle. Aber was heißt das für die europäische Integration, den europäischen oder den deutschen Volksbegriff heute? Erstens ist die moderne computergestützte Kriegsführung - was mit dem Golfkrieg und dem Angriff auf Jugoslawien deutlich geworden ist - nicht mehr auf die Mobilisierung der gesamten Bevölkerung angewiesen. Im Gegenteil, der Krieg kann sogar gegen den Protest großer Teile der Bevölkerung "erfolgreich" geführt werden. Zweitens braucht es im Verteidigungsfall nicht des nationalen homogenen Volkes im Sinne einer Herkunftsgemeinschaft um Verteidigungsbereitschaft zu wecken. Umgekehrt scheint der Angriff erst dazu beizutragen, ein kollektives Wir-Gefühl entstehen zu lassen, unabhängig von der Heterogenität der angegriffenen Bevölkerung des Staates. Das zeigt sowohl die Herausbildung der französischen Nation als Reaktion auf den Angriff der monarchischen Reaktion, als auch die Herausbildung eines deutschen Nationalgefühls als Reaktion auf die napoleonische Okkupation. Wenn man drittens das nationale Wir-Gefühl als Voraussetzung für einen Angriffskrieg begreift, für das es oft genug herhalten musste, steht es geradezu im Widerspruch zu einer geistesgeschichtlichen Tradition, die mit dem demokratischen Republikanimus die Hoffnung auf "ewigen Frieden" verband.[51] Exemplifiziert werden dadurch geradezu die Gefahren, die mit dem Homogenitätspostulat als ethnische Abgrenzung nach außen verbunden sind. Die Konstruktion des nationalen Wir-Gefühls als Voraussetzung der Opferbereitschaft im wohlfahrtsstaatlichen Sozialverband scheint erstens unangemessen, weil Verteilungskämpfe auch im Nationalstaat nicht etwa stillgelegt sind. Sozialstaatliche Umverteilung, wo sie denn stattfindet und nicht ausschließlich als "Sozialismus in einer Klasse" (Scharpf) als Versicherungssystem zum gegenseitigen Vorteil funktioniert, lässt sich wohl kaum als nationalbewusstes Opfer der Vermögenden zugunsten der sozial Schwächeren deuten. Umgekehrt gibt es Solidarität mit sozial Benachteiligten auch jenseits der nationalen Solidarität, was unterschiedlichste Hilfen für andere Staaten, so beschränkt sie auch seien mögen, zeigen. Zweitens besteht eine "merkwürdige Dissonanz zwischen den etwas archaisch anmutenden Zügen des 'Verpflichtungspotentials' aufopferungswilliger Schicksalsgenossen", und dem modernen Staatsverständnis im demokratischen Rechtsstaat, nach dem allgemeine Gesetze ihre verpflichtende Kraft daraus beziehen, dass sich deren Adressaten auch als deren Autoren begreifen dürfen.[52] Die Akzeptanz von staatlichen Entscheidungen allein aus dem nationalen Wir-Gefühls zu erklären, das es verhindere diese Entscheidungen als Fremdherrschaft zu begreifen, ist zumindest unzureichend und z.T. unzutreffend. Die Parole "Wir sind das Volk" machte deutlich, dass die Konfliktlage in der DDR quer zur nationalen Frage lag. Die Entscheidungen der DDR Institutionen stießen nicht etwa deshalb auf Ablehnung, weil sie als Fremdherrschaft erschienen, sollen weil sie trotz großer nationaler Homogenität nicht an die Willensbildung in der Bevölkerung zurückgebunden wurden. Revolutionen unterscheiden sich von Befreiungsbewegungen eben dadurch, dass sie sich innerhalb der Nation abspielen, die Legitimität der Regierung also trotz nationaler Homogenität bezweifelt wird. Das nationale Wir-Gefühl reicht in diesen Fällen nicht als Kitt, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu gewährleisten - jedenfalls dürfte das die Sicht der gestürzten Herrscher sein. Umgekehrt wird der neue Zusammenhalt der Beherrschten, die die alten Herrscher stürzen, nicht vom nationalen Wir-Gefühl getragen, am Werk sind andere kollektive Identifikationsmuster. Die Parole "Wir sind das Volk" signalisierte die kollektive Identität einer demokratischen Bewegung in der DDR, erst mit dem Umschwung zu "Wir sind ein Volk" wurde die kollektive Identität über die Nation definiert. Entscheidender ist aber, dass durch diese und auch die übrigen Deutungen des nationalen Wir-Gefühls die Problematik der sozialen Integration unterkomplex behandelt wird. Die Frage "was hält die Gesellschaft zusammen?" kann doch nicht ernsthaft mit "Das nationale Wir-Gefühl" beantwortet werden. Und so gestellt, kann die Frage auch nicht mit dem Versuch beantwortet werden, die kollektive Identität vom nationale WirGefühl auf einen Verfassungspatriotismus[53] umzustellen. In bestimmten historischen Phasen, meist in Ausnahmezuständen, war das Nationalbewusstsein in der Lage, alle übrigen Konflikte in der Gesellschaft, die oben aufgezählt wurden, zu verdecken und als zentraler Kitt zu fungieren - aber dies um den Preis der Ausgrenzung oder Vernichtung des Heterogenen, Fremden. In normalen Situation braucht es jedoch offenbar anderer oder weiterer Mechanismen, um eine Gesellschaft, verstanden als Bevölkerung eines abgrenzbaren Territoriums, zusammen zu halten. "Was hält die Gesellschaft zusammen?" ist die zentrale Frage, auf die ein Teil der Soziologie versucht eine Antwort zu geben. Die Antworten fallen bekanntlich recht unterschiedlich aus, und über sie werden die verschiedenen Richtungen in der Soziologie konstituiert. Es lassen sich mindestens drei grobe Richtungen unterscheiden: Die utilitaristische Tradition stützt entweder ausgehend vom egoistischen homo oekonomicus den Zusammenhalt auf rationale Berechnungen des gegenseitigen Vorteils oder auf staatlichen Zwang oder auf Kompromisse pluralistischer Interessen. Wertorientierte Theorien begründen den Zusammenhalt entweder mit der sozialisationsbedingten Internalisierung gemeinsamer Wertvorstellungen oder mit der diskursiven Herausbildung konsensualer Vorstellungen, von denen dann ein Wir-Gefühl, sei es national oder verfassungspatriotisch eine unter vielen sein kann. Schließlich leitet der Funktionalismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt ab aus der Entwicklung differenzierter, aufeinander abgestimmter gesellschaftlicher Subsysteme, denen sich die Umwelt anpasst und die sich ihrer Umwelt anpassen - ein wie immer geartetes Wir-Gefühl hat da erst gar keinen Platz. Diese verschiedenen Antworten[54], die um Kombinationen und verschiedene Schattierungen zu ergänzen wären, können hier nicht diskutiert werden. Sie zeigen aber an, dass die der Verweis auf das nationale Wir-Gefühl nicht ausreicht um den Zusammenhalt einer "atomisierten Gesellschaft"[55] zu erklären. VII. Politische Integration und demokratische Kultur Wenn man die Existenz unterschiedlicher Konflikte oder eine Atomisierung der Gesellschaft annimmt, geht man gleichzeitig davon aus, dass man auch die Frage "Was treibt die Gesellschaft auseinander?" sinnvoll stellen kann. Das ist die Fragestellung der konflikttheoretischen Soziologie von Marx bis zu postmodernen Individualisierungstheorien. Wenn man also sinnvoll die vorpolitischen Bedingungen der Demokratie diskutieren will, müssen die widerstreitenden Faktoren der sozialen Integration und der sozialen Desintegration in ihrer Gesamtheit in den Blick geraten. Im Ergebnis kann man Prognosen anstellen zur Stabilität einer bestimmten gesellschaftlichen Regulationsweise und der politischen Institutionen. So gesehen geraten die politisch-juridischen Institutionen in eine Abhängigkeit von den Faktoren gesellschaftlicher Integration und Desintegration - eine Abhängigkeit die empirisch sicher existiert. Niemand würde aber das normative Postulat, staatliche Institutionen demokratisch zu organisieren, unter den Vorbehalt eines günstigen Verhältnisses von desintegrierenden und integrierenden Faktoren stellen. Ebenso wenig Sinn macht es, dieses Postulat allein unter den Vorbehalt eines nationalen Wir-Gefühls zu stellen. Das legt es nahe, die Frage umzudrehen: welchen Beitrag leisten die juridisch-politischen Institutionen zur Integration oder zum Zusammenhalt einer Gesellschaft, verstanden als territorial abgrenzbare Bevölkerung, welche die Zurechnungseinheit der Demokratie ausmacht? Dabei ist es angezeigt, den Begriff des Zusammenhalts zu präzisieren. Zusammenhalt kann man sicher sehr anspruchsvoll verstehen, als Versöhnung der Gesellschaft oder als harmonisches Zusammenleben auf konsensualer Basis, was die Bedingungen dieses Zusammenlebens betrifft. Zusammenhalt der Gesellschaft wird so Bestandteil des guten Lebens. Man kann Zusammenhalt aber auch viel weniger anspruchsvoll, gleichsam minimalistisch definieren. Dann rückt die Legalität des äußeren Verhaltens, die Kant als Rechtspflicht bestimmt[56], in den Mittelpunkt des Interesses. Es kommt nicht darauf an, dass die Individuen allen politischen Entscheidungen zustimmen, sondern nur, dass sie die gesetzmäßigen Anforderungen erfüllen. Das heißt nichts anderes, als dass Konflikte friedlich, zivilisiert ausgetragen werden; individuelle Konflikte auf den dafür vorgesehenen rechtsförmigen Wegen, kollektive Konflikte über demokratischen Wettbewerb, über Einflussnahme auf die kollektive Willensbildung und friedlichen Protest. Das setzt allerdings voraus, dass sich die aktuelle Minderheit den Entscheidungen der aktuellen Mehrheit beugt. Erleichtert wird das auf einer rationalen Ebene dadurch, dass aktuelle Minderheiten gleichzeitig potenzielle Mehrheiten bilden. Das gibt nicht nur den Minderheiten die Hoffnung, ungemäße Entscheidungen revidieren zu können, sondern erleichtert es der aktuellen Mehrheit auch, Kompromisse mit der aktuellen Minderheit einzugehen. So bleiben jedenfalls große Teile der aktuellen Minderheit in einer demokratischen Kultur trotz dieser Stellung nicht einflusslos. Institutionell abgesichert wird dieser Einfluss in der Parteiendemokratie durch die Mechanismen - insbesondere der föderalen - Gewaltenteilung. Dieses Verhältnis wird dann problematisch, wenn es strukturelle Mehrheiten gibt und diese ihre Entscheidungskompetenzen zur Unterdrückung der Minderheit nutzen. Einige Vorkehrungen gegen eine solche Diktatur der Mehrheit werden durch die Symbiose von Rechtsstaat, mit den Elementen Herrschaft des allgemeinen Gesetzes und einem Schutz gewährenden Katalog von gleichen Grund- und Menschenrechten, und Demokratie getroffen. Die rechtsstaatlichen Garantien gewährleisten zum einen den Einfluss der aktuellen Minderheit auf die Willensbildung der staatlichen Institutionen sowie auf die Willensbildung in der Gesellschaft und gerade darin steckt das Potenzial, selbst Mehrheit zu werden. Zweitens schaffen sie aber auch Freiräume, in denen Einzelne oder Gruppen ihre Vorstellungen vom guten oder richtigen Leben innerhalb der Legalität verwirklichen können, was Mehrheitsentscheidungen, denen das Individuum nicht zustimmt, für dieses zumindest akzeptabel macht. Bezeichnet man dies als demokratische Kultur, kann diese selbst dazu beitragen, den Zusammenhalt der Gesellschaft im obigen minimalistischen Sinne herzustellen. Ihre Voraussetzungen sind darum nicht weniger anspruchsvoll, aber es sind keine vorpolitischen Voraussetzungen in dem Sinne, dass sie jenseits der demokratischen Kultur bestehen müssen. Das Homogenitätspostulat gerät dann, insbesondere wenn man es ethnisch definiert, geradezu in Widerspruch zur demokratischen Kultur, weil ein monistisches Wir-Gefühl notwendig zur Unterscheidung von "Wir" und "Anderen" zwingt, und so über Ausgrenzungen strukturelle Minderheiten erzeugt werden. Das heißt es entstehen erst Minderheiten, denen die Chance genommen wird, Einfluss auf Entscheidungen zu gewinnen, potenzielle Mehrheit zu werden. Die Voraussetzungen der demokratischen Kultur werden so von der sich selbst abgrenzenden Mehrheit durchbrochen, mit der Gefahr, dass die Ausgegrenzten die Legalität aufkündigen. Die demokratische Kultur ist darauf angewiesen, dass es nicht ein ausschließendes und einheitliches Element der Erzeugung kollektiver Identitäten, ein monistisches Wir-Gefühl, gibt. Als solches wird aber die Herkunftsgemeinschaft als Schicksalsgemeinschaft konzipiert. Daneben dürfen und müssen geradezu unterschiedliche Anknüpfungspunkte für eine Wir-Identität bestehen. Das heißt, dass kollektive Identität auch für eine Person nicht ausschließend gedacht wird. Ein und dieselbe Person kann sich vielmehr gleichzeitig sehr unterschiedlichen Kollektiven zugehörig fühlen.[57] Sie kann etwa gleichzeitig ein kollektives Bewusstsein entwickeln als Gewerkschafter, Standardtänzer, "mir Kölsche" und Motorradfahrer. So verstanden bündeln WirGefühle kollektive Interessen und ermöglichen oder erleichtern zumindest deren Vertretung, Abstimmung und parteipolitische Bündelung. Es entsteht das Paradox, dass nicht ein monistisches Wir-Gefühl auf der Grundlage homogener Merkmale, sondern die Differenz und die Möglichkeit des Streites, d.h. der Konflikt und Institutionen seiner Artikulation und Austragung zur Voraussetzung der Demokratie werden. Der Zusammenhalt der Gesellschaft entsteht auf demokratischer Grundlage nicht durch Einheitlichkeit, die Ausscheidung von Differenz, sondern durch den zivilen Konflikt auf der Grundlage der Differenz, d.h. durch den Streit. Zusammenhalt entsteht dort wo miteinander geredet und gestritten wird.[58] Der Dauerstreit der demokratischen Öffentlichkeit ist auf der Ebene politisch-juridischer Institutionen die "eigentümliche Form, mittels derer moderne Gesellschaften ihren Zusammenhalt besorgen."[59] Über den Dauerstreit und dessen Austragung in zivilen Formen wird die demokratische Kultur dann Teil der sozialen Praxis, die selbst strukturbildend wirkt und die demokratische Kultur reproduziert. Damit werden die Voraussetzungen der Demokratie von der berechnenden Rücksichtnahme aktueller Mehrheiten auf potentielle Mehrheiten umgestellt auf ihre Re-Produktion durch eine demokratische Kultur, die demokratische Handlungsweisen strukturiert und generiert, gleichzeitig von diesen immer wieder neu produziert und strukturiert wird. Demokratische Kultur re-produziert sich als Teil der symbolischen Ordnung und der strukturellen Gegebenheiten einer politischen Einheit ebenso wie andere strukturelle Voraussetzungen. Sie bleibt damit prekär, was aber nicht durch unterstellte oder herzustellende vorpolitische Voraussetzungen vermieden werden kann. Normative Voraussetzung der Demokratie ist dann kein nationales Wir-Gefühl, keine ethnische Homogenität, sondern nur eine kollektive Identität als Demokraten. Und so schlecht ist es um diese in Europa - auch empirisch - nicht bestellt. Die europäische Einigung wurde sicher zum Erfolgsmodell, weil sie durch unterschiedliche Faktoren wie geschichtliche Erfahrung oder Vorteile eines erweiterten Marktes, die motivbildend wirkten, getragen wurde. Neuerdings, d.h. unter den Bedingungen der Globalisierung hat das demokratische Motiv eine nicht unerhebliche Bedeutung erlangt. Da die Gesellschaften der Nationalstaaten ihre Fähigkeit zur Selbststeuerung verloren haben, entwickelt sich die Hoffnung, in einem größer dimensionierten Raum wie Europa diese Fähigkeit zurück zu erlangen. Es könnte also wiederum die demokratische Idee sein, die eine territoriale Einheit erzeugt, die aber auf die nationale Homogenität verzichten kann. Zurück zum Seitenanfang [1] Schefold, D., Volk als Tatsache, Ideologie und politische Kultur, in: Bormann, A. v. (Hg.), Volk Nation - Europa, Würzburg 1998, S. 57 ff. [2] BVerfGE 89, S. 155/ 184 ff; Böckenförde, E.-W., Staat Nation Europa, Frankfurt 1999, S. 68/ 93; Grimm, D., Braucht Europa eine Verfassung?, München 1995, S. 36 ff; weitere Nachweise bei Schefold, a.a.O., S. 60 f. [3] Viehoff, R./ Segers, R.T. (Hg.), Kultur Identität Europa, Frankfurt 1999, passim. [4] Böckenförde, a.a.O., S. 93. [5] Hohe Relevanz hat der Begriff des Volkes, der nationalen, ethnischen Einheit schließlich in einer eher unappetitlichen politischen Diskussion und Praxis erhalten. In Jugoslawien konnte die Ideologie (Schefold, a.a.O., S. 62) der ethnische Einheitlichkeit dazu herhalten, den Staat auseinanderzusprengen, und sie veranlasste dessen ehemalige Bürger, sich gegenseitig brutale Gewalt anzutun. Nationale Identität dient in der Bundesrepublik seit mindestens einer Dekade neonazistischen Gewalttätern als Vorwand für rassistische Gewalttaten, die nicht erst neuerdings Todesopfer fordern. Demokratische Politiker postulieren über den Begriff der "deutschen Leitkultur" eine neue, nicht (mehr) vorhandene Einheitlichkeit und nehmen damit Ausgrenzungen billigend in Kauf. Ausgrenzungen, die sowohl "deutsche Subkulturen", wie Elemente von Kulturen anderen Ursprungs treffen kann. Um Missverständnisse auszuschließen: Es gibt keine Verbindungen oder Übergänge zwischen der angesprochenen Diskussion um die vorpolitischen Voraussetzungen der Demokratie und den zuletzt genannten Erscheinungen. Im Gegenteil, das sei betont, versuchen erstere das real existierende Phänomen nationaler Identität aufzugreifen und zu zivilisieren, indem die Anforderungen an das Wir-Gefühl niedrig gehalten und von ethnischen oder rassistischen Konnotationen befreit werden. Und die Negation der Existenz nationaler WirGefühle wird dem Phänomen nicht gerecht. Das zeigt das Beispiel Rosa Luxemburg, die allgemein den Internationalismus gegen das irrige Nationalbewusstsein beschwor, gleichzeitig aber gegen die Unterdrückung der polnischen Nation agitierte. [6] Neumann, F., Die Herrschaft des Gesetzes, Frankfurt 1980, S. 129 ff. [7] Vgl. etwa Kant, I., Metaphysik der Sitten, Rechtslehre § 46, A 166 ff; B 196 ff. [8] Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, zur bürgerlichen Gesellschaft §§ 189 ff; § 257: "Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee". [9] Hegel, a.a.O., § 268: "Die politische Gesinnung, der Patriotismus überhaupt, als die in Wahrheit stehende Gewissheit ... und das zur Gewohnheit gewordene Wollen ist nur Resultat der im Staate bestehenden Institutionen, als in welchem die Vernünftigkeit wirklich vorhanden ist...". [10] Vgl. zu den ideengeschichtlichen Entwicklungen um 1800: Giesen, B./ Junge, K., Vom Patriotismus zum Nationalismus. Zur Evolution der "Deutschen Kulturnation", in: Giesen, B. (Hg.), Nationale und kulturelle Identität, Frankfurt 1991, S. 255 ff. [11] Vgl. Herder, J. G., Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, in: ders., Werke in zwei Bänden Bd. 2, München 1953, S. 13 ff. [12] Fichte, J. G., Reden an die deutsche Nation, Leipzig 1944. [13] Vgl. Hobsbawn, E. J., Das imperiale Zeitalter, Frankfurt 1995 Kap. 6; eine ausführliche Beschreibung der Mechanismen der Nationenbildung in Italien, in ders., Die Blütezeit des Kapitals, Kap. 5 II. [14] Vgl. Anderson, B., Die Erfindung der Nation, Frankfurt/ New York 1996, passim, S. 44 ff. [15] Zitiert n. Roos, H., A History of Modern Poland, London 1966, S. 48. [16] Peter Glotz fasst das ironisch zuspitzend so zusammen: "Eine Nation ist eine Gruppe Menschen, die durch einen gemeinsamen Irrtum hinsichtlich ihrer Abstammung und eine gemeinsame Abneigung gegen ihre Nachbarn geeint ist" (Der Irrweg des Nationalstaates, Stuttgart 1990, S. 41). [17] Eder, K., Integration durch Kultur, in: Viehoff/ Segers, (Hg.), Kultur Identität Europa, a.a.O., S. 154. Eder entwickelt u.a. den interessanten Gedanken, dass die abendländisch, christliche Kultur, die neuerdings als Einheit und Leitkultur ins Gespräch gebracht wird, sich tatsächlich aus zwei sehr gegensätzlichen Traditionen synkretistisch zusammensetzt: der griechisch Tradition blutiger Opferrituale und eines extensiven Machtgebrauchs und der jüdisch-christlichen Tradition der "extensiven rituellen Beschränkung des Blutvergießens" und Machtverzichts (a.a.O., S. 155 ff). [18] Trotz der separatistischen Bewegungen eines Teils der französisch-sprachigen Minderheit, die sich eben nicht durchsetzen konnten, in Volksabstimmungen keine Mehrheit für die Abspaltung erhielten. Umgekehrt zeigt das Beispiel Italien und der Lega Nord, dass separatistische Tendenzen sich auch bei einheitlicher Sprache entwickeln können. [19] Schefold, Volk als Tatsache Ideologie und politische Kultur, a.a.O., S. 59. [20] Giesen, B., Die Intellektuellen und die Nation, Frankfurt 1993, passim, Eisenstadt, Sh. N./ Giesen, B., The Construction of Collective Identity, in: European Journal of Sociology 1995 (36(, S. 72 ff. [21] Dazu: Fisahn, A., Natur - Mensch - Recht, S. 291 ff. [22] Es macht wenig Sinn, die Existenz dieser Unterschiede zu negieren oder zu relativieren und sie nur als ideologische Vehikel sozialer Auseinandersetzungen zu begreifen. Die gesellschaftlichen Konflikte lassen sich eben nicht auf soziale Konflikte reduzieren und diese treten schon gar nicht "rein" auf. [23] Heine etwa verspottete das Nationalgefühl: Ich bin kein Römling, ich bin kein Sklav', Ein deutscher Esel bin ich Gleich meinen Vätern, sie waren so brav, So pflanzenwüchsig, so sinnig. O welche Wonne, ein Esel zu sein, Ein Enkel von lauter Langohren, Ich möcht' es von allen Dächern schrei'n: Ich bin als ein Esel geboren. Ich bin ein Esel und will getreu Wie meine Väter, die alten, An der alten lieben Eselei, Am Eseltume halten. [24] Balibar, E., Nation Gemeinwesen, Imperium, in: ders., Die Grenzen der Demokratie, Hamburg 1993, S. 124 ff. [25] Schefold, Volk als Tatsache Ideologie und politische Kultur, a.a.O., S. 58. [26] Münch, R., Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften, in: Heitmeyer, W. (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen?, Frankfurt 1997, S. 73; Ähnlich Brubaker, R., Staats-Bürger, Deutschland und Frankreich im historischen Vergleich, Hamburg 1994: "Die Franzosen verstehen ihre Nation als das Produkt des Staates, die Deutschen sehen ihre Nation als Basis des Staates an" (S. 238). [27] Böckenförde, E.-W., Demokratie als Verfassungsprinzip, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt 1991, S. 332 f. [28] Böckenförde, E.-W., Die Nation, Identität in Differenz, in: ders., Staat, Nation, Europa, a.a.O., S. 55. [29] Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, a.a.O., S. 314. [30] Ebenda, S. 333 f. [31] Ebenda, S. 359 f. [32] Böckenförde, Die Nation, Identität in Differenz, a.a.O., S. 66. [33] Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, a.a.O., S. 314. [34] Böckenförde, Die Nation, Identität in Differenz, a.a.O., S. 67. [35] Assimilationsanforderungen, wie sie in der abgeschmacktesten Form gegenwärtig im politischen Diskurs als Forderung der Anpassung an ein "deutsche Leitkultur" von der Fraktionsspitze der CDU/CSU erhoben werden. Dabei verleitet dieser Begriff zu zynischen Bemerkungen: Was ist gemeint? Pöbelnd grölende Fußballfans, die sich an jeder Ecke öffentlich vom übermäßigen Biergenuss erleichtern? Sind hier übergewichtige Volksmusiker gemeint oder dürre Punker; volltrunkene Stammtischbrüder oder wasserstoffblonde Berufstöchter; koksende Bundestrainer oder kiffende Rastafaris astreiner deutscher Herkunft; exhibitionistische Swingerpärchen oder katholische Jungfrauen; selbstherrliche Konsumprotzer oder asketische Veganer; Dynamische Karrierefrauen oder hauptberufliche Ehefrauen? Oder müssen sich all diese Gruppen noch assimilieren, "deutsch normalisiert" werden? [36] "Traditionsbewusst" bedeutet in diesem Kontext praktisch, dass man das Abstammungsprinzip bei der Bestimmung der Staatsangehörigkeit beibehält - aber es wird eben durch die unkomplizierte Einbürgerung von Migranten durchbrochen. [37] Dieses beschreibt Marx so: "Der umfassende Widerspruch aber dieser Konstitution (der demokratischen Verfassung A.F.) besteht darin: Die Klassen, deren gesellschaftliche Sklaverei sie verewigen soll, Proletariat, Bauern, Kleinbürger, setzt sie durch das allgemeine Stimmrecht in den Besitz der politischen Macht. Und der Klasse, deren alte gesellschaftliche Macht sie sanktioniert, der Bourgeoisie, entzieht sie die politischen Garantien dieser Macht. Sie zwängt ihre politische Herrschaft in demokratische Bedingungen, die jeden Augenblick den feindlichen Klassen zum Sieg verhelfen und die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft selbst in Frage stellen. Von den einen verlangt sie, daß sie von der politischen Emanzipation nicht zur sozialen fort-, von den anderen, daß sie von der sozialen Restauration nicht zur politischen zurückgehen"(Klassenkämpfe in Frankreich, MEAW S. 47 f). [38] Heller, H., Politische Demokratie und soziale Homogenität, in: ders., Gesammelte Schriften Bd. II, S. 421 ff; Neumann, F., Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung, in: ders., Wirtschaft, Staat, Demokratie, Frankfurt 1978, S. 57 ff. [39] Kirchheimer, O., Weimar - und was dann?, in: ders., Politik und Verfassung, Frankfurt 1981, S. 56; Rosenberg, A., Demokratie und Sozialismus, Frankfurt 1988, passim. [40] Lenin, W.I., Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, (1913), in: Lenin, Ausgewählte Werke Bd. II, Berlin 1988, S. 358 f. Und er nahm ein aktuelles europäisches Problem gleichsam vorweg: "Wenn jegliche Privilegien wegfallen, wenn keine der Sprachen mehr aufgezwungen wird, dann werden alle Slawen einander leicht und schnell verstehen lernen und nicht vor dem 'furchtbaren' Gedanken zurückschrecken, dass im gemeinsamen Parlament Reden in verschiedenen Sprachen zu hören sein werden" (a.a.O., S. 357). [41] Hier muss nicht thematisiert werden, inwieweit sich der Stalinismus mit Lenins Verständnis der "Diktatur des Proletariats" deckte oder diesen pervertierte und inwieweit dieser Begriff im Widerspruch zur Forderung nach "konsequentem Demokratismus" stand. [42] Aber diese Homogenisierung hat bekanntlich nicht funktioniert, so erweist sich Lenin als weitblickend. Schon vor den zentralen kriegerischen Auseinandersetzungen in Jugoslawien warnte Glotz, die Idee des völkisch homogenen Nationalstaates auf Osteuropa zu importieren. Der Nationalstaat sei für Osteuropa keine Lösung, da dort zu viele Völker "durcheinander siedelten". Krieg und Vertreibung wären erneut seine Konsequenz. Glotz empfiehlt darum Demokratisierung bei gleichzeitiger Föderalisierung, d.h. Übertragung autonomer Rechte auf die Regionen (Der Irrweg des Nationalstaates, S. 22 ff). [43] Schmitt, C., Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin 1926, S. 13 f. [44] Schmitt, a.a.O., S. 18. [45] Schmitt, a.a.O., S. 14. [46] Schmitt, a.a.O., S. 18. [47] Böckenförde, E.-W., Die Nation, Identität in Differenz, in: ders., Staat, Nation, Europa, a.a.O., S. 58. [48] Scharpf, F., Demokratie n der transnationalen Politik, in: Beck, U. (Hg.), Politik der Globalisierung, Frankfurt 1998, S. 232. [49] Offe, C., Demokratie und Wohlfahrtsstaat, in: Streeck, W. (Hg.) Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie, Herausforderungen für die Demokratietheorie, Frankfurt 1998, S. 129. [50] Münch, Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften, in: Heitmeyer, W. (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen?, a.a.O., S. 72; ähnlich Norbert Elias: "Nationalstaaten sind, so könnte man sagen, in Kriegen und für Kriege geboren" (Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt 1991, S 277). [51] Kant, I., Zum ewigen Frieden, in: ders., Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie Ethik und Politik, Hamburg 1973, S. 115 ff. [52] Habermas, J., Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie, in: ders., Die postnationale Konstellation, Politische Essays, Frankfurt 1998, S. 152 f. [53] Jürgen Habermas meint zwar, dass das Nationalbewusstsein als Grundlage staatsbürgerlicher Solidarität ausgespielt habe und auf einen Verfassungspatriotismus umgestellt werden müsse. Denn Multikulturalismus und Individualisierung "nötigen dazu, die Symbiose des Verfassungsstaates mit der 'Nation' als einer Herkunftsgemeinschaft aufzukündigen, damit sich auf abstrakterer Ebene die staatsbürgerliche Solidarität" erneuern könne (a.a.O., S. 128). [54] Vgl. einen etwas ausführlicheren Überblick bei Münch, Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaften, in: Heitmeyer, (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen?, a.a.O., S. 66 ff. [55] Böckenförde, vgl. Zitat Fn. 47. [56] Kant definiert: "Man nennt die bloße Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung einer Handlung mit dem Gesetze, ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben, die Legalität (Gesetzmäßigkeit); diejenige aber, in welcher die Idee der Pflicht aus dem Gesetze zugleich die Triebfeder der Handlung ist, die Moralität (Sittlichkeit) derselben." (Metaphysik der Sitten, AB 15); vgl. auch: Dreier, R., Zur Einheit der praktischen Philosophie Kants, in: ders., Recht - Moral - Ideologie, Frankfurt 1981, S. 290. [57] Elias, Die Gesellschaft der Individuen, S. 270 ff; Graumann, C. F., Soziale Identitäten. Manifestationen sozialer Differenzierung und Identifikation, in: Heitmeyer, a.a.O., S. 59 ff. [58] Eder, K., Integration durch Kultur? Das Paradox der Suche nach einer europäischen Identität, in: Viehoff/ Segers (Hg.), Kultur Identität Europa, a.a.O., S. 162 ff. [59] Dubiel, H., Unversöhnlichkeit und Demokratie, in: Heitmeyer (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen, a.a.O., S. 439.