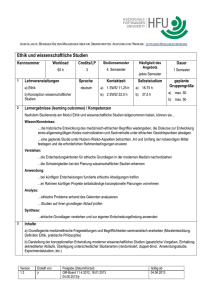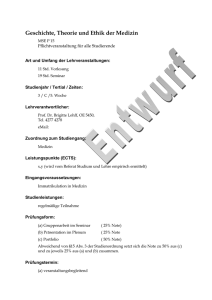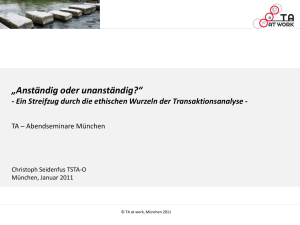Einführung in die Ethik
Werbung

Katholische Hochschule Freiburg WS 2014/15 Skript zum Seminar Einführung in die Ethik Fach: 1.1.1 Philosophie und Ethik Studiengänge: BA Pflege-/Berufspädagogik (PPB/BVB/BBB) BA Management im Gesundheitswesen (MGB/MBB/MVB) Zu erbringende Leistung: Leitung: Hausarbeit Daniel Bremer M.A. Kirchenackerweg 23 CH-8050 Zürich [email protected] http://ethik-pflegen.ch Tel. ++41(0) 44 311 69 19 [Dieses Skript ist online abrufbar auf http://ethik-pflegen.ch unter der Rubrik Aktuelles bis 30.Januar 2015] Daniel Bremer 2014 Inhalt 1. Einführung 1.1 Einige Ziele des Seminars 1.2 Allmähliche Erarbeitung eines persönlichen Glossars 1.3 Vier Arten von Aussagen in ethischen Diskursen 1.4 Was sind "Werte“? 1.5 Wertehierarchie oder Werterelativismus? 1.6 Wo kommen Werte her? 1.7 Sind Werte überzeitlich gültig oder veränderbar? 1.8 Wertanalyse: Geltung und Wert 1.9 Werden Werte gefunden oder erfunden? 1.10 Was sind moralische Werte? 1.11 Normen 1.12 Ist jede Handlung moralisch? "Richtige" vs. "gute" Handlung 1.13 Kombinatorische Methoden zur Handlungs- und Fallanalyse 1.14 Drei Grundpositionen der philosophischen Ethik 4 6 7 8 10 10 11 14 14 16 16 17 20 21 22 2. Der Utilitarismus 2.1 Utilitarismus und Pflegeethik 2.2 Varianten utilitaristischer Theorien 2.3 Der Handlungsutilitarismus 2.4 Der Regelutilitarismus 2.5 Der Präferenzutilitarismus 2.6 Der negative Utilitarismus 2.7 Verantwortungsethik 2.8 Probleme utilitaristischer Ansätze 2.8 Literatur zum Utilitarismus 23 24 27 27 27 29 30 31 31 36 3. Die Deontologische Ethik 3.1 Der handlungsdeontologische Ansatz 3.2 Der regeldeontologische Ansatz 3.3 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 3.4 Sir William David Ross: Tatsächliche und prima facie Pflichten 3.5 Deontologische Ansätze in der Pflegeethik 3.6 Vor- und Nachteile deontologischer Ansätze 3.7 Literaturhinweise 37 38 39 39 44 45 45 48 4. Die Tugendethik 4.1 Vorüberlegungen zum Begriff der "Tugend" 4.2 Tugendethische Ansätze 4.3 Gemeinsame Aspekte solcher Ansätze 4.4 Alasdair MacIntyre: Tugenden der anerkannten Abhängigkeit als Basis für einen tugendethischen Ansatz in der Pflegeethik 4.5 Anwendung für die Pflegeethik 4.6 Vor- und Nachteile von Tugendethiken 4.7 Literaturhinweise 49 49 50 53 5. Ethischer Diskurs in ethischen Kommissionen und Komitees 5.1 Wider den Methodenpositivismus 5.2 Methoden im Diskurs 5.3 Modelle ethischer Entscheidungsvorbereitung 5.4 Ethisches Argumentieren, ethische Rhetorik 5.5 Macht und Ohnmacht im Diskurs 5.6 Ethische Kompetenzen 5.7 Umgang mit ethischem Fachwissen 5.8 Thematische Begriffsvertiefungen 59 59 60 65 73 79 93 96 99 54 56 56 58 2 6. Ethischer Diskurs: Organisationsformen 6.1 Ethische Kommissionen und Komitees, ethische Konzilien 6.2 Das ethische Café 6.2.1 Struktur, Konstitution, Ablauf, Teilnehmer 6.2.2 Moderation 6.2.3 Institutionalisierung 6.2.4 Themen 6.2.5 Funktion, Leistungsfähigkeit und Grenzen 6.3 Deinstitutionalisierte Formen angewandter Ethik 102 102 104 106 109 110 113 114 115 7. Weitere ethische Ansätze 7.1 Angewandte Ethik in der Pflege 7.2 Gerontologische Ethik 7.3 Aspekte performativer Ethik 7.4 Narrative Ethik 7.5 Problembasierte Ethik 117 117 118 132 134 135 8. Schlüsselbegriffe und Probleme moderner Ethik 8.1 Verantwortung 8.2 Würde 8.3 Autonomie 149 149 153 161 9. Anstelle eines Schlusswortes: Mut zur Ethik! 167 10. Anhang 10.1 Allgemeiner Tugendkatalog 10.2 Vormoderner Tugendkatalog 10.3 Aristotelischer Tugendkatalog 10.4 Tugendkatalog nach William K. Frankena (1963) 10.5 Aus der deontischen Logik 10.6 Ethische Theorien 10.7 Ethische Fallanalyse 168 168 169 170 171 172 173 174 11. Literaturliste zur Lehrveranstaltung 177 Vorwort Das vorliegende Skript ist aus den Lehrveranstaltungen „Ethische Kommissionen und Komitees“ an der Katholischen Fachhochschule in Freiburg i. Brsg. In dem Sommersemestern 2002 bis 2004, die von Prof. Dr. E. Heusler und D. Bremer M.A. gemeinsam gehalten wurden, entstanden. Auf das Sommersemester 2005 wurde es um einige Kapitel erweitert und ist als work in progress in weiterem Wachstum begriffen. Für allfällige Fehler oder Ungereimtheiten liegt die alleinige Verantwortung beim Autor, für kritische Hinweise, Ergänzungs- und Erweiterungsvorschläge besteht in philosophischen Ohren immer Gehör. Das Skript allein ist wertlos, die Lektüre müßig – wenn nicht Ethik im Sinne angewandter Philosophie betrieben wird, zu deren erwünschtem Vollzug im Berufsalltag von weiblichen wie männlichen Pflegemanagern und Pflegepädagogen dieser Papierhaufen allenfalls eine erste Orientierung oder eine Basis zur Reflexion zu bieten vermag. Zürich, 13.10.2014 D. Bremer 3 1. Einführung Wer die Frage nach dem Wesen oder der Definition von "Ethik" stellt, wird in einschlägigen Ethikbüchern und Lexika überfündig. Hier drei Definitionen aus Pflegeethikbüchern zur Auswahl: "Ethik ist angewandte Philosophie. Sie sucht nach Antworten auf die Fragen: Wie soll der Mensch sein Leben gestalten? Wie soll er sich gegenüber seinen Mitmenschen verhalten? Welchem Ziel soll sein Handeln dienen? Die Ethik lehrt, die jeweilige Situation zu beurteilen, um das ethisch richtige Handeln zu ermöglichen. Die ethische Überlegung hat zum Ziel, unser Handeln mit unseren Werten in Einklang zu bringen."1 "Ethik (griech. "ethos", Sitte) ist eine Disziplin der Philosophie, die auch als Wissenschaft vom moralischen Handeln bezeichnet und als Synonym von Moralphilosophie gesehen wird." 2 "Ethisch bedeutet in der Übersetzung des griechischen Wortes "ethos" zunächst den durch Gemeinschaft und Herkommen bestimmten Ort des Wohnens, Gesinnung, Haltung. Übertragen auf heutige Verhältnisse heisst das, dass sich Ethik mit allem befasst, was im Rahmen des gemeinsamen Wohnens bzw. Lebens Brauch und Sitte ist und somit auch die Einstellung und Gesinnung der Einzelpersonen mitbestimmt." 3 Allen Definitionen ist eigentümlich, dass sie gewisse Aspekte einer immer komplexer werdenden philosophischen Disziplin anschneiden. Die Steigerung der Komplexität ethischer Diskurse hat ihren Sachgrund in der gesteigerten Komplexität der realen Verhältnisse und unserer hypothetischen Kenntnisse von ihnen. Um Komplexität und die damit verbundenen Orientierungsschwierigkeiten in ethischen Fragestellungen zu reduzieren und in einem positiven Sinne zu kompensieren, schlage ich vor, einige zentrale Grundpositionen ethischer Theorien zu behandeln, jene Grundpositionen, die für viele spezielle Pflegeethikmodelle Pate standen. Hinweise auf diese Grundpositionen finden sich bereits in der Etymologie des Begriffs "Ethik", der ursprünglich vier Grundbedeutungen hatte: Das griechische "Ethos" gab es in zwei Varianten mit vier Bedeutungen: 1. äthos 2. ethos etho a) gewöhnlicher Aufenthaltsort, Wohnort, Weideplatz, feste Bleibe, Stall, Höhle, Asyl b) Gewohnheit, Sitte, Brauch c) Charakter, Sinnesart, d) Denkweise, Gesinnung, Haltung Gewohnheit, Sitte, Brauch gewohnt sein, pflegen Der Disziplinentitel "Ethik" leitet sich ursprünglich von diesen zwei Varianten ab. "Ethos" als Brauch, Sitte bedeutet: Wer durch Erziehung daran gewöhnt worden ist, sein Handeln an dem, was Sitte ist, was im antiken Stadtstaat, in der Polis Geltung hat und sich daher ziemt, auszurichten, der handelt "ethisch". Im engeren Sinn ethisch handelt jedoch derjenige, der überlieferten Handlungsregeln und Wertmaßstäben nicht fraglos folgt, sondern es sich zur Gewohnheit macht, aus Einsicht und 1 Aus: Ethische Grundsätze für die Pflege. Hg. vom Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Bern 1990 (Nachdruck 2000), S. 15. 2 Schayck, A. van: Ethisch handeln und entscheiden. Spielräume von Pflegenden und die Selbstbestimmung des Patienten. Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 15. 3 Plenter, Christel: Ethische Aspekte in der Pflege von Wachkoma-Patienten. Orientierungshilfen für die Pflegeethik. Hannover 2001, S. 75. 4 Überlegung das jeweils erforderliche Gute zu tun. Das ethos wird dann zum äthos = Charakter; es verfestigt sich zur Grundhaltung der Tugend. Später wird das lateinische mos (Plural: mores) als Übersetzung beider Varianten verwendet und bedeutet daher sowohl Sitte als auch Charakter. Von mos leitet sich wiederum das deutsche Wort Moral her, das ein Synonym für Sitte ist. Zur Moral oder Sitte "werden jene - aus wechselseitigen Anerkennungsprozessen in einer Gemeinschaft von Menschen hervorgegangenen und als allgemein verbindlich ausgezeichneten - Handlungsmuster zusammengefasst, denen eine normative Geltung zugesprochen wird."4 Moral / Sitte entsprechen mehr dem, was mit ethos gemeint ist: Handlungsanweisungen oder Sollenssätze, Regeln, deren Befolgung zum Gebot erhoben wird und deren ordnungsmäßige Befolgung noch kein Garant für die moralische Qualität bildet. Moral und Sitte bezeichnen mithin Ordnungsgebilde, die gewachsene Lebensformen repräsentieren, Lebensformen, die die Wert- und Sinnvorstellungen einer Handlungsgemeinschaft widerspiegeln. Moralität / Sittlichkeit entsprechen mehr dem, was mit äthos gemeint ist: Die Qualität des Handelns, das sich einem unbedingten Anspruch (dem Guten) verpflichtet weiß. Moralität / Sittlichkeit sind Prinzipienbegriffe: Was aus Moralität geschieht, gilt zu Recht als moralisch, auch wenn eine Handlung im Grenzfall gegen Normen einer faktisch geltenden Moral verstößt. Moralität kann gefasst werden als das "zur festen Grundhaltung gewordene unbedingte Gutseinwollen, das sich den unbedingten Anspruch der Freiheit zu eigen und zum Sinnhorizont jedweder Praxis macht. Wer aus dieser Grundhaltung heraus handelt, besitzt moralische Kompetenz."5 Moralisch / sittlich: Die Adjektive dagegen sind doppeldeutig. Wenn eine Handlung als moralisch/sittlich beurteilt wird, so heißt dies entweder: sie folgt einer Regel der geltenden Moral/Sitte; oder: sie hat ihren Grund in der Moralität/Sittlichkeit des Handelnden. Wenn Sie also von jemandem sagen, er sei ein unmoralischer Mensch, so meinen Sie entweder, sein Verhalten entspreche nicht dem von den meisten anerkannten Moralkodex, oder aber, er habe einen verdorbenen Charakter. Ethisch: Umgangssprachlich wird dieses Adjektiv häufig synonym mit moralisch/sittlich gebraucht: man spricht von ethischen Handlungen, ethischen Ansprüchen, ethischen Normen etc. Um jedoch die verschiedenen Reflexionsniveaus von vorneherein bereits sprachlich scharf gegeneinander abzugrenzen, ist man in der gegenwärtigen Ethikdiskussion dazu übergegangen, den Titel Ethik wie auch das Adjektiv ethisch ausschließlich der philosophischen Disziplin vom moralischen/sittlichen Handeln des Menschen vorzubehalten6. 4 Pieper, Annemarie: Einführung in die Ethik. Hagen 1993, Ke 1, S. 7. Pieper, A.: a.a.O. S. 17. 6 Vgl. Patzig, Günther: Ethik ohne Metaphysik, Göttingen 1971, S. 3.; und Pieper, A.: a.a.O., S. 8. 5 5 1.1 Einige Ziele des Seminars In den folgenden Seminarblöcken soll aus philosophischer Perspektive versucht werden, "Ethik" als eine periodische Tätigkeit aktiver Reflexion für den Bereich der Pflege fruchtbar zu machen. Ein Ziel wird dann erreicht, wenn die ethischen Überlegungen anhand von Konfliktfällen und moralischen Dilemmata und anhand ethischer Theorieelemente soweit gediehen sind, dass sie in Form eines "mentalen Modells" neuronal etabliert und situativ in wechselnden Kontexten reaktiviert und für ethische Diskurse im Team von Pflegenden, Ärzten, Patienten und Angehörigen gewinnbringend genutzt werden können. Der Boden, von dem aus sich ethische Überlegungen erheben, ist hierbei als ein nicht gesicherter oder nur bedingt stabilisierbarer anzusehen: Bei dem philosophischen Nachfragen nach der "eigentlichen" Bedeutung gewisser Begriffe wird schnell feststellbar, dass es diese eigentliche Bedeutung immer nur bezüglich gewisser selbst schwer zu begründender Ausgangspunkte gibt. "Ethik" werden wir somit nicht als ein feststehendes Denkgebäude auffassen, wie dies etwa die Entwicklung der pflegerischen Ethikkodizes im 20. Jahrhundert nahezulegen scheint, sondern eher als fortwährendes prozedurales Konstituens pflegerischer Tätigkeit, die sich personal und interpersonal im täglichen Handeln, in reflexiven Zwischenphasen und in Ethikkomitees oder krankenhausinternen Ethikcafes vollzieht. Selbstredend gibt es zahlreiche limitierende Faktoren, die dem sich vollziehenden Wandel im Berufsbild der Pflegenden vermehrt zeigen, wie fehlende Zeit, Spannungen im Pflegeteam, strukturelle und personale Machthierarchien, unterschiedliche Tagesformen der Beteiligten, unvorhergesehene Zwischenfälle, mangelnde ethische Kompetenz, Verschlossenheit, etc. Dennoch sollte man im Auge behalten (und dies ist bereits ein Argument aus Sicht einer teleologischen Ethik), dass gelingende ethische Diskurse zu einer Optimierung konfliktträchtiger Situationen und darüber hinaus ein Movens für den weiteren Motivationsverlauf im Pflegeberuf darstellen (man denke an das Burnout-Syndrom unter Pflegenden). Wenn "Ethik" in Pflegeberufen angewandt werden soll, dann sollte dies derart regelmäßig und intensiv geschehen, dass sich die ethisch-moralische Kompetenz der Auszubildenden und Ausgebildeten fortwährend entwickelt. Diese bedingte Notwendigkeit sollte individuell so einsichtig gemacht werden können, dass sich ethische Reflexion nicht etwa nur aus bloßer Pflichtgemässheit oder Regelbefolgung Kraft des jeweiligen Berufsethos ergibt, sondern aus persönlich begründbarer und intersubjektiv nachvollziehbarer Prüfung erhebt. Voraussetzung dazu ist nicht ein deklarativ abrufbares "Wissen" über ethische Theorien oder Fehlschlüsse, sondern ein Bewusstsein über die Aktivierbarkeit mentaler Modelle, die sich aus ethischen Reflexionen etabliert haben. Solches "Wissen" ist ein prozedurales Wissen, das sich auch dann aktivieren lässt, wenn die einstmals damit erlernte Terminologie längst in Vergessenheit geraten ist. Ein weiteres Ziel der Auseinandersetzung mit den folgenden Theorieelementen aus Ethik, Logik und weiteren verwandten Disziplinen der Philosophie ist also nicht eine umfassende oder auf Vollständigkeit angelegte Kenntnis derselben, sondern vielmehr die eigene vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen Elementen, die dafür gründlich reflektiert, diskutiert und auf ihre praktische Relevanz im Pflegealltag, im Bereich des Pflegemanagements und der Pflegepädagogik hin überprüft und weiterentwickelt werden sollen. 6 1.2 Allmähliche Erarbeitung eines persönlichen Glossars Um die für die Ethik der Pflege grundlegenden traditionellen Ansätze der Ethik für deren Bedürfnisse fruchtbar machen zu können, ist es vorab nötig, sich einige Grundbegriffe zu erarbeiten und fortwährend zu erweitern und zu überprüfen. Machen Sie sich dies zur Gewohnheit, knöpfen Sie sich von Zeit zu Zeit einen Begriff vor, der Sie beschäftigt und gehen Sie ihm so weit als möglich auf den Grund. Einige Grundbegriffe der Ethik: Ethik, Moral, Moralprinzip, ethisches Prinzip, moralische Regel, Maxime, Ethos, Sitte, Sittlichkeit, Wert, Norm, Pflicht, Gesetz, Gesinnung, Gebieten - Sollen - Erlauben - Verbieten, Gut/Schlecht, Glück, Freiheit, Verantwortung, Gewissen, Gefühle, Tugend, Nützlichkeit, Wille, Autonomie, Prinzipien, Dilemma, moralische Urteile, Geltung, Wahrheit, Menschenbild, ... Auftrag: Erarbeiten Sie Sich im Laufe des Seminars und darüber hinaus Ihr persönliches Glossar derjenigen Fachtermini, Begriffe, Grundsätze und Argumentationsschemata, die Sie jeweils für sinnvoll, d.h. theoretisch reflektiert und ggf. für praktisch anwendbar halten. Verwenden Sie dazu etwa Karteikarten, um sich vor anstehenden Teamgesprächen oder pflegepädagogischen Aktivitäten über ethisch anstehende Problemfälle zu reinformieren. Lexika: Düwell M. / Hübenthal Ch. / Werner M. H. (Hg.): Handbuch Ethik. Stuttgart, Metzler, 2002. Höffe, Otfried (Hrsg.): Lexikon der Ethik. München, Beck, (6) 2002. 7 1.3 Vier Arten von Aussagen in ethischen Diskursen In der Ethik ist es sinnvoll, vier Arten von Aussagen zu unterscheiden: Moralische Aussagen: Sind normative (wertende) Sätze, die singuläre oder allgemeine Gebote und Werturteile beinhalten, die in der Alltagspraxis mit dem Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit auftreten und zu einem bestimmten Handeln auffordern. Beispiele: Du musst hier und jetzt diesem Patienten die Wahrheit sagen, um schlimmere Folgen zu verhüten. Ehrlich währt am längsten. Kein Patient soll wegen seines Glaubens diskriminiert werden. Metamoralische Aussagen: Sind deskriptive (beschreibende) Sätze, vermittels derer nicht zu einem Handeln aufgefordert wird, sondern tatsächliche moralische oder moralisch relevante Verhaltensweisen unter Einhaltung eines persönlichen moralischen Urteils beschrieben, analysiert, rekonstruiert, erklärt werden. Beispiele: Pflegeleiter A glaubte, Pflegerin B habe richtig entschieden. Unter Pflegerinnen gilt Fürsorge als anstrebbarer Wert. Ethische Aussagen: Sind normative Sätze zweiter Ordnung, die nicht unmittelbar zu einem Handeln auffordern, sondern auf einen Maßstab zur Beurteilung der Moralität von Handlungen rekurrieren und insofern generell zu einer kritischen Würdigung vor jedwedem Handeln auffordern. Beispiele: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Es soll immer und überall Freiheit um der Freiheit willen realisiert werden. Metaethische Aussagen: Sind deskriptive Sätze zweiter Ordnung, vermittels derer keine Handlungen, sondern ethische Theorien und Systeme beschrieben, analysiert, rekonstruiert, erklärt und unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten beurteilt werden. Beispiel: Die utilitaristische Ethik behauptet das Prinzip der Nützlichkeit als Moralkriterium, gerät aber in Schwierigkeiten, wenn es darum geht, den für alle Betroffenen größtmöglichen Nutzen aus den möglichen Folgen einer Handlung quantitativ exakt zu ermitteln. 8 Übung Die folgenden vierzehn Sätze enthalten a) b) c) d) moralische, metamoralische, ethische, metaethische Aussagen. Ordnen Sie die Sätze bitte entsprechend, und erläutern Sie Ihre Entscheidung für die Aussagetypen a bis d jeweils an einem Beispielsatz. 1. Niemand soll wegen seiner Hautfarbe diskriminiert werden. 2. Die Aristotelische Tugendethik orientiert sich an den Tugenden der Mitmenschen. 3. Um der Humanität willen ist das Gute zu tun und das Böse zu lassen. 4. Es ist jedem Menschen zuzumuten, dass er sein Handeln rechtfertigt, d.h. durch Rekurs auf Gründe, die jedermann als gut einzusehen vermag, in seiner Vernünftigkeit ausweist. 5. Wer sich leichtsinnig in Gefahr begibt, ist selbst schuld, wenn ihm etwas Schlimmes zustößt. 6. Die jüdische Medizinethik basiert auf dem Prinzip, dass menschliches Leben Heiligkeit sowie unantastbaren und unendlichen Wert besitzt. 7. Menschliches Leben muss grundsätzlich geschützt werden. 8. Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. 9. Die befreiende Wirkung des Zuspruchs der Menschenwürde liegt darin, dass sie unverfügbar ist und so jedem Menschen mit den Menschenrechten Schutz garantiert. 10. Auch wenn der Personenstatus erst mit der Geburt beginnt, ist ungeborenes Leben im Mutterleib dennoch zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung als menschliches Leben zu betrachten und mit entsprechendem Respekt zu behandeln. 11. Nach Amnesty International werden fast auf der ganzen Welt politische Häftlinge gefoltert. 12. Unterscheide stets zwischen Individualwürde und Gattungswürde! 13. Tugendethiken sind im Bereich der Pflegeethik im Aufwind. 14. Fürsorgegebote sind sinnvoll, weil sie praktisch verwirklichbar sind. 9 1.4 Werte Zentrale und grundlegende Elemente jeden ethischen Bemühens sind Werte. Herauszufinden, was Werte überhaupt sind, woher sie stammen, wie sie als mentale Konzepte funktionieren und welche Werte für welche Zusammenhänge relevant sind, ist Aufgabe der Werttheorie (Axiologie) innerhalb der philosophischen Ethik. Was sind Werte? Hier zwei Definitionsversuche: "Unter Werten versteht man die bewussten oder unbewussten Orientierungsstandards und Leitvorstellungen, von denen sich Individuen und Gruppen bei ihrer Handlungswahl leiten lassen."7 "Ein Wert ist ein lohnender oder wünschenswerter Maßstab oder eine Qualität. Werte können in der Alltagserfahrung eines jeden Menschen leicht erkannt werden. Sie können in Sprache ausgedrückt werden, in Verhaltensweisen oder durch Verhaltensmaßstäbe, die eine Person vertritt und die sie aufrechtzuerhalten versucht."8 Definitionsversuche dieser Art motivieren die Leser dazu, sich auf die Suche nach und die Beschreibung von "Werten" zu machen. Was aber "Werte" sind und wie und ob sie erkannt werden können, müsste zunächst geklärt werden. 1.5 Wertehierarchie oder Werterelativismus? Eine grundlegende Unterscheidung, die schon von Aristoteles gemacht wurde, ist die Frage, ob alle Werte gleichwertig sind, oder doch eine Hierarchie der Werte besteht. Hat erstere Position als Wertrelativismus den Vorteil, interkulturell die je geltenden Wertvorstellungen zu achten und zu tolerieren, bringen Wertkonflikte in konkreten Dilemmasituationen eher zum Ausdruck, dass eine Werthierarchie besteht. Für die Ethik im Sinne angewandter Philosophie ergibt sich die Frage: Welches sind die Legitimationsgrundlagen für Werthierarchisierungen? Um hier nur ein Problem anzudeuten: Betrachtet man die Unterteilung von Handlungen in instrumentell richtige/falsche und moralisch gute/schlechte, so argumentieren etwa die utilitaristischen Vertreter so, dass sie nennbare und abschätzbare Handlungsfolgen bereits als moralische Güter einstufen. So wäre das Gelingen einer therapeutischen Intervention bereits ausreichend für moralische Güte. Nicht so deontologische oder tugendethische Ansätze: Hier braucht es zusätzliche Eigenschaften, die eine Handlung als moralisch gut ausweisen können. Während die Utilitaristen konkret wahrnehmen, messen und benennen können, was sie als gut bewerten (etwa minimale Kosten bei maximalem Gesundheitsertrag), gestaltet sich der Rekurs auf die unbedingte Geltung bestimmter Prinzipien (etwa Verteilungsgerechtigkeit oder Tugend) ungleich schwieriger. 7 8 Höffe, Otfried (Hrsg.): Lexikon der Ethik, München (6) 2002, Artikel "Wert", S. 290. Omery, A.: Values, moral reasoning and ethics. Nurs Clin N Amer 24 (2), S. 499-508. 10 1.6 Wo kommen Werte her? Von "Werten" wird in zahlreichen ethischen Schriften, allen voran etwa die Ethikkodizes für die Krankenpflege (ICN etc.) gesprochen. Wo aber kommen sie her? Woran sind sie zu erkennen? Sind "Werte" einzelne Begriffe? Oder können auch Prinzipien bzw. Maximen (z.B. "Bleibe deinen Verpflichtungen treu!") zu den "Werten" gezählt werden? Oder könnte man gar einen ganzen ethischen Ansatz (eine Theorie) als "Wert" taxieren? Wer nach der "Quelle" von Werten fragt, hat verschiedene Rekursmöglichkeiten. In der Alltagssprache finden sich verschiedene Beispielsätze aus der Berufspraxis, in denen Handlungen als moralisch wertvoll / nicht wertvoll unter Angabe verschiedener Wertquellen zu stützen versucht wurden: Rekurs auf ein Faktum: „Der Patient ist zufällig ohnehin gestorben. Somit erübrigt sich der ethische Diskurs über das Dilemma künstlicher Lebenserhaltung.“ Rekurs auf Gefühle: „Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Vorgehen. Deshalb schlagen wir doch den anderen Weg ein.“ Rekurs auf mögliche Folgen: „Es bringt den meisten Betroffenen mehr, wenn wir auf lebenserhaltende Maßnahmen verzichten.“ „Es ist Kosten sparender und wird die Lebensqualität des Patienten beträchtlich steigern, wenn hier eine Operation vorgenommen wird.“ „Wenn wir dies tolerieren, dann öffnet das der Willkür der Forschungsfreiheit Tür und Tor.“ Rekurs auf Wertmaßstab: „Die christliche Nächstenliebe gebietet, dass ich jedem auch noch so aussichtslos kranken Menschen beistehe – sogar entgegen dessen Willen.“ „Der hippokratische Eid gebietet, Leben in jedem Fall zu erhalten.“ „Die Menschenwürde ist ein unbedingt gebietender Wert der Menschenrechtskonvention und darf hier nicht verletzt werden.“ Rekurs auf moralische Kompetenz: „Der nationale Ethikrat hat ja ohnehin auch gesagt, dass Leben gefunden und nicht gemacht wird. Deshalb ist es moralisch gut, kein Leben zu patentieren.“ Rekurs auf das Gewissen: „Obwohl der ethische Diskurs mir zu dieser Lösung rät, kann ich sie mit meinem Gewissen doch nicht vereinbaren.“ Rekurs auf Autorität: „Der Oberarzt meint, dass es moralisch besser sei, in diesem Fall der Natur ihren Lauf zu lassen und meine Mutter sterben zu lassen. Er muss es ja wissen, schließlich ist er Oberarzt.“ 11 „So machen wir das jetzt. Punkt und Ende der Diskussion.“ Rekurs auf Empörung: „Es ist entsetzlich, wie die Pharmaforschung versucht, aus der Verwendung von menschlichen Spitalabfällen wie Nabelschnurblut oder Nachgeburten sofort maximalen Profit zu schlagen.“ Rekurs auf Tradition: „Bei uns ist es seit vielen Jahren üblich, alles auch nur erdenklich mögliche zu unternehmen, um einem Patienten ein möglichst langes Leben sicherzustellen, deshalb werden wir auch in diesem Falle so handeln.“ Rekurs auf Erfahrung: „Nun bin ich seit siebzehn Jahren in der Pflege tätig und habe immer wieder erfahren, dass es besser ist, sanften Druck auf die Patientenmeinungen auszuüben.“ Rekurs auf Gemeinschaft: „Im Teamgespräch sind wir zum Konsens gelangt, dass das Anlegen von Hüftschützern bei Sturzgefährdung unbedingt, also auch gegen den Patientenwillen, durchgesetzt werden müsse.“ Rekurs auf Vernunft: „Wenn ich mir die Sache kritisch überlege, so wäre es mit dem ICN widerspruchsfrei vereinbar, nach Überlegung einem Patienten bestimmte zutreffende negative Informationen, die seine Gesundheit beeinträchtigen könnten, vorzuenthalten.“ Rekurs auf Biographie: „Wenn ich die Lebensgeschichte dieses Patienten betrachte, so scheint es angebrachter, keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr zu unternehmen.“ Rekurs auf Verantwortung: „Es ist doch verantwortungslos, hier nichts zu tun. Wir müssen handeln.“ Rekurs auf Lebensbild: „Nun ist er 93 Jahre alt. Da lohnt sich eine künstliche Beatmung nicht mehr, dieses Leben ist gelebt.“ Rekurs auf Natur: „Lassen wir in diesem Falle der Natur ihren Lauf.“ Rekurs auf Tugend: „Es ist nur loyal gegenüber dem Krankenhaus als Arbeitgeber, aus diesem schwierigen Fall kein gerichtliches Drama zu machen.“ „Es ist mutig, sich hier nicht einer Operation zu unterziehen.“ Rekurs auf Autonomie: „Schließlich will der Patient den Eingriff nicht. Also unterlassen wir ihn.“ Rekurs auf ästhetische Prädikate: „Es ist bei dieser Variante ein schönerer Tod für den Patienten.“ „Es ist harmonischer, wenn alle Beteiligten gleichviel Mitverantwortung tragen.“ „Das ist schön gesprochen. Machen wir es so.“ 12 Rekurs auf Lust: „Es ist für alle Pflegenden und Angehörigen angenehmer, das Flüssigkeit absondernde und übel riechende Bein des Patienten zu amputieren.“ Rekurs auf Unlust: „Ich habe selber so viel Persönliches zu verarbeiten, da habe ich einfach keine Lust mehr, das persönliche Gespräch mit allen Patienten zu suchen.“ Rekurs auf Machbarkeit: „Es ist technisch kein Problem, hier einzugreifen. Deshalb machen wir den Eingriff.“ Rekurs auf Milieu: „Bei diesem sozialen Umfeld des Patienten sehe ich keine Chance auf Gesundung und Resozialisation. Lassen wir ihn gehen.“ Rekurs auf Rang: „Der Patient ist ein bekannter Politiker, deshalb erhält er entgegen der Warteliste gleich die nächste Spenderniere. Das sind wir ihm schuldig: schließlich ist er auch Sponsor unserer Klinik.“ Rekurs auf Politik: „Es ist politisch angebracht, begleitetem Suizid rechtliche Grenzen im Sinne strikter Vorschriften und Qualitätskontrollen beizugeben, damit kein Missbrauch stattfinden kann.“ Rekurs auf Wissen: „Aber im Ethikseminar haben wir gelernt, dass utilitaristische Begründungen nicht ausreichen. Deshalb fordere ich hier, dass nach dem Prinzip der Gerechtigkeit alle Beteiligten in gleicher Weise in das ethische Gespräch einbezogen werden!“ Rekurs auf Erlebnis: „Vor acht Jahren ist mir dies passiert. Seit diesem Zeitpunkt weiss ich, dass es hier besser ist, nicht einzugreifen.“ „Dann hatte ich diese tief religiöse Erfahrung. Von da an wusste ich, dass unbedingte Fürsorge fortan zur Haupttugend für mein Leben werden würde.“ „Seit diesem schrecklichen Unfallerlebnis bedeutet mir Lebensrettung sehr viel.“ Aufgabe: Erstellen Sie eine Hierarchie dieser und weiterer Rekursmöglichkeiten. Welche erachten Sie als generell eher stark, welche als eher schwach für die Argumentation im ethischen Diskurs? Begründen Sie Ihre Wahl! Zu bedenken ist bei den bisherigen Ausführungen, dass sie davon ausgehen, dass Werte irgendwie objektiv vorliegen und Menschen sie nur heranzuziehen brauchen, wenn ein Wertproblem entsteht. Was aber, wenn dies eine unzureichende Vorstellung ist? Werte könnten doch auch – anstelle irgendwo existierend vorzuliegen – allererst dann entstehen, wenn ein ethisches Gespräch geführt wird. So kann es durchaus geschehen, dass im ethischen Dialog, der sich sachbezogen um die Bewertung von Handlungsmöglichkeiten bemüht, spontan und unvorhergesehen Bewertungen entstehen, die niemand von vorneherein beabsichtigt hatte. Diese performative Genese von Werten gilt es gegen die üblichen Objektivierungen von Werten 13 im Auge zu behalten, da sie gerade dann bedeutsam werden können, wenn der ethische Diskurs aus verschiedenen Gründen nicht weiterkommt. 1.7 Sind Werte überzeitlich gültig oder veränderbar? Auffallend an der Vielfalt ist die offensichtliche Schwäche bestimmter Rekurse, etwa des Rekurses auf Autorität. Allerdings scheint dies auch ein historisch-zeitliches Phänomen zu sein, zumal beispielsweise vor rund dreißig Jahren der Meinung eines Arztes oder gar Oberarztes nach paternalistischer Manier meist unbedingte moralische Geltung eingeräumt wurde, während der heutige autonome „informierte Patient“ oft gleichviel oder sogar mehr Wissen über den Forschungsstand seiner Krankheit mitbringen kann, als der Arzt aufweist. Man folgt den ärztlichen Ratschlägen heute weniger, weil es der Arzt als Arzt ist, der den Rat erteilt, sondern z.B. weil man glaubt, ihm eher als einem anderen Arzt vertrauen zu können. Während allerdings einige Philosophen Werte als zeitgebunden und veränderlich betrachten, halten andere dagegen, dass Werte überzeitliche Geltung beanspruchen. Damit wird auch deutlich, dass Vorstellungen von Qualitäten von Werten mit den je unterstellten Vorstellungen von Leben, Geschichte, Mensch und Alter verknüpft sind und ein komplexes Ganzes darstellen, das nur schon wahrzunehmen und zu beschreiben eine Haupttätigkeit ethischer Analyse bildet. Doch Ethik erschöpft sich nicht darin, Probleme auf bestehende Rekursmöglichkeiten anzupassen, dies wäre vorphilosophisch. Es muss in einer Wertanalyse nicht nur auf genannte, sondern ggf. auch auf noch nicht eingebrachte Werte eingegangen werden, etwa Prinzipien der Würde menschlichen Lebens oder Gerechtigkeit. Zudem muss auch die Zugangs- und Rechtfertigungsmethode geprüft werden: Ist es beispielsweise sinnvoll, die Suche auf einen einzigen gültigen Wert auszurichten oder lassen sich auch polyvalente Lösungen finden? 1.8 Wertanalyse: Geltung und Wert Für eine jeder ethischen Untersuchung vorausgehenden Wertanalyse ist es angebracht, sich über die unterschiedlichen "Wert" - Vorstellungen der Beteiligten zu informieren. Dabei kann die folgende sprachliche Differenzierung hilfreich ein: Semantisch gesehen liegen "Wert" und "Geltung" nahe beieinander. "Werte", wenn sie denn etwas wert zu sein beanspruchen, beanspruchen ein "Gewicht", sie "gelten". Dabei ist es wichtig zu sehen, dass das alltagssprachlich oft verwendete Prädikat "es gilt ..." eine unbedingte Geltung einfordert oder nahelegt, deren allgemeine Rechtfertigung schwer überprüfbar ist. Unbedingte, notwendige Geltung: Einstelliges Prädikat „Es gilt etwas.“ Typische unbedingte Geltung einfordernde Werte sind etwa die inhärente Menschenwürde der Menschenrechtskonvention oder ein (in vielen Kulturen zu findendes) allgemeines Tötungsverbot. Oft sind auch religiöse Normen mit unbedingter Geltung versehen: So etwa die Unfehlbarkeit des Papstes oder die Rechtmäßigkeit eines heiligen Krieges. Wie allerdings die allgemeine Notwendigkeit der unbedingten Geltung von Werten über diese Rekurse hinaus gerechtfertigt werden soll, führt die Vertreter solcher Werte schnell in Begründungsnot. In 14 ethischen Gesprächen bilden solche Werte unbedingter Geltung oft unüberbrückbare Hindernisse, sofern sie als unveränderlich behauptet werden. Dann droht dem Versuch ethischer Verständigung nach einer Problemoffenlegung über einen Wertkonflikt ein möglicher Abbruch. Unbedingte Geltung einfordernde Werte vernachlässigen den gegebenen konkreten Kontext einer Situation, was zum Vorteil oder zum Nachteil für die Betroffenen werden kann. Für den ethischen Diskurs ist es viel hilfreicher, das Prädikat des Geltens als ein vierstelliges zu lesen und zu verwenden: Bedingte, kontingente Geltung: Vierstelliges Prädikat "etwas gilt als etwas für jemanden bezüglich eines Geltungsmaßstabes". Beispiel: „In unserer Pflegedienstabteilung gilt es entsprechend dem Grundsatz des Leidminderns im ICN als moralisch gut, dann einzugreifen, wenn trotz anders lautender Anweisungen offensichtlich üble Konsequenzen drohen.“ Die hier auch sprachlich zum Ausdruck kommende vierfache Bezüglichkeit weist "Geltung" als bedingte Geltung aus. Man kann auch sagen, dass es sich um eine kontingente Geltung handelt. Kontingent sind Sätze, die in einem bestimmten Zusammenhang wahr sein können, aber in einem anderen Zusammenhang nicht. Bedingte oder kontingente Geltung bezieht sich auf den lokal oder situativ jeweils gegebenen Bezugsrahmen, in dem zur Diskussion stehende Werte reflektiert werden. Wer im ethischen Diskurs nur schon die Fragen nach den Bedingungen kontingent geltender Werte erhebt, dem erschließt sich oft schon der Werthorizont einer Situation. Überdies werden mit diesem vierstelligen Prädikat die individuellen Vorstellungen ernst genommen, zur Sprache gebracht und im situativen Kontext positioniert. Die Betroffenen werden aktiv in den Analyseprozess eingebunden und beteiligen sich an der Entfaltung des ethischen Diskurses. Geltung erhalten bei ethischen Fehlentscheidungen aber auch "Unwerte" oder unakzeptable Moralkriterien. "Geltung" scheint also ein noch grundlegenderer Begriff zu sein, als "Wert". Jede ethische Wertanalyse sollte sich nicht nur Aufschluss darüber verschaffen, welche Werte die gerade Betroffenen jeweils einbringen, sondern versuchen, aus der Fülle beschriebener Werte in ethischen Modellen alle problemrelevanten nicht genannten Werte einfließen zu lassen. Der Beschreibung vorliegender Werte folgt danach eine Gewichtung der Geltung, die mit den möglichen Handlungsalternativen verbunden ist. 15 1.9 Werden Werte gefunden oder erfunden? Zu bedenken gilt es überdies, dass man kritisch betrachtet nicht stillschweigend davon ausgehen kann, dass Werte quasi als äußere Güter einfach vorliegen und es die Aufgabe der Betroffenen ist, diese anzuwenden oder ins Spiel der Argumentationen einzubringen, wie es eben unterstellt wurde. Vielmehr müssen auch Ansätze diskutiert und erwogen werden, in denen Werte beispielsweise erst dann entstehen, wenn man sie sprachlich zum Ausdruck bringt. Dies wird besonders bei Tugendethiken deutlich, die nicht z.B. mittels eines „Tapferkeitsmessgerätes“ empirische Messungen vornehmen können, sondern erst durch das Verlautbaren von Allgemeinbegriffen wie „Tapferkeit“ oder Prädikaten in Sätzen wie „Diese Handlung war ja sehr tapfer!“ Tugenden generieren. Zu bedenken gilt es auch die Option konstruktivistischer Schöpfung von Werten: Sind solche Schöpfungen willkürlich oder folgen sie bestimmten Gesetzen und Regeln? Nicht vergessen werden soll schließlich der Umstand, dass es nicht nur gilt, die ErfundenGefunden-Polarität von Werten gegeneinander auszuspielen, sondern auch die Fälle zu erwägen, dass beides oder keines von beiden der Fall sein könnte. Gerade die Möglichkeit, dass Werte ebenso sehr vorgefunden wie erfunden werden könnten, trifft man in ethischen Diskursen sehr selten an, vielleicht mit aufgrund des unterstellten abendländisch-christlichen Paradigmas, jeweils monokausal einen einzigen Sündenbock als Ursache verantwortlich machen und mit Schuld beladen zu müssen. Völlig anders geht etwa eine Diskursethik vor, die die Geltung von Werten zum Gegenstand der Konsensfindung macht. Kann aber ein Konsens allein moralische Güte garantieren? Was macht man, wenn es bei einem Dissens bleibt? Wieder anders geht eine vertragstheoretische Ethik vor, die Werte allererst mit den Betroffenen aushandelt. Kann ein solcher value deal aber bereits moralische Güte liefern? Aufgabe zur Wertgenese: Wie kommt man zu „Werten“? Nach Kant etwa muss man alle emotionalen Komponenten (die Neigungen) aus dem Spiel lassen, damit eine vernünftige Analyse für das moralisch Gebotene erfolgen kann. Umgekehrt fordern Augustinus und Max Scheler, dass man erst in einem Zustand des Liebens bzw. Einfühlens erkennen kann, welche Werte geboten sind. Diskutieren Sie, was diese Unterscheidung leistet und ob sie für ethische Diskurse förderlich ist! 1.10 Was sind moralische Werte? Nicht alle Werte sind moralisch relevant. Dass eine bestimmte Operation so und so viel kostet, bedeutet noch nicht, dass dieser ökonomische Wert mit einem moralischen gleichzusetzen ist. "Moralisch" sind Werte, "die wir menschlichem Handeln, Verhalten, Charaktereigenschaften oder Institutionen zuschreiben" (Frankena 1983). Was ist von solch einem Definitionsversuch zu halten? Ist jedes menschliche Verhalten "moralisch"? Handelt eine Pflegerin, die etwa einen Verband vorbildgerecht wechselt, "moralisch wertvoll"? Welches ist das Kriterium, das die Entscheidung bei solchen Fragen ermöglicht? Müsste man nicht bereits wissen, was "moralisch" hier bedeutet, um einen Wert als moralisch zu klassifizieren? Wie oben gesehen, müssen in ethischen Diskursen moralische 16 Wertmassstäbe eingebracht werden, die den instrumentellen, ökonomischen oder sonst wie bestimmten Wert zusätzlich als moralisch auszeichnen können. Aufgabe: Versuchen Sie folgende Liste von "Werten" in verschiedene Klassen einzuteilen: berufliche, rechtliche, politische, ästhetische, soziale, kulturelle, ökonomische, persönliche und moralische Werte. Halten Sie Ihre Einteilung für notwendig wahr oder könnte sie auch anders ausfallen, wäre also kontingent? Ehrlichkeit, Vorliebe, Schweigepflicht, Geschmack, Mitleid, Reinlichkeit, Respekt, Achtung vor dem Leben, Wohlbefinden, Ekel, Wohltätigkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Organisationsfähigkeit, Formvollendetheit, Standhaftigkeit, Loyalität, Autoritätshörigkeit, Wahlbeteiligung, Mitsprache, Menschenwürde, Autonomie, Fürsprache, Diskriminierungsverbot, Fürsorge, Selbstgenügsamkeit, Eleganz, Nächstenliebe, Instrumentalisierungsverbot, Aufrichtigkeit, Meinungsäußerungsfreiheit… Es gibt in der Geschichte des ethischen Denkens eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, wie moralische Werte erkannt und begründet werden können. Zu den bekanntesten und viel diskutiertesten gehören utilitaristische, deontologische und tugendethische Ansätze. Sie prägen auch den aktuellen pflege- und medizinethischen Diskurs. Lektürehinweis: Lesen Sie zur Bestimmung von "Werten": Joas, Hans: Die Entstehung der Werte. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1997. Scheler, Max: Schriften zur Anthropologie. Stuttgart (RUB 9337) 1994, besonders S. 249-286: Die Rangordnung der Werte und Gefühle. Aufgabe: Versuchen Sie, einen moralisch/ethischen Dialog zu verfassen, der sich aus einer pflegerischen Dilemmasituation heraus erhebt! Lassen Sie die Dialogpartner verschiedene Wertrekurse machen, die vom Gegenüber in Frage gestellt werden. Wo liegt die Grenze zwischen moralisierendem und ethischem Diskurs? 1.11 Normen Werte können nicht nur in Form von Charaktereigenschaften (Tugenden) sondern auch in Form von Normen, abgeleitet von lat. norma = Regel, Massstab, Muster, Vorschrift oder leitender Grundsatz, auftreten. Allerdings muss man sich zunächst die Vieldeutigkeit des Begriffs der „Norm“ verdeutlichen: Normen sind erstens in einem technischen Sinn hochpräzise Vorschriften, die Masse und Grössen bestimmter herstellbarer Gegenstände festlegen (z.B. DIN-Norm etc.). Zweitens können Normen im Sinne von „normal“ einen Durchschnittwert bei Messungen bezeichnen: Ein „normales“ menschliches Haar ist im Durchschnitt 30-70 Mikrometer dick. Drittens kann Norm als Ideal aufgefasst werden, dem sich handelnde Versuche immer nur annähern können. Zum Beispiel könnte die Norm, das kostengünstigste 17 Krankenhaus mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis sein zu wollen, einen immer währenden, aber kaum je endgültig erreichbaren Anspruch darstellen. Viertens schliesslich wird Norm in moralischem oder rechtlichem Sinn aufgefasst als Vorschrift, die menschliches Handeln leiten soll. Dass Normen sich auf künftige Handlungen beziehen, kommt in Otts Definitionsversuch treffend zum Ausdruck: „Normen sind generalisierte regelförmige Verhaltenserwartungen.“9 Generalisierte Normen kommen in vielen Bereichen menschlichen Lebens vor. So gibt es wissenschaftliche Normen (z.B. intersubjektive Nachvollziehbarkeit), logische Normen (z.B. „Jeder Schritt in der Argumentation muss nachvollziehbar sein.“), theologische Normen („Du sollst nicht ehebrechen.“), rechtliche Normen („in dubio pro reo“), moralische Normen (goldene Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“). Normen können von Prinzipien unterschieden werden: Wird beispielsweise nach dem Sinn einer Norm gefragt, so muss man zur Verteidigung sog. Prinzipien als „erste Sätze“ von grundlegender Art fragen. Beispiel: Im Ethikkodex für Pflegende (ICN) werden die Normen „Gesundheit fördern“ und „Krankheit verhüten“ genannt. Hierbei wird stillschweigend ein bestimmter Begriff von Gesundheit als etwas in jedem Fall Förderungswertes ebenso unterstellt, wie die Vorstellung, „Krankheit“ sei etwas in jedem Falle zu Verhütendes. Fragt man nach dem dahinter liegenden Lebens- und Menschenbild, so öffnet sich ein weites Feld an unterschiedlichen Typisierungen und Interpretationsmöglichkeiten, die erst in einem ethischen Diskurs thematisiert und geklärt werden können. Hat beispielsweise eine Person prinzipiell das Recht, in die Integrität einer anderen Person einzugreifen? Normen werden meist in grammatikalischer Imperativform formuliert. So enthält auch der für das gesamte Berufsfeld der Pflege geltende Ethikkodex ICN eine Reihe von Normen: ___________________________________________________________________________ ICN: Ethische Grundregeln für die Krankenpflege Erstmals wurden in Sao Paulo, Juli 1953, vom Aufsichtsrat (Grand Council) des Weltbundes der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) Ethikregeln für die Krankenpflege angenommen. Diese wurden vom Aufsichtsrat im Juni 1965 in Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, revidiert. Die vorliegende Berufsethik wurde vom ICN-Fachausschuss für Krankenpflege ausgearbeitet und vom Rat der Ländervertretungen in Mexico City, Mai 1973, angenommen. Copyright 1973, ICN, Genf. Ethische Grundregeln für die Krankenpflege Die Krankenschwester (Krankenpfleger entsprechend für Krankenschwester im gesamten Wortlaut) hat vier grundlegende Aufgaben: Gesundheit zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wiederherzustellen, Leiden zu lindern. Der Bedarf an Pflege besteht weltweit. Zur Pflege gehört die Achtung vor dem Leben, vor der Würde und den Grundrechten des Menschen. Sie wird ohne Rücksicht auf die Nationalität, die Rasse, den Glauben, die Hautfarbe, das Alter, das Geschlecht, die politische Einstellung oder den sozialen Rang ausgeübt. 9 Ott, Konrad: Moralbegründungen. Hamburg 2001, S. 167. 18 Die Krankenschwester übt ihre berufliche Tätigkeit zum Wohle des einzelnen, der Familie und der Gemeinschaft aus; sie koordiniert ihre Dienstleistungen mit jenen verwandter Gruppen. Die Krankenschwester und der einzelne Die vordringlichste Verantwortung der Krankenschwester gilt dem pflegebedürftigen Menschen. Die Krankenschwester sorgt bei ihrer Tätigkeit dafür, dass die Wertvorstellungen, die Sitten und Gewohnheiten sowie der Glaube des einzelnen respektiert werden. Die Krankenschwester betrachtet jede persönliche Information als vertraulich und leitet sie mit Überlegung weiter. Die Krankenschwester und die Berufsausübung Die Krankenschwester ist für die Ausübung der Pflege sowie für ihre fortlaufende Weiterbildung persönlich verantwortlich. Die Krankenschwester hält die Pflege auf dem höchsten Stand, der in einer gegebenen Situation möglich ist. Die Krankenschwester beurteilt die Fähigkeiten der Personen, von denen sie Verantwortung übernimmt oder an die sie Verantwortung weitergibt. Die Krankenschwester sollte in ihrem beruflichen Handeln jederzeit auf ein persönliches Verhalten achten, das dem Ansehen des Berufes dient. Die Krankenschwester und die Gesellschaft Die Krankenschwester teilt mit anderen die Verantwortung dafür, dass Massnahmen zugunsten der gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung ergriffen und unterstützt werden. Die Krankenschwester und ihre Mitarbeiter Die Krankenschwester sorgt für eine gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern auf pflegerischen und anderen Gebieten. Die Krankenschwester greift zum Schutz des Patienten ein, wenn sein Wohl durch einen Mitarbeiter oder eine andere Person gefährdet ist. Die Krankenschwester und der Beruf Die Krankenschwester ist massgeblich daran beteiligt, wünschenswerte Richtlinien für die Berufsausübung und Berufsbildung festzulegen und zu verwirklichen. Die Krankenschwester wirkt aktiv mit, ein Fundament an beruflichem Wissen aufzubauen. Durch ihren Berufsverband setzt sich die Krankenschwester ein für die Schaffung und Erhaltung gerechter sozialer und wirtschaftlicher Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege. Aufgabe: Lesen sie aus dem obigen Text Normen und Werte heraus. Stellen sie diese in einer Tabelle zusammen und fragen sie sich, welche Begriffe, Vorstellungen, Lebens- und Menschenbilder hier stillschweigend unterstellt werden. Sind diese allgemeingültig? Suchen sie schwierig zuzuordnende Gegenbeispiele aus ihrer Berufserfahrung! Was lässt sich daraus für den Umgang mit Normen im praktischen ethischen Diskurs folgern? 19 1.12 Ist jede Handlung moralisch? "Richtige" vs. "gute" Handlung In ethischen Diskursen ist immer wieder festzustellen, dass die Prädikate "wahr", "richtig", "gut", "falsch", "schlecht", "böse" unsauber angewandt werden. Eine hilfreiche Unterscheidung kann die Unterteilung einer Handlung gemäß verschiedenen Gesichtspunkten sein. Instrumentell richtig sind Handlungen, die gemäß Vorschrift ohnehin zu verrichten sind. Aus instrumenteller Richtigkeit folgt aber keineswegs Moralität. Die Handlung wird erst aufgrund eines je zu verwendenden oder vorfindbaren Moralkriteriums zu einer moralisch "guten" bzw. "schlechten" Handlung. Handlung instrumentell moralisch Fall: richtig gut 1 falsch schlecht 2 gut schlecht 3 4 Aufgabe: Formulieren Sie zu jedem Fall ein konkretes Beispiel einer moralisch guten/schlechten Handlung! Fall 1: Fall 2: Fall 3: Fall 4: Anschlussfragen zu den Beispielen Es handelt sich bei diesen Urteilen um moralische Urteile. Wie können sie moralisch gerechtfertigt werden? Worauf nehmen Sie bei Rechtfertigungsversuchen Rekurs? Auf Fakten, Gefühle, mögliche Folgen, Moralkodex, moralische Kompetenz, Gewissen? 20 1.13 Kombinatorische Methoden zur Handlungs- und Fallanalyse Nehmen wir nun an, eine Handlung könne nicht nur auf moralischer und instrumenteller, sondern auch auf rechtlicher und vernunftgemäßer Ebene bewertet werden. Dann ergeben die vier Kriterien in Matrixdarstellung schon 24 = 16 Fälle möglicher Handlungen, die untersucht werden können: Handlungsqualitäten M: moralisch (gut / schlecht) V: vernünftig (vernünftig / unvernünftig) I: instrumentell (richtig / falsch) R: rechtlich (legal / verboten) M ¬M V ¬V V ¬V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I R ¬R R ¬R ¬I Es lassen sich noch weitere Handlungsqualitäten hinzunehmen, wie etwa "politisch korrekt / inkorrekt", "schön/hässlich", "effizient/ineffizient", "schnell/langsam", "üblich/unüblich", "tugendhaft/untugendhaft", "lustvoll/schmerzvoll", "gemeinnützig/eigennützig", "zahlbar/ unbezahlbar" etc. Die Zahl der Fälle wächst allerdings exponentiell an! Solche Matrizen oder Baumdarstellungen helfen, die möglichen Wertkonflikte der möglichen Handlungsalternativen zu beschreiben und dienen so der späteren Entscheidungsfindung durch Gewichtung ausgesuchter Aspekte. Probleme: Um eine Handlung als von der Qualität x zeugend zu identifizieren, sind Kriterien nötig, die eine möglichst genaue Einstufung einer Handlung als x-Handlung erlauben. Welches sind diese Kriterien? Zudem muss die Beurteilungsmethode dieser Kriterien sicherstellen, dass genau die und nur diejenigen Kriterien gemessen werden. Welche Methoden garantieren dies? Wenn mehrere Eigenschaften eine Handlung prägen, wie in diesem komplexen Fall unserer Matrix: Wie werden sie untereinander gewertet und gewichtet? Sind alle gleichwertig oder zeichnen sich einige vor anderen aus? Welche Metamoral entscheidet hier? Je nachdem, worauf man sich bei der Beantwortung dieser Fragen beruft, entstehen unterschiedliche Ansätze von Ethiken. Aus den sog. "klassischen" Positionen sind modernere Ansätze entstanden, die versuchen, unter den verschiedenen Problemen, die sich bei einer Zusammenführung verschiedener Positionen ergeben, zu vermitteln. 21 1.14 Drei Grundpositionen der philosophischen Ethik Platon stellt im Dialog Euthyphron (XII, 10a) eine wichtige Grundfrage zur Ethik: "Wird das Fromme, weil es fromm ist, von den Göttern geliebt, oder ist es fromm, weil es von ihnen geliebt wird?" Mit anderen Worten: Lassen sich Gegenstände oder Handlungen finden, die an sich oder in sich selbst moralisch wertvoll sind oder werden diese als solche von jemandem deklariert? Analysiert man eine Handlung, die einen Zustand A in einen neuen Zustand B überführt, genauer, so zeigen sich unterschiedliche Ansätze ethischer Rechtfertigung: Gesinnung "gut" Zustand A Handlung Zustand B "gut" Tugend "gut" Folge "gut" Gesinnungsethik Deontologische Ethik (von tò d¡on: die Pflicht, das Erforderliche) Tugendethik Teleologische Ethik (von tò t¡low: das Ziel) Verantwortungsethik Teleologische Ethik Handlungen sind gut ohne Rücksicht auf die Folgen. Erfolgen Handlungen aus Pflicht, oder sind sie nur pflichtgemäss? Empiriefreie Begründung moralischer Prinzipien. Handlungen sind gut, wenn tugendhaft Handlungen sind gut allein aufgrund der sich aus ihnen ergebenden Folgen Kant, Fichte Aristoteles Utilitarismus Mill, Bentham Probleme Anwendbarkeit Abstraktheit Überprüfbarkeit Anwendbarkeit Folgenabschätzung Expertenrekurs Zweck rechtfertigt die Mittel (cf. Spaemann, R.: Moralische Grundbegriffe, München 1994, S. 63ff.) 22 2. Der Utilitarismus In der Ethik des sog. "Utilitarismus" werden Handlungen dann als moralisch gut oder richtig eingestuft, wenn diese Handlungen Zustände herbeiführen, die für ihre Urheber bzw. alle von der Handlung betroffenen menschlichen (und teilweise auch tierischen) Wesen nützlich sind. Worin dieser Nutzen jeweils besteht, ist je nach Vertreter verschieden. Diese Ethik der Nützlichkeit, wie der Utilitarismus auch genannt wird, gibt es in einer deskriptiven (beschreibend-erklärenden) und in einer normativen (ein moralisches Kriterium setzenden) Variante. David Hume (1711-1776) etwa war als Vorläufer ein Vertreter eines deskriptiven Utilitarismus, der versuchte, die Entstehung und Geltung moralischer Normen und gesellschaftlicher Institutionen auf den Nutzen zurückzuführen, den sie für die Gesellschaft haben. Als normative Ethik setzt der Utilitarismus das Prinzip der Nützlichkeit als ein moralisches Kriterium, an dem die moralische Richtigkeit und Falschheit von Handlungen und Recht und Unrecht moralischer, rechtlicher und anderer gesellschaftlicher Normen und Institutionen gemessen werden sollte. Die klassischen Vertreter dieses Typus sind Jeremy Bentham (17481832) und John Stuart Mill (1806-1873). Sie haben als erste den Utilitarismus systematisch zu entwickeln versucht. Jeremy Bentham ging in seinen Überlegungen von drei Prämissen aus: Einem psychologischen Hedonismus, demgemäss alle Menschen von Natur aus nach Lust und Vermeidung von Schmerz streben: „Nature has placed mankind under the government of two sovereign masters, pain and pleasure.“10 Zweitens nimmt er eine Wertlehre an, nach der die Suche nach Lust vernünftig, Verzicht und Entsagung dagegen als irrational abgelehnt werden. Zur Erreichung dieses Zieles schlägt Bentham ein hedonistisches Kalkül vor, das ein Maximum der Lust bzw. ein Minimum des Leids für alle von einer Handlung Betroffenen errechnen soll. Man addiert die Werte aller Freuden auf der einen und die Werte aller Leiden auf der anderen Seite, um in einer Gesamtbilanz das Tun oder das Unterlassen einer Handlung als moralisch gut auszuweisen. Eine dritte Prämisse ist in diesem Kalkül die Norm der Unparteilichkeit, nach der die Lust eines jeden Individuums gleich zählt: „Everybody to count for one, nobody for more than one.“ 11 Damit will Bentham eine Basis gegen die Formen politischer oder sozialer Diskriminierung gewinnen. Kritisch nimmt John Stuart Mill Korrekturen an Benthams Entwurf vor. Zunächst ersetzt er die von Bentham rein quantitativ behandelte und in sich nicht unterschiedene Lust durch qualitative Unterscheidungen. So gilt ihm etwa sie geistige Lust höher als bloss körperlichsinnliches Vergnügen. Ebenso wendet sich Mill gegen eine direkte Anwendung des Utilitarismus auf einzelne Situationen, sondern empfiehlt die Ausbildung von Regeln oder Tugenden zur Bewältigung der häufigsten Alltagssituationen. Mill wird somit zum Urvertreter eines Regelutilitarismus, der sich vom Handlungsutilitarismus unterscheidet (siehe unten). Mill beschrieb sein Nutzenprinzip so: "Nach dem Prinzip des größten Glücks ist, wie oben erklärt, der letzte Zweck, bezüglich dessen und um dessentwillen alles andere wünschenswert ist (sei dies unser eigenes Wohl oder das Wohl anderer), ein Leben, das so weit wie möglich frei von Unlust und in quantitativer Hinsicht so reich wie möglich an Lust ist; wobei der Maßstab, an dem Qualität gemessen und mit der Quantität verglichen wird, die 10 Bentham, Jeremy: An introduction to the principles of morals and legislation. In: Works, hrsg. Von J. Browning, London 1838-43, Vol 1, p. 1. 11 Bentham, Jeremy: Plan of parliament reform (1809), a.O. Vol. 3, p. 459. 23 Bevorzugung derer ist, die ihrem Erfahrungshorizont nach - einschließlich Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung - die besten Vergleichsmöglichkeiten besitzen. Indem dies nach utilitaristischer Auffassung der Endzweck des menschlichen Handelns ist, ist es notwendigerweise auch die Norm der Moral. Diese kann also definiert werden als die Gesamtheit der Handlungsregeln und Handlungsvorschriften, durch deren Befolgung ein Leben der angegebenen Art für die gesamte Menschheit im größtmöglichen Umfange erreichbar ist; und nicht nur für sie, sondern, soweit es die Umstände erlauben, für die gesamte fühlende Natur."12 Man bemerkt bei der Lektüre utilitaristischer Konzeptionen der Ethik, dass sie auffallend "empirisch" sind, d.h. sich auf gemachte oder künftige Erfahrungen beziehen. "Nützlich" im Sinne des Utilitarismus ist das, was dazu beiträgt, Glückserfahrung, Interessenbefriedigung und den Genuss eines lebenswerten Lebens zu ermöglichen, und die moralisch richtige Handlung ist eben die, die in diesem Sinne die jeweils nützlichste von allen möglichen ist. Woraus aber besteht das von den Utilitaristen je zu erreichende "Glück"? Hören wir dazu John Stuart Mill: "Unter "Glück" [happiness] ist dabei Lust [pleasure] und das Freisein von Unlust [pain], unter "Unglück" [unhappiness] Unlust und das Fehlen von Lust verstanden. Damit die von dieser Theorie aufgestellte Norm deutlich wird, muss freilich noch einiges mehr gesagt werden, insbesondere darüber, was die Begriffe Lust und Unlust einschließen sollen und inwieweit dies von der Theorie offengelassen wird. Aber solche zusätzlichen Erklärungen ändern nichts an der Lebensauffassung, auf der diese Theorie der Moral wesentlich beruht: Dass Lust und das Freisein von Unlust die einzigen Dinge sind, die als Endzwecke wünschenswert sind [...]."13 Ob eine Handlung als moralisch "gut" bzw. "richtig" oder nicht eingestuft wird, hängt also nicht davon ab, dass etwa die Handlung "an sich gut" ist oder einer abstrakt gefassten "Zweckmäßigkeit an sich" entsprechen muss, und auch nicht davon, ob die handelnde Person moralisch integer oder mit besonderen moralischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Im utilitaristischen Ansatz wird allein das Ausmass, indem eine Handlung konkretes Glück bewirken oder konkretes Unglück verhindern kann, gemessen. Man hat deshalb die utilitaristischen Ansätze der Ethik als teleologische Ethik (von griechisch to telow = das Ziel, der Zweck) bezeichnet, weil sie einen bestimmbaren Endzweck als Moralkriterium im Blicke hat. Da dieser auf die Zukunft, die Auswirkungen und die Konsequenzen gerichtete Blick entscheidend ist, kann man die Formen des ethischen Utilitarismus zum sog. Konsequentialismus zählen. Diese - um modern zu sprechen: Folgenabschätzung - kann im Einzelfall, wenn es darum geht, in einer schwierigen ethischen Dilemmasituation die geeigneten möglichen Folgen für alle Beteiligten erstens zu erfassen und zweitens richtig einzuschätzen, zu schwierigen Problemen der Entscheidung führen. 2.1 Utilitarismus und Pflegeethik Im Bereich der Pflegeethik spielen Elemente von utilitaristischen Ethiken eine nicht unerhebliche Rolle. Wenn es etwa darum geht, in einer ethisch schwer entscheidbaren Situation vorgesehene Handlungen als moralisch vertretbar einzustufen, so können Nutzenabwägungen in das argumentative Feld des ethischen Diskurses eingebracht werden. Bevor aber "Sinn" oder "Nützlichkeit" utilitaristischer Argumente abgewogen werden können, sollten Pflegende, Pflegemanagement- und Pflegepädagogik-Studierende utilitaristische 12 13 Mill, John Stuart: Utilitarianism (1871); dt. Der Utilitarismus. Stuttgart, RUB 9821, 1985, S. 20/21. Mill, John Stuart: Utilitarianism (1871); dt. Der Utilitarismus. Stuttgart, RUB 9821, 1985, S. 13. 24 Elemente an Beispielen erkennen und beschreiben können. Darum geht es in der folgenden Aufgabe: Beispiel: Im Krankenhaus geht die Grippe um, mehrere ihrer Pflegeteammitglieder sind bereits erkrankt. Auch die Pflegerin Anna hat es erwischt, dennoch tritt sie ihren Dienst an. Sie laden Pflegerin Anna zu einem kurzen Gespräch vor und überlegen sich ihre Argumente, die sie aus ethischer Sicht im Sinne des Utilitarismus für ihren Entscheid einbringen können. Aufgabe in drei Schritten 1. 2. 3. Beschreiben Sie anhand des Beispiels alle ihnen nur denkmöglichen Nutzenabwägungen und Folgeneinschätzungen für jedes Handeln, das Sie als Alternative zum gegebenen Problem sehen. Bestimmen sie zu jeder alternativen Handlung somit mögliche Werte, die es aus utilitaristischer Sicht zunächst zu erfassen gilt. Versuchen Sie nun in einem zweiten Schritt, den Werten und damit indirekt den alternativen Handlungen zur Lösung des Problems ein entsprechendes Gewicht zu erteilen. Versuchen Sie, die Probleme dieses Vorgehens zu beschreiben: Welche Schwierigkeiten bereitet Ihnen dieser utilitaristische Problemlösungsweg? Haben Sie auch grundsätzliche Einwände oder Bedenken? Mögliche Handlungen: ___________________________________________________ ___________________________________________________ Werte dieser Handlungen: ___________________________________________________ ___________________________________________________ Gewichtung dieser bewerteten Handlungen: ____________________________________________________ ____________________________________________________ Probleme und Bedenken: ____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 25 Die eben vollzogene Vorgehensweise hat Brody14 in einem Modell der Analyse und ethischen Entscheidungsfindung beschrieben, das vom Utilitarismus ausgeht. Utilitaristisches Analysemodell nach Brody 1. 2. 3. 4. Erfassen des Problems Aufführen verschiedener alternativer Handlungen zur Lösung des Problems Folgenabschätzung für jede Lösungsmöglichkeit Zuteilen von positiven oder negativen Werten (Glück/ Unglück, gut/ schlecht, Wohlbefinden/ Schmerzen, etc.) 5. Wahl derjenigen Lösung mit dem höchsten Wert 6. Vollzug der ethisch richtigen Handlung Lösung a)_______ b)_______ c)_______ Folge _______ _______ _______ Wert(e) + -- + - +++ +- - - Rangfolge/Entscheid 2. 1. Handlungsvollzug 3. Quelle: Brody, H. Ethical Decisions in Medicine. Boston (2) 1981, S. 355; auch in: Ethische Grundsätze für die Pflege. Hrsg. Vom schweizerischen Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Bern 2000, S. 24. Aufgabe: Sie bereiten sich als Pflegemanagerin auf eine wichtige Sitzung vor. Um Argumente zu finden, wenden Sie Brodys Analysemodell auf folgende Beispiele an: Seit fünf Jahren liegt ein Patient gefesselt an einer medizintechnischen Apparatur. Er scheint therapieresistent zu sein, "lebt" allerdings in biologischem Sinne. Der pflegerische Aufwand ist immens, die Kosten für die Apparatur belaufen sich täglich auf 50'000 Euro. Mediziner stufen die Heilungschancen als "aussichtslos" ein, die Angehörigen leiden unter den für sie auftretenden finanziellen Kosten und den psychischen Belastungen, die Krankenkasse ist auch nicht erfreut über den Aufwand, die Krankenhausleitung hat Platznot und könnte das Zimmer für dringendere Fälle verwenden, zudem fehlt die Pflegezeit und die Zuwendung, die hier aufgewendet wird, angesichts von Pflegepersonalknappheit anderen Patienten. Fall A Fall B Fall C Fall D 14 Patient ist 20 Jahre alt und bei Bewusstsein. Patient ist 20 Jahre alt und nicht bei Bewusstsein. Patient ist 75 Jahre alt und bei Bewusstsein. Patient ist 75 Jahre alt und nicht bei Bewusstsein. Brody, H.: Ethical Decisions in Medicine. Boston (2) 1981, S. 355. 26 2.2 Varianten utilitaristischer Theorien Um einzelnen oder mehreren Schwierigkeiten zu begegnen, haben sich utilitaristische Denker bemüht, durch Variation einzelner Aspekte ihrer Ansätze der Kritik Rechnung zu tragen. Deshalb sind die Utilitaristen in zwei Lager zerfallen: Die Handlungsutilitaristen und die Regelutilitaristen, die, je nachdem, ob das Nützlichkeitsprinzip auf einzelne Handlungen oder auf Regeln für ganze Klassen von Handlungen angewendet wird, Handlungen als moralisch gut taxieren. 2.3 Der Handlungsutilitarismus (z.B. J. Bentham15, J.J.C. Smart16) Der Handlungsutilitarismus ist diejenige Auffassung, nach der die moralische Richtigkeit oder Falschheit einer Handlung nur anhand der guten oder schlechten Konsequenzen dieser Handlung bestimmt werden muss, d.h. von der Wirkung der Handlung auf das Wohlergehen aller menschlichen (oder vielleicht sogar aller fühlenden) Wesen. Für den Handlungsutilitarismus dient eine "Faustregel" (ein "Rezept") ausschliesslich als Sekundärregel, als Behelf, sich die Abschätzung der Gesamtfolgen der entsprechenden Handlung in bestimmten Fällen zu ersparen, wobei die individuellen Gesamtfolgen für die moralische Richtigkeit und Falschheit einer Handlung jedoch weiterhin bestimmend bleiben. Der Handlungsutilitarist lässt im Grunde nur das Nützlichkeitsprinzip selbst gelten. Ethisches Prinzip (normative Aussage 2. Ordnung): Jeder sollte sich so verhalten, dass seine Handlung ein Maximum an Glück und ein Minimum an Unglück für alle Betroffenen hervorbringt. An der oben genannten Definition, die so von Smart vertreten wird, sind zwei grundlegende Prinzipien ablesbar, die den Handlungsutilitarismus bestimmen: das Konsequenzenkriterium: Moralisch richtige/falsche Handlungen werden anhand des Werts ihrer Konsequenzen gemessen. Und das ihm vorauslaufende Wertkriterium: Am Wertkriterium wird der jeweilige Wert der Konsequenzen einer Handlung gemessen. Während das Konsequenzenkriterium für alle utilitaristischen Positionen gilt, unterscheiden sich die verschiedenen Handlungsutilitarismen entsprechend ihres Wertkriteriums, das eine je verschiedene Wertbasis bestimmt. Bei Smart ist diese etwa ganz intrapersonal hedonistisch angelegt, während etwa Mill oder Moore neben intrapersonalen auch interpersonale Werte annehmen und so ihre Ansätze zur Sozialethik auszubauen versuchen. 2.4 Der Regelutilitarismus (z.B. R.B. Brandt17, J.O. Urmson18, R.F. Harrod19, J. Harrison20, J. Rawls21) Der Regelutilitarismus vertritt die Auffassung, dass die moralische Richtigkeit oder Falschheit einer Handlung anhand der guten oder schlechten Konsequenzen einer Regel bestimmt werden muss, der zufolge jeder die Handlung in ähnlichen Umständen ausführen soll. 15 Bentham, J.: Introduction to the principles of morals and Legislation. 1859. Smart, J.J.C.: An outline of a system of utilitarian ethics. 1973. 17 Brandt, R.B.: Ethical Theory. Englewood Cliffs 1959. Sowie: Some merits of one form of rule utilitarianism. Univ. Of Colorado studies in philos. 3 (1967) S. 39-65. 18 Urmson, J.O.: The interpretation of the moral philosophy of J.S. Mill. Philos. Quart. 3 (1953) S. 33-39. 19 Harrod, R.F.:Utilitarianism revised. Mind 45 (1936) S. 137-156. 20 Harrison, J.:Utilitarianism, universalization and our duty to be just. Proc. Arist. Soc. 53 (1953) S. 105-134. 21 Rawls, J.: Two concepts of rules. Philos. Review 64 (1955) S. 3-32. 16 27 Er entspricht der von Mill ins Spiel gebrachten indirekten Form des Utilitarismus, der Nutzenberechnungen nicht direkt auf die jeweiligen Entscheidungsoptionen anwendet, sondern auf Regeln oder Praktiken. Der Regelutilitarist verlangt, dass wir die Sekundärregeln, deren Befolgung sich bisher als überwiegend nützlich erwiesen hat, in einer Entscheidungssituation auch dann noch verbindlich anerkennen, wenn die Befolgung der Sekundärregel zufällig nicht zu den bestmöglichen Konsequenzen führen würde (ausser im Falle, dass die Befolgung der Sekundärregel übermäßig schlimme Folgen hätte und mit dem Nützlichkeitsprinzip in Konflikt geriete). Die Sekundärregel wird hier stärker gewichtet. Ethisches Prinzip (normative Aussage 2. Ordnung): Jeder sollte immer jene Regeln befolgen, die ein Maximum an Glück oder ein Minimum an Unglück für alle Betroffenen hervorbringen. Beispiel: Der Angehörige Herr M. wundert sich, dass seine kranke Frau immer so schläfrig ist. Sie wissen zufällig, dass man ihr irrtümlicherweise eine zu starke Dosis eines Medikaments verabreicht hat. Welche Regeln könnte man aus handlungs- oder regelutilitaristischer Sicht als Sekundärregeln in dieser Situation geltend machen, um die Folgen dieser spezifischen Situation abzuschätzen? Als Sekundärregel könnte etwa diese vorgebracht werden: Kläre alle Beteiligten immer über die Fehlerhaftigkeit einer Situation auf, weil ein Zustand maximaler Informiertheit ein für die Folgen der Handlungen optimierter Zustand ist. Wie verhält es sich im Falle, da Sie erwägen, aus bestimmten Gründen, etwa weil Sie zufällig erfahren haben, dass Herr M. zu starken Depressionen neigt oder außerordentlich aggressives Verhalten an den Tag legen kann, wenn er mit "Ungerechtigkeiten" konfrontiert wird, zur Notlüge zu greifen und somit die Sekundärregel zu verletzen? Ist diese Handlung moralisch "richtig"? Für den Regelutilitaristen wäre dies ein bedauernswerter Kompromiss, ein unumgänglicher Notstand, der die Sekundärregel verletzen würde. Für den Handlungsutilitaristen hingegen gibt es hier nichts zu bedauern, weil das Nutzenprinzip gewahrt war und die Sekundärregel ohnehin nur eine gewisse Hilfsfunktion übernommen hätte. Aufgabe: Führen Sie am folgenden oder an einem selbst gewählten Beispiel ähnliche Überlegungen durch, formulieren Sie diese und diskutieren sie den Fall mit einer Kommilitonin / einem Kommilitonen! Beispiel: Einer Patientin geht es mal besser, mal schlechter. Im Patientenbericht entdecken Sie die Verfügung, dass ihr jedes zweite Mal ein Placebo anstelle von Morphin verabreicht wird. 28 2.5 Der Präferenzutilitarismus (R.M. Hare22, P. Singer23) R. M. Hare hat die Unterscheidung zwischen Handlungs- und Regelutilitarismus kritisch aufgegriffen und versucht zu zeigen, dass zwischen ihnen kein wesentlicher Unterschied bestehe, wenn man zwischen einer „kritischen“ und einer „intuitiven“ Ebene unterscheide. Auf der kritischen Ebene der ethischen Reflexion liegt der Handlungsutilitarismus: Hat man genügend Zeit, Raum, Information und philosophisch-analytische Kompetenz, kann eine Nutzenerwägung sehr differenziert ausfallen. Auf der intuitiven Ebene hingegen brauchen wir bei Fehlen dieser Voraussetzungen einfache Regeln, wie sie der Regelutilitarismus empfiehlt. In den letzten Jahren sind die Debatten um gewisse Aussagen des australischen Ethikers Peter Singer außerordentlich heftig geführt worden. In seinem Buch Praktische Ethik vertritt er unter anderem die These, dass in gewissen Fällen aktive Euthanasie moralisch vertretbar sei. Sätze wie "die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht" lösten, nachdem sie kontextfremd in öffentlichen Publikationen Eingang gefunden hatten, eine Welle des Protestes und der Empörung aus. Seine Auftritte in Deutschland und der Schweiz wurden durch öffentlichen Protest verhindert, eine differenzierte Diskussion unter optimalen "herrschaftsfreien Diskursbedingungen" (Habermas) konnte nicht stattfinden. Doch Peter Singer "ist kein Einzelfall, kein zynischer Außenseiter; seine Überlegungen stehen im Zusammenhang der Wiederaufnahme utilitaristischer Ethikkonzepte in der analytischen Philosophie angelsächsischer Prägung. Die Empörung über Singers Äußerungen hat diesen Kontext oft gar nicht zur Kenntnis genommen und damit auch nicht die Herausforderung, die andererseits in Thesen der Praktischen Ethik besteht, die etwa das Recht der Tötung von Tieren bestreiten."24 Singer versucht insbesondere, den Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit in seine Folgenabschätzungen einzubeziehen. Ziel ist eine unparteiische und maximale Befriedigung von Präferenzen, d.h. Interessen oder Wünschen. Moralisch richtig sind Handlungen dann, wenn die Konsequenzenabwägung keinen Unterschied macht, wem die guten Folgen zuteil werden. Wie aber kann ein solches Gleichheitsgebot oder Diskriminierungsverbot utilitaristisch gerechtfertigt werden? Wie würden Sie entscheiden, welchem von fünf bedürftigen Patienten Sie eine zeitlich und materiell nur einmal verrichtbare pflegerische Zuwendung zukommen lassen oder wer ein Spenderorgan erhält? Lektüre: Lesen Sie Singers 1994 revidierte und erweiterte 2. Auflage seiner "Praktischen Ethik"25, insbesondere die Kapitel 11 und 12 sowie den im Anhang angeführten Aufsatz "Wie man in Deutschland mundtot gemacht wird". Versuchen Sie die utilitaristischen Elemente und Argumente wiederzuentdecken und sich die Probleme dieses Ansatzes klarzumachen getreu der Devise Piagets "Nur aus Fehlern lernt man."! Als Gegenfolie eignet sich Hans Jonas: Technik, Medizin und Ethik. Praxis des Prinzips Verantwortung. Frankfurt a.M. 1985. 22 Hare, R.M.: Moral thinking. Its levels, methods and points. Oxford 1981; deutsch: Moralisches Denken 1992. Singer, Peter: Praktische Ethik. 2. revidierte und erneuerte Auflage, Stuttgart (RUB8033) 1994. 24 Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie. München (4) 2000, S.461f. 25 Singer, Peter: Praktische Ethik. 2. revidierte und erneuerte Auflage, Stuttgart (RUB8033) 1994. 23 29 2.6 Der negative Utilitarismus Angesichts der bekannten Schwierigkeiten des klassischen Utilitarismus versuchte Karl Popper (und vor und nach ihm weitere Ethiker26) parallel zu seinem wissenschaftstheoretischen auf Ch. S. Peirce (1839-1914) zurückgehenden pragmatizistischen Fallibilismuskonzept einen negativen Utilitarismus zu begründen. Wie Smart vertritt er die Auffassung, dass es unmöglich sei, die Richtigkeit eines ethischen Prinzips zu begründen, weil es keine rationale, wissenschaftliche Basis für die Ethik gäbe. Dennoch sei es geboten, mit der Sprache der Vernunft ethische Ansätze kritisch zu untersuchen, was dazu führe, dass man sich vermittels eines trial-and-error-Prozesses allmählich einem besseren Grenzwert nähere: der Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen. Popper schlägt vor, anstelle eines Strebens nach nicht stichhaltig begründbaren Glücksgütern eine Strategie der Vermeidung von Unglücksgütern anzustreben: Not, Elend, Ungerechtigkeit, Leid und Grausamkeit gilt es zu minimieren: "Vermindere das Leiden, so sehr du nur kannst."27 Diese vage Formel garantiert für sich genommen allerdings noch keine damit automatisch verbundene Optimierung oder Maximierung von Glücksgütern. Popper war sich dieser Vagheit bewusst und präzisierte sie durch die Ergänzung: Statt „die grösste Glückseligkeit für die grösste Zahl "sollte man - etwas bescheidener - das kleinste Maß an vermeidbarem Leid für alle fordern."28 Popper nennt einige Gründe, die für einen negativen Utilitarismus sprechen. - - - - - "Gutes" zu fordern bringe nichts, da moralische Probleme nicht durch Definitionen lösbar werden, sondern nur durch die Beseitigung von Übeln für bessere Lebensbedingungen gesorgt werden könne. Der klassische Utilitarismus mit seiner Forderung nach größtmöglichem Glück gehe deshalb fehl, weil die Auffassungen von "Glück" von Mensch zu Mensch sehr divergieren. Eine Vermittlung sei hier weder sinnvoll noch praktisch realisierbar. Popper warnt immer wieder vor einer "staatlichen Zwangsbeglückung", indem er sagt: "Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle."29 Die Sozialpolitik dürfe mithin nicht einfach ihre jeweilige Wertbasis den Betroffenen aufzwingen, sondern Bedingungen zu schaffen, die es den Betroffenen ermöglichen, ihre je eigene Wertbasis bestimmen zu können. "Meiner Meinung nach [...] enthält das menschliche Leiden einen direkten moralischen Appell, nämlich den Appell zu helfen, während keine ähnliche Nötigung besteht, das Glück oder die Freude eines Menschen zu vermehren, dem es ohnehin gut geht."30 "Es trägt zur Klarheit auf dem Gebiet der Ethik wesentlich bei, wenn wir unsere Forderungen negativ formulieren."31 26 Smart, R.N.: Negative Utilitarism. 1958; Strotzka, H.: Fairneß, Verantwortung, Fantasie. 1983; Kaufmann, A.: Negativer Utilitarismus. 1994. Siehe dazu: Zecha, G.: Negativer Utilitarismus. In: Ethica; 9 (2001) 3, S. 267291. 27 Popper, K.: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Band I: Der Zauber Platons. Tübingen 1994, S. 290. 28 Popper, K.: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (I), S. 362. 29 Popper, K.: a.a.O., (II), S. 277. 30 Popper, K.: a.a.O., (I), S. 362. 31 Popper, K.: a.a.O.,(I) S. 362 30 Aufgabe: Formulieren Sie Vor- und Nachteile, die Sie in Poppers Ansatz eines Negativen Utilitarismus sehen. Wie beurteilen Sie dessen Relevanz für eine Ethik in der Pflege? 2.7 Verantwortungsethik (H. Jonas, K.-O. Apel) Max Weber prägte 1919 in seinem Vortrag „Politik als Beruf“ den Begriff der „Verantwortungsethik“, um das Einstehen für die Wahl der Mittel sowie für die Folgen und Nebenfolgen von Handlungen zu bezeichnen. Verantwortungsethik steht im Gegensatz zur „Gesinnungsethik“ bzw. zu einer religiös motivierten „absoluten Ethik“: Es ist „ein abgrundtiefer Gegensatz, ob man unter einer gesinnungsethischen Maxime handelt – religiös geredet: ‚Der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim’ -, oder unter der verantwortungsethischen: dass man für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat“32. Die Verantwortungsethik rechnet insbesondere mit den „durchschnittlichen Defekten der Menschen“, es gebe kein Recht, „Güte und Vollkommenheit“ bei Menschen vorauszusetzen. Anthropologisch bedeutsam ist hier das an Hobbes orientierte realistische Menschenbild im Sinne des homo homini lupus (‚der Mensch ist des Menschen Wolf’ nach Plautus), das hinter utilitaristischen Ansätzen aufscheint. Positiv formuliert könnte man es aber auch als zumutungsarm kennzeichnen: der Mensch wird als frei von - wie der Geschichtsverlauf zeigt scheinbar guten Gesinnungen konzipiert und mutet sich und anderen deshalb nur wenig zu. Im Zuge des rasanten technischen Wandels in Ökologie und Medizin wurden Fragen der Technikfolgenabschätzung immer dringlicher. Hans Jonas konzipiert eine Verantwortungsethik als teleologisch-ontologische „Zukunftsethik“, die auf Verantwortung als Prinzip gründet: „die Möglichkeit, dass es auch zukünftig Verantwortung gebe, ist die allem vorausliegende Verantwortung.“33 K.-O. Apel erweitert seine Diskursethik zu einer „geschichtsbezogenen“34 Verantwortungsethik. In ihr soll die „Zumutbarkeit von Anwendungen“ kommunikationsethischer Prinzipien in einer historischen Situation überprüft werden. Aufgabe: Versuchen Sie herauszufinden, auf welche Weisen der Begriff der Verantwortung gedacht werden kann, wie er funktioniert und welche Möglichkeiten und Grenzen er für die pflegerisch-ethische Auseinandersetzung im konkreten Anwendungsfall haben könnte. Wann ist wem bezüglich welcher Werte über wen oder was Verantwortung beizumessen / zuzumuten? 2.8 Probleme utilitaristischer Ansätze Bewertungsproblem: Wie erfolgt die Bestimmung des Gutes? Wie Sie aus der Auseinandersetzung mit den Beispielen vielleicht bemerkt haben, gibt es bestimmte Probleme bei der Durchführung einer Folgenabschätzung. Zunächst einmal ist gar nicht klar, welches das geeignetste Gut oder Glück aller sein soll, das man ins Auge nimmt. Bereits unter den klassischen Vertretern des Utilitarismus herrschte darüber Unklarheit. Geht es um die Qualität des Glückes, das optimiert werden soll? Wenn mehrere Werte optimierbar sind, welche werden bevorzugt nach welchen Kriterien? Ist beispielsweise "Schmerzfreiheit" des Patienten ein in jedem Falle anzustrebender Endzweck? Wie verhält es 32 Weber, Max: Politik als Beruf (1919), in: Ges. Polit. Schriften, (4) 1980, 551f. Jonas, H. Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt a. M. 1980, S. 186. 34 Apel, K.-O.: Diskurs und Verantwortung. Frankfurt a. M. 1990., S. 134. 33 31 sich mit der Quantität des Wertes: Soll er maximiert oder angemessen gestaltet werden? Worin liegt das "Optimum"? Wie lassen sich – ohne Rückgriff auf „gesinnungsethische“ Normen und Werte – die Mittel und Folgen von Handlungen qualifizieren? Ist der strenge Gegensatz zwischen deontologischer Gesinnungsethik und utilitaristischer Verantwortungsethik aufrechtzuerhalten – oder ergänzen sich nicht beide vielmehr? Sind Folgen abschätzbar? Ein weiteres Problem besteht in der praktisch kaum oder nur schwer durchzuführenden Folgenabschätzung. Prognosen sind - wissenschaftstheoretisch betrachtet - Induktionsschlüsse. Induktionsschlüsse sind aber, wie Aristoteles vermutet und Hume gezeigt hat, allesamt logisch ungültig. Dem amerikanischen Philosophen Nelson Goodman gelang in seinem lesenswerten Buch Fact, Fiction, Forecast eine gravierende Verschärfung dieses Problems. Das Hauptargument von Hume für die Ungültigkeit von Induktionsschlüssen lautet, dass wenn wir fragen, ob etwas Erwartetes in Zukunft eintreffen wird, wir üblicherweise darauf verwiesen werden, dass das Erwartete schon immer mit einer gewissen Regelmäßigkeit eingetreten ist, und es deshalb so und so wahrscheinlich ist, dass es wiederum eintreten wird. Fragt man nun, warum dies denn immer wieder eingetreten ist, so zeigt sich, dass man annimmt, dass Vergangenheit und Zukunft gleichförmig sind. Fragt man nach der Legitimation dieser "Gleichförmigkeit", so wird man wieder auf die Phänomene der regelmäßig aufgetretenen Ereignisse verwiesen. Dies aber ist zirkulär: Dasjenige, was zu zeigen ist, wird stillschweigend vorausgesetzt. Solche Argumentationen sind logisch betrachtet ungültig. Wir werden in weiteren ethischen Ansätzen sehen, wie evtl. dennoch mit "guten Zirkeln" argumentativ gewinnbringend operiert werden kann. Wenn Gewissheit nicht zu haben ist, tritt die Eintreffenswahrscheinlichkeit als kompensatorisches Element ins Blickfeld. Ohne hier eine grundlegende wissenschaftstheoretische Kritik ins Feld zu führen, sei exemplarisch auf die Schwierigkeiten der Interpretierbarkeit von statistischen Erhebungen hingewiesen, wie sie Beck-Bornholt und Dubben35 erarbeitet haben. Treten Folgen aufgrund von Voraussagen ein? Es kommt aber noch schlimmer: Selbst wenn sich unsere Voraussagen und Folgenabschätzungen bewähren, d.h. tatsächlich wie vorausgesagt eintreten sollten, so können wir nicht wissen, ob sie gerade wegen unserer Voraussagen eingetreten sind, oder nur zufällig aufgrund ganz anderer, uns unbekannter Faktoren sich so zeigen, wie sie sich uns zeigen. Dieses Problem wird in der Sprache der Wissenschaftstheorie das Verifikationsproblem genannt. Kann einem Expertenrat vertraut werden? Unbefriedigend ist aus medizinisch-pflegerischer Sichtweise zudem, dass die Folgenabschätzungen bei zahlreichen Fällen aufgrund der Komplexität eines medizinischen Sachverhaltes derart schwierig zu ermitteln sind, dass man zur ethischen Abwägung auf das Wissen von Experten zurückgreifen muss. Diese Fremdbestimmtheit (Heteronomie) ist für die 35 Beck-Bornholt, Hans-Peter und Dubben, Hans Hermann: Der Hund, der Eier legt. Erkennen von Fehlinformation durch Querdenken. Hamburg 2001; sowie: Dieselben: Der Schein der Weisen. Irrtümer und Fehlurteile im täglichen Denken. Hamburg 2001. 32 ethische Entscheidungsfindung problematisch: Welche Aussagen und Darstellungen sind nicht von anderweitigen Interessen "gefärbt"? Welche Aussagen sind in welchem Grade verlässlich? Wer ist Subjekt der Verantwortung? Wenn utilitaristische Folgenabschätzungen gemacht werden: Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Ist die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilbar? Wenn ja, wie? Wenn nein: gibt es eine kollektive Verantwortung? Wer aber ist dann Träger der Verantwortung? Wenn es eine mehrfache Verantwortung gibt, - z.B. gegenüber dem Patienten wie auch gegenüber den Vorgesetzten, dem Berufsethos, den ökonomischen Bedingungen, der Gesellschaft -, wie sind diese untereinander zu hierarchisieren und zu bewerten? Welche Rolle spielen Verantwortungsbewusstsein oder Verantwortungsgefühl bei der Anwendung eines utilitaristischen Ansatzes? Eindeutige Kriterien - schwierige Abschätzung Ein eigentümliches Dilemma des Moralkriteriums utilitaristischer Ansätze besteht darin, dass es einerseits verlässlicher und eindeutiger ist, als die von den meisten anderen normativen Ethiken angebotenen Kriterien, dass andererseits aber die Vorschrift, bei der Entscheidung zu einer bestimmten Handlung die gesamten wahrscheinlichen Konsequenzen der Handlung zu berücksichtigen, seine Anwendung ungemein erschwert. Die Entscheidung wird dadurch erleichtert, dass sie sich nicht auf die Stimme des Gewissens, auf Intuition oder Gefühle verlassen muss (alles Instanzen, die bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedliche Handlungen nahelegen können), sondern auf das empirisch-wissenschaftliche Einverständnis darüber, welche Handlungen die Betroffenen am ehesten glücklich oder am wenigsten unglücklich machen. Gerechtigkeitsproblem: Maximales Glück - für alle gleichviel? Utilitaristische Ansätze reden zwar von Nutzenoptimierung, können aber das Problem der Nutzenverteilung nicht begründen: Wie soll Verteilungsgerechtigkeit begründet werden? Gibt es in gewissen Situationen Präferenzen, die dem Nutzenprinzip für einige Beteiligten zuwiderlaufen? Welcher ethische Ansatz kann diese Frage klären? Zudem muss das Problem der Glücksverteilung unter allgemeinen Gütern (Gemeinwohl) und einzelnen Gütern (Individualwohl) im Konfliktfall gelöst werden können. Was ist etwa zu tun, wenn es für alle Beteiligten und deren allgemeinen Nutzen gut wäre, lebenserhaltende Maßnahmen eines Patienten zu unterbinden, für das Individuelle Gut des Patienten aber mit dem Tode verbunden wäre? Wie soll etwa eine Organspende ohne Rekurs auf den Aspekt der "Fairneß" erfolgen? Wie sollen "Sündenbockfälle" oder rechtliche Präzedenzfälle utilitaristisch gerechtfertigt werden? Wie Werte ermitteln? Ein weiteres Problem ist dasjenige, dass der moralische Wert einer Handlung reduziert wird auf die Bestimmung von (im worst-case-Fall: fremdbestimmten) Werten der Folgen, die optimiert werden sollen. Es gibt sehr viele Werte: ein eindeutiges Wertauswahlkriterium für jede ethisch konfliktträchtige Situation ist schwierig zu ermitteln. Dies hat manche Utilitaristen bewogen, 33 zum Nützlichkeitsprinzip weitere abgeleitete Regeln (Sekundärregeln) zu formulieren, die für bestimmte Situationen bestimmte Handlungsweisen vorschreiben und so die Folgenabschätzung vereinfachen. Andere haben versucht, Gefühle wie Sympathie (A. Smith) oder personale Lust (J.J.C. Smart) als Wertbasis zu verwenden. Sozialethisch orientierte Utilitarismen wiederum versuchen, das Gemeinwohl als Wert höher einzustufen, als individuelle Werte (J.S. Mill, R.B. Brandt). Die Frage, wie Werte erhoben und selbst bewertet werden, ist entscheidend für jede ethische Analyse eines Problems oder eines Ansatzes. Quelle: Legitimation: Eigenschaft: Legitimation: Woher kommen die vorgeschlagenen Werte? Wie wird diese Auswahl legitimiert? Sind alle vorgeschlagenen Werte gleichwertig oder hierarchisch geordnet? Wie wird die jeweilige Eigenschaft begründet? Vermittlung intra- und interpersonaler Werte? Wenn die Wertbasis von utilitaristischen Auffassungen so bestimmt wird, dass sowohl intrawie auch interpersonale Werte als erstrebenswert bewertet werden, dann ergeben sich gleich mehrere Folgeprobleme. Zum einen muss geklärt werden, ob allgemeine Werte in allen Fällen vor individuellen Werten den Vorrang haben sollen oder umgekehrt. Zweitens entsteht hieraus das Problem, dass einerseits gewisse moralische Üblichkeiten in einer Gruppe oder Gesellschaft bereits bestehen. Ist es im Konfliktfall moralisch richtig, den üblichen Moralvorschriften zu folgen (Moralbefolger) oder sollen geltende Regeln bei größerem Nutzen gebrochen und reformiert werden (Moralreformer)? Moralbefolgung wird schnell "unethisch" weil unreflektiert und erhält den Anstrich "unwissenschaftlich" zu sein, Moralreform lädt das Folgeproblem auf sich, dass das allgemeine Gebot, herrschenden Moralvorstellungen Folge zu leisten, insgesamt geschwächt wird. Wie bestimmt der Utilitarist die Utilität seines Utilitarismus? Ein Paradoxon zum Nachdenken: Angenommen, ein Utilitarist muss durch Anwendung seiner Folgenabschätzung erkennen, dass z.B. eine tugendethische Position bessere Konsequenzen zeitigt, als sein eigener Ansatz. Muss er dann seine Position folgerichtig aufgeben oder bestätigt die Anwendung dieser Folgenabschätzung nicht gerade wieder seine utilitaristische Position? Was ein Utilitarist in keinem Fall darf, ist zu sagen: „Es ist gerecht, dem Utilitarismus zu folgen.“ (denn dann vertritt er eine Tugendethik) oder: "Es ist, nach rationaler Prüfung, eine unbedingte Pflicht, dem Utilitarismus zu folgen." (denn dann vertritt er ein deontisches Pflichtelement, das unbedingte Geltung einfordert und im Unterschied zum Regelutilitarismus keine Ausnahme duldet). Keine Regel ohne Ausnahme Eines der schlagenden Argumente der Utilitaristen für den Utilitarismus und gegen deontologische Ethiken ist dasjenige, dass "Faustregeln" besonders für Handlungsutilitaristen (wie Smart) verletzbare Regeln sind: "Keine Regel ohne Ausnahme" bedeutet hier, dass die Ausnahmen geradezu die Regel erst konstituieren, während deontologische Ethiken beanspruchen, dass ihre Regel unverletzbar seien und unbedingte Geltung einfordern würden. 34 Utilitaristische Überlegungen notwendig, aber nicht hinreichend Wenn man sich selber im täglichen Handeln beobachtet, stellt man mit utilitaristischem Theorieblick schnell fest, wie stark Folgenabschätzungen das menschliche Handeln bestimmen. Nur schon die ökonomische Profitabschätzung ist als eine der zentralen verhaltenssteuernden Methoden gesellschaftlich stark verankert. Dass schwer bestimmbare Folgenabschätzungen aber nicht hinreichende Bedingungen für moralische Güte sein können, wird bei schwierigen Pflegefällen, wo es beispielsweise um den Autonomieverlust von Patienten geht, schnell ersichtlich. Hier sind Folgen allein nicht abschätzbar. Diese Unverzichtbarkeit auf utilitaristische Aspekte unter gleichzeitigem Einbezug theoriefremder Elemente aus Tugendoder Deontologischen Ethiken haben zahlreiche Ethiker (wie etwa Hans Jonas) dazu bewegt, komplexere Formen ethischer Theorien zu entwickeln, die diesen Schwierigkeiten Rechnung zu tragen versuchen. Zusammenfassung von Vor- und Nachteilen utilitaristischer Ansätze für die Pflege: Vorteile: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Nachteile: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Wert und Relevanz utilitaristischer Überlegungen für die Pflegeethik ___________________________________________________________________________ 35 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2.9 Literatur zum Utilitarismus Mill, John Stuart: Der Utilitarismus. Stuttgart, RUB 9821, 1985. Bentham, Jeremy: Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und der Gesetzgebung. In: Gawlick, Günter (Hg.): Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Band 4: Empirismus. Stuttgart, RUB 9914, 1985, S. 246-272. Brody, H.: Ethical dimensions in medicine. Hart, H.L.A.: Die utilitaristische Rechtfertigung der Strafe und ihre Grenzen. In: H.L.A. Hart: Recht und Moral. Drei Aufsätze. Göttingen 1971. Hoerster, Norbert: Utilitaristische Ethik und Verallgemeinerung. Freiburg und München 1977. Plenter, Christel: Ethische Aspekte in der Pflege von Wachkoma-Patienten. Orientierungshilfen für die Pflegeethik. Hannover 2001, S.107ff: Der Utilitarismus. Smart, J.J.C.: Handlungsutilitarismus und Regelutilitarismus. Identisch mit: J.J.C. Smart: Extremer und eingeschränkter Utilitarismus. In: Otfried Höffe (Hg.): Einführung in die utilitaristische Ethik. Klassische und zeitgenössische Texte. München 1975, S. 121-132. Williams, Bernard: Kritik des Utilitarismus. Frankfurt a. M. 1979. 36 3. Deontologische Ethik Im Gegensatz zu einer utilitaristischen Ethik bestimmt die deontologische Ethik die moralische Richtigkeit von Handlungen nicht ausschließlich daran, ob und in welchem Umfang eine Handlung Gut, Glück, Lust, Erkenntnis etc. verschafft, sondern auch oder ausschließlich daran, ob die Handlung von ihrer bestimmten inneren Beschaffenheit ist oder Handlung eines bestimmten Typs ist. Moralische Normen wie die, seine Versprechen zu halten, keine Unwahrheit zu sagen oder seine Schulden abzugelten, sind für eine deontologische Ethik in sich selbst, ungeachtet der Folgen der vorgeschriebenen Handlung, gültig. Sie büßen selbst dann ihren Wert nicht ein, wenn die Folgen der Anwendung einer vorgeschriebenen Handlung schlechtere Folgen zeitigen als z.B. ihre Nichtbefolgung. Die deontologische Ethik wird deshalb auch Pflichtethik (von gr. tò d¡on: die Pflicht, das Erforderliche), von Max Weber auch "Gesinnungsethik" genannt. Dieser Ansatz wurde in seiner extremen Ausformung als Pflichtenfanatismus wohl von keinem Ethiker ernsthaft vertreten. Selbst in Immanuel Kants "Grundlegung der Metaphysik der Sitten" finden sich in den fünf verschiedenen Versionen des "kategorischen Imperatives" utilitaristische Elemente, die die abstrakten Pflichten auf ausgezeichnete Zwecke hin zu konkretisieren versuchen. Deontologische Ethiken sind von Formen des Regelutilitarismus wohl zu unterscheiden: Während der Regelutilitarist die Verbindlichkeit einer jeden Regel (Sekundärregel) allein an der gesellschaftlichen Nützlichkeit misst, beanspruchen deontologische Ansätze, dass ihre Pflichtprinzipien in sich selbst, d.h. unbedingt verbindlich sind. Die deontologischen Ansätze der Ethik berufen sich somit auf "höhere" Standards zur Beurteilung der Moralität einer Handlung als etwa auf deren möglichen Folgen. Eine nahe liegende Möglichkeit liegt in der Berufung auf Offenbarungswissen. Wenn jemand glaubt, dass Gebote der Moral theogon (gottentsprungen) seien, dann beurteilt er oder sie eine Handlung als moralisch gut, wenn sie mit den Prinzipien dieser Gebote übereinstimmen ungeachtet der Konsequenzen oder des situativen Kontextes der Handlung. So glaubte etwa Jeanne d'Arc, dass sie aufgrund von göttlichen Eingebungen moralisch richtig handle. Lektürehinweis: Lesen sie zum Dilemma theologischer Moralbegründung Platons Dialog "Euthyphron"! Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für ethische Diskurse, wenn religiöse Pflicht- und Wertvorstellungen mit unbedingtem Geltungsanspruch an einem Dilemma beteiligt sind? Im Bereich der Pflege können solche deontologischen Gebote unter Rekurs auf Offenbarung dann zu schwierigen Diskursen führen, wenn unvereinbare Gebote der Diskurspartner (etwa aufgrund unterschiedlicher religiöser Moralkodizes und Gewichtung derselben) zur Debatte stehen. Wie man sich dann am besten verhält, ohne in fundamentalistische Diskursfallen zu tappen, soll später anhand ethischer Diskursmethoden problematisiert werden. Wie bereits bei den Utilitaristen teilen sich die Deontologen in zwei Lager auf: Handlungs- und Regeldeontologen. 37 3.1 Der handlungsdeontologische Ansatz (J. Fletcher36) Handlungsdeontologische Theorien behaupten, dass alle grundlegenden Verpflichtungsurteile reine Einzelurteile seien von der Form "In dieser Situation sollte ich so und so handeln", während allgemeine Urteile wie "Man sollte seine Versprechen halten" nicht möglich, nutzlos oder allenfalls aus Einzelurteilen ableitbar seien. Extreme Handlungsdeontologen vertreten die Ansicht, dass wir in jeder Situation von neuem sehen und entscheiden können und müssen, was moralisch richtig oder pflichtgemäß ist, ohne uns dabei auf irgendwelche Regeln oder Folgenabschätzungen zu berufen. Andeutungsweise vertrat Aristoteles eine solche Auffassung, wenn er schreibt, in der Bestimmung der goldenen Mitte "liegt die Entscheidung bei der unmittelbaren Wahrnehmung". Joseph Butler lehnt ebenfalls jeglichen Regelrekurs ab: "Angenommen, ein aufrechter, ehrlicher Mensch fragt sich, bevor er sich auf eine Handlung einlässt: Ist diese Handlung richtig oder falsch? Ich zweifle nicht im Mindesten, dass fast jeder anständige Mensch in fast jeder Situation diese Frage wahrheits- und tugendgemäß ohne Zuhilfenahme einer allgemeinen Regel beantworten wird." 37 Das auffallendste Merkmal dieser Ansätze ist, dass sie uns keinerlei Kriterium bieten, gemäß dem entschieden werden kann, welche Handlung im Einzelfall moralisch wertvoller sei. Sie besagen vielmehr, dass moralische Einzelurteile grundlegend sind und aus ihnen (wenn überhaupt) alle weiteren Regeln abgeleitet werden müssen und nicht umgekehrt. Wie aber kann dies gelingen? Intuitionisten berufen sich auf "Intuition", eine Art moralisches Einfühlungsvermögen, Existentialisten hingegen würden sich auf die "Entscheidung" berufen, die eine gute Wahl ermögliche. Die sich daraus ergebenden Probleme liegen auf der Hand: Wie gelangen Menschen, denen es offensichtlich an so etwas wie "moralischer Intuition" mangelt, zu dieser, ohne dass Regeln befolgt werden müssten? Ja: Können wir in einer modernen Welt ohne Regeln auskommen? Man denke nur an den Zeitverlust aufwendiger Analysen oder die Erziehung. Zudem haben ethische Prinzipien und moralische Gebote oft einen universalistischen Anspruch: Sie gelten implizit für alle Menschen in vergleichbaren Situationen. Wie will ein situativ nach handlungsdeontologischen Methoden Entscheidender konsequent in vergleichbaren Situationen handeln, ohne Verallgemeinerung von Teilaspekten einer Situation? Vorteile dieser Theorien liegen im Ausgangspunkt der Unzufriedenheit mit herrschenden Normen, die in jeder Einzelsituation nie ganz "passen". Dagegen kann aber eingewendet werden, dass dieses "Nicht-ganz-Passen" nicht automatisch bedeutet, dass sich ähnliche Situationen nicht partiell verallgemeinern ließen, damit Regeln entwickelt werden können. Weitere Einwände gegen diese Position betreffen technische Details, wie etwa das Problem der Erfassung einer einzigartigen, singulären Situation: Wie kann diese ohne Rekurs auf abstrahierte Allgemeinbegriffe und Prinzipien erfolgen? 36 Fletcher, Joseph: Situation Ethics. Butler, Joseph: Fifteen Sermons (1726), zit. nach Frankena, W.K.: Analytische Ethik. München (5) 1994, S. 35f. 37 38 3.2 Der regeldeontologische Ansatz (I. Kant38, W.D. Ross39) Regeldeontologen vertreten die Ansicht, dass der moralische Beurteilungsmaßstab in einer oder mehreren Regeln oder Prinzipien besteht, die konkret oder sehr abstrakt sein können. Im Gegensatz zu teleologisch orientierten Ansätzen halten sie daran fest, dass diese Regeln unabhängig davon, ob sie zu guten Konsequenzen führen oder nicht, Handlungen als moralisch gut legitimieren, die unter diese Regel fallen. Gegen die Handlungsdeontologen behaupten sie, dass ihre Regeln und Prinzipien grundlegender Natur seien und einzelne konkrete Urteile sich aus ihnen ableiten ließen. Im Unterschied zu Regelutilitaristen, die ihre Regeln geradezu aufgrund von Ausnahmen begründen (etwa wenn nur 10 % aller Fälle nicht unter eine Regel fallen, so konstituieren diese gerade die Regel), beanspruchen Regeldeontologen für ihre Regeln und Prinzipien unbedingte Geltung unabhängig von möglichen Konsequenzen oder möglichen Ausnahmen. Typische Gebote, Regeln bzw. Prinzipien sind etwa: Das Gebot, Versprechen zu halten. Das Gebot, Vereinbarungen einzuhalten. Das Gebot, die Wahrheit zu sagen (Lügenverbot). Das Tötungsverbot. Das Diskriminierungsverbot. Das Prinzip der Menschenwürde. etc. Haupteinwand hiergegen ist das Argument der Regelutilitaristen: Keine Regel ohne Ausnahme. Die Regeldeontologen könnten im Falle des Auftretens von Ausnahmen zu ihren Regeln diese aber entsprechend erweitern, so dass sie wieder eine allgemeine Geltung beanspruchen können: "Man soll nicht lügen" könnte durch die Ausnahme der Notlüge zur neuen Regel "Man soll nicht lügen, außer wenn es sich um eine Notlüge handelt" erweitert werden. Wie man allerdings entscheiden kann, ob im konkreten Fall eine Notlüge angebracht ist, was im Bereich der Pflege bei Wahrheitsvorbehalten gegenüber Patienten oft der Fall ist, kann uns ein regeldeontologisches Prinzip nicht vermitteln: es ist meist zu allgemein oder zu abstrakt. 3.3 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz im mir.40 Kant hat auf ein Problem, das sich bei Regeldeontologen aus der Situation sich widerstreitender Prinzipien ergibt, mit dem Versuch reagiert, ein einziges Moralprinzip zu formulieren, das für alle moralischen Entscheidungen wirksam sein kann, die einem Individuum unterlaufen können. Man kann hier auch von einem regeldeontologischen Monismus sprechen. Dieses Prinzip sieht Kant im berühmten "kategorischen Imperativ" begründet, der es jedem rational unabhängig denkenden Subjekt ermöglichen soll, sein Handeln als je moralisch gutes erkennen und ausweisen zu können. 38 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). Kritik der praktischen Vernunft (1788). Hrsg. v. W. Weischedel. Band 6, Darmstadt (5) 1983. Metaphysik der Sitten (1797). Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen (1797). Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (1793). Hrsg. v. W. Weischedel. Band 7. Darmstadt (5) 1983. 39 Ross, William David: Foundations of Ethics. Oxford 1963. 40 Kant, I.: Kritik der praktischen Vernunft. A 289. Hrsg. v. W. Weischedel. Darmstadt (5) 1983, S. 300. 39 An dieser Stelle werden nur zwei Elemente aus Kants Ethik herausgegriffen, weil sie im Hinblick auf eine Erweiterung der moralischen Kompetenz für die Pflege wertvoll erscheinen: Der kategorische Imperativ und Kants Unterscheidung von pflichtgemäßen Handlungen und Handlungen aus Pflicht. Damit wird weder der Anspruch befriedigt, die Kantische Ethik exemplarisch darzustellen (dazu fehlt uns in diesem Rahmen leider die Zeit), noch wird dieser Ansatz hinreichender Kritik unterzogen werden können. Dazu müsste ein intensives Studium der Quellentexte erfolgen, das wiederum die Ergebnisse aus Kants Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der Urteilskraft mitbedenken sollte, um besser verstehen zu können, worin Kants Ansatz genau besteht und welche Missverständnisse darüber immer wieder aufkeimen. Lektürehinweis: Trauen Sie Sich, wenn Sie etwas mehr Zeit haben, ruhig trotzdem einmal das Wagnis zu, Kants "Grundlegung der Metaphysik der Sitten" zu lesen. Einmal eingelesen, werden Ihnen Kants Überlegungen verständlicher besonders vor dem Hintergrund differierender Ansätze zur Ethik. In welchen pflegeethischen Dilemmasituationen sind unbedingte Prinzipien als Rekursstationen ethischer Begründung angebracht? Hypothetische und kategorische Imperative Kant unterscheidet das, was er als Pflicht auffasst, in der Form von gebietenden Sollenssätzen, als "Imperative". Er kennt einerseits hypothetische Imperative der Geschicklichkeit und solche Imperative, die kategorisch, d.h. unbedingt gebieten, was als moralisch wertvolle Handlung gilt. Hypothetische Imperative sind bloße pragmatisch-instrumentelle Klugheitsgebote, die besagen, welche Mittel man einsetzen sollte, sofern man ein bestimmtes Interesse optimal verfolgen will. Sie können deshalb stets nur auf bedingte (hypothetische), nicht unbedingte Gültigkeit Anspruch erheben. Beispiel: Wenn sie das Lernklima unter ihren Pflegestudenten verbessern möchten, dann sollten sie dafür sorgen, dass der Unterricht lebensnah und lebendig gestaltet werden kann. Man kann solche hypothetischen Imperative durchaus mit demjenigen Handlungstyp vergleichen, den wir in der Einleitung dieses Skripts als instrumentell richtige/falsche Handlung beschrieben haben. Sie sind, auch nach Kant, bei einem Gelingen noch lange nicht auch moralisch gut oder schlecht, Kant nennt sie deswegen manchmal bloß "moralkonform" und nicht "aus Moralität geschehend". Kategorische Imperative sind inhaltlich spezifischere Pflichtprinzipien, die dem kategorischen Imperativ als oberstem formalem Prinzip unbedingt (kategorisch) genügen müssen. Wir finden bei Kant fünf verschiedene Formulierungen: 1. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. 2. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. 3. Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchest. 4. Handle nur so, dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könne. 40 5. Jedes Vernunftwesen muss so handeln, als ob es durch seine Maxime jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reich der Zwecke wäre. Alle Versionen sind in einer Unzahl von Varianten kritisiert, gelobt, erweitert oder karikiert worden. Man kann die erste, weil sie von so auffallender Abstraktheit ist, monistisch als den kategorischen Imperativ betrachten, der zu Handlungen auffordert, die nicht in Bezug auf etwas anderes, sondern als solche für sich selbst gut sind (unabhängig von Situation, Folgen, Zeit, Kultur oder Einzelperson). Kant selber entwarf ihn als Gegenmodell gegen teleologische Ethiken, die immer meinen, ein Ziel (telos) als letztlich anzustrebenden Glückszustand ausmachen zu können. Seine Absicht lag darin, die offensichtliche Verwirrung, die bei der Bestimmung von Glücksgütern entsteht, durch die Formulierung eines in sich selbst guten formalen Prinzips auszuräumen, indem er sowohl die Freiheit und Würde des Menschen im Begriff der Autonomie als auch seine Gebundenheit an das selbst gesetzte allgemeine oberste Sittengesetz in Verbindung brachte. Kant will seinen kategorischen Imperativ als unbedingt (objektiv), notwendig und allgemeingültig verstanden wissen. Warum dies möglich sein soll, erklärt er in seinen Kritiken: Weil der Wille genau dann gut ist, wenn die Vernunft autonom und in Freiheit entscheidet, kann ein oberstes Moralprinzip formuliert werden, das als oberstes Sittengesetz in Form eines Testverfahrens (dem kategorischen Imperativ) erlaubt, Handlungen nicht nur als pflichtgemäß, sondern als moralisch gut ("aus Pflicht") einzustufen. Was aber hindert den Menschen daran, dies zu tun? Kant kennt als zweite Quelle, die den Willen davon abhält, gut zu sein, die Neigung. Sie entspringt aber dem empirischen Bereich der Phänomene und ist Kant, der seinen Ansatz aus einer Fundamentalkritik am englischen Empirismus entwickelt hat, begründetermassen suspekt. Aufgabe: Versuchen sie den kategorischen Imperativ (in einer oder mehreren Varianten) am Beispiel eines pflegeethischen Dilemmas durchzudenken und anzuwenden. Welche Probleme ergeben sich dabei? Beispiel: Ein Patient versuchte erfolglos, sich nach schrecklichen intensiven Schmerzzuständen umzubringen. Wie begründen sie ihre Entscheidung, ihm klarzumachen, dass Selbstmord auch in seiner schlimmen Lage unheilbarer Krankheit keinesfalls eine Alternative darstellt, mittels des kategorischen Imperativs? Lösungshinweis: Ihre persönliche Maxime lautet etwa: Selbstmord ist keine Lösung. Wie kann diese Maxime nun verallgemeinert werden? Vermittels des kategorischen Imperativs! Bitte nicht utilitaristisch: Kann ich wollen, dass es ein allgemeines Gesetz gibt, das besagt, dass alle Schmerzleidenden sich umzubringen hätten? Wie sähe eine Welt voller sich selbst umbringender Schmerzpatienten aus? Grauenhaft! Also nein. (dies wäre eine hier unzulässige Folgenabschätzung!) Sondern: Kann ich wollen, dass es ein allgemeines Gesetz gibt, das besagt, dass immer dann, wenn Patienten Schmerzen leiden, Selbstmord eine zulässige Alternative darstellt? Nein, denn ein solches Gesetz stünde im Widerspruch zum Prinzip der Selbsterhaltung der Natur und ist deshalb unzulässig. 41 Beachten Sie: Kriterium ist für Kant die Widerspruchsfreiheit im Denken, nicht die Vorstellbarkeit einer zukünftigen Situation! Anschlussfrage für kritische Geister: Woher nimmt Kant die unbedingte Geltung des Prinzips der Selbsterhaltung der Natur (Kant nennt es auch „Prinzip der Selbstliebe“)? Gibt es in der Natur nicht Gegenbeispiele, die diesem Prinzip zuwiderlaufen und es somit in seiner allgemeinen Geltung einschränken? Beispiel41: Auf Verlangen seiner Versicherung lässt ein vierundsechzigjähriger Mann in einem Krankenhaus eine Routineabklärung vornehmen. Dabei stellen die Ärzte fest, dass er Krebs hat, der innerhalb der folgenden sechs Monate zum Tode führen wird. Eine Aussicht auf Heilung besteht nicht. Chemotherapie könnte sein Leben vielleicht um ein paar Monate verlängern, hätte jedoch Nebenwirkungen, die der Arzt in diesem Fall nicht in Kauf nehmen will. Zudem ist er der Ansicht, dass eine solche Therapie den Patienten vorbehalten bleiben sollte, bei denen Aussicht auf Besserung besteht. Der Patient leidet unter keinerlei Symptomen, die ihm Grund zu der Annahme geben würden, er sei nicht völlig gesund. In der nächsten Woche will er einen kurzen Urlaub antreten. Wie soll der Arzt mit der Wahrheit umgehen? Aufgabe: Gehen Sie zunächst den unten aufgeführten Fragen nach. Versuchen Sie dann mittels der Anwendung des kategorischen Imperativs ein allgemeines Lügenverbot bzw. eine unbedingte Pflicht zur Wahrheitsmitteilung zu begründen. Zu welchem Prinzip stünde eine unaufrichtige Informationsvermittlung im Widerspruch? (z.B. ICN42 konsultieren) Welche der untenstehenden Fragen sind utilitaristischen Charakters? a) Soll er die Wahrheit dem Patienten mitteilen, oder soll er sie verschweigen? b) Sollte er die Wahrheit verleugnen, wenn er gefragt wird? c) Falls er die Wahrheit sagt, sollte er damit warten, bis der Urlaub des Patienten zu Ende ist? d) Soll er, falls er die Wahrheit sagt, die Möglichkeit der Chemotherapie erwähnen und begründen, warum er in diesem Fall davon abrät? e) Oder soll er jeden Versuch unterstützen, den Tod hinauszuschieben? Lektürehinweis: Lesen Sie das Büchlein "Der kategorische Imperativ für Anfänger" parallel zu Kants "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, und versuchen sie sich ethische Dilemmasituationen aus dem Pflegealltag vorzustellen, in denen es hilfreich sein könnte, sich auf unbedingt gebietende Prinzipien zu berufen. Handlungen aus Pflicht versus pflichtgemäße Handlungen Gemäß Kant kann eine Handlung entweder als pflichtgemäß (pg) oder nicht pflichtgemäß ( pg) eingeteilt werden, d.h. sie kann als moralisch richtig oder falsch (nicht: moralisch gut) 41 Bok, Sissela: Lügen. Vom täglichen Zwang zur Unaufrichtigkeit. Hamburg 1980, S. 263-268. Es spielt für unsere Zwecke keine Rolle, ein medizinethisches Beispiel mit einem pflegeethischen Kodex zu begründen, zumal die pflegeethische Formulierung des ICN im hier zu berücksichtigenden Punkte etwas klarer ist, als der hippokratische Eid oder das Genfer Ärztegelöbnis von 1948. 42 42 eingestuft werden. So entspricht etwa eine Tat äußerlich betrachtet einer moralisch gebotenen Regel. Sie ist deswegen für Kant aber noch keineswegs auch moralisch gut! Denn zweitens kann diese Handlung aufgrund von Neigung gern (g) oder entgegen der Neigung ungern (ug) erfolgen. Drittens wird die Handlung gemäß Kant als moralisch gut, d.h. aus Pflicht (P) oder als moralisch schlecht (P), d.h. nicht aus Pflicht geschehen, wenn die Gesinnung, die hinter dieser Handlung steht, dem Testverfahren des kategorischen Imperativs unterzogen worden ist. Somit ergeben sich für Kant vier, genau besehen allerdings acht mögliche Fälle: Moral (moralkonformes Verhalten) pg pg Handlungen Gesinnung P 1 2 3 4 P 5 6 7 8 g ug ug g Neigung Für Kant fallen nur die Fälle 1 und 2 in den Bereich der Moralität, während die Fälle 5 und 6 den Bereich der Legalität bilden. Handlungen sind also dann bloß legal, wenn sie der äußeren Gestalt nach oder bloß aufgrund von Neigung moralkonform (pflichtgemäß) sind. Handlungen werden erst dann moralisch wertvoll, wenn sie überdies aus Pflicht geschehen. Da Kant diesen Punkt als besonders wichtig einstufte, fielen einige Formulierungen etwas drastisch aus, so dass viele Kritiker den Eindruck bekamen, Kant vertrete hier einen moralischen Rigorismus, der den Einfluss von Neigung verbieten wolle. Friedrich Schiller beispielsweise veranlasste dies zu folgendem Spottgedicht: Gern’ dien ich den Freunden, doch thu ich es leider mit Neigung, Und so wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin. Da ist kein anderer Rat, du musst suchen, sie zu verachten, Und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut. (Schiller, F.: Über die Grundlage der Moral, § 6.) Aufgabe: Versuchen Sie sich vorzustellen, ein Pflegerin diene ihren Patienten deswegen, weil sie es aus Neigung gern tut. Wie könnte man Sie davon überzeugen, dass es besser wäre, nicht bloß pflichtgemäß aus Neigung, sondern in jedem Falle aus Pflicht im Sinne von Kants deontologischen Überlegungen moralisch richtig zu handeln? 43 3.4 Sir William David Ross (1877-1940): Tatsächliche und prima facie Pflichten Der Regeldeontologe Ross hat zwischen tatsächlichen Pflichten und prima facie-Pflichten unterschieden. Was tatsächlich moralisch richtig (pflichtgemäß) ist, ist dasjenige, was wir in einer konkreten Situation tatsächlich tun sollten. Hier gibt es keinerlei Regeln gemäß Ross. Aber es kann, wie er behauptet, ausnahmefreie Regeln geben, die prima facie gelten. Eine Regel gilt prima facie, wenn sie unter gewöhnlichen Umständen Anwendung findet, d.h. wenn sie zu einer tatsächlichen Pflicht führt, sofern keine anderen Gesichtspunkte im Spiel sind. Beispiel: Wenn sie einer ihrer Pflegerinnen einen freien Tag versprochen haben, so sind sie prima facie verpflichtet, ihr einen freien Tag zu gewähren. Falls zudem keine ersichtlichen Gründe bestehen, welche diese prima facie Pflicht überwiegen, so sind sie auch tatsächlich verpflichtet, ihr einen freien Tag zu geben. Prima Facie Pflichten. "Prima facie" bedeutet wörtlich "auf den ersten Blick" oder "auf der Oberfläche der Dinge". Eine Prima Facie-Pflicht ist eine, der alle menschlichen Wesen in einem allgemeinen Sinne folgen müssen, außer wenn schwerwiegende oder vernünftigere Umstände eine Abweichung erfordern sollten. Ross nennt als Beispiele: 1. Pflichten der Glaubwürdigkeit (oder Aufrichtigkeit): Die Wahrheit sagen, aktual gegebene Versprechen einhalten, vertragliche Übereinkünfte einhalten. 2. Pflichten der Wiedergutmachung (reparation): für moralisch falsche Handlungen wiedergutmachende Handlungen vollziehen. 3. Pflichten der Großzügigkeit (gratitude): Erkennen, was andere für uns getan haben und unsere Großzügigkeit entsprechend auf sie ausdehnen. 4. Pflichten der Gerechtigkeit: einer ungerechten Verteilung von Gütern von Vorneherein Einhalt gebieten. 5. Pflichten der Wohltätigkeit: Helfen, die Bedingungen anderer in den Bereichen der Tugend, der Intelligenz oder des Glücks zu verbessern. 6. Pflichten der Selbstverbesserung: uns selbst zur Verbesserung unserer moralischen Kompetenz (Tugend, Intelligenz, Glück) hin fördern. 7. Pflichten der Nichtungerechtigkeit: andere nicht ungerecht behandeln und andere vor Ungerechtigkeiten bewahren.43 Ross beruft sich also wie Kant auf allgemeine Regeln, denen alle menschlichen Wesen unbedingt Folge zu leisten haben. Ross geht über Kant hinaus, wenn ein Konfliktfall zweier (speziell prima facie-) Pflichten ansteht. Er formulierte dazu zwei Prinzipien: 1. Always do that act that is in accord with the stronger prima facie duty. 2. Always do that act that has the greatest of prima facie rightness over prima facie wrongness.44 Dabei ergeben sich aber offensichtlich Probleme. Wie sollen wir beispielsweise entscheiden, wann und ob es sich um eine "prima facie-Pflicht" handelt? Auf welcher Grundlage beruht die Liste von Ross, warum sollen wir gerade diese Pflichten befolgen? Sind diese wirklich selbstevident, wie Ross behauptet (ähnlich wie Aristoteles)? Wie sollen überdies im Konfliktfalle die beiden Prinzipien, die Ross nennt, angewandt werden? Wo wird insbesondere moralische Güte von Prima facie-Pflichten von moralischer Schlechtigkeit (wrongness) abgegrenzt? Hier stößt man auf das altbekannte Sorites-Problem des Entscheidens bei 43 44 Ross, W.D.: The Right and the Good, New York 1930, S. 21-22. A.a. O.: S. 41-42. 44 graduellen Übergängen, ab wann etwas als etwas Neues und nicht mehr als etwas Vorheriges gilt. 3.5 Deontologische Ansätze in der Pflegeethik Für die Ethik in der Pflege lässt sich ein Modell ethischer Analyse und Entscheidungsfindung ausgehend von deontologischen Überlegungen konzipieren: Deontologisches Analysemodell 1. Erfassen des Problems. 2. Ausarbeitung verschiedener alternativer Handlungen zur Lösung des Problems. 3. Aufführen verschiedener ethischer Prinzipien oder Grundsätze mit unbedingter Geltung. 4. Vergleich von 2. und 3. 5. Mögliche Resultate und Folgeprobleme: Fall A: Eine Handlung allein wird als pflichtentsprechend bewertet. Ihr entsprechend wird gehandelt. Fall B: Mehrere Handlungen werden als pflichtentsprechend bewertet. Alle könnten durchgeführt werden. Nun werden weitere Kriterien herangezogen (Zeit, Effizienz, Umweltverträglichkeit, Ökonomie, etc.). Fall C: Eine Handlung wird ausgewählt, die nur mit einigen Regeln übereinstimmt, zu anderen aber im Widerspruch steht. Für den Fall C können weitere übergeordnete Prinzipien 2. Ordnung (Metaprinzipien) herangezogen werden, die den Widerspruch ggf. aufzulösen vermögen. Führt eine Neubewertung zu einer haltbaren Pflichtkonformität, so wird gehandelt, andernfalls wird es schwierig... Quelle: Brody, Howard: Ethical Decisions in Medicine (2) Boston 1981, S. 354; Auch in: Ethische Grundsätze für die Pflege. Hrsg. Vom schweizerischen Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Bern 2000, S. 23. Beispiel: Die Leiterin des Pflegedienstes, Berta, erklärt, dass es gegen das Berufsethos verstößt, wenn jemand sich weigert, an einer internen Weiterbildung über "Angewandte Methoden der Patientenkommunikation" teilzunehmen. Schwester Anna äußert persönliche Bedenken und möchte daran nicht teilnehmen. Die Betroffenen gelangen an Sie und wollen ihren Rat. Aufgabe: Rechtfertigen Sie Ihre Entscheidung aus deontologischer Sicht! Lassen Sie dabei alle teleologischen oder rechtlich-machtstrukturellen Überlegungen aus dem Spiel! 3.6 Vor- und Nachteile deontologischer Ansätze Rational unabhängige Subjekte? Ein Problem, das gerade im Bereich der Pflegeethik anzutreffen ist, ist der Umgang mit Entscheidungen über Patienten mit drohendem oder schon de facto vorherrschenden Autonomieverlust (Autonomieverlust im Bereich allg. Pflege: Bewusstseinsverlust, Koma, etc.; im Bereich der Gerontologie: Demenz, Alzheimer, Delir, Depression, etc.). Kants Verfahren etwa basiert auf der Annahme, dass ein betroffener Mensch autonom, d.h. aufgrund des Vollbesitzes seiner Vernunftfähigkeit unabhängig von empirischen äußeren Meinungen seine 45 Entscheidung so zu treffen hat, wie es das oberste Sittengesetz gebietet. Wie sollen dies Patienten tun, wenn ihr Bewusstseinszustand offensichtlich defizitär geworden ist? Kann man hier ohne einen Fürsorgebegriff, einen Verantwortungsbegriff oder eine Stellvertreterfunktion auskommen? Gerechtigkeitsprinzip Ein großer Vorteil deontologischer Ansätze ist ein Rekurs auf das Prinzip der Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit. Dabei geht es nicht nur um die deontologisch mögliche Rechtfertigung materieller Güter im Krankenhaus (bestimmte Medikamente, Organspenden, Benutzung teurer Maschinen, spezieller Impfstoffe, etc.) sondern auch um subtile Handlungs- und Aufmerksamkeitsgüter (wie eine gerecht portionierte motivierende Zuwendung zu verschiedenen Patienten unabhängig von Alter, Religion, Zustand, Charakter etc. oder eine gerecht verteilte Zuwendung zu Vorgesetzten oder Untergebenen unabhängig von deren Kompetenz, Einfluss, Rang, Stand, etc.), die im Pflegealltag vorkommen. Erst ein Rekurs auf ein Prinzip der Gerechtigkeit vermag utilitaristische Güterabwägungen so zu regulieren, dass eine faire Verteilung für alle Beteiligten entstehen kann. Sind Verallgemeinerungstests konkretisierbar? Ein weiteres Problem liegt in der allgemeinen abstrakten Formulierung oberster unbedingte Geltung beanspruchender Prinzipien: Wie sollen sie konkretisiert werden? Kant hat diese Schwierigkeit stellenweise geahnt und konkretere Formulierungen wie etwa die Mittel-/ZweckFormel angegeben oder über die Notlüge nachgedacht und bemerkt, dass eine Verallgemeinerung wohl nicht ohne Ausnahme möglich sein wird. Ross hat nicht zuletzt deshalb einen doch konkreteren Satz an Pflichten formuliert, der die Anwendbarkeit erleichtern soll. Wann aber „passt“ ein Prinzip auf eine konkrete Situation? Zudem muss gefragt werden, ob Handlungsmaximen, wenn sie mit solchen Prinzipen widerspruchsfrei verträglich sind, wirklich moralisch gut oder schlecht sind. Liegt hier nicht ein so genannter "formalistischer Fehlschluss" vor, der darin besteht, zu glauben, dass aus formaler Subordination bereits Sollenssätze abgeleitet werden können? Folgt aus Widerspruchsfreiheit bereits moralische Güte? Gattungsschutz: Wie soll überhaupt etwas unbedingt geschützt werden können, wenn es zwangsläufig Ausnahmen geben kann? Nur durch Setzung unbedingter Werte und Prinzipien. Worauf können sich indirekt Betroffene berufen, um einem moralisch fragwürdigen Vorgehen Einhalt gebieten zu können? Im ethischen Dilemmafall, in dem einem ein bestimmtes Handeln als fragwürdig erscheint, kann man auf ethische Formulierungen in offiziellen Ethikkodizes zurückgreifen und zumindest eine Auseinandersetzung darüber in Gang setzen, ob dieses je konkrete Handeln bereits unter diese Gebote, die unbedingte Geltung einfordern, fällt oder nicht. Bedenken sie etwa den Fall, in dem Pflegende in Pflegesituationen mit gleichzeitig stattfindender medizinischer Forschung konfrontiert sind und oft mehr wissen, als der Patient. Hier treffen ethische Grundsätze auf Prinzipien der wissenschaftlichen Forschungsfreiheit, die beide auf unterschiedliche Weise das allgemeine Wohl des Menschen anstreben. Rekurse auf deontologische Prinzipien können in ethischen Diskursen „Bremsungen“ übermütiger 46 utilitaristischer Folgenabwägungen erzeugen. Allerdings ist ihre Rechtfertigung nicht unproblematisch. Widerstreitende Prinzipien: Worin besteht das Metakriterium der Vermittlung? Ist eine ethische Auseinandersetzung zu einem konkreten Problemfall soweit entwickelt, dass die möglichen Prinzipien offen und unverträglich zutage liegen, fehlt oft ein übergreifendes ethisches Prinzip oder Kriterium, das unter den verschiedenen Prinzipien eine Wertgewichtung vornehmen kann, die für alle Betroffenen tragbar ist. Hier sind im ethischen Diskurs besondere Vermittlungskompetenzen gefragt, die scheinbar unvereinbare Positionen zu vermitteln und einem Konsens zuzuführen vermögen. Es gibt aber auch Fälle, die keine befriedigende Vermittlung zulassen. Dann bleibt der Ethik die Aufgabe, die Schwierigkeiten und Defizite jeder Handlungsoption herauszuarbeiten und den Beteiligten aufgrund der Problemlage „Mut zum Dissens“ zu machen. Lassen sich ethische Entscheidungen allein aufgrund eines je eigenen Vernunftrekurses treffen? Bürgt ein errungener Konsens für moralische Güte? Die bisher behandelten ethischen Ansätze gingen in ihrem Menschenbild von der Annahme aus, dass ethische Entscheidungen von Menschen allein aufgrund eigener ethischer Kompetenz durchführbar wären. Welche Rolle spielen dabei aber die Anderen (Ärzte, Pflegende, Angehörige, Vormundsbeamte, Sozialarbeiter, Ethikerinnen, Gerontologinnen, etc.)? Gerade im Bereich der Pflegeethik müssen Entscheidungen sozialethisch und diskursiv im Team getroffen werden, wenn die Gefahr ethischer Fehlschlüsse oder situativer moralischer Blauäugigkeit vermieden werden soll. Wie kann dies in gemeinsamen ethischen Diskurs gelingen? Hier scheint das Bedürfnis nach regulativen Prinzipien zu entstehen, die einerseits Entscheidungsfindungsprozesse ermöglichen, andererseits aber auch nach Prinzipien zweiter Ordnung, die versuchen, zwischen ethischen Werten und pragmatischen angesagten Handlungen zu vermitteln. Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas haben versucht, solche Regeln gelingender (herrschaftsfreier) Diskurse in ihren Diskursethiken zu formulieren. Die Anschlussfrage stellt sich, ob ein gelingender Entscheidungskonsens eines bestimmten Teams tatsächlich auch schon dafür sorgen kann, dass eine bestimmte Handlung moralisch gut wird. Handelt es sich hier nicht um einen "konsensualistischen Fehlschluss", der eine aus einem Konsens erzielte lokale Geltung mit allgemeiner universeller Geltung moralisch guter Handlungen verwechselt? Ist eine Handlung auch tatsächlich moralisch gut, wenn alle an einem Fall Betroffenen einen Konsens zur Geltung gebracht haben? Mit welchem Grad an Kritizität muss ein Konsens errungen werden, damit eine Handlung als moralisch gut gelten kann? Oft hört man von Politikern das Argument: „Hören Sie, unsere Ethikkommission hat acht Monate um einen Konsens gerungen, deshalb schlage ich vor…“ 47 Relevanz deontologischer Ansätze für die Pflegeethik ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.7 Literaturhinweise Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). Kritik der praktischen Vernunft (1788). Hrsg. v. W. Weischedel. Band 6, Darmstadt (5) 1983. Kant, Immanuel: Metaphysik der Sitten (1797). Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen (1797). Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (1793). Hrsg. v. W. Weischedel. Band 7. Darmstadt (5) 1983. Ludwig, Ralf: Kant für Anfänger. Der kategorische Imperativ. München 1995. Ross, William David: Foundations of Ethics. Oxford 1963. Ross, William David: The Right and the Good, New York 1930. 48 4. Tugendethik Tugendethische Ansätze unterscheiden sich von den bisher besprochenen utilitaristischen und deontologischen Ansätzen vor allem darin, dass sie sich in Situationen, wo eine moralische Bestimmung einer Handlung angesagt ist, auf die entsprechenden Eigenschaften oder die Charakterzüge der ethisch Handelnden zurück beziehen. Der Rekurs auf (angelernte oder angelegte) interne Vermögen einer handlungsfähigen Person soll jeweils die moralische Qualität einer Handlung unabhängig von der je bedachten Gesinnung (Pflicht) oder des möglichen Folgenverlaufes aus dessen Tugendhaftigkeit sichern. Die Tugendethikerin fragt nicht: Soll ich so handeln? sondern: Ist diese Handlung z.B. gerecht? Man merkt bereits dieser Fragestellung ihren Bezug zur konkreten Situation an: Hier wird ein Maßstab der Beurteilung gleich mitgeliefert, ohne zunächst einen utilitaristischen Folgenabschätzungskalkül oder einen deontologischen Pflichtenverallgemeinerungstest machen zu müssen. Der Ansatz hat aber bei Legitimationsrückfragen das Problem der Bestimmung dessen, was denn "Tugend" sein soll und wie man diese erlangt, zu klären. Welche Tugenden sind erstrebenswert? Mut, Loyalität, Standhaftigkeit, Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung, Geduld oder Leidenschaft? Der klassische Text zur Tugendethik ist die Nikomachische Ethik von Aristoteles. Später hat Thomas von Aquin die aristotelische Tugendlehre im Sinne christlicher Vorstellungen umgearbeitet und in vielen Einzelaspekten verfeinert. Ausgehend von dieser Position sind seit den späten 70er Jahren zahlreiche Versuche unternommen worden, die aristotelischen Theorieelemente zu aktualisieren, gerade in einer Zeit, die von ökonomischen Folge- und Nutzenkalkülen und einer bislang in dieser Form nie da gewesenen Technisierung des Gesundheitswesens zeugt. Solch neuere tugendethische Positionen werden beispielsweise von G.E.M. Anscombe, G.H. von Wright, W.K. Frankena, M. Hare, M. Nussbaum, Ph. Foot oder A. MacIntyre vertreten. 4.1 Vorüberlegungen zum Begriff der "Tugend" Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff "Tugend" hören? Vielleicht an irgendwelche "eingeborenen Vermögen", die jemanden besonders auszeichnen? An Heldentaten? An den Religionsunterricht? An spezielle Tugend- oder Untugendkataloge (etwa die antiken Kardinaltugenden, die zehn Gebote, oder die sieben Todsünden)? An ihren Latein- oder Griechischunterricht? An besondere Menschen mit Vorbildcharakter (Mutter Theresa, Florence Nightingale, Gandhi, Albert Schweitzer, Henry Dunant,...)? An moralische Vorschriften? Im Griechischen hatte der Begriff der areté eine viel weitere Bedeutung, als uns die engen Konnotationen des über das lateinische virtus ins Deutsche gekommenen Begriffs der "Tugend" weismachen. Areté umspannte einen Bereich, der von den Begriffen Vortrefflichkeit, Qualität, Tüchtigkeit, Tapferkeit, Geschicklichkeit, Kraft, Tugend, Heldentat, Verdienst, Auszeichnung, Ruhm, Gedeihen, Glück angedeutet wird. Stemmer hat deshalb vorgeschlagen, areté eher mit "Gutsein" zu übersetzen, weil das griechische Wort sich nicht nur auf Menschen, sondern auch auf "Gegenstände (z.B. Messer oder Rebscheren), Körperorgane oder Tiere"45 beziehe. Die Frage, ob es sich bei den Tugenden im Sinne von areté bereits um moralische Eigenschaften eines Dinges handle, ist im Hinblick auf das ursprüngliche Verständnis zu verneinen: Wer so fragt, bringt die seit Kant vorherrschende Bestimmung der Tugend als Moralität mit. Das muss aber keineswegs der Fall sein, so kann man im weiten Bedeutungsumfang durchaus davon 45 Stemmer, P.: Artikel Tugend. In: Ritter, J.: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1978ff., Sp. 1532. 49 sprechen, dass es Tugenden eines Dirigenten oder Tugenden der Nachdenklichkeit gebe, die deshalb noch keineswegs moralisch sein müssen. Thrasymachos, Sokrates' Gesprächspartner im ersten Buch der Politeia, vertrat die Ansicht, areté habe nicht der, der schwächlich Rücksicht nehme auf andere und sich moralisch verhalte, sondern der, der ohne Rücksicht seine Begierden und Wünsche so weit wie möglich auslebe. Während in der modernen Ethik zumeist die Frage im Vordergrund steht, welchen Handlungen man moralisch verpflichtet ist und was die Quelle dieser Verpflichtung ist, umfasst die antike Vorstellung von Ethik die sehr viel weitere Frage, wie man leben soll. Die zunächst banale antike Antwort darauf ist die Aussage, dass man ein guter Mensch, also einer, der areté hat, sein soll. Worin aber diese areté genau besteht, wurde unterschiedlich beantwortet. Für die Antike war es primär der Begriff des Glücks, der grundlegend war. Man nennt deshalb ethische Ansätze dieser Richtung auch Glücksethiken oder eudaimonistische Ethiken. Beispiel: Auf der Station eines Krankenhauses, in der terminale Patienten liegen, hat sich die Regel als moralkonform etabliert, dass man die Betroffenen nur dann über die tatsächlich durchgeführte Medikationsstrategie informiert, wenn diese dies ausdrücklich verlangen. Schwester Anna ist dies aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Zeit suspekt geworden. Sie fragt sich, ob sie nicht diese Üblichkeit im Rahmen eines ethischen Diskurses in kritischem Sinne thematisieren sollte. Wie müsste Sie aus tugendethischer Sicht argumentieren? Dilemma: Ist die Person tugendhaft, die moralkonform agiert (Gehorsam, Standhaftigkeit) oder diejenige, die gegen herrschende moralische Regel aufbegehrt oder gar gegen diese bewusst verstößt (Mut, Kühnheit)? 4.2 Tugendethische Ansätze Wenngleich sich schon in frühen philosophischen Texten der Antike die Rede von bestimmten Tugenden erhebt, so ist doch das erste und bis heute nennenswerte Werk, das sich systematisch mit der Frage nach dem Wesen von Tugenden und deren moralischer Relevanz auseinandersetzt, die Nikomachische Ethik von Aristoteles. Die Lektüre derselben ist alles andere als eine leichte philosophische Kost, obwohl Aristoteles methodisch sorgfältig vorgeht: Zum einen spielt dem modernen Leser die begriffliche Bedeutungsweite des Griechischen einen Streich, zum anderen liegen doch unterschiedliche Übersetzungen vor, was im Grenzfall ein Heranziehen des griechischen Quelltextes nötig macht. Wer sich dennoch auf die sehr lohnenswerte Lektüre einlassen will, sollte parallel dazu einige ausgesuchte Aufsätze zu Spezialthemen aus der Nikomachischen Ethik heranziehen, um der vielen Schlüsselstellen und deren immanenter Problematik Gewahr zu werden. Bereits im ersten Satz dieses Textes charakterisiert Aristoteles den Menschen als nach dem Guten strebend, sofern er handelt. „Handeln“ (prattein) ist dabei mehr als „Hervorbringen“ (poiein): Wer weiss, wie etwas hervorgebracht wird, etwa wie man korrekt einen Verband wechselt, der macht dies im Hinblick auf das eine Ziel, dass der Verband fertig gestellt und seine Arbeit beendet ist. Das Verbinden ist das Mittel zum alleinigen Zweck des fertigen Verbandes. Wer hingegen „handelt“ der hat zusätzlich die Komponente des „Selbstzweckhaften“ im Spiel. Der moralisch-ethisch vollkommene Mensch (spoudaios) – eine Art oberer Grenzwert anthropologischer Typen – handelt nur noch aus Selbstzweck heraus und nie bloss als Mittel zu einem bestimmten Zweck. Diese Selbstzweckhaftigkeit ethisch wertvollen Handelns (Autotelie) ist stets begleitet von Lust und Freude und verwirklicht die eudaimonia, das Glück oder die Glückseligkeit. Oberstes Ziel dieses Bestrebens der Menschen nach dem Guten ist aber nicht etwa, nur gute Handlungen, sondern gute Menschen (agathoi) 50 und als letzte Konsequenz derselben, die Staatskunst (politiké techné) einer Polisgemeinschaft zu vervollkommnen. Ethisch wertvolles Handeln im Sinne der areté (der moralischen Tüchtigkeit, „Tugend“ wäre zu eng) orientiert sich in einer überschaubaren Gemeinschaft an moralisch mehr oder weniger tugendhaften Vorbildern. Der Mensch ahmt zunächst die ihm als gut vorgelebten Handlungen nach und entwickelt durch Gewöhnung allmählich und zunächst „ethische Tugenden“ (Charaktertugenden). Sie werden anhand der mesotes-Lehre, der Lehre von der richtigen Mitte, geordnet. So bildet etwa Tapferkeit die Mitte zwischen Angst und Verwegenheit oder Grosszügigkeit die Mitte zwischen Knausrigkeit und Verschwendungssucht. Dieses Erringen von Charaktertugenden durch Gewöhnung wird mit dem griechischen Begriff dafür, ethos, bezeichnet – und bedarf der weiteren Ergänzung. In Analogie zu seiner Vorstellung der Seele, die sich aus einem irrationalen und einem rationalen Teil zusammensetze, müssen die Charaktertugenden nun von einem Satz von dianoetischen Tugenden (nous = Geist, Verstand), Verstandestugenden ergänzt werden. Zu diesen zählt Aristoteles v. a. die phronesis (sittlich-praktische Einsicht/ Vernunft), die neben dem noûs (als intuitivem Verstand) und der sophia (Weisheit) dafür sorgt, dass sich die Charaktertugenden durch die Reflexion mittels dieser Verstandestugenden, einem Mit-sich-zu-Rate-gehen, das ethos zum äthos, zur charakterlich gefestigten Grundhaltung (hexis) entwickelt. Diese Grundhaltung ermöglicht es dem handelnden Menschen dann, in jeder Situation einzeln neu entscheiden zu können, was im Hinblick auf das höchste Gute (die Staatskunst) das moralisch angebrachte Handeln ist. Mit dem Begriff der „Grundhaltung der Wahl“ (hexis prohairetiké) wird dieser tugendethische Ansatz zu einer „Ethik der (sittlich richtigen) Wahl“. Diesen grundlegenden Überlegungen lässt Aristoteles sehr ausführliche und methodisch durchdachte Untersuchungen zum Wesen vieler Einzeltugenden folgen (Großzügigkeit, Gerechtigkeit, Willensfreiheit, Lust, Freundschaft), die auch heute noch gegenüber vielen Analysen bestehen können oder gar ihresgleichen suchen. Die Philosophin Elisabeth Anscombe46 hat in einem Aufsatz von 1958 den vorherrschenden Gebrauch der Ausdrücke "moralisch richtig", "moralisch falsch" oder "moralische Verpflichtung", wie sie von Deontologen und Utilitaristen vertreten werden, kritisiert und als "inhaltsleer" gebrandmarkt. Es sei in konkreten Situationen weitaus angebrachter, inhaltsvolle Tugendbegriffe zu verwenden. Sie geht sogar soweit zu sagen, dass man auf den Begriff der Pflicht gänzlich verzichten solle. Woran aber orientiert man sich? Gemäß Anscombe kann es "prinzipiell keinen anderen Maßstab geben, als dass man einige Beispiele anführt"47, die man in der je spezifischen Situation zur Beurteilung heranzieht. Gemäß G.H. von Wright gehören Tugenden nicht zu den disponiblen Dingen, über die man einfach verfügen könnte, sondern sie sind vielmehr im Sinn der "ethischen Tugenden" bei Aristoteles als "traits of character", Charakterzüge, zu verstehen. Ihm gemäß gibt es Tugenden des eigenen Wohls (self-regarding virtues) und Tugenden zum Wohl der anderen (otherregarding virtues), die er von technischen Vorzügen in spezifischen Situationen, in denen es darum geht, das je instrumentell Gebotene zu bestimmen, zu unterscheiden habe. Philippa Foot schreibt Tugenden eine korrektive Aufgabe zu. So beschränken etwa die Tugenden der Tapferkeit und Besonnenheit bestimmte Affektwirkungen, während Tugenden wie Gerechtigkeit oder Wohltätigkeit ein Motivationsdefizit ausgleichen: "Es scheint also richtig, jemandem, der andere stark entmutigt oder schwächt, eine Art von moralischem Fehler zuzuschreiben, auch wenn er aufrichtig zu helfen meint; und andererseits Tugend im eigentlichsten Sinne in jemandem zu sehen, der schnell und erfindungsreich ist, Gutes zu tun. (...) Jemandes Tugend 46 47 Anscombe, G.E.M.: Modern moral philosophy. In: Philosophy 33 (1958), S. 1-19. Anscombe, G.E.M., zitiert nach: Rippe, K.P. und Schaber, P.: Tugendethik. Stuttgart 1998, S. 9. 51 wäre also an seinen tiefsten Wünschen so gut wie an seinen Absichten zu messen; und das passt zu unserer Vorstellung, dass eine Tugend wie Großzügigkeit sich ebenso in der Einstellung wie im Handeln zeigt. Freude am Wohlergehen anderer gilt als Zeichen einer großzügigen Haltung, und kleine positive oder negative Gefühlsreaktionen sind oft sicherster Ausdruck der moralischen Haltung." 48 Beispiel: Pflegerin Berta fällt durch ihre chronische morgendliche Unwirschheit auf, die Patienten und Angehörigen das Gefühl vermittelt, im falschen Krankenhaus gelandet zu sein. Aufgabe: Sie laden in Ihrer Funktion Pflegerin Berta zu einem Gespräch vor. Wie werden Sie ihre Argumente aus tugendethischer Sicht zur Verbesserung der Lage darlegen? Könnte hier vergleichsweise auch utilitaristisch oder deontologisch argumentiert werden? Welche Variante finden Sie angemessener und erfolgversprechender? W.K. Frankena fasst die Tugendethiken so auf, dass sich hier eine Ethik der Prinzipien und eine Ethik der Eigenschaften zu ergänzen hätten (Komplementaritätsthese): „Ich meine daher, wir sollten die Moral der Prinzipien und die Moral der Charaktereigenschaften, Handeln und Sein, nicht als rivalisierende Formen der Moral auffassen, zwischen denen es zu entscheiden gilt, sondern als zwei einander ergänzende Aspekte derselben Sache. Dann gibt es für jedes Prinzip eine entsprechende sittlich gute Eigenschaft (häufig unter demselben Namen), die aus der Disposition oder Neigung besteht, dem Prinzip entsprechend zu handeln; und für jede sittlich gute Eigenschaft gibt es ein Prinzip, das jene Handlungsweise definiert, in der die Eigenschaft Ausdruck findet. Um ein berühmtes Wort Kants abzuwandeln: Prinzipien ohne Eigenschaften sind unvermögend, Eigenschaften ohne Prinzipien sind blind.“49 Er sieht folgende Vorteile der Tugendethik: 1. Nicht die Handlung, sondern die handelnde Person ist der primäre Gegenstand moralischer Bewertung. 2. Während die Ausführung pflichtgemäßer Handlungen auf kontingente Motivationen zurückgehen kann (wie etwa Kants Analyse gezeigt hat), ist bei der tugendhaften Eigenschaft die jeweils richtige Motivation impliziert. 3. Eine Moral der Pflichten und Prinzipien ist für Einzelfälle unzureichend, während eine tugendhafte Eigenschaft prinzipiell die richtige Entscheidung in allen Situationen ermöglicht. Tugenden unterscheidet er in Tugenden erster Ordnung, die konkreter und auf einen engen Sektor sittlichen Lebens beschränkt sind (z.B. Ehrlichkeit, Dankbarkeit, etc.) und Tugenden zweiter Ordnung, die abstrakter, allgemeiner und nicht auf bestimmte Bereiche sittlichen Lebens beschränkt sind. Hierzu zählen Gewissenhaftigkeit, moralische Tapferkeit (d.h. Tapferkeit in moralisch relevanten Situationen), Rechtschaffenheit, ein guter Wille (= Kants Achtung vor dem sittlichen Gesetz), moralische Selbständigkeit, die Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen und einmal angenommene Prinzipien, wenn nötig, zu revidieren, die Disposition zu klarem Denken, die Disposition, die relevanten Tatsachen zu ermitteln und zu respektieren, und – dies betont und begründet er ausdrücklich – die „Fähigkeit, das „Innenleben“ anderer auf intellektueller und emotionaler Ebene nachzuvollziehen“; d.h. die 48 Foot, Philippa: Tugenden und Laster. In: Die Wirklichkeit des Guten. Moralphilosophische Aufsätze. Frankfurt a. M. 1997, S. 108-127; hier S. 111f. 49 Frankena, William K.: Analytische Ethik. München (5) 1994, S. 84. 52 „Fähigkeit, uns den Mitmenschen als Person zu vergegenwärtigen – als jemanden, der sich selbst so wichtig ist, wie wir uns selbst wichtig sind – und uns von seinen Interessen und den Auswirkungen unseres Handelns auf sein Leben eine lebendige und von Mitgefühl getragene Vorstellung zu machen.“50 4.3 Gemeinsame Aspekte solcher Ansätze Mit dem Begriff der Tugendhaftigkeit verbinden Tugendethiker die Vorstellung, dass tugendhaft Handelnde nicht rein willkürlich oder zufällig das jeweils Richtige tun, sondern mit der Zeit eine innere Disposition entwickeln (oder bereits darüber verfügen). Dabei geht der Tugendbegriff weiter als andere Ansätze, weil er oft die emotionale Einstellung einer Person mitbestimmt. Geduld kann man z.B. als Vermögen bezeichnen, in bestimmten Situationen die richtige, nämlich die geduldige Einstellung einzunehmen. Geduld könnte - im Sinne von Aristoteles - das richtige Mittelmass zwischen Ungeduld und Gleichgültigkeit sein. Oder Geduld kann in der charakterlichen Disposition liegen, um bestimmte Emotionen wie vorzeitige Angst vor dem Scheitern oder Furcht vor vorschnellen Fehlschlüssen zu unterdrücken, auszugleichen oder überwinden zu können. Vor dem Hintergrund der altbekannten Frage, wo Tugenden denn herkommen, kann mit der sog. fifty-fifty-These vorläufig geantwortet werden: zum Teil sind sie angeboren und zum Teil erworben. Ethisch betrachtet macht das philosophisch-pädagogische Bemühen um Tugenden vor allem dann einen Sinn, wenn der Erwerbsbereich fokussiert wird, auf den sich die Anstrengungen beziehen. Die Gegenposition mit der Vorstellung vererbter Tugenden führt zu einer rein deskriptiven Angelegenheit, die ebenfalls von einigen Vertretern ethischer Deterministen und neuerdings wieder von zahlreichen Neurowissenschaftlern vertreten wird. Wie in anderen Ansätzen auch gehen die Antworten auf die Geltung der Tugenden bei den Tugendethikern auseinander. M. Nussbaum beispielsweise vertritt die Ansicht, dass es sehr wohl einen Satz von Tugenden universeller Geltung gebe, die in jedem Tugendkatalog vorfindbar oder aufweisbar seien, während A. MacIntyre dieser These zunächst widersprochen hat. Es ist ebenfalls unklar, ob sich bei einem behaupteten primären Tugendkatalog (z.B. die vier Kardinaltugenden Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Besonnenheit) weitere Subtugenden wie z.B. Demut ableiten lassen. Umstritten ist zudem ob ein Satz von Tugenden insgesamt eine Einheit bilden, dass man entweder über alle verfügt oder keine - oder nicht vielmehr einzelne Tugenden nacheinander entwickelt und ausgebildet werden können. Wichtig für Tugendethiken ist zudem das umfassendere Menschenbild, das Tugendethiker voraussetzen. Menschen, die über die Tugend der praktische Urteilskraft (der phronesis im aristotelischen Sinne) verfügen, beurteilen Situationen viel differenzierter, als etwa ein utilitaristischer Schreibtischtäter, der ausrechnet, was moralisch geboten ist. Moralisch richtig ist vielmehr, was ein tugendhafter Mensch in einer bestimmten Situation als richtig entscheidet. Beispiel A: 50 In einem städtischen Krankenhaus wurde ein Linearbeschleuniger zur Bestrahlung für einige Millionen beschafft. Wegen Personalknappheit kann die Maschine aber nicht ausgelastet werden, wodurch für Patienten der Onkologieabteilung Wartezeiten von bis zu sieben Wochen entstehen. Nun Frankena, William K.: Analytische Ethik. München (5) 1994, S. 83. 53 könnte ein Privatkrankenhaus die Maschine mit seinem Gastpersonal und seinen Privatpatienten ergänzend nutzen und ökonomisch auslasten. Für die Privatpatienten entsteht dadurch keinerlei Wartezeit. Beispiel B: Pflegerin Berta betreut drei Patienten in einem Zimmer, einen davon, einen ästhetisch ansprechenden Mann mit sympathisch-gewinnender Wirkung, behandelt sie mit deutlich mehr Zuwendung, während die anderen beiden mit beflissener Hartherzigkeit abgehandelt werden, so dass sich diese bei der Stationsschwester der Pflegedienstleitung darüber beklagen. Aufgabe: Als Pflegemanagerin bringen sie im ethischen Diskurs, an dem Sie beteiligt sind, die Tugenden des Gemeinwohls (Wohltätigkeit) und der Gerechtigkeit ins Spiel. Zu welchen Lösungen gelangen Sie? Wie können Sie diese jeweils unter Rekurs auf Tugenden begründen? Wie lauten insbesondere Ihre Begründungssätze sprachlich? 4.4 Alasdair MacIntyre: Tugenden der anerkannten Abhängigkeit als Basis für einen tugendethischen Ansatz in der Pflegeethik Der irisch-amerikanische Philosoph Alasdair MacIntyre hat, nachdem er mit seinem bahnbrechenden Werk "After Virtue" (dt. Der Verlust der Tugend) den aristotelischthomistischen Tugendbegriff für die Moderne gegen ihre moralische Orientierungslosigkeit versucht hat stark zu machen, kürzlich ein neues Buch vorgelegt: Dependent rational animals (dt. Die Anerkennung der Abhängigkeit). Sein Ansatz ist relativistisch: Es geht darum, sich im Kontext der jeweiligen kulturellen Umgebung jene Tugenden anzueignen, die sich dort bewährt haben und weiterhin bewähren. MacIntyre kritisiert zunächst die gesamte abendländische Ethik von Platon bis G.E. Moore, sie hätte den grundlegenden Fehler begangen, von rational unabhängigen Subjekten auszugehen, die tugendhaft sein könnten, nachdem sie gewisse Überlegungen reflexiv vollzogen hätten. Insbesondere die analytischen Sprachphilosophen seien von einer fehlerhaften Interpretation der aristotelischen Mensch-Definition ausgegangen, die das "animal rationale" immer nur als "rationale" gelesen hätten und den animalischen Bereich für die Ausbildung entsprechender "Tugenden der Abhängigkeit" sträflich vernachlässigt hätten. Ontogenetisch sei es nämlich so, dass wir gewisse Tugenden von Kind auf allmählich in tugendhaften Kontexten erwerben, bis wir rational unabhängige Subjekte werden. Doch dann sei die Tugendentwicklung nach MacIntyre keineswegs abgeschlossen: Nun gelte es, zusätzlich Tugenden der anerkannten Abhängigkeit auszubilden, die es ermöglichen, uns selbst, wenn wir behindert, gebrechlich oder krank werden oder andere, die aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht mehr in der Lage sind, Tugenden der Unabhängigkeit zur Grundlage ihres Handelns zu machen, zu unterstützen. Dies ist deshalb geboten, weil wir unser Leben lang nicht unabhängige Subjekte seien, sondern immer in soziale Netze des Gebens und Nehmens eingebunden gewesen sind und sind. Deshalb entstehe so etwas wie eine Bring- und Holschuld, die uns gebietet, nachdem wir diesen Zustand rationaler Unabhängigkeit erreicht hätten, uns dem Bereich der Abhängigkeit zuwenden müssten vermittels der Tugenden der anerkannten Abhängigkeit, zu denen MacIntyre etwa den Begriff der Großzügigkeit (in indianischem Sinne: "Wancantognaka steht für Großzügigkeit, die ich all jenen schulde, die sie auch mir schulden"51) oder der Fürsorge anführt. Wichtig scheint ihm aber, dass die Zuwendung, die wir anderen zuteil werden lassen, nicht zu persönlich-intim angelegt ist, weil in solchem Falle das Stadium der tugendhaften Unabhängigkeit noch gar nicht erreicht wurde. Andererseits darf diese Zuwendung auch nicht 51 MacIntyre, A.: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Hamburg 2001, S. 143. 54 in den absolut altruistisch aufgefassten selbstlosen Bereich abgleiten, weil dann der je situative Bezug auf die Anwendungssituation verloren gehe. Er hält deshalb sowohl die Familie als auch den Nationalstaat für unzulässige Gesellschaftsformen für eine Ausbildung dieser Tugenden, da die eine zu intim und zu personal, die andere zu umfassend und zu abstrakt ist. Arbeitsgemeinschaften wie etwa ein Krankenhaus-Pflegeteam, Schulklassen, etc. bezeichnet er als ideale Formen hierfür. In einer Matrix können die Tugenden so dargestellt werden: TU TU TA 3 TA 2 1 "": "nicht" im Sinne logischer Negation Aus einem möglichen Zustand der Tugendlosigkeit (1) (wobei MacIntyres Menschenbild nicht naive Lockesche tabula-rasa-Personen annimmt) entwickeln Menschen zunächst Tugenden der rationalen Unabhängigkeit (TU), die ihnen eine gewisse gesellschaftliche Beweglichkeit und Selbständigkeit ermöglichen (2). Danach werden allmählich Tugenden der anerkannten Abhängigkeit (TA ) entwickelt, die es ermöglichen, den aktualen Mitmenschen, die es nötig haben, so beizustehen, wie es jene taten, die es für uns taten, als wir noch bedürftig waren (3). Man versteht nun, warum man MacIntyre sowohl als Tugendethiker als auch als kommunitaristischen Ethiker einordnen kann. In deutlicher Abwendung von utilitaristischen Folgenberechnungen und direkter Kantkritik plädiert MacIntyre dafür, dass die Neigung zur Ausbildung und Verrichtung solcher Tugenden der anerkannten Abhängigkeit als emotionalem Faktor dazu von zentraler Bedeutung ist. Wir verfügen über ein vorsprachliches "primäres und grundlegendes Interpretationswissen über die Gedanken und Gefühle anderer, das nicht durch Schlussfolgerungen gerechtfertigt wird oder werden muss"52. Er bezeichnet es vage als Mitgefühl oder Sympathie und behauptet, dass auch Tiere dies hätten und in ihrem ausgeprägten Sozialverhalten zeigen würden. Seine Theorie ist also eine naturalistische Spielart der Ethikbegründung, die auf umfangreiche empirische Studien der neueren Tierverhaltensforschung und auf zahlreiche Beispiele zurückgreift. 52 MacIntyre, A.: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Hamburg 2001, S. 25. 55 4.5 Anwendung für die Pflegeethik Setzt MacIntyre mit seinem Ansatz nicht voraus, dass mein Gegenüber mindestens empfindungsfähig sein muss, um mit einem tugendethisch agierenden Pfleger in Beziehung treten zu können? Wie soll das beispielsweise bei einem Patienten mit offensichtlichem Autonomieverlust möglich sein? Ist es hier nicht eine einseitige Bürde, die sich ein Pflegender aufladen muss, ohne Wirkung zu erzielen, ohne dass einem die Patienten etwas zurückzugeben vermögen? MacIntyre hält dies für einen Irrtum: "Was sie [körperlich oder geistig Behinderte] uns geben, ist die Möglichkeit, etwas Wesentliches zu lernen, nämlich was es bedeutet, dass jemand ganz und gar in unsere Fürsorge gegeben ist und wir für sein Wohlergehen verantwortlich sind. Jeder von uns war als Kind in umfassende Fürsorge eines anderen gestellt, der für unser Wohl Verantwortung trug. Nun haben wir die Gelegenheit zu lernen, was wir diesen Menschen schulden, indem wir lernen, was es heißt, anderen anvertraut zu sein. Dergleichen Beziehungen haben zwei Aspekte. Der eine betrifft all die Maßnahmen, die ein Leben erhalten und den körperlichen Schmerz lindern, und manchmal auch die psychologische Betreuung, das ganze schmutzige Geschäft mit den Bettpfannen, dem Erbrochenen, dem Wechseln der Laken, dem Umgang mit wundem Fleisch, der Gereiztheit oder dem zusammenhanglosen Gerede, dem Verabreichen der Medizin und Verbinden von Wunden. Der andere Aspekt bezieht sich auf die Rolle des Stellvertreters für die Behinderten, die nicht für sich selbst sprechen können. Die Aufgabe des Stellvertreters besteht darin, für den Behinderten innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft das Wort zu ergreifen, und zwar so, wie er oder sie es selbst getan hätte, wären sie dazu noch in der Lage. Der Schwerbehinderte braucht jemand, der für ihn sozusagen als sein zweites Ich spricht. Und da wir alle potentiell in diesen Zustand geraten können, mögen wir alle jetzt oder später jemanden als unser zweites Ich benötigen, der für uns die Stimme erhebt. Niemand aber wird für mich sprechen können, wenn er mich nicht schon vorher gekannt hat. Ein solcher Mensch wird im allgemeinen wissen müssen, wie ich das für mich Gute in verschiedensten vergangenen Situationen beurteilt und durch welche Überlegung ich meine Urteile gestützt hätte. Denn nur, wenn sie dies wissen, werden sie für mich so sprechen können, wie ich es selbst getan hätte." 53 Aufgabe: Wie beurteilen Sie die Anwendbarkeit dieser Überlegungen für die Pflegeethik? Inwiefern können Pflegende die Funktion eines "zweiten Ichs" übernehmen, neben ihren ohnehin schon weitreichenden Tätigkeiten? Beschreiben sie dies anhand eines Beispiels! Halten Sie diesen Ansatz überdies für lehrbar und tradierwürdig? 4.6 Vor- und Nachteile von Tugendethiken Konkrete Anwendbarkeit Tugendethische Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie praktisch anwendbar sind. Durch die Tugendkataloge werden Beurteilungsmaßstäbe mitgeliefert, die sogleich anwendbar und teilweise meist nachvollziehbar sind. Es muss nicht auf abstrakte deontologische Verallgemeinerungsprinzipien oder utilitaristische Folgenkalküle zurückgegriffen werden, um entscheiden zu können, was moralisch richtig ist. Problem der Vermittlung Tugendethische Ansätze klingen und sind meist verlockend nützlich, doch wie sorgen Sie beispielsweise dafür, dass Sie als Pflegemanagerin oder Pflegepädagogin "tugendhafte" Pfleger bekommen? Sind Tugenden vermittelbar? Genügt es, darüber das Wichtigste zu wissen? 53 MacIntyre, A.: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Hamburg 2001, S. 164. 56 Welche Rolle kommt dabei auf Sie zu? Was machen Sie mit Pflegenden, die ihre gebotenen Handlungen vortrefflich und bei eigener guter Laune auszuführen Imstande sind, aber oft negativ, zynisch und hartherzig zu den Patienten sind? Wie muss ein sozialer Kontext beschaffen sein, damit sich ein erwünschter Satz von Tugenden entwickeln kann? Probleme des Abwägens unter Tugenden In Konflikt- oder Dilemmasituationen ist es schwierig, einzelne sich widersprechende Tugenden (wie etwa Gehorsam vs. Mut, Wohltätigkeit vs. Gerechtigkeit) gegeneinander abzuwägen. Gibt es dazu Metatugenden oder müssen nun doch Folgenabschätzungen oder deontologische Prinzipien zur moralischen Orientierung herhalten? Was macht man, wenn z.B. die Tugend des „Mutes“ auf ganz unterschiedliche Weise ausgelegt wird: Jemand erachtet es einerseits als mutig, eine gewisse Regel oder Üblichkeit im Anwendungsfall zu überschreiten, während es jemand anderer gerade als mutig taxiert, diese Regel nicht zu brechen, sondern beizubehalten? Wie sind Tugenden bewertet: gleichwertig oder hierarchisch? Wenn Tugenden als gleichwertig angesehen werden, dann führt dies im Anwendungsfall unweigerlich zu Schwierigkeiten, da es offensichtlich sehr gegensätzliche Tugenden gibt, die man anführen könnte: Ist etwa „Kühnheit“, „Mut“ der „Zurückhaltung“ und der „Gehorsamkeit“ bzw. der „Loyalität“ in jedem Falle vorzuziehen? Wie werden solche Fragen im ethischen Diskurs entschieden? Wieder mittels bestimmter „ethischer“ Tugenden – oder braucht es nun eine durch Tugendprinzipien formulierte Struktur, die Ordnung schafft? Wie aber kann so eine Ordnung gebildet und begründet werden, dass sie anwendbar bleibt? Charakter vs. Handlung Solange jemand "tugendhaft" operiert, ist nichts daran moralisch bedenklich. Was aber ist zu tun, wenn beispielsweise ein Pfleger mutig ist, aber dennoch falsch handelt? Rechtfertigt eine moralisch günstige Charaktereigenschaft auch offensichtlich falsche Handlungen als "moralisch gut"? Wie kann zudem zwischen "internen" Tugenden (Standhaftigkeit, Mut, Tapferkeit) und Tugenden für Andere (Wohltätigkeit, Fürsorge, Großzügigkeit) hinsichtlich der Motivation vermittelt werden? Anwendbarkeit dennoch schwierig Wie lassen sich tugendethische Ansätze auf moderne technische Fragen, die die Ethik betreffen, etwa die Stammzelllinienforschung, die Sterbehilfe oder die Abtreibung anwenden? Die Aufforderung, jeweils das zu tun, was ein tugendhafter Mensch tun würde, scheint hier nicht weiter zu führen. Das Problem ist, dass wir schon eine Vorstellung davon besitzen müssen, ob etwa die Handlung, einen Fötus abzutreiben, moralisch verwerflich ist oder nicht, um unsere Tugenden danach zu richten. Dies aber widerspricht der tugendethischen Grundthese, dass es primär die Tugenden seien, die eine Handlung z.B. "gerecht" machen würden. Bei modernen verfahrenstechnisch neuen ethischen Problemen helfen Tugendrekurse eher wenig. Weiterführendes Grundproblem 57 Verfügt man, nach Erwerb, automatisch qua Charakter über moralische Qualität in den eigenen Handlungen aufgrund der Tugenden oder sind Tugendbefolgungen einer Willensanstrengung unterworfen? Kann ich tugendhaft sein wollen - oder verfehlt diese Überlegung gerade den Sinn der Tugendethik? Unterschwellig spielt hier also ein Menschenbild mit, indem über das Autonomieproblem vorentschieden wird, je nach Ansatz. Können Pflegende tugendhaft handeln, selbst wenn sie gar keine Handlungsfreiheit aufweisen? Relevanz tugendethischer Ansätze für die Pflegeethik ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4.7 Literaturhinweise Anscombe, G.E.M.: Modern moral philosophy. In: Philosophy 33 ,1958. Aristoteles: Nikomachische Ethik. Stuttgart, Reclam 8586, 1969. Foot, Philippa: Die Wirklichkeit des Guten. Moralphilosophische Aufsätze. Frankfurt a.M. 1997. Frankena, William K.: Analytische Ethik. Eine Einführung. München (5) 1994. Höffe, Otfried: Aristoteles. Becksche Reihe Denker Bd. 535, München (2) 1999. Höffe, Otfried (Hg.): Aristoteles: Die Nikomachische Ethik. Reihe Klassiker auslegen. Berlin 1995. Horn, Christoph und Rapp Christof: Wörterbuch der antiken Philosophie. München 2002. MacIntyre, Alasdair: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Hamburg 2001. MacIntyre, Alasdair: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt a. M. 1995. Müller, Anselm Wilfried: Was taugt die Tugend? Elemente einer Ethik des guten Lebens. Stuttgart 1998. Rippe, Klaus Peter und Schaber, Peter (Hrsg.): Tugendethik. Stuttgart, Reclam 9740, 1998. 58 5. Ethischer Diskurs: Methoden und Methodenprobleme 5.1 Wider den Methodenpositivismus Bevor in diesem Kapitel eine Auswahl an Methoden vorgestellt und erläutert wird, die in ethischen Diskursen Anwendung finden, muss hervorgehoben werden, dass der Begriff der Methode in der Ethik eine gänzlich andere Rolle spielt als etwa in den praktischen Verfahrensweisen vieler standardisierter Richtlinien und Handlungsanleitungen der Berufe im Gesundheitswesen. Der Unterschied zwischen „Methode“ und „Methode“ rührt daher, dass sich Handlungsanweisungen der Berufspraxis aus der Beschreibung gelingender und sich bewährt habender Tätigkeiten gebildet haben. Diese Tätigkeiten werden methodisch verallgemeinert und dienen der Bewältigung lösbarer Probleme. Ob beispielsweise mechanisch oder elektrisch reanimiert wird, betrifft eine lösbare Frage und ändert nichts am Entscheid, dass reanimiert wird. Wird hingegen die Frage aufgeworfen, ob es moralisch angemessen und ethisch begründbar sei, in diesem oder jenem Fall noch zu reanimieren oder nicht, dann wird die Frage deshalb schwieriger, weil nun offene und bislang ungelöste Grundprobleme tangiert werden, die sich einer engen methodischen Absicherung verwehren. Im öffentlichen Diskurs zeigt sich diese Differenz oft in der Empörung, die ethische Standardisierungsversuche auslösen. Die Methoden der Ethik tragen deshalb in erster Linie dazu bei, die Problemlage zu erfassen und zu beschreiben, vorliegende Wertkonflikte zu formulieren, lösbare von offenen Problemen zu unterscheiden, verschiedene Begründungsvarianten an einem Problem zu durchdenken und allgemein die ethischen Kompetenzen der Diskursteilnehmer schrittweise zu erweitern. Anders als bei berufspraktischen Methoden gehört zur philosophierenden Ethik auch eine Reflexion über die Qualität und die Ansprüche der je angewandten Methode selbst und deren Anwendbarkeit auf den jeweils vorliegenden Fall. Pointiert ausgedrückt kann man sich fragen, wem etwa damit gedient ist, wenn eine ethische Argumentation sich genau an ein bestimmtes vorgegebenes Modell (z.B. utilitaristischer oder deontologischer Art) hält: dem Patienten oder dem Modell? Doch selbst wenn diese Frage als selbstverständliche und rhetorische eingestuft wird (was übrigens nicht von allen Ethikern getan wird!), bleibt die Frage offen, ob wir das, was wir von der Anwendung einer bestimmten Methode erwarten, auch berechtigterweise erwarten dürfen. Ich spreche hier die Problematik des blinden Flecks eines blauäugigen Methodenpositivismus an, der meint, mit dem, was er regelgeleitet tut, immer auch schon genau zu wissen meint, dass, was und weshalb er dies tut. Eine Gretchenfrage der philosophierenden Ethik lautet: Kann ich wissen, was ich mache, wenn ich argumentiere, begründe, widerlege, opponiere, aufkläre, assoziiere, systematisiere, verkompliziere, vereinfache, dramatisiere, bagatellisiere, …? Methodenpositivisten würden antworten, dass ich eben dies mache, was mir die Bedeutungen dieser Prädikate versprechen. Dem ist zu entgegnen, dass solchen wie und wo auch immer definierten oder sonst festgelegten Bedeutungen im komplexen Feld einer Falldiskussion nur eine sehr bedingte Bedeutung zukommt. Dies merkt, wer ethische Gespräche in ihrer Vielfältigkeit und Prozessualität untersucht. Obwohl die groben Leitlinien ethischer Gespräche von Bedeutungen und sprachimmanenten logischen Strukturen mitgeprägt werden, dürfen die zahlreichen weiteren Faktoren der gesprochenen Rede nicht unbeachtet und unthematisiert bleiben, wenn dem Phänomen eines Wertkonfliktes auf ethische Weise Rechnung getragen werden soll. Dazu genügt eine Reduktion des Gesprochenen auf Bedeutung und Kohärenz nicht, selbst wenn viele Gespräche sich entlang von semantischen Oberflächen und Linien bewegen. Unmut, kleine 59 Begeisterungen und Empörungen, Gleichgültigkeit, Sym- und Antipathien, Charaktertugenden, Rang- und Standeswürde, Engagement, Interesse oder andere Faktoren können die Untertöne desselben Satzes in so vielen Weisen färben, dass Gesprächsverläufe nur dann vorausgesagt und verifiziert werden können, wenn sie mit Gewalt vorstrukturiert werden. Dann aber droht die Gefahr, das Phänomen aus dem Fokus zu verlieren oder dieses nur in reduzierter Weise partial zu instrumentalisieren – beispielsweise auf ein Ideal vollständiger Kohärenz, durchgeführt von einem sich als souverän wähnenden, sich als mit sich selbst identisch vorführendes Subjekt. Judith Butler hat in diesem Zusammenhang von der ethischen Gewalt gesprochen, die von der Forderung ausgeht, dass wir „jederzeit unsere Selbstidentität vorführen und aufrecht erhalten und von Anderen dasselbe verlangen.“ Dabei bleibt unsere „eigene Undurchsichtigkeit“, „unsere gemeinsame und unabänderliche Teilblindheit in Bezug auf uns selbst“54 auf der Strecke. Diese Rede, die bei Helmuth Plessner als anthropologischerkenntnistheoretische Rhetorik vom „blinden Fleck“ und vom homo absconditus55 auftaucht und bei Alasdair MacIntyre um die soziale und körperliche Dimension erweitert wird als expliziter Vorwurf an viele Ethikkonzeptionen, ein allzu verallgemeinertes, souveränreflexionsfähiges ethisches Subjekt unterstellt zu haben, das blind war für seine Abhängigkeiten von Anderen und von seiner Körperlichkeit56 – diese Rede ist von eminenter Bedeutung für den Vollzug ethischer Diskurse, weil sie ein weiteres Grundproblem aufgreift und für die angewandte Ethik zu verallgemeinern versucht: Das Problem der Identität der je sprechenden Person. Dieses offene und bislang ungelöste Problem werden wir in seiner Komplexität hier nicht entwickeln. Seine Andeutung mag genügen um einsichtig zu machen, dass es beim Vollziehen eines ethischen Diskurses wenig Sinn macht, wenn sich Subjekte als selbstidentische und souveräne inszenieren und in einer methodenpositivistischen Haltung ein ethisches Entscheidungsfindungsmodell auf hygienische Maximalkohärenz hin an einem exemplarischen Fall herunterargumentieren. Die Einhaltung einer bestimmten Methode der Ethik eröffnet im besten Falle neue Sichtweisen einer Problematik und erweitert die Sichtweise. Soll ein Fall möglichst differenziert untersucht werden, so empfiehlt sich für die angewandte Ethik eher ein breiter polymethodischer Zugang als eine stark fokussierte Bündelung einer einzigen Methode bis in die feinen und dem Laien als spitzfindig erscheinende Diskussion der ethischen Forschung. Für den Umgang mit dem Folgenden sei dem Anwender philosophierender Ethik deshalb nahe gelegt, möglichst viele verschiedene Methoden an einem Fall zu erproben und auf seine Leistungsfähigkeit und seine Grenzen hin jeweils zu reflektieren. 54 Butler, Judith: Kritik der ethischen Gewalt. Frankfurt a. M. 2003, S. 54 „Die Schrankenlosigkeit des menschlichen Wesens, die wir gleichwohl in seiner spezifischen Lebensstruktur verankern können, gibt das Recht, vom homo absconditus zu sprechen, weil er die Grenzen seiner Schrankenlosigkeit kennt und sich damit unergründlich weiß. Sich und seiner Welt offen, weiß er um seine Verborgenheit.“ In: Plessner, Helmuth: homo absconditus (1969). In: Ders. Gesammelte Schriften VIII, Frankfurt a. M. 2003, S. 353-366, hier S. 357. Das lateinische absconditus bedeutet verborgen, verhüllt. 56 MacIntyre, Alasdair: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Hamburg 2001, S. 12f: „Von Platon bis Moore und darüber hinaus finden sich für gewöhnlich, von einigen seltenen Ausnahmen abgesehen, nur flüchtige Erwähnungen menschlicher Gebrechlichkeit und Leiden sowie ihrer Verbindung zu unserer Abhängigkeit von anderen.“ 55 60 5.2 Methoden im Diskurs Die folgenden Ausführungen zu einzelnen Methoden sind gezielt auf eine Anwendbarkeit im ethischen Diskurs hin formuliert. Philosophisch unbewanderte Leser und Anwender sollten deshalb im Hinterkopf behalten, dass es von jeder der hier im Singular wiedergegebenen methodischen Ansätze beinahe unüberschaubar viele Varianten gibt und eine reichhaltige kritische Diskussion über die jeweilige Leistungsfähigkeit und die Grenzen des Ansatzes immer noch anhält. Philosophisch bewanderte Leser sollten hingegen im Auge behalten, dass es einem an einem ethischen Diskurs Beteiligten zu einem akuten Fall aus dem Gesundheitswesen wenig hilfreich ist, zwischen den phänomenologischen Ansätzen des mittleren Husserl und MerleauPontys im Detail unterscheiden zu können. Einer weiteren Vertiefung einzelner Methoden sei damit aber kein Riegel geschoben – ganz im Gegenteil lohnt sich die spätere Präzisierung einzelner Methoden und Begriffe ungemein. Übersicht über einige Methoden philosophierender Ethik Methode Phänomenologie Ziel Vorteile Leistungsfähigkeit Nachteile Grenzen / Probleme Wahrnehmung verfeinern Situationsbezug Sach-/Tatsachenrekurs Vorurteilsfreie Wahrnehmung ohne Kategorisierungen möglich? Deutungen kennen Einbezug und Reflexion von Kontexten Sind die einbezogenen Kontexte fallrelevant? Begriffe und Argumente klären Präzisierung logischer Aspekte der Argumentation Verschärfung des kategorialen Untertons Reduktion auf Kohärenz Positionen abwägen Konturierung von Positionen Reduktion auf einige wenige Positionen; Kampfmetaphorik unterscheiden, aufschieben (différance) um-, weiterschreiben abwägen Überspringen von methodischen oder ideellen Grenzen Terminologische und methodologische Fassbarkeit Hermeneutik Analytik Dialektik Dekonstruktion Lektüreempfehlungen: Bochenski, I.M.: Die zeitgenössischen Denkmethoden. Tübingen 1993. Soentgen, Jens: Selberdenken! 20 Praktiken der Philosophie. Wuppertal 2003. Phänomenologie Ihre Devise lautet in vereinfachter Form: „Zu den Sachen selbst!“ Was damit genau gemeint ist, ist je nach phänomenologischem Ansatz verschieden. Für die einen bedeutet ein phänomenologischer Zugang zu einem Phänomen ein Zugang, der möglichst frei ist von Vorurteilen. Genau hinsehen, bevor man urteilt zielt ab auf ein Ideal des unvoreingenommenen Blicks. Was dabei allerdings jeweils erkannt wird, ist je nach Konzeption des 61 Wahrnehmungsapparates sehr verschieden. Naive Auffassungen meinen, die Dinge selbst so zu erfassen, wie sie sind, kritischere Auffassungen respektieren die Schwierigkeiten oder die Unmöglichkeit solchen Unterfangens und beschränken sich auf die Erscheinungen der Dinge oder die Erscheinungen, die aus unserem Inneren jeweils entstehen. Ohne hier diese Differenzierungen im Einzelnen zu verfolgen, kann festgehalten werden, dass es keinem ethischen Diskurs schadet, einen vorliegenden Tatbestand aus einer verfeinerten Wahrnehmung des vorliegenden Falles heraus zu untersuchen. Lektüre: Neben dem Klassiker zur Phänomenologie, den Cartesianischen Meditationen von Edmund Husserl, sei im Hinblick auf die vielfältigen Weiterentwicklungen als Einstiegsdroge in diesen Ansatz der Leserschaft empfohlen: Bernhard Waldenfels: Phänomenologie in Frankreich. Frankfurt a. M. 1987. Hermeneutik Hermeneutik bedeutet „Auslegekunst“. Texte werden mehrmals gelesen, wobei sich unter Einbezug verschiedener Hintergründe die Bedeutungen möglicher Lesarten ständig erweitern. Hermeneutik bedeutet, so hat es Odo Marquard einmal pointiert gesagt, „dasjenige aus einem Text herauszuholen, was nicht drinsteht.“ Er trifft damit eine auch umstrittene Annahme Gadamers, man müsse jedem Text zunächst einmal eine Art „Vollkommenheit“ unterstellen, deren Reichhaltigkeit die hermeneutische Textauslegung herausarbeiten solle. Damit droht die Gefahr einer Überinterpretation. Auch der „hermeneutische Zirkel“, das mehrmalige Durchgehen und Weiterauslegen des Textes unter wechselnden nahen und weiten Perspektiven („Horizonten“) hat bei einiger Plausibilität nicht nur unter Analytikern Bedenken ausgelöst, sondern birgt das Problem der unbeachteten gegenseitigen Interpretation und Schematisierung sowohl des Textes wie auch des jeweiligen Auslegehintergrundes. Das hat Martens dazu bewogen, von einem morbus hermeneuticus zu sprechen: Ein Text hat gerade zehn Abschnitte, weil das Seminar, an dem der Kurs durchgearbeitet wird, zehn Sitzungen dauert. Bei aller Kritik kommt der hermeneutischen Methode aber das Verdienst zu, gezielt für Reichhaltigkeit und Fülle an Auslegungsmöglichkeiten zu sorgen, die anderen Methoden gerade abgeht, weil ihre methodischen Engführungen restriktiver gestaltet sind. Lektüre: Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen 1990. Analytik Analytische Methoden basieren in der Regel auf Bestimmungs- und Absicherungsversuchen des Kohärenzgrades von Texten. Mit Methoden der Logik werden die logischen Strukturen eines Textes auf formale Geltung hin untersucht, Argumentationen bloßgelegt, Fehlschlüsse und Widersprüche aufgedeckt. Ihr Stellenwert ist selber Gegenstand philosophischer Reflexion, weil einerseits sprachliche Rechtfertigungen immer auch logische Aspekte beinhalten, deren Schlüssigkeit oder Fehlerhaftigkeit einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit und den Wert philosophischer Texte haben. Andererseits aber sichert die analytische und formale Korrektheit einer Argumentation nicht die Wahrheit der zugrunde gelegten Prämissen. So kann ein Text zwar logisch einwandfrei und kohärent formuliert sein, aber ohne jegliche praktische oder mit Welt korrespondierender Bedeutung sein, andererseits kann der logisch erbärmlich argumentierende Text äußerst relevante Prämissen und Annahmen diskutieren. Im Übrigen ist in der Forschung unklar, was wir tun, wenn wir Argumentieren – selbst oder gerade dann, wenn 62 wir die Regeln eines bestimmten oder gar bewährten logischen Kalküls genau eingehalten. Ein seit Aufkommen der Logik im Hochmittelalter bekanntes Problem ist auch, dass mit den Mitteln formaler Analysen von logischen Strukturen mehr Aussagen generiert werden können, als für den Weltbezug nötig, sinnvoll oder praktisch sind. Dennoch ist die Kenntnis typischer Fehlschlüsse und Argumentmuster für das Führen ethischer Diskurse ein beinahe unerlässliches Desiderat, weil gerade die Möglichkeiten und Grenzen einzelner Argumentationen in verschiedenen Kontexten wieder erkannt werden sollten und nicht nur mit Gegenargumenten behandelt, sondern eigens in ihrer Problematik thematisiert werden können sollten. Lektüre: Irving M. Copi: Einführung in die Logik. München 1998. Dialektik Unter den vielen Begriffen und Auffassungen von Dialektik, deren Vielfalt philosophiegeschichtlich von der Antike bis zur Moderne reicht, soll hier bloß ein rudimentäres Verständnis angeführt werden. Die Dialektik formuliert verschiedene Positionen zu einem bestimmten Problem und versucht danach, diese in einem Dialog gegeneinander auszuspielen mit dem Ziel, die stärkere von den eingebrachten Positionen zu konturieren. Vorteile dialektischer Verfahren liegen in einer Art „Resistenztest“ von Haltungen oder Überzeugungen. Eine bestimmte Position wird im Kreuzfeuer der dialektischen Kritik ausgezeichnet und in der Regel begründetermaßen beibehalten oder verworfen. Probleme ergeben sich üblicherweise in der Dialogstruktur: Wie viele Positionen sind aus einer Problematik heraus in einen dialektischen Prozess einzubeziehen? Oft werden nur zwei Positionen gegeneinander ausgespielt, wobei eine Freund-Feindmetaphorik oder eine Metaphorik des Kampfes ihr Scherflein zur Verzerrung einer Sachlage beitragen können. Dialektische Methoden neigen zudem dazu, eine gewisse Blindheit für die Komplexität eines Einzelfalles zu generieren und Sachverhalte auf zwei oder mehreren Kontroversen zu reduzieren. Neben dieser Kritik am Reduktionismus des Verfahrens liegt das Problem vor, wie lange und wie kritisch ein dialektisches Verfahren durchgeführt werden soll. Was ist das Abbruchkriterium einer dialektischen Kette? Ein Konsens? Eine neue, dritte Synthese? Ein Dissens? Eine Aporie? Ein Sich-Verlieren in den filigranen Spitzfindigkeiten eines zu weit verästelten Diskurses? Ein subjektives oder kollektives Abbruchgefühl? Trotz dieser Schwierigkeiten werden sich in beinahe jedem ethischen Diskurs dialektische Momente finden, in denen verschiedene Positionen gegeneinander abgewogen werden müssen. Es kann auch geschehen, dass ein dialektisches Verfahren nach Abschluss und Verwerfung indirekt die gefragten, aber nicht erfassten Sichtweisen aufzuzeigen vermag. Lektüre: Rainer Hegselmann: Formale Dialektik. Ein Beitrag zu einer Theorie rationalen Argumentierens. Hamburg 1985. Dekonstruktion Eine Kritik, die von der Seite der Dekonstruktion erhoben worden ist, ist die unbegründete und vielleicht unbegründbare Setzung eines souveränen Subjektes, das von einem unangetasteten und oft auch noch überzeitlich konzipierten und damit gegen die Veränderungen der Zeit immunen Feldherrenhügel der Interpretation aus Texte und Fälle untersucht. Il n’y a pas de hors-texte – Es gibt keinen Text außerhalb des Textes. Dieser Satz Derridas verdeutlicht mit einem weiten Auffassen des Textbegriffes dieses Problem und reagiert methodisch darauf in einer Weise, die die Verfahrensbedingungen und deren Verzerrungseffekte in eine Auslegung 63 und Interpretation mit einbezieht und diese dadurch einer vorschnellen und allzu sicher sich gebärdenden Interpretation entzieht. Sie gewährt ihr Aufschub und Distanz in einem – eben différance, wie Derrida sein Kunstwort dafür entworfen hat. Anstatt eine bessere und immer bessere Interpretation zu liefern, die dann bei einer besten oder grundlegenden ihr Ende findet, hört der Prozess der Deutung mittels dekonstruktivistischer Verfahren niemals auf. Texte werden nicht nur gedeutet, sondern stets auch um- und weitergeschrieben. Für die Ethik kann das beispielsweise bedeuten, dass ein ethisches Beschlusspapier, ein Leitbild oder eine Verfahrens- und Bewertungsrichtlinie nicht definitiv erstellt werden kann. Es bleibt stets die Aufgabe, diese Varianten aus den Grenzen ihrer Bedingungen heraus zu neuen Varianten mindestens umzuschreiben oder aber weiterzuentwickeln. Diese methodischen Erörterungen dekonstruktivistischer Verfahren unterliegen jedoch selber wieder zu dekonstruierenden Veränderungen, was vielen Interpreten die nicht zu unterschätzende Mühe bereitet hat, genau zu formulieren, worin eine dekonstruktivistische Methode (die von Derrida nicht explizit als solche formuliert wurde, vor allem aber in der amerikanischen Literaturwissenschaft zur Methode erhoben wurde) genau besteht. Dieser Schwierigkeiten zum Trotz liegt der Vorteil dekonstruktivistischer Verfahren für ethische Dialoge gerade darin, nicht formulierte Instanzen und Rahmenbedingungen in den oft auf einer bestimmten semantischen Ebene von Bedeutungen geführten ethischen Diskurs einbringen zu können und so neue, völlig aus dem Fokus gebliebener Aspekte des ethischen Verfahrens selber thematisieren zu können. Lektüre: Jacques Derrida: Grammatologie. Frankfurt a. M. 1998. Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt a. M. 1976. Engelmann, Peter (Hg.): Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Stuttgart 1990. Philosophische Methodenreflexion Um methodischer Blauäugigkeit und dem eingangs erwähnten Methodenpositivismus entgegenzutreten, sei den Teilnehmenden und vor allem den moderierenden Personen ethischer Diskurse eine philosophische Methodenreflexion nahe gelegt. Haltungen und Entscheidungsgrundlagen wären defizient, wenn sie nur aufgrund semantischer Engführungen oder aufgrund von glaubwürdigen Kohärenzgraden einer bestimmten Argumentation zustande gekommen wären. Nötig ist – bei aller Empathie und allem sich leidenschaftlich Engagieren für ethische Belange konkreter Einzelfälle – ein immer auch distanziertes Verhältnis zum eigenen und fremden Tun. Dieses Einsehen und Urteilen gelingt wohl nur vermittels dem Selberdenken, Handeln und Sein und ist wohl schwerlich methodisierbar oder überprüfbar. 5.3 Modelle ethischer Entscheidungsvorbereitung In den bisher untersuchten Ansätzen ethischer Theorie kamen vereinzelt Modelle ethischer Entscheidungsfindung vor. In der Literatur zur angewandten Ethik finden sich zahlreiche solcher Modelle, die eine gewisse Orientierungs- und Anregungsfunktion übernehmen können. Ein Vergleich zeigt bestimmte Ähnlichkeiten, die den meisten solcher Modelle eigen sind. Typischerweise umfassen sie die folgende Reihe von Punkten, die bei Entscheidungsfindungsprozessen – man sollte präziser und besser von Entscheidungsvorbereitungsprozessen – Beachtung finden: Typische Punkte ethischer Entscheidungsvorbereitungsmodelle 64 Klärung von Vorfragen zu Gesprächsbedingungen Problembeschreibung und Wertanalyse Erarbeitung von Handlungsoptionen Erhebung dafür relevanter Werte Gewichtung / Güterabwägung Entscheidungsempfehlung oder Dissens Nachbereitung / Wiederholung / Evaluation Die kritische Leserschaft wird beim Durchdenken der folgenden Modelle viele Bezüge zu den bisher dargestellten Positionen utilitaristischer, deontologischer oder tugendethischer Ansätze ethischen Denkens wieder erkennen. Termini wie „Prinzip“ oder „Folgen“ sollten dabei im günstigen Falle die inneren Warnlampen unvermittelt zum Blinken bringen und den entsprechenden Problemhintergrund aufrufen, der an der jeweiligen Stelle des ethischen Diskurses eingebracht werden kann. Auf einen explizit kritischen oder selbstkritischen Kommentar wurde hier verzichtet, einige Hinweise auf regelrechte Fragwürdigkeiten in einzelnen Modellen aber gleichwohl angemerkt. Auf Modelle, die bereits im Titel mit numerologischen Prädikaten Formen der Abgeschlossenheit, überzeitlicher Abschließbarkeit suggerieren, wurde hier bewusst verzichtet. Das bedeutet nicht, dass mit solchen Modellen nicht auch erfolgreich ethische Diskurse geführt werden können, jedoch scheint nicht einsichtig, was ein ethisch fraglicher Nebenwert numerologischer Kompaktheit (fünf Prinzipien, sieben Schritte57, etc.) in den sehr komplexen ethischen Problemfeldern zu suchen hat. Warum vereinfachende, zwar mnemotechnisch gut merkbare, aber der Sache nach die Schwierigkeiten bloß verdeckende Kategorienkataloge einführen, wenn man nachher bloß erkennt, dass sie nicht hinreichen und sie kaum wieder aus den Köpfen zu verbannen sind? 57 Vgl. Baumann-Hölzle, R. (1999), 7 Schritte ethischer Urteilsbildung, in: Dialog Ethik Interdisziplinäres Institut für Ethik im Gesundheitswesen, www.dialog-ethik.ch vom 6.10.1999. 65 5.3.1 Modell Bremer / Heusler (2003) Katholische Fachhochschule Freiburg "Ethische Kommissionen und Komitees" SS 2003 Prof. Dr. Erika Heusler / Daniel Bremer M.A. Schritte ethischer Entscheidungsfindung i. Formulierung und ausführliche Analyse der Situation Was ist das Problem? Weshalb ist es ein Problem? Wie kam es dazu? In welchem Kontext steht es (Altenheim, Abteilung ...)? Wer sind die betroffenen und die beteiligten Personen? Welche Rollen spielen sie? Wie sind ihre Beziehungen untereinander? Wie stellt sich die Situation aus dem Blickwinkel jeder einzelnen Person bzw. Partei dar? Welche Hinweise gibt die Lebensgeschichte der beteiligten Person( en) - pflegerischer, medizinischer, sozialer, religiöser Hintergrund? Welche zusätzlichen Informationen vervollständigen das Bild von der Situation? Wie bin ich involviert? Was ist mein Anteil? (…) ii. Ethische Reflexion Wie lässt sich der ethische Konflikt formulieren? Welche Normen sind von Bedeutung? Welche Werte sind in Frage gestellt, stehen auf dem Spiel? Gibt es einen Wertekonflikt? Wer trägt die Verantwortung? (…) iii. Entwurf und Analyse von mindestens drei Handlungsalternativen Welche Handlungsalternativen gibt es? Hier gilt es kreativ zu werden' Welche sind kurzfristig, welcher längerfristig? Was sind ihre möglichen Folgen? Wird jemandem durch eine Handlungsalternative Schaden zugefugt? Wird das Problem in einem Schritt lösbar sein oder werden weitere Schritte nötig sein? Besteht eine zeitliche Vorgabe? Auf welcher Verantwortungsebene ist welche Handlungsalternative angesiedelt (individuell, institutionell gesellschaftspolitisch)? Wie ist die Rechtslage? Welche Ethikentwürfe stehen hinter den einzelnen Handlungsvorschlägen? Welche Menschen-, Lebens und Altersbilderbilder? Welche Metaphernspendebereiche lassen sich erkennen? iv. Güterabwägung, Konsensfindung und Entscheidung Gibt es eine Hierarchie der Handlungsalternativen? Gibt es eine Kompromisslösung? Lassen sich die Handlungsmöglichkeiten verallgemeinern? Was für ein moralisches Klima wollen wir? Zu welchem Konsens kommen wir? Oder müssen wir uns darüber verständigen, dass es keinen Konsens gibt? (Mut zum Dissens) Wie lautet die Entscheidung? (…) v. Überprüfung der Entscheidung Wie fühlt sich die Entscheidung an? Wie geht es den einzelnen Beteiligten mit der Entscheidung? Was verändert sich aufgrund der Entscheidung? Was ist der Gewinn - was ist der Preis? Wie sieht der erste Schritt aus? (…) 66 5.3.2 Modell Bremer (2003) Offener Fragenkatalog zur ethischen Fallanalyse Vorbemerkungen Es gibt mittlerweile eine ganze Vielzahl von Modellen zur ethischen „Entscheidungsfindung“, die unterschiedlich viele Fragen, Methoden und Aspekte einbringen. Problematisch scheint der Begriff deshalb zu sein, weil er Gewissheit verspricht, die von ethischen Überlegungen weder erwartet werden kann noch soll. Als treffenderen Ausdruck schlage ich deshalb vor, eher von „Entscheidungsvorbereitungsmodellen“ zu sprechen, oder noch einfacher einen beliebig reduzier- oder erweiterbaren „Offenen Fragekatalog zur ethischen Fallanalyse“ bereitzustellen, der die Frage, wem wir verpflichtet sind zu folgen, stets mit enthält und mitstellt. Denn die Frage, ob Menschen für bestimmte Werte zu leben haben oder umgekehrt bestimmte Werte sich nach den Menschen zu richten haben, ist bislang nicht entschieden – und deshalb ein nicht zu unterschätzendes Element angewandter ethischer Reflexion. Vor allen ethischen Bemühungen liegt eine erste Entscheidung in der Frage, ob die Beteiligten sich überhaupt auf ein ethisches Gespräch einlassen können und wollen. Wer die Frage in Vorgespräche einbringt, sollte die Angesprochenen und sich selbst mit dem, was „Ethik“ bedeuten und leisten kann, vertraut machen. Dabei gilt es zu beachten, dass Ethik keinen Moralersatz darstellt, sondern mögliche Handlungsalternativen entwickelt auf ihre moralische Güte hin befragt und zur Diskussion stellt. Im Vollzugsfall stellt sich dann bald die dilemmatische Frage, wie weit eine ethische Untersuchung vorangetrieben werden soll: Geht sie von den Werten aus, die die Betroffenen von sich aus einbringen und hält sich mit der Erweiterung von Aspekten und Werten zurück? Oder bringt sie ein, was sie alles kann und zu bieten hat mit der Gefahr der Überforderung der Beteiligten? Oder wählt sie einen Mittelweg, der es unternimmt, gezielt einige unbedachte Aspekte in das ethische Gespräch einzubringen, das seinen Ausgang von den Vorstellungen der Beteiligten aus erhebt? Oder wählt sie eine Methode, die von einem einfachen Kommunikationsmodell abweicht und z.B. hermeneutisch, dekonstruktivistisch, performativ-transitorisch etc. verfährt? Im Anwendungsfall eines ethischen Gespräches im Sinne sich vollziehender praktischer Philosophie wird sich in nicht vorhersehbarer Weise mindestens eine der unzähligen Varianten ergeben, je nach den ethischen Kompetenzen der Beteiligten, deren Wertvorstellungen, deren Reaktionen, biographischen Erfahrungen, deren Auffassungsgabe und vielen weiteren Faktoren. Ob diese methodischen Varianten selbst „gut“ waren, ist wiederum eine ethische Frage, die nicht deswegen schwer zu beantworten ist, weil es an Kriterien mangelt, sondern weil vielmehr zu viele untereinander unverträgliche Kriterien angeführt werden können, die eine eindeutige Wahl kaum zulassen werden. Wie aber arrangiert man sich mit solchen Schwierigkeiten? Die zunächst einfache Antwort lautet: Indem man sie zur Sprache bringt. Genau dies ist die wohl wichtigste Aufgabe der beginnenden ethischen Auseinandersetzung, wenn sie im Sinne angewandter Philosophie betrieben werden soll. Der hier vorgeschlagene folgende offene Fragenkatalog leistet somit keinerlei Gewähr oder Garantie für das Gelingen ethischer Entscheidungsfindung, sondern soll die Beteiligten zum Nach- und Weiterdenken über ihre Situation anregen. Es wird eine Vielzahl von Fragen angeführt, die nicht hierarchisch gegliedert sind und keineswegs zwingend Vollständigkeit beanspruchen oder bei vollständigem Durchdenken moralisch „bessere“ Entscheidungsvoraussetzungen zu schaffen vermögen. Die Unterteilung in Vorfragen und Hauptfragen erhebt sich lediglich aus dem defizitären Umstand, dass viele Modelle ethischer Entscheidungsfindung die Fragen nach den Bedingungen ethischer Gespräche selten mitführen. Sie werden hier unter der Kategorie der Vorfragen geführt. Zu beachten ist, dass folgende Fragen nicht etwa nur als einmalige Prozedur durchgeführt werden: Es gibt hier keinen Standard, zumal sich während eines ethischen Gespräches nicht nur die Sichtweisen der Betroffenen, sondern auch ihre Zugangsweisen auf das Problem und ihre damit verbundenen Werte durchaus verändern können. Diesem Phänomen und zahlreichen weiteren, wie der Wahl des in einem weiten Sinne verstandenen Vokabulars, der Argumentationsweisen, der kategorialen Untertonschärfe, etc., die hier unausgeführt bleiben, sollte im sich vollziehenden ethischen Diskurs gleichfalls Rechnung getragen werden. Vorfragen Lässt ein moralisch bedenklicher Fall ein ethisches Gespräch mit allen Betroffenen zu? Ist genügend Raum, Zeit und ethische Kompetenz vorhanden, um ethische Gespräche zu einem Fall führen zu können? 67 Woraufhin soll ein ethisches Gespräch geführt werden: Zur Entscheidungsfindung in einem moralisch bedenklichen Fall? Zur Nachbearbeitung moralisch bedenklicher abgeschlossener Fälle (Prävention)? Zur Etablierung, Aufrechterhaltung und Erweiterung der ethischen Kompetenz der regelmässig Betroffenen? Wer führt in welchem Rahmen mit wem wie lange und wie ausführlich ethische Gespräche? Werden Plenumsgespräche geführt? Werden Einzelgespräche geführt? Braucht es ethisch kompetente, am Fall aber unbetroffene Moderatoren? Welche Gesprächsregeln sollten stets beachtet werden? Welche Argumentationsfallen oder Fehlschlüsse können und sollen vermieden werden? (…) Hauptfragen Worin besteht das Problem? Wie sieht jeder Betroffene die aktuelle Problemlage? Was macht das Problem zum Problem? Worin liegt die Schwierigkeit? Welches ist die Geschichte des Problems? Welches waren die Bedingungen der Problementstehung? Welche Personen / Institutionen sind am Problem in welcher Weise beteiligt? Auf welche Werte nehmen die Beteiligten Rekurs? Gibt es darunter unveränderliche Werte? Welche Wertkonflikte bestehen bereits? Wie ist die Verantwortung verteilt? Wer könnte Verantwortungs- und Entscheidungsträger sein? Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen und können realisiert werden? Hier gilt es, möglichst viele Alternativen zu entwickeln! Wie könnte das Problem gelöst oder zumindest Schritte hin auf eine günstige Veränderung der Lage vorgenommen werden? Geht es um akute Lösungsfindung oder sollen mittel- bis langfristig Handlungsempfehlungen entwickelt werden? Welche Werte werden zur Begründung für diese Handlungsmöglichkeiten herangezogen? Hier gilt es, eine ganze Palette an Werten heranzuziehen! Welche Folgen ergeben sich für alle Betroffenen aus den erwogenen Handlungen? Verletzen die Handlungen irgendwelche unbedingte oder bedingte Geltung einfordernde ethische und rechtliche Prinzipien oder Normen? Welche Menschenbilder stehen hinter den jeweiligen Handlungsbegründungen? Ist die gemachte Reduktion des Falles auf die gewählten Werte für alle Beteiligten ausreichend? 68 Auf welchen Verantwortungsebenen ist welche Handlungsalternative wie bewertet: individuell – institutionell – gesellschaftspolitisch? Sind die Bewertungskriterien der Handlungsmöglichkeiten herausgearbeitet, so können sie nun dem Versuch einer Hierarchisierung unterzogen werden: Welche Handlung ist die moralisch gebotene und ethisch am besten rechtfertigbare? Kann ein Konsens gefunden werden, mit dem alle Beteiligten weiterhandeln können? Besteht ein nicht auflösbares Dilemma? Haben die Beteiligten Mut zum Dissens? Können sich die Verantwortungsträger zu einer Entscheidung durchringen? Im Zweifelsfall kann das ethische Gespräch unter Einbringung bisher unberücksichtigter Aspekte wiederholt werden. Hier gilt es, den Entscheidungsträgern wenn möglich eine ausreichende Bedenkzeit einzuräumen. Oft geht nach gefällten Entscheidungen nochmals ein Ruck durch die eigenen Überlegungen, die Schritte in Richtung Selbstbestimmung bei Entledigung selbsttäuschender Faktoren bedeuten können. Wenn Begründungen von Entscheidungen fraglich werden, können vertiefte philosophische Problemaufweise den Betroffenen Sicherheit in der Unsicherheit liefern, zumal die oben genannten Unterscheidungen üblicherweise kaum weitergehend problematisiert werden. So sind beispielsweise Fragen nach der Möglichkeit von Vorhersehbarkeit beabsichtigter Handlungen oder der grundsätzlichen Geltung von Werten wichtig, weil sie auf Grundprobleme führen, die zur Sprache gebracht werden und weitere Handlungsmöglichkeiten eröffnen können. Zu Bedenken gilt es, dass eine Entscheidung nicht „besser“ ist, wenn sie den Handlungsempfehlungen des ethischen Gespräches folgt. Oft sind – und das ist ein Ausdruck menschlicher Freiheit – Emotionen bei Entscheidungsprozessen als letztes Zünglein an der Waage beteiligt, die nicht zwingend der Logik einer Analyse folgen. Es wäre ein formalistischer Fehlschluss zu glauben, eine logisch zusammenhängende Argumentation wäre deshalb in Bezug auf ausführbare Handlungen wertvoller als eine weniger logische nur weil sie formal korrekt erfolgte! Und da Ethik im Sinne angewandter Philosophie kein Moralersatz ist und sein will, macht sie hier keinerlei Vorschriften. Kurz gefasst: Philosophische Ethik will Werthorizonte aufzeigen Legitimationsmöglichkeiten aufdecken Reflexionsprozesse in Gang bringen Problemlagen und Normenkonflikte analysieren Handlungsoptionen entwickeln und gewichten Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen schaffen Rätegeberin sein Philosophische Ethik will nicht von Verantwortung entlasten Vorschriften machen (Ethik ist nicht Moral und auch nicht Ethos) Bestimmte Werte vermitteln Entscheidungsträger sein Moralische Defizite kompensieren Ratgeberin sein Die minimale Hoffnung, die mit dem ethischen Gespräch verbunden ist, liegt darin, dass eine wohlüberlegte Entscheidung – egal, wie man sich schlussendlich entscheidet – die bessere Entscheidung darstellt, gerade weil sie es mindestens unternommen hat, das denk- und machbar Mögliche mit zu berücksichtigen bevor die Entscheidung (aus welchen Gründen auch immer) gefallen ist. (…) 69 5.3.3 Modell Tschudin Phasen der ethischen Entscheidung Phase 1: Analyse Handelt es sich um ein aktuelles oder um ein potentielles Problem? Wie ist das Problem entstanden? Weshalb ist es ein schwieriges Problem? Welche Fakten sind wichtig? Welche Fakten sind irrelevant oder unwichtig? Welche Werte sind in Frage gestellt? Weist das Problem Aspekte auf, die sich mit dem Gewissen von Beteiligten nicht vereinbaren lassen? Welches sind die Ansichten des Patienten? Was will er? Welche Personen sind direkt betroffen? Welche Rollen spielen die beteiligten Personen? Wie sieht jede einzelne Person das Problem? Welches sind die Erwartungen jeder Person bezüglich des Ergebnisses? Welche Personen haben eine Schlüsselposition? In welcher pflegerischen, medizinischen und sozialen Situation befinden sich diese Schlüsselpersonen? Welche Aspekte lassen sich verändern, welche nicht? Lässt sich dieses Problem mit anderen Situationen vergleichen? Gibt es weitere wesentliche Punkte zu berücksichtigen? Phase 2: Planung Welche Vorgehensweisen sind möglich? Welches sind die kurzfristigen und langfristigen Möglichkeiten? Welches sind die möglichen Folgen jedes Vorgehens? Wer zieht insbesondere Nutzen daraus? Inwiefern ist es überhaupt möglich, zu einem Ergebnis zu gelangen? Wird jemandem von einer der Folgen geschadet? Wenn ja, wie? Ist das Problem mit einer Entscheidung zu lösen, oder sind weitere Entscheidungen notwendig? Besteht ein zeitliches Limit? Welches ist die grundsätzliche Frage bei diesem Problem? Geht es um das Recht der Person oder um die Handlung selber? Geht es darum, die Wünsche des Patienten zu respektieren? Geht es um professionelle Verantwortung? Welche ethischen Prinzipien58 stehen auf dem Spiel (beispielsweise die Prinzipien vom Wert des Lebens, vom Guten oder Richtigen, der Gerechtigkeit oder Fairness, der Wahrheit und Ehrlichkeit oder der individuellen Freiheit)? Besteht ein Konflikt zwischen diesen Prinzipien oder überschneiden sie sich? Welches ist das wichtigste Prinzip? Geht es um die Folgen einer Handlung? Geht es um die Frage, ob eine weitere Behandlung Sinn hat? Geht es um Werte, die einander widersprechen? Welche Werte sind wichtiger? Weshalb? Ist es eine Frage der beruflichen Beziehungen? Wird an Regeln des Berufskodex appelliert? Wird dadurch die Situation beeinflusst oder verändert? Ist ein Kompromiss möglich, oder muss das Problem durch eine entschiedene Handlung gelöst werden? 58 Zu Bedenken gilt es hier, dass die notwendige und unbedingte Geltung der hier angeführten Prinzipien keineswegs erwiesen ist, sondern Gegenstand der philosophisch-ethischen Rechtfertigung geblieben ist. Die Prinzipien gehen zurück auf J. Paul Thiroux: Ethics – theory and practice. Encino, California 1977, von wo sie mit allzu verbindlichem Unterton in die Pflegeethikliteratur (z. B. Tschudin (1988, 1990), van Schayck (2000), etc.) eingegangen sind und einer deontologisch bedenklichen Tendenz Vorschub geleistet haben, solche Prinzipien unhinterfragt als gegeben hinzunehmen. Damit wird die philosophierende Ethik geradezu verunmöglicht. Aussagen über die fünf Thiroux-Prinzipien wie „Als Ganzes decken sie die Theorie des moralischen Verhaltens ab und können sowohl auf einzelne Personen oder Situationen als auch generell angewendet werden,…“ (Tschudin, V.: Helfen im Gespräch. Basel 1990, S. 154) zeugen einerseits von einer zu restriktiven und vereinfachenden Sicht auf die Komplexität vorliegender Einzelfälle und andererseits von einer mangelhaften theoretischen Kenntnis ethischer Schwierigkeiten und Problemhintergründe. 70 Phase 3: Ausführung Welche Handlung soll ausgeführt werden? Wer führt die Handlung aus? Wann? Wie? Phase 4: Evaluation Ist das Problem durch die Entscheidung gelöst? Wenn nicht, Warum nicht? Inwiefern hat die Lösung eines Teilproblems die weitere Fragestellung beeinflusst? Waren die Erwartungen realistisch? Wenn nicht, warum waren sie nicht realistisch? Waren nur einige Aspekte realistisch? Welche? Warum waren einige Aspekte nicht realistisch? Wenn wir uns noch einmal entscheiden müssten, würden wir wieder gleich entscheiden? Wenn nicht, warum nicht? Können wir sagen, dass eine Entscheidung eine Zunahme des Guten bewirkt hat? Haben andere Personen von der ursprünglichen Entscheidung ebenfalls einen Nutzen gehabt? Hat diese Entscheidung spätere ähnliche Entscheidungen erleichtert? Ist irgendein Aspekt dieser ethischen Entscheidung zu einem allgemeinen Gesetz geworden? Quelle: Tschudin, V.: Ethics in Nursing. The caring relationship. London 1986; dt. Ethik in der Krankenpflege, Basel 1988, S. 104-112. 5.3.4 Utilitaristisches Modell nach Brody Der kritischen Leserschaft dürfte nach der Lektüre der bisherigen einführenden Kapiteln in die ethische Theorie klar geworden sein, dass rein utilitaristische Modelle ethische Problemlagen in ihrer Komplexität nicht hinreichend erfassen können. Dennoch finden Folgenabwägungen ihren Platz und in ethischen Diskursen, wobei ihr Stellenwert aus Sicht performativer und methodenkritischer Überlegungen immer auch Gegenstand der ethischen Reflexion sein sollte. Utilitaristisches Analysemodell nach Brody 1. 2. 3. 4. Erfassen des Problems Aufführen verschiedener alternativer Handlungen zur Lösung des Problems Folgenabschätzung für jede Lösungsmöglichkeit Zuteilen von positiven oder negativen Werten (Glück/ Unglück, gut/ schlecht, Wohlbefinden/ Schmerzen, etc.) 5. Wahl derjenigen Lösung mit dem höchsten Wert 6. Vollzug der ethisch richtigen Handlung Lösung a)_______ b)_______ c)_______ Folge _______ _______ _______ Wert(e) + -- + - +++ +- - - Rangfolge/Entscheid 2. 1. Handlungsvollzug 3. Quelle: Brody, H. Ethical Decisions in Medicine. Boston (2) 1981, S. 355; auch in: Ethische Grundsätze für die Pflege. Hrsg. Vom schweizerischen Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Bern 2000, S. 24. 71 5.3.5 Modell Sistermann Zum Vergleich sei hier aus dem Felde wirtschaftsethischer Überlegungen ein Modell angeführt, dass in trotz seiner Knappheit für die Strukturierung ethischer Diskurse im Gesundheitswesen dienlich sein kann. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hinführung Problemstellung Selbstgesteuert-intuitive Problemlösung Angeleitet kontrollierte Problemlösung Festigung Transfer Quelle: Sistermann, Rolf: Konsumismus oder soziale Gerechtigkeit? In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik, Nr 1/2005, S. 16-27. 5.3.6 Modell Thompson Im folgenden Modell bilden die Schritte 1-7 die Analyse des ethischen Problems. Schritt 8 enthält den Prozess der ethischen Abwägung. Schritt 9 betrifft die Entscheidung, Schritt 10 die Evaluation. Modell der bio-ethischen Beschlussfassung 1. Beschreibe die Situation und bestimme die Gesundheitsprobleme, erforderliche Entscheidungen, ethische Aspekte und wichtigste Beteiligte 2. Sammle ergänzende Informationen, um die Situation zu verdeutlichen 3. Bestimme die ethisch wichtigen Aspekte der Situation 4. Umschreibe die persönlichen und professionellen ethischen Positionen 5. Bestimme die ethischen Positionen der wichtigsten Beteiligten 6. Beschreibe die vorhandenen Wertkonflikte 7. Stelle fest, wer die Entscheidung treffen muss 8. Bestimme die Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten und führe sie durch 9. Beschließe eine bestimmte Handlung oder Entscheidung und führe sie durch 10. Evaluiere und/oder revidiere die Ergebnisse der Handlung oder Entscheidung Quelle: Thompson, J. & Thompson H. Bio-ethical Decision-Making for Nurses. Aplleton-Century-Crafts, Norfolk (Connecticut) 1985; dt. zit. nach: van der Arend, Arie / Gastmans Chris: Ethik für Pflegende, Bern 1996, S. 120. 5.3.7 Deontologisches Modell nach Brody Der kritischen Leserschaft dürfte nach der Lektüre der bisherigen einführenden Kapiteln in die ethische Theorie klar geworden sein, dass rein deontologische Modelle ethische Problemlagen in ihrer Komplexität nicht hinreichend erfassen können. Dennoch finden Abwägungen über den Geltungsstatus bestimmter Prinzipien ihren Platz und in ethischen Diskursen, wobei ihr Stellenwert aus Sicht performativer und methodenkritischer Überlegungen immer auch Gegenstand der ethischen Reflexion sein sollte. 72 Deontologisches Analysemodell 1. Erfassen des Problems. 2. Ausarbeitung verschiedener alternativer Handlungen zur Lösung des Problems. 3. Aufführen verschiedener ethischer Prinzipien oder Grundsätze mit unbedingter Geltung. 4. Vergleich von 2. und 3. 5. Mögliche Resultate und Folgeprobleme: Fall A: Eine Handlung allein wird als pflichtentsprechend bewertet. Ihr entsprechend wird gehandelt. Fall B: Mehrere Handlungen werden als pflichtentsprechend bewertet. Alle könnten durchgeführt werden. Nun werden weitere Kriterien herangezogen (Zeit, Effizienz, Umweltverträglichkeit, Ökonomie, etc.). Fall C: Eine Handlung wird ausgewählt, die nur mit einigen Regeln übereinstimmt, zu anderen aber im Widerspruch steht. Für den Fall C können weitere übergeordnete Prinzipien 2. Ordnung (Metaprinzipien) herangezogen werden, die den Widerspruch ggf. aufzulösen vermögen. Führt eine Neubewertung zu einer haltbaren Pflichtkonformität, so wird gehandelt, andernfalls wird es schwierig... Quelle: Brody, Howard: Ethical Decisions in Medicine (2) Boston 1981, S. 354; Auch in: Ethische Grundsätze für die Pflege. Hrsg. Vom schweizerischen Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Bern 2000, S. 23. 5.4 Ethisches Argumentieren, ethische Rhetorik Eine weit verbreitete Auffassung von Philosophie und insbesondere von Ethik besteht darin zu erwarten, dass diese Instanzen „bessere“ oder „vernünftigere“ Argumente und Gründe zur Rechtfertigung menschliches Handelns liefern können. In den letzten Jahren hat sich mittlerweile eine eigene Ethikindustrie gebildet, welche für Firmen, staatliche Institutionen, Stiftungen etc. beispielsweise ethische Kodizes entwirft und deren Implementierung begleitet, ethische Komitees entwirft, organisiert und durchführt, Mitarbeiter in ethischen Belangen weiterbildet, Ethikverträglichkeitsprüfungen unternimmt, etc. Dabei wird ein hoher Begründungs- und Rechtfertigungsaufwand geleistet: Argumente werden vorgebracht, gute und bessere Gründe für oder gegen eine bestimmte Handlungsoption aufgezählt, Kontroversen längeren Ausmaßes geführt oder Debatten und Grundfragen zu schwierigen Themen erörtert. Was dabei oft – und das selbst dann, wenn gewiefte Debattanten sich nicht nur die Sache, sondern auch die Geltung ihrer Argumente streitig machen – vergessen oder gar nicht beachtet wird, ist die Frage danach, was das ist, ein „Argument“ und was wir denn alles tun, wenn wir „bessere Gründe“ oder „gute Argumente“ äußern. Wer sich mit Argumentation und Rhetorik beschäftigt – und das hatte schon Aristoteles unternommen in den auch nach über zweitausend Jahren immer noch mit großem Gewinn lesbaren Büchern der Logik (Organon) und der Rhetorik – der wird mit einer ganzen Fülle verschiedener Argumenttypen konfrontiert. Diese haben bestimmte Bezeichnungen und geben vor, auf eine bestimmte Weise zu funktionieren. Viele Rhetorik- und Argumentationsratgeber gehen dabei von dem Bild aus, dass es ein hierarchisiertes Set von Argumenten gäbe, die sich Menschen nutzbar machen können, um in der chaotischen Welt der Diskurse besser zu bestehen, nicht übers Ohr gehauen zu werden, mehr Erfolg zu haben, zur Wahrheit durchdringen zu können, Hypothesen zu überprüfen oder das Gute vom Schlechten absondern zu können. Charakteristisch ist hierbei die oft aufzufindende Metaphorik des Kampfes, die Argumente als „Waffen“ auffasst, mit dem man „Gegnern“ „eins auswischen kann“, im „Kampf 73 der Worte“ zu „obsiegen“ vermeint, „es jemandem zeigen zu können“ und viele weitere dieser Art. Betrachtet man allerdings – z.B. in der Situation des Betrachters am Fischteich – von außen zwei oder mehrere Diskursteilnehmer bei der Argumentation oder betrachtet man sich dabei selbst, so lassen sich eine ganze Menge weiterführender Fragen aufwerfen, die in Bereiche führen, die von der Bedeutung der geäußerten Sätze sehr verschieden sind. Verschiedene Ebenen der Argumentation Betrachten wir dies an einem Beispiel. Ein Pflegedienstleiter wirft einer Pflegerin vor, ihre Patienten ungerecht zu behandeln, weil sie ihnen unterschiedlich viel Zuwendung entgegenbringe. Die Pflegerin weist den Vorwurf damit zurück, dass er selber seine Angestellten ungerecht behandle, weil er einigen viel mehr Vorwürfe mache als anderen. Es handelt sich hier um das so genannte Tu-quoque-Argument, das Argument des „du auch“: Ein moralischer Vorwurf wird abgewehrt durch den Verweis, dass der Vorwerfende selber dem Anspruch des Vorwurfes nicht genüge. Wie kann man jemandem mangelnde Gerechtigkeit vorwerfen, wenn man es selber nicht fertig bringt, gerecht zu handeln? Ein Problem dieses Arguments besteht darin, dass ein Vorwurf durchaus sachlich berechtigt sein kann unabhängig davon, ob er auch moralisch berechtigt ist. Die Empörung der Verteidigerin speist sich aus dem offensichtlichen Umstand, dass der Vorwerfer den besagten Ansprüchen selber nicht zu genügen vermag, wodurch der Eindruck der Heuchelei entsteht – und gleichzeitig die zur Diskussion stehende Sache – ein Problem der Zuwendungsverteilungsgerechtigkeit – aus dem Blick gerät, obwohl sie zu Diskussion stünde und nicht die moralische Integrität des Vorwerfers. Interessant ist es nun weiterzufragen, was wir mit solchem Wissen über die Schwierigkeiten und Reichweitenprobleme gewisser Typen von Argumenten im ethischen Diskurs anfangen. Viele ethische Überlegungen und Diskussionen setzen an einer bestimmten kontroversen Frage ein, indem sie auf einer ersten Ebene der Untersuchung verschiedene Meinungen aufführen. Auf einer nächsten Ebene werden dann Argumente und Gründe für oder gegen bestimmte Meinungen und Haltungen angeführt. Als nächstes können rhetorisch und argumentationstheoretisch geschulte Teilnehmer auf einer dritten Ebene die Argumente der anderen Parteien angreifen und deren Wirksamkeit in Frage stellen. Vielleicht werden nun die rhetorisch Ungeschulten aufgeben und sich durch die implizite Gewalt, die entsteht, wenn auf Sätze keine Gegen- oder Mitsätze folgen, unterdrücken lassen (manchmal sogar in der scheinbar tröstenden Vorstellung, „überzeugt worden zu sein“) oder ein Moderator wird eingreifen und die Teilnehmer des abstrakten argumentationstheoretischen Diskurses „zur Sache“ zurückbitten. Doch was geht hier vor? Zunächst erhoffte man sich aus dem Rekurs auf „bessere Argumente“ einen Gewinn, um dann, wenn man sie im ethischen Diskurs versucht anzuwenden, Schiffbruch zu erleiden. Kommt dazu, dass gewisse Argumenttypen zu bestimmten Zeiten en vogue sind und vielerorts wirkungsvoll verwendet werden, während andere Typen wiederum gerade keinerlei Wirkung haben. 74 Performative Aspekte bleiben regelmäßig unthematisiert Ein weiteres, oft manchmal zwar wahrgenommenes, aber kaum je im Diskurs thematisiertes Phänomen ist die gesamte Interaktionsdimension des Sprechens und Inszenierens von Sätzen in Argumentform. Sie geht über die naive kommunikationstheoretische Vorstellung des Sendens und Empfangens von Bedeutungspäckchen (Shannon/Weaver 1948) weit hinaus und umgreift alle Aspekte (einschließlich unbekannter Faktoren), die durch eine reduzierende informationstheoretische Sichtweise verdeckt werden. Welche Färbung z.B. der Untertonmodulation dem Aussprechen eines Argumentes zukommt, ist für die Interpretation beim Gegenüber oft von viel höher Bedeutung, als die vermeintliche Bedeutung im offiziellen Spiel der Argumentation selber. Es spielt eine erhebliche Rolle, wie ich meinem Gesprächsteilnehmer etwas mitteile: Ob ich die Aussage scharf und knapp, zögerlich verlangsamt, fragend-interessiert, ironisierend, sarkastisch, diffamierend, resignierend, triumphierend oder hypothetisch-differenziert aufführe, ist im singulären Moment von hoher Wichtigkeit. Dass man solche Aspekte in einen ethischen Diskurs einbringen kann, setzt aber zunächst voraus, dass man sie überhaupt wahrnehmen, identifizieren und beschreiben kann. Weiter (und hier setzen viele Argumentationsbücher aus) braucht es ein Verwendungswissen von Argumenttypen und / oder performativen Aspekten: Wann und in welcher Situation sind sie angebracht, wann fehl am Platz? Wie gehe ich meinerseits mit Argumenten um? Drittens ist im Auge zu behalten, warum die Diskussion geführt wird: Ein konkretes Entscheidungsproblem, ein diskursives Ritual, ein Innewerden von gemeinsamen offenen Grundproblemen, eine möglichst kohärente Argumentation, eine stimmige Atmosphäre, ... ? Einige typische Argumente Anstatt hier erneut wiederzugeben, was schon vielerorts gut beschrieben ist, eine Aufgabe: Untersuchen sie den Mechanismus, die Leistungsfähigkeit und die Grenzen folgender, in ethischen Diskursen häufig anzutreffenden Argumente: Slippery-Slope-Prinzip / Schiefe Ebene / Dammbruch-Argument Tu-quoque-Argument Argumentum ad hominem Argumentum a majore Analogie und Gleichnis Differenzierungsargument Argument ad temperantiam Historisch-genetisches Argument Argument ad misericordiam Argument ad nauseam Argument ad lapidem Red Herring Petitio principii Ignoratio elenchi Das leuchtende Beispiel Paranoia-Argument / Schwarzes-Schaf-Argument (...) 75 Suchen sie in ihrer Berufswelt (Gespräche, Diskussionen, Texte aller Art) nach typischen vorkommenden Beispielen dieser Argumenttypen. Klären Sie die Rechtfertigungsgrenzen und das Leistungsvermögen dieser Argumentationstypen. Versuchen Sie, den Verwendungsmöglichkeiten und dem fehlerhaften Gebrauch durch eigene Diskurserfahrung und Reflexion auf die Schliche zu kommen. Lassen sich mit der Zeit daraus Thesen ableiten für einen ethisch verantwortungsvollen Umgang mit Argumenten? Was machen Sie insbesondere mit Ihrem Wissen um die Mechanismen von Argumenten und dem Wissen um die Inszenierungsbedingungen von ethischen Diskursen? Literaturempfehlungen zu dieser Aufgabe: Edmüller, Andreas / Wilhelm, Thomas: Argumentieren: Sicher – treffend – überzeugend. Trainingsbuch für Beruf und Alltag. Planegg 2000. Pfeifer, Volker: Ethisch Argumentieren. Bühl 1997. Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren, Anleitung zum subversiven Denken. München 1997. (Weitere Titel finden sich in der Literaturliste am Ende dieses Skripts) Einige typische Fehlschlüsse Der Wichtigkeit halber seien hier einige häufig anzutreffende Fehlschlusstypen angeführt, deren Kenntnis die Wahrnehmung und den Umgang im Diskurs ermöglichen, erleichtern oder wenn nötig auch erschweren kann. Formalistischer Fehlschluss Aus logischer Kohärenz und formaler Schlüssigkeit folgt ontologisch noch nicht, dass eine Konklusion Sollensgeltung erlangt. Beispiel: Selbst wenn ein Ethik-Komitee zum Schluss gelangt, dass man operativ eingreifen sollte, kann sich der darüber informierte Patient aus eigenen Gründen dagegen entscheiden. Sollen-Sein-Fehlschluss (u. a. W. Schmid 1998) Auch normativistischer Fehlschluss Aus einer Norm auf ein Sein zu schließen, ist problematisch, weil nachgewiesen werden müsste, dass gerade diese Norm auf diese konkrete Situation „passt“. Problem der Korrespondenz Sprache - Wirklichkeit! Naturalistischer Fehlschluss (George Edward Moore 1903) "Es ist eine Untersuchung, der wir besondere Aufmerksamkeit widmen sollten, weil diese Frage, wie "gut" zu definieren ist, die fundamentalste Frage der ganzen Ethik ist. (...) Bevor die Antwort auf diese Frage bekannt ist, ist es jedenfalls unmöglich, dass jemand überhaupt sagen könnte, worin die Evidenz für irgendein beliebiges ethisches Urteil liegt. Aber das Hauptziel der Ethik als einer systematischen Wissenschaft ist die Angabe genauer Gründe dafür, dass dies oder das für gut gehalten wird. (...) Wenn ich gefragt werde: "Was ist gut?", so lautet meine Antwort, dass gut gut ist, und damit ist die Sache erledigt. Oder wenn man mich fragt "Wie ist gut zu definieren?", so ist meine Antwort, dass es nicht definiert werden kann, und mehr ist darüber nicht zu sagen. (...) Aber es gibt ganz und gar nichts, das wir für gut einsetzen könnten. Das ist gemeint, wenn ich sage, gut sei undefinierbar. (...) Ich behaupte nicht, dass das Gute, das, was gut ist, 76 undefinierbar sei. Wenn ich das dächte, würde ich nicht über Ethik schreiben, denn meine Hauptabsicht ist, diese Definition suchen zu helfen. (...) Demnach halte ich das Gute für definierbar, und doch bleibe ich dabei, dass gut selbst undefinierbar ist. "gut" ist also, sofern wir damit die Eigenschaft meinen, die wir einem Ding zuschreiben, das wir mit gut bezeichnen, im entscheidenden Sinne des Wortes keiner Definition fähig. Der entscheidende Sinn von "Definition" ist derjenige, wonach eine Definition feststellt, welches die Teile sind, die unveränderlich ein bestimmtes Ganzes bilden, und in diesem Sinne entzieht sich "gut" jeglicher Definition, da es einfach ist und keine Teile hat. Es ist einer jener zahllosen Gegenstände des Denkens, die selbst der Definition unfähig sind, weil sie die letzten Begriffe sind, mit denen alles, was definiert ist, definiert werden muss. (...) Und es steht fest, dass die Ethik entdecken will, welches diese anderen Eigenschaften sind, die allen Dingen, die gut sind, zukommen. Aber viel zu viele Philosophen haben gemeint, dass sie, wenn sie diese anderen Eigenschaften nennen, tatsächlich "gut" definieren; dass diese Eigenschaften in Wirklichkeit nicht "andere" seien, sondern absolut und vollständig gleichbedeutend mit Gutheit [goodness]. Diese Ansicht möchte ich den "naturalistischen Fehlschluss" nennen, und ihn werde ich nun abzuhandeln versuchen. (...) Wenn jemand zwei natürliche Dinge miteinander verwechselt, indem er das eine durch das andere definiert, wenn er zum Beispiel sich selbst, der ein natürlicher Gegenstand ist, mit "Lust empfinden" oder "Lust", ebenfalls natürlichen Gegenständen, verwechselt, so besteht kein Grund, den Fehlschluss naturalistisch zu nennen. Wenn er aber "gut", welches nicht im selben Sinne ein natürlicher Gegenstand ist, mit irgendeinem natürlichen Gegenstand verwechselt, dann besteht Grund, von einem naturalistischen Fehlschluss zu sprechen." (George Edward Moore: Principia Ethica (1903); dt. Principia Ethica. Stuttgart 1970, RUB 8375, Kapitel 1, S. 34ff) "Im "Oxford English Dictionary" heisst es, "gut" sei "das allgemeinste Adjektiv der Empfehlung, das in einem hohen oder zumindest zufriedenstellenden Grad die Existenz gewisser charakteristischer Eigenschaften behauptet, die entweder in sich Bewunderung verdienen oder für irgendeinen Zweck nützlich sind"." (zit. nach Frankena, W.K.: Analytische Ethik. München (5) 1994, S.98.) Sein-Sollen-Fehlschluss (David Hume 1739) Beispiel: Ein Patient hat Schmerzen. Also soll ihm in jedem Fall geholfen werden. Hier wird aus einem Sein (das Faktum, dass ein Patient Schmerzen hat) auf logisch unzulässige Weise ein Sollen abgeleitet. Der Schluss (als deontologischer Modus Ponens) wäre nur dann korrekt, wenn eine weitere Sollens-Prämisse behauptet wird: Allen Patienten, die Schmerzen haben, soll in jedem Falle geholfen werden. Ein Patient hat Schmerzen. Also soll ihm in jedem Fall geholfen werden. 77 Wie aber wird diese zusätzliche Sollens-Prämisse ihrerseits legitimiert, ohne in einen infiniten Regress, ein Dogma oder einen logischen Zirkel zu geraten? Auch die weiteren Auswege rationaler Rechtfertigung scheinen problematisch, wie das bekannte Münchhausen-Trilemma Hans Alberts zeigt. Hier der Originaltext Humes zur eigenen Überprüfung: "I cannot forbear adding to these reasonings an observation, which may, perhaps, be found of some importance. In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remark'd, that the autor proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surpriz'd to find, that instead of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, 'tis necessary that it shou'd be observ'd and explain'd; and at the same time that a reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it." "Ich kann nicht darauf verzichten, diesen Überlegungen eine Beobachtung anzufügen, welche möglicherweise als bedeutsam erachtet wird. In jedem Moral-System, welchem ich bis jetzt begegnet bin, habe ich immer bemerkt, dass der Autor für eine gewisse Zeit der üblichen Argumentationsweise folgt, die Existenz eines Gottes postuliert oder Beobachtungen betreffend menschlicher Angelegenheiten macht. Und dann werde ich plötzlich überrascht, dass anstelle der üblichen Verbindung von ist und ist nicht-Sätzen, ich keinem Satz begegne, der nicht mit einem sollen oder nicht sollen in Verbindung gesetzt wird. Diese Änderung ist nicht wahrnehmbar, aber nichtsdestotrotz folgenschwer. Denn da dieses sollen oder nicht sollen eine neue Relation oder eine Bestätigung darstellt, ist es notwendig, dass es bemerkt und erklärt wird. Gleichzeitig wie eine Begründung geliefert werden soll für etwas was undenkbar/unbegreiflich ist, soll auch gezeigt werden, wie diese neue Relation von absolut anderen Relationen abgeleitet werden kann". (David Hume: A Treatise of Human Nature. (1739) Book III: Of Morals. Ed. by L.A. SelbyBigge, Oxford (2) 1978, S. 496; übersetzt von lic. Phil. Monica Müller, Zürich) 78 5.5 Der angewandte ethische Diskurs: Macht und Ohnmacht im Gespräch Sanftes Plädoyer für eine Ethik der Terminologie Die Totalität des Scheins von Unmittelbarem, der in der zum blossen Exemplar gewordenen Innerlichkeit gipfelt, erschwert es den vom Jargon der Eigentlichkeit Berieselten ungemein, ihn zu durchschauen.59 Abstract Der folgende Beitrag legt dar, dass einerseits das Phänomen der Macht – so wie es sich im Gespräch zeigt – in unterschiedlicher Weise denk- und deutbar ist, was für die konkrete Sprechpraxis auch unterschiedliche mögliche Umgangsformen nach sich zieht. Es geht dem Autor allerdings nicht darum, durch eine Erweiterung der Um- und Zugangsformen neuen Möglichkeiten der Machterweiterung die Hand zu reichen, sondern vielmehr darum zu zeigen, dass ein differenzierter und reflektierter Umgang mit kategorisierenden Sprechhandlungen durch explizite Verweisung auf ihre spezifische und perspektivisch bedingte Weise der Bezugnahme viel zur Entschärfung von Asymmetrien der Macht im Gespräch über die Standes-, Fach-, und zwischenmenschlichen Grenzen hinaus beitragen kann. Wie sag ich’s meinem Kollegen, Patienten, Vorgesetzten, Untergebenen, Freund oder Feind? Wer sich solche Fragen stellen kann, kann zwar vielleicht tatsächlich nicht wissen, wie er etwas bestimmtes zum Ausdruck bringen möchte, aber man ahnt zumindest, dass die Frage des Stils ziemlich bedeutsam ist – oft gar bedeut- und wirksamer, als die mitgeteilte Botschaft selbst. Dabei geht es nicht um einen von unzähligen Ratgebern der Rhetorik nahe gelegten Einsatz gewisser sprachlicher Kniffe, die angeblich für gewisse Situationen passender seien, denn solche Ratschläge sind nicht universalisierbar. Wer zum Beispiel etwa „schonend“ einem Patient einen vermuteten oder eindeutigen Befund mitteilen will, kann genauso Verdachts- und Empörungsmomente über die Art und Weise der Mitteilung auslösen, wie wenn er dasselbe schonungslos und direkt gesagt hätte – und umgekehrt. Vielmehr soll untersucht werden, wo ein möglicher Kern des Problems solcher Stilfragen liegt und wie konkret Umgangsformen und Sprechweisen aussehen können, die dieser Problematik Rechnung tragen. Dazu wird vorderhand das Phänomen der Macht und Ohnmacht im Gespräch etwas näher beleuchtet, um zu sehen, welche Zusammenhänge zwischen Macht und kategorialem Sprechen bestehen. 1. 2. 3. 4. 5. Macht und Ohnmacht Macht und kategoriale Schärfe Entschärfungsstrategien: Plädoyer für eine Ethik der Terminologie Gründe für solche Bezugnahmeweisen-Verweise Literatur 5.5.1 Macht und Ohnmacht Gegenstand der Betrachtung soll hier das vielgestaltige Phänomen der in Gesprächen erfahrbaren Machts- und Ohnmachtsmomente sein. Andere Machtaspekte, wie etwa Macht als Verwirklichungskraft, als hintergründig determinierende Wirkkraft, als verordnete Vorschrift, der zu folgen oder gegen die gerade aufbegehrt werden soll, als Wissen, als Trieb, als lokal 59 Adorno, Theodor W.: Der Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt a. M. 1964, S. 65. 79 entstehende oder überzeitlich wirksame Struktur, etc. etc. bleiben hier unbeachtet, gehörten aber durchaus als erwägenswerte Problemhintergrundaspekte indirekt zum hier behandelten Thema, weil solche Strukturen oft gleichzeitig einen Gesprächshorizont überlagern und durchdringen.60 Im Gespräch, im Dialog oder in einer Diskussion gehen Beteiligte gewöhnlich davon aus, dass bestimmte Personen über etwas Bestimmtes reden. Sie gehen zumeist davon aus, dass das, was sie tun, auch möglich ist, dass sie es sind, die da sprechen und dass das, worüber sie zu sprechen glauben, auch in der Tat dasjenige sei, wovon sie sprechen und dass sie darüber hinaus auch etwas erwägen, klären, regeln, abmachen, einfordern oder verwerfen können. Jedoch: W e r s p r i c h t ? Und: W a s k l ä r t ? Was vordergründig klar scheint, ist es nach kurzem Innehalten, Nachdenken und Erwägen nicht mehr. Dabei scheinen sich zwei Konzeptionen aneinander zu reiben, wie man sich „Macht“ im Gespräch, das immer auch als ein bestimmter Symbolgebrauch aufgefasst werden kann, denken kann, nämlich: These 1: Der sprachliche Symbolgebrauch schafft Machtverhältnisse, setzt diese durch und stellt so selber eine Form der Gewalt dar. These 2: Bestehende Machtverhältnisse sind zwar unausweichlich mit alltäglichem Symbolgebrauch verknüpft, aber darin nicht begründet. Uns interessieren hier nicht so sehr die argumentativen Rechtfertigungsbodenlegeversuche aus der philosophischen Diskussion um einzelne dieser Thesen zur Macht, sondern der Umstand, dass beide im Gesprächsvollzug als Phänomen erlebbar und erfahrbar sind und deshalb auch bestimmte angemessene Umgangsweisen mit diesen Konzeptionen (bzw. auch mit der immer auch mit zu berücksichtigenden Möglichkeit, dass beide Thesen unzutreffend sind und tatsächlich noch ganz andere, bislang unbedachte und unbemerkte Faktoren wirksam sein könnten) im praktischen Gesprächsalltag einfordern. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie ein Sortiment von Wörtern mit sich herumtragen, das sie zur Begründung und Rechtfertigung ihrer Handlungen einsetzen können. Gewöhnlich besteht ein solches Sortiment aus einem bestimmten Vokabular, das wir hier in einem etwa umfassenderen Sinne konzipieren. Ein bestimmtes Vokabular enthält nicht nur bestimmte Ausdrücke, Termini oder Begriffe, sondern eine ganze hier nicht im Einzelnen beschriebene Fülle von Strukturen wie einen Satz häufig und typischerweise gestellter und verwendeter Fragen, Antworten, Zweifelsbekundungen, Bestätigungen, Ausrufen, Befehle, Verordnungen, Argumente, Schlussfolgerungen (unabhängig davon, ob diese allgemein gültig oder formal korrekt sind oder nicht), Diskursroutinen, Metaphernspendebereiche, Werte, Prinzipien, kategoriale Bezugsrahmen, Rhythmen, Intonationen, Untertontypologien, Anschluss- oder Abbruchssignale, Sprechpausentypen, - aber darüber hinaus auch ein bestimmtes Wissen über Sprechüblichkeiten: Etwa ist der Kontext bekannt, wann, womit, wie und wie ausführlich in einem bestimmten Kulturraum, einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe oder einer bestimmten Situation etwa jemandem gedankt, geantwortet oder auf etwas 60 Der interessierten Leser sei auf die zahlreichen Beiträge zur Diskursethik von Jürgen Habermas sowie deren umfangreiche aus der Praxisanwendung entstandene Kritik ebenso verwiesen wie auf die Theorie der Macht, die Michel Foucault vor dem historischen Hintergrund von „Überwachen und Strafen“ entwickelt. Kurt Röttgers hat diese und viele weitere Aspekte des Themas in seinem umfassenden Buch „Spuren der Macht“ begriffsgeschichtlich und systematisch untersucht. Beiträge zur politischen und strukturellen Macht finden sich im Anschluss an die Modelle von Macchiavelli und Bodin gar bibliotheksweise. 80 in einer bestimmten typischen Situation durch Sprechhandlungen verbaler und nonverbaler Art Bezug genommen werden muss, ein Wissen um je bestehende Inszenierungsüblichkeiten. Ein solches Vokabular kann mit Rorty als ein „abschliessendes“ Vokabular bezeichnet werden, wenn sich eine Person zumeist und in aller Regel darin aufhält und die überwiegende Anzahl ihrer sprechsprachlichen Weltbezugnahmen so artikuliert, wie sie aufgrund der fremd übernommenen oder selbst gewählten internen Struktur ihres Vokabulars gegeben sind. Dabei kann man sich (in Anlehnung an einen Vorschlag Goodmans61) einen gewissen Grad der Verwendung einzelner solcher vokabularinterner Termini und Strukturen denken: Werden also etwa ein bestimmter Begriff, eine typische Frage oder eine bestimmte Begründungsstruktur häufig gebraucht, so weisen sie einen hohen Verwendungsgrad auf, sie sind in den einzelnen Hypothesen der Weltbezugnahme dieser bestimmten Person verankert und erfahren durch periodische Anstösse aus der nicht vokabulativ erfassten Sphäre der Welt empirische oder phänomenologische Bestätigungen oder Korrekturen. Bewähren sich bestimmte Hypothesen aus diesem Vokabular, so werden sie vererbt, ihr Vererbungsgrad ist ein Indiz dafür, wie lange sie schon aufrechterhalten werden. Bewähren sich bestimmte Termini in diesen vererbten Hypothesen, so weisen sie mit der Zeit einen hohen Verankerungsgrad auf. Gelangt ein neuer und bisher unbekannter Terminus in Berührung mit diesem Vokabular, so kann diese Person sich ihn zunächst nur aus diesem ihrem Vokabular, ihrem habitualisierten Horizont heraus zu erklären versuchen und ihn unter Verwendung bislang bekannter und verankerter Termini bestimmen. Gelingt dies nicht, so kann oft nur mittels eines anderen, von ihr bislang nicht beachteten Vokabulars eine Klärung und Integration des neuen Begriffs und damit die Erweiterung ihres eigenen Vokabulars geschehen. Ich sage bloss „oft“ weil auch andere, hier nicht entwickelte Klärungen möglich sein können: spontane, plötzliche und unerwartete Einsichten und Erkenntnisse etwa in die Struktur und Mechanismen bestimmter Begriffe, Schlussformen, Argumentationen, Diskursüblichkeiten, etc., die sich scheinbar unvermittelt einstellen können, aber methodisch-didaktisch kaum erzwungen werden können. Um eine einfache binäre Unterscheidung Rortys62 aufzugreifen, der Personen in solche mit „abschliessendem Vokabular“ und „Ironikerinnen“ eingeteilt hat, sei hier ein typologisches Feld entfaltet und erweitert, das mannigfaltige graduelle Übergänge und korrelative Überlagerungen zwischen den hier festgehaltenen Polen enthält. Die vier Pole stellen nicht nur „Positionen“ von Auffassungsweisen dar, wie man Vokabularien betrachten kann, sondern zeigen auch diskursive Bewegungen an, Akte und Gewohnheiten, wie sich sprechende und auf Welt Bezug nehmende Personen in oder zwischen bestimmten Vokabularien bewegen. Der Abschliessende Vokabularier ist ein typischer Sprachnesthocker, der sich vorzugsweise im eigenen selbst gewählten oder heteronom übernommenen Vokabular aufhält. Er bewegt sich diskursiv im eigenen Horizont, beschönigt diesen, indem er ihn von argumentativem Unrat wie vagen Hypothesen reinigt, wobei hier meist der Metaphernspendebereich der Hygiene wirksam wird. Oft sind dabei Autoimmunisierungsargumente, z.B. Argumente wie das der Retorsion 61 Goodman, Nelson: Fact, Fiction, Forecast (1955), deutsch: Tatsache, Fiktion, Voraussage, Frankfurt a. M. 1988, S. 124ff. 62 Vgl. Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie, Solidarität. Frankfurt a.M. 1999, S. 127f: „ ’Ironikerin’ werde ich eine Person nennen, die drei Bedingungen erfüllt: (1) Sie hegt radikale und unaufhörliche Zweifel an dem abschliessenden Vokabular, das sie gerade benutzt, weil sie schon durch andere Vokabulare beeindruckt war, die Menschen oder Bücher, denen sie begegnet ist, für endgültig nahmen; (2) sie erkennt, dass Argumente in ihrem augenblicklichen Vokabular diese Zweifel weder bestätigen noch ausräumen können; (3) wenn sie philosophische Überlegungen zu ihrer Lage anstellt, meint sie nicht, ihr Vokabular sei der Realität näher als andere oder habe Kontakt zu einer Macht ausserhalb ihrer selbst.“ 81 (Umdrehung), wie etwa ein Tu-quoque-Argument63 übliche Mittel, um den internen konservierten Stubenraum wirksam und nachhaltig zu desinfizieren. Personen dieses Typus zeichnen sich überdies dadurch aus, dass sie bevorzugte „Leerraummeider“ sind, also die fülligen und um viele Möglichkeiten reicheren Zwischenräume von Vokabularien meiden. Die Füllesuchenden Vokabularier stellen eine Variante des abschliessenden Vokabulariers dar. Sie sind wie diese ebenso Leerraummeider und reinigende Hygieniker, wechseln aber ihre je geschlossenen Vokabularien häufig. Diese als Sprachnestwechsler zu bezeichnenden Personen entwickeln somit eine bewegte Diskursgeschichte des Aufenthalts in vielen Horizonten von abschliessenden Vokabularien, aber sie leben dort jeweils sozusagen „in Vollpension“ und sind nicht an einer Betrachtung der Art und Weise ihres Tuns interessiert. Die Ultraironikerinnen sind Personen, die sich überwiegend und Vorzugsweise in den Zwischenräumen von abschliessenden Vokabularien aufhalten, weil sie erfahren haben, dass verschiedene untereinander unverträgliche abschliessende Vokabularien bestimmte Teilgeltungen beanspruchen, die eine kategorische Reduktion auf ein einziges zu verteidigendes Vokabular fraglich machen. Sie sind typische Leeraumgänger oder Sprachnestflieher, Nomaden des Geistes, für die ein gelingender diskursbewegender Lebensvollzug nur unter resoluter Meidung der „Identifikation“ mit den Fallgruben abschliessender Vokabularien möglich ist. Der hier verwendete Typus des „Leerraums“ ist nur aus der Perspektivik der abschliessenden Vokabularier gewählt, genau genommen verhält es sich aber gerade umgekehrt: Das abschliessende Vokabular ist „leer“ an Mehr- und Vieldeutigkeit, während der Zwischenraum von einer ungeheuerlichen Vielfalt und Fülle optionaler Bedeutungen „semantisch dicht“64 ist. Die Ironikerinnen schliesslich stellen jenen Typus dar, der sich in, zwischen und durch verschiedenste untereinander unverträgliche Vokabularien diskursiv bewegen kann. Wenn es für diese Personen eine positionale „Basis“ gibt, dann liegt diese weder in den Aussagegehalten abschliessender Vokabularien, noch in den semantisch dichteren Zwischenräumen, sondern vielmehr in der grundlegenden und permanent vollzogenen parallelen Bewegung der Rechtfertigung ihrer jeweils vollzogenen Art und Weise der Bezugnahme auf Welt. Zwar können sie sich durchaus temporär auf ein abschliessendes Vokabular einlassen, aber immer im Wissen und dem Aufschluss darüber, in welcher Weise sie dies gerade tun: Dass sie also z.B. die Gegenstände ihrer Betrachtung als Erinnertes, als Fremdes, als zu Bewertendes, als Pathologisches etc. betrachten. Diese hier nur durch vier ausgezeichnete Extrempole beschriebene anthropologische Typologie ist nun nicht in naiver Weise so zu lesen, dass man kategorisierende Zuordnungen vornimmt und ganz nach dialektischer Manier die einzelnen Positionen gegeneinander auszuspielen beginnt. Vielmehr sind diese und all die sehr vielen Zwischenpositionen als sich überlagernde 63 Vgl. Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten argumentiert, ohne den Verstand zu verlieren. Eine Anleitung zum subversiven Denken. München 1997, S.47: „Dieses Argument dient der Abwehr moralischer Angriffe. Man wirft dem Gegner, der einem wegen eine Tat X Vorwürfe macht, vor, dass er genau dasselbe getan habe. (…) Das allgemeine Prinzip ist komplex: (a) Wer selber X tut, hat kein Recht, uns X vorzuwerfen, folglich ist (b) sein Vorwurf damit erledigt, widerlegt nicht ernst zu nehmen. Selbst wenn man (a) zugibt, ergibt sich (b) damit jedoch keineswegs.“ 64 Vgl. Goodman, Nelson: Sprachen der Kunst. Frankfurt a.M. 1997, S. 148f. und ders.: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt a.M. 1998, S. 88ff.; Goodman beschreibt fünf Charakteristika einer allgemeinen Symboltheorie: syntaktische Dichte, semantische Dichte, relative Fülle, Exemplifikation und multiple und komplexe Bezugnahme. „Semantisch dicht“ meint hier in Analogie zu Goodmans Beispielen eines skalenlosen Thermometers oder gewöhnlichem Deutsch, dass Sprachen und damit einhergehende Bedeutungen – obwohl die Form der Sprache nicht syntaktisch dicht ist – gleichwohl auf ein Kontinuum möglicher Bedeutungen referieren können. 82 Sphären in korrelativem Sinne zu denken. Personen unterscheiden sich somit nicht nach Massgabe der je vollzogenen Diskursbewegung, keine ist kritiklos „besser“ als eine „andere“, sondern darin, wie reich in Zahl und Differenziertheit ihr Repertoire an Weltbezugnahmeweisen ist. „Reichtum“ oder „Armut“ an Bezugnahmeweisen sind dabei nicht a priori bewertbar, sondern werfen je spezifische ethische Fragen der Umgangsweise mit so oder so sich diskursiv bewegenden Personen auf. Rorty beispielsweise macht sich für eine spezielle Tugend der „Solidarität“ stark, die Ironikerinnen gegenüber Personen, die nicht ironiefähig sind oder sein wollen, ausüben müssen. Hier eröffnet sich der umfangreiche Horizont der in letzter Zeit wohl nicht ganz zufällig revitaliserten Tugendethiken, den wir hier allerdings nicht weiterverfolgen. 5.5.2 Macht und kategoriale Schärfe Der Zusammenhang zwischen unserem Sprechen und Phänomenen der Macht hängt ein Stück weit damit zusammen, wie kategorisch wir unser Sprechen gestalten. Lexika weisen den griechischen Terminus kategoría gewöhnlich zuerst mit "Anklage" aus. Diese Bestimmung wirft ein Licht auf den ursprünglichen Herkunfts- und Verwendungsort: das Gericht. In der Agora stehen sich Anklage und Verteidigung gegenüber, wobei diejenigen, deren Aussagen am verlässlichsten, klarsten und eindeutigsten dem Tatsachenverlauf entsprechen, eher Prozesse gewinnen. In diesem ursprünglichen Sinne findet sich das Wort kategoría auch bei Aristoteles: "Die Gattung der Gerichtsrede beinhaltet entweder Anklage oder Verteidigung; denn eins von beiden müssen die streitenden Parteien tun."65 In Gerichtsprozessen hatte die juridische Rede eine strenge Form, genauso traten auch Standardsituationen immer wieder auf, in denen eingefahrene Argumentationsmuster die Abläufe mit der Zeit standardisierten. Das Verbum kategoreo bedeutet "nieder-reden" (im weiteren Sinne auch: anklagen, beschuldigen, vorwerfen, tadeln, aussagen, zu erkennen geben, zeigen, verraten, beweisen) und steht dem Verbum apologeomai, "von-sich-weg-reden" (im weiteren Sinne: sich verteidigen, sich rechtfertigen, zu seiner Verteidigung vorbringen, verteidigen) gegenüber. Zu finden ist dieses Verb heute noch im Begriff der Apologie, der Verteidigungsrede. Der unbedingte Geltungs- bzw. Wahrheitsanspruch, der mit diesen Aussageverben verbunden ist, führte später zur heute noch gebräuchlichen adjektivischen Verwendung von "kategorisch" im Sinne von "unbedingt gültig" bzw. "behauptend". Nun ist unser Sprechen nicht etwa nur innerhalb eines Gerichts durch einen gewissen Grad an Kategorisierung gekennzeichnet, sondern auch viele Sätze, die wir in ganz vielen Lebensbereichen äussern, weisen einen solchen auf. So tragen so einfache und alltägliche Sätze wie „Das ist aber günstig“ oder „Da irrst du dich. Es war ganz anders“ oder „Es wird sicher bald alles wieder gut“ – einmal ganz abgesehen davon, was sie vorgeben zu bedeuten und davon, was sie vermutlich unausgesprochen auch noch alles bedeuten können – einen gewissen Kategorisierungsgrad in sich, der auch mitbestimmt wird durch eine bestimmte Wort- und Satzformwahl. Darüber hinaus sind natürlich bestimmte nonverbale Inszenierungselemente wirksam, wie der Unterton, der Rhythmus, die diskursiven Üblichkeiten des lokalen und des die Situation übergreifenden Kontextes, beabsichtigte und unbeabsichtigte Färbungen der Redeweise, der Gestik und Mimik, die räumliche Konstellation etc. etc. 65 Aristoteles: Rhet. A3, 1358 b 11 (Sieveke). 83 Unsere Betrachtung beschränkt sich hier auf die Aspekte des Kategorischen. Als Beispiel für einen Satz mit beinahe hundertprozentigem Kategorizitätsgrad könnte man sich einen Satz denken der Art: (1) „Herr B., sie leiden an x und sie sollten nun unbedingt z tun, nur z vermag ihnen weiterzuhelfen. Bei allen Patienten, die mit z behandelt wurden, hat sich immer Erfolg eingestellt.“ Was wird Herr B. wohl erwidern? Ja, was kann er – angesichts der kategorischen Schärfe, die durch die Termini unbedingt, nur, allen und immer miterzeugt wird – noch vernünftigerweise erwidern, ohne dass sein möglicher und vielleicht tatsächlich berechtigter Einwand nicht als aufbegehrender Affront aufgefasst wird? Liegt die Gefahr der Anwendung solcher Sätze nicht unter anderem darin, dass hier ein Gespräch, das sich sachlich um ein Problem bemühen könnte, geradezu unterdrückt und vermieden wird? Je höher der Grad an kategorischer Schärfe eines Satzes ist, desto grösser scheint die Wahrscheinlichkeit zu werden, dass sich eine angesprochene Person gar nicht am Gespräch beteiligen kann, dass sie in buchstäblichem Sinne bevormundet wird und eine Partizipation schwierig wird. Nun können selbstredend ganz verschiedene übergreifende Funktionen erfüllt werden mit Sätzen von hohem Kategorizitätsgrad. So können solche Sätze gezielt zur Verunsicherung (etwa bei Befragungen und Rechtfertigungen in Gebieten, die mit solchen Sätzen innerhalb streng abgeschlossener Vokabularien operieren, wie Mathematik oder Recht oder als Provokation z.B. in politischen Reden) oder zu Versicherung und Beruhigung (etwa im medizinischen, pflegerischen oder psychologischen Gespräch) in taktischer Weise eingesetzt werden. Sie können und werden aber sehr häufig in ganz vielen Lebensbereichen auch benutzt, ohne dass man sich genügend Gedanken darüber macht, was diese Sätze – unabhängig von ihrem Aussagegehalt – alles bewirken können. Man bemerkt dies häufig zu spät, zum Beispiel wenn man unbeabsichtigt etwas gesagt hat, das eine so nie geahnte Reaktion bei den Angesprochenen hervorgerufen hat. Auf der anderen (hier absichtlich überzeichneten) Seite stünden Sätze und Aussagen mit einem sehr geringen Kategorizitätsgrad. Der obige Satz klänge nun etwa so: (2) „Herr B., vermutlich leiden sie an x und sie könnten nun beispielsweise z tun, es wäre möglich, dass z ihnen weiterhilft, aber sicher ist das nicht. Bei einigen Patienten, die mit z behandelt wurden, hat sich ein Erfolg eingestellt, bei anderen nicht.“ So gesprochen wirkt der Satz einladend für eine sachbezogene Entgegnung des Angesprochenen, das vormals krass asymmetrische intradiskursive Machtgefälle wird symmetrisiert, Mitsprache scheint nicht nur zugelassen, sondern ist sogar erwünscht. Es wurden gezielt Termini wie „unbedingt“, „nur“, „alle“, „immer“ ersetzt durch wissenschaftstheoretisch „realistischere“ und kategorisch moderatere Ausdrücke und Formulierungen. Der Nimbus des allwissenden Expertentums ist in dieser Variante allerdings aufgegeben und Expertenpersonen werden sich sofort die Frage stellen, ob so formulierte Sätze nicht gerade diejenige Erwartungshaltung beim Ratsuchenden zerstören, die davon ausgeht, dass der Experte es ja wissen müsste, schliesslich hat man sich ja nicht umsonst in jahrelangen Studien ein Expertenwissen zugelegt, das nur dann zum tragen kommt, wenn es mit hohem Kategorizitätsgrad angewandt wird. Doch darum geht es hier nicht. In der Tat steckt hinter diesen aufgespannten Polen der Kategorisierung ein weiteres, lebensund weltanschauliches Grundproblem. Es sind die zwei Prämissen, die in der Geschichte des 84 Denkens häufig anzutreffen sind und die als Positionen zwar gegeneinander ausspielbar, aber nicht eindeutig festlegbar scheinen: Man kann erstens die Auffassung vertreten, dass aus der unübersichtlichen und vielfach konträren Vielfalt der Denk- und Handlungsmöglichkeiten prinzipiell eine Einheit, eine Ordnung, ein System, ein Ethos, eine Struktur, ein Optimum, eine wissenschaftlich eindeutig beleg- und beweisbare Weltbetrachtungsweise entdeckbar sei. Dieser Einheitsphilosophie kann eine Vielheitsphilosophie entgegengestellt werden, die gerade diese Möglichkeit angesichts der zahlreichen unvereinbaren, aber doch halbwegs plausibel scheinenden Vielfalt an Denk- und Handlungsmustern aufgibt zugunsten einer toleranten, nichtisolierenden, ideologiekritischen, unabgeschlossenen, aber auch mit Willkürgefahr behafteten offenen Sichtweise von Welt. Dies bedingt, dass eine hundertprozentige „weltenblinde“ Identifikation mit einer bestimmten Sorte von Vokabular oder einer von bestimmten Normen, Regeln, Werten und Argumentationsmustern durchsetzten Weltauffassung nicht mehr möglich ist, dass aber eine partielle Berücksichtigung durchwegs sinnvoll sein kann. Das Spiel der gegenseitigen Verdächtigungen ist uns aus dem kalten Krieg noch allzu bekannt, die Einheitsperson bezichtigt die Vielheitsperson der Verwässerung des Wesentlichen und klar Erkennbaren, während die Vielheitsperson die Einheitsperson verdächtigt, durch ihr kategorisches Gerede Wesentliches, nämlich Vielfältiges auszugrenzen und gezielt zu verschweigen, um sich mächtig zu inszenieren und die Kontrollgewalt über die kategorisch ausgezeichneten Gebiete zu sichern. Nun kann man sich diese problembeladenen Sachverhalte zwar vergegenwärtigen, aber wie sie lösen? Versuche, eindeutige, letztlich grundlegende philosophische Kategorien zu beschreiben, mittels derer die Struktur beschrieben werden könnte, gab und gibt es in der Geschichte des Denkens zuhauf, aber die Versuche der Beschreibung von Kategoriensystemen sind derart vielfältig und unterscheiden sich in ihren Begründungsvarianten so grundlegend, dass eine einzige überregional geltende Auffassung derzeit kaum möglich scheint, ohne Vielfaltsqualität preiszugeben. Auch kann das gegenseitige Starkmachen der einen wider die andere Auffassung kaum eine differenzierte, von positionalen Konflikten freie und praktisch anwendbare Umgangsform liefern. Vielmehr scheint mir diejenige Variante vernünftigerweise anwendbar zu sein, die sich von den oben beschriebenen polaren Gegensätzen, auch binären Oppositionen genannt, so distanziert, dass sie beide zugleich bzw. mehrere Typen und auch grundlegend andere Typen wie kontinuierliche oder graduelle Strukturen berücksichtigt. Sprache kann, wenn sie in der bei uns üblichen Weise aufgefasst wird, nicht umhin, als in gewissem Sinne einen minimalen Grad an Kategorisierung aufzuweisen, und es kann deshalb nicht das Ziel sein, Kategorisierungen egal welchen Schärfegrades zu kritisieren, zu loben oder gar zu verteufeln, sondern vielmehr darum, die je angewandte Zugangsweise mitzusignalisieren: Also, wie dies die oben beschriebenen Ironikerinnen tun, nicht nur zu sagen, was klar und unzweideutig oder eher vermutlich Sache ist, sondern gleichzeitig auch mitzuteilen, dass dies nur auf eine bestimmte Weise so ist, wie es präsentiert wird. Diese nuanciert und subtil eingeflochtene Verweisung auf die Art und Weise der Bezugnahme setzt natürlich voraus, dass man als sprechende Person nicht nur über verschiedene Vokabularien verfügt, sondern auch über verschiedene Arten und Weisen der Darstellung, also beispielsweise auch der Wahl einer bestimmten kategorischen Schärfe oder Unschärfe und dass man darüber hinaus sich verpflichtet, anzuzeigen, dass jeweils auf nur eine bestimmte von vielen Möglichkeiten der Bezugnahme etwas zum Ausdruck gebracht wird. So besehen würden unsere obigen Beispielsätze nun beispielsweise so klingen: (1)’ „Herr B., gemäss den üblichen und von mir angewendeten Diagnoseverfahren leiden sie an x und sie sollten nun unbedingt z tun, nur z vermag ihnen weiterzuhelfen. Bei allen Patienten, die mit z behandelt wurden, hat sich immer Erfolg eingestellt.“ 85 (2)’ „Herr B., die in solchen Fällen üblichen Diagnoseverfahren liefern keine eindeutigen Ergebnisse, aber auf Grund meiner praktischen Erfahrung kann ich die Vermutung äussern, dass sie vermutlich an x leiden und sie könnten nun beispielsweise z tun, es wäre möglich, dass z ihnen weiterhilft, aber sicher ist das nicht. Bei einigen Patienten, die mit z behandelt wurden, hat sich ein Erfolg eingestellt, bei anderen nicht.“ Ja, als Luxusvariante liesse sich nun auch der Satz formulieren, der beide Zugangsweisen in sich vereinigt und gleichzeitig ihre Zugangsweise signalisiert: (3) Herr B, als ein Arzt, der ausschliesslich die üblichen Diagnoseverfahren anwenden würde, kann ich ihnen sagen, dass sie an x leiden und nun unbedingt z tun sollten, nur z vermag ihnen weiterzuhelfen. Bei allen Patienten, die mit z behandelt wurden, habe sich gemäss einschlägiger Studien, immer Erfolg eingestellt. Allerdings muss ich ihnen als erfahrener und wissenschaftstheoretisch kritischer Arzt auch sagen, dass die hier angewendeten üblichen Diagnoseverfahren nicht zwingend eindeutige Ergebnisse liefern, es aber aufgrund meiner Erfahrung möglich wäre, dass sie vermutlich an x leiden und nun beispielsweise z tun könnten und z ihnen weiterhelfen könnte. Bei einigen Patienten, die mit z behandelt wurden, hat sich ein Erfolg eingestellt, bei anderen nicht. Was meinen Sie dazu? Anzumerken ist hierbei, dass „kritisch“ in (3) nicht in ausschliesslich negierendem, sondern in umfassendem Sinne gebraucht ist, also etwa mit „eingedenk aller Vor- und Nachteile, die sich an einer Sache zeigen“ übersetzt werden könnte. Betrachtet man die Werthaltungen, die hinter diesen Sätzen wirksam sind, dann entspricht (1) eher einem paternalistisch-präskriptiven Modell, das Werte wie Autorität oder Pflichtbewusstsein hochhält. Während (2), (1)’ und (2)’ Annäherungen an und (3) eine deutliche Fürsprache für Werte wie Patientenautonomie und Anerkennung und Partizipation des Angesprochenen übernehmen. 5.5.3 Entschärfungsstrategien: Plädoyer für eine Ethik der Terminologie Mit den festgestellten Werten, die den Aussageweisen entgegenzukommen scheinen, ist der Schritt in ethisches Terrain vorgezeichnet. Naiverweise darf nun – auch wenn derzeit die Patientenautonomie das paternalistische Modell in der Arzt/Pflege-Patientenkommunikation abgelöst zu haben scheint – nicht davon ausgegangen werden, dass dies ein linearer, geschichtlich irreversibler Prozess der Wertwandlung oder gar eines moralischen Fortschrittes darstellt. Dazu fehlen zu viele Kriterien und bestehen zu viele grundlegende Schwierigkeiten wie Induktion oder Verifikation, die diesen Vorbehalt belegen könnten. Warum hier dennoch eine Ethik der Terminologie formuliert wird, hat seinen Grund in der Sache: Die Missverständnisrate, die Fehlschlussrate und die Wahrscheinlichkeit unzulässiger Verallgemeinerungen sowie das implizit mit den Sprechweisen verbundene intradiskursive Machtproblem kann durch eine subtilere, differenziertere und reflektiertere Wortwahl und den möglichen zurückhaltenden Gebrauch bis hin zu einem bewussten Verzicht auf bestimmte Termini reduziert werden. Dem Machtphänomen wird dabei mit einer aufwendigeren aber 86 anspruchsärmeren Strategie begegnet, die Möglichkeiten der Einflussnahme beider Seiten möglichst offen hält. Elemente einer „Ethik der Terminologie“: Deklarationspflicht der Zugangsweise: Arten und Weisen der Bezugnahme sollen als je besondere gekennzeichnet und mitgeteilt werden. Gute Hilfe bietet hier die Kürzestform der Als-Struktur, die einsilbig knapp die jeweilige Bezugnahmeweise als solche beinahe unmissverständlich charakterisiert. Andere Formen sind die Verwendung des Konjunktivs oder die explizite Formulierung der Bezugnahmeweise wie z.B.: Denke ich analytisch, dann käme ich zum Schluss… Überblicke ich die Möglichkeiten, dann… Wenn ich die hier erwähnten Möglichkeiten gegeneinander abwäge, dann… Ästhetisch gesehen, wäre dies die wohl eine harmonische Lösung… Wenn ich sehe, wie sich unser Verständnis der Sache allmählich entwickelt hat, dann… Auch diskursive Üblichkeiten, Redegewohnheitsnotwendigkeiten können durch Hinweis auf die Weise der Bezugnahme kategorial entschärft werden: „Üblicherweise sagt man in einer solchen Situation, in der wir uns befinden, dass …; hier aber denke ich eher, dass…“ Terminiwahl: Termini mit extremer kategorialer Schärfe wie „alle“, „immer“, „nur“, „eigentlich“, „ausschliesslich“, „insgesamt“, „generell“, „es gibt“, „es gilt“, „es ist“, „die Lösung“, „das Beste ist“, „genau“, „exakt“, „wahr“, „unbedingt“, „völlig“, „unmöglich“, etc. sowie bestimmte Artikel: „der“, „die“, „das“,… sollten mit der nötigen Zurückhaltung eingesetzt werden und aus wissenschaftstheoretischen, logischen und machttheoretischen Erwägungen wenn möglich durch kategorial adäquatere und sanftere Termini ersetzt werden wie: „wenn…dann…“, „einige“, „manchmal“, „oft“, „dies gilt als etwas für jemanden bezüglich eines bestimmten Beurteilungsmassstabes“, „unter anderem gibt es auch“, „die einzige Lösung, die mir bekannt ist, ist…“, „das wie mir scheint Beste für diesen Fall bezüglich eines bestimmten Beurteilungsmassstabes ist…“ unbestimmte Artikel: „ein“, „eine“, „eines“, „einer“ In vielen Formulierungen Dispositionsprädikate wie: wiederkehrende so genannte 87 „heilbar“, „unheilbar“, „therapierbar“, „verantwortlich“, „unverzeihlich“, „behandelbar“, „erklärbar“, „unerklärlich“, „unaushaltbar“, „unerträglich“, „verständlich“, etc. sind in bestimmten Anwendungen wissenschaftstheoretisch fragwürdig, weil sie genau gesehen mittels induktiver Schlüsse auf Künftiges Gewissheiten formulieren, über die jetzt nicht mit Gewissheit entschieden werden kann. Solche Dispositionsprädikate sind im Deutschen an den Endungen –bar oder –lich zu erkennen und können kategorial entschärft oder ersetzt werden durch Formulierungen wie: „gilt nach heutigem Stand der Forschung als heilbar / „gilt nach heutigem Ermessen als unheilbar / als schwer zu heilen“ „mit Therapien konnten bislang einige gute Ergebnisse erzielt werden“ „wir/ich übernehmen / übergeben heute / jetzt die Verantwortungsverpflichtung für etwas und tun unser Bestes / versuchen diese zu erfüllen“ „Fehler passieren zwar, dennoch ist dieser einer der gravierenden Sorte, der uns zum Nachdenken über mögliche Verfahrensänderungen zwingt“ etc. 5.5.4 Gründe für solche Bezugnahmeweisen-Verweise Man kann sich nun mit gutem Recht fragen, warum eine in dieser Weise hier vorgeschlagene Ethik der Terminologie, die mit höherem Aufwand eine anspruchsärmere Bezugnahme auf Welt samt Rekurs auf die Weise der Bezugnahme vorschlägt, befolgt werden soll. Ich sehe dafür mehrere Gründe: Erstens. Dem Problem des Allgemeinen und Einzelnen wird in differenzierter Weise Rechnung getragen. Wenn man mittels allgemeiner Begriffe einen konkret vorliegenden Einzelfall zu beurteilen hat – wobei es nun egal ist, um welchen Gegenstand es sich in welchem Kontext handelt – dann steht man vor dem Problem der Verifikation oder Falsifikation, ob der konkret vorliegende Gegenstand tatsächlich unter die im allgemeinen Begriff erhoffte Gattung fällt bzw. ob er Wesenszüge der erhofften Art trägt, die hinreichend sind, um den Fall möglichst treffend zu beschreiben. Wissenschaftstheoretisch betrachtet ist es (zumindest bislang) nicht möglich eine bestimmte Vermutung zu überprüfen. Selbst dann, wenn sich bestimmte Daten gerade so verhalten, wie es in der Vermutung behauptet wird, kann es immer noch sein, dass diese Daten sich wegen ganz 88 anderer, noch unbekannter Faktoren gerade so zeigen, dass sie auf eine bestimmte Hypothese „zu passen“ scheinen. Aber zu jedem vorliegenden Datensatz können überdies gleichzeitig weitere, der ersten widersprechende Hypothesen geäussert werden, die von einem vorliegenden Datensatz gerade genauso scheinbar bestätigt werden. So kann man z.B. bei einem vorliegenden empirisch erhobenen Befund sowohl die Vermutung äussern, dass sich der weitere Verlauf aufgrund der Daten so entwickeln wird, wie bisher; gleichzeitig aber kann auch und zu Recht vermutet werden, dass das vorliegende Bild eines Sachverhaltes sich ab einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft ändern wird, jetzt aber von den Daten geradeso gut „bestätigt“ wird, wie die andere Hypothese. Die hierbei unterstellte Gleichförmigkeit oder Ungleichförmigkeit eines Entwicklungsfortgangs bzw. der dabei angewandten Zeitvorstellung bildet den Rahmen, der einer Rechtfertigung bedarf. Diese kann nun allerdings selbst nicht wiederum unter Verweis auf empirische Daten erfolgen, ohne zirkulär zu werden: Denn wenn empirische Daten dazu dienen sollen, eine allgemeine Hypothese über diese Daten zu stützen, dann muss eine gewisse Gleichförmigkeit des Zeitverlaufes angenommen werden. Wer dann fragt, warum diese gerade gleichförmig und nicht etwa ungleichförmig sei und als Antwort den Verweis auf bisher regelmässig erschienene empirische Daten erhält, der setzt unzulässigerweise gerade dasjenige voraus, was er gerade zeigen will. In diesem alten, aber immer noch ungelösten Problem liegt in der Tat eine schwer zu knackende erkenntnistheoretische Nuss, was man z.B. an der konkreten Frage sieht, ob ein als konkreter Fall vorliegender und künstlich beatmeter Komapatient im lebenserhaltenden Fall eine menschlich und ökonomisch belastende Zumutung für die Betroffenen darstellt und als „hoffnungslos“ einzustufen ist oder ob der Fall unter die Kategorien „medizinisches Wunder“ bzw. „statistischer Ausreisser“ fällt und eine Rehabilitation erwartet werden darf. Von Bedeutung ist in unserem hier thematisierten Fall nicht die schwierig zu erbringende ethische Entscheidungsfindung bei diesem Dilemmafall, sondern die Problematik der im geführten Diskurs angewandten Redeweise. Diese wird an einem Beispielssatz aus dem eben zitierten Fall sichtbar. Anstelle des von dem ersten an diesem Fall beteiligten Arzt gegenüber den Angehörigen geäusserten Satze: (4) „Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei diesen Fällen beträgt drei Prozent. Ich rate Ihnen aus medizinischer Sicht, die Beatmungsmaschine abzustellen. Wie sehen Sie die Sache?“ könnte in Hinsicht auf die oben vorgeschlagene Ethik der Terminologie und die wissenschaftstheoretische Problematik der schwierigen Bestimmung des je vorliegenden Einzelfalles auf eine allgemeine Hypothese der Satz beispielsweise so umformuliert und kategorial entschärft werden: (4)’ „Wenn wir weiter künstlich beatmen würden, dann besteht gemäss Statistik eine Überlebenswahrscheinlichkeit von drei Prozent. Ob dieser konkret vorliegende Fall allerdings genau in diese Kategorie fällt, dafür fehlen genaue Anhaltspunkte und Kriterien, die eine eindeutige Voraussage möglich machen würden. Als ein der Statistik verpflichteter Mediziner würde ich Ihnen raten abzustellen. Als ein wissenschaftskritisch eingestellter Denkender würde ich sagen, dass wir methodisch nicht in der Lage sind, genau vorauszusagen, ob in diesem Falle eine Gesundung oder ein Status quo eintritt. Als Pflegeperson würde ich (zum Beispiel) den immensen und für den Patienten vermutlich mit wenig Lebensqualität verbundenen Pflegeaufwand als zu grosse Belastung empfinden und überdies viel weniger Zeit für die übrigen Patienten freimachen können. 89 Als bestimmten Werten verpflichteter Mensch würde ich dieses Leben zu erhalten versuchen. Als ein dem geltenden Recht verpflichteter Staatsbürger muss ich Sie darauf hinweisen, dass aktives „Abstellen“ widerrechtlich ist. Als ein ökonomisch und gesundheitspolitisch Denkender würde ich die nach acht Monaten aufgelaufenen Kosten der Pflege im Falle eines unveränderten Komazustandes als Anlass nehmen, abzustellen. Als religiöser Mensch würde ich dieses Leben als heiliges und damit unbedingt zu erhaltendes einstufen. – Wie sehen Sie als Angehörige die Sache?“ Man bemerkt jeweils zweierlei: An (4) die Gefahr, dass einerseits die kategoriale Schärfe dazu beitragen kann, die fallimmanente Problematik zu verdecken und andererseits, dass die Gefahr einer Druck ausübenden heteronomen Kategorialgewalt dazu führen kann, dass dem Aussagesatz vorschnell und unter diskursivem Druck fremdbestimmt zugestimmt wird oder ihm in empörender Ablehnung begegnet wird. An (4)’ die Möglichkeit, dass aufgrund der partizipativen Offerte eine machtsymmetrische Anschlusskommunikation gegeben wird, die genügend Auswahlmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte anbietet, um nicht in den potenziell verfänglichen Mechanismus binärer Oppositionen zu geraten. Andererseits ist die Weise der Bezugnahme explizit zum Ausdruck gebracht zum einen durch die schonende, kategorial entschärfte und wissenschaftstheoretisch angemessene Hypothetisierung („wenn…dann…“), andererseits durch die Als-Struktur, die kennzeichnet, dass es sich um perspektivisch unterschiedliche, aber nicht zwingend konvergente Standpunkte derselben Sache handeln könnte. Die hier angeführte Vielzahl ist weder vollständig noch eindeutig, es lassen sich leicht auch Überschneidungen und weitere Perspektivpunkte formulieren. Im Anwendungsfall gilt es meines Erachtens, die relevanten und mindestens nötigen Standpunkte anzusprechen; im ethischen Diskurs aber sicher in jedem Fall die Perspektiven von Patient, Angehörigen, Pflegepersonal und medizinischem Personal, und dazu gegebenenfalls diejenigen von Führungspersonal, Seelsorgern, Ethikern, Psychologen, Therapeuten, etc. Zweitens. Dem Problem aufgrund kategorialer Schärfe entstehender Machtasymmetrien wird auf eine Art entgegengewirkt, die die je andere Person ernsthaft in den Diskurs einbezieht und durch einen deutlich erhöhten Beschreibungsaufwand eine allenfalls gegebene Problemlage in differenzierter Form verdeutlicht. Damit wird eine Diskussion versachlicht und durch die je angeführten unterschiedlichen Perspektivpunkte in ihren umfassenderen Konturen sichtbarer. Die aus der mehrperspektivischen Distanz eröffnete Sicht leistet sowohl einer entpersonalisierten wie auch einer sachangenäherten Betrachtungsweise Vorschub. Sogar die strukturell bedingten und gegebenen asymmetrischen Machtformen erlangen durch solche Verweise auf die Bezugnahmeweise ein anderes Gesicht und erweitern den Auffassungsmodus um die generativen Aspekte von Macht. Drittens. Durch die oben beschriebenen Prozesse der kategorialen Entschärfung und der entpersonalisierenden Sachannäherung kann die Unsicherheitsumgangskompetenz der Beteiligten erhöht werden. Hier ist zwischen einer Unsicherheit in der Sache und einer 90 Unsicherheit in der Person deutlich zu unterscheiden: Liegt eine Sachlage vor, die schwierig zu entscheiden ist und die Beteiligten überfordert, so kann diese Überforderung auch in der Sache selber begründet sein. Gewisse so genannte hard cases – ethische Dilemmata, für die es viel zu viele nicht auf einen Nenner zu bringende Kriterien für sich ausschliessende Handlungsalternativen gibt – lassen sich auch unter Aufbietung aller bestehenden Begründungsressourcen nicht klärend einer angemessenen und für alle akzeptablen Entscheidung hinführen. Was also tun? Mindestens eines wäre im Sinne einer redlichen Sachangemessenheit ratsam: Die versprachlichte Beschreibung der Problemlage. Damit wird – nur scheinbar paradox – eine Sicherheit in der Unsicherheit gewonnen, die mit den allfälligen Unsicherheiten und Sicherheiten in den habitualisierten Vorstellungshorzionten von Personen vorderhand nicht korrespondiert. Voraussetzung dazu ist eine permanente und reflektierte Verwendung dieser differenzierten Vokabularien, einer Menge an unterschiedlichen Bezugnahmeweisen und den entsprechend vollzogenen Verweisen auf die Art der Bezugnahme in einem personalen Umfeld. In einer solchen Praxis des Sprachgebrauchs bildet sich habituell ein Hintergrund oder Horizont, der ein den in den Sachen liegenden Problemen angemessenes Orientierungsfeld bietet. Viertens. Angesichts der eingangs beschriebenen Machtphänomene, die von der Frage ausgegangen waren: Wer spricht? – sollte nicht naiverweise von einer zu einfachen und dem Phänomen der „Macht“ und seinen potenziell folgenschweren Implikationen nicht gerecht werdenden Sicht der Dinge ausgegangen werden, dass eine sprechende Person jederzeit die souveräne Kontrollmacht über das Gesagte, Erwiderte oder Gerechtfertigte besitze. Vielmehr ist performativen Phänomenen Rechnung zu tragen, die sich im Gespräch ereignen: plötzliche Übergänge, Sprünge, spontane Einsichten, Perspektivenwechsel, druckerzeugende Engführungen, öffnende Erweiterungen, kreativ-generative Metaphernneubildungen, zirkuläre, regressive oder dogmatisierende Momente, Inszenierungs- und Bezugnahmeverweise, Metaund Objektsprachenwechsel, Interaktionsphänomenen, Intonationsarten, Durchbrechungen oder Einnistungen in Redegewohnheitsnotwendigkeiten, Kontextverschiebungsphänomene, Bezugsrahmenwechsel, etc. etc. Helmuth Plessner formulierte hierfür das von ihm so bezeichnete „anthropologische Grundgesetz“ der „Vermittelten Unmittelbarkeit“. Der Mensch ist demgemäss kraft seiner exzentrischen Positionalität – also des Wissens und Bewusstseins darüber, dass er immer nur vermittelt auf Welt Bezug nehmen kann, gleichzeitig aber in der Anwendung dieser Vermittlungsmittel und ihrer Effekte nicht mächtig ist, weil er eben nur vermittelt auf Unmittelbares zugreifen kann – angesichts den nur bedingt vorhersehbaren und sich unmittelbar ereignenden Phänomenen in Gesprächsvollzügen seiner Kontrollgewalt nicht mächtig. Diesem sich ereignenden Entgleiten der Kontrollmacht lässt sich auf verschiedene Arten begegnen: Durch aktive oder passive Gewalt, indem also entweder der Grad an kategorialer Schärfe derart erhöht wird, das von diskursiver Gewalt gesprochen werden muss oder andererseits im Schweigen eine ohnmächtige Kapitulation inszeniert wird, ohne als solche versprachlicht zu werden. Wer die Hoffnung auf ein Gelingen diskursiver Verfahren nicht aufgeben möchte, der hätte dieses Phänomen der offenen Entwicklungsmöglichkeit bei gleichzeitig möglichem und drohenden Kontrollverlust mit zu bedenken und die dafür nötigen minimalen sprachlichen Mittel, von denen oben in der „Ethik der Terminologie“ einige Möglichkeiten angedeutet wurden, heranzuziehen, anzuwenden und wenn möglich auch deren Anwendung zu verbalisieren. Zusammengefasst ergeben sich somit folgende Gründe für eine Ethik der Terminologie: 91 Symmetrisierung sich diskursiv ereignender Machtphänomene Reduzierte kategoriale Schärfe bewirkt Entlastung von (ungewolltem) normativem Verpflichtungsdruck der Rede Explizite Verweise auf Bezugnahmeweisen eröffnen konstitutiv ein Diskursfeld, das durch Entpersonalisierung einer versachlichten Gesprächskultur Vorschub leistet und die Perspektivität des Zugangs verdeutlicht Vermeidung von unzulässigen Fehlschlüssen bei sich und anderen Zurückhaltender Einsatz von Dispositionsprädikaten und Verwendung kategorial „sanfterer“ Termini ist aufwendiger, aber wissenschaftstheoretisch, logisch und machttheoretisch „realistischer“, weil anspruchsärmer Diskurskatalysator für sachbezogene „echte“ Gespräche Eröffnung eines diskursiven Raumes, der für sich im Gesprächsvollzug ereignende Machtphänomene deskriptiv und normativ vorbereitet ist Erhöhung der Unsicherheitsumgangskompetenz Diesen Elementen kommt in einem hier nicht umfassend ausgearbeiteten Ethikansatz, der Überlegungen zu den Machtphänomenen in Gesprächen auf der Ebene der Wortwahl Rechnung trägt, eine besondere Bedeutung zu. Er ist selbstredend zu ergänzen mit bestimmten tugendethischen, deontologischen und utilitaristischen Elementen und Erwägungen, damit ein Umfeld an ethisch reflektierter Sprechkultur geschaffen werden kann, das die Gewinnung und Kompetenzerweiterung der Betroffenen ständig zu erweitern vermag. 5.5.5 Literatur Adorno, Theodor W.: Der Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt a. M. 1964. Aristoteles: Rhetorik. Hrsg. u. übers. von Franz G. Sieveke. München 1995. Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a. M. 1977. Goodman, Nelson: Fact, Fiction, Forecast (1955), deutsch: Tatsache, Fiktion, Voraussage, Frankfurt a. M. 1988 Goodman, Nelson: Sprachen der Kunst. Frankfurt a. M. 1997 Goodman, Nelson: Weisen der Welterzeugung. Frankfurt a. M. 1998. Pfeifer, Volker: Ethisch Argumentieren. Bühl 1997. Plessner, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin, New York 1975. 92 Plessner, Helmuth: Macht und menschliche Natur. Gesammelte Schriften V. Frankfurt a. M. 2003. Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie, Solidarität. Frankfurt a. M. 1999. Röttgers, Kurt: Spuren der Macht. Begriffgeschichte und Systematik. Freiburg i. Brsg., München 1990. Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne der Verstand zu verlieren. München 1997. 5.6 Ethische Kompetenzen Ethische Kompetenzen aufzulisten ist eigentlich müßig: Diejenige Person, die über solche Kompetenzen verfügt, braucht eine solche Liste nicht, und derjenigen Person, die nach Erlangung solcher Kompetenzen trachtet, nützt sie wenig. Hier werden nun – ohne den monströsen Anspruch auf Vollständigkeit – dennoch einige Aspekte aufgezählt, denn es kann sein, dass Sie dereinst vor der Aufgabe stehen, die Gründung eines ethischen Komitees legitimieren oder spezifizieren zu müssen, wobei folgende Liste eine Startrampe zum Selberdenken, eine Inspirations- oder Kritikquelle sein kann. Stichwortartige Mikrokompetenzaspekte - Mindestens drei verschiedene Moralbegründungsmöglichkeiten (ethische Ansätze) kennen im Sinne von: „für sich einmal gründlich durchdacht haben und in Situationen angewandt haben“ - Argumentationen, Fehlschlüsse, Denkfehler (er)kennen - Möglichkeiten und Grenzen ethischer Gesprächsführung kennen - Temporäres echtes „Sich-Einlassenkönnen-auf“ fremde Positionen - Bereitschaft, eigene Vorstellungen zu revidieren oder ggf. über Bord zu werfen - Haushälterisch und vorsichtig mit dem eigenen Vokabular und Mehrwissen umgehen können - Gespräche moderieren können (leiten, strukturieren, paraphrasieren, festhalten, aushalten, etc.) - Keinerlei persönliche oder sonstige hintergründigen Interessen im Diskurs verfolgen - Sach- und problemorientierte Diskussionen führen - Sich festsetzende Leitprinzipien erkennen und auswechseln können - Übergänge machen können (transitive Kompetenz) 93 - Vermittelte Unmittelbarkeit erzeugen: Performativität ist einzigartig, unvorhergesehen, unkontrollierbar Prozedurale Kompetenzaspekte 1. Phänomenologie Wahrnehmung, Entdeckung und Benennung moralischer Werte, Normen, Prinzipien und Argumente in pflegerischen und medizinischen Gesprächen. Welche Werte bringen die Betroffenen in den Diskurs ein? Worauf nehmen sie Rekurs? 2. Erprobung ethischer Begriffe im Diskurs Bringen Sie behutsam ethische Fachtermini, die Sie sich angeeignet haben, in Gespräche ein. Achten Sie auf die Reaktionen der Betroffenen. Vermeiden Sie unbedingte kategorische Behauptungen ("Das ist so, wir haben das so gelernt, das macht man so"), indem Sie Termini wie "alle", "immer", "überhaupt", "die Lösung", "nur", "man muss hier", "das einzig richtige ist" vermeiden und eine etwas hypothetischere Sprache wählen: "Man könnte", "vielleicht", "versuchsweise", "eine Lösung wäre", "es gibt einige Möglichkeiten", „wenn man so argumentiert...“, etc. 3. Klärung von Missverständnissen Angebracht scheint zudem die Klärung der Verwendung und Bedeutung der Termini "moralisch" und "ethisch". Sie hilft allen Beteiligten, jenen scheinbar wertneutralen Diskursraum zu schaffen, in den eigene Interessen (personale Moral, Standeswerte, Machtinteressen) nicht einfließen, sondern alle möglichen Optionen gleichberechtigt in Erwägung gezogen werden mit dem Ziel, das ethisch vertretbarste Resultat zu bestimmen. 4. Reflexion und Intervention Reflektieren Sie die impliziten Voraussetzungen, von denen die Beteiligten ausgehen. Welche Menschen-, Alters- und Lebensbilder liegen jeweils zugrunde? Sprechen Sie die Beteiligten darauf an: "Sie gehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, davon aus, dass Menschen an den Ergebnissen ihrer Handlungen gemessen werden sollen?" 5. Erweitern von Perspektiven Versuchen Sie allmählich, alternative Ansätze vorschlagsweise in Diskurse einzubringen. Achten Sie darauf, dass der Diskurs nicht in die "fundamentalistische Falle" tappt, indem Sie auf Diskursbedingungen und Regeln aufmerksam machen: "Es geht nicht darum ein Modell gegen das andere auszuspielen oder Eigeninteressen zu befriedigen, sondern die situativ beste ethische Lösung für die/den Betroffenen Patienten zu finden." 6. Isosthenie der Handlungsbegründungen Weichen Sie Problemen nicht dadurch aus, dass sie zulassen, dass man sich willkürlich für eine Handlungsmöglichkeit entscheidet, bevor man nicht alle anderen Optionen mit mindestens der 94 gleichen argumentativen und analytischen Sorgfalt reflektiert und so stark gemacht hat, wie die gerade bevorzugte. Diese therapeutische Technik nannten die antiken Skeptiker isostheneia, „Gleichkräftigkeit“. 7. Retrospektion Versuchen Sie, auch bereits geschehene, Ihnen aber ethisch fragwürdig begründete Handlungen diskursiv aufzuarbeiten. Dazu braucht es Engagement und viel Überzeugungsarbeit. Es wird sich hierbei vorzugsweise um Fälle handeln, die verallgemeinerbar scheinen und häufig anstehen. 8. Diskursraum schaffen Versuchen Sie, Zeiten und Räume zu isolieren, in denen ethische Diskurse stattfinden können. Auf dem Wege der Institutionalisierung muss hier meist viel krankenhaus- oder pflegeheiminterne Überzeugungsarbeit geleistet werden. Freie Formen ethischer Reflexion können extern organisiert werden, am besten mit in ethischen Diskursen geübten Fachkräften (ethisch versierte Theologinnen und Philosophinnen). Grundlegende Voraussetzung ist aber die je eigene ethische Gesprächskompetenz, an der fortwährend in angewandter und diskursiver Praxis gearbeitet werden muss. 9. Übung überall Führen Sie "probehalber" ethische Diskurse auch in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis durch. Erproben und erleben Sie, wann ein Gespräch beginnt zirkulär, uferlos oder dogmatisch (fundamentalistisch) zu werden und wie Sie ihre Gesprächspartner dazu bringen können, durch die Beachtung der Diskursbedingungen (Metakognition: "Nun ist unser Gespräch in eine Sackgasse der Zirkularität geraten. Wir sollten deshalb versuchen...") die verfahrene Gesprächssituation zu erkennen und konstruktiv zu lösen. 10. Mut zur Ethik Bleibt zu sagen: Haben Sie Mut, sich ethisch zu engagieren! Stellen Sie sich der Reflexion ethischer Dilemmata und lernen Sie die grundlegenden Schwierigkeiten, Lösungsansätze und Aporien kennen, auszuhalten und konstruktiv umzusetzen! 95 5.7 Umgang mit ethischem Fachwissen Kommt es zur Umsetzung, Anwendung und Applikation von philosophischem und insbesondere ethischem Wissen, so wird bei dieser Tätigkeit schnell die Frage virulent, welches Wissen in welcher Qualität bei dem die praktische Ethik umsetzenden Personen mindestens vorhanden sein muss. Genügt es, sich auf den „gesunden Menschenverstand“ zu verlassen? Oder brauchen die Diskursteilnehmer Leitlinien zum ethischen Diskurs, Entscheidungsfindungsmodelle und dergleichen? Sollten Moderatoren ethischer Diskurse mindestens einen Nachdiplomstudiengang in angewandter Ethik absolviert haben? Oder ist es als Minimum anzusehen, dass ein ganzes Studium der Philosophie (mindestens im Hauptfach oder als Masterstudiengang) vorliegt? Oder sollen Doktor- und Privatdozenten- oder gar professorale Würden erworben worden sein? Braucht es gar keinen akademisches Ethikfachwissen, sondern vielmehr eine reichhaltiges praktisches Erfahrungswissen aus geführten ethischen Diskursen? Allein die Form dieser Fragen verweist das Denken zurück in den Kernbereich ethischer Probleme: Wie erwirbt man ein Wissen vom Umgang mit ethischen Fragen und Problemen? Braucht es dazu ein Wissen vom „Guten“ – oder reicht z.B. eine breite Methodik und Didaktik der Ethik aus, um ethische Diskurse führen zu können? Stellt man sich diesen Fragen, so werden auch die erkenntnistheoretische Grundfrage des Erwerbs von Wissen überhaupt und die epistemologische Frage nach der Auffassung und Legitimierbarkeit von „Wissen“ mitgestellt. Diesen Fragen wird hier nicht ausführlich nachgegangen. Die folgenden Überlegungen aus Sicht einer gemäßigt skeptischen Haltung werden dafür zur Diskussion gestellt. Aus der Sicht einer bescheidenen, gemäßigten Skepsis müsste man das Vorhandensein einer breiten, qualitativ möglichst hochwertigen Fülle von Begriffen, Prinzipien, Argumenten, Methoden, Ansätzen, Theorien und Problemen einfordern. Ihre Kenntnis allein genügt aber nicht, wenn nicht eine wiederum breite Fülle von ethischen Kompetenzen vorhanden ist, die aus häufiger und permanent reflektierender ethischer Diskurspraxis entstanden ist. Auch dies genügt m.E. noch nicht, wenn sich nicht dasjenige dazugesellt, was Aristoteles im Rahmen seiner Theorie der praktischen sittlichen Vernunft eingefordert hat: Ein je situatives Erfassenkönnen der ethische bedenkenswerten Konflikte in einem konkret vorliegenden Fall. Aristoteles verwendet drei Begriffe, um diese Kompetenzaspekte zu erörtern: phronesis, aisthesis und hexis prohairetiké. Einerseits sollte sich die phronesis – eine Art praktischer Vernunft im Bereich des Sittlichen – zunächst durch Gewöhnung, dann aber vermehrt durch Loslösung von der Schiene der Gewöhnung hin zu einem situativen Erfassenkönnen einer Sachlage gebildet haben. Dazu förderlich ist eine Reflexion nicht nur über die semantischen Inhalte, sondern auch und vor allem über die Zugangsweisen, Methoden, Formen, Wendungen, Paradigmen und Argumente, die im ethischen Diskurs vorkommen, sich zeigen, eingebracht, verteidigt oder verworfen werden. Wichtig dabei ist zu beachten, dass die Tugend der phronesis nicht als eine Art berechnende Vernunft mit von vorneherein eingeschlossenen guten Werten missverstanden wird. Aristoteles nennt mit nous (Vernunft, Geist) und sophia (Weisheit) zwei weitere Verstandestugenden, deren Etablierung zusammen mit der phronesis den ethischen Menschen zu einem spoudaios, einem „ethisch Vollkommenen“ veredeln können. Beide Instanzen weisen auf einen Bereich hin, in dem weitere Beobachter und Beurteiler anzutreffen sind, die nicht nur die möglichen Handlungen bewerten und gewichten, sondern auch beurteilen, dass und wie sie dies tun und darüber hinaus auch noch die Frage nach der Berechtigung der Akteurrolle der praktischen Vernunft selbst stellen. Sie können als Letztbeobachter in dem Sinne aufgefasst werden, dass sie nicht nur registrieren und regeln, was sie in anderen Bereichen des Geistes vorfinden, sondern sie sind zugleich Beobachter ihrer selbst. 96 Ähnliche Beschreibungen intramentaler Ordnungen finden sich in Gedanken von philosophischen Textet durch die Jahrhunderte hindurch bei Denkern66, die sich mit erkenntnistheoretischen Fragen auseinandergesetzt haben. Von aisthesis spricht Aristoteles einerseits im Zausammenhang mit der Grundlegung des wissenschaftlichen Wissenserwerbs. In der „Rangfolge“ genannten Auflistung der Schritte und Stufen des Wissenserwerbs in wissenschaftlichem Sinne folgen einander Wahrnehmung (aisthesis), Erinnerung (mneme), Erfahrung (empeiria; wissen, dass), Können (techné) und Beweiswissen (epistemé; wissen, warum). Sie stellen den Weg wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung ausgehend von der Betrachtung vorliegender Einzeldinge dar. Derselbe Begriff der aisthesis taucht jedoch auch in den praktischen Wissenschaften wie der Ethik und der Rhetorik auf. Am aristotelischen Altersbild lässt sich hierbei die in der Ethik nur angedeutete erweiterte Bedeutung von aisthesis ausmachen. Das Altersbild von Aristoteles wird häufig ausschließlich in seiner negativen Variante und damit unvollständig rezipiert67, er spricht jedoch auch von einer ethischen Kompetenz des Alters in einem positiven Sinne: Einige Alte „hätten ein Auge bekommen“ und deshalb sei ihren Aussagen selbst dann zu vertrauen, „wenn sie ohne Beweis vorgetragen werden“. Diese metaphorische Sprechweise eines inneren Auges korrespondiert im Bereich der Ethik mit dem Wahrnehmen (aisthesis), das – ethisch gesprochen – als „situatives Problemsehen“, ein „konkretes Werterfassen und/oder Wertkonflikterfassen“ verstanden werden kann. Nötig sei drittens eine „Grundhaltung zur Wahl (hexis prohairetiké), die den Schritt vom situativen Erfassen bis zum möglichen Entscheiden über die Handlungsoptionen sichern soll. Die Grundhaltung der Wahl ist aus Erfahrung und Eingewöhnung in gutes Handeln innerhalb eines Kontextes erworben worden, dessen Qualität in seiner vielfältige Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit von Vorbildern und Mahnbildern besteht. Neben Vorbildern guter Handlungen guter, tugendhafter Menschen sind auch Mahnbilder des weniger guten bis hin zum sittlich Schlechten (kakia68) gegeben. Es ist wichtig, dieses Moment des Nichteliminierens des Nichtguten als wesentliches Moment für die Erfassung und Konturierung guter Werte im Auge zu behalten. In der Moderne tritt dieses Moment nicht nur in tugendethischen, an Aristoteles orientierten Ansätzen auf, sondern auch in negativ-utilitaristischen (Popper), oder verantwortungsethischen (Jonas). Bereits Nietzsche hat auf den wertgenetischen Effekt der Empörung hingewiesen. Der Zusammenhang dieser Begrifflichkeiten deutet die Komplexität an, in der, mit der und aus der heraus sich angewandte Ethik entwickeln kann. Man wird beim kritischen Überprüfen einer Sachlage auch bald bemerken, dass die übliche terminologische Unterscheidung der kognitiven und pädagogischen Psychologie69 zwischen deklarativem und prozeduralem (operativem) Wissen bei weitem nicht hinreicht, dieser Komplexität zu entsprechen, wenngleich sie im pädagogischen Diskurs ihren praktischen Stellenwert hat. Denn im ethischen philosophierenden Diskurs potenzieren und iterieren sich die Schwierigkeiten, wenn er sich um den der Redlichkeit verpflichteten Fragen der Legitimation und ethische Reflexion um die jeweiligen angewandten Zugangsweisen stellt. 66 Exemplarisch seien erwähnt: Thomas von Aquin: De veritate / dt. Von die Wahrheit. Artikel 9, Hamburg 1986, S. 63-65 ; Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), Berlin, New York 1975, S. 309-341. 67 So beispielsweise bei Leser, Markus: Vorstellungen über das Alter heute und damals, Basel (2001), S. 9: „Dabei sind speziell die Aussagen von Aristoteles in der Rhetorik für das vorliegende Thema von besonderem Interesse. Aristoteles zeichnete darin ein eher düsteres Bild vom Alter.“ 68 Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik VII, 1-11. In der anthropologischen Typologie zählt Aristoteles den theriotes (der animalisch rohe Mensch) und den akolastos (der zügellose Mensch) zu denjenigen Menschen, bei denen mittels Ethik ohnehin nichts Gutes zu erreichen sei. 69 Vgl. Eysenck, M.W./ Keane, M.T.: Cognitive Psychology. Sussex (4) 2000 und Gage N.L. / Berliner D.C.: Educational Psychology. Massachusetts 1992; dt. Pädagogische Psychologie (5) 1996. 97 Ethisches Denken wird durch das bloße Befolgen vorgefertigter Anleitungen nicht kompensiert sondern besteht in einer Art Aktivierungsleistung, zu deren Anregung Modellen und Leitfragen der Untersuchung allenfalls eine auslösende Funktion zukommt. Interessant ist der Umstand, dass viele Anleitungen zur Strukturierung ethischer Diskurse entweder sofort in medias res gehen mit fragwürdig positivistischen Fragen der Art „Welches ist der Patientenwille?“ oder aber die Frage nach „dem Problem“ stellen, ohne weiter zu bestimmen, was es bedeutet, ein Problem zu erfassen und zu formulieren. Dabei scheint gerade dieser grundlegende Punkt, die Frage nach der Erfassung der Problemlage von wichtigerer Bedeutung zu sein, als viele sich anschließende analytische Verfahrensfragen zur Entscheidungsvorbereitung. Was aber ist das, ein „Problem“? Eine erste hilfreiche Unterscheidung macht eine Trennung zwischen lösbaren, jetzt gerade (noch) nicht gelösten Problemen und offenen, bislang ungelösten Problemen. Beispiel für ein lösbares Problem stellt etwa die Frage dar, mit welcher Reanimationsmethode (chemisch, mechanisch, elektrisch) zur Anwendung kommen soll, wenn vorgängig entschieden wurde, dass reanimiert werden soll. Ein Beispiel für ein offenes Problem ergibt sich aus der Fragestellung, ob es einem Menschen zugemutet werden darf, ihn zu reanimieren oder nicht zu reanimieren. Welches oder welche Klasse von Kriterien können und sollen zur Legitimation der einen wie der anderen Variante sinnvollerweise unter Berücksichtigung eines allgemeinen oder aber individualisierten Menschenbildes herangezogen werden? Bereits ein kurzes Nachdenken führt die sich diese Frage stellende Person in komplexe Problemfelder offener, bislang auch nach hunderten von Jahren Denkgeschichte ungelöster – aber ggf. deshalb nicht zwingend unlösbarer Fragen. Darauf gibt es zwei fehlerhafte Reaktionen, die oft anzutreffen sind, wenn diese Problemfelder aufgespannt werden: Der pragmatische Kurzschluss: Offene Probleme lassen sich ohnehin nicht lösen, also lassen wir die Finger davon und Handeln wie bisher. Der theoretische Kurzschluss: Offene Probleme sind wichtiger als das praktische Handeln, deshalb können diese Probleme nicht lange und tief genug einbezogen werden. Beide Kurzschlüsse scheinen auf ihre Art zu kurz zu greifen. Doch die adäquate Antwort auf die Schwierigkeiten liegt nicht bloß in einer kombinatorischen Mitteposition, sondern geht vermutlich auch darüber noch hinaus in denjenigen Bereich, der sich phänomenologisch zeigt, wenn Pragmatismus und Theorievorurteil für einen Moment ausgeblendet werden. Wir wissen im Grunde nicht, was das ist, Ein „Problem“ – aller bisherigen Bestimmungsversuche zum Trotz. Die gefragte Problemumgangskompetenz wird somit auf Aspekte erweitert, die hier nicht genannt werden, weil sie einer Bestimmung noch harren. Der Einbezug solcher Graubereiche des Noch-nicht-Bestimmten ist deshalb von Wichtigkeit, weil die Wahrnehmung einer Situation (aisthesis) sonst Gefahr läuft, im Erfassen des bereits Gewussten zu verharren ohne dieses vermittels eines Blicks auf das Phänomen ausreichend aufgeweicht und in Korrespondenz gesetzt zu haben. Wie auch immer ein ethischer Diskurs gestaltet wird oder verläuft, enthält er ein dreifaches Anfangswertproblem: 1. Gibt es von vorneherein eine feste Argumentationsbasis, von der her argumentativ operiert wird?, oder 2. gibt es diese zunächst nicht, und man findet sie oder erzeugt sie aus dem Diskurs heraus?, oder 98 3. gibt es eine Fülle möglicher Argumentationsbasen und Ebenen, die hierarchisiert, toleriert, gewonnen oder verworfen werden müssen? 5.8 Thematische Begriffsvertiefungen Fallanalysen müssen methodisch nicht notwendig den analytischen Struktur eines Entscheidungsvorbereitungsmodells unterworfen werden. Es ist ebenso gut möglich, die Problemlage eines vorliegenden Falles zu erfassen, um dann einen sich daraus abzeichnenden relevanten Begriff herauszugreifen und gezielt zu vertiefen. Voraussetzungen dazu sind breite und differenzierte Kenntnisse von ausgewählten und im Gesundheitswesen häufig diskutierten Schlüsselbegriffen und den damit verbundenen Grundproblemen der angewandten Ethik. Mögliche Kandidaten für Schlüsselbegriffe, die die angewandte Ethik im Gesundheitswesen betreffen, sind beispielsweise Verantwortung, Würde, Autonomie, Person, Mensch, Leben, das Leib-Seele-Problem, Gerechtigkeit, Fürsorge, Wahrheit, Forschung und Wissenschaft, Technik, Sterben und Tod, Interkulturalität, Altersbilder, Betroffenheit, Ökonomisierung oder der Patientenwille. Thematische Begriffsvertiefungen ermöglichen es der moderierenden Person, im jeweiligen Fall relevante Begriffe und Probleme zu erkennen, deren Adäquatheit abzuschätzen und deren Relevanz für eine bestimmte Sachlage zu ermitteln. Das Hintergrundwissen über einen bestimmten Terminus oder ein mögliches Problem wird dann in den Diskurs so eingebracht, dass die Angemessenheit und der thematische Zusammenhang die Relevanz dieses Wissenstransfers zu unterstreichen vermögen. Ein typischer Fehler dieses hermeneutischen Verfahrens ist die begriffliche Armut des Analysanden oder dessen daraus resultierender partieller Blindheit für das Erfassen einer Sachlage. Pointiert gesagt wäre ein bestimmter Schlüsselbegriff für einen Fall deshalb relevant, weil es der einzige ist, über den der Analysand tiefere und differenziertere Kenntnisse aufweist und er deshalb dazu neigt, in allem gerade diesen und nur diesen Begriff wieder zu erkennen. Martens hat in diesem zirkulären Zusammenhang vom morbus hermeneuticus gesprochen: Weil in einem konkreten Fall ein bestimmtes Problem vorliegt, kennt es der Analysand und umgekehrt liegt dieses Problem dem Fall zugrunde, weil der Analysand es kennt. Damit stellt sich ein Basisproblem hermeneutischdeutender Vorgehensweisen: Wie viel kann, darf, soll, muss in einen Fall hineininterpretiert werden? Darf es mehr sein, als effektiv vorliegt? Sollen die Patienten und Beteiligten gar didaktisch angeleitet werden? Oder soll nur soviel eingebracht werden, wie gerade als Bedürfnis der Fragenden eingefordert wird? Diese Fragen zielen ab auf eine Bestimmung eines Grenzkriteriums. Als mögliche Kandidaten für ein solches Grenzkriterium wären viele verschiedene denkbar: Regeln, Erfahrungen, Situationen, Kontextparameter oder Diskursphänomene. Ich greife hier exemplarisch einige Diskursphänomene heraus, die mir an Vollzügen ethischer Diskurse im Verhalten der Teilnehmenden immer wieder aufgefallen sind und formuliere Anschlussfragen zum Weiterdenken: 1. Es gibt seitens der Teilnehmenden eine Art Bereitwilligkeit zur Vertiefung. Einige sind sehr interessiert daran, sich in die Verästelungen spezifischer Argumentation zu wagen, andere wenden sich früher ab und versuchen mit wechselnden perspektivischen Sprüngen die unterstellte Verzettelungsgefahr zu einseitiger Argumentation zu bannen. Wie damit umgehen? Vertiefen um jeden Preis? Erweitern der perspektivischen Fülle? Beides? Andere Wege? 2. Es gibt ein bestimmtes Maß des Sich-Einlassen-Könnens auf ein bestimmtes Problemfeld ethischer Fragestellungen der Teilnehmenden. Unabhängig vom Sich-Einlassen-Wollen zeigt 99 sich beim Vollzug eine Art Kompetenz, die ich dendritische Kompetenz nenne. Dendron ist der griechische Baum, dendritisch betont und symbolisiert den Baum und die verzweigten Verästelungen in einer Argumentation, die schnell entstehen, wenn Begrifflichkeiten unterschieden und verfeinert werden. Wer sich auf die feinen und feinsten Äste einer Argumentation hinausbewegen und dort vorübergehend aufhalten, die dortigen Erkenntnisse und Aporien aber auch wieder in den Zusammenhang konkreter Fakten zurücktransformieren kann, der besitzt dendritische Kompetenz. Welches aber sind die Grenzkriterien? Sind Verästelungsängste und Vorbehalte zu respektieren oder mit sanfter, ethisch nicht unproblematischer Gewalt zu bekämpfen? Welcher Verästelungsgrad ist der Pragmatik der Handlungsoptionsabwägung förderlich? 3. Es gibt gewisse Parameter der Betroffenheit. In vielen Verfahrensanleitungen zu ethischen Diskursen ist davon nie die Rede, aber Betroffenheiten färben die Werthaltungen die Wahrnehmungen und die übrigen hier angesprochenen Kompetenzen nicht unbeträchtlich. Die Haltungen Betroffener gewinnen dabei meist eine gewisse Ernsthaftigkeit oder es mangelt ihnen umgekehrt an einer weniger ausgeprägten Bereitwilligkeit, spielerisch mögliche Positionen durchzudenken und nachzuempfinden. Wie mit Betroffenheiten umgehen? Sollen die Sperrzonen geäußerter oder zum Ausdruck kommender Widerstände vollumfänglich, teilweise oder gar nicht respektiert werden? Welcher Stellenwert kommt der Betroffenheit in ethischen Diskursen zu? Wie fasst man Betroffenheit auf? Ein besonderes Problem stellen – gerade im Gesundheitswesen – Erstbetroffenheiten von Patienten und Angehörigen dar, die auf die Gewohnheiten und Abgebrühtheiten der Berufsleute treffen. Aber auch im innerberufsspezifischen Feld treffen solche Erst- oder gar Einmaligkeitsbetroffenheiten mit standardisierten Betroffenheiten in Kollision. Wie wird sinnvollerweise damit umgegangen? Genügt es allenfalls bereits, diese Effekte zur Sprache zu bringen – oder bedarf es gar restriktiver Normen dazu? 4. Es gibt einen Modus der Verführbarkeit. Es mag sonderbar erscheinen, den Begriff der Verführbarkeit in ethischen Kontexten anzusprechen, aber er hat, wie ich meine, hier einen berechtigten Platz. Verführung meint ursprünglich ein „Beiseiteführen“ (lat. seducere, seductio). Beiseite geführt werden im Zustand der Verführbarkeit die möglichen Handlungsoptionen als Optionen. Damit eröffnet sich, solange noch nicht entschieden wurde, in welche Richtung das Handeln sich bewegen soll, ein Freiraum der Entscheidung, der mit Gefühlen der Selbstmächtigkeit oder der Willensfreiheit in engem Zusammenhang steht. Der Schwebezustand der Verführbarkeit, das Aushaltenkönnen des Noch-nicht-entschiedenHabens macht den eigentlichen Kern des Verführungsmodells aus. „Verführung“ wird hier also nicht so verstanden, wie es mittelalterliche Tugendlehren aufgefasst haben und die Nachgiebigkeit (seductio) zu den Untugenden auf den Index des zu Vermeidenden gezählt haben. Im Gegenteil scheint der Zustand der Verführbarkeit als ein Sich-Aufhalten-Können im Grenzbereich des Erwägens ein zentrales Element des Entscheidens im Allgemeinen und des Abwägens ethischer Begründungen und moralischer Bewertungen im Besonderen zu sein. Der homo seducens ist weder Sirene noch Casanova, sondern Schwebezustandsmanager. Wie gelangt man in solche Zustände der Verführbarkeit? Wie werden sie reguliert? Wann ist Überschreiten und wann Bewahren der Grenzen angesagt? Wie lange soll man sich in solchen Zuständen sinnvollerweise aufhalten? Haben solche Zustände tatsächlich mit Freiheit zu tun, oder sind sie Ausdruck einer Pragmatismusverweigerung oder gar einer Unfähigkeit, sich entscheiden zu können? 5. Es gibt ein Maß an Offenheit, Erwägungsbereitwilligkeit. Eng gekoppelt an die Zustände der Verführbarkeit liegen Offenheit und eine Bereitwilligkeit des Erwägens vor. Die 100 „Offenheit“ lässt sich in skeptischer Tradition analytisch im Mittelbereich des Unentschiedenen zwischen Affirmation und Negation verorten. Wer nicht nein sagt, der sagt nicht zwingend ja, sondern kann auch die Frage im Modus des Sich-noch-nicht-Entschieden-Habens bewerten. Diese Strukturmomente wurden vor allem in Ansätzen dreiwertiger Logik zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederaufgegriffen und zu Kalkülen entwickelt (Reichenbach, Lukasiewicz, Bochvar70), um quantenlogische Phänomene besser erklären zu können. Oft zeigt sich in ethischen Diskursen, dass die Modi des Bejahens und Verneinens bei den Teilnehmenden stark bewertet sind, der Modus des Unentschiedenen, noch offenen aber nur in abgewerteter Weise vorhanden oder gar nicht explizit entwickelt ist. Welcher Stellenwert kommt diesem Status des Unentschiedenen aber berechtigterweise zu? Ist er – aus nutzenorientierter Sicht – ein Entscheidungshindernis? Ist er aus tugendethischer Sicht eine Art Inkompetenz der Sich-nichtentschliessen-Könnenden? Oder kommt ihm ein viel bedeutsamerer Status zu, der einer erkenntnistheoretischen Erkenntnis Ausdruck verleiht, dass wir – Wissenschaft und Religion in Ehren – immer noch nicht genau wissen, was wir tun, wenn wir auf Welt sprachlich Bezug nehmen? Wäre dieser Status des Unentschiedenen damit nicht vielleicht doch der redlichste und ehrlichste, aber derzeit in erschreckendem Ausmaße nicht standardisierte und nicht sozialisierte Status? 6. Es gibt ein Maß an Ordnung bzw. Unordnung, eine transitorische Bereitwilligkeit. Es ist sonderbar, aber je nachdem wie ethische Diskurse geführt werden, melden sich die kritischen Rückmeldungsstimmen meist in ausgleichender Weise. Ist ein ethischer Diskurs stark strukturiert, etwa unter Verwendung von deontologischen Analyserastern oder utilitaristischen Matrizen, dann werden Stimmen der Empörung laut, die sich nach Fülle und Erweiterung sehnen. Umgekehrt werden in einem ethischen Diskurs, der eher assoziativ und sprunghaft verläuft, Stimmen laut, die sich für Struktur und eine lineare Tendenz im Diskursverhalten stark machen. Was ist hierbei das Maß an Ordnung oder Unordnung, das einen ethischen Diskurs prägen soll? Was ist das Qualitätsmerkmal ethischer Diskurse? Lässt sich diese Frage ohne Rekurs auf ein angeblich Gutes überhaupt beurteilen? Oder soll dazu auf die Bestimmung eines Guten gerade verzichtet werden? Wie auch immer diesen Fragen nachgegangen wird, kann es für die Moderation ethischer Diskurse wichtig sein, den Grad an transitorischer Bereitwilligkeit der Teilnehmenden und der moderierenden Person selber zu messen und zu erproben, indem verschiedene methodische Zugänge erprobt werden. Vgl. dazu das Kapitel „Mehrwertige Systeme der propositionalen Logik“ in: Copi, Irving M.: Einführung in die Logik. München 1998, S. 233-250. 70 101 6. Ethischer Diskurs: Organisationsformen 6.1 Ethische Kommissionen und Komitees, ethische Konzilien Mittlerweile hat die Vielfalt an Organisationsformen angewandter und praktizierender Ethik im Allgemeinen und in Institutionen des Gesundheitswesens im Besonderen eine beinahe unüberschaubare Zahl erreicht. Gemeinsam sind den Konstitutionen ethischer Foren bestimmte Parameter wie Zusammensetzung, Status, Moderation, Interdisziplinarität, Methoden, Form, Ort Häufigkeit und Dauer. Die Bildung einer so benannten Ethik-Kommission geht auf einen Fall aus New Jersey71 (1976) zurück, bei dem die Frage nach dem Abschalten oder Beibehalten der künstlichen Beatmung einer Komapatientin aufgeworfen wurde und der Gerichtshof die Klagenden an eine neu gebildete Ethik-Kommission verwiesen hatte. Die gesellschaftliche Tendenz der letzten Jahre brachte einen Schub an internen EthikKommissionen in privaten und öffentlichen Institutionen, die – was nicht unbedenklich erscheint – aller stets gegen Außen versichernden Offenheit für Diskussionen einen nicht wegzudiskutierenden autoprotektionistischen Einschlag aufweisen. Das hat schon vor einiger Zeit die Frage aufgeworfen, wer denn die vielen Ethik-Kommissionen landauf landab überwache. In der Schweiz steht derzeit die Frage im Raum, ob die dort tätigen Organisationen, die Beihilfe zum Suizid anbieten und Zürich damit innert weniger Jahre zur Sterbestadt Nummer eins in Europa gemacht haben, eine staatliche Überwachung und Qualitätssicherung der Beurteilungsstrukturen über die Zurechnungs- und Urteilsfähigkeitsbestimmung der Sterbewilligen in diesen Organisationen errichtet werden soll. Externe Ethikberatungen oder gar die Einsitznahme institutionsfremder oder freischaffender Ethiker und Ethikerinnen wird von Führungspersonen oft als Bedrohung eingestuft und mit Befürchtungen um Macht- und Kontrollverlust abgewiesen oder aber mit dem fragwürdigen Argument abgelehnt, dass der Betrieb bislang ja auch ohne Ethik funktioniert habe. Hierbei liegt oft eine falsche Auffassung von Ethik zugrunde. Ethik wird nicht als philosophierende Ethik aufgefasst, sondern als Ethos – als moralischer Bezugsrahmen, der bestimmte Werte und moralische Prinzipien in Form von Sätzen zweiter Ordnung bereitstellt und allgemeine Geltung einfordert. Ein anstehendes ethisches Problem wird dabei ausschließlich auf ein bestimmtes Ethos zurückgeführt und so eine aktive, kritische und differenzierte philosophische Auseinandersetzung nachgerade verhindert. Leider wird die Auffassung von Ethik als Ethos im Sinne eines nicht wertneutralen ethischen Handelns durch verschiedene private Ethikberatungsfirmen72, unnötigerweise Vorschub geleistet. Man holt sich denjenigen Ethiker in die eigene Ethikkommission, der bereit ist, sich mit dem Firmenethos zu identifizieren. Damit gerinnt die dynamische Qualität philosophierender Ethik zu einem einseitigen Ethos und hört auf, Ethik zu sein. Philosophierende Ethik und in besonderem Masse die moderierenden Personen sollten demgegenüber ihre privaten oder politischen Überzeugungen nicht undeklariert oder gar unbemerkt in einen ethischen Diskurs einfließen lassen. Das im Auge zu behaltende Prädikat „wertneutral“ stellt selber einen Wert dar, dessen Eigentümlichkeit aber gerade darin besteht, eine bestimmte Aussage weder zu bejahen, noch zu verneinen, sondern einstweilen im Status 71 Tönnies, M.: Die Grenzen unzumutbarer Behandlung, S. 179, zit. nach Plenter, Christel: Ethische Aspekte in der Pflege von Wachkoma-Patienten. Hannover 2001, S. 129. 72 Typische Vertreter sind Ethikerinnen und Ethiker, die hintergründig oder offen z.B. eine liberale, juridische oder theologisch-konservative Haltung vertreten. Je nach Interesse eines Auftraggebers werden ethisch bedenkliche Fragen auf eine einseitige Auslegung entweder in Richtung Zulassung oder in Richtung Verbot hin verkürzt und fließen dann in ethische Leitlinien und PR-Aktivitäten ein. Wer Ethik als Ethos auffasst, instrumentalisiert Einzelfälle zur internen oder öffentlichen Stützung ideeller Werte und entzieht sich in unredlicher Weise einem ganzen Bereich ausgegrenzter und je nach Standpunkt berechtigter Gegenargumente. 102 der Unentschiedenheit und Offenheit zu belassen. Nur so können auch die kritischsten Gegenstimmen im ethischen Diskurs ein ernstes Gehör erhalten. Ein weiteres Problem, das mit diesen Bemühungen um eine Ethisierung verschiedener Lebensbereiche verknüpft ist, stellt die mangelnde unmittelbare Erweiterung ethischer Kompetenzen der betroffenen Berufsleute in Pflege und Medizin dar. Zwar werden brisante Fälle, bei denen rechtliche Fragen aufgeworfen werden oder gar der Ruf einer Institution auf dem Spiel steht, zu Untersuchungsgegenständen eigens dafür einberufener ethischer Kommissionen. Die unzähligen ethischen Probleme subtiler bis dramatischer Art in den vielen Begegnungs- und Interaktionsmomenten zwischen Ärzten, Pflegenden, Patienten und Angehörigen aber werden vor Ort nicht angepackt. Was fehlt und Not tut, sind Zeit und Raum für moderierte Gesprächsplattformen, wo problematische Themen zur Sprache gebracht werden können und – je nach untersuchtem Fallbeispiel – die lösbaren Problemanteile in Handlungsoptionen überführt, die bislang ungelösten Grundprobleme philosophischer Art aber davon geschieden werden. Diese lösen zu wollen, führt an die Grenzen der Überforderung von Laien wie Experten gleichermassen. Wo man sich allerdings trifft, ist das gemeinsam entwickelte Problemverständnis, das zu einem bewussten und differenzierteren Umgang im täglichen medizinischen und pflegerischen Handeln auf der kommunikativen, emotionalen und performativen Ebene führen und in der gewöhnlichen Sprache des Alltags formuliert werden kann. Damit ist eine erste Entlastungsfunktion solcher moderierter ethischer Gespräche angedeutet. Ethische Leitbilder, die in der Regel nur denjenigen von Nutzen sind, die daran mitgearbeitet haben, verschwinden nach deren Errichten oftmals in den Schubladen mittlerer Kader und harren einer Diskussion und Umsetzung vor Ort. Es reicht für eine Ethisierung des eigenen beruflichen Handelns nicht aus, dass sich Institutionen des Gesundheitswesens nach Aussen hin mit dem Vorhandensein einer Ethik-Kommission (die erstens nur aus den leitenden Personen bestehen und zweitens nur in extremen Fällen zusammensitzen) oder dem Errichtenlassen ethischer Leitlinien und Standards begnügen. Für die Erweiterung der ethischen Kompetenzen genügt es auch noch nicht, bestimmte Mitarbeiter in den Genuss teurer externer ethischer Weiterbildungen abzudelegieren, wenn vor Ort nicht aktiv und pädagogisch wie ethisch kompetent dafür gesorgt wird, dass die Mitarbeiter eines Teams regelmässig Gelegenheit erhalten, ihre ethischen Bedenken und Fragen reflektieren und zur Sprache bringen können. Sollen die ethischen Kompetenzen erweitert werden, so bedeutet dies, dass vermehrt ethische Gesprächsplattformen etwa in Form von Ethik-Cafés gebildet werden sollten. Das Ethische Café - ein erfolgreiches Beispiel aus der Praxis A.Z. aus H., ein erfahrener langjähriger Intensivpfleger auf der medizinischen Intensivstation in einem mittelgrossen Krankenhaus und überdies nicht nur als Fernstudierender der Philosophie an ethischen Fragen besonders interessiert griff die Idee des Ethik-Cafés anlässlich eines Medizinethikseminars auf und strebte deren Etablierung und Umsetzung in seiner Abteilung erfolgreich an. In den Ethik-Cafés auf seiner Intensivstation werden regelmässig Fallbeispiele mit ganz unterschiedlichen Zugangsweisen diskutiert und auf ihre ethischen Probleme hin befragt. An diesen ethischen Cafés nehmen neben Stationsärzten und Pflegenden je nach Thema auch zugezogene Personen teil, sei es etwa beim Thema „Hirntod“ beteiligte Oberärzte, ein Transplantationskoordinator oder ein interner Seelsorger. Moderiert werden die Cafés von A. Z. und in der Initialphase auch zusätzlich von einem beigezogenen Ethiker, der Hinweise auf in den Sachen liegende besondere Schwierigkeiten gibt, erweiternde Methoden einfliessen lässt und didaktische Kritik übt. Die Reaktionen und Rückmeldungen der Teilnehmenden an diesen Ethik-Cafés sind nicht nur aus diesem Anwendungsfall überwiegend positiv – die Beteiligten fühlen sich in ihrem Denken ernst genommen, gewinnen Vertrauen ins eigene Denken, muten sich zu, auch über die internen Verantwortlichkeitsgrenzen hinaus die alle betreffenden philosophischen Grundprobleme zu überdenken und entwickeln eigene, zum Teil sehr kreative Handlungsoptionen, um regelmässig wiederkehrenden ethisch bedenklichen Fällen aus dem Klinikalltag kompetenter und gelassener zu begegnen. Dabei wird durch die Variation der möglichen Untersuchungszugänge eine einseitige Auslegungsgewohnheit – etwa durch die nicht reflektierte Befolgung ausgesuchter einzelner ethische Entscheidungsfindungsmodelle – entgegengewirkt. Viele ethisch-philosophische Probleme weisen eine doppelte Anforderung auf, indem sowohl die Quelle wie auch die Zugangsweise einzelner Werte oder Behauptungen gerechtfertigt oder erwiesen werden 103 müssen und eine monomethodische Ausrichtung diesem Anspruch nicht Rechnung trägt. Die zeigt sich in besonderem Masse wenn sich Fragen nach Verantwortung, Würde, Autonomie oder Gerechtigkeit stellen. 6.2 Das Ethische Café Die Geschichte der Entstehung von ethischen Cafés ist verbunden mit der Entstehung und Wiederbelebung der Philosophischen Praxis bzw. der Philosophischen Beratung seit Beginn der 1980er Jahre. Namen wie Seymon Hersh, Gerd B. Achenbach, Steffen Graefe, Günther Witzany, Gert Maier standen am Anfang und führten zu ersten Reaktionen in der Öffentlichkeit und in der akademischen Philosophie73. In Gladbach war es Gerd B. Achenbach74, der 1981 die philosophische Praxis ins Leben rief, 1992 veranstaltete in Paris der inzwischen verstorbene Marc Sautet75 erste Philosophische Cafés. Mittlerweile gibt es in vielen Städten Europas regelmässig stattfindende philosophische Cafés76, es gibt philosophische Arbeitskreise, philosophische Leserunden77 und philosophische Beratung78 in vielen Formen. Mit dem Fokus auf ethische Fragen entstand daraus die Form des Ethik-Cafés, das in unterschiedlichen Formen, verschiedenem Geltungsstatus in zahlreiche Institutionen des Gesundheitswesens Eingang gefunden hat. Auch hinsichtlich der philosophierenden Alterssegmente haben sich Entwicklungen ergeben: So wurde im gleichen Zeitraum das Philosophieren mit Kindern entwickelt und vielerorts ansatzweise institutionalisiert. Im Entstehen begriffen sind vermehrt auch Philosophische Cafés und Ethik-Cafés für Senioren, die altersrelevante Fragen zur Lebensgestaltung und Wertveränderung als Schwerpunkte haben. Das philosophische Café Ein Philosophisches Café ist ein moderierter öffentlicher Raum, an dem Interessierte nicht nur sie beschäftigende Fragen stellen können, sondern sich diesen Fragen im gemeinsamen Gespräch stellen können. Im Plenum werden zu bestimmten Fragen Antwortmöglichkeiten zur Sprache gebracht, gesammelt und auf ihre Geltung hin untersucht. In philosophischen Cafés ist ein Ausgang von der Alltagssprache unumgänglich. Gefragt ist eine "Methodik von unten": Ausgehend von den ernstzunehmenden Meinungen wird philosophiert. Philosophie ist so "reflektierte Alltagsreflexion" und wird zum Katalysator des Selberdenkens. Die Teilnehmer lernen, ihre subjektive, reflektierte Interpretation einzubringen und nachvollziehbar zu begründen. Diese Methode hat Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik (VII 1, 1145b2-7) in drei Schritten beschrieben: 73 Vgl. Ruschmann, Eckart: Philosophische Beratung. Stuttgart 1999, S. 86. Vgl. hierzu: Röttgers, Kurt: Praktische Philosophie. Dokumentarfilm von Jürgen Bethke et al., Zentrum für Fernstudienentwicklung der Fernuniversität Hagen 1996. 75 Sautet, Marc: Un café pour Socrate, Paris 1995; dt. Ein Café für Sokrates. Philosophie für jedermann. Düsseldorf und Zürich 1999. 76 Der Autor dieser Zeilen betreibt und moderiert – kostenlos – seit einigen Jahren selber mehrere gut besuchte öffentliche Philosophische Cafés. Vgl. hierzu die Berichte von Hafner, Urs (2003): Sokrates in der City. Café philosophique: Wir alle können Philosophieren, behauptet ein Philosoph. Wirklich? Ein Erfahrungsbericht. Wochenzeitung Nr. 47 vom 20.11.2003, s. 31, Zürich; und Kalberer, Guido (2004): Gehobenes Tischgespräch. Im Restaurant Bubbles findet jeden Monat ein philosophisches Café statt. In: Tages Anzeiger vom 04.02.2004, S. 54, Zürich. 77 Vgl. z.B. Bremer, Daniel: Philosophische Gespräche für Alzheimerpatienten und Angehörige. Ein Pilotprojekt. In: Printernet. Wissenschaftliche Fachzeitschrift für die Pflege Nr. 9 / 2004, S. 473-482. 78 Vgl. Ruschmann, Eckart: Philosophische Beratung. Stuttgart 1999; Burckhart, Holger und Sikora, Jürgen (Hrsg.): Praktische Philosophie – Philosophische Praxis. Darmstadt 2005. 74 104 "(1) Man muss die Phänomene sichern (tithenai ta phainomena), (2) die Schwierigkeiten durcharbeiten (diaporêsai) und (3) die glaubhaften Ansichten (endoxa) zumindest die meisten und wichtigsten, beweisen (deiknynai)." [Übers. v. Höffe, O.: Aristoteles, München (2) 1996, S. 96] "Man muss nun, wie in den anderen Fällen, zuerst die Phänomene sichern (tithenai ta phainomena), die Schwierigkeiten durchgehen (diaporesai), und dann alles nachweisen was (hinsichtlich jener Affekte) glaubhafte Meinungen sind (endoxa), oder doch das meiste und wichtigste." [Übers. v. E. Martens] Mit „Phänomene sichern“ ist gemeint, dass man zunächst die bei allen Gesprächsteilnehmern vorhandenen Vorstellungen über einen Gegenstand zur Sprache bringt und sammelt. Danach arbeitet man sich durch Befragung dieser Vorstellungen bis zum glaubhaften Kernaspekt einer Sache oder eines Problems vor und versucht diesen drittens zu präzisieren, zu legitimieren oder in seiner Schwierigkeit darzustellen. Allerdings bedarf dieser Zugang einiger methodischer Erweiterungen, die im Anwendungsfall bedeutsam werden können. Der Vielfalt an möglichen Themen sind keine Grenze gesetzt. Ursprünglich stand bei den Pariser Philocafés von Sautet die Idee demokratischer Themenwahl durch Abstimmung der Teilnehmer im Zentrum. Er führte diese Cafés an Sonntagnachmittagen durch, so dass viel Zeit war für Prozeduren der Themenwahl. Versuche in dieser Richtung für am Abend durchgeführte Philocafés haben allerdings gezeigt, dass eine Quartals- oder Semesterweise Vorherbestimmung der Themen (die durchaus von regelmässig teilnehmenden Besuchern bestimmt wird) angebrachter ist. So stellen sich die interessierten Teilnehmenden auf das Thema ein und man legt gleich los – ohne dass langwierige Abstimmungsverfahren nötig werden. Diese themenfokussierte Variante ist auch für die Ethik-Cafés von Bedeutung, wenngleich im Vollzug durchaus Kurswechsel oder Methodenvariationen möglich sein sollten. Zu Beginn kann die moderierende Person einleitend einige Aspekte oder Thesen zum Thema erläutern. Als Variante können auch einige provokative oder divergierende Thesen zum Thema in schriftlicher Form visualisiert oder auf einem kleinen Handzettel ausgehändigt werden, so dass Zugangsmöglichkeiten eröffnet werden. Ein Philocafé am Abend dauert in der Regel zweieinhalb bis drei Stunden. In einigen Cafés wird, wenn der Gesprächsfunke entzündet ist, leidenschaftlich gegen drei und mehr Stunden bis an den Rand der Erschöpfung diskutiert. Günstiger und rücksichtsvoller scheint die Variante, nach etwa einer Stunde eine kurze Pause zu machen. Sie bringt zwar einen kleinen Bruch in die Diskussion, ermöglicht den Teilnehmern allerdings eine Rückbesinnung, die Konsumation von Getränken und eine kurze Erholung. Gleichzeitig können Indisponierte oder Unzufriedene das Gespräch gegebenenfalls verlassen oder interessierte Zaungäste dazu stossen. Einige Philocafés versuchen, durch Einladung bekannter und philosophisch kompetenter Persönlichkeiten ihr Café zur Attraktion zu machen. Einerseits kann eine Veranstaltung dadurch inhaltlich an Gehalt gewinnen, andererseits ändert sich der Charakter des Philocafés grundlegend: Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer wird fokussiert auf die Voten der eingeladenen Persönlichkeit, ebenso die Gesprächsbeiträge. Die künstlich herbeigerufene Kompetenz-Asymmetrie bewirkt, dass sich die Teilnehmer weniger über eine Sache untereinander austauschen und ihre philosophische Kompetenz selber aktiv erweitern sondern viel eher geneigt sind, die präsentierten und vorbewerteten Gesprächsbeiträge passiv zu geniessen. Das Café erhält in dieser Form eher das aufgrund der Inszenierungsbedingungen doch befremdende Gepräge einer Vorlesung oder Beratung mit Fragenbeantwortung, was der Grundintention aktiv philosophierender Teilnehmer grundlegend zuwiderläuft. Eine weitere Variante ist die Fischteichgesprächsstruktur: In einem öffentlichen Café findet in einem von allen einsehbaren Bereich ein Philocafé statt. Zaungäste haben die Gelegenheit, mit einem Ohr zuzuhören und gegebenenfalls mitzumachen, können aber bei Berührungsängsten 105 andererseits auch aus Distanz kritisch beobachten, was vor sich geht. Diese Form verhindert, dass sich mit der Zeit feste Zirkel bilden. Das Ethik-Café Parallel zum philosophischen entwickelte sich die Struktur des ethischen Cafés. Ein Ethik-Café ein institutionsinterner öffentlicher Raum oder eine moderierte Gesprächsplattform, wo Fragen, Themen und Probleme von ethischer Brisanz aus dem Berufsalltag zur Sprache gebracht, analysiert und diskutiert werden. Unter Einbezug ethischen Fachwissens und verschiedenen Verfahrensweisen werden Probleme und Dilemmata untersucht, verschiedene Handlungsmöglichkeiten entwickelt, relevante Werte ermittelt und zugeordnet und durch Abwägungen und Gewichtungen Entscheidungen vorbereitet. Unterscheide zum Philosophischen Café sind die thematische Zentrierung auf Themen, die bei Einzelfällen oder wiederkehrenden exemplarischen Fällen von Bedeutung sind sowie ein kritischer und variierender Einbezug von Elementen und Strukturen, de sich aus der reichhaltigen Vielfalt entwickelter phliosophisch-ethischer Zugangsweisen zu einem Phänomen speist. 6.2.1 Struktur, Konstitution, Ablauf, Teilnehmer von ethischen Cafés Struktur und Rahmenbedingungen Ethik-Cafés sind Gesprächsplattformen für ethische Diskurse, die auf Station oder stationsübergreifend regelmässig stattfinden. Sie dauern in der Regel etwa zwei Stunden und finden je nach Bedarf alle zwei Wochen oder einmal im Monat statt. Ethische Cafés haben interdisziplinären Charakter, d.h. nicht nur Pflegende und Mediziner, sondern auch anderweitige, in bestimmte Themen involvierte Spezialisten werden manchmal zugezogen. So können – je nach Fall –beispielsweise ein Seelsorger oder ein Transplantationskoordinator bei Themen wie Hirntod oder Reanimation beigezogen werden. Oder ein Alternativmediziner bei Fall-Dilemmata rund um die Einbettung alternativer Medizinformen. Eine wichtige Voraussetzung der Teilnehmer ist die Freiwilligkeit und die Anrechnung auf Arbeitszeit. Ethik-Cafés sind im Unterschied zu ethischen Kommissionen öffentlich – d.h. es kann als Diskursteilnehmer jeder Interessierte aus dem Berufsfeld dazu stossen. Damit wird Problemen der Verzerrung von Diskursen durch apriorische Vorbewertung nach Rang- und Statuswürde institutionell ein erster Boden entzogen. Ein zweiter wird durch eine möglichst interessenunabhängige Moderation im Diskursvollzug entzogen. Nicht alle Menschen (weder alle Ärzte noch alle Pflegenden) sind grundlegend daran interessiert oder aus verschiedenen Gründen nicht dazu in der Lage, im gemeinsamen Gespräch ein ethisch-philosophisches Problembewusstsein zu entwickeln – eine Beobachtung und Erfahrung, die bereits Aristoteles festgestellt und beschrieben hatte. Nur diejenigen, die eine Vorstellung darüber haben und erwägen können, wie eine Situation besser gehandhabt werden könnte, sind auch Ansprechpartner ethischer Diskurse. Teilnehmer mit abschliessendem Vokabular, die von ihrem darin postulierten jeweiligen Gut überzeugt sind, haben meist nur schon Schwierigkeiten, sich in fremde Positionen hineinzuversetzen oder mit Gegenargumenten die eigene starre Sicht der Dinge zu dynamisieren. Es wäre wenig sinnvoll, philosophierende Ethik in dem hier verstandenen Sinne von allen gewaltsam einzufordern - wobei natürlich auch auftretende Effekte von Gesinnungswandel durch die Massageeffekte im Bewusstsein79 nicht gänzlich auszuschliessen sind. Vgl. McLuhan, Marshall: Medien verstehen – die Ausweitungen des Menschen. In: Marshall McLuhan – absolute. Hrsg. V. Martin Baltes und Rainer Höltschl. Freiburg i. Brsg. 2002, S. 138-147. 79 106 Die Gespräche werden in einer verständlichen Sprache des Berufsalltags geführt, wer Fachtermini aus seinem Spezialgebiet einbringt, muss diese auch erläutern und für alle verständlich machen können. Die Moderation verläuft zurückhaltend, aber ethisch kompetent – was viele Faktoren mit einschliesst. So müssen Moderierende Personen nicht nur über ein möglichst breites multidisziplinäres Fachwissen verfügen, sondern auch in besonderem Masse an der jeweils vorliegenden Problemstellung einzelner Fälle interessiert sein, die Situation adäquat erfassen können, sich in sämtliche präsente Positionen und Meinungen einfühlen können, ein reichhaltiges methodisches Verfahrenswissen den Gesprächssituationen entsprechend einzusetzen im Stande sein, erkennen können, wann in welchem Ausmasse welche Hintergründe einzubringen sind und in besonderem Masse ein Gespür dafür entwickelt zu haben, wann welche offenen und bislang ungelösten ethischen Probleme von lösbaren Problemen unterschieden werden müssen. Zentral ist überdies eine ideologiekritische oder im Bereich der Ethik präziser ausgedrückt: eine ethos-kritische Haltung aufzuweisen, die es nicht unterlässt, auf die Schwierigkeiten und Probleme einzelner Lösungen hinzuweisen, solange die Offenheit der Teilnehmenden gegeben ist. Es darf im Hinblick auf die Komplexität einzelner Fälle auch nicht der Fall sein, dass verkappte Zielvorstellungen wie unbedingte Lösbarkeit oder Konsens um jeden Preis oder ein harmonisches Gespräch verfolgt werden – denn die philosophierende Ethik ist für die Fälle da und nicht umgekehrt. Dabei ist es durchaus möglich, dass keiner der Beteiligten auch unter Aufbietung allen verfügbaren Fachwissens einen sich offenbarenden Dissens (an einem so genannten hard case) zu überbrücken vermag. Die Ethik leistet hier ihre genuine Arbeit, die darin besteht, solche Schwierigkeiten sichtbar zu machen, was allen Beteiligten eine differenzierte Sicht auf die Problematik ermöglicht und sie in solchen Fällen davon entlastet, Unmögliches entscheiden und verantworten zu müssen. Thematisch gibt es keinerlei Einschränkungen. Zentral ist, dass kontroverse Stimmen am gleichen Tisch eine differenzierte Problemsicht ermöglichen, die meist bereits durch die Verlautbarung entstehen kann und nicht notwendig einer metatheoretischen Paraphrase bedarf. Inhaltlicher Aufbau und Ablauf eines ethischen Cafés 1. Ausgangspunkt ist ein Konkretes Fallbeispiel. In der Regel wählen die Berufsleute einen Fall aus, der in seiner Problematik insgesamt oder mit Fokus auf eine bestimmte Fragestellung hin diskutiert wird. Dieser wird in kurzer, aber prägnanter Form schriftlich abgegeben. Die Teilnehmer paraphrasieren den Fall, holen ergänzende Informationen ein oder korrigieren und präzisieren Details an der Schilderung. Oft ist festzustellen, dass der Fall durch diese Eingangssequenz allererst seine Konturen gewinnt, die bei einer vorgängigen Lektüre der Fallschilderung verborgen bleiben können. Von Wichtigkeit ist hier auch derjenige Informationsanteil, der von am Fall Betroffenen eingebracht werden kann. 2. Diskussion: Im vielstimmigen Austausch wird das Empörung auslösende Problem benannt und aus verschiedenen Richtungen beleuchtet. Es zeigt sich dabei ein Problemhintergrund, der selbst für erfahrene Problemkenner meist eine Komposition aus altbekannten, grossen Problemen und neuen, überraschenden und unerwarteten Aspekten und Fragen beinhaltet. Aufgabe der Moderation ist die Strukturierung und die Entwicklung weiterer sich ergebender Verfahrensschritte oder Vertiefungen, die ein Abwägen zwischen einem Einbringen erwarteter typischer Schwierigkeiten und Probleme bestimmter Themen und einem Sich-Einlassen auf aktuell sich ergebende, möglicherweise so noch nie bedachter Einwände und Aspekte eines Themas beinhaltet. 107 3. Theoretische Vertiefung. Es wird entschieden, wie die Analyse weitergeführt werden soll – ob beispielsweise eine Vertiefung in die Problematik einzelner Themen eines Falles erfolgen soll oder ob der Fall einer methodischen Engführung, z.B. unter Einbezug eines ausgewählten Modells ethischer Entscheidungsvorbereitung getroffen werden soll. Man entscheidet auch, ob man zielorientiert diskutieren soll, zum Beispiel mit der Absicht, eine Regelung für ein immer wiederkehrendes Problem zu entwickeln oder demgegenüber der Vollzug und die Kompetenzerweiterung der Beteiligten im Mittelpunkt stehen soll, die nicht durch pragmatisierende Verkürzungen getrübt werden soll. 4. Diskussion entlang der hinzugekommenen Erkenntnisse. In bilanzierenden Endphasen ethischer Diskurse im Ethik-Café werden nicht nur mögliche Ergebnisse gesammelt, sondern auch Kritik zum aktualen und künftigen Vollzug ethischer Diskurse eingeholt und diskutiert. 5. Es gibt auch Kaffee. Eine minimale Gemütlichkeit fördert die Basisheiterkeit und Ungezwungenheit, sich in einem so offenen und temporär dehierarchisierten Rahmen diskursiv zu bewegen. 6. Das Hinweisen auf weiterführende Literatur oder die Abgabe von Artikeln zu einem Thema. Hierbei muss, um einer Ideologisierungsgefahr zu begegnen, auf Vielfalt und Verschiedenheit unterschiedlicher Ansätze geachtet werden. Gerade die Überzeugungskraft abwegiger Standpunkte darf didaktisch nicht unterschätzt werden. Gesprächsregelungsmöglichkeiten Gespräche in philosophischen Cafés und Ethik-Cafés sollten gewissen minimalen Regeln der Gesprächsführung folgen, die den Teilnehmern transparent gemacht werden sollten. Dies muss nicht zwingend von vorneherein geschehen (womit nur unnötige Distanz geschaffen wird), sondern kann sich durchaus nach mehreren Runden allmählich entwickeln, indem diese Modalitäten diskutiert werden. Nachfolgend einige Überlegungen und Vorschläge zu möglichen Regeln, die aus den Erfahrungen der Moderation zahlreicher philosophischer Gesprächsrunden, Philo-Cafés und Ethik-Cafés entstanden sind. Man sollte themenbezogene Beiträge machen. Diese Beiträge sollten nicht in dominierende Selbstdarstellungsvoten umschlagen. Es wird nicht politisiert, indem man sich moralische Forderungen entgegenhält und einen Grabenkampf eröffnet. Man sollte keinen Gesprächsteilnehmer persönlich angreifen oder Aussagen verletzender Art machen: die Meinungen der Personen als Personen stehen im philosophischen Gespräch nicht zur Debatte. Meinungsverschiedenheit bildet eine Grundlage für jedes philosophische Gespräch. Wo keine Differenzen bestehen, bedarf es keiner Auseinandersetzung. Unvoreingenommenheit meint nicht Vorurteilsfreiheit, sie lässt sich vielmehr offen auf unbekannte oder unangenehme, den eigenen Vorurteilen zuwiderlaufende Gedanken und Positionen prüfend ein. Aufmerksamkeit ist wichtig, weil es auch darum geht, aus den Voten des Gegenübers dasjenige herauszuhören, was wichtig ist und das Gespräch weiterbringen kann. Ein bestimmter Grad von nicht emotional überbordender, aber auch nicht sich in Gelassenheit ergebender Minimalleidenschaftlichkeit ist ebenfalls geboten: Argumente sollen geprüft und gegebenenfalls einer scharfsinnigen und engagierten Kritik unterzogen werden. Die Rede vom „jemanden beim Wort nehmen“ zeigt den minimalen Grad an Verbindlichkeit an, der gefordert wird – planloses Hin- und Herreden ist nicht gefragt und zielt eher in Richtung des Sich-aus-seiner-Verantwortung-Stehlens für das, was man behauptet hat. Mitzubringen ist idealerweise eine Unzufriedenheit über die bisherigen Lösungsansätze einer Frage. Man philosophiert nicht, um sich vorgefasste Meinungen bestätigen zu lassen. Wer sich mit sich und der Welt im Reinen wähnt, braucht nicht zu 108 philosophieren. Schließlich bereitet und begleitet ein philosophisches Gespräch eine gewisse Heiterkeit und Gelassenheit im Umgang mit schwierigen und nicht auf einen Nenner zu bringenden Fragen. Gerade der spielerische Ernst und die Freude am Spiel erwägenswerter unterschiedlicher Standpunkte ermöglichen es den Teilnehmern, sich immer sicherer in einem Feld voller Ungelöstheiten zu bewegen 6.2.2 Moderationskompetenzen im ethischen Diskurs Die folgenden Thesen sind aus der kritischen Betrachtung und zahlreichen Vollzugserfahrungen moderierter philosophischer Gespräche entstanden. Es sind Aspekte aufgeführt, die über die Moderationsüblichkeiten ‚gewöhnlicher’ Gespräche hinaus besonders für philosophisch-ethische Gespräche Relevanz beanspruchen. Acht Thesen zu Moderation und Vollzug praktischen Philosophierens im Rahmen ethischer Gespräche 1. Die Antworten auf philosophische Fragen dürfen nicht Gewissheit oder Ungewissheit suggerieren, indem entweder eindimensionale Ansichten und Begriffe als Quintessenz geimpft oder andererseits Probleme bis zur Unkenntlichkeit zerfasert werden. Das SichBewegen-Können im Status des Noch-Unentschiedenen ist eine wesentlich Moderationskompetenz, die den Teilnehmenden deutlich werden soll. 2. Die Repliken sollen nicht dazu dienen, einer gestellten Frage nur dadurch gerecht zu werden, dass der entstandene kommunikative Leerraum aufgefüllt wird mit Wissensinhalten, die keinen Problembezug erkennen lassen. 3. Antworten auf philosophische Fragen sind Probleme. Deshalb müssen die Repliken mehrdimensional und polyperspektivisch den jeweiligen Problemkomplex umgreifen. Dies gelingt in der Regel selten mit rhetorisch zwar wirksamen Schlagwörtern oder Sentenzen, sondern erfordert meist einen entsprechend differenzierten rhetorischen Aufwand. 4. Vermeintliche Lösungen müssen mitsamt einer Reflexion über die Bedingtheit ihrer Voraussetzungen vorgebracht werden. Man kann eine Deklarationspflicht über den Ursprung eingeführter Argumente, Thesen und Ansätze erheben. Unbestimmte Quellen sind unglaubwürdig. 5. Gegebenenfalls haben sich die Veranstalter über bestimmte Antwortkomplexe im Voraus zu verständigen, z.B. darüber, wie man die Komplexität einer Problematik didaktisch vertretbar herüberbringt. Grundlegende Differenzen und Schwierigkeiten in der Sache sollen vorab formuliert und allenfalls an entscheidender Stelle eingebracht werden. 6. Die Sprache sollte soweit als möglich die Berufsalltagssprache ('ordinary language') des sein – fremde Fachtermini (v.a."-ismen" oder Autorennamen) sollten mit Zurückhaltung und nicht ohne Betonung des jeweils problemrelevanten Beitrags verwendet werden. 7. Problem der Moderation: Je nach Aktivitätsgrad der Teilnehmer muss mehr oder weniger Aktivierungsleistung durch die Veranstalter beigesteuert werden. Das 109 Autoritätsgefälle (Machtproblem) sollte soweit verringert werden als möglich, aber auch soweit aufrechterhalten werden, als nötig. 8. Ungeachtet der immanenten Eigenproblematik sollte die Grundhaltung der Veranstalter von "skeptischer Zuversicht" geprägt sein. Gewissenhafter Zweifel erzeugt eine Rezeption, die von einem Mindesternst geprägt ist, der trotz allen Humors, den eine denkerische Überlegenheit erzeugt, erhalten bleiben und spürbar gemacht werden sollte. Ironisierungen sind auf dem (schwankenden) Erträglichkeitsniveau zu halten. Selbstironie und Reflexionsernst sind aber gleichberechtigte Partner im diskursivmetaphorischen philosophischen Sprachspiel. 6.2.3 Institutionalisierung Wer sich der Aufgabe der Institutionalisierung eines Ethik-Cafés stellt, steht vor einem zirkulären Anfangswertproblem: Um nicht nur oberflächlich verstehen zu können, was ein Ethik-Café leistet und wo seine Grenzen liegen, müsste man über längere Zeit daran teilgenommen und Erfahrung gesammelt haben. Dies wäre die Voraussetzung für diejenigen Personen, die allererst ein ethisches Café in seiner Institution zu bewilligen haben. Damit es soweit kommt, müsste ein Ethik-Café aber bereits institutionalisiert sein. Der logische Zirkel wird in der Praxis zu einem „guten“ Zirkel der allmählichen, manchmal zähen Überzeugungsarbeit durch die Initianten überschritten. Widerstände liegen zumeist in den leitenden Positionen, die das Berufsethos für Abteilungen oder ganze Häuser prägen. In manchen Krankenhäusern wären manche Ärzte der Durchführung ethischer Diskurse im Team mit Pflegenden nicht abgeneigt, doch die Pflegedienstleistungen blocken auf aus verschiedenen Gründen Institutionalisierungswünsche ab. Dennoch gelingt es auch Pflegefachkräften vermehrt, ethische Cafés zu gründen. Ein erster Schritt dazu kann auch darin liegen, ein bewilligtes Pflegefachgespräch in seiner Funktion auf ethische Aspekte zu erweitern und den Teilnehmerkreis institutionsintern zu erweitern. Die folgenden Hinweise können bei der Gründung eines Ethik-Cafés oder eines ethischen Komitees zur Anwendung gelangen oder Hilfestellung für eigene Überlegungen bieten: Institutionelle Ebene - Bedarf abklären, Überzeugungsarbeit leisten - Institutionalisierung sichern (rechtlich, ökonomisch, politisch) - Form der Institutionalisierung wählen (freiwillige individualethische Fallbewältigung und/oder unentbehrliches und im Ablauf unverzichtbar eingebundenes Strukturelement) - Möglichkeiten der Finanzierung abklären. Wenn immer möglich sollte die Teilnahme als bezahlte Arbeitszeit gelten können. Für eine Pilotphase könnte auch auf Entgeld verzichtet werden, bis erste Resultate über die Wirkung seitens der Teilnehmenden vorliegen. - Strukturen eines Ethik-Cafés oder eines ethischen Komitees konzipieren: Wer darf, kann, soll teilnehmen können? (verschiedene Hierarchie- und Kompetenzstufen erfordern eher externe Moderation und Supervision als auf gleicher Hierarchiestufe sich befindliche Gremien) Wie gross soll die Teilnehmerrunde sein? 110 Gibt es Zielvorgaben? Müssen demokratische Entscheide gefällt werden können? Hat das Ethik-Café beratenden und kompetenzerweiternden Charakter? Sollen Angehörige und Patienten einbezogen werden können? Haben die Gespräche eine präventive, retrospektive oder akute Zielrichtung? Wie oft und regelmäßig werden die Gespräche geführt? Wie wird für nachhaltige Sicherung erreichter Ergebnisse gesorgt? (Publikation, etc.) Wer moderiert die Gespräche? (interne fachlich und ethisch kompetente Personen oder externe Philosophen bzw. Ethiker) Ist die Teilnahme freiwillig oder verbindlich? Wie werden Erkenntnisse erzeugt und gesichert? (…) - Testlauf von 4 – 6 moderierten Gesprächen durchführen, Rückmeldungen auswerten und gemeinsam reflektieren. Allenfalls Kurskorrekturen vornehmen. - Eigene Bezeichnung wählen: Ethikplattform, Ethische Gesprächsrunde, Ethikkomitee, Ethische Kommission, Ethikcafé, Ethiktreff, Ethikzirkel, Ethikberatung, Ethik-Konzil, etc. - Ethikkomitee als Qualitätsmerkmal der PR-Abteilung der Gesamtinstitution werbeartig kommunizieren, so dass entsprechende Öffentlichkeitsarbeit diesen qualitativ hochwertigen Aspekt intern gepflegter ethischer Gesprächskultur nach außen hin sichtbar machen kann – falls erwünscht. - Transparenz der institutionellen Werte (Ethikkodex, ethisches Leitbild der Institution) - (…) Individuelle Ebene - Zirkuläres Initiationsproblem: Um ethische Kompetenzen zu erwerben, braucht es für Pflegedienstleitende, Pflegemanagerinnen oder Pflegepädagoginnen Moderationserfahrungen, die nur prozesshaft erworben werden können. Wie ein Ethikkomitee gründen und rechtfertigen, ohne philosophische Schlüsselkompetenzen aufzuweisen? Hier genügt es, für eine gewisse Zeit externe Moderatoren für ethische Gespräche heranzuziehen, quasi als ethische Kulturinjektion. - Theoretisches Wissen über Argumente, neue und traditionelle ethische Ansätze, Begriffe, Grundprobleme und Kontroversen müssen lebenslang aufbereitet und in ethische Diskurse eingebracht werden können. Wer setzt und regelt die Ansprüche des Reflexionsniveaus? - Erfahrungswissen aus vielen, auch und gerade gegensätzlichen Welten und deren Wertmassstäben muss vorhanden sein, um gegebenenfalls in ethische Gespräche eingebracht werden zu können. (interkulturelles, interreligiöses, interdisziplinäres Wissen) - Moderationskompetenzen für ethische Gespräche schrittweise und systematisch erweitern. - Eine gewisse Standfestigkeit im Denken oder besser ausgedrückt: eine philosophisch-ethische Schwimmfähigkeit ist angesagt, die selbst in komplexen oder heiklen Gesprächssituationen noch Worte und Konzepte findet (Schweigen inbegriffen…), um Aspekte zu gliedern, ordnen oder allenfalls zu verwirbeln. Man kann diesen Zustand auch als ein Sich-In-der-UnsicherheitSicherfühlen bezeichnen, eine Art aktive Gesetztheit gepaart mit heiterer Gelassenheit, die es – 111 analog der Aristotelischen hexis prohairetiké (einer Grundhaltung der Wahl, cf. Kapitel 4) – ermöglicht, in vielen Situationen ethisch bestehen zu können und situativ genügende Entscheidungsvoraussetzungen im Diskurs hervorzuheben. - (…) Eine Pflegemanagerin berichtet rückblickend80 „Ich erinnere mich noch gut an die erstaunten und skeptischen grossen Augen, die mich anstarrten, als ich mit meinen Pflegemitarbeitern das erste Mal den Gedanken erwog, eine Plattform für regelmäßige ethische Gespräche zu gründen. Natürlich war mir selber mein eigener Anspruch etwas unheimlich: Von Ethik verstehe ich kaum etwas, und die spärlichen Hinweise auf Möglichkeiten der Gestaltung, die wir in der Ausbildung erhalten hatten, konnten allenfalls als kleine Orientierungshilfe dienen. Einige Mitarbeiter waren zwar sofort begeistert und ermunterten mich im Unterfangen, andere wiesen aber sofort mit dem realistischnüchternen Blick darauf hin, dass man solche Projekte gegenüber der Leitung der Institution kaum rechtfertigen könne und die Finanzen ohnehin knapp und immer knapper bemessen seinen. Gesagt, getan: Nach knappem Mehrheitsentscheid im Team unternahm ich die ersten Schritte der Überzeugungsarbeit. Ich sammelte zunächst Informationen und Berichte bei Kolleginnen in benachbarten Institutionen, die bereits über so etwas wie eine ‚ethische Binnenkultur’ verfügten. Zufällig stand eine allgemeine Weiterbildung in Form einer Tagung in diesem Jahr bevor, wo man noch auf der Suche nach Referenten war. Es gelang mir – es wundert mich heute noch, das meine Aussage Gehör fand – bei einem Small Talk zwischen Tür und Angel unserem leitenden Oberarzt, der nebenbei mit der Organisation dieser Tagung betraut war die Bemerkung fallen zu lassen, dass man doch vielleicht auch jemanden aus dem Bereich Ethik als Referenten einladen könnte, das sei interessant und trage obendrein noch zum Image der Klinik bei. Zum guten Glück konnte ich auf die spontane Rückfrage, ob ich denn so einen Referenten kennen würde, antworten. Denn ich hatte mir einige Ansprechpersonen aus dem Bereich Ethik vorsorglich notiert. Die eingeladene Referentin aus dem Bereich Ethik legte durch ihren engagierten Vortrag, dem sich eine kleine Diskussion anschloss, den Boden für weitere Gespräche, in denen ich Schritt für Schritt versuchte, offene Ohren für erste ethische Gehversuche zu finden. Inzwischen hatte ich meinen Konzepte mehrfach überarbeitet und in immer subtiler formulierten Varianten in die Vorgespräche eingebracht. Nach weiteren zwei Monaten wurde dann versuchsweise eine Serie von fünf ethischen Gesprächen von je zwei Stunden Dauer bewilligt. Nun ging’s ans Lebendige: Würden mich – sollte ich denn die Moderation der Gespräche übernehmen – die Mitarbeiterinnen als glaubwürdige Instanz akzeptieren? Ich beschloss, für diese erste Serie von Gesprächen als Begeleitung eine diskursfähige, kompetente, einfühlsame und in ethischen Belangen bewanderte Person als Moderatorin und Supervisorin beizuziehen. Die Philosophin, die ich fand, meisterte die Gesprächsleitung der Fallbesprechungen so beeindruckend, dass ich viel lernen konnte über die verschiedenen Diskurs- und Denkmanöver, die sie durchzuführen im Stande war. Selbst wenn manche Gespräch an kritischen Punkten angelangt waren, wo es beispielsweise scheinbar unversöhnliche Pro und Contra-Parteien gab, schaffte Sie es, durch Hinweise und Rückfragen die Gemeinsamkeiten herauszubringen, die beide Parteien stillschweigend unterstellt hatten. 80 Obwohl die folgende Schilderung eines Erfahrungsberichtes eine literarische ist, basiert sie auf wahren Tatsachen. Es gibt immer wieder ethisch interessierte und engagierte Pflegende, die sich für eine Umsetzung und Etablierung ethischer Gesprächsplattformen in ihren Institutionen stark machen und diese auch gegen die institutionellen Widerstände durchsetzen. 112 In Nachgesprächen äußerten die Teilnehmer überwiegend positive Rückmeldungen, viele waren schon froh, überhaupt einmal irgendwo ihre Gedanken und Überlegungen mitteilen zu können, ohne dass dies gleich Rückwirkungen auf die Stimmungslage des Pflegeteams hatte. In einigen der folgenden Fallbesprechungen gelang es uns sogar, selber Leitlinien zu formulieren, die Hinweise auf die künftige Regelung solcher Fälle enthielten und die wir auch im internen Mitteilungsblatt publik machten. Heute, acht Jahre später, habe ich nach unzähligen selber geleiteten Ethikbesprechungen gerade drei weitere künftige Moderatorinnen über eine gewisse Zeit begleitet und ihnen wichtige Hinweise gegeben, wie man solche Gespräche führen kann und wie man insbesondere schwierige Gesprächsklippen umschiffen kann. Ethik ist in unserer Klinik kein Fremdwort mehr, weil wir nun über Jahre hinweg in kleinen Schritten den Umgang mit ethisch bedenklichen Vorfällen diskutiert und geübt haben. Wegweisend war dabei schon die institutionelle Schaffung von Gesprächsplattformen, die es inzwischen auch für Gespräche mit Pflegenden, Ärzten, Patienten und Angehörigen gibt. Vorreiter war damals unsere Geriatrieabteilung, die als erste Raum für solche Ethikgespräche geschaffen hatte – bald zogen auch, wenngleich nach viel schwerer zu leistender Überzeugungsarbeit – die anderen Abteilungen nach. Die interne Ethikkultur ist längst auch zu einem Qualitäts-Gütesiegel der ganzen Institution geworden, auf das bei öffentlichen Veranstaltungen nicht ohne Stolz hingewiesen wird, ein klein wenig davon trage ich auch in mir…“ 6.2.4 Themen Die Themen ethischer Cafés ergeben sich aus den Schwierigkeiten und Empörungen des Berufsalltags. In der Regel werden einzelne Fälle untersucht und diskutiert, die ganz spezifische Fragen aufwerfen oder Wertkonflikte enthalten. Themen können aber auch Überlegungen zu spezifischen, immer wiederkehrenden Begriffen aus dem Themenfeld der Ethik sein, die dann gemeinsam vertieft und diskutiert werden. Auch Verfahrensfragen zu Methoden der Argumentation, Strukturierung oder der Gestaltung des sprachlichen Zugangs zu ethischen Fragen können Gegenstände sein. Wichtig zu sehen sind die feinen Unterschiede ethischer Konflikte und Fragen, die auch und gerade weitab von den großen z.B. im Rahmen der Bioethik immer wieder erörterten Fragen entstehen. Viele ethische Konflikte beginnen schon im Kleinen und unscheinbaren Rahmen täglichen Handelns: Mit welchen Menschen- und Patientenbildern verrichten Pflegende und Mediziner ihre täglichen Handlungen? Wie stark darf / muss / soll man sich in ein eigenes Rollenverständnis zurückziehen und wie stark darf man sich offenen und erweiterten Problemen stellen? Wie gestaltet man die Routineverrichtungen? Wie kann man mit Patienten und Angehörigen in einer Weise sprechen, die weder die Betroffenheit der Nichtberufsleute noch die Abgebrühtheit und Souveränität des beruflichen Rollenverständnisses verletzt? Kann man Tugenden wie Respekt, Aufrichtigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, etc. entwickeln und umsetzen? Hier einige Beispiele aus Ethik-Cafés einer Intensivstation: Reanimation Intubation Hirntod / Todesvorstellungen Umgang mit Angehörigen Macht und Ohnmacht im Diskurs Verantwortung Folgenabschätzung Prinzipientreue / Loyalität Diskriminierungen Gerechtigkeitsauffassungen Würdekonzeptionen Therapieren oder nicht? Menschen- Lebens- Altersbilder Umgang mit Berufsrollen Leib-Seele-Problem(e) Fürsorge 113 Patientenverfügung und maximale Intensivtherapie Intubieren oder nicht: Ein Dilemma für Ärzte und Pflegende Eine ethische Theorie: Der Utilitarismus Pflege eines hirntoten Menschen: Gibt es da ein Problem? Grundsätzlich gibt es wohl keinen abschließbaren Katalog typischer Themen, die für sämtliche Fälle relevant wären. Häufig ist allerdings ein Bezug zu offenen und auf vielfache Weise nicht abschließend beantwortbaren Grundfragen der Auffassung von Mensch, Leben und Tod, Verantwortung, Autonomie, Würde, Gerechtigkeit, Umgang mit Technik, Altersbildern oder Ökonomisierungsfragen erkennbar. Eine Frage, der man sich oft zu stellen hat und die in ethischen Diskurses eingebracht werden sollte, ist diejenige, ob und falls ja, wann eine Reduktion oder Zurückführung eines meist komplexen Falles auf wenige Begriffe oder Probleme zulässig ist. 6.2.5 Funktion, Leistungsfähigkeit und Grenzen Einige der Funktionen, Leistungen und Grenzen wurden bereits erwähnt. Ethische Cafés ermöglichen es den Teilnehmenden, selber Probleme zu Sprache zu bringen und im gegenseitigen Gespräch entfalten und kritisieren zu können. Sie werden im Denken ernst genommen und erlernen allmählich, zwischen lösbaren und offenen Problemen zu unterscheiden und im Denken und Reden damit adäquat und sach- wie problemgerecht umzugehen. Ihre ethischen Kompetenzen werden schrittweise erweitert. Ethik in institutionsinternen moderierten ethischen Cafés zu betreiben hat überdies ein ganzes Bündel therapeutischer Effekte81, deren Pointe es aber ist, gerade nicht als solche von vorne herein mitformuliert zu sein. Hier einige Stimmen von Teilnehmern aus Pflege und Medizin: „Die Möglichkeit, sich in Ruhe über schwierige Situationen auszutauschen, finde ich wichtig.“ „Die sachliche Analyse hilft mir dabei, Vorurteile abzubauen und den eigenen Standpunkt herauszufinden.“ „Ich finde es gut, dass jeder seine Meinung sagen kann ohne dabei bewertet zu werden.“ „Es ist erstaunlich, wenn man mal sieht, wie viele Probleme in einem einzigen Fallbeispiel stecken.“ „Ich habe hier die Möglichkeit, die Arbeitskollegen mal von einer anderen Seite kennen zu lernen. Ich glaube, das fördert den Teamgeist.“ Somit lassen sich – nicht abschliessend – folgende Aspekte zu Funktionen ethischer Cafés vorläufig festhalten: Ethische Cafés können: Probleme zur Sprache zu bringen Austausch zu ermöglichen Reflexionsprozesse in Gang zu setzen Bremer, Daniel: Zeitrandgespräche. Philosophische Gespräche zwischen Alt und Jung. Dokumentarfilm, 36’, Zürich 2003; oder: Bremer, Daniel: Zeitrandgespräche. Protokolle der philosophischen Gespräche zwischen Alt und Jung. Zürich 2003. 81 114 philosophisch-ethische Hintergründe heraushebend vermitteln Meinungsverschiedenheiten nachvollziehen können Problembewusstsein entwickeln Teamgeist zu fördern Sich im Denken bewegen können Ethische Fragen von berufspraktischen Fragen trennen Offene, bislang ungelöste Probleme von lösbaren beruflichen Problemen trennen Verschiedene Zugangsweisen zu Fragestellungen deklarieren und problematisieren (...) Ethische Cafés können/sollen nicht: Vorschriften machen Werte vermitteln Moralische Verurteilungen vornehmen Klare, eindeutige Lösungen zu suggerieren Konsense um jeden Preis anstreben (...) Diese Hinweise sind selbstredend erweiter- und variierbar, solange die Kernaufgabe ethischer Tätigkeit – das Fördern und Sichtbarmachen ethischer Konflikte und die strikte Enthaltung moralisierenden Eingreifens eingehalten werden. 6.3 Deinstitutionalisierte angewandte Ethik Ein Problem, das sich mit jeder Institutionalisierung erhebt, liegt darin, dass die Institutionalisierung allein nicht in hinreichendem Masse die Qualität ethischer Diskurse sichern kann. Diese hängt in überwiegendem Masse von der Motivation der Moderatoren und Teilnehmenden ab. Zwar wurde der Ruf nach qualitätssichernden Kriterien auch für ethische Diskurse laut – jedoch ist zu erwägen, ob damit nicht gerade jener Freiraum offener Diskursmöglichkeiten in fraglicher Weise eingegrenzt wird und Ethik aufhört, philosophierende Ethik zu sein. Philosophierende Ethik darf sich grundsätzlich gerade nicht verzwecken lassen, womit nicht ausgeschlossen ist, dass sie sich temporär verzwecken kann, wenn verschiedene Standpunkte erwogen werden. Gerät dabei allerdings der Fokus auf grundlegende Schwierigkeiten einer Sache aus dem Blick, erhebt sich ein Verdacht der rigiden Kristallisation auf ein bestimmtes Ethos. Überdies stellt sich bei allen Qualitätssicherungsmaßnahmen die grundlegende Frage nach dem Kriterium der Qualität und – nota bene – der Auffassung von „Qualität“ überhaupt. Lässt sich Gewissheit und Sicherheit gerade in offenen und schwierig einzugrenzenden Feldern ethischer Probleme durch ein institutionalisiertes Qualitätsmanagement sichern? Mit welchem Qualitätsbegriff operieren Qualitätssicherer? Lassen sich deren Methoden, Ansätze und Begriffe so begründen, dass ein Intervenieren oder Zulassen nachvollziehbar ist? Ohne diesen wichtigen, aber auch komplexen Fragen hier im Einzelnen weiter nachzugehen, werden Formen und Möglichkeiten deinstitutionalisierter angewandter Ethik aufgeführt und kurz erläutert. Vor-Ort-Gespräche mit Patienten, Angehörigen, Berufsleuten Ethische Fragen tauchen oft unvermittelt vor Ort auf. Auslöser können scheinbar kleine Details sein, an denen Wertvorstellungen und Begründungen kollidieren. Hier können die ethischen Fragen unvermittelt diskutiert werden oder Hinweise auf deren Diskussionswürdigkeit gegeben 115 werden. Manche Fragen lassen kaum Raum für längere Gespräche zu – dennoch berichten Pflegende und Ärzte immer wieder von erfolgreichen ethischen Zwiegesprächen, die in entsprechenden Situationen durchaus möglich waren und als wertvoll eingestuft werden. Ärzte-Coaching Medizinisches Personal hat ein Raum- und Zeitproblem – oft passt ein vorgesehenes Zeitfenster für eine Teilnahem an einem Ethische Café nicht oder wird von Einsätzen verunmöglicht. Hier könnten Einzelgespräche mit Ethikern bzw. den Moderatoren ethischer Cafés gezielt jene Fragen aufgreifen, die bei Ärzten Empörung oder ethische Bedenken auslösen. Im Zentrum von solchen Eins-zu-eins-Gesprächen steht neben der Erfassung und Formulierung des Problems die Erweiterung und Differenzierung der Sichtweise über die ärztlich-medizinische Perspektive hinaus. Dafür haben Ethiker und Moderatoren temporär die Rolle des Advocatus Diaboli zu übernehmen, der sich für Gegenstimmen nicht am Tische sitzender Parteien stark macht. Seminarbesuche Außerhalb des Berufsalltags kann man seine ethischen Kompetenzen oder mindestens ethisches Wissen in Ethik-Seminaren erweitern. Bislang – und dafür waren die Universitäten auch eigens zuständig – pflegten die Philosophischen Institute primär den Forschungsdiskurs und legten ihre Ethikseminare auf den Erwerb differenzierter Fähigkeiten für das Mitarbeiten-Können im Forschungsbereich aus. Mit der Umstrukturierung angestammter Studienstrukturen auf das Bachelor- und Mastersystem stellen sich viele Universitäten und Fachhochschulen der Aufgabe der Anbindung von Forschungsergebnissen in den praxisbezogenen Berufsalltag. Das Entstehen von Nachdiplomstudiengängen (Masterstudiengänge in Ethik) ist ein Schritt in diese aus Sicht der betroffenen Berufsleute begrüßenswerte Richtung. Viele Universitäten haben aber den Status des Gasthörers oder Akademiestudierende beibehalten, die es Interessierten auch ohne Absolvierung eines Masterstudienganges erlaubt, an Ethik-Seminaren82 teilzunehmen. Fachgesprächsrunden Fachgespräche bestimmter Berufsgruppen oder Stationsteams können ebenfalls Orte ethischer Fragestellungen sein. Sei es, dass ethisch interessierte Berufsleute selber die Fragen einbringen – sei es, dass eine externe und ethisch kompetente Person beigezogen wird. Ethische Cafés können sich auch aus Fachgesprächsrunden allmählich entwickeln. Symposien und Workshops Angebote ethischer Weiterbildung sind immer auch Anregungsquellen für eine eigene und dann berufsangewandte Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen. Hier gibt es erfahrungsgemäss allerdings große qualitative Unterschiede und wenige Standards. Auf vielen Symposien fehlt die Zeit für Workshops oder der Name desselben wird nicht zu einem didaktisch vertretbaren Programm gestaltet. Manche Dozierende weisen zwar hochqualifizierte Abschlüsse auf, können aber den Ton und die Sprache der Berufsleute nicht treffen oder haben didaktische Schwierigkeiten, andere gestalten ihre Beiträge und Referate zwar liebevoll und mit hohem Aufwand, schaffen es aber nicht, Probleme differenziert zu durchdringen und zur Sprache zu bringen. Ein großer Mangel herrscht im kritischen Bewusstsein über die Bedingtheiten und Schwächen des je selber vorgetragenen und hinsichtlich der Deklaration und Thematisierung derselben – Faktoren, die gerade im Bereich ethischer Probleme wichtiger sind, als ein souverän vorgetragenes, aber einseitiges Plädoyer für oder gegen etwas. 82 Der Autor bietet im Rahmen seiner Mentortätigkeit an der Fernuniversität Hagen am Studienzentrum Pfäffikon SZ regelmäßig Tagesseminare zu ethischen Themen des Gesundheitswesens an, deren Besuch allen Interessierten möglich ist. Näheres auf www.fuh.ch . 116 7. Weitere ethische Ansätze 7.1 Angewandte Pflegeethik Warum soll überhaupt ethisch gedacht und gehandelt werden? Diese Grundfrage stellt sich vor jedem Beginn ethischer Reflexion. Sie kann aus begründungstheoretischer Sicht nicht hinreichend beantwortet werden. Man ist logisch betrachtet angesichts des Feststellens angeblicher faktischer "Übel" nicht verpflichtet, irgendetwas zu sollen (vgl. Humes "Sein-Sollen-Fehlschluss"). Menschen, die etwa der Tätigkeit des Reflektierens und Analysierens von Konfliktsituationen keinen Wert beimessen, werden auch kaum argumentativ dazu gebracht werden können, ihre Haltung zu ändern. Am Anfang allen ethischen Handelns steht also die Wahl, überhaupt ethisch aktiv zu werden. Entscheidend ist dabei nicht, wie, sondern dass man wählt. Dies setzt Kenntnis über mindestens zwei Alternativen voraus. Ethisches Handeln setzt voraus, dass ein reflektierter Entscheidungsfindungsprozess der bessere Weg ist, als z.B. ein nur spontaner Entscheid - selbst wenn am Ende nicht "vernünftig" entschieden wird. Dahinter steht die Überlegung, das Menschenmögliche überlegt zu haben, bevor ein Fehler begangen wird. Allerdings ist zu beachten, dass Ethisches Handeln nur dort Erfolg haben kann, wo auch eine Bereitschaft zum Diskurs entstehen kann oder vorhanden ist. Das Sensorium für solche Situationen im Bereich der Pflege zu entwickeln, hängt eng mit dem Gelingen ethischer Reflexion zusammen. Es gibt Spitäler und Pflegeheime, die geradezu eine eigene philosophische Reflexionskultur auf sämtlichen Personalebenen und Hierarchiestufen entwickelt haben und regelmäßig ethische Cafés für Berufsleute, Patienten und Angehörige durchführen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Spitäler und Pflegeheime, die jeglichen Bemühungen um ethische Diskurskultur äußerst skeptisch gegenüberstehen. In der Tat kann man sich fragen, ob es nicht gänzlich Sache der erfahrenen Berufsleute ist, innerhalb ihrer Vokabularien eine eigenständige ethische Kultur zu entwickeln, anstatt über externe Ethikexperten teuren Theorierat herbeizuholen, der dann seinerseits das Problem des Theorie-Praxis-Transfers aufwirft. Man darf sich auch berechtigterweise mit der Frage auseinandersetzen, ob es sinnvoll ist, weitere Berufsethiken für Bereiche zu entwickeln, die sich ohnehin schon in einem nicht unproblematischen Gegensatz voller Feindbilder befinden, wie die Etablierung einer Medizinethik und einer Pflegeethik. In Bezug auf die philosophischethischen Grundprobleme stehen sämtliche Bereichsethiken vor denselben Problemen wie etwa der Frage nach der Quelle und der Legitimation von Werten oder der Suche nach Kriterien für den einen oder anderen Rechtfertigungsansatz aus der Landschaft ethischer Ansätze. Auf der Ebene der rechtlichen, politischen und wissenschaftlichen Ebene hingegen bestehen bekanntermaßen Unterschiede zwischen Pflege und Medizin, so dass durchaus eine je eigene Ethik angemessen scheint. Woraus auch immer ein allfälliger Motivationsgrund zu ethischem Handeln entstanden ist – sei es irgendeine positivistische Gesinnung, eine Gewissensstimme, eine äußerst empörende Erfahrung – wer Ethik betreiben möchte, sollte es tatsächlich tun. Oft lässt sich die Wirkung und Reichweite ethischer Gespräche nur aus ihrem angewandten Vollzug an einer konkreten Falldiskussion selber erkennen – wer Ethik betreibt, lernt und erfährt auch allmählich, worin die spezifische Leistungsfähigkeit solcher Diskurse liegt. Die Crux des Unterfangens möglicher Institutionalisierung ethischer Komitees liegt allerdings darin, meist ökonomisch auf Sparkurs befindliche Anlaufstellen nicht unmittelbar, sondern bloß im Metadiskurs über Ethik von Ethik 117 überzeugen zu müssen, was in der Tat nicht einfach ist, wenn Vorbehalte und Vorurteile über den Gegenstand vorliegen, die nicht leichterdings ausgeräumt werden können. 7.2 Gerontologische Ethik Das folgende Referat – gehalten anlässlich der Generalversammlung des Vereins zur Förderung der Altersmedizin altavita (am 12.03.2003, 18.00-19.30 Uhr im Kongressforum Stadtspital Waid, Tièchestrasse 99, 8037 Zürich) – widmet sich dem Thema: Ethik im Alter - Wo fängt sie an, wo hört sie auf? 7.2.1 Philosophische Vorbemerkungen Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ja gemeinhin üblich, sich zunächst für die Einladung zu einem Referat, - und dann erst noch zu einem Referat aus der Sicht der Philosophie! - bei den Veranstaltern zu bedanken – also tue ich dies. Achtung, jetzt kommt’s: Herzlichen Dank für die Einladung den Veranstaltern, einerseits dem Verein altavita, der sich für die Förderung der Altersmedizin einsetzt, zum anderen dem Stadtspital Waid, das bald schon sein neues geriatrisches Zentrum eröffnen und in Betrieb nehmen wird. Vielleicht werden einige von Ihnen eine gesunde Portion Skepsis mitbringen und sich fragen, was ein Philosoph den zur einfachen Klärung von Altersfragen beitragen könne. Nun, ich versuche es trotzdem und halte mich an ein bonmot Hans Blumenbergs, der einmal gesagt hat: „Philosophie darf nicht schwer sein. Sonst ist etwas faul bei dem, der sie vertritt.“ „Ethik im Alter“ – dies ist nicht nur ein weites Feld, wie der alte Briest (in Fontanes Effi Briest) immer dann zu sagen pflegte, wenn er in Schwierigkeiten der Begründungsnot kam – sondern es sind dies im Plural gesprochen „weite Felder“, ja ganze Landstriche an nicht subventionierten und unbeackerten Feldern. Auf einem dieser Felder wird sich einst folgender Fall zugetragen haben, wenn sich die Berichterstatterin in ihrem 107. Lebensjahr richtig daran erinnert haben wird: Laura Meier wurde 1990 in Zürich geboren. Sie verbrachte den Grossteil ihres Lebens in der Schweiz, zog mit ihrem Lebenspartner drei Kinder gross, arbeitete danach wieder in ihren zwei Stammberufen als Organisatorin und Photographin weiter, nur im Jahre 2037 unterbrochen von einem Freizeitjahr, das sie mit ihrem Lebenspartner in Südostasien verbrachte. Im Jahr 2060 erkrankte ihr Lebenspartner schwer und verlor nach mehreren nur scheinbar gelungenen Operationen sein Sprachvermögen. 118 Da Laura Meier schon während ihrer Schulzeit im Ethikunterricht immer grosses Interesse an existentiellen Fragestellungen gehabt hatte und nicht nur während ihres einjährigen obligatorischen Alters-Pflegevorsorgedienstes viele Pflegefälle praktisch und im ethischen Gespräch betreut hatte, sondern sich seit ihrem 50. Altersjahr regelmässig in philosophischen Cafés für Senioren mit Fragen zur Lebensgestaltung, Krankheit, Würde etc. mitdiskutiert und so ihre philosophische Kompetenz für ethische Fragen entwickelt hatte, fielen ihr die Gespräche um die Entscheidung für oder gegen lebensverlängernder Massnahmen bei ihrem Partner – eingedenk der aller Schwere und schmerzlichen Belastung des Falles – insgesamt doch leichter, als sie gedacht hätte. Sie konnte die Argumente und Begründungen von Pflegenden, Ärzten und weiteren Angehörigen nachvollziehen und in die jeweiligen Problemhintergründe eingliedern. Nie fühlte sie sich den Argumenten hilflos ausgeliefert oder von diesen überfordert. Eine gute Unterstützung war ihr während der schwierigen Zeit die spitalinterne Humanberaterin, die sie ernst nahm, die nie hintergründigen Druck ausübte und mit ihr zusammen alle in dieser Situation gegebenen Handlungsmöglichkeiten durchdachte. Aus dem Mediennetz bezog Laura Meier nicht nur viel an für diese Krankheit relevanten Informationen, sondern sie beschäftigte sich intensiv mit vielen ähnlich liegenden, hier veröffentlicht zugänglichen ethischen Dilemmafällen – und zwar gelungenen wie misslungenen. Mit ihrem Lebenspartner hatte sie sich nur sporadisch über Sterbeprozesse unterhalten. Gut erinnert sie sich heute daran, wie sie ihn – in völliger Unkenntnis von Philosophie – zum ersten Mal mitgeschleppt hatte zur städtischen Ethikanlaufstelle. Das war im Jahre 2041 gewesen. Ihr Lebenspartner verstand gar nichts und kam kopfschüttelnd wieder heraus. Erst als ihr Sohn fünf Jahre später nach einem schweren Unfall und acht Monaten Koma starb, begann er sich selber intensiv mit Lebensfragen zu beschäftigen – dann war auch die Zeit, als er ihr gegenüber seine eigenen Vorstellungen über ein seiner Ansicht nach würdevolles Sterben kundtat. Heute, da ihr Partner seit zwei Jahren verschieden ist, ist Laura Meier froh darüber, sich im Laufe ihres Lebens ethische Kompetenz angeeignet zu haben. So verstand sie etwa die anfängliche grosse Skepsis des Pflegepersonals, den mit dem Arzt und den Angehörigen beschlossenen Sterbeprozess einzuleiten, indem auf künstliche Ernährung schrittweise verzichtet wurde. Im anschliessenden spitalinternen Ethikforum trat sie nochmals als Sprecherin auf, um den Fall in allen Details samt der von ihr durchdachten Begründungsmöglichkeiten zu schildern und vermochte so den Anwesenden und Beteiligten ihren Entscheid plausibel zu machen, so weit dies möglich war. Ihr Fall ist heute für alle lesbar im Mediennetz zugänglich. Ich möchte hier aus philosophischer Sicht versuchen, ihnen darzulegen, was „Ethik im Alter“ bedeuten könnte, wo man damit anfängt und wo deren Grenzen liegen. Es stellt sich unter anderen die Frage, ob Ethik im Sinne „philosophischer Ethik“, für die ich hier einstehen werde, den von der heutigen Gesellschaft an sie herangetragenen Ansprüchen überhaupt gerecht werden kann. Unlängst erklang im Zürcher Gemeinderat der Ruf nach „mehr theologiefreier Ethik“, andere wandten ein, dass man vielleicht zunächst einmal klären sollte, was „Ethik“ ist. Und man kann nur ergänzen: Zu klären wäre auch, wie es kommt, dass „Ethik“ (leider) sehr oft missverstanden und instrumentalisiert wird oder (aus philosophischer Perspektive schlimmer) sich instrumentalisieren lässt. Ich mache dies in drei Schritten, die sich drei Fragen zuwenden: 1.) 2.) 3.) Was ist „Ethik“? Was ist „Ethik“ nicht? (Missverständnisse ausräumen) Wie könnte Ethik für das Alter aussehen? (Strukturen, Elemente) Wo fängt eine solche Ethik an, wo hört sie auf? (Methoden, Ansatzstellen) 119 7.2.2 Was ist „Ethik“, was ist „Ethik“ nicht? Zur Einleitung erwähne ich hier eine kleine Anekdote, die sich kürzlich ereignet hat und die eine alte Schwierigkeit widerspiegelt, die im Zusammenhang mit unserem Thema steht. Diesen Winter wurde im Rahmen einer Veranstaltung der philosophischen Gesellschaft Zürich ein altgedienter Hausarzt eingeladen, um zum Thema „Medizinische Modelle des Menschen in Kollision“ aus medizinischer Sicht zu referieren. Neben dem ohnehin schon brisanten und interessanten Thema war dann aber bemerkenswert, wie der Referent selber immer wieder ausdrücklich betonte, wie schwierig es für ihn als langerfahrenen Praktiker ganz konkreter Fälle sei, allgemeine Aussagen machen zu können. So begnügte er sich (und was heisst hier eigentlich „begnügen“?), verschiedene Fälle aus seiner Praxis zu schildern, um vorsichtig an diesen konkreten Fällen bestimmte Auffälligkeiten anund auszuführen. Für Philosophen, die sich gewöhnlich mehr oder ausschliesslich für das Allgemeine interessieren, war dies keine kleine Belastungsprobe – zumal hier der Gegensatz zwischen praktischer, reichhaltiger Erfahrung und dem Fehlen philosophischer Kompetenz offen zutage trat. Dieses alte Thema des Gegensatzes zwischen Praxis und Theorie tritt immer wieder auch da zutage, wo es um die ethische Reflexion, die moralische und instrumentelle Bewertung und Rechtfertigung von Handlungsmöglichkeiten konkreter Pflegefälle geht, besonders und immer wieder auch in Altenpflegeheimen und geriatrischen Abteilungen. Als Lehrbeauftragter für Pflegeethik und als Mentor für Philosophie habe ich in zahlreichen Gesprächen, Diskussionen und Korrekturen schriftlicher Arbeiten im Rahmen von Ethikseminaren regelmässig Einsicht in die Schwierigkeiten erlangt, die sich für Studierende und studierende Berufsleute aus Pflege und Medizin ergeben, wenn sie versuchen, aus dem breiten Bereich von ethischen Ansätzen bestimmte Begriffe, Modelle, Prinzipien, Tugenden oder Begründungsmethoden heranzuziehen, um sie dann mit ihren praktischen Berufserfahrungen in Verbindung zu bringen, indem beispielsweise ein ethisches Gespräch versucht wird. Eine Ursache für diese Schwierigkeit liegt meines Erachtens darin, dass in unseren Bildungsgängen kritisches Nachdenken über Begründungsmöglichkeiten, Denkansätze, Hypothesen oder Fragen nach der Geltung bestimmter Moralgebote kaum gepflegt wird. Dies zeigt nur schon ein Blick auf das Mauerblümchendasein, dass dem Fach Philosophie in einzelnen Kantonen (z.B. Zürich) zukommt. Gefragt sind stattdessen primär pragmatisch abgezweckte berufsbezogene Kompetenzen, das kritische Nachdenken können andere für uns übernehmen. Vor kurzem zählte man in der Schweiz allein 150 Ethikkommissionen, die in verschiedenen Bereichen solche Defizite zu kompensieren versuchten. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind die Fragen und die Entwicklung der Denkkompetenzen der je Betroffenen, insbesondere der älteren Menschen und derjenigen, die eng mit älteren Menschen zusammenarbeiten. Ein zweiter Grund liegt m. E. dann aber in den oft unvollständigen Auffassungen von Theorie und Praxis, die bei vielen Praktikern wie Theoretikern zu finden sind. Immanuel Kant hat einmal in einem Aufsatz mit dem Titel: „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ geschrieben, dass bei dem schwierigen Übergang von der Praxis zur Theorie bei misslingen es „nicht an der Theorie“ lag, „wenn sie zur Praxis wenig taugte, sondern daran, dass nicht genug Theorie da war, welche der Mann [Kant hat hier Ärzte und Rechtsgelehrte im Blick] von der Erfahrung hätte lernen sollen, und welche wahre Theorie ist, (…)“.83 83 Kant, Immanuel: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. In: Ders. Werke. Hrsg. V. Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1980, Band 9, S. 127. 120 Was hier fehlt, ist die berufs- oder lebensbegleitende periodisch zu vollziehende kritische Reflexion über diesen Theorie-Praxis-Zusammenhang. Nicht nur Theorien sollten gekannt werden, sondern es ist eine Theorie-Umgangskompetenz angesagt. Genau hier setzt Ethik als philosophische Ethik an: Sie versucht, die ethische Kompetenz der Nachdenkenden nicht nur mit minimal nötigen Begrifflichkeiten auszustatten, sondern insbesondere Ethik in Gespräch zu vollziehen. Hierzu zunächst eine Klärung des Begriffes der „Ethik“, an dessen Mehrdeutigkeit die Philosophie nicht ganz unschuldig ist. Die im gesellschaftlichen Diskurs weit verbreitet anzutreffenden Missverständnisse um die Begriffe Moral und Ethik gehen auf die schon in der Antike bei Aristoteles anzutreffende Mehrdeutigkeit des Begriffes „Ethik“ zurück. Mit dem kurzen e (espilon) geschrieben, bedeutet ethos Ge-wohnheit, Sitte. Aufgrund von ethos zu handeln bedeutet hier so zu handeln, wie man es je schon aufgrund der Gegebenheiten der Lebensherkunft gewohnt ist. Man folgt gewohnheitsmässig den beobachteten und sich bewährt habenden Handlungen der Mitbewohner. Mit langem ê (eta) geschrieben meint êthos zunächst Wohnung, Höhle, Asyl; dann aber die sich aus langandauerndem Gewohnheitshandeln und nun aus reflektierter Einsicht in die moralische Güte einer Handlung sich ergebende verfestigte Charakterhaltung. Ethos ist auch heute noch im deutschen Sprachgebrauch zu finden und bezeichnet in der Regel Sammlungen von Sätzen moralischer Grundwerte bestimmter Berufsgruppen (Berufsethos, etwa Hippokratischer Eid, ICN, Genfer Konvention, etc.). Ausgehend von diesen Unterscheidungen muss nun deutlich zwischen zwei Ethikbegriffen unterschieden werden, während ein dritter hier nicht im Vordergrund steht. Betrifft „Ethik“ einen bestimmten und schriftlich fixierbaren Satz bestimmter moralischer Prinzipien, Werte und Legitimationsstrukturen, wie sie etwa in zahlreichen Modellen und Ansätzen von Ethik zu finden sind (utilitaristische Ethik, Tugendethik, deontologische Ethik, angewandte Ethik, Tierethik, etc.) dann spricht man von einer Ethik, Ethiken oder ethischen Ansätzen. Sich unreflektiert auf solche Ansätze zu berufen, ist vorphilosophisch. Der zweite und für die praktische Anwendung viel wichtigere Begriff der Ethik meint einen reflexiv-diskursiven Vollzug ethischer Analyse: Hier werden Werthorizonte aufgezeigt, Begründungsweisen überprüft, Denkprozesse in Gang gesetzt, Problemlagen analysiert und offengelegt sowie Entscheidungsvoraussetzungen für ebenfalls je zu bestimmende Verantwortungsträger geschaffen. Ethische Diskurse zu vollziehen bedeutet, angewandte Philosophie zu betreiben. Insofern spricht man hier besser von angewandter philosophischer Ethik. Drittens kann man innerhalb des fachphilosophischen Binnendiskurses Ethik als „Wissenschaft vom moralischen Handeln“ bezeichnen. Hier geht es um Fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit von Ethik, Wert und Moral überhaupt sowie um die Entwicklung und Kritik alter und neuer Ethikmodelle. Schaut man sich nun an, wie in den vielen Ethiklehrbüchern und Richtlinien für Berufsleute diese Definitionen sich niedergeschlagen haben, zeigt sich ein heterogenes Bild: 121 "Ethik ist angewandte Philosophie. Sie sucht nach Antworten auf die Fragen: Wie soll der Mensch sein Leben gestalten? Wie soll er sich gegenüber seinen Mitmenschen verhalten? Welchem Ziel soll sein Handeln dienen? Die Ethik lehrt, die jeweilige Situation zu beurteilen, um das ethisch richtige Handeln zu ermöglichen. Die ethische Überlegung hat zum Ziel, unser Handeln mit unseren Werten in Einklang zu bringen."84 "Ethik (griech. "ethos", Sitte) ist eine Disziplin der Philosophie, die auch als Wissenschaft vom moralischen Handeln bezeichnet und als Synonym von Moralphilosophie gesehen wird."85 "Ethisch bedeutet in der Übersetzung des griechischen Wortes "ethos" zunächst den durch Gemeinschaft und Herkommen bestimmten Ort des Wohnens, Gesinnung, Haltung. Übertragen auf heutige Verhältnisse heisst das, dass sich Ethik mit allem befasst, was im Rahmen des gemeinsamen Wohnens bzw. Lebens Brauch und Sitte ist und somit auch die Einstellung und Gesinnung der Einzelpersonen mitbestimmt."86 Als Arbeitsdefinition und damit zum besseren Verständnis, wovon ich hier zu Ihnen spreche, schlage ich folgende Ethikdefinition vor, die gleichzeitig Missverständnisse ausräumen will: Philosophische Ethik Ethik ist sich vollziehende angewandte Philosophie. Sie zielt darauf, intersubjektiv nachvollziehbar bestehende und mögliche Werthorizonte aufzudecken und zu erweitern, Legitimationsvarianten aufzuzeigen, Reflexionsprozesse in Gang zu bringen, Problemlagen und Normenkonflikte zu analysieren, Handlungsoptionen zu entwickeln und zu gewichten sowie Entscheidungsvoraussetzungen zu schaffen. Sie wirft ebenso die Fragen auf nach den legitimierbaren Wertquellen, den zuständigen Verantwortungs- und Entscheidungsträgern. Ethik ist somit performativ. Ethik in diesem Sinne will nicht von Verantwortung entlasten, Vorschriften machen, bestimmte Werte vermitteln, Entscheidungsträger sein, moralische Defizite kompensieren. Philosophische Ethik ist nicht moralische Ratgeberin, sondern zeigt den Betroffenen die Vielfalt der Antwortregister. Philosophische Ethik ist somit eine Rätegeberin. Philosophische Ethik will Werthorizonte aufzeigen Legitimationsmöglichkeiten aufdecken Reflexionsprozesse in Gang bringen Problemlagen und Normenkonflikte analysieren Handlungsoptionen entwickeln und gewichten Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen schaffen Rätegeberin sein Philosophische Ethik will nicht Von Verantwortung entlasten 84 Aus: Ethische Grundsätze für die Pflege. Hg. vom Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger. Bern 1990 (Nachdruck 2000), S. 15. 85 Schayck, A. van: Ethisch handeln und entscheiden. Spielräume von Pflegenden und die Selbstbestimmung des Patienten. Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 15. 86 Plenter, Christel: Ethische Aspekte in der Pflege von Wachkoma-Patienten. Orientierungshilfen für die Pflegeethik. Hannover 2001, S. 75. 122 Vorschriften machen (Ethik ist nicht Moral und auch nicht Ethos) Bestimmte Werte vermitteln Entscheidungsträger sein Moralische Defizite kompensieren Ratgeberin sein 7.2.3 Wie könnte eine Ethik des Alters aussehen? Die demographische Entwicklung westlicher Gesellschaften hin zu einer eigentlichen Altersrevolution (2050 sei die Hälfte der Menschheit über 60 Jahre alt), die gestiegene Lebenserwartung, das Problem der Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen und die moderne Vielfalt an Möglichkeiten, menschliches Handeln moralisch legitimieren zu können führen unter anderem zur Frage, ob die Entwicklung tragfähiger gerontologischer Ethiken angebracht ist. Analog zu anderen Bereichsethiken wie Medizinethik, Tierethik, Ökologischer Ethik, Wirtschaftsethik etc. wäre eine Ethik der Gerontologie ihrem Gegenstand, dem Alter als Zustand und dem Altern als Prozess anzumessen. Die Denk- und Problemgeschichte der Ansätze philosophischer Ethikmodelle ist derart vielfältig, dass es durchaus möglich ist, eine gerontologische Ethik zu konzipieren. Zunächst sind dafür die verschiedenen Ebenen zu nennen, auf denen ein solcher Ansatz zu greifen hat. Zum einen wäre die personale Ebene zu nennen: Träger der ethischen Auseinandersetzungen wären die Individuen eines bestimmten Gesellschaftssegmentes, insbesondere dabei nicht etwa nur alte Menschen, sondern Menschen aller Altersgruppen. Neben dem Vermitteln und Entwickeln ethischer Kompetenz wäre neu wäre die Frage in die Diskussion einzubringen, wann und wie im Bildungsgang Menschen mit dem Thema des Alterns und dessen ethisch relevanten Aspekten zu konfrontieren wären. Zweitens ist die soziale Ebene zu nennen: Ob, und wenn ja, wie liesse sich eine gerontologische Ethik in allgemein verbindlichem Sinne, gegebenenfalls gar mit rechtlichen Sanktionierungsmöglichkeiten, politisch und gesellschaftlich institutionalisieren? Im Zentrum steht hier die Frage, ob ethische Richtlinien in der Form von Handlungsempfehlungen so gestaltet werden können, dass sie über ihre Vorhandenheit hinaus auch permanent angewendet und periodisch den rasanten technologischen Entwicklungsmöglichkeiten angepasst werden können. Stichwort: Nachhaltigkeit. Drittens gibt es die Ebene der allgemeinen theoretischen Fassung einer gerontologischen Ethik: Welche Komponenten, welche Argumentationsmuster, welche Werte, Prinzipien, Tugenden und Legitimationsmittel scheinen einer Altersethik angemessen? Hier gibt es zahlreiche zum Teil sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Zu berücksichtigen gilt es hierbei insbesondere, dass aus dem Problem des mit dem Altern verbundenen möglichen Prozesses des Autonomieverlustes (infolge Demenz, Senilität, Morbus Alzheimer, etc.) eine Möglichkeit gefunden werden muss, die eine mögliche Diskriminierung dieser Gruppen von alten Menschen im Hinblick auf ihre je zu bewahrende Würde auszuschliessen vermag. In ähnlichem Sinne muss bei Autonomiegewinn dafür gesorgt werden, dass sich ältere Menschen weiterhin uneingeschränkt von gesellschaftlichen negativ besetzten Altersbildern frei zum Ausdruck bringen können und am gesellschaftlichen Leben solange als möglich teilnehmen können. Mit dieser groben Unterscheidung werden einige der vielfältigen Anknüpfungspunkte einer gerontologischen Ethik angedeutet. Davon sollen nur zwei kurz ausgeführt werden. 123 7.2.3.1 Die individualethische Komponente: Ethische Kompetenz Wenn wir Ethik in letzterem Sinne als philosophische Ethik auffassen, dann kann eine Ethik im Alter keine konkreten Handlungsanweisungen geben, da sie ja dann gerade zu einer Moral des Alters führen würde, die in einem bestimmten Kontext gepflegt, befolgt und in Kraft gehalten wird. Eine philosophische Ethik im Alter hingegen bemüht sich darum, die jeweilige, selten bewusste kontextuelle Gebundenheit moralischer Gebote zu erkennen, zu benennen und auf mögliche Geltung hin zu hinterfragen. Warum sollen alte Menschen bestimmte Gebote oder Handlungsempfehlungen befolgen? Ausübende dieser philosophischen Ethik sind ältere Menschen selbst, sowie alle Personen, die mit ihnen zusammenleben oder ihr Leben helfend unterstützen, also Angehörige, Pflegende, Ärzte, Gerontologinnen sowie alle weiteren Personen, die hier freiwillig oder beruflich mitarbeiten. Eine über längere Zeiträume sich erstreckende Auseinandersetzung mit altersrelevanten Fragen wäre hierbei ein zu verwirklichendes Desiderat. Es sind dies Fragen nach der Lebensgestaltung, den Wertveränderungen, der sich verändernden Anzahl und Intensität sozialer Kontakte, (Isolation) der Veränderungen der je unterschiedlichen Autonomiegrade (Zuwachs und Abnahme!), der Lebensbilanz, des Sterbens, der Gesundheit und Krankheit des Todes, etc. Sich mit solchen Fragen präventiv und spielerisch auseinanderzusetzen ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil viele Menschen erst in existentiell bedrohlichen Situationen beginnen, sich ernsthaft mit solchen Fragen zu beschäftigen, dann aber meist die Zeit knapp wird, zu knapp für eine intensive und einigermassen gründliche gedankliche Auseinandersetzung. Ein vorgängiges Einüben ethischer Reflexion bringt den Ausführenden ein deutliches Mass an Autonomiegewinn, durch den das Nachdenken über die aktuellen Schwierigkeiten eines bevorstehenden Entscheides in einem ethischen Dilemmafall oder zum eigenen Rollenverständnis argumentativ begründet in Frage gestellt werden können. Die hier nur angedeutete ethische Kompetenz setzt sich aus zweierlei Komponenten zusammen. Deklaratives Wissen Kennen unterschiedlicher Ansätze der Ethik Kennen wichtiger Begriffe Kennen von Argumenten Prozessuales Vollziehen (keine Technik!) Diskursfähig werden und bleiben Regelumgangskompetenz entwickeln Ethische Gespräche führen Der Philosophie, also engagierten Philosophinnen und Philosophen käme hier die didaktische Vermittlerrolle zu: Sie kann ethische Kompetenzen im spielerisch-ernsthaften Vollzug interessierten älteren Menschen und allen, die es einmal werden oder mit alten Menschen beruflich zu tun haben, vermitteln. Dies ist möglich in der Diskussion und Auseinandersetzung mit altersrelevanten philosophischen Texten oder mit entsprechenden Themenschwerpunkten. Hier nun aber ein Einwand aus gemachten Erfahrungen praktischer Philosophie (mit Kindern und Menschen aller Altersgruppen): Praktische Philosophie zu verordnen ist nicht unproblematisch. In der Regel sind es für eine bestimmte Fragestellung sensibilisierte 124 Menschen, die einer Frage in einer bestimmten, kaum mit Stundenplänen zu vereinbarenden Zeiten nicht bloss auf den Grund, sondern auf die Gründe gehen möchten. Andere sind philosophisch nicht einfach so ansprechbar und reagieren befremdet oder abwehrend („Nur keine Grundsatzdiskussion!“ – ohne zu wissen, was das ist oder bringen könnte). These 1: Die individualethische Komponente einer Ethik für das Alter deckt sich mit der philosophischen Ethik. Ihren Ausdruck und Niederschlag könnten individualethische Komponenten in verschiedenen institutionellen Formen finden: Philosophische Cafés für Senioren mit Themenschwerpunkt Alters- und Lebensfragen Ethikforen für Senioren mit Falldiskussionen aus ethischer Sicht Ethikberatung für Patienten und Angehörige Ethikcafés in geriatrischen Abteilungen von Spitälern und geriatrischen Pflegeheimen Humanberater (Psychologen / Theologen / Philosophen) in Spitälern Ethik für Demente im Frühstadium und Angehörige Ethik in Medizin- / Pflege-/ Gerontologieausbildung und Fortbildung Städtische Ethikanlaufstellen Home-Page mit ethischen Dilemmafalldiskussionen (gelungene und misslungene) 125 7.2.3.2 Die sozialethische Komponente: Gerontologische Ethik für alle 7.2.3.2.1 Gerontologische Ethik für pflegebedürftige ältere Menschen Im Bereich der Geriatrie und der Krankenpflegeheime älterer Menschen sind die oft polymorbiden Patienten, die Pflegenden, die Ärzte und die Angehörigen Träger der Auseinandersetzung, Entscheidung und Verantwortung ethischer Fragen und Konflikte. Eine gerontologische Ethik könnte so aussehen, dass in Frage kommende Werte, Prinzipien und Argumentationsstrukturen in ethischen Gesprächen behutsam eingeführt werden. Dies setzt zunächst den Einbezug ethisch kompetenter Fachpersonen voraus, die ggf. die für ethische Diskurse nötigen Kompetenzen nachhaltig den Berufsleuten zu lehren vermögen. Andere Möglichkeiten bestehen darin, ständige Ethikfachleute anzustellen (wie in den Niederlanden Philosophen, Theologen oder Psychologen als sog. „Humanberater“ angestellt sind), oder aber in Konfliktfällen externe mobile Ethikberatung beizuziehen. Wichtig ist hierbei die Beachtung, dass eine gerontologische Ethik weder anzugeben weiss noch vorzuschreiben hat, was im Einzelfall je gut und moralisch geboten scheint, sondern es einzig unternimmt, durch eine differenzierte Fallanalyse und der Beschreibung unterschiedlicher Handlungsalternativen samt der damit verbundenen moralischen Vor- und Nachteile aus verschiedenen Perspektiven und Legitimationsmöglichkeiten zu bestimmen, um so den differenzierten Blick auf die Problemlage zu eröffnen. Eine gerontologische Ethik darf nicht Gegenstand der Instrumentalisierung oder Kompensation werden, da die Frage nach dem oder den Verantwortungsträgern selber jeweils Gegenstand des unter den Betroffenen geführten ethischen Gespräches ist. Es genügt also nicht, ausschliesslich Theologinnen oder Therapeuten einer bestimmten Gattung anzustellen. Nicht, dass enge normative Konzepte des guten Lebens als solche des Teufels wären, aber wer sie in der Philosophie sucht, hat sich, so Helmuth Plessner, „in der Adresse geirrt.“87 Als Ausgangspunkte für ethische Gespräche können Modelle ethischer Entscheidungsfindung dienen, von denen es mittlerweile eine ganze Palette unterschiedlicher Provenienz gibt. Wichtig wäre hier, sich nicht auf eine irgendwie in solche Modelle hineingelegte und vorherbestimmte Geltung zu verlassen, sondern jeden Punkt kritisch durchzudenken und mit den von den Betroffenen eingebrachten Wertvorstellungen zu vergleichen. Erst dadurch kann die gewünschte Regelumgangskompetenz entstehen. Dabei ist zwar ein Konsens anzustreben, aber nicht um des Konsens Willen selbst: Es gibt schwierige ethische Dilemmata, die einen befriedigenden Konsens auch nach mehrfacher Anwendung verschiedener Entscheidungsfindungsprozeduren nicht zulassen und im Dissens enden. Dennoch muss entschieden werden: Die gefällte Entscheidung basiert dann aber nicht auf einem erzwungenen Konsens, sondern gründet in eine offene Problemlage, einen Unterbau der Ausweglosigkeit (die paradoxerweise darin besteht, dass es nicht keine, sondern zu viele nur halbwegs gangbare Auswege gibt) die alle Beteiligten als solche zur Kenntnis genommen haben. 7.2.3.2.2 Gerontologische Ethik für alle Generationen Gesamtgesellschaftlich betrachtet liegen ethische Konflikte nicht nur akut in medizinischen oder pflegerischen Dilemmasituationen vor, sondern werden auch aus den unterschiedlichen und konfligierenden Vorstellungen vom Alter, vom Leben und vom Menschen erzeugt. 87 Schürmann, Volker: Heitere Gelassenheit. Grundriss einer parteilichen Skepsis. Magdeburg 2002, S. 10. 126 Betrachtet man philosophische und literarische Texte zum Thema Alter, so zeigen sich darin nicht etwa nur schwarz-weiss Bewertungen über alte Menschen, sondern genauer vier vorherrschende Altersdiskursformen Alterstrost, Altersklage, Alterslob und Altersschelte88 . Wer allerdings danach fragt, was Alter sei, der erfährt wenig bis nichts über das Alter, dafür aber sehr viel über die moralisch-didaktischen Absichten der Autoren und deren Altersbilder; ihre belehrenden Absichten gelten üblicherweise jüngeren Menschen, die von ihrer Argumentation überzeugt werden sollen. Doch es ist (die Altersforschung in Ehren) philosophisch betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir nicht genau wissen, was Alter eigentlich ist. Denn: Dass man geneigt ist, ältere Menschen (wie übrigens auch Kinder) in bestimmten Hinsichten als noch nicht bzw. nicht mehr vollständig und damit als weniger wertvoll einzustufen, hat seinen Ursprung in den negativ besetzten Altersbildern in unseren Köpfen. Warum nur entwerfen wir ältere Menschen so oft als Fremde? Deshalb (obwohl eigentlich peinlich) These 2: Ältere Menschen sind in erster Linie Menschen wie alle übrigen. Es gibt keinen an Altersdefinitionen festmachbaren Grund, sie anders zu behandeln. Anzumerken gilt es hierzu, dass daran nicht etwa das inzwischen recht reichhaltige Definitionsangebot der Altersforschung schuld ist, sondern die fehlende ethische Kompetenz zahlreicher noch nicht alter Menschen, mit Klassifikationen in nicht entwürdigender Weise umgehen zu können. Da wir aber beim status quo negativ besetzter Altersbilder ansetzen müssen, folgt These 3: Das negative Altersbild muss gesamtgesellschaftlich ausgeglichen werden. These 4: Die gesellschaftlichen Potentiale des Alters werden nur unzureichend genutzt, wir brauchen ein neues Leitbild der Zuordnung von Bildung und Arbeit im Lebensverlauf. Dazu ist bei den jüngeren Generationen ein Gesinnungswandel nötig, der das jeweilige Bild und den Wert des Alten und Alterns betrifft. Neben den hier nicht weiter ausgeführten Massnahmen des Ethik- und Philosophieunterrichts an Schulen sowie den architektonisch-baulichen Massnahmen (keine Altensiedlungen, sondern generationenübergreifende multifunktionale Wohnungen, die individuelles und soziales Leben bis ins hohe Alter ermöglichen), sei hier nur eine weitere Möglichkeit etwas ausgeführt. APV: Alterspflege-Vorsorgedienst im umgestalteten Lebensverlauf Eine in der Schweiz altbekannte, aber bislang nicht realisierte Möglichkeit, eine erwünschte Umwertung bestehender negativ besetzter Altersbilder hin zu einer Haltung der Achtung des Alters zu erzeugen, wäre ein z.B. vor dem sechzigsten Altersjahr von jedem Bürger zu erbringender Altenpflegedienst, der ihm auf einem Konto gutgeschrieben würde. Später selbst alt und pflegebedürftig geworden, könnte er diese Leistung von jüngeren Generationen in Anspruch nehmen. Wer zu einem solchen Pflegdienst nicht fähig oder willig ist, zahlt entsprechend einen deftigen Pflegedienstersatz. 88 Göckenjahn, Gerd: Das Alter würdigen. Altersbilder und Bedeutungswandel des Alters. Frankfurt a.M. 2000, S. 42ff. 127 Die damit verbundenen Möglichkeiten der Einsparung von Gesundheitskosten wären allerdings sekundär einzustufen gegenüber dem Gewinn an Sensibilisierung des Altersbildes und der damit möglichen Erweiterung ethischer Kompetenz in einer auf Überalterung zustrebenden Gesellschaft. Analog zu den Elementen des drei Säulen Modells (1. AHV, 2. BVG Berufliche Vorsorge, 3. a. gebundene Vorsorge b. freie Vorsorge) könnte man als 4. Säule einen APV, einen Alterspflege-Vorsorgedienst einrichten. Um ihre bestehenden Werte in einem Gedankenspiel aufzulockern: Für gewisse Militärdienstuntaugliche oder –unwillige besteht ja der Zivildienst, der z.T. Pflegefunktionen abdeckt. Stellen Sie sich nur kurz vor, der Zivildienst wäre nicht als Strafe für militärische Untauglichkeit bewertet – sondern umgekehrt: Wer nicht fähig oder willig ist, Pflegedienst zu leisten, muss zur Strafe ins Militär oder einen Ersatz zahlen. Diese Lösung kann von verschiedenen Ethikansätzen legitimiert werden. Deontologisch könnte man ein Gerechtigkeitsprinzip stark machen, das auf einem „phasenverschobenen Freiheitstausch“89 basieren könnte. Die jüngere Generation spendet aus freier Entscheidung der älteren Generation einen Pflegedienst, den sie später von den jüngeren Nachfolgegenerationen phasenverschoben einfordern kann. Tugendethisch hingegen liesse sich argumentieren, dass nicht irgendwelche Prinzipien veranschlagt werden können, sondern es Sache rational unabhängiger Subjekte sein muss, in einem nächsten Schritt Tugenden der anerkannten Abhängigkeit90 zu entwickeln, die sich gemäss einer Art goldener Regel innerhalb eine Gesellschaft entfalten können. (Was du selber als Elternteil deinen Kindern an Zuwendungsleistungen weitergegeben hast, das erwartest du auch von deinen Kindern zurückzubekommen, wenn diese erwachsen und du alt bist.) Voraussetzung wäre dazu ein gesellschaftlicher Kontext, der aus je bereits tugendhaft handelnden Menschen besteht, so dass sich bei den Nachfolgegenerationen aufgrund von Vorbildorientierung die gewohnheitsmässige Befolgung solch altruistischer Dienste allmählich zu einer Charaktereigenschaft bzw. ethischen Grundhaltung verfestigt (hierauf beruht auch der Ansatz von Aristoteles). Utilitaristisch könnten entweder die entstehenden ökonomischen, gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Folgen kalkuliert werden oder etwa ein Begriff der Verantwortung für spätere Generationen (Hans Jonas) zu Begründung herangezogen werden. Als goldene Regel der gerontologischen Ethik könnte (in Anlehnung an Höffe, 2002, S. 199) hierzu formuliert werden: Was du als Patient nicht willst, das man dir tut, das füge als Pflegedienst Leistender auch keinem anderen als Patienten zu! Zur Umgestaltung der verbreiteten Lebensverlaufs-Struktur, dass Junge sich zu bilden, Mittelalterliche zu arbeiten und Ältere sich der Freizeit widmen sollten, haben Riley, M. und Riley J.W. eine altersintegrierte Lebensverlaufs-Struktur vorgeschlagen91. Alle drei Bereiche (Bildung / Arbeit / Freizeit) sollten für alle Altersklassen durchgängig lebbar werden. 89 Höffe, Otfried: Medizin ohne Ethik? Franfkurt a.M. 2002, S.194. MacIntyre, Alasdair: Die Anerkennung der Anhängigkeit. Hamburg 2001. 91 Riley, M. / Riley J.W.: Individuelles und gesellschaftliches Potential des Alterns. In: Baltes, P.B. / Mittelstrass, J. (Hrsg.): Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung. Berlin 1992. 90 128 Typen gesellschaftlicher Lebensverlaufs-Strukturen Abgewandelt nach: Riley, M.; Riley, J. W.: Individuelles und gesellschaftliches Potential des Alterns. In: Baltes, P.B.; Mittelstrass, J. (Hrsg.): Zukunft des Alterns und gesellschaftliche Entwicklung. Berlin 1992 altersdifferenziert Bildung Arbeit Freizeit / Pflegebedarf Bildung altersintegriert Freizeit Pflegebedarf Arbeit APV: Pflegedienst z.B. 1 Jahr Alter: jung mittel älter alt Das Viersäulenmodell 1. 2. 3. 4. Säule: AHV Säule: BVG Säule: a) gebundene b) freie Vorsorge Säule: APV: Alters-Pflege-Vorsorge D. Bremer 07.03.03 129 7.2.4 Wo fängt eine solche Ethik an, wo hört sie auf? (Ansatzstellen, Methoden) Letzte Woche erschien in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel 92, in dem sich ein Autor die Mühe nahm, eine Werbekampagne der Stiftung für Gesundheitsförderung kritisch zu hinterfragen. In dieser Werbekampagne geht es (angeblich) darum, die Aufmerksamkeit der Leser für aktuelle moralische Gebote aus dem Gesundheitswesen zu gewinnen durch Sprüche wie „Friss das Doppelte!“ und ähnliche ironische moralische Imperative. Ohne hier auf die sachliche Angemessenheit dieser Kritik eingehen zu wollen, kam das aktuelle Defizit einer moralfreien Diskussion über Moral und deren möglicher und vielfältiger Begründungen deutlich zum Ausdruck. Allerdings verkennt der Autor klar, dass bereits die grundlegendsten Unterscheidungen der philosophischen Ethik genügt hätten, um das dieser Stiftung unterstellte Missverständnis auszubügeln. Die philosophische Ethik bemüht sich ja gerade nicht darum, bestimmte moralische Gebote vorzuschreiben, sie ist nicht präskriptiv. Die philosophische Ethik versucht, Moralbegründungsstrategien zu untersuchen und gegebenenfalls neue Strategien von solchen Begründungen zu entwickeln oder zusammenzustellen. Ob und wie sich solche Begründungsstrategien im praktischen Moralkonflikt oder ethischen Dilemmafall bewähren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Diese hängt von den je aktivierbaren ethischen und kommunikativen Kompetenzen und den raumzeitlichen Gegebenheiten aller Betroffenen in einem Einzelfall ab. Es wäre vermessen, stillschweigend bei einer moralischen Aufrüstungskampagne davon auszugehen, dass sich Menschen gemäss einem bestimmten Menschenbild verhalten werden. Allerdings schneidet dieser Artikel eines der Grundprobleme aller Bemühungen um Ethik und Moralvermittlung seit jeher an: Können und sollen Menschen, und wenn ja, wie können Menschen dazu gebracht werden, sich an bestimmte, gerade als „richtig“ oder „wertvoll“ empfundene moralische Sätze und Regeln zu halten? Die Grundfrage ist zunächst, ob man sich für eine Auseinandersetzung und Bemühung um Moral und deren ethische Begründung überhaupt einlassen möchte. Ob dieses Sich-einlassen-auf selbst wertvoll ist oder neutral oder gar schlecht, ist bislang nicht entschieden. Es gab und gibt viele Ethiker, die sich um solche Modelle bemühen, es gibt aber auch Philosophen, die grundsätzlich davon abraten und etwa eine „Ethik des Moralverzichts“ propagieren (wie z.B. Norbert Bolz). Es geht mir hier in keiner Weise darum, diese gegeneinander argumentativ auszuspielen, sondern vielmehr darum, darauf aufmerksam zu machen, dass sich all diese vielen Bemühungen um oder gegen „Ethik“ aus einem gemeinsamen Bereich erheben: Den in unserer Alltagssprache vorfindlichen Wörtern „Moral“, „Wert“, „Geltung“, „Sollen“, „Gewissen“, „Ethik“, etc., die früher oder später in den je eigenen Bezugsrahmen mindestens vorübergehend Einzug halten werden. Man kann nicht konsequent „Moralabstinenz“ für sich beanspruchen, ohne irgendwann, und sei es erst bei eigener Krankheit im Alter, in eine ethische Dilemmasituation als Betroffener hineinzugeraten. Das bedeutet, dass ein Ansatzpunkt für eine Auseinandersetzung mit Ethik die Sprache des Alltags sein kann. In philosophischen Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen lässt sich sehr gut erfahren und zeigen, dass bestimmte Denkstrukturen und Argumente, die sich in 92 Becker, Thomas A.: Krankheit als soziales Risiko. Schwierigkeiten einer wirksamen Gesundheitsförderung. Neue Zürcher Zeitung Nr.54 vom 06.03.2003, S. 15. 130 differenziert sprachlich ausgearbeiteter Form bei bekannten Philosophen finden, bereits im Kern in den Aussagen der philosophierenden Kinder erkennbar sind und von ihnen kritisch durchdacht werden. Als ich zu Beginn der Neunziger Jahre selber viele solche Gespräche mit Kindern geführt habe, haben sich immer wieder verblüffend viele Zugangsweisen des Denkens zur Welt und zum Leben gezeigt, wenn bestimmte Grundfragen gestellt waren. Ein ähnliches Bild (ohne hier in irgendeiner Weise das krude und hochproblematische Gleichsetzungsparadigma, ältere Menschen seien Kindern gleich heraufzubeschwören) zeigt sich bei philosophischen Gesprächen mit älteren Menschen. These 5: Ansatzpunkte für ethische Gespräche sind je die Sprachen des Alltags, aus denen heraus sich Werte, Geltungsansprüche, Moralbegründungen etc. erheben. Erst im situativen Bedarfsfall werden neue ethische Begriffe behutsam verankert. Allerdings – und hier kommt ein erster Einwand, den ich mit Aristoteles teile – längst nicht alle Menschen sind über den Weg ethisch-philosophischer Auseinandersetzung für die Etablierung moralischer Werte oder der Vermeidung moralischer Unwerte zu gewinnen. So kann man zwar Schulstunden, Seminare, Kolloquien, Ethikcafés oder Diskussionsrunden strukturell und institutionell konzipieren, doch ein Gelingen ethischer Reflexion kann damit allein noch lange nicht erzwungen werden. Wenn vernünftige – d.h. offene und sachbezogene Gespräche über Wertprobleme – nicht gelingen können, dann bleiben wenige Alternativen, um das menschliche Verhalten ändern zu wollen. Dies wird besonders deutlich bei Werbekampagnen, die oft gar das Gegenteil davon bewirken, was sie ursprünglich beabsichtigt haben. Man kann dann oft nur mit den fragwürdigen Mitteln der Gewalt operieren – sei es passivem Widerstand (eine Instanz, die sich ungeachtet ihres Misserfolges notorisch dennoch für irgendwelche Werte einsetzt – den Konsequenzumwertungseffekt erhoffend) – sei es der aktiven Gewalt im Sinne von Androhung rechtlicher Sanktionen und ökonomischer Konsequenzen. Nun gäbe es selbstverständlich noch sehr viel mehr zu dem bislang Angeführten zu sagen, auszuführen und zu präzisieren, doch ich überlasse jetzt unsere Raumzeit ihren Fragen und danke für ihre Geduld und Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen bezüglich des Themas „Ethik im Alter“ das eine oder andere Licht aufgegangen ist, auch wenn es nur die Trübheit einer Petrolfunzel erreichen sollte. 131 7.3 Aspekte performativer Ethik Regelumgangskompetenz als Desiderat für eine performative Ethik Werden aus ethischen Diskursen Regeln oder Handlungsempfehlungen entwickelt, so ist darauf zu achten, dass diejenigen, die sich an der Anwendung solcher Empfehlungen versuchen, auch eine "Regelumgangskompetenz" mitvermittelt wird. Oft lässt sich bei regelfolgenden Menschen in Dilemmasituationen das Verhalten beobachten, dass sie der Regelbefolgung unbedingten Wert beimessen und nicht selten ihre ganze Person in Frage stellen: "Wie konnte dies geschehen, ich habe doch genau die Regel befolgt!" Das Problem, das sich hier ergibt, hat seine Wurzeln in der grundsätzlichen Annahme einer Zwei-Welten-Ontologie: Hier sind die handelnden und falliblen Menschen, dort sind die festen, geltenden und unbedingt gebietenden Regeln, denen man zu folgen hat. Es ist hilfreich, sich versuchsweise diesem Zweiweltendenken zu entziehen, indem man sich vorstellt, dass "Regelfolgen" auch etwas ganz anderes bedeuten könnte. Wie wäre es, wenn es nur primär ein Handeln gibt, an dem sich dann sekundär Regeln zeigen? Versuchen Sie sich vorzustellen, dass sie eine ganz gewöhnliche Handlung nicht verrichten, indem Sie einer Regel folgen, sondern indem sie einfach handeln... Versuchen wir, uns dies klarer zu machen. Ist man, wie man oft meint, bei der angeblichen Tätigkeit des "Regelbefolgens" wirklich sicher, ob das, was man macht, der gebietenden Regel wirklich entspricht? Ist es nicht vielmehr so, dass wir dies gar nicht feststellen können und eher bemerken, dass wir zwar vorgeben, dies und das gemäss jener Regel zu tun, bei genauer Beobachtung die einzelnen Ereignisse unseres Handelns aber einzigartig in ihrer Erscheinung sind? Angenommen, Sie nehmen sich vor, eine Studie zu verfassen um darin einige ihrer durch Beobachtung gewonnenen Daten zu verallgemeinern. Welche Bedeutungsverschiebungen ergeben sich dabei bei den einzelnen Daten, wenn sie einem Verarbeitungsprozess unterworfen werden? Ist die fünfzigste Datenerfassung des angeblich selben Datums wirklich von derselben Art, wie etwa die erste? Man kann sogar etwas scheinbar so Festgefügtes wie einen mathematischen Beweis betrachten, bei dem man gewöhnlicherweise voraussetzt, dass ein Begriff auf Zeile eins immer noch genau dasselbe bedeutet, wie in Zeile fünfzehn. Doch ist dies beim gedanklichen Nachvollzug auch so erfahrbar? Ist es nicht viel eher so, dass sich die Bedeutung eines bestimmten Begriffes immer fortwährend ändert, wenn mit ihm gedanklich, schriftlich oder verlautbart im Sprechen gehandelt wird? Wäre dies so, so entstünde Bedeutung fortwährend im je aktuellen Handeln neu, sie läge dann nicht irgendwo (wo eigentlich?) für unser Handeln ein für allemal bereit, um von uns mehr oder weniger gut angewandt zu werden. Daraus ergeben sich ganz andere Betrachtungsweisen für den Umgang mit Welt, die man wegen ihres Vollzugscharakters z.B. in Form einer performativen Ethik zu fassen versuchen könnte. Dazu würde ein Repertoire an unterschiedlichen ethischen Weltzugangsweisen gehören, die je nach Situation als Ausgangspunkte gewählt werden können, damit sich der je singuläre ethische Diskurs entwickeln kann. Eine Weltzugangsweise besteht aus einem kategorialen Bezugsrahmen, der verschiedene Prinzipien, Begriffe, Argumente, Prämissen, eine bestimmte Logik etc. enthält. 132 Konsequenzen für eine Pflegeethik Welche Konsequenzen würden sich hieraus für einen pflegeethischen Diskurs ergeben? Zunächst müsste eine Pflegeperson davon ausgehen, dass es nicht auf der einen Seite ethische Theorien und gutgemeinte abstrakte Werte, Prinzipien, Regeln oder Tugenden gibt und auf der anderen Seite unfähige Menschen, die sie nicht praktisch umsetzen können. Man kann versuchen, sich von diesem Modell zu lösen und ein prozessuales Modell zu denken. Hier ergeben sich Bedeutungen ethischer Termini erst in der konkreten Anwendung, sie sind daher nicht verpflichtet, irgendwelchen apriorisch festgelegten Werten und Normen um derentwillen zu folgen, sondern konstituieren im interpersonalen Diskurs ihre Werte direkt selber. Was aber sind dann "Regeln"? Regeln könnte man in diesem Modell als eine Art Wegweiser betrachten, die eine Erinnerungs- und Instantiierungsfunktion aufweisen - uns also bestenfalls darauf aufmerksam machen können, dass z.B. ethisch diskutiert werden könnte. Was danach im konkreten Vollzug geschieht, ist aber etwas je Einzigartiges, selbst wenn man meint, verallgemeinerte Ähnlichkeitsstrukturen angeblich je gleicher Handlungen ausmachen zu können. Dieses "Ausmachen" ist selbst wieder ein performativer Akt, der sich im Vollzug andauernd verändert und Bedeutungsverschiebungen erfährt. Für die Etablierung eines ethischen Diskurses in der Pflege würde dies bedeuten, dass ein solcher solange besteht, als er aufrechterhalten und "gelebt" wird durch Vollzug. Was dann genau entsteht, weiss man nicht so sicher - denn das Identitätsproblem, das darin besteht, dass wir z.B. nicht verifizieren können, ob wir das, was wir vor einer Stunde getan haben, genau dasselbe ist, was es gewesen sein sollte nach unserem jetzigen Urteil, bleibt virulentermassen ungelöst, solange kein brauchbares Identitätskriterium zur Hand ist. Konkret ergibt dies eine ganz andere, erweiterte Perspektive beispielsweise für das pflegepädagogische oder pflegeethische Handeln. Es wird dann nicht ein festgefügter und bewerteter Lerninhalt transportiert, sondern ausgehend von gewissen Hinweisen, von denen aus die Lehrperson in eine scheinbar bestimmte Richtung einen ethischen Lehrdiskurs anhebt, ergeben sich fortwährend Bedeutung und Wert als sekundäre Effekte für die konkret diesen singulären Prozess Vollziehenden zur Zeit tx am Ort sx,y,z. Philosophiegeschichtlich vorbereitet findet sich dieser Ansatz in Ludwig Wittgensteins sog. "Spätphilosophie", im aphoristisch ausgeführten und postum veröffentlichten Buch "Philosophische Untersuchungen", wobei man allerdings zeigen kann, dass dieser Ansatz bereits in seiner nur vordergründig analytischen Frühschrift "Tractatus logico-philosophicus" angelegt ist. Weitere Vorläufer sind Heraklit, Spinoza und Nietzsche, einige moderne Ethiker93 neigen diesem Ansatz nach den gescheiterten oder unbefriedigenden Versuchen, Ethik als Diskursethik (K.O. Apel, J. Habermas) durch Regeln und Regelbefolgung zu begründen, wieder vermehrt zu. Beispiel A: Krankenpflegerin Carla hat, weil sie es, wie sie selber überzeugt ist, unterlassen hat, einen Patienten auf die Wichtigkeit des Verfassens einer Patientenverfügung aufmerksam zu machen, Schuldgefühle, als der Patient komatös geworden ist. Sie sprechen mit Carla, deren Verhalten von hoher seelischer Belastung zeugt. Aufgabe: Versuchen Sie, Carla 93 Wirth, Uwe (Hrsg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt a.M. 2002 (stw1575). Siehe auch: Bayertz, Kurt (Hrsg.): Moralischer Konsens. Technische Eingriffe in die menschliche Fortpflanzung als Modellfall. Frankfurt a.M. 1996 (stw 1251). 133 a) aus Sicht einer Zwei-Welten-Ethik (egal, welches Modell) und b) aus Sicht einer performativen Ethik einen ihre (wie auch immer gerechtfertigten) Schuldgefühle lösenden Einfluss zu erwirken, damit sie wieder befreiter auf Pflegepatienten einzugehen vermag. Beispiel B: Ein nun komatöser Patient hat eine Patientenverfügung gemacht, Sie wissen davon. Die beteiligten Ärzte offenbar nicht. Nun bringen Sie ihr Wissen darum in den Diskurs ein und begründen dies damit, dass dem Willen des Patienten unabhängig von der jetzigen Situation unbedingt Folge zu leisten ist. Aufgabe: Was ist wichtiger: Das Vorhandensein der Patientenverfügung oder Ihr performativer Akt seiner Einbringung in den aktuellen Diskurs? Wodurch erhält das Dokument seinen Wert? Liegt er im Dokument selbst "eingelagert"? Oder entsteht der Wert erst dadurch, dass Sie jetzt diese Verfügung wertend in den Diskurs einbringen? 7.4 Narrative Ethik Den Menschen als geschichtenerzählendes Wesen aufzufassen – als homo historiae narrans – ist eine Auffassung, die sich aus der Kritik an der analytischen Philosophie in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ergeben hat. Wegweisend waren Philosophen wie Arthur C. Danto mit seiner Kritik an der analytischen Geschichtsphilosophie oder Stanley Cavell, der die Autobiographie in den Denkraum der Philosophie einbezogen hat. Für die Ethik im Gesundheitswesen hat Howard Brody94 die Narrativität stark gemacht. Eine narrative Ethik würde zum Leitprinzip erheben, dass sich Werte oder Orientierungen in Wertkonflikten weder aus abstrakten Prinzipien, noch aus Folgen, Gefühlen, Gewissensstimmen oder Folgen ableiten lassen, sondern sich aus den je situativ in einem konkreten Kontext vorhandenen und erzählten Geschichten ergeben. Patienten, Angehörige, Pflegende und Ärzte geben Geschichten, Erfahrungsberichte und Erlebnisse preis, die im Zusammenhang mit einer einzelnen ethisch zu reflektierenden Situation stehen. Was erzählt wird, trägt zur Wertgenese bei, was verschwiegen wird, zur Nichtbeachtung. Anwendung gefunden hat dieser ziemlich theoriefreie Ansatz einer Ethik im in Kanada entwickelten ‚Critical Incident Reporting System’, einem Meldesystem für aufgetretene menschliche Fehler, das aus der Luftfahrt übernommen im Gesundheitswesen immer mehr Verbreitung findet. Schätzungen des Schweizerischen Bundesamtes für Sozialversicherungen95 haben ergeben, dass allein in der Schweiz jährlich 2000 bis 3000 Menschen an vermeidbaren medizinischen Fehlern sterben. Neu wurde entsprechend der Pionierarbeit der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesiologie eine freiwillige anonyme Meldung von kritischen Zwischenfällen für Ärzte eingeführt. Sie ermöglicht es, im Internet Meldungen über Fehler zu veröffentlichen – frei nach dem Motto: „Nur aus Fehlern lernt man.“. Trotz großer Skepsis seitens gewisser Teile der Ärzteschaft (Angst, Ärzte könnten rechtlich belangt werden; Furcht, sich eine Blöße geben zu müssen; Selbstüberschätzung) glauben die Initianten dass es im Bereich der Medizin hier zu einer „Kulturänderung“ kommen könnte. Brody, Howard: Stories of Sickness. New Haven and London 1987: “Conversation among physicians is surely central to medicine, and this conversation frequently takes the form of telling stories. From Hippocrates until fairly recent times, the case history has dominated medical thinking and has been the cornerstone of the medical literature.” 95 Siehe hierzu: Frei, Martina: Auch Ärzte sollen zu ihren Fehlern stehen. In: Tages Anzeiger Zürich vom Freitag 12. 04.2002 und die Meldung „Freiwillige Datenbank für medizinische Fehler“ in Neue Zürcher Zeitung Nr. 84 vom 12.04.2002, S. 13. 94 134 Praktisch wird das Verfahren auch in Pflegebereich eingesetzt, so auf der Intensivmedizin am Kantonsspital Sankt Gallen, wo entstandene Fehler in kurzer erzählter Geschichtenform anonym an einer Pinwand öffentlich zugänglich gemacht werden, damit Leser unmittelbar aus den konkreten Schilderungen Regeln für ihr eigenes professionelles Handeln ableiten können. Kritiker werden einwenden, dass solch narrative Ansätze der Ethik sehr fragwürdig sind, wenn es etwa darum geht, interne Gütestandards zu formulieren oder zu verifizieren: Wie viele Geschichten sind etwa nötig, um Erkenntnisse oder Kurskorrekturen daraus abzuleiten? Was, wenn Leser unterschiedliche Schlüsse aus denselben Geschichten ziehen? Was macht man, wenn beispielsweise zu wenige oder nur qualitativ belanglose Geschichten erscheinen? Wie schlichtet man insbesondere Wertkonflikte, die sich aus konfligierenden Geschichten ergeben? Wiederum mit Metageschichten über Wertkonfliktsituationen? Doch solche Einwände wären nur dann berechtigt, wenn man versuchen würde, narrative Ethiken zum allein geltenden Maßstab zu erheben, was ohnehin praktisch kaum möglich sein wird. Als Komplement zu anderen ethischen Elementen können solche Meldungen „Kritischer Ereignisse“ hingegen mit Sicherheit eine nützliche und gewinnbringende Funktion erhalten, vor allem dann, wenn sie beispielsweise direkt in Ethischen Gesprächen, Ethikcafés oder Ethischen Kommissionen einfließen und diskutiert werden. Andere Verfahren narrativer Ansätze der Ethik liegen im Einbezug literarischer Erzählungen von Gesundheit und Krankheit. Unter dem Stichwort „Bibliotherapie“ hat sich inzwischen ein ganzer Berufszweig entwickelt, in dem unter Zuhilfenahme literarischer Erzählungen Einsichten in Denkprozesse zu ethischen Konflikten ermöglicht werden. Dies macht bis einem gewissen Grad durchaus Sinn, wenn es für Betroffene darum geht, sich mit einem Fall zu beschäftigen. Der Gewinn literarischer Erzählungen gegenüber digitaler Theorie-Rasteranalysen liegt unbestritten in der phänomenologischen Sichtbarmachung einer ganzen analogen Fülle von Aspekten. So könnte – wer dieses Skript bis hierhin gelesen hat – in der autobiographischen Erzählung „Mein Leben als Sohn. Eine wahre Geschichte.“ von Philip Roth96 nicht nur zahlreiche typische Erwägungen in den Denkweisen der Protagonisten wieder erkennen, sondern er gewinnt überdies einen Einblick in die Umgangsweisen mit verschiedenen Urteilen von Medizinern, die – obwohl apodiktisch und mit gewissenhaftversicherndem Unterton ausgesprochen – ganz anders rezipiert werden, als die Bedeutung nahe legt. Abschließend hier einige Hinweise auf literarische Texte, die ethische Reflexionen zu Fällen erzählen: Thomas Mann: Der Zauberberg; L.N. Tolstoy: Der Tod des Ivan Ilich; Franz Kafka: Die Verwandlung; E. Hemingway: In unserer Zeit; Albert Camus: Die Pest; Anton Tschechow: Onkel Vania; Eric-Emmanuel Schmitt: Oscar und die Dame in Rosa; etc. Ausschnitte aus solchen Texten können sehr gut Eingang finden in ethische Diskurse oder können Handreichungen für Patienten und Angehörige sein, sich umfassender mit einer Krankheit auseinanderzusetzen. Aus ethischer Sicht ist in Bezug auf Schilderungen veralteter medizinischer Aspekte eine kritische Reflexion im Diskurs wichtig und ergänzenswert. 96 Roth, Philip: Mein Leben als Sohn. Eine wahre Geschichte, dt. v. Jörg Trobitius. München 1995. 135 7.5 Problembasierte Ethik Der Theorie-Praxis-Transfer: Barrieren für die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis!?97 Abstract Der folgende Beitrag unternimmt den Versuch, einige grundlegende Schwierigkeiten des TheoriePraxis-Transfers auszuloten, um Hinweise auf einen differenzierteren und adäquateren Umgang mit den theorietransferimmanenten Problemen in der Praxis der Anwendung und Umsetzung von Forschungsergebnissen aufzuzeigen. Der vorgeschlagene problemzentrierte Lösungsansatz beruft sich auf Erfahrungen aus dem Bereich der Ethik als angewandte Philosophie und auf Ergebnisse sprachphilosophischer Forschungen. Inhalt Problemlage Barrierenvielfalt Problemzentrierter Ansatz: Beschreibung Problemzentrierter Ansatz: Drei Thesen Literaturverzeichnis Problemlage Wer schon einmal versucht hat, eine plausible, empirisch gut gestützte Theorie in die Praxis einer bestimmten Institution einzuführen, der weiss, dass dies alles andere als ein einfaches Geschäft ist. Barrieren vieler Art erschweren oder verunmöglichen solch erneuernde Übertragungen, obwohl sich mancherorts durchaus offene Ohren in latenter Lauschstellung befinden und bereit für Erweiterungen wären. Oft lassen die Rahmenbedingungen oder eingespielte Üblichkeiten und Gewohnheiten nicht zu, dass der Boden für neue Ansätze der Forschung gelockert wird. Man darf sich nun zu Recht fragen, was aus Sicht der Philosophie zu einer Lösung dieser Schwierigkeiten beigetragen werden kann. Versteht man „Philosophie“ als angewandte, praktische Tätigkeit, die es im Diskurs unternimmt, allererst Bedingungen für mögliche fruchtbare Entscheidungen zu schaffen – ohne selber als Interessenvertreterin im Spiel zu sein –, dann käme dem Philosophieren eine Art Regenwurmfunktion zu. Es vermag den harten Boden der Gewohnheiten zu lockern und nach Bedarf auch zu düngen. Wenn in irgendeiner Form Neues an jemanden herangetragen wird oder man selber mit Neuem konfrontiert wird und sich die Frage stellt: Lasse ich mich oder lässt sich der andere auf Neues ein oder nicht? – dann bestehen vereinfacht gesagt mindestens drei verschiedene Möglichkeiten zur Reaktion: Erstens kann man versuchen, das jeweils Neue mit Gewalt durchzusetzen. So könnte etwa eine Pflegemanagerin einen neuen Ansatz ihrem Berufsumfeld einfach verordnen, sofern das in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Zweitens kann man sich dem Neuen verschliessen und die Flucht beispielsweise zurück in die eigenen Gewohnheiten oder in die institutionellen Üblichkeiten antreten. Drittens kann man versuchen, mit vernünftigen Gründen und Argumenten in einen Theorie-TransferDiskurs einzutreten und die Anzusprechenden davon zu überzeugen, dass sich zumindest ein Versuch mit dem je neuen Ansatz lohnen könnte. Der Fokus der folgenden Überlegungen liegt auf dem dritten und letzten Punkt. Bremer, Daniel: Referat am ersten internationalen Kongress für angewandte Pflegeforschung – Pflegeforschung für die Anwendung vom 7.-8. Mai 2004 in Freiburg / Br. zum Thema „Der chronisch Kranke und der alte Mensch“; Samstag 8. Mai 2004, 09.00 – 09.30 Uhr. 97 136 Unter anderen hat sich Kim98 (1988) unserem Problem zugewandt: Wie können erfolgversprechende neue Ergebnisse der Forschung in Pflege und Gerontologie in die Praxis transferiert und genutzt werden? Er nannte drei Voraussetzungen: 1. Existenz eines Grundstocks an gesichertem Wissen mit hohem Voraussagegrad 2. Die Fähigkeit, dieses Wissen auf lokale Gegebenheiten zu übertragen und zu nutzen 3. Offenheit der Institution für Veränderungen Der erste Punkt birgt einige interne Schwierigkeiten wissenschaftstheoretischer Art, auf die wir hier nicht näher eintreten können obwohl deren Kenntnis viel zu einem redlichen Umgang mit Forschungsergebnissen beitragen kann – wie bestimmte Grundprobleme des Empirismus99, Messprobleme, Grenzen der Statistik100, Interpretation und Auslegung von Daten oder der unklare Zusammenhang zwischen allgemeinen Hypothesen und beobachteten singulären Prozessen. In Punkt zwei wird die „Fähigkeit des Übertragenkönnens“ angesprochen: Ihre Konzeption und ihre Bedingungen wollen wir nun etwas näher untersuchen. Dies kann dann die Voraussetzung dafür sein, genauer zu verstehen, was mit „Offenheit“ als drittem Desiderat gemeint sein könnte und wie sie hergestellt werden kann. Unserem Problem der Bestimmung einer Art „Übertragungskompetenz“ für Theorie-Praxis-Transfers hat sich vor einiger Zeit ein prominenter Denker zugewandt: Immanuel Kant. Er schrieb 1793, nachdem er seine kritischen Schriften bereits veröffentlicht hatte, einen Aufsatz mit dem Titel: „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“. Er schreibt dort: „Dass zwischen Theorie und Praxis noch ein Mittelglied der Verknüpfung und des Überganges von der einen zur anderen erfordert werde, die Theorie mag auch so vollständig sein, wie sie wolle, fällt in die Augen; denn, zu dem Verstandesbegriffe, welcher die Regel enthält, muss ein Actus der Urteilskraft hinzukommen (...)“101 Das fehlende Bindeglied, dass es jemandem erlaube, eine Theorie gelingend in einen Bereich der Praxis zu übertragen, bestimmt Kant als „Urteilskraft“ – doch das allein ist nicht alles, wie die folgende anthropologische Typologie zeigt. Kant unterscheidet zwischen Theoretikern, die nie praktisch werden, „weil es ihnen an Urteilskraft fehlt: z.B. Ärzte, oder Rechtsgelehrte, die ihre Schule gut gemacht haben, die aber, wenn sie ein Consilium zu geben haben, nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. - Wo aber diese Naturgabe auch angetroffen wird, da kann es doch noch einen Mangel an Prämissen geben; d. i. die Theorie kann unvollständig sein (...) Da lag es dann nicht an der Theorie, wenn sie zur Praxis wenig taugte, sondern daran, dass n i c h t g e n u g Theorie da war, welche der Mann von der Erfahrung hätte lernen sollen; und welche wahre Theorie ist (...)“ und Praktikern, die nie theoretisch werden: „Es kann also niemand sich für praktisch bewandert in einer Wissenschaft ausgeben und doch die Theorie verachten, ohne sich bloss zu geben, dass er in seinem Fache ein Ignorant sei: Indem er glaubt, durch gewisse Prinzipien (...) zu sammeln, und ohne sich ein Ganzes über sein Geschäft gedacht zu haben, weiter kommen zu können, als ihn die Theorie zu bringen vermag.“ Problematisch ist zunächst der Umstand, dass Kant die „Urteilskraft“ als „Naturgabe“ einstuft – glücklich, wer darüber verfügt, Pech für jene, die sie nicht oder noch nicht in genügendem Masse aufweisen. 98 Zit. nach Brandenburg und Klie (2003): S. 76. Fraassen, Bas van (1994) 100 Beck-Bornholt, H.-P. und Dubben, H-H. (1997) und (2001) 101 Kant, I. (1793): Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. In: Werke, Hrsg. v. W. Weischedel, Darmstadt 1980, Band 9, S. 127. 99 137 Zweitens aber ist die Ergänzung bedeutsam, dass wenn ein Theorietransfer nicht gelingt, nach Kant „nicht genug“ Theorie da war oder aber jemand nicht in der Lage ist, „sich ein Ganzes über sein Geschäft“ zu denken. Kant beschreibt hier einen wichtigen Punkt, der mit der griechischen Bedeutung von theoria gegeben ist: „theoria“ steht für das „Anschauen“, „Zuschauen“, „Betrachten“, dann auch für „Untersuchung“, „wissenschaftliche Erkenntnis“ und – das wird gerne übersehen: für „Schauspiel“. Wer also eine „theoria“ in die Praxis einführen möchte, der müsste nicht nur diese kennen und von ihr überzeugt sein, sondern er sollte ebenso gut deren Kontexte und Ko-Theorien kennen sowie sich der Inszenierungsbedingungen der Einführung bewusst sein und diese auch explizit machen. Der abgeleitete „theoros“ steht denn im griechischen nicht für den Schauspieler, sondern für „Zuschauer“: Er weiss nicht nur, was gespielt wird, sondern immer auch, dass und wie gespielt wird. Das Phänomen, dass jemand, der sich mit einer neuen Theorie beschäftigt, diese anfänglich ganz plausibel, später als sehr schlüssig einstuft, um schließlich gänzlich davon überzeugt zu werden, so dass er kaum mehr Alternativen im Blicke hat, kann man als das Ödipusparadoxon des Umganges mit Theorie bezeichnen. Vielleicht erinnern Sie sich an den Wandlungsprozess, dem Ödipus im Drama des Sophokles unterliegt: Je mehr er sieht (die Wahrheit über seine Taten), desto blinder wird er (für die Ränder der Wahrheit). Im Zustand der bestätigten Kenntnis der ganzen Wahrheit ist er – durch selbstverschuldete Selbstverstümmelung – paradoxerweise blind geworden für das Naheliegende. Er vergass, dass er Zuschauer seiner selbst hätte sein können, ein Umstand, in dem der Philosoph Helmuth Plessner102 im Kern schon 1928, dann 1948 ausdrücklich die eigentliche Würde des Menschen sah, also lange bevor sich die Psychologie des Rollenspielmodells in therapeutisch verkürzter Weise bemächtigte. Entsprechendes kann einer Theorietransferperson passieren: Je kohärenter, verführerischer, plausibler, schlüssiger, erfolgversprechender, etc. eine neue Theorie erscheint, desto größer ist die Gefahr, dass man ihre Ränder, Bedingungen, Voraussetzungen und Lücken sowie die zugrundeliegenden offenen Probleme vergisst – anstatt sie im Transferdiskurs durch Problematisierung explizit zu machen. Barrierenvielfalt Bevor wir diesen Aspekt weiter vertiefen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Vielfalt und Komplexität möglicher Barrieren, die einem reibungslosen Einbau eines bestätigtermassen erfolgversprechenden neuen theoretischen Ansatzes in eine Praxiswelt häufig im Wege stehen: Plessner, Helmuth (1948): „Jedoch übernimmt der Schauspieler, ob gut oder schlecht, in jedem Falle die Aufgabe, seiner Rolle eigene Figur zu sein. In dieser extremen Möglichkeit, zu der das Leben nur in Ausnahmen und festlicherweise Gelegenheit bietet und nur Träger seiner grossen Rollen, zur Hauptsache den Priester und den Herrscher, befugt, wird der Menschendarsteller zum Repräsentanten menschlicher Würde. Der Menschheit Würde ist in seine Hand gegeben. Aber diese Würde hat ihre Wurzel nicht allein in der Ebenbildlichkeit zu Gott, sondern ebenso sehr in dem mit der Abständigkeit zu sich gegebenen Abstand zu ihm. Würde besitzt allein gebrochene Stärke, die zwischen Macht und Ohnmacht gespannte zerbrechliche Lebensform. Ihre Überlegenheit über das blosse Leben, die in ihren geistigen Äusserungen vernehmbar wird, erkauft sie mit Hemmung und Unterlegenheit im blossen Leben. So erweist sich in Kleists Erzählung Über das Marionettentheater der Bär dem Fechter überlegen. Mit der Entdeckung seiner selbst, diesem Über-sich-selbst-hinaus-Sein, dieser fatalen présence à soi hat der Mensch seine Freiheit gewonnen und die ungebrochene Sicherheit seiner Animalität verloren. Zwischen Natur und Gott, zwischen dem, was kein Selbst ist, und dem, was ganz selbst ist, steht der Mensch, der sein Selbst sich präsentiert. Er besitzt weder die ungehemmte Präzision der Marionette bzw. die Instinktsicherheit des Tieres noch die vollkommene Ursprünglichkeit unfehlbarer Verwirklichung. Er ist gebrochene Ursprünglichkeit, die nicht über sich selbst verfügt. Er fällt nicht mit dem zusammen, was er ist: dieser Körper, dieses Temperament, diese Begabung, dieser Charakter, insofern als er sie, sich von ihnen distanzierend, als dieses ihm gegebene Sein erkennt. Sie sind ihm zugefallen und ihrer Zufälligkeit bleibt er sich bewusst, ob er nun ihrer Herr wird oder nicht. Das, was er hat, hat er zu sein – oder nicht zu sein. In diesem Sich-selber-präsent-Sein liegt der Bruch, die ‚Stelle’ möglichen Sich-von-sich-Unterscheidens, die dem Menschen im Zwang zur Wahl und als Macht des Könnens seine besondere Weise des Daseins, die wir die exzentrische genannt haben, anweist. Sie exponiert ihn und setzt ihn damit besonderer Gefährdung aus, der er in den Korrekturen und Kompensationen der Kultur auf besonderen Wegen zu begegnen sucht. Auf diesem Weg macht er sich diese Situation selber durchsichtig, stellt sie vor und löst sich von ihr, im Bilde freilich nur und imaginativ: auf dem Wege des Schauspiels. Er gibt der Sich-Präsenz die Form und den Sinn der Trägerschaft der Rolle, der Repräsentation, welche den Träger und Darsteller aus der zufälligen Einheit mit sich in die künstliche Einheit mit dem Dargestellten bringt und im Spiel spielend bewahrt.“ (Plessner, Helmuth, 1948: Zur Anthropologie des Schauspielers. In: ders. Gesammelte Schriften. Band VII, S. 399-418. Frankfurt a.M. 2003, S. 416f.) 102 138 Soziale Barrieren: - Interdisziplinäre Barrieren (binnendisziplinäre Fachsprache, Kongresse, Berufs-, Menschen- und Lebensbilder, Gruppenkonflikte) - Negative (Pseudopositive) Konnotation von mündlicher „Kommunikation“: „Gespräche bringen nichts! Dafür fehlen Zeit, Raum, Geld und sachverständige moderierende Personen“ (…) Institutionelle Barrieren: - Hierarchien, Machtstrukturen, Üblichkeiten... - Fehlende Rahmenbedingungen für Gespräche und moderierte Diskursplattformen (…) Personale Barrieren: - Mangelndes oder Fehlendes Problembewusstsein (Wissen über wissenschaftstheoretische, ethische, sprachlich-kommunikative, machttheoretische und weitere offene Grundprobleme) - Mangelnde Problematisierungskompetenz - Scham, ungelöste Probleme anzusprechen, Brüche und Grenzen explizit zu machen (Grund: Kultur der Fehlerfreiheit und Makellosigkeit) - Mangelnder Respekt vor Ungleichheit; souverän-ödipale Selbstkonstitution mit phänomenologischem Lebensweltverbindungsverlust (…) Sprachliche und konzeptionelle Barrieren: - Unzulässig reduzierte Vorstellungen von Theorie und Praxis - Mangelndes Bewusstsein im Umgang mit kategorialer Schärfe im Sprechen - Nicht-Explizitmachen von Inszenierungsbedingungen und Gewaltaspekten in der Verwendung von Sprache - Selbstreferentialität: Ausdrückliche Mitthematisierung des jeweiligen Theorietransferversuches bzw. des einem selber widerfahrenden Theorietransfers im Gespräch (…) Beim Theorietransfer in eine Praxiswelt ist oft nicht nur ein limitierendes Bild von Theorie im Kopfe wirksam, sondern ein ebensolches theoretisches Bild der Auffassung von „Praxis“, womit die Praxis als Praxis theoretisch reduziert wird und der phänomenologische Blick auf lokal Gegebenes abgeschwächt wird oder ganz verloren geht. Genauso wird oft die Theorie als Theorie von praktischen Bedingungen losgelöst betrachtet, was sie phänomenologisch betrachtet gar nicht ist, denn einen souveränen, den Transferprozess nicht beeinflussenden unbeteiligten Handelnden anzunehmen ist ein Fehler, auf den beispielsweise bereits Gadamer103 hingewiesen hatte, als er die Reduktion der Hermeneutik auf eine blosse Methode kritisierte. Gadamer, Hans-Georg (1960): Gadamer grenzt sich in seinem epochemachenden Werk „Wahrheit und Methode“ gegen einen naiven methodischen Begriff der Hermeneutik als Auslegekunst ab und folgt damit Martin Heideggers Spuren ausdrücklich und bewusst, nicht zuletzt, weil ihm die Abtrennung des (vermeintlich unbeteiligten) Interpreten von seinem Gegenstand problematisch scheint: „Die Zugehörigkeit des Interpreten zu seinem Gegenstande, die in der Reflexion der historischen Schule keine rechte Legitimation zu finden vermochte, erhält nun einen konkret aufweisbaren Sinn, und es ist die Aufgabe der Hermeneutik, die Aufweisung dieses Sinnes zu leisten. Dass die Struktur des Daseins geworfener Entwurf ist, dass das Dasein seinem eigenen Seinsvollzug nach Verstehen ist, das muss auch für den Verstehensvollzug gelten, der in den Geisteswissenschaften geschieht. Die allgemeine Struktur des Verstehens erreicht im historischen Verstehen ihre Konkretion, indem konkrete Bindungen von Sitte und Überlieferung und ihnen entsprechende Möglichkeiten der eigenen Zukunft im Verstehen selber wirksam werden. Das sich auf sein Seinkönnen entwerfende Dasein ist immer schon ‚gewesen’. Das ist der Sinn des Existenzials der Geworfenheit. Dass alles freie Sichverhalten zu seinem Sein hinter die Faktizität dieses 103 139 Viele dieser Barrieren wären eigene Untersuchungen wert. Hier wird im Folgenden ein problemzentrierter Ansatz vorgestellt, der – gelingt seine Umsetzung im Diskurs – einen Schlüssel zur Beschreibung und Bewältigung dieser und vieler ähnlich gelagerter Barrieren in anderen Bereichen darstellt, sofern man den gewaltarmen Weg über das „vernünftige“ Gespräch wählen möchte. Problemzentrierter Ansatz: Beschreibung Wenn Forschung und Praxis aufeinanderprallen, führt das im Allgemeinen zu Schwierigkeiten. Um diese und um den hier vorgeschlagenen problemzentrierten Ansatz besser zu verstehen, sei hier ein Aspekt der Problematik beleuchtet, den der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Nelson Goodman in seinem bahnbrechenden Buch Fact, Fiction, Forecast (1955) näher beschrieben hat. Er beschäftigte sich darin mit dem Problem der Induktion und es gelang ihm eine Verschärfung des Problems zu einem eigentlichen Paradoxon, das später jahrzehntelang die Journale der Wissenschaftsphilosophie beschäftigt hatte. Er hatte gezeigt, dass es bei induktiven Schlüssen von Einzeldaten auf beliebig viele Daten um eine Einbettung von Prädikatsausdrücken in das wissenschaftliche Zeichensystem geht und nicht – wie man bis dahin lange vermutet hatte – wie unser Weltwissen über die Begrenztheit unserer Erfahrung hinaus ausgedehnt werden kann. Warum wir den täglichen Induktionsschlüssen vertrauen liegt also nicht darin begründet, dass wir die Wirklichkeit an sich mittels einer verallgemeinerten Hypothese im Griffe halten, sondern es ist ein Indiz dafür, dass wir bestimmte Zeichen regelmässig verwenden. Goodman vergleicht in seinen späteren Werken unterschiedliche Sprachen aus Wissenschaft, Alltag oder Kunst und beschreibt sie als regelförmige Zeichensysteme, die je verschiedene Versionen oder „Weisen der Welterzeugung“ (1978) hervorbringen. Das Interessante an dieser Auffassung ist, dass die übliche Hierarchisierung zwischen Praxiswelt und Forschungswelt aufgehoben wird, weil sich die Prozesse der Sprachverwendung und Bedeutungserzeugung strukturell gleichen. Im Diskurs der Forschung werden, wie es heute üblich ist, erhobene Daten mit speziell formulierten Hypothesen in Verbindung gebracht. Man kann dann sagen, eine bestimmte Hypothese wird von empirisch erhobenen Daten gestützt und erlangt durch ihre auf Veröffentlichung beruhender Behauptung innerhalb der scientific community eine prinzipielle Fortsetzbarkeit. Einmal behauptete Hypothesen werden periodisch überprüft und fortgesetzt, sofern sie die unternommenen Falsifikationsversuche überstehen. Werden sie falsifiziert, so verlieren sie ihren Behauptungsstatus und werden nicht mehr fortgesetzt. Man kann sich nun den Grad der Fortsetzung als eine Art Index denken. So sind beispielsweise diejenigen Hypothesen, deren Fortsetzungsgrad hoch ist und die somit eine hohe Verwendungshäufigkeit aufweisen auch gut verankert im Forschungsdiskurs. Strukturell ähnlich verläuft ein Diskurs in einer Praxiswelt. Hier wird ebenfalls der Verankerungsgrad bestimmter Prädikate oder Begriffe durch einen Verankerungsgrad indexikalisch gemessen. Während modische Wörter einen hohen Verankerungsgrad aufweisen, verhält es sich bei selten verwendeten Begriffen gerade umgekehrt. Gelangt nun ein neuer Terminus, beispielsweise der Begriff „Quark“ mit einer neuen Bedeutung in den Praxisweltdiskurs, so muss er mittels bereits verwendeter und gut verankerter Termini erklärt werden, um verstanden und weitergereicht werden zu können. So bezeichnete etwa der Begriff „Quark“ ab einem bestimmten Zeitpunkt der physikalischen Forschung nicht nur länger nur ein Nahrungsmittel, sondern auch ein „subatomares Teilchen“. Man kann sagen, dass der Begriff „Quark“ nun den Verankerungsgrad der bekannten Ausdrücke „subatomares Teilchen“ erbt und dadurch neu verankert wird. Nun sind diese Verwendungs- und Fortsetzungsvorgänge Prozesse, die sich über eine gewisse Zeit erstrecken. Man kann deshalb von Verankerungsgeschichten sprechen, die gewisse Begriffe oder Hypothesen und Theorien durchmachen. Dieser Prozess ist zirkulär: Auf die Frage, was ein „Vererbungsgrad“ sei, könnte man antworten, dass es sich dabei um eine Eigenschaft von Prädikaten Seins nicht zurück kann, darin lag die Pointe der Hermeneutik der Faktizität und ihr Gegensatz zu der transzendentalen Konstitutionsforschung der Husserlschen Phänomenologie. Unüberholbar liegt dem Dasein voraus, was all sein Entwerfen ermöglicht und begrenzt. Diese existenziale Struktur des Daseins muss ihre Ausprägung auch im Verstehen der geschichtlichen Überlieferung finden, und so folgen wir zunächst Heidegger.“ (Wahrheit und Methode, S. 268f) 140 handelt, die gut verankert sind – und auf die Frage, was ein „gut verankertes“ Prädikat sei, antworten: Eines, das erfolgreich vererbt wurde. Weil dieser Verwendungsprozess allerdings ein zeitlicher ist, würde ein bestimmtes Prädikat nie denselben Verankerungsgrad aufweisen, da es nicht an denselben Verwendungszeitpunkt zurückzukehren vermag. Man kann insofern von einem „guten Zirkel“ sprechen. Was hat dies nun mit unserer Transferproblematik zu tun? Das Ermutigende an dieser Beschreibung von Sprachverwendungsaspekten liegt in der Strukturähnlichkeit beider Lebenswelten, derjenigen von theoretischer Forschung und praktischer Anwendung. Theoriewelt wie Praxiswelt kochen auch bloss mit mehr oder weniger gut verankerten Begriffen und Metaphern. Wer Theorie-Praxis-Transfers unternimmt, müsste also eingedenk dieser Zusammenhänge seine neuen Begriffe und Thesen allererst in der Zielsprache der Praxiswelt allmählich und behutsam verankern und zudem dafür sorgen und hoffen, dass diese auch vererbt werden und sich der Verankerungsgrad einer neuen Theorie erhöht. Die Kenntnis solcher Zusammenhänge ermöglicht es überdies, bei einer entsprechenden Gelegenheit im Diskurs gemeinsame Bezüge verschiedener Welten herstellen zu können, die der standardisierten hierarchischen Lesart, die eine Differenz auf der Bedeutungsebene stark macht, wirksam entgegentritt. Doch dazu gehört noch einiges mehr. Ein erfolgreicher Ansatz kann aus der angewandten Ethik auf unser Transferproblem übertragen werden. Im angewandten ethischen Diskurs ist eine intersubjektive Verständigung auch und gerade in hochkontroversen Fragen zu ethischen Dilemmata über den Rekurs auf gemeinsame offene Probleme möglich. Ethische Diskurse sind nicht blosse Projektionsprozesse der Teilnehmenden, sondern erzeugen eine Vielzahl unterschiedlicher und zum Teil konfligierender Perspektiven und Einstellungen, die eine meist empirisch bekannte Weltauffassung verändern, verfremden und neue Bedeutungen erzeugen. Dadurch resultiert eine gewisse Unbestimmtheit, die Teilnehmende auf unterschiedliche Weise verarbeiten können. Wer empörende dilemmatische Befunde auf seine Erfahrung reduziert, normalisiert den potenziell problembezogenen Diskurs und vernachlässigt damit die wertgenetische Dimension ethischer Gespräche. Wer ethisch Bedenkliches auf deontologische Prinzipien unbedingter Geltung zurückführt, dramatisiert den Diskurs und erschwert dadurch seinen Vollzug. Wer Wertkonflikte auf philosophische Grundprobleme zurückzuführen vermag und daran die Teilplausibilitäten der verschiedenen Antworten diskutiert, stellt eine offene Ausgangsbasis her, deren Qualität gerade in ihrer aus Überbestimmung resultierender Unbestimmtheit besteht. Solche überbestimmte Unbestimmtheit, solch eine heimatliche Entfremdetheit, solch eine sichernde Unsicherheit ist das gemeinsame prozedurale Ausgangsmoment zur Ermöglichung von Entscheidungsfindungsprozessen. An diesem Punkt öffnet eine gemeinsam gestellte Grundfrage den Vorhang auf die Fülle konformer und konfligierender teilplausibler Antwortmöglichkeiten. Der Wurm vieler scheiternder Konfliktlösungsversuche oder Anwendungen von Modellen zur Entscheidungsfindung steckt schon im üblichen ersten Punkt: der Problemerfassung. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich vom zu simplen Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation (das auf Shannon/Weaver 1948 zurückgeht) zu distanzieren. Eine Prozesse der Problematisierung vollziehende Person äussert vielleicht einmal Sätze der Art: „Dies ist das Problem“. Man kann hier die Frage stellen, ob es denn der Intention der sprechenden Person auf diese Weise gelingen kann, „den ganzen Schauplatz und das ganze System der Äusserungen beherrschen [zu] können“, was Derrida deutlich verneint: „Ist diese Struktur der Iteration einmal gegeben, so wird die Intention, welche die Äusserung beseelt, sich selbst in ihrem Inhalt nie vollkommen gegenwärtig sein“104. Es gibt seiner Auffassung gemäß keine „Sättigung des Kontextes“, den ein von Seiten der Gadamerschen Hermeneutik erhoffter „Vorgriff der Vollkommenheit“105 unterstellt hat. Ohne weiter auf dieses hier nur angedeutete Spannungsfeld zweier Ansätze der Moderne – Hermeneutik und Dekonstruktion – näher einzugehen, könnte die oben angesprochene und im problematisierenden Diskurs erzeugte überbestimmte Unbestimmtheit mit Derridas Begriff der différance sowohl als Differenz wie auch als Aufschub näher gefasst werden. Hergestellte Differenz zwischen konfligierenden Ansätzen vermag einen Aufschub gegen zu früh einsetzende Kategorisierung einer Problemlage zu erzeugen und beschreibt überdies das erlebbare Phänomen des Entgleitens der Kontrollmacht über das Gesagte im Diskurs – beides Aspekte, die dem kohärent-direkten, sich mit Wahrheitsanspruch in hypothetischer Korrespondenz zur Wirklichkeit wähnenden Forschungsdiskurs oder dem pragmatisch-teleologischen Praxisdiskurs eher fremd sind. 104 105 Derrida, J. (1988): S. 346 Gadamer, H. (1960): S. 298 141 Analog zu diesen Überlegungen aus dem Bereich der angewandten Ethik könnte ein Transferdiskurs Forschung - Praxis ebenfalls durch expliziten Rekurs auf zugrunde liegende gemeinsame offene Probleme ermöglicht werden. Die Aufgabe eines solchen Unterfangens wäre dann also nicht primär, sich an den sattsam bekannten und unsere Vorurteile prägenden Differenzen zwischen Praxis und Forschungswelt aufzureiben, sondern eine Gesprächskultur zu entwickeln, die ihren Weg über die Problematisierung gemeinsamer offener Grundprobleme sucht. Dazu gehört, dass man einerseits lokale lösbare Probleme von überregionalen offenen Problemen zu unterscheiden weiss. Lokale lösbare Probleme liegen innerhalb von Praxis- oder Forschungswelt vor, sind als solche bekannt und Gegenstand der Fachdiskussion. Offene Probleme sind in der Regel weniger Gegenstand einer lokalen Fachdiskussion in Bereich der Praxis, liegen aber unterschwellig den unterschiedlichen Ansätzen von Pflegetheorien, Pflegemethoden oder Pflegemodellen zugrunde. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: In den gewohnten und gerade angewendeten Pflegemethoden innerhalb der Berufspraxis einer Institution herrscht ein bestimmtes Menschenbild vor, das bestimmten Patienten zugeordnet wird. So beherrscht beispielsweise eine Art „Verlustmetaphorik“ die Rede von und über Demenzpatienten: Eigenschaften „gehen verloren“, Erinnerungen „verflüchtigen sich“, je mehr Patienten einst wussten, desto mehr „haben sie zu verlieren“, während andere, die „wenig besitzen“ im Demenzfall „auch wenig zu verlieren“ hätten – was solange gehe, „bis nichts mehr möglich ist, weil alles weg ist“. Die hier unterlegte Vorstellung stellt ein Menschenleben als eine Art Akkumulationsprozess dar, wobei das Sammeln von einem so vorgestellten souveränen Träger unternommen wird. Diese Auffassung ist im Diskurs sowohl unter geriatrischem Fachpersonal wie auch unter Angehörigen oder in neurowissenschaftlichen Ansichten über Demenzpatienten (cf. Damasio 2001, der vom „Verlust des Selbst“ spricht) weit verbreitet. Weil diese Auffassung einen hohen Verankerungsgrad aufweist, werden ihre Metaphern auch häufig weitervererbt. Wer es in Pflege und Betreuung Dementer hingegen über diesen metaphorischen Tellerrand hinaus fertig bringt, sich den vorurteilsreduzierten Blick auf situativ gegebene und manchmal schlecht verallgemeinerbare Phänomene zu erhalten, die durch diese Auffassung ausgegrenzt werden, der bemerkt, dass diese Metaphorik zu einseitig ist. Inzwischen hat sich als neue Auffassung für gewisse Phasen des Demenzverlaufs auch eine andere Auffassung sanft verankert, die mit dem Terminus einer „Umorientierung“ äußerlich sichtbare Veränderungen nicht nur ausschließlich als Verlust auffasst, sondern auch als Momente einer Umgestaltung, die phasenweise gar Züge von Kreativität in einem weiten Sinne aufweisen können. Das offene Problem, das hinter diesen beiden und weiteren Auffassungen steckt, lautet: Wie denkt man sich ein Patientenbild? Gibt es Kriterien, die eine Präferenz einer bestimmten Sichtweise rechtfertigen? Wie geht man mit verschiedenen Auffassungen von „Bild“ um? Sind Metaphern nur Bilder, hinter denen sich so etwas wie der „wahre“ oder „eigentliche“ Patient verbirgt? Oder gibt es unter diesen Auffassungen eine Hierarchie mit guten Gründen für eine bestimmte, „passende“ Sichtweise? Oder sind diese vielen zum Teil konfligierenden Ansichten gleichberechtigte Lesarten von Patienten? Oder sind diese Auffassungen des Problems allesamt unzutreffend, weil man davon ausgeht, dass Patientenbilder vorliegen, während sie doch in Wirklichkeit in der Verwendung allererst und stets neu erzeugt werden? Zusätzlich zu dieser Problematik der je zu verwendenden Metaphorik stellt sich die Frage nach der angewandten Identitätskonzeption in der Lesart von Patienten. Die Frage, wie man „Identität“ denken, entwerfen und erfahren soll, führt in ein bislang offenes anthropologisches Grundproblem der internen Konzeption vom Menschen überhaupt hinein. Dass ein bestimmtes Menschenbild, das in einem neuen theoretischen Ansatz stillschweigend oder explizit unterstellt wird, in unzulässiger und diskriminierender Weise reduktionistisch ist, kann ich nur feststellen, wenn ich a) über eine Vielzahl von möglichen Menschenbildern verfüge (mindestens drei, maximal wäre derzeit die Kenntnis von mehr als 271 homo-Begriffen möglich106) und b) mit dem grundlegenden Problem der bis jetzt unbeantworteten Grundfragen vertraut bin: Was ist der Mensch? und: Wie gehe ich mit der Vielzahl an Menschenbildern um? 106 Lenk, Hans (2000): Lenk hat 271 [sic!] verschiedene Menschenbegriffe aus der Denk- und Problemgeschichte und vielen weiteren Quellen zusammengetragen. Die lange Liste (S. 13-45) ist nicht abgeschlossen, ergänzend sind der homo sacer von Agamben (2002) oder der homo effodens et effodendum von Bremer (2002) anzufüren. 142 Beides sind Grundbedingungen für einen Problematisierungsdiskurs, in dem der Boden gelockert werden kann für einen gemeinsamen, Praxis- und Forschungswelt gleichermaßen betreffenden Ausgangspunkt für eine Diskussion und eine Bewertung möglicher Handlungsoptionen. Man kann die verschiedenen Auffassungen von Forschung, Berufspraxis, Kunst, Religion, etc. auch als Weltprozesse beschreiben, die in eine jeweilige Lebenswelt eingebettet sind und sich dort in komplexer Weise durchdringen und überlagern. Lebenswelten wiederum gibt es viele verschiedene, die man sich leicht an interkulturellen Differenzen verdeutlichen kann: Pflege in Japan vollzieht sich in einem Rahmen andersartiger Auffassungen als Pflege in Deutschland. Oft erleiden Bemühungen um einen direkten Transfer von Theorie Schiffbruch, weil der Blick auf die allen Auffassungen von Lebenswelt, Forschungs- oder Berufswelt gemeinsamen offenen Grundprobleme vergessen gegangen ist oder aber als unzumutbarer Umweg der üblichen Ökonomie der direkten Verbindung zu widersprechen scheint. Man kann sich die Sache auch anhand des Bildes einer Problemlandschaft vorstellen: Eine endlose Ebene aus der sich da und dort Berge erheben oder Vertiefungen ihren Schlund öffnen. Diskurse sind Wanderungen auf dieser Ebene und werden durch geschwungene Pfeile dargestellt. Sie setzen irgendwo ein, bewegen sich mal kohärent und schlüssig, mal sprunghaft und diskontinuierlich und enden wieder an irgendeiner anderen Stelle. Orientierung ist nur bedingt möglich: In der Regel kann man wissen, dass man spricht, aber genau besehen ist nicht klar, was das, wovon man spricht, für eine Bedeutung, für einen Wert, für einen Sinn hat oder wie der je sich vollziehende Diskursbewegungsweg mit wirklichen Tatbeständen zusammenhängt. Je höher eine Erhebung ist, desto positiver ist der Problematisierungsgrad eines Diskurses. Positiv ist ein Problematisierungsgrad wiederum, wenn der Verankerungsgrad eines Problems klein ist: Berge stellen somit abstoßende Probleme, sogenannte Repulsorprobleme dar. Weil sie einen niedrigen Verankerungsgrad in den Diskursräumen aufweisen, meiden viele Gespräche solche Erhebungen. Man denke hierbei an eine Klasse von Problemen, die nicht gerade en vogue sind wie etwa Tabuthemen107: Todesvorstellungen, Ekel, Störungen, etc. oder Wert-, Sinn-, Wahrheits-, Bedeutungsquellprobleme und weitere Probleme wie Induktion, Verifikation, Legitimation, Existenz, Sprache, Relation, Kategorien, etc. Entsprechend heißen Vertiefungen in dieser Problemlandschaft Attraktorprobleme. Sie wirken, gerade weil ihr Verankerungsgrad hoch ist, anziehend. Man stelle sich hierbei eine Klasse von bekannten Problemen vor wie etwa notorisch verwendete Metaphernspendebereiche (z.B. Kampfmetaphorik, Weg-, Last-, Gefässmetaphoriken, Lebens-, Alters- und Menschenbilder) oder Probleme, die durch binäre Oppositionen strukturiert sind, wie etwa die Diskussionen um aktive / passive Sterbehilfe, den Theorie-Praxis-Transfer, das scheinbar nicht verbunden denkbare Gegensatzpaar Denken-Emotion108, oder die Frage, ab wann in der ontogenetischen Entwicklung eines Menschen von „Leben“ gesprochen werden kann. Hier ist ebenfalls der Begriff der „Diskursfalle“ zu verorten. Er beschreibt ein Phänomen, bei dem gewisse Diskurse der Eigendynamik und Funktion bestimmter sprachlogischer Konzeptionen aufsitzen und dabei relevante Bezüge zur Wirklichkeit und zu den Bedingungen und Grundproblemen der Diskurse selbst aus den Augen verlieren. Man kann nun Diskurse zunächst grob in zwei Klassen einteilen: problemfreundliche und problemfeindliche Diskurse. In vielen Lebenswelten sind die problemfeindlichen Diskurse weit verbreitet: sie drücken sich vor der Thematisierung offener Fragen, meiden Tabuthemen, halten sich 107 Von den 48 Semesterarbeiten einer Ethik-Vorlesung des Autors an der KFH Freiburg der vergangenen beiden Sommersemester 2002 und 2003 hat sich beispielsweise – trotz freier Themenwahl - nur gerade eine Arbeit mit dem tabubehafteten Themenbereich Ekel und Scham in der Pflege auseinandergesetzt. 108 Aus feministischer Sicht erhebt Meier-Seethaler (2001) hieran Kritik und stellt ihrer Untersuchung ein Motto von Hanna Joahnsen voran: „Wenn es doch endlich einmal gelänge, in unserer Sprache ein Wort einzuführen, welches Denken und Fühlen nicht trennt. Ich habe es satt, mich immer für das eine und gegen das andere entscheiden zu müssen, und wie viel Unglück ist erst dadurch entstanden, dass die Menschen auch danach gehandelt haben.“ (S. 5) Ebenso kann aus analytischer Sicht die Korrespondenzrelation zwischen einer binären Opposition und der Wirklichkeit kritisiert und als problematisch eingestuft werden, weil beispielsweise nur schon der ontologische Status dieser Korrespondenzrelation unklar ist. Dagegen operieren viele Neurowissenschaftler (Damasio, Roth, u.a.) mit dieser Unterscheidung und ordnen unter treuer Verwendung derselben binären Opposition diesen Begriffen unterschiedliche Zonen am Gehirn zu, von denen sie glauben, berechtigterweise die Termini „Emotion“ oder „Denken“ zuordnen zu können. Dass hier ein gravierendes wissenschaftstheoretisches Grundproblem kaum thematisiert wird – die Frage nämlich, welcher verlässlichen Quelle die angeblich verlässlichen Befunde berechtigterweise entstammen – halten viele dieser Forscher für irrelevant. Doch mit welchem Recht? Welche Instanz spricht hier – „das Gehirn“? 143 zwar manchmal auch leidenschaftlich in den attraktiven Diskursfallen auf, meiden aber aus unterschiedlichen Gründen eine grundlegende Problematisierung. Problemfreundliche Diskurse hingegen suchen geradezu Attraktor- und Repulsorprobleme und befragen diese auf ihre Bedingungen und grundlegenden, bislang offenen Grundschwierigkeiten hin. Wo andere zwar ahnen oder wissen, dass es da noch andere Kaliber von Fragen und Schwierigkeiten gibt, diese aber meiden, da setzen problemfreundliche Diskurse allererst ein. Der Anspruch, der mit diesem Beschreibungsversuch einhergeht, ist ein bescheidener. Er zielt nicht primär darauf ab, dass dieses Modell einer Diskurslandschaft einen Geltungsstatus aus einer Entsprechung mit wirklichen Bedingungen erhält. Dafür sind noch allzu viele Fragen offen. Es ist beispielsweise nicht klar, wer oder was denn in einem Diskurs spricht. Es ist unklar, wie solche Diskurse aufzufassen sind: Kann man wissen, was man macht, wenn man spricht, indem man darüber spricht oder denkt oder empirische Messungen macht? Wir können natürlich auch die Frage, ob ein bestimmtes Problem berechtigterweise einen hohen Verankerungsgrad aufweist, nicht schlüssig beantworten – denn dies ist eine Frage des je herangezogenen Wertmassstabes. Der Anspruch, den dieses Modell erhebt, liegt darin, das je eigene Nachdenken über die verschiedenen Auffassungsmöglichkeiten und Lesarten von Theorie und Praxis und deren Transfer- und Einbettungsvorstellungen in Bewegung zu bringen. Konkretisiert auf den Bereich der Pflegepraxis und Pflegeforschung könnte eine Anwendung durch Diskurs folgenden Weg gehen: Als lösbare Barrieren bestehen beispielsweise Interdisziplinaritätsschranken, die in einen Modus „echter“ Kooperation überführt werden oder ein bestimmtes enges Krankheitsbild wird durch einen neuen Ansatz zu einem neuen Krankheitsbild109 erweitert oder eine übliche Theorie durch einen neuen Ansatz ersetzt oder ergänzt. Voraussetzungen wären Gespräche, die sich den vermeintlichen Umweg über die Thematisierung noch nicht gelöster Barrieren bzw. offener Grundprobleme leisten. Dazu könnte die Schaffung von moderierten Gesprächsplattformen in Bereich der Praxis ebenso katalytisch wirken, wie entsprechende Gespräche an Pflegeforschungsforen, Kongressen oder Fachkolloquien. Zu den (bislang) nicht gelösten Barrieren würde bei unseren Beispielen das Problem der angemessenen Menschen-, Krankheits-, Lebens-, Altersmetaphorik dienen. Man stellt sich im Diskurs gemeinsam der Frage nach dem Umgang mit der Vielfalt an Krankheitsmetaphern, Alters- und Lebensbildern, diskutiert die verschiedenen Lesarten oder fragt nach einem berechtigten Beurteilungskriterium. Ein weiteres Problem stellt die Frage des Umganges mit Theorievielfalt dar: Wie denkt man sich „Theorie“? Welche Ansprüche lassen sich berechtigterweise damit verbinden? Wie geht man mit vielen, sich gegebenenfalls widersprechenden Theorien um? Problemzentrierter Ansatz: Drei Thesen Dass Theorie-Praxis-Transfers ein „schwieriges Geschäft“110 darstellen, mag inzwischen noch deutlicher geworden sein und die drei Thesen, die hier als mögliche Lösungshinweise vorgestellt werden, sind in der Praxis alles andere als einfach anwendbar. Denn genau besehen wird hier ein tugendethischer Ansatz vorgeschlagen, der nicht bloss mittels Änderungen von institutionellen Rahmenbedingungen operiert, sondern die Kompetenzen der Beteiligten direkt ins Visier nimmt. Die konkrete Tugend liesse sich als eine Form von Grosszügigkeit bestimmen, da sie durch den Umweg über die Gesprächskultur Überschüsse der Zuwendung, der Mehrinformation und der Problematisierung leistet. Während eine von ökonomischen Werthaltungen geprägte prinzipienorientierte Vorgehensweise stets über den direktesten Weg Überschüsse allererst erzeugen muss, geht eine hier eingeforderte Gesprächskultur unmittelbar und ohne Aufschub dazu über Überschüsse zu leisten. Diese Überschüsse liegen als Problembewusstsein vor, bevor pragmatische Lösungen angestrebt werden und erfordern eine besondere Kompetenz. Bereits Aristoteles111 hatte in seiner Nikomachischen Ethik darauf hingewiesen, 109 Siehe hierzu die wiederaufgelegten und für pflege- und medizinethische Überlegungen äusserst wichtigen beiden Artikel von Sontag (2003) 110 Brandenburg, H. (2003): Gerontologie und Pflege – Zum Wissenschaftscharakter von Gerontologie und Pflegewissenschaft. In: Brandenburg / Klie (2003): S. 60-82; S. 76. 111 Aristoteles (2001): Nik. Eth. IV, 1-3 sowie VI, 5 144 dass die Etablierung einer Charaktertugend der Grüsszügigkeit, die sich zwischen Knausrigkeit und Verschwendungssucht einpendelt, ungenügend bleibt, wenn nicht eine Art sittlicher Einsicht, die er phronesis nannte, hinzukommt. Sie erlaubt eine situative Einschätzung einer dilemmatischen Situation, wie sie auch bei einem Theorietransfer entstehen kann. Modern gesprochen könnte auch von einem Bedeutungsüberschussmanagement gesprochen werden, das ein theorietransferierende Person zu vollziehen im Stande sein sollte. Schon aus Überlegungen der Würde und der didaktisch-pädagogischen Möglichkeiten ist es ratsam, sich die Anwendungen und Umsetzungen dieser Thesen als Prozesse innerhalb einer sich entwickelnden und gepflegten regelmässigen Gesprächskultur zu denken. Dabei ist das gesamte je beteiligte personale Umfeld von hoher Bedeutung: Welche Umgangskultur mit Gewohnheiten, Üblichkeiten, Neuem und Fremdem hat sich lokal etabliert? Gibt es darin Menschen, die nicht nur über ausreichende kommunikative Kompetenzen verfügen, sondern auch Situationen einzuschätzen vermögen, in denen Gespräche erforderlich sind sowie überdies Gelegenheiten erhalten, diese Kompetenzen umzusetzen und dies dann auch tatsächlich tun? These 1 Wer Theorie-Praxis-Transferbarrieren auf gemeinsame offene philosophische Grundprobleme zurückzuführen vermag, stellt eine Ausgangsbasis her, deren Qualität gerade in ihrer aus Überbestimmung resultierenden Unbestimmtheit besteht. Solch überbestimmte Unbestimmtheit, solch heimatliche Entfremdung, solch eine sichernde Unsicherheit ist ein gemeinsames prozedurales Ausgangsmoment zur Ermöglichung von Entscheidungsfindungsprozessen im Konfliktfall. An diesem Punkt öffnet eine gemeinsam gestellte Grundfrage den Vorhang auf die Fülle konformer und konfligierender teilplausibler Antwortmöglichkeiten. These 2 Für gelingende Theorie-Praxis-Transfers sollten Bedingungen geschaffen werden, unter denen sich Barrieren abbauen lassen. Zu solchen Bedingungen gehören: 1. Ein echtes Interesse der transferwilligen Personen an der Vermittlung eines Verständnisses des Forschungsprojektes bei sämtlichen Beteiligten – unter besonderer Berücksichtigung gemeinsamer offener Grundfragen und den problematischen Grenzen des Ansatzes – sowie dessen Umsetzung im Diskurs. 2. Diskursplattformen in institutionalisierter Form – wenn möglich mit sach- und problemverständigen Moderatoren, die nicht an eine interne Hierarchie gebunden sind und auch sonst keinerlei undeklarierte Absichten verfolgen. 3. Gesprächskultur - sowohl disziplinär, interdisziplinär und metadisziplinär. Kultur kann als Antwort auf die „Was bringt‘s? - Mentalität“ genau jene Räume der Fülle ausloten, die von letzterer ausgegrenzt werden. 145 These 3 Wer Theorie-Praxis-Transferbarrieren ausräumen oder besser: gar nicht erst entstehen lassen möchte, der tut gut daran, zunächst für eine „Offenheit“ bei den angesprochenen Institutionen zu sorgen. Dazu könnten gehören: 1. Diskursbereitschaft generieren. 2. Vorbereitende Diskurse auf allen relevanten Ebenen führen, indem die Problematik der bestehenden Üblichkeiten auf die grundlegenden Probleme hin angesprochen wird. Kategoriale Schärfe ist möglichst zu vermeiden. 3. Aufweichung und Verdünnung angestammter Vorstellungen, die ergänzt, revidiert oder erweitert werden sollen. Philosophischer Diskurs als Antikoagulationsmittel für feste Vorstellungen oder für eine Metaphernverdünnung. 4. Erhöhung des Verankerungsgrades neuer Begriffe, Hypothesen, Probleme und Ansätze durch Verwendung und Gebrauch. 5. Explizite Hinweise auf eigene Offenheit gegenüber dem Versuchscharakter eines neuen Ansatzes: Auch ein allfälliges Scheitern wäre ein Versuch wert. Literaturverzeichnis Agamben, Giorgio (2002): Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt a. M. Aristoteles (2001): Nikomachische Ethik. Übersetzt von Olof Gigon, Düsseldorf, Zürich Beck-Bornholt, Hans-Peter und Dubben, Hans-Hermann (2001): Der Schein der Weisen. Irrtümr und Fehlurteile im täglichen Denken, Hamburg Beck-Bornholt, Hans-Peter und Dubben, Hans-Hermann (1997): Der Hund, der Eier legt. Erkennen von Fehlinformation durch Querdenken, Hamburg Brandenburg, H. und Klie, Th. (2003): Gerontologie und Pflegewissenschaft, Hannover Bremer, Daniel (2002): Hochbegabung als Herausforderung. Referat gehalten im Kulturverein Repfergasse in Schaffhausen am 6. Juni 2002, unveröffentlicht, Zürich Damasio, Antonio R. (2001): The feeling of what happens. Body and emotion in the making of consciousness, Harcourt Derrida, Jacques (1988): Signatur, Ereignis, Kontext. In: Ders. (1999): Randgänge der Philosophie, S. 325 - 351, Wien Fraassen, Bas van (1994): Empirismus im XX. Jahrhundert, Hagen Gadamer, Hans-Georg (1960): Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen Goodman, Nelson (1955): Fact, fiction, forecast, dt. (1978): Tatsache, Fiktion, Voraussage, Frankfurt a. M. Kant, Immanuel (1793): Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. In: Derselbe (1980): Werke, hrsg. v. W. Weischedel, Band 9, S. 127 – 130, Darmstadt Kim, H.S. (1988): A study of three approaches to research utilization. Unpublished manuscript. University of Rhode Island. Kingston, Rhode Island Lenk, Hans (2000): Kreative Aufstiege. Zur Philosophie und Psychologie der Kreativität, Frankfurt a.M. 146 Meier-Seethaler, Carola (2001): Gefühl und Urteilskraft. Ein Plädoyer für die emotionale Vernunft, München Plessner, Helmuth (1948): Zur Anthropologie des Schauspielers. In: ders. (2003): Gesammelte Schriften. Band VII, S. 399 - 418, Frankfurt a. M. Sontag, Susan (2003): Krankheit als Metapher. Aids und seine Metaphern, Frankfurt a. M. 147 Problemlandschaft Repulsorprobleme Problematisierungsgrad + 0 _ Attraktorprobleme Diskursbewegungswege linear-kohärenter Diskurs diskontinuierlichtransitorischer Diskurs problemfreundlicher Diskurs problemfeindlicher Diskurs 148 8. Schlüsselbegriffe und Probleme moderner Ethik Die folgenden Abschnitte enthalten Hinweise auf oft wiederkehrende und deshalb wichtige Begriffe angewandter Ethik. Sie sollen nicht im Sinne von Letztbegründungsversuchen aufgefasst werden, sondern Leserinnen und Lesern als Anregungen für die eigene Entwicklung eines ethischen Vokabulars dienen. Die Liste an Begriffen ist eine offene und wird sukzessive erweitert und verfeinert. 8.1 Verantwortung In den letzten Jahren hat eine intensive Diskussion um den Begriff der Verantwortung in der Ethik eingesetzt und zu verschiedenen Präzisierungsversuchen geführt. Auch in der Rangliste gewählter Themen für Seminararbeiten der Studierenden von Pflegemanagement und Pflegepädagogik an der KFH Freiburg der letzten Jahre liegt der Begriff der Verantwortung an erster Stelle – wobei die Themenwahl gänzlich freigestellt war und darüber in der Vorlesung keine Vertiefung stattgefunden hatte. Die folgenden Schemata sollen für ethische Diskurse, in denen in irgendeiner Weise von „Verantwortung“ die Rede ist, helfen, die vielschichtige Problematik und Komplexität um diesen Begriff zu befragen und zu entwickeln. Wichtig ist dabei einerseits, die Mehrstelligkeit des Prädikats „Verantwortung tragen / übernehmen“ mit in die Reflexion einzubeziehen. Dabei treten bei der Bestimmung der einzelnen Bezugsparameter (Verantwortungsträger, Zeitraum, Bedeutung, Instanz, Objekt, Folgen und moralische Bewertung bzw. ethische Legitimation) eine Fülle von Anschlussfragen auf. Sie verdeutlichen das Problemfeld dieses in der jüngeren Ethik öfter diskutierten Terminus. Zweitens ist wichtig, dass man dieses Handeln der Bestimmung von „Verantwortung“ einbettet in einen kritischen Reflexionsrahmen, der die Bedingungen solchen „verantwortlichen“ Vorgehens oder Begründens untersucht und zur Sprache bringt. Angeführt sind schematisch des weiteren aktuelle Tendenzen aus der Verantwortungsdiskussion, die sich vom Schwerpunkt der rückblickenden Verursacherverantwortung (die besonders bei strafrechtlichen Fragen eine Rolle spielt) hin zu einer prospektiv ausgerichteten Sorge-für-Verantwortung umlagern. Dabei steht je mach Konzeption auch die Reichweite und die Bestimmungsfelder solcher Verantwortung zur Diskussion. Sollen bereichsspezifische Verantwortungsbegriffe etabliert werden oder soll man überregionale Verantwortung spezifizieren, die gerade bei konfliktgeladenen Situationen eine bedeutsame reflexive Berufungsinstanz sein kann? Nicht unbeachtet sollte der Bezug von Verantwortungstheorien zum konsequentialistischen Utilitarismus bleiben. Dessen Grundprobleme (Fragwürdigkeit der Folgenabschätzung bei gleichzeitiger weit verbreiteter pragmatischer Verwendung; Induktionsproblem, Verifikationsproblem, etc.) spielen bei vielen Verantwortungskonzeptionen hintergründig eine bedeutsame Rolle und müssen, wenn eine unkritische Reflexion vermieden werden soll, transparent gemacht und in den ethischen Diskurs miteingebracht werden. Immer wieder taucht in ethischen Debatten um Verantwortung das sogenannte DammbruchArgument auf, das bereits der römischen Sentenz „Principiis obsta, radix vix rumpitur alta.“ (dt. „Wehret den Anfängen, eine tiefe Wurzel lässt sich nur mit Kraft, d.h. kaum, ausreißen.“). In seiner Genese aus der in den USA geführten Diskussion um die Abschätzung, was alles passiert, wenn ein Staudamm wegen Staumauerbruchs sich in zivilisatorische Gebiete ergießt, stellt Hans Lenk (1986) die Problematik des Arguments dar. Eine Schwierigkeit dieses Arguments liegt darin begründet, dass diejenigen, die sich für ein Verbot und ein Moratorium einer gewissen Technologie einsetzten, sich auf einen prospektiven, überzeitlichen 149 Betrachterstandpunkt stellen, von dem aus die möglichen Gefahren und Endzustände erwogen werden, die sicher eintreffen, wenn die zur Debatte stehende Technik weiterverfolgt wird. Befürworter können entgegnen, dass entweder eine solche Abschätzung nicht gemacht werden kann – oder dass man sich längst und unaufhaltsam im Rutschprozess auf der schiefen Ebene befände und ein Moratorium aussichtslos zu spät komme. Für beide Positionen stellt sich allerdings die kritische Frage, ob die Beschreibung des Zustandes als „slippery slope“ eine berechtigte bzw. adäquate ist. Wie können Standortbestimmungen und Beschreibungen von Istund Sollzuständen in komplexen Zusammenhängen vorgenommen werden? Hier gibt die Debatte über die Möglichkeit von Technikfolgenabschätzung weitere Hinweise. Weitere Anwendungsgebiete und (künftige) Konfliktfelder sind die begrenzte Beanspruchungszeit von Patienten bei gleichzeitiger Behandlungsabsichten verschiedener medizinischer Ansätze (etwa wenn Patienten im Sinne ihrer autonomen Wahlfreiheit gleichzeitig schul- und alternativmedizinische Ansätze einfordern, die sich entweder aus Wirkungs- oder aus Zeitgründen nicht gleichzeitig anwenden lassen.), der stets Zuwachs in lebenserhaltenden Technologien oder die zunehmende prothetische Simulierbarkeit des menschlichen Körpers. Auf ontologische Überlegungen des Erhalts von Verantwortung-übernehmen-Können stellt Hans Jonas sein „Prinzip Verantwortung“. Als Einstieg sei der interessierten Leserin Monika Sängers Anthologie (1991) von philosophischen Texten zum Begriff der Verantwortung empfohlen. Aus der dort vorgestellten Vielfalt wird die Komplexität des Begriffs deutlich. Die folgenden Schemata sollen für ethische Diskurse, in denen in irgendeiner Weise von „Verantwortung“ die Rede ist, helfen, die vielschichtige Problematik und Komplexität um diesen Begriff zu befragen und zu entwickeln. 150 Verantwortung Struktur und Problematik Probleme Problem Induktion, Zeitpunkt des Eintritts: Absicht? Sprechakt? Beginn von H? Erste Folgen B? Zustand B? Nachweis, Verifikation: Wie z.B. empirisch feststellen, ob tatsächlich Verantwortung getragen wird? Bedeutung Zurechnung (imputatio) Rechtfertigung Haftbarkeit Verteidigung Sich-rechtfertigen-Müssen eine Sache vor Gericht verteidigen (respondere, apologeomai) Zuständigkeit Kompetenzzuschreibung Probleme Probleme Handlungsdefinition, Grenzfälle: Sprechakte, Unterlassungen, „Zustand“? „Ereignis“? sämtliche Probleme der Utilitarismen, Folgenabschätzung, Kalkül, Induktion, ... Metaverantwortung WAS Bereich, Objekt Eigenschaften Relation, mehrstelliges Prädikat Tugend, Prinzip, Vektor, Richtung-Haben M1 M2 M3 H1 W1 W6 H2 W3 W2 W 7 H3 W8 W9 Welcher moralische Bezugsrahmen (Mx) paßt zur Situation möglicher Handlungsoptionen (H1Hn)? Welche Werte (W) sind nach welchem Kriterium relevant? WOFÜR Folgen Handlung A -> B Ereignis Zustand Tatsache Wert, Zweck Menschheit, Natur Geschichte, (...) WANN retrospektiv aktual prospektiv durativ Probleme - beabsichtigte - unbeabsichtigte weil Jemand war/ist/wird verantwortlich jemandem gegenüber für etwas im Hinblick auf unter Beachtung von bezüglich eines Maßstabes WER Akteur, Subjekt Individuum Kollektiv Institution Probleme Gibt es den idealen Akteur? Voraussetzungen? Wie wird Kollektiv-V. möglich? Kriterium? Warum Einzelne zur Rechenschaft ziehen, wenn alle v. sind? Was taugt das KausalSchema (SündenbockModell)? Redeweisen jemanden zur V. ziehen jemanden für etwas v. machen V. übernehmen V. tragen aus Verantwortlichkeit handeln unverantwortlich handeln die volle V. tragen verantwortungslose Tat sich aus der V. stehlen sich vor der V. drücken sich der V. entziehen Typen legale V., moralische (Selbst-)V., Verursacher-V., Treuhänder-V., HegeV., solidarische V., Gattungs-V., Fürsorge-V., Präventions-V., Kausalhandlungs-V., Ex-post-V., Sorge-für-V., Seins-V., universale V., individualistische V., kollektive V., (...) WOVOR Instanz WESWEGEN Wert, Begründungen Gericht, Gewissen, Recht, Gott, Normen, Werte, Geschichte, Zukunft, Vernunft, Menschheit, künftige Menschheit, vergangene Menschheit, Lebewesen, Natur, Globus, Arbeitgeber, Organisation, öffentliche Meinung, Habitus, Urteile anderer, (...) Menschheit als Zweck an sich selbst (Kant) Ehrfurcht vor dem Leben (Schweitzer) Pflicht zur Bewahrung des Seins (Jonas) Frieden mit der Natur (Meyer-Abich) das gute Leben aller: Nützlichkeit, Wohlwollen, Gerechtigkeit (Ropohl) intergenerationeller Nutzensummenutilitarismus (Birnbacher) Menschenwürde als présence-à-soi (Plessner), (...) Probleme Legitimation, Regulation der Vielfalt, Zirkularität: Wie kann etwas, für das erst gesorgt werden muss und sich einstellen wird (B) bereits vorgängig als Legitimationsinstanz für das Handeln herangezogen werden? Problem Ist V. a priori wertvoll oder braucht es eine moralisch-ethische Ergänzung z.B. als Reflexion? Ist V. nicht eine unzumutbare Zumutung? Probleme Wertgenese, Legitimation, Regulation der Vielfalt, (...) © D. Bremer 20.02.2005 151 Tendenzen in der aktuellen Verantwortungsdiskussion Verursacherverantwortung Treuhänder- / Hege-Verantwortung rückwirkend zuschreibende Ex-Post-Verantwortung prospektiv ausgerichtete Sorge-für-Verantwortung vergangenheitsorientierte Handlungsresultatsverantwortung zukunftsorientierte, durch Kontrollfähigkeit und Machtverfügbarkeit bestimmte Seins-Verantwortung Individualistischer Verantwortungsbegriff universale Verantwortung für die Menschheit, Natur im Ganzen homogener, zweistelliger Begriff heterogener, mehrstelliger Begriff, vieldeutig Literatur Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt a.M. 1982. Lenk, Hans: Verantwortung und Gewissen des Forschers. In: Wissen und Gewissen. Hg. v. Otto Neumaier. Wien 1986, S. 35-55. Lenk, Hans / Ropohl, Günter: Technik und Ethik. Stuttgart 1987. RUB 8395. Picht, Georg: Wahrheit, Vernunft, Verantwortung. Philosophische Studien. Stuttgart 1969. Sänger, Monika (Hg.): Verantwortung. Arbeitstexte für den Unterricht. Stuttgart 1991. RUB 15022 152 8.2 Würde Der Begriff der Menschenwürde – seine Herkunft und Bedeutung Zwei verschiedene Würdebegriffe Seine wesentliche Prägung erfuhr der Begriff der menschlichen Würde oder Personenwürde im Laufe der Jahrhunderte durch die jüdisch-christliche Tradition ebenso wie durch die Philosophie, insbesondere die Philosophie der Stoa und dann vor allem in der Ethik Kants. Aber auch die neuzeitlich liberale Menschenrechtstradition, die von der Französischen Revolution ausging, leistete für sein heutiges Verständnis und seine gesellschaftspolitische Relevanz ihren unverzichtbaren Beitrag. Bereits in der Antike ist der Begriff der Menschenwürde in zwei bis heute noch vorfindbaren Bedeutungen anzutreffen. Cicero112 spricht von Würde – dignitas – einer Person zur Auszeichnung seiner Stellung und seines Ranges innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. In diesem Sinne wird „Würde“ auch im Begriff „Würdenträger“ deutlich. In anderem Sinne äussert sich Cicero113 aber auch, dass bestimmte Formen des Lebens mit der Würde der menschlichen Natur als Vernunftwesen nicht vereinbar sind. Man kann im Sinne der ersten Bedeutung auch von kontingenter oder prädikativer Würde sprechen. „Kontingent“ sind Sachverhalte, die gerade so sind, wie sie sich uns zeigen, die aber problemlos auch anders sein könnten. „Prädikativ“ ist dieser Würdebegriff, weil Würde bestimmten Dingen oder Personen zugesprochen (prädiziert) werden kann. Im Gegensatz dazu kann die zweite Bedeutung des Begriffs als notwendige, inhärente oder immanente Würde bezeichnet werden. „Notwendig“ sind Sachverhalte, die so sein müssen, wie sie sind und gar nicht anders sein können. „Inhärent“ ist diese Form der Würde, weil sie einem Gegenstand oder Lebewesen unveräusserlich (inhaerere = darin hängen, immanere = in der Hand sein) ist. Letztere Bedeutung findet sich z.B. in der bekannten Formulierung im deutschen Grundgesetz oder der Schweizerischen Bundesverfassung wieder, dem gemäss die Würde des Menschen „unantastbar“ ist. Man beachte auch die Formulierung der UNOMenschenrechtsdeklaration, die von einer „inherent dignity (…) of all members of the human family“114 spricht. Beiden Begriffen ist zunächst gemeinsam, dass sie Würde im Hinblick auf eine Teilhabe des Menschen an einem grösseren religiösen, gesellschaftlichen, rechtlichen, moralischen oder metaphysischen Rahmen beziehen. Hat der Mensch für die Stoa Würde, weil er am kosmischen Logos Anteil hat, wird in der jüdisch-christlichen Tradition der Patristik die Imago-DeiKonzeption vertreten, die den Menschen aufgrund seiner Ebenbildlichkeit Gottes mit inhärenter Würde ausstattet. Einen ersten Schritt in die neuzeitliche Würdeauffassung macht Pico della Mirandola115, der die Menschenwürde noch innerhalb der Gottesebenbildlichkeitsvorstellung neu an die dem Menschen von Gott gleichermassen gegebene Freiheit der Bestimmung knüpft. Mit der Neuzeit rückt zusehends die Bestimmung der Würde aufgrund menschlicher Vernunft in den Brennpunkt. So hält Pascal fest: „Unsere ganze Würde besteht also im Denken, an ihm müssen wir uns aufrichten und nicht am Raum und an der Zeit, die wir doch nie ausschöpfen werden. Bemühen wir uns also, richtig zu denken, das ist die Grundlage der Sittlichkeit.“116 112 Cicero: De inv. II, 166: dignitas est alicuius honesta et cultu et honore et verecundia digna auctoritas. Cicero: De off. I, 106. 114 Zitiert nach Gewirth, Alan: Human Dignity as the Basis of Rights, in: Meyer, Michael J. & Parent, William A. (eds.): The Constitution of Rights. Human Dignity an American Values, Ithaca: Cornell University Press 1992, S. 12. 115 Pico della Mirandola, Giovanni: Über die Würde des Menschen. De hominis dignitate [1496], Übers. Von Herbert Werner Rüssel. Zürich, 1989. 116 Pascal, Blaise: Pensées. Gedanken. Übersetzt von Ewald Wasmuth. Stuttgart 1956. Pensée 347, S. 74. 113 In der Neuzeit holt sich in der Würdekonzeption Immanuel Kants der Mensch seine Legitimation nicht länger heteronom (fremdbestimmt) aus einem metaphysischen oder religiösen Rahmen, sondern aus dem Faktum der Autonomie und menschlicher Vernunft, die sich in Freiheit selbstgesetzgebend dem höchsten Sittengesetz unterstellt. Die Würde des Menschen ist ihm ein „unvergleichlicher Wert“ bzw. „Zweck an sich“117 und kann niemals gegen irgendwelche konkret bestimmte andere Werte aufgewogen werden. Sie ist unverhandelbar und dem Menschen als Zweck an sich selbst aufgegeben. Man kann angesichts dieser Entwicklung des Würdebegriffes das Subjektsein des Menschen doppelt auffassen. Einerseits ist der Mensch ein Wesen, das sein Leben bewusst, d.h. aus freien vernünftigen Entscheidungen selber vollzieht. Der Mensch ist insofern autonom, als er sich selber Ziele zu setzen vermag, die er unter den Bedingungen des Lebens mit einem gewissen Mass an Freiheit selbständig anstreben und erreichen kann. Der Mensch ist seiner Autonomie würdig. Andererseits ist der Mensch ein Wesen, dessen Freiheit über die empirisch wahrnehmbare Ebene hinausgeht, diese transzendiert hin auf einen Rahmen, in den er je eingebettet bleibt. Beide Aspekte kommen in den folgenden alltagssprachlichen Zugängen zum Ausdruck. Kontingente Würde Würde in diesem Sinne lässt sich durch drei Eigenschaften charakterisieren: Sie ist zum einen übertragbar. Die Würde kann errungen, übergeben und wieder verloren werden. Man denke hierbei an die alltagssprachliche Redeweise vom „würdigen Sieger“. Zweitens ist dieser Würdebegriff dadurch bestimmt, dass er graduell gedacht wird: Würde kann in Stufen verschiedene Grade erreichen, von dem Verdikt „unter aller Würde“ bis zur „höchsten Würde“ findet er breite Verwendung. Drittens ist auffallend, dass dieser Würdebegriff unter Menschen sehr ungleich verteilt ist. Wegen dieser drei Eigenschaften der Übertragbarkeit, Gradualität und Ungleichverteilung sowie dem Umstand, dass diese Würde von Menschen anderen Menschen oder Gegenständen zugesprochen wird, spricht man auch von prädikativer oder kontingenter Würde. Es gibt mehrere auffällige Verwendungsweisen von kontingenter Würde. Spricht man von einer „würdevollen Zeremonie“, einem „würdigen Auftritt“, einem „würdigen Tod“ so sind ästhetische Wertungen mit dem kontingenten Würdebegriff verbunden. Man misst etwas an einem idealen Massstab. Wird von einem Sieger ausgesagt, dass er seines Sieges würdig ist, so meint man damit, dass der Sieg verdient wurde. Man kann hier vom Übertragen einer gesellschaftliche Würde, einem „Würdeklassenwechsel“ sprechen, genauso wie etwa ein Bischof zum „Würdenträger“ aufgrund besonderer Verdienste erhoben werden kann. Umgekehrt kommt der Verpflichtungscharakter, der mit dieser gesellschaftlichen Würde verbunden ist, etwa in der Redeweise „Würde bringt Bürde“ zum Ausdruck. Anders schliesslich wird der Begriff verwendet, wenn jemand eine Prozedur „mit Würde“ über sich ergehen lässt, sei es eine Prüfung oder eine Feier. Dann wird „Würde“ zum Ausdruck von Charakterstärke, man kann deshalb auch von expressiver Würde sprechen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man den Geltungsaspekt des Wertes kontingenter Würde betrachtet: Geltung ist ein mindestens vierstelliges Prädikat: etwas gilt als etwas für jemanden bezüglich eines Wertmassstabes. Wer diskursiv einen kontingenten Würdebegriff verwendet, sollte Rechenschaft über die entsprechenden Geltungsbedingungen dieses Wertes ablegen können. Nur so wird der situativ vorliegende axiologische118 Kontext deutlich, der den Verpflichtungs- und Geltungsgrad eines Wertes zum Ausdruck bringt oder erzeugt. 117 118 Kant, I.: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [1785], 1974: BA 79,80. Axiologie = Wertlehre, value theory; spezifische Binnendiziplin der philosophischen Ethik 154 Inhärente Würde Die Unveräusserlichkeit der inhärenten Würde des Menschen lässt zunächst an die Grundrechte denken. In ihnen wird die moralrechtliche Dimension des Würdebegriffes deutlich. Wer nachfragt, was denn nun konkret unter inhärenter Würde zu verstehen sei, bemerkt, dass die Frage nicht leicht zu beantworten ist. Sind es in religiösen Kontexten Würdezusprechungen aufgrund von Quellen des Offenbarungswissens, bei Kant die autonome Selbstlegitimation aufgrund der Vernunft, so wird in juristischen Kontexten auch dazu tendiert, die Menschenwürde „als Wert der Person an sich zu betrachten bzw. als etwas, das zur menschlichen Naturausstattung gehört“.119 Umstritten ist die Frage, ob es die vorliegenden Menscherechte sind, die allererst den Menschen ihre unveräusserliche Würde verleihen (Primat des Rechts und der Moral), oder umgekehrt die Menschenrechte die dem Menschen inhärierende und unveräusserliche Würde nur zum Ausdruck bringen (Primat der Würde). Bestünde dieses Zum-Ausdruck-bringen der Würde zum Beispiel darin, dass Menschen über einen gewissen Grad an Autonomie verfügen und ebenso der Fähigkeit, seine Rechte auch einfordern zu können120, so müsste man sich überlegen, ob etwa Dementen, Unzurechnungsfähigen, Geisteskranken oder Kindern Würde zukomme oder nicht. Solche Überlegungen stehen aber in deutlichem Widerspruch zum Würdebegriff der Menschenrechtskonvention. Mit Parent121 könnte man hingegen versuchen, Menschenwürde mittels des kantischen Diskriminierungsverbotes zu verbinden: Menschenwürde ist das, was verletzt wird, wenn eine Person erniedrigt wird. Erniedrigungen können geschehen durch strukturelle oder personale Gewalt, wie Repressive Gesetzgebungen, erdrückende Armut, Menschenhandel, das ökonomische Verfügen über human resources oder Folter. Dabei werden Menschen nicht als Zweck an sich selbst, sondern bloss als Mittel instrumentalisiert. Inhärente Menschenwürde könnte so als Recht, nicht erniedrigt zu werden, aufgefasst werden und wäre nicht zwingend mit dem Verfügen über autonome Vernunftfähigkeiten verbunden. Eine grundlegende Schwierigkeit, die entsteht, wenn „Würde“ als ein innerer Wert einer Person bestimmt wird, also als eine Eigenschaft, die seinem Wesen als Mensch eigentümlich ist, ist, das „Würde“ dann formal betrachtet ungeeignet ist, moralische Normen zu begründen. Dies deshalb, weil man dann jeweils von einem Sein auf ein Sollen schliessen würde, was, wie David Hume gezeigt hat, formal unzulässig ist: Aus einem Faktum, dass ein Patient Schmerzen leidet, darf – logisch gesehen – nicht geschlossen werden, dass man auch in diesem Fall seine Schmerzen lindern soll. Das wäre nur dann zulässig, wenn ein allgemeiner Sollenssatz gelten würde, der besagt, dass immer wenn ein Patient Schmerzen leidet, man dessen Schmerzen auch lindern sollte. Mit anderen Worten: Würde ein Patient über „Würde“ als Eigenschaft verfügen, so dürfte man daraus kein Sollen ableiten – ausser es könnte plausibel gezeigt werden, dass der Zuspruch, dass Menschen Würde haben sollen, berechtigte allgemeine Geltung hätte. Wie aber soll so ein allgemeiner Sollenssatz begründet werden? Im Falle eines Rekurses auf Seiendes wird die Argumentation zirkulär: Ein Patient ist würdig, weil ihm Würde zugesprochen werden kann; zugesprochen aber kann ihm „Würde“ weil er bereits über die Eigenschaft der Würde wesentlich verfügt. Im anderen Falle einer versuchten rationalen Begründung des allgemeinen Sollenssatzes droht ein unendlicher Regress. Was also tun? Woraus aber wird ein solcher Sollenssatz allgemeiner Würde sinnvollerweise abgeleitet? 119 Nipperdey, H.C.: Die Würde des Menschen, in: Bettermann / Neumann / Nipperdey (Hrsg.): Die Grundrechte. Hb. der Theorie und Praxis der Grundrechte 2: Die Freiheitsrechte in Deutschland. 1964, S. 1ff. 120 Vgl. Feinberg, Joel: Rights, Justice and the bounds of liberty, Princeton 1980; S. 151f. 121 Parent, William A.: Constitutional Values and Human Dignity, in: Meyer, Michale J. & Parent, William A. (eds.): The Constitution of rights. Human dignity and American Values, Ithaca 1992. 155 Zum Umgang mit Würdebegriffen in Pflege und Medizin Für den Würdebegriff in Pflege und Medizin wird hier offenkundig, dass individualethisch ansetzende Würdebegriffe wie die kontingenten nicht ausreichen, um instrumentellen Missbrauch der Menschenrechte eines Patienten, Angehörigen, Arztes oder Pflegenden zu schützen, andererseits die inhärenten Fassungen des Würdebegriffes das sozialethische Problem aufwerfen, wann und gemäss welchem Kriterium ein Zur-Geltung-bringen oder eine Berufung auf inhärente Würde im konkreten Pflegefall jeweils gegeben sind. Dies wird z.B. besonders bedeutsam bei Fragen, ob lebensverlängernde Massnahmen bei Sterbeprozessen noch angesagt sind oder bei Zweifeln über die Würdigkeit bestimmter Therapieformen für Demenz. Im ethischen Diskurs können die unterschiedlichen Auffassungen von Würde, die Teilnehmer zur Sprache bringen, mit den obigen Kategorisierungen untersucht werden. Überdies liefern sie eine Terminologie der Würde, die es erlaubt, in einen die Grenzen menschlicher Unwürdigkeit streifenden Fall präzise einzugreifen – auch wenn das Problem des Würdekriteriums bislang eine schwierige und offene Frage geblieben ist. Gerade deshalb erlangt die Gesprächkultur dort, wo sie möglich ist und die Bedingungen dafür gegeben sind, eine hohe Bedeutung. Sie stellt den Ort des möglichen interaktiven Erwerbs einerseits von Problemwissen und andererseits von Problemumgangskompetenz dar. Am Beispiel des Würdebegriffs erläutert hiesse dies, dass Mediziner und Pflegefachkräfte situativ in der Lage wären, unterschiedlich begründete Auffassungen von alternativen Würdekonzeptionen in ein Gespräch einfliessen zu lassen, wenn etwa ein bestimmter Gebrauch der Worte „würdig“ oder „Würde“ bei sich oder bei anderen problematisch scheint der Empörung auslöst. Die folgenden Fragen können helfen, in ethischen Diskursen, bei denen Würdebegriffe auftauchen und relevant werden, nachzufragen und zu präzisieren, um welche „Würde“ es geht und gleichzeitig herauszufinden, wie es um das Problembewusstsein der jeweiligen Würdevertreter zur Würdeproblematik bestellt ist. Untersuchungs- und Sondierungsfragen zum Umgang mit „Würde“ Von welcher Geltungsauffassung von „Würde“ wird ausgegangen: einer unbedingt, notwendig geltenden, „unveräusserlichen“ Geltung oder von einer graduellen, kontingenten Geltung? Wird ein Unterschied zwischen allgemeiner (z.B. Gattungswürde) oder individueller Würde (z.B. hat Frau Meier eine Individualwürde als Frau Meier) gemacht? Was steht am Anfangspunkt der Rede von „Würde“: Eine Absicht Eine Empörung? Ein Zweifel? Ein Wissen? Eine Meinung? Eine Gesinnung? ....? Trägt mein/unser Denken, Sprechen und Handeln bzw. das Denken, Sprechen und Handeln Anderer Züge von Diskriminierungen? Gibt es möglicherweise unzureichend erklärte oder nachlässig undifferenzierte Kategorisierungen, die stigmatisierend wirken? Sind solche stigmatisierenden Kategorisierungen kontextvariant (situativ angemessen) oder kontextinvariant (überzeitliche, ewige Geltung beanspruchend)? Wie ist mit dem Würdeparadoxon umzugehen, das besagt, dass „Würde“ als Menschenrecht zwar unantastbar und unveräusserlich sei, diese aber gleichzeitig permanent missachtet und verletzt wird? Verschweigen? Thematisieren? Einseitig auslegen? Instrumentalisieren? ...? 156 (...) Texte zum Begriff der Menschenwürde Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UNO), New York 1948, Artikel 1 (Menschenwürde): Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Schweizerische Bundesverfassung, Artikel 7, Menschenwürde: Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Cicero: De inventione II, 166: Kontingente Würde Nunc de eo in quo utilitas quoque adiungitur, quod tamen honestum vocamus, dicendum videtur. Sunt igitur multa quae nos cum dignitate tum quoque fructu suo ducunt; quo in genere est gloria, dignitas, amplitudo, amicitia. Gloria est frequens de aliquo fama cum laude; dignitas est alicuius honesta et cultu et honore et verecundia digna auctoritas; amplitudo potentiae aut maiestatis aut aliquarum copiarum magna abundantia; amicita voluntas erga aliquem rerum bonarum illius ipsius causa quem diligit cum eius pari voluntate. Nun denke ich, sollten wir über das sprechen, was mit dem Nützlichen verbunden wird, und das wir nichtsdestoweniger ehrenvoll nennen. Es gibt nämlich viele Dinge, die uns nicht nur wegen ihrer Würde (ihrem inneren Wert), sondern auch wegen ihrer Nützlichkeit anziehen; zu dieser Klasse gehören Ruhm, Würde, Einfluss und Freundschaft. Der Ruhm einer Person besteht in einem weit verbreiteten Ruf mitsamt dem dazugehörigen Lob; die Würde ist der Besitz eines ausgezeichneten Amtes, welches Verehrung, Ansehen und Hochachtung verdient. Einfluss ist eine Fülle von Macht, Würde oder Quellen dieser Art. Freundschaft ist der Wunsch, jemandem Gutes zu tun nur um des Nutzens der Person willen, die man liebt und die gleichen Willens ist. (Cicero: De Inventione. Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts and London 1960, S. 333; Übersetzung D. Bremer) Cicero: De officiis I, 106: Inhärente Würde Ex quo intellegitur corporis voluptatem non satis esse dignam hominis praestantia eamque contemni et reici oportere, sin sit quispiam, qui aliquid tribuat voluptati, diligenter ei tenendum esse eius fruendae modum. Itaque victus cultusque corporis ad valitudinem referatur et ad vires, non ad voluptatem. Atque etiam, si considerare volemus, quae sit in natura <nostra> excellentia et dignitas, intellegemus, quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac molliter vivere, quamque honestum parce, continenter, severe, sobrie. Daraus ersieht man, dass körperliches Vergnügen der erhabenen Stellung des Menschen nicht genug würdig ist und verschmäht und zurückgewiesen werden muss; wenn es aber einen gibt, der dem Vergnügen einigen Wert beilegt, so muss der sorgsam ein Mass des Geniessens einhalten. Es sollen also Unterhalt und Pflege des Körpers auf Gesundheit und Kraft, nicht auf das Vergnügen bezogen werden; ferner: wenn wir bedenken wollen, eine wie überlegene Stellung und Würde in <unserem> Wesen liegt, dann werden wir einsehen, wie schändlich es ist, in Genusssucht sich treiben zu lassen und verzärtelt und weichlich, und wie ehrenhaft andererseits, sparsam, enthaltsam, streng und nüchtern zu leben. (Cicero: De officiis. Vom pflichtgemässen Handeln. Übersetzt von Heinz Gunermann. Stuttgart 1992, S. 93-95.) 157 Friedrich Schiller „Über Anmut und Würde“ 1793: graduelle Würde So wie die Anmut der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist Würde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung. (…)Beherrschung der Triebe durch moralische Kraft ist Geistesfreiheit, und Würde heisst ihr Ausdruck in der Erscheinung. (…) Anmut liegt also in der Freiheit der willkürlichen Bewegungen; Würde in der Beherrschung der unwillkürlichen. (…) Würde wird daher mehr mit Leiden (pathos); Anmut mehr im Betragen (ethos) gefordert und gezeigt; (…) Auch die Würde hat ihre verschiedenen Abstufungen und wird da, wo sie sich der Anmut und Schönheit nähert, zum Edlen, und wo sie an das Furchtbare grenzt, zur Hoheit. Der höchste Grad der Anmut ist das Bezaubernde; der höchste Grad der Würde die Majestät. (Friedrich Schiller, Werke in drei Bänden. Hg. Von Herbert G. Göpfert, München 1966, Band II, S. 382-424) Immanuel Kant: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“1785: inhärente Würde Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent gestattet, das hat Würde. (…) das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloss einen relativen Wert, d. i. einen Preis, sondern einen innern Wert, d. i. Würde. Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann; weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebendes Glied im Reiche der Zwecke zu sein. Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, dasjenige, was allein Würde hat. (…) Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur. (Immanuel Kant: Grundlagen zur Metaphysik der Sitten. Hg. von Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1956, Band 6, S. 68-69) Friedrich Nietzsche: Würde als Ausdruck der Empörung über Ungleichheit Man protestiert im Namen der Menschenwürde: das ist aber, schlichter ausgedrückt, jene liebe Eitelkeit, welche das Nicht-gleichgestellt-sein, das Öffentlich-niedriger-geschätzt-werden als das härteste Los empfindet. (Friedrich Nietzsche, Werke, Hg. Von Karl Schlechta, 1956, Band 1, S. 674) Pico della Mirandola (1463-1494): De dignitate hominis / Über die Würde des Menschen (posthum Bologna 1496) Verehrte Väter! In arabischen Schriften habe ich folgendes gelesen. Man fragte einmal den Sarazenen Abdallah, was ihm auf dieser Welt, die doch gleichsam eine Schaubühne wäre, denn am bewunderungswürdigsten vorgekommen wäre. Darauf antwortete jener, nichts scheine ihm bewunderungswürdiger zu sein als der Mensch. Dieser Meinung kann man auch noch den Ausspruch des Merkurius hinzufügen: „Ein grosses Wunder, o Asklepius, ist der Mensch.“ Als ich diese Aussprüche einmal recht überlegte, erschienen mir die traditionell überlieferten Meinungen über die menschliche Natur etwas unzulänglich. So zum Beispiel die Meinung, der Mensch sei ein Bote und Vermittler zwischen den Geschöpfen; er sei ein Freund der Götter; er sei der König der niederen Sinne durch die klare Erforschung seiner Vernunft und durch das licht seines Verstandes; er sei der Dolmetscher der Natur; er sei ein Ruhepunkt zwischen der bleibenden Ewigkeit und der fliessenden Zeit; oder er sei nach Aussagen der Perser das Band, das die Welt zusammenhält; er sei sogar das Hochzeitslied der Welt; er stehe schliesslich nach dem Zeugnisse Davids nur wenig unter den Engeln. Das sind wahrlich alles hohe Eigenschaften, aber darin liegt nicht die Hauptsache, nämlich warum gerade der Mensch den Vorzug der höchsten Bewunderung für sich in Anspruch nehmen solle. Warum bewundern wir denn nicht mehr die Engel und die seligen Chöre des Himmels? Ich habe mich schliesslich um die Einsicht bemüht, warum das glücklichste und aller Bewunderung würdigste 158 Lebewesen der Mensch sei und unter welchen Bedingungen es möglich sein konnte, dass er aus der Reihe des Universums hervortritt, beneidenswert nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Sterne, ja sogar für die überweltlichen Intelligenzen. Oder warum nicht? Denn auch deswegen wird der Mensch mit vollem Recht für ein grosses Wunder und für ein bewunderungswürdiges Geschöpf geheissen und gehalten. Wie sich das aber nun verhält, verehrte Väter, das höret an und bringt mit geneigten Ohren und milder Gesinnung meiner Arbeit euere Wohlwollen entgegen. Bereits hatte Gottvater, der höchste Baumeister, dieses irdische Haus der Gottheit, das wir jetzt sehen, diesen Tempel des Erhabensten, nach den Gesetzen einer verborgenen Weisheit errichtet. Das überirdische Gefilde hatte er mit Geistern geschmückt, die ätherischen Sphären hatte er mit ewigen Seelen belebt, die materiellen und fruchtbaren Teile der unteren Welt hatte er mit einer bunten Schar von Tieren gefüllt. Aber als er dieses Werk dann vollendet hatte, da wünschte der Baumeister, es möge jemand da sein, der die Vernunft eines so hohen Werkes nachdenklich erwäge, seine Schönheit liebe, seine Grösse bewundere. Deswegen dachte er, nachdem bereits alle Dinge fertiggestellt waren, wie Moses und der Timaeus bezeugen, zuletzt an die Schöpfung des Menschen. Nun fand sich aber unter den Archetypen in Wahrheit kein einziger, nachdem er einen neuen Sprössling hätte bilden sollen. Auch unter seinen Schätzen war nichts mehr da, was er seinem neuen Sohne hätte als Erbe schenken sollen, und unter den vielen Ruheplätzen des Weltkreises war kein einziger mehr vorhanden, auf dem jener Betrachter des Universums hätte Platz nehmen können. Alles war bereits voll, alles unter die höchsten, mittleren und untersten Ordnungen der Wesen verteilt. Aber es wäre der väterlichen Allmacht nicht angemessen gewesen, bei der letzten Zeugung zu versagen, als hätte sie sich bereits verausgabt. Es hätte seiner Weisheit nicht geziemt, wenn sie aus Mangel an Rat in einer notwendigen Sache geschwankt hätte. Es wäre der milden Liebe nicht würdig gewesen, dass derjenige, der bei andern Geschöpfen die göttliche Freigebigkeit loben sollte, bei sich selbst gezwungen wäre, diese zu verdammen. Daher beschloss der höchste Künstler, dass derjenige, dem etwas Eigenes nicht mehr gegeben werden konnte, das als Gemeinbesitz haben sollte, was den Einzelwesen ein Eigenbesitz gewesen war. Daher liess sich Gott den Menschen gefallen als ein Geschöpf, das kein deutlich unterscheidbares Bild besitzt, stellte ihn in die Mitte der Welt und sprach zu ihm: „Wir haben dir keinen bestimmten Wohnsitz noch ein eigenes Gesicht, noch irgendeine besondere Gabe verliehen, o Adam, damit du jeden beliebigen Wohnsitz, jedes beliebige Gesicht und alle Gaben, die du dir sicher wünschst, auch nach deinem Willen und nach deiner eigenen Meinung haben und besitzen mögest. Den übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von uns vorgeschriebenen Gesetze bestimmt und wird dadurch in Schranken gehalten. Du bist durch keinerlei unüberwindliche Schranken gehemmt, sondern du sollst nach deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand ich dein Geschick gelegt habe, sogar jene Natur dir selbst vorherbestimmen. Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von dort bequem um dich schaust, was es alles in dieser Welt gibt. Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu entarten. Es steht dir frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluss deines eigenen Geistes zu erheben.“ (Pico della Mirandola: Über die Würde des Menschen. Aus dem Neulateinischen übertragen von Herbert Werner Rüssel. Zürich 1989, S.7-11) Krockow, Chr. Graf von, 1958: Dezisionistische Würde Der Mensch kann versuchen, nicht nur die ihm vorgegebenen Ordnungen durch bewusste Orientierung an universalen Normen umzuformen, sondern alle transzendenten Normen überhaupt abzuwerfen, um sich einzig auf sich selbst, das Wagnis und die Würde seiner je eigenen Entscheidung zu stellen. (Krockow, Chr. Graf v.,1958: Die Entscheidung. Eine Untersuchung über Ernst Jünger, Carl Schmitt, Martin Heidegger. Frankfurt a.M. 1990, S. 4.) 159 Helmuth Plessner, 1948: Skeptische Würde exzentrischer Positionalität Jedoch übernimmt der Schauspieler, ob gut oder schlecht, in jedem Falle die Aufgabe, seiner Rolle eigene Figur zu sein. In dieser extremen Möglichkeit, zu der das Leben nur in Ausnahmen und festlicherweise Gelegenheit bietet und nur Träger seiner grossen Rollen, zur Hauptsache den Priester und der Herrscher, befugt, wird der Menschendarsteller zum Repräsentanten menschlicher Würde. Der Menschheit Würde ist in seine Hand gegeben. Aber diese Würde hat ihre Wurzel nicht allein in der Ebenbildlichkeit zu Gott, sondern ebenso sehr in dem mit der Abständigkeit zu sich gegebenen Abstand zu ihm. Würde besitzt allein gebrochene Stärke, die zwischen Macht und Ohnmacht gespannte zerbrechliche Lebensform. Ihre Überlegenheit über das blosse Leben, die in ihren geistigen Äusserungen vernehmbar wird, erkauft sie mit Hemmung und Unterlegenheit im blossen Leben. So erweist sich in Kleists Erzählung Über das Marionettentheater der Bär dem Fechter überlegen. Mit der Entdeckung seiner selbst, diesem Über-sich-selbst-hinaus-Sein, dieser fatalen présence à soi hat der Mensch seine Freiheit gewonnen und die ungebrochene Sicherheit seiner Animalität verloren. Zwischen Natur und Gott, zwischen dem, was kein Selbst ist, und dem, was ganz selbst ist, steht der Mensch, der sein Selbst sich präsentiert. Er besitzt weder die ungehemmte Präzision der Marionette bzw. die Instinktsicherheit des Tieres noch die vollkommene Ursprünglichkeit unfehlbarer Verwirklichung. Er ist gebrochene Ursprünglichkeit, die nicht über sich selbst verfügt. Er fällt nicht mit dem zusammen, was er ist: dieser Körper, dieses Temperament, diese Begabung, dieser Charakter, insofern als er sie, sich von ihnen distanzierend, als dieses ihm gegebene Sein erkennt. Sie sind ihm zugefallen und ihrer Zufälligkeit bleibt er sich bewusst, ob er nun ihrer Herr wird oder nicht. Das, was er hat, hat er zu sein – oder nicht zu sein. In diesem Sich-selber-präsent-Sein liegt der Bruch, die ‚Stelle’ möglichen Sich-von-sichUnterscheidens, die dem Menschen im Zwang zur Wahl und als Macht des Könnens seine besondere Weise des Daseins, die wir die exzentrische genannt haben122, anweist. Sie exponiert ihn und setzt ihn damit besonderer Gefährdung aus, der er in den Korrekturen und Kompensationen der Kultur auf besonderen Wegen zu begegnen sucht. Auf diesem Weg macht er sich diese Situation selber durchsichtig, stellt sie vor und löst sich von ihr, im Bilde freilich nur und imaginativ: auf dem Wege des Schauspiels. Er gibt der Sich-Präsenz die Form und den Sinn der Trägerschaft der Rolle, der Repräsentation, welche den Träger und Darsteller aus der zufälligen Einheit mit sich in die künstliche Einheit mit dem Dargestellten bringt und im Spiel spielend bewahrt. (Plessner, Helmuth, 1948: Zur Anthropologie des Schauspielers. In: ders. Gesammelte Schriften. Band VII, S. 399-418. Frankfurt a.M. 2003, S. 416f.) Weiterführende Literatur zum Thema „Würde“ Angehrn, Emil / Baertschi, Bernard (Hrsg.): Menschenwürde. Studia Philosophica Vol. 63/2004, Basel 2004 Balzer, Philipp et al.: Menschenwürde vs. Würde der Kreatur. Begriffsbestimmung, Gentechnik, Ethikkommissionen. Freiburg i. Brsg., München 1999. Weingarten, Michael: Leben (bio-ethisch). Bibliothek dialektischer Grundbegriffe Band 4. Bielefeld 2003. 122 Zuerst in Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), in der vorliegenden Ausgabe Bd. IV; weiterhin in Macht und menschliche Natur (1931), in der vorliegenden Ausgabe Bd. V; und in Lachen und Weinen (1941), in diesem Band. S. 202-387. 160 8.3 Autonomie Vom Umgang der Rede von „Autonomie“ – Überlegungen aus ethischer Sicht Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich die vielen unterschiedlichen in Lexika und Büchern vorgeschlagenen und beschriebenen Begriffe zur „Autonomie“ durch genaue Lektüre, Reflexion und sogar mittels Diskussion mit Berufskolleginnen angeeignet. Sie fühlen Sich sogar ein wenig stolz, nun im Konzert der Rede von Autonomie mitreden zu können. An Fachsymposien getrauen Sie sich, in Fragen der Autonomie ein Wörtchen mitzureden und oft können Sie ihre Zuhörer von der Sinnhaftigkeit eines bestimmten Autonomieverständnisses überzeugen. Nun kommt aber es im Pflegealltagsgespräch zu folgender Szene: Sie betreuen zusammen mit einer Kollegin einen dementen Patienten und fragen sich, ob eine bestimmte pflegerische Handlung am Patienten gerade auch noch vorgenommen werden soll oder nicht. Die Zeit ist ohnehin knapp bemessen. Ihre Kollegin antwortet: „Ach lass mal, der kriegt ohnehin nicht mit, ob wir das nun tun oder nicht!“ Empört, aber nicht ohne ein wenig Stolz stellen Sie fest, dass sich sofort ihr ethisch geschultes Gewissen meldet und mit roten Blinklampen signalisiert: „Autonomie! Die Autonomie des Patienten ist in Gefahr!“ Wie aber sollen Sie reagieren? Es scheint, als stünde man in solchen Momenten vor einem doppelten ethischen Problem. Erstens gilt es zu bestimmen, welches Problem mit Autonomie hier vorliegt und um welchen Begriff von Autonomie es hier überhaupt gehen könnte. Das Spektrum reicht von Autonomie im Sinne eines gerade noch Wünschen Könnens des eigenen Zustandes über verschiedene Grade von Selbständigkeit (im Sinne einer Handlungsfreiheit) bis zur Vorstellung eines vernünftigen, unabhängigen, jederzeit frei und vernünftig selber entscheiden könnenden – hochgradig autonomen – Subjektes. Im Einzelnen drängen sich dabei unterschiedliche Bestimmungen des Begriffes von Autonomie auf. Wird sie – ihrem wörtlichen Sinn nach – als Gesetze gebend (die Vernunft ist fähig, sich selbst Gesetze zu machen), Gesetze habend oder bloss Gesetze befolgend aufgefasst? Meint sie Unabhängigkeit (wessen wovon?)? Oder freie Entscheidungsfähigkeit? Individualität? Kreativität? Individuelle Freiheit? Willensfreiheit? Wahlfreiheit? Wunschfreiheit? Handlungsfreiheit? Emanzipation? Selbständigkeit? Privatheit? Eigenmächtigkeit? Selbstregulierung? Reproduktionsfähigkeit? Beschränkt man sich darauf, solche Eigenschaften an einem Subjekt wahrzunehmen und ihm berechtigterweise zuzuschreiben, so stellt sich das Problem der richtigen Beurteilung und Einschätzung der Lage. Wann liegt nach welchen Kriterien welcher Begriff von Autonomie vor? Diese Bestimmung ist anspruchsvoll und schwierig, zumal wir nicht bloss im Hinblick auf unser Beispiel des Demenzpatienten, sondern auch bei allen anderen, unbeeinträchtigt vor sich hin lebenden Menschen ein Problem der Feststellung dieser Eigenschaften haben. Es handelt sich dabei um das alte, aber immer noch ungelöste Problem des Fremdpsychischen. Was wir allenfalls mit einiger Sicherheit feststellen können, wäre das Fehlen gewisser fremdkörperlicher Eigenschaften bei anderen. Verschiedentlich wurde bereits vorgeschlagen, diese Zuschreibung im Sinne einer Selbständigkeit von Autonomie abzugrenzen, weil man Autonomie eher auf im weitesten Sinne Kognitives beschränken kann. Man darf sich hierbei aber die berechtigte Frage stellen, was damit gewonnen wird. Geht man – wie oben bereits stillschweigend getan – davon aus, dass Körperliches und Seelisches123 (Bewusstsein, Geist, Urteilsvermögen, Verstandestätigkeit, etc.) tatsächlich existieren und trennbar seien, so scheint die These plausibel, dass auf einer materiellen Ebene aufgrund der 123 Ich verzichte an dieser Stelle auf die differenzierte Diskussion der mindestens sechzehn konkurrierenden, halbplausiblen Lösungsansätze zum Leib-Seele-Problem. Interessierten sei immer noch empfohlen: Hans Jonas: Macht und Ohnmacht der Subjektivität. Das Leib-Seele-Problem im Vorfeld des Prinzips Verantwortung. Frankfurt a. M. 1983. 161 physikalischen Annahme geschlossener Kausalketten im Universum so etwas wie absolute Autonomie von Körperlichem ausgeschlossen und unmöglich ist. Auf der Ebene des Bewusstseins hingegen kann durchaus davon ausgegangen werden, dass so etwas wie Autonomie möglich wäre. In der philosophischen Tradition hat man lange Zeit „Autonomie“ nicht nur mit Willenssondern oft mit Handlungsfreiheit in eins gesetzt. Wenn ich etwa tun will, also beabsichtige dies oder das zu tun, dann handle ich nur dann autonom, wenn ich nicht am Handeln gehindert werde. Im medizinisch-pflegerischen Bereich führt diese Auffassung aber zu grossen Schwierigkeiten, was man am Beispiel gerade handlungsunfähiger Patienten sehen kann. Dann würde etwa ein Komapatient im Zustand des Komas nicht als autonom gelten, obwohl er sein Bewusstsein und seine Handlungsfähigkeit wieder erlangen könnte, was in einigen Fällen ja erfreulicherweise auch eintritt. Man müsste bereits einen Zusatzbegriff wie „potentiell autonom“ einführen, um anzudeuten, dass Autonomiehoffnungen bestehen. Mag dieser Fall noch als problemlos handhabbar im Sinne einer korrekten Zuschreibung von Autonomie angesehen werden, so zeigt sich die am Beispiel einer 73 jährigen Alzheimerpatientin schon schwieriger. Sie hatte seit fünf Jahren aufgehört zu sprechen und lebte in einem Pflegeheim für Demente. Als mit ihr zufällig ein neues Therapiekonzept erprobt worden ist, das von der These ausging, dass eine Kontextveränderung bei einigen Demenzpatienten stimulierend wirken könnte, zeigte sich eine unerwartete Wirkung. Die Patientin reagierte beim Besuch eines Streichelzoos beim Anblick von Zwergziegen heftig, ging auf diese zu, bückte sich, um Gras zur Fütterung abzureissen und griff versehentlich in Brennnesseln. Das ausgesprochene „Aua! Ich muss sie doch füttern!“ war der erste Satz, den die Patientin nach einer fünfjährigen Schweigepause geäussert hatte. Ein ähnliches Beispiel, das ich selber in einer von mir moderierten philosophischen Gesprächsrunde mit Patienten mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen und Angehörigen 124 erlebt habe, war der Fall von Herrn F. Äusserlich wirkte er gezeichnet, ging mit Mühe am Stock, hatte Mühe beim Verrichten täglicher einfacher Tätigkeiten und wurde zusehends zum belastenden Pflegefall für seine Ehepartnerin. Fachärzte hatten eine Form von Demenz diagnostiziert. Seine Ehepartnerin beschrieb den dialogischen Umgang mit Herrn F. als zusehends schwieriger, er verstehe oft nicht richtig, reagiere falsch oder erzähle langfädig von Dingen aus der Vergangenheit, die keinen Bezug zu einer gestellten Frage hätten. Dennoch nahm Herr F. über ein Jahr lang regelmässig an den philosophischen Gesprächsrunden teil. Erstaunlicherweise blühte Herr F. in diesen Gesprächen richtiggehend auf. Er hatte, wie er selber erzählt hat, früher regelmässig Diskussionsrunden besucht und sich gedanklich und dialogisch mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Seine – angeblich verschwundenen – diskursiven und analytischen Kompetenzen zeigten sich im Gespräch auf unerwartete und erstaunliche Weise. Herr F. hörte dem beginnenden Gespräch in der Regel zunächst still zu. Nach etwa zwanzig Minuten, als meistens ein allererster phänomenologischer Rundgang das Meinungsspektrum und erste Erklärungs- und Rechtfertigungsversuche der Teilnehmer an den Tag gebracht hatte, meldete sich Herr F. nicht nur mit einem eigenen Beitrag, sondern stellte oft eine messerscharfe Analyse der methodischen Zugangsweise des bisherigen Gesprächsverlaufes in den Raum. So machte er sinngemäss öfters Bemerkungen der Art: „Das ist zwar interessant, aber wenn man auf diese Art weiterdiskutiert, läuft man Gefahr, den Punkt Y aus den Augen zu verlieren. Deshalb müsse man das Problem anders angehen…“ Bemerkungen dieser Art führten dann oft dazu, dass ein kurzer, aber intensiver philosophischer Binnendialog zwischen Moderator und Herrn F. stattfand, den die übrigen Gesprächsteilnehmer mit Erstaunen zur Kenntnis genommen haben. Mit der Zeit gewöhnte sich die Gesprächsrunde daran, einen zwar von aussen betrachtet gezeichneten, von seiner analytischen, rhetorischen 124 Bremer, Daniel: Philosophische Gespräche für Alzheimerpatienten und Angehörige. Ein Pilotprojekt. In: Printernet. Wissenschaftliche Fachzeitschrift für die Pflege Nr. 9, September 2004, S. 473-482. 162 und philosophischen Kompetenz aber hervorragenden Mitmenschen erfreulicherweise in der eigenen Runde zu wissen. Herr F. war stets selbstkritisch und ging im Anschluss an das Gespräch über Gebühr hart mit sich ins Gericht, was von allen Beteiligten aber umgehend dementiert wurde. Viele behielten Herrn F. in lobenswerter Erinnerung. Diese Beispiele zeigen zumindest, dass die Zuschreibung von Autonomie weder im Sinne von Handlungsfreiheit auf körperlicher Ebene, noch im Sinne eines der oben genannten Eigenschaftsbegriffe auf psychischer Ebene einfach zugeschrieben werden sollte – wie überhaupt das Zuschreiben von Eigenschaften bereits im Hinblick auf Dinge, geschweige denn auf Menschen oder gar auf Patienten – grundlegend problematisch ist. Dies liegt daran, dass – metaphysisch betrachtet – stillschweigend eine Konzeption von Substanz unseren Wahrnehmungsgewohnheiten unterstellt wird, der überdenkenswert und allenfalls erweiterbar ist. Man fasst gemäss dieser Vorstellung z.B. Menschen so auf, dass an einer Art neutralem Träger – meistens gedacht als individueller Körper plus eine Art „Kern des Selbst“ – bestimmte Eigenschaften sind. Diese Eigenschaften (Grösse, Haarfarbe, typische Sprechweisen, eine typische Gestik, etc.) seien im Unterschied zum unwandelbaren Kern des Selbstes veränderbar, sie können eine gewisse Zeit lang auftreten und können wieder verschwinden, ohne dass jemand sagen würde, wir seien nun jemand anderer geworden. Den Kern des Selbstes, andere sprechen von Identität und dergleichen, bliebe übrig, wenn man alle zufälligen Eigenschaften abstrahieren oder entfernen würde. Dann hätte man das vor sich, was etwa Herrn F. zu Herrn F. machen würde, sein Wesen. In ganz ähnlichem Sinne versucht man nun, verschiedene Begriffe von Autonomie entweder als zufällige Eigenschaften („Der Patient Y hat seine Autonomie verloren!“) oder als zum Kern des Selbstes gehörendes und überdauerndes Wesensmerkmal zu beschreiben („Auch wenn der Patient Y nun bereits fünf Monate künstlich beatmet wird, besitzt er Kraft seiner unveräusserlichen Würde als Mensch einen autonomen Kern, was es nicht erlaubt, die Apparate aus Kostenerwägungen abzustellen.“). Zwei Aspekte scheinen bei dieser Auffassung von Menschen und Dingen (die uns hier nur marginal interessieren) bedeutsam zu sein. Erstens die Beobachtung, dass Autonomie im Sinne von Unabhängigkeit oder gar Autarkie weder auf geistiger noch auf körperlicher Ebene möglich ist. Weder die Freiheit von etwas noch die Freiheit zu etwas verzichten auf eine Bezugnahme auf Kontexte geistiger oder physikalischer Art. Selbst Phantome wie „Freiheit an sich“ spekulieren zwar auf etwas Kontexttranszendentes oder Kontextinvariantes, rekurrieren aber semantisch doch auf die eine oder andere Form bedingter Freiheit, von denen oder im Gegensatz zu denen sich solch eine Behauptung in scheinbar souveräner Weise gebärdet. Der Ethiker Alasdair MacIntyre 125 ortet in der jahrhundertealten Annahme zahlreicher Ethiken, dass ein Mensch in moralischen Belangen selbständig und souverän denken, urteilen und entscheiden könne, sogar einen Hauptfehler. Menschen, die den Menschen als souveränes und unabhängiges Subjekt konzipieren, das stets im Vollbesitz seiner geistigen Vermögen das Gute und Richtige für alle beurteilen und verfolgen könne, verkennen dabei, dass sich der Mensch als primär animal und nur sekundär rationale immer und überwiegend in einem Netz sozialer und biologischer Abhängigkeiten befindet. Das Streben nach Autonomie ist deshalb, so seine These, nur ein vorübergehendes Zwischenziel menschlicher Entwicklung und Ausbildung. In zweiter Linie brauche es weitergehende Tugenden anerkannter Abhängigkeit, wie Grosszügigkeit oder Fürsorge, die über die Generationen hinweg dafür sorgen, dass die Spezies nicht nur erhalten, sondern auch in einer wünschenswerten Form des Zusammenlebens fortexistieren kann. In zweiter Linie kann und soll man sich fragen, ob die bislang erörterte Form der Auffassung von Autonomie als so und so wahrzunehmende, zu entwickelnde, zu erweiternde Eigenschaft an einem Träger dem Phänomen „Mensch“, wie es uns z.B. als Patient oder als „uns selbst“ 125 MacIntyre, Alasdair: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Über menschliche Tugenden. Hamburg 2001. 163 erscheint, gerecht wird. Denn Eigenschaften zu bestimmen, läuft auf die latente und nicht zu unterschätzende Gefahr hinaus, dass wir unsere Beobachtungen und unseren Blickwinkel so reduzieren, dass wir geneigt sind, am anderen nur noch diese und diese bestimmten Eigenschaften (und sonst nichts weiter) wahrzunehmen. Dies führt im Pflege- und Medizinalltag dann dazu, Menschen nur noch im Hinblick auf ein bestimmtes Merkmal zu reduzieren: „Haben Sie das Hämatom von Zimmer dreizehn schon versorgt?“ Nicht unoft wird, wie Pflegende berichten, dieser einen Menschen auf wenige oder nur eine Eigenschaft reduzierende und diskriminierende Jargon auch in Anwesenheit der Betroffenen verwendet, etwa wenn zwei Pflegende im gleichen Zimmer einen oder mehrere Patienten zu versorgen haben. Natürlich erfüllt dieser Jargon eine wichtige entlastende Funktion im Hinblick auf das psychologische Sich-von-etwas-distanzieren-Können und mag im stillen Kämmerlein der Arztund Pflegendenaufenthaltsräume berechtigterweise gepflegt sein. Doch bei in der Sache nach unbewanderten Patienten wirkt ein solches Sprechen schnell verletzend und schwächt das ohnehin schwer zu erringende Vertrauen des Patienten in die Institution und die Menschen, die dort arbeiten. Dem Eigenschafts-Träger-Modell unserer Auffassung von Wirklichkeit kann ein weiteres, zwar nahe liegendes, aber kaum je resolut oder konsequent durchdachtes und im Pflegealltag angewendetes Modell anbei gestellt werden: Das Prozessmodell. Als moderner und in vielen Bereichen der Gesellschaft bewanderter Denker hat Alfred North Whitehead diesen Ansatz erneut aufgegriffen und konsequent in seiner spekulativ angelegten „organistischen Philosophie“126 durchdacht. Zugrunde liegen unserer Wahrnehmung „wirkliche Ereignisse“ [actual entities], genauer gesagt: Prozessdinge. Es gibt nicht einen (ohnehin schwer zu identifizierenden) Träger, an dem sich der zeitliche Wandel der Eigenschaften abspielt, sondern die Wirklichkeit besteht in erster und grundlegender Weise aus Prozessen. Steine, Pflegende, Patienten, Krankheiten, Steuergesetze, Fakten, etc. sind ebenso Prozesse, wie etwa Ihr Lesen dieses Textes oder Ihr abschliessendes Urteil darüber. Aus dieser Prozesswirklichkeit, die Whitehead als weitläufiges Netz von Ereignissen denkt, leiten wir dann und wann aufgrund wiederholter Wahrnehmungen und Kategorisierungen Realitäten ab, die wir als überzeitlich aufzufassen gewohnt sind. Sie sind aber nur relativ stabil und ohne fortwährende Realisierung aus den grundlegenden Prozesswirklichkeiten nicht selbständig überdauerungsfähig. Jeder begrifflichen Realisierung von „Autonomie“ läge gemäss einer solchen Auffassung stets eine prozessuale Wirklichkeit zu Grunde. Was aber ist damit gewonnen? Ein Vorteil dieser Auffassung liegt darin, dass man nicht vorschnell ein zeitunabhängiges und mit der Zeit gerade deshalb problematisch werdendes kategorisch scharfes Urteil fällen muss. Ein solches birgt die Gefahren der (möglicherweise diskriminierenden) Reduktion des Patienten auf bestimmte Eigenschaften und trägt dem Problem der phänomenologischen Wahrnehmung von prozessual bedingten Veränderungen nicht unbedingt Rechnung, weil es den kritischen Blick allenfalls gerade verstellt. Ein Versuch, Autonomie als prozessuales „Wechselspiel“ im Verbund mit „Sicherheit“ zu denken, geht auf Baltes und Wahl (1992) zurück. Sie zeigen eine dynamische Auffassung von Autonomie als Zustand oder Modus an, wobei angenommen wird, dass der Patient zwischen Autonomie- und Sicherheitsbedürfnissen hin und herschwanke. Dabei gilt es die präzisierende Frage zu stellen, ob Pflegende etwa einen Patienten vor sich haben, der durch vermehrte Sicherheit in seiner Autonomie (in irgendeinem oder mehreren der oben beschriebenen Auffassungen) gestärkt oder umgekehrt sich dann gerade in seiner Autonomie bedrängt fühlt. Obwohl sich beide Phänomene beobachten lassen und man je unterschiedlich darauf reagieren kann, sind die hier abgeleiteten Vorstellungen von Autonomie schon weit weniger kategorisch scharf aufgefasst, als in den oben geschilderten Beispielen, wo ein Träger-Eigenschaftsmodell unterstellt wurde. 126 Whitehead, Alfred North: Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie. Frankfurt a. M. 1995, S. 21ff. 164 Es soll hier im Weiteren nicht der grundlegenden und schwierigen Frage nachgegangen werden, wie es tatsächlich um die Wirklichkeit bestellt ist. Wir wollen vielmehr fragen, was mit diesem Ausflug in die Lesart von Welt als einer Prozessualen im Hinblick auf das Problem der Auffassung von Autonomie anzufangen ist. Solange wir die Frage nach der Bestimmbarkeit von Welt ausgeklammert lassen, finden wir zumindest zwei verschiedenartige Auffassungsweisen von Autonomie: Autonomie als Eigenschaft oder Autonomie als Prozess. Ein Vorschlag des Umganges mit diesem Gegensatz geht in die Richtung, beide Auffassungsweisen beim Reden und Sprechen von und über Autonomie im mitdenkenden und betrachtenden Auge zu behalten und bei Gelegenheit auf die Problematik der Bestimmung von Autonomie einzugehen. Ein weiteres Problem stellt sich mit der Frage, ob und falls ja, wie dieses Wissen um diese (in diesem Fall zweifellos thematisierbaren) Fragen um Autonomie angewandt werden soll. Strategien zum Umgang mit ethischen Befunden und ethischem Wissen Die Frage mutet sonderbar und verdächtig an: Wie kann man eine Frage nach der richtigen Strategie des ethischen Einwandes stellen, wenn doch ein deutlicher Befund vorzuliegen scheint, dass ein offensichtliches moralisches Übel vorliegt? Bedarf es noch eines taktisch wohlüberlegten Kalküls, damit die moralische Botschaft ihren Adressaten erreicht? Genügt es nicht, seiner situativ aufgestauten Empörung freien Lauf zu lassen und spontan moralisch zu intervenieren? Lösen wir uns einen Moment lang von dieser Pflegesituation am Krankenbett und blenden über in den Bereich der seit Jahrhunderten unternommenen Versuche, Moral so zu lehren, dass nachhaltig ein gutes Verhalten oder sogar ein gutes Handeln möglich werde. Moralische Erziehung lief und läuft am einfachsten durch Androhung oder Ausübung von Sanktionen. Der übermässige Teil straffällig gewordener Personen bleibt bei einem einzigen geahndeten Rechtsübertritt und nur ein ganz kleiner Teil gehört zu den notorischen Straftätern, die wiederholt straffällig werden. Drohungen sind solange wirksam, als den zu Massregelnden auch ein sozialer Kontext umgibt, der ähnlich vorbildlich handelt. In einem solchen Kontext treten auch ab und zu abschreckende Beispielfälle auf, welche die schädigenden Konsequenzen der moralischen Behauptung verifizieren und rechtfertigen. So fällt es beispielsweise Patienten mit Alkoholabusus innerhalb eines abgegrenzten sozialen Umfeldes voller Vorbilder leicht(er), sich den anzueignenden moralischen Forderungen anzupassen und danach zu leben. Problematischer wird es allerdings, wenn sich ein Mensch in verschiedenen Kontexten zugleich aufhält. Jeder Kontext liefert von den anderen divergierende moralische Regeln oder ethische Begründungsprinzipien, die im Anwendungsfall zu sich ausschliessenden Handlungsanweisungen führen. Soll etwa alten Menschen auf Station, die sich weigern, gewaschen zu werden, im Sinne eines herangezogenen Begriffes der „Patientenautonomie“ oder der „Würde der Person“ stattgegeben werden – oder soll das ethische Leitbild der Pflegeeinrichtung, dass alles unternommen wird, um für das Wohl der Patienten zu sorgen, herangezogen werden, um ein tägliches Waschen gegen den Willen des Patienten zu legitimieren? Welche Bedingungen und Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein moralisch-ethisches Intervenieren überhaupt angebracht ist? In verschiedenen ethischen Ansätzen geraten die Konzeptionisten dieser Ansätze bei dieser Frage in Schwierigkeiten. Aristoteles setzt – wenn sich denn eine Art moralischer praktischer Vernunft allmählich entwickelt hat und moralisch gutes Handeln nicht mehr länger nur auf ein Befolgen moralisch guter Regeln abgestützt wird – auf eine Art situatives Erfassenkönnen der Problemlage. Nietzsche gründet seine Wertenstehungserklärung auf das Vorliegen einer Empörung. Regeldeontologen oder Regelutilitaristen setzen auf das Befolgen bestimmter guter 165 Regeln, die in sich gut sind oder sich bewährt haben. Handlungsdeontologen oder Handlungsutilitaristen setzen wiederum auf ein situatives Erfassenkönnen entweder der gerade situativ angesagten Prinzipien oder der angemessenen und erfolgversprechendsten Handlungen. Diese Liste liesse sich hier noch problemlos um mindestens zwei Dutzend zumindest halbplausible Erklärungsversuche erweitern.127 Sie provoziert aber nachgerade die Anschlussfrage nach dem „guten“ Umgang mit dieser Vielfalt. Soll man sie a) selektionieren? b) tolerieren? c) hierarchisieren? d) ignorieren? e) alles tun, je nach Situation? f) weder noch tun? g) weiterwursteln? h) sich dieser Frage stets neu stellen? i) dogmatisieren? j) ...? Ich schlage vor, diese Frage in aktiver Weise offen zu halten. Im Pflegealltag gilt es, Diskursangebotssignale auszusenden, die zum Gespräch einladen können. Reagiert der Kontext, so kann die Rede z.B. auf Autonomie und das Problem ihrer Bestimmung gebracht werden. Hilfreich ist dabei die Deklaration, wie und in welchem Sinne der gerade verwendete Begriff der Autonomie gebraucht wird: „Ja, wenn Sie „Autonomie“ so auffassen, dass… dann…“ oder „Geht man davon aus, dass „Autonomie“ als … aufgefasst wird, dann…“. Solche mit Diskursangebotssignalen versehenen Antworten sondieren zugleich mehreres. Wir wissen zunächst in der Regel gar nicht, ob unser Kontext diskurswillig oder diskursfähig ist. Reagiert der Kontext, so wird sich schnell eine differenzierte Diskussion einstellen, wenn erstens die Perspektive der gerade verwendeten Autonomiebegrifflichkeiten angedeutet wird und zweitens sogar der dahinter liegende Problemhintergrund. Gelingt es, den Diskurs so weit zu führen, dass die Beteiligten ein gerade zugrunde liegendes offenes Grundproblem erfassen, so kann es zu einem entlastenden und versichernden Solidarisierungseffekt kommen, der sich aus der Erkenntnis des bislang ungelösten und offenen Grundproblems erhebt. Dieser als Sicherheit in der Unsicherheit erfahrbare Moment setzt natürlich erstens ein fundiertes Wissen um die Bestimmbarkeit der Grenzen von „Autonomie“ voraus, zweitens eine Rede- und Problematisierungskompetenz, die das führen gelingender Gespräche ermöglicht und drittens eine Offenheit der anzusprechenden Personen im Kontext voraus. Literatur Bremer, Daniel: Philosophische Gespräche für Alzheimerpatienten und Angehörige. Ein Pilotprojekt. In: Printernet. Wissenschaftliche Fachzeitschrift für die Pflege Nr. 9, September 2004, 473-482. Bremer, Daniel: Ethische Kommissionen und Komitees. Skript zur Vorlesung an der KFH Freiburg i. Brsg. für Studierende des Pflegemanagements und der Pflegepädagogik im 6. Semester. Zürich 2004. Bremer, Daniel: Macht und Ohnmacht im Gespräch. Vortrag am Ethikforum für Ärzte und Pflegende vom 6. Oktober 2003 in der Klinik für Aktutgeriatrie am Stadtspital Waid. In: ders. Ethische Kommissionen und Komitees. Skript zur Vorlesung an der KFH Freiburg i. Brsg. für Studierende des Pflegemanagements und der Pflegepädagogik im 6. Semester. Zürich 2004. Hans Jonas: Macht und Ohnmacht der Subjektivität. Das Leib-Seele-Problem im Vorfeld des Prinzips Verantwortung. Frankfurt a. M. 1983. 127 Vgl. Bremer, Daniel: Ethische Kommissionen und Komitees. Skript zur Vorlesung an der KFH Freiburg i. Brsg. für Studierende des Pflegemanagements und der Pflegepädagogik im 6. Semester. Zürich 2004. 166 MacIntyre, Alasdair: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Über menschliche Tugenden. Hamburg 2001. Whitehead, Alfred North: Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie. Frankfurt a. M. 1995. 9. Mut zur Ethik! Das Studium von ethischen Ansätzen konturiert sich erst in der konkreten Erprobung im ethischen Diskurs, weshalb es, sofern "Ethik" in der Pflege zur Anwendung gelangen soll, nötig ist, die Elemente und Begrifflichkeiten in ständig angemessenerer Weise zu verwenden. Das Prädikat „angemessen“ verweist dabei auf viele verschiedenartige Aspekte, die im ethischen Sprechen wirksam sind und die viel zur Erfassung der Übersicht von Problemen beitragen und es deshalb kaum sinnvoll scheint, Diskurse etwa auf eine formale Kohärenzqualität besserer Argumentation zu reduzieren. Es ergeben sich bei solchen Anwendungsversuchen ohnehin ständig Probleme: Der tägliche Visitendiskurs beispielsweise ist vielfach derart ritualisiert und eingespielt, dass Einwände seitens ethisch orientierten Pflegepersonals oft als irritierende und deshalb unangebrachte Störfaktoren angesehen werden. Hier Lanzen für eine Gesprächsbereitschaft zu brechen, ist zwar schwierig, aber wünschenswert, obwohl die zeitliche und institutionelle Beschränkung einer eingehenden Erörterung enge Grenzen setzt. Ethische Bedenken müssten hier allenfalls in knapper, präziser und treffender Formulierung eingebracht werden, um überhaupt wirksam zu werden. Die Einwände müssen zudem gut begründet sein, da sonst verbale Abwehr seitens der Assistenz-, Stations- und Oberärzte erfolgen kann und den Pflegern die Ohnmacht gegenüber struktureller Macht spürbar werden lässt. Dennoch berichten Studierende von erfolgreichen ethischen Interventionen, selbst auf Intensivstationen oder gar von der erfolgreichen Gründung und Institutionalisierung ethischer Gesprächsplattformen in ihren Institutionen. Entgegen allen gut gemeinten Strukturbemühungen – selbst wenn sie zur gelingenden Institutionalisierung ethischer Gesprächsplattformen führen sollten –: sie entbinden nicht vor der permanenten Auseinandersetzung mit ethischen Fragen und Problemen. Bleibt zu sagen: Haben Sie Mut, sich ethisch zu engagieren! Stellen Sie sich der Reflexion ethischer Dilemmata und lernen Sie die grundlegenden Schwierigkeiten kennen, auszuhalten und konstruktiv umzusetzen! Auch und gerade hinsichtlich problematischer Fragen, die bislang offen geblieben sind… Lektüretipp für Zweifelnde: Martha C. Nussbaum: Vom Nutzen der Moraltheorie für das Leben. Übers. v. Joachim Schulte. Wien 2000. * * * 167 10. Anhang 10.1 Allgemeiner Tugendkatalog Tugenden Untugenden Tapferkeit Weisheit Mut Aufrichtigkeit Autonomie Selbstdisziplin Gehorsam Durchhaltewille Beständigkeit Mäßigkeit Anstand Glaube Nächstenliebe Hoffnung Demut Barmherzigkeit Keuschheit Offenheit Patriotismus Pflichtbewusstsein Ordnungsliebe Pünktlichkeit Fleiß Zielstrebigkeit Durchsetzungsgabe Anpassungsfähigkeit Eigeninitiative Treue Achtung vor Leben Flexibilität Dankbarkeit Mitmenschlichkeit Rücksichtnahme Toleranz Zurückhaltung Enthaltsamkeit Gerechtigkeit Besonnenheit Fürsorge Großzügigkeit Wohltätigkeit Klugheit Praktische Vernunft Phronesis Zuvorkommenheit Höflichkeit Schicklichkeit Hilfsbereitschaft Ambition Mitleid Empathie Ehrlichkeit / Redlichkeit Loyalität Takt Diskretion Beharrlichkeit Sanftmut Güte Genussfähigkeit Wahrhaftigkeit Mitfreude Teilnahme Verlässlichkeit Gründlichkeit Sanftmut Freigebigkeit Vorsicht Sinnenfreude Solidarität Geduld Selbstbeherrschung Selbstlosigkeit Ungerechtigkeit Lüge, Täuschung Eigensinnigkeit Geiz Hoffahrt Wollust (luxuria) Habgier (avaritia) Völlerei (gula) Zorn (ira) Trägheit (accidia) Neid (invidia) Hochmut, Stolz (superbia) Prunksucht Genusssucht Schwelgerei Maßlosigkeit Unflätigkeit Hartherzigkeit Trunksucht Müßiggang Verleumdung Lästerung Bosheit Dummheit Eitelkeit Pedanterie Wankelmut Tollkühnheit Wagemut Übellaunigkeit Übermut Griesgrämigkeit Besserwisserei Arroganz Enthaltsamkeit Lethargie (…) (…) (…) 168 10.2 Vormoderner Tugendkatalog Tugenden (virtutes) Iustitia Prudentia Fortitudo Temperantia Fides Spes Charitas, Gratia Patientia Pietas Bonitas Magnitudo Potestas Sapientia Gloria Constantia Decentia (…) Gerechtigkeit Vorherwissen, Lebensklugheit, Umsicht, Vorsicht Stärke, Tapferkeit, Mut, Unerschrockenheit Maßhalten, Mäßigung, Selbstbeherrschung Glaube, Vertrauen, Pflichttreue, Redlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen Hoffnung, Erwartung, Aussicht, Befürchtung, Besorgnis 1. Anmut, Liebreiz, Grazie; 2. Gunst, Beliebtheit, Einfluss; 3. gutes Einvernehmen, Freundschaft, Liebe; 4. Gunst, Gefälligkeit, Gefallen, Huld, Gnade, Zuneigung, Freundlichkeit, Parteilichkeit; 5. Dank, Erkenntlichkeit; 6. unentgeltlich, umsonst, gratis. Die Chariten sind die drei Grazien, Töchter des Zeus, Begleiterinnen der Aphrodite: Aglaia, Euphrosyne, Thalia. Ertragen, Erdulden, Ausdauer, Geduld, Nachgiebigkeit, Hingabe, Unterwürfigkeit, Unempfindlichkeit, Gleichgültigkeit Fromme Gesinnung, dankbare Liebe, Frömmigkeit, Pflichtgefühl, Pietät, Milde, Sanftmut, Barmherzigkeit, Gnade Güte, Vorzüglichkeit, Rechtschaffenheit, Herzensgüte, Gutmütigkeit Größe, Stärke, Kraft, Gewalt, Geistesgröße, Härte, Bedeutung, Wichtigkeit, Gewicht, Erhabenheit, Ansehen, Macht, Hoheit Macht, Kraft, Herrschaft, Amtsgewalt, Möglichkeit, Gelegenheit, Erlaubnis, Vollmacht Einsicht, Verstand, Klugheit, wahres Wissen, Philosophie, Lebensweisheit Ruhm, Ehre, Anerkennung Festigkeit, Ruhe, ruhiger Seelenzustand, Gelassenheit (ataraxia der Skeptiker; eupatheia der Stoiker) Beständigkeit, Stetigkeit, Regelmäßigkeit, Beharrlichkeit, Zuverlässigkeit, Übereinstimmung, Konsequenz, Folgerichtigkeit, Charakterfestigkeit, Gleichmut Anstand, Schicklichkeit Untugenden (vitias) Avaritia Gula Luxuria Superbia Acidia Invidia Ira Mendacium Inconstantia Gloriatio (…) Habgier Völlerei Wollust Hochmut, Stolz Trägheit Neid Zorn Lüge, Täuschung Unbeständigkeit, Wankelmut Ruhmredigkeit, Prahlerei, Ehrgeiz, Ruhmsucht 169 10.3 Aristotelischer Tugendkatalog Der folgende Aristotelische Tugendkatalog ist seiner Nikomachischen Ethik entnommen, nähere Angaben hierzu unter Kapitel 4.2 dieses Skripts. Ethische Tugenden / Charaktertugenden Bereich Zuwenig Mitte Zuviel ____________________________________________________________________ Angst Tapferkeit Verwegenheit andreia, III, 9.-12. Feigheit Mut Draufgängertum Affekte Unlust Besonnenheit Lust Stumpfsinn sophrosyne Zügellosigkeit III, 13.-15. Geld Knausrigkeit Grosszügigkeit Verschwendungseleutheritotes Sucht IV, 1.-3. Engherzigkeit Grossgeartetheit Grossmannssucht megaloprépeia, IV, 4.-6. Ehre Engsinnigkeit Hochsinnigkeit dummer Stolz megalopsychia, IV, 7.-9. Gleichgültigkeit Ehrliebe Geltungssucht philotimia, IV, 10. Zorn Phlegmatismus ruhiges Wesen Jähzorn praotés, IV, 11. Geselligkeit geheuchelte Aufrichtigkeit Aufschneiderei Bescheidenheit alétheia Prahlsucht IV, 13. Geselligkeit Rüpelhaftigkeit Gewandtheit Albernheit euprapelia, IV, 14. Geselligkeit Widerborstigkeit Freundlichkeit Liebedienerei philia (ohne Nebenabsicht) IV, 12. Kriechertum (mit Nebenabsicht) Schüchternheit Feinfühligkeit Unverschämtheit Schamhaftigkeit Schamlosigkeit aidos, IV, 15. Missgunst ehrliche Empörung Schadenfreude Entrüstung nemesis Gerechtigkeit Dikaiosyné V Dianoetische Tugenden / Verstandestugenden Vorzüge des Verstandes / areté logiké episteme / wissenschaftliche Erkenntnis techné / praktisches Können phronesis / sittliche Einsicht noûs / intuitiver Verstand / Vernunft sophia / philosophische Weisheit VI 3 VI 4 VI 5 VI 6 VI 7 Alle Angaben beziehen sich auf die Nikomachische Ethik von Aristoteles, cf. Literaturverzeichnis. 170 10.4 Tugendkatalog nach William K. Frankena (1963) William K. Frankena (1963): Tugenden erster und zweiter Ordnung Tugenden erster Ordnung: konkret auf einen engen Sektor sittlichen Lebens beschränkt - Ehrlichkeit, Dankbarkeit, etc. Tugenden zweiter Ordnung: abstrakter, allgemeiner, nicht auf bestimmte Bereiche sittlichen Lebens eingeschränkt - Gewissenhaftigkeit - Moralische Tapferkeit (d.h. Tapferkeit in moralisch relevanten Situationen - Rechtschaffenheit - ein guter Wille (= Kants Achtung vor dem sittlichen Gesetz) - moralische Selbständigkeit - die Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen und einmal angenommene Prinzipien, wenn nötig, zu revidieren - Disposition zu klarem Denken - Disposition, die relevanten Tatsachen zu ermitteln und zu respektieren - Fähigkeit, das „Innenleben“ anderer auf intellektueller und emotionaler Ebene nachzuvollziehen - Fähigkeit, uns den Mitmenschen als Person zu vergegenwärtigen – als jemanden, der sich selbst so wichtig ist, wie wir uns selbst wichtig sind – und uns von seinen Interessen und den Auswirkungen unseres Handelns auf sein Leben eine lebendige und von Mitgefühl getragene Vorstellung zu machen 171 10.5 Aus der deontischen Logik Ein Teilgebiet der Philosophie ist der Bereich der Logik. Es gibt hier allerdings nicht eine Logik, sondern zahlreiche sehr verschiedene Logiken (Logikkalküle oder Axiomensysteme), die für ganz verschiedene Anwendungen entwickelt wurden. Aus der so genannten Modallogik wurde für die Analyse ethische Probleme die deontische Logik, die Logik des „man sollte“ entwickelt. Sie verwendet verschiedene Funktoren wie „erlaubt“, „geboten“ oder „verboten“, um ethische Argumentationen auf formale Gültigkeit hin zu untersuchen. Modallogisches Diagramm Die Modallogik als Logik von Notwendigkeit und Möglichkeit untersucht, wie Dinge oder Sätze über Dinge sein können und wie sie sein müssen. Dabei gehen Modallogiker von folgenden Klassen von wahren (w) oder falschen (f) Sätzen unterschiedlicher modaler Eigenschaften aus: w f w notwendig kontingent f unmöglich möglich Deontisches Diagramm Die deontische Logik ist die Logik des Gebots, des "man sollte". Sie untersucht, ob moralische Sollenssätze unbedingt geboten (moralisch notwendig), bedingt geboten oder verboten sind. Entsprechend werden folgende Klassen von Sätzen unterschieden: w unbedingt geboten f w bedingt geboten f verboten erlaubt Hierbei besteht ein Zusammenhang zwischen Modallogik und deontologischer Logik, dem die meisten Ethiker zustimmen: Was geboten ist, muss man auch tun können. Gebote machen nur dann Sinn, wenn man sich auch daran halten kann, kraft seiner Vermögen und Fähigkeiten. Lektüre für logisch Interessierte: Copi, Irving M.: Einführung in die Logik. München 1998. 172 10.6 Ethische Theorien Deskriptive Modelle Normative (nicht präskriptive!) Modelle Entwickeln Moralprinzipien zweiter Ordnung zur Rechtfertigung moralischer Handlungen Phänomenologische Ethik Wertethik Deontologische Ethik Gesinnungsethik Teleologische Ethik Verantwortungsethik E. Husserl M.Scheler N. Hartmann H. Reiner Regeldeontologische Ethik Transzendentale Willensethik Kant, Fichte, W.D. Ross Tugendethik Aristoteles G.E.M. Anscombe, W.K.Frankena, M. Nussbaum, G.H. von Wright, A. MacIntyre Ph. Foot, J. McDowell Sprachanalytische Ethik Meta-Ethik Kognitivisten Handlungsdeontologische Ethik J. Fletcher Konstruktive Ethik O. Schwemmer Naturalisten Perry, Lewis Sprachgrammatische Ethik K. O. Apel Intuitionisten G. E. Moore, Ross, Reid Prichard, Ewing Generative Ethik Krings Nonkognitivisten Emotivisten A. Ayer, Stevenson Präskriptivisten R.M. Hare Logisten Deontologen G.H. von Wright Vertragstheoretische Ethik Kontraktualismus Gerechtigkeitsethik Rousseau, Hobbes J. Rawls Kommunitaristische Ethik Geschichtlich-kontextuelle Ethik Narratives Tugendmodell A. MacIntyre M. Walzer © Daniel Bremer 16.05.2003 Hedonistische Ethik Aristipp: sinnlischer Genuss Epikur: geistiger Genuss H. Marcuse A. Plack Utilitaristische Ethik J. Bentham J.S. Mill H. Sidgwick Regelutilitarismus R.B. Brandt Handlungsutilitarismus J.J.C. Smart Negativer Utilitarismus K. Popper R.N. Smart Präferenzutilitarismus P. Singer Verantwortungsethik H. Jonas Egoistische Ethik M. Stirner Materialistische Ethik Physiologische Ethik LaMettrie Holbach Helvétius Marxistische Ethik Marx / Engels F. Schischkin Diskursethik J. Habermas / K.O. Apel Ethik der Wahl W. Schmid Skeptische Ethik W. Weischedel / O. Marquard Pluralistische Ethik Postmoderne Ethik Z. Bauman Existenzialistische Ethik Daseinsethik Kierkegaard, Camus Feministische Ethik J. Butler / L. Irigaray Performative Ethik Narrative Ethik 10.7 Ethische Fallanalyse: Zuordnung von Werten zu den Handlungsoptionen und Gewichtung Werte Bilanz Handlg. Rang H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 Gewichtung: + + + ++ + +/- hohe Relevanz Handlung mittlere Relevanz fördert mässige Relevanz Wert zweideutig, je nach Standpunkt (Wert = 0) Regeln zur Fallanalyse -- stark wertmindernd -- wertmindernd - mässig wertmindernd Handlung mindert Wert 1. Wo liegen die Probleme? 2. Handlungsoptionen formulieren H1 – Hn 3. Relevante Werte ermitteln und eintragen 4. Plus-und Minuswerte jeder Zeile addieren und in die Bilanzspalte eintragen, wobei jedes Plus ein Minus aufhebt. 5. Rangspalte ermitteln. 6. Ausführliche ethische Diskussion der Ergebnisse bzw. der Schwierigkeiten, die bei der Bestimmung aufgetreten sind, führen; sowie ethische Legitimation der empfehlenswerten Handlungen erwägen. 174 11. Literaturliste zur Lehrveranstaltung Ethik im Allgemeinen Angehrn, Emil und Baertschi, Bernard (Hg.): Menschenwürde. Studia Philosophica Vol 63/2004, Basel 2004. Apel, Karl-Otto: Transformation der Philosophie. Band Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt a.M., stw 165, 1976. 2: Das Apriori der Aristoteles: Nikomachische Ethik. Stuttgart, RUB 8586, 1983. Birnbacher, Dieter und Hoerster, Norbert (Hg.): Texte zur Ethik. München (9) 1993. Birnbacher, Dieter: Tun und Unterlassen. Stuttgart, RUB 9392, 1995. Brody, Howard: Ethical Decisions in Medicine. Boston (2) 1981. Brody, Howard: Stories of Sickness. New Haven and London 1987. Dehner, Klaus: Lust an Moral. Die natürliche Sehnsucht nach Werten. Darmstadt 1998. Ferber, Rafael: Philosophische Grundbegriffe. Eine Einführung. München (2) 1994. Foot, Philippa: Die Wirklichkeit des Guten. Moralphilosophische Aufsätze. Frankfurt a.M. 1997. Frankena, William. K.: Analytische Ethik. München (5) 1994. Frankfurt, Harry G.: Freiheit und Selbstbestimmung. Berlin 2001. Habermas, Jürgen: Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt a.M., stw 422, 1983. Habermas, Jürgen: Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt a.M., stw 975, 1992. Hastedt, Heiner und Martens, Ekkehard (Hg.): Ethik. Ein Grundkurs. Hamburg 1994. Honderich, Ted: Wie frei sind wir? Das Determinismus-Problem. Stuttgart, RUB 9356, 1995. Höffe, Otfried: Lexikon der Ethik. München (4) 1982. Irrgang, Bernhard: Praktische Ethik aus hermeneutischer Sicht. Paderborn, UTB 2020, 1998. Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt a.M. 1984. Jonas, Hans: Macht oder Ohnmacht der Subjektivität? Das Leib-Seele-Problem im Vorfeld des Prinzips Verantwortung. Franfurt a.M. 1981. Jonas, Hans: Technik, Medizin, Ethik. Praxis des Prinzips Verantwortung. Frankfurt a.M. 1987. Kant, Immanuel (1785): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Frankfurt 1974. Kant, Immanuel (1797): Metaphysik der Sitten. Hamburg 1990. Ludwig, Ralf: Kant für Anfänger. Der kategorische Imperativ. München 1995. MacIntyre, Alasdair: Die Anerkennung der Abhängigkeit. Über menschliche Tugenden. Hamburg 2001. MacIntyre, Alasdair: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt a.M., stw 1193, 1995. MacIntyre, Alasdair: Geschichte der Ethik im Überblick. Vom Zeitalter Homers bis zum 20. Jahrhundert. Weinheim (3) 1995. Marquard, Odo: Glück im Unglück. Philosophische Überlegungen. München (2) 1996. Mill, John Stuart: Der Utilitarismus (1871). Stuttgart, RUB 9821, 1985. Moore, George E.: Principia Ethica. Erweiterte Ausgabe. Stuttgart, RUB 8375, 1996. Patzig, Günther: Ethik ohne Metaphysik. Göttingen 1983. Peirce, Charles Sanders: Über die Klarheit unserer Gedanken. Frankfurt a.M. (3) 1985. Pfister, Jonas: Philosophie. Ein Lehrbuch. Stuttgart 2006. Pieper, Annemarie (Hg.): Philosophische Disziplinen. Ein Handbuch. Darin: Kapitel 4: Ethik. S. 72-91. Leipzig 1998. Rippe, Klaus P. (Hg.): Angewandte Ethik in der pluralistischen Gesellschaft. Freiburg (Schweiz) 1999. Rippe, Klaus P. und Schaber, Peter (Hg.): Tugendethik. Stuttgart, RUB 9740, 1998. Schmid Wilhelm: Suche nach dem Sinn. Jeden Herbst kommt für zwei Wochen ein Philosoph ins Spital Affoltern. Was macht er da? In: NZZ-Folio Nr. 1, Januar 2002, S.60-62. Schmid, Wilhelm: Philosophie der Lebenskunst. Frankfurt a.M. 2001. Seiffert, Helmut: Einführung in die Wissenschaftstheorie. Band 3. Darin besonders Kapitel 3: Ethik. S. 55-94. München (2) 1992. Singer, Peter: Praktische Ethik. Stuttgart, RUB 8033, 1994. Spaemann, Robert: Moralische Grundbegriffe. München 1994. Wehowsky, Stephan: Gespräche über Ethik. München 1995. Weston, Anthony: Einladung zum ethischen Denken. Freiburg (Breisgau) 1999. 176 Williams, Bernard: Der Begriff der Moral. Eine Einführung in die Ethik. Stuttgart, RUB 9882, 1978. Ethik in der Pflege Arend, Arie van der: Ethik für Pflegende. Bern 1996. Arend, Arie van der: Pflegeethik. Wiesbaden 1998. Arndt, Marianne: Ethik denken. Maßstäbe zum Handeln in der Pflege. Stuttgart 1996. Balzer, Philipp, Rippe, Klaus P. und Schaber, Peter: Menschenwürde vs. Würde der Kreatur. Begriffsbestimmungen, Gentechnik, Ethikkommissionen. Freiburg (Breisgau), München 1999. Blonsky, Harald: Ethik in der Gerontologie und Altenpflege – Leitfaden für die Praxis. Hagen. Bondolfi, Alberto: Ethisch denken und moralisch handeln in der Medizin. Anstösse zur Verständigung. Zürich 2000. Hoppe, Eva / Körner, Uwe: Ethik. Arbeitsbuch für Schwestern und Pfleger. Reinbek 1995. Käppeli, Sylvia: Moralisches Handeln und berufliche Unabhängigkeit in der Krankenpflege. In: Pflege 1998, 20-27. Kemetmüller, Eleonore: Ethik in der Pflegepädagogik. Wien 1998. Kruse, Torsten / Wagner, Harald: Ethik und Berufsverständnis der Pflegeberufe. Berlin 1994. Plenter, Christel: Ethische Aspekte in der Pflege von Wachkoma-Patienten. Orientierungshilfe für eine Plegeethik. Hannover 2001. Richardson / Webber: Ethische Aspekte in der Kinderkrankenpflege. Wiesbaden 1998. Sass, Hans-Martin: Medizin und Ethik. Revidierte und bibliographisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart, RUB 8599, 1999. Schayck, Andrea van: Ethisch handeln und entscheiden. Stuttgart 2000. Schmid Wilhelm: Suche nach dem Sinn. Jeden Herbst kommt für zwei Wochen ein Philosoph ins Spital Affoltern. Was macht er da? In: NZZ-Folio Nr. 1, Januar 2002, S.60-62. Schmid, Wilhelm: Philosophie der Lebenskunst. Frankfurt a.M. 2001. Schröck, Ruth: Zum moralischen Handeln in der Pflege. In: Pflege 8 (1995) 315-323. Schwerdt, Ruth: Eine Ethik für die Altenpflege. Ein transdisziplinärer Versuch aus der Auseinandersetzung mit Peter Singer, Hans Jonas und Martin Buber (= Reihe Pflegewissenschaft) Bern 1998. 177 Steinmann, Norbert und Gordijn, Ben: Ethik in der Klinik – ein Arbeitsbuch zwischen Leitbild und Stationsalltag. Zürich 2003. Tschudin, Verena: Ethik in der Krankenpflege. Basel 1988. Tschudin, Verena: Helfen im Gespräch. Eine Anleitung für Pflegepersonen. Basel 1990. Turnherr, Urs: Angewandte Ethik. In: Pieper, Annemarie (Hg.): Philosophische Disziplinen. Ein Handbuch. Leipzig 1998, S. 92-114. Wittrahm, Andreas: Orientierungen zur ganzheitlichen Altenpflege: Anthropologie – Ethik – Religion (= Lehr- und Arbeitsbücher Altenpflege) Bonn 1994. Argumentation / Begründung / Legitimation / Logik / Methoden Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft. Tübingen (5) 1991. Berger, Peter L. und Luckmann, Thomas: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt a.M. (17) 2000. Copi, Irving M.: Einführung in die Logik. München 1998. Edmüller, Andreas / Wilhelm, Thomas: Argumentieren: Sicher – treffend – überzeugend. Trainingsbuch für Beruf und Alltag. Planegg 2000. Hegselmann, Rainer: Formale Dialektik: Ein Beitrag zu einer Theorie des rationalen Argumentierens. Hamburg 1985. Hoyningen-Huene, Paul: Formale Logik. Eine philosophische Einführung. München 1998. Huppenbauer, Markus / De Bernardi, Jürg: Kompetenz Ethik für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Tool für Argumentation und Entscheidungsfindung. Zürich 2003. Mitterer, Josef: Die Flucht aus der Beliebigkeit. Frankfurt a.M. 2001. Ott, Konrad: Moralbegründungen zur Einführung. Hamburg 2001. Pfeifer, Volker: Ethisch Argumentieren. Bühl 1997. Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Anleitung zum subversiven Denken. München (2) 1997. Schulte, Joachim und Wenzel, Uwe Justus: Was ist ein "philosophisches" Problem? Frankfurt a.M. 2001. Senger, Harro von: Die Kunst der List. Strategeme durchschauen und anwenden. München 2001. Soentgen, Jens: Selbstdenken! 20 Praktiken der Philosophie. Wuppertal 2003. 178 Walther, Jürgen: Philosophisches Argumentieren. Lehr- und Übungsbuch. Freiburg, München 1990. © D. Bremer 13.10.14 179