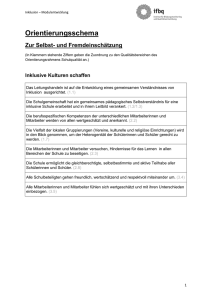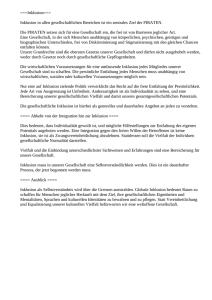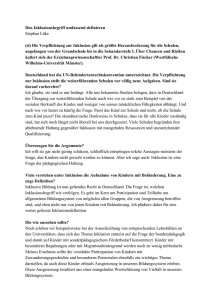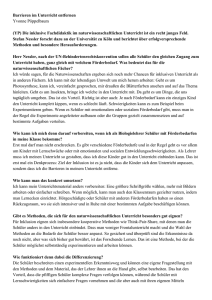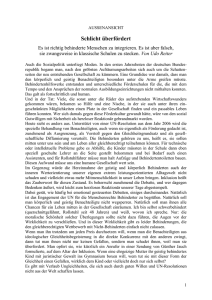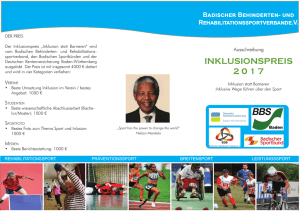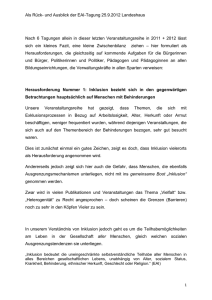1 Norbert Wohlfahrt Vom „Klassenkompromiss“ zur klassenlosen
Werbung

1 Norbert Wohlfahrt Vom „Klassenkompromiss“ zur klassenlosen Staatsbürgergesellschaft? Zu einigen Widersprüchen einer „inklusiven“ Sozialpolitik Vorbemerkung Die heute im politischen und wissenschaftlichen Diskurs als selbstverständlich geltende Tatsache, dass gesellschaftliche Phänomene wie Armut, Behinderung, Krankheit und dergleichen mehr nur durch Politik und politisches Handeln bewältigt werden können, ist so selbstverständlich nicht. Es galt nicht immer als ausgemacht, dass staatliche Interventionen überhaupt der geeignete Anknüpfungspunkt für die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft sind. Das Ende der junghegelianischen Bewegung wurde durch eine Auseinandersetzung eingeleitet, die sich auf eben diesen Tatbestand bezog: Arnold Ruge, zusammen mit Karl Marx Gründer der deutsch-französischen Jahrbücher, war mit Blick auf den Weberaufstand zu der Auffassung gelangt, dass allein durch politische Organisation und Bildung die eigentlichen Ursachen von Armut bekämpft werden können: eine gesellschaftliche Revolution ohne politische Seele, d.h. eine, die nicht von einem allgemeinen Standpunkt aus organisiert sei, sei unmöglich (Ruge, in: Vorwärts! Pariser Zeitschrift. Ausgabe vom 2. Juli 1844). In seiner ebenfalls im Vorwärts abgedruckten Erwiderung vertrat Marx den Standpunkt, dass politische Maßnahmen nur begriffen werden können (er bezog sich auf diesbezügliche Maßnahmen Friedrich Wilhelm IV, König von Preußen), wenn man die Natur der Verelendung verstünde. Die Überwindung der Armut, so Marx, ist nicht von der Entwicklung der politischen Vernunft abhängig: im Gegenteil. Wie das Beispiel der französischen Revolution und Robespierres zeige, habe dieser Armut wie auch Reichtum lediglich als Hindernis für die Schaffung einer wahren Demokratie gesehen. Und damit den Grund der sozialen Gegensätze ignoriert. Diese Auseinandersetzung, die zum Bruch von Marx mit Ruge führte, verdeutlicht die Entwicklung, die die Kritik am deutschen Idealismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts genommen hatte: ausgehend von der Kritik an Hegels politischem Idealismus eines sich als Vernunft verwirklichenden preußischen Staates hatte sich eine politische Auseinandersetzung um die Frage ergeben, was denn nun den Staat als Staat der bürgerlichen Gesellschaft auszeichne. Und Marx hatte schließlich allen Erwartungen daran, dass der Staat der richtige Adressat bei der Lösung der gesellschaftlich begründeten sozialen 2 Probleme sei, eine Absage erteilt: „Ja, gegenüber den Konsequenzen, welche aus der unsozialen Natur dieses bürgerlichen Lebens…, dieser Industrie, …entspringen, diesen Konsequenzen gegenüber ist die Ohnmacht das Naturgesetz der Administration. Denn diese Zerrissenheit, … dies Sklaventum der bürgerlichen Gesellschaft ist das Naturfundament, worauf der moderne Staat ruht. …Je mächtiger der Staat, je politischer daher ein Land ist, um so weniger ist es geneigt, im Prinzip des Staates, also in der jetzigen Einrichtung der Gesellschaft, deren tätiger, selbstbewusster und offizieller Ausdruck der Staat ist, den Grund der sozialen Gebrechen zu suchen und ihr allgemeines Prinzip zu begreifen“ (Marx, MEW, Bd. 1, S. 401f). Dass der Staat der tätige Ausdruck einer Gesellschaft ist, deren soziale Gebrechen andere Gründe haben als die einer untätigen Politik, ist nach mehreren Weltkriegen und einer beispiellosen Erfolgsgeschichte des Kapitalismus, aus dem Gedächtnis des politischen und wissenschaftlichen Diskurses nahezu verschwundenes Wissen. Die von Marx verfochtene Alternative, die sozialen Gegensätze der Gesellschaft als gesellschaftliche Gegensätze aufzuheben und damit auch das auf sie gerichtete politische Handeln ad acta zu legen, hat sich nicht nur nicht durchgesetzt, sie ist auch von den ihm nachfolgenden Sozialisten gründlich in ihr Gegenteil verkehrt worden, indem sie in treuer Anknüpfung an Arnold Ruge ausgerechnet mittels des Staates den Sozialismus herbeizuführen gedachten. Erinnert werden muss allerdings daran, dass mit dem historischen Scheitern des Sozialismus die Analyse, dass der Grund aller sozialen Gebrechen nicht in einem mangelhaften Regieren derselben zu suchen ist, nach wie vor Gültigkeit hat. Allerdings haben sich die Koordinaten seit Marx grundlegend verschoben: wurden Mitte des 19. Jahrhunderts politische Auseinandersetzungen noch mit der Hoffnung verbunden, dass die „gesellschaftliche Emanzipation“ ein Werk derer sein könnte, die als Betroffene allen Grund haben, die sie beschränkenden Verhältnisse beiseite zu schaffen, so ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse nur noch als politisches Handeln denk- und erwartbar. Was die Vorkämpfer einer sozialistischen Gesellschaft nicht einmal zu denken gewagt haben, dass ausgerechnet der politische Idealismus eines „vernünftigen Staates“ die gesamte Menschheit und ihr Denken beherrscht, ist so gut wie Realität geworden. Veränderungen der sozialen Lage erwartet sich niemand mehr von denen, die in ihren Interessen eingeschränkt werden (und auch nicht von deren Interessenvertretungen), sondern nur noch von veränderten politischen Koalitionen und staatlichen Kalkülen. Die „sozialen Gebrechen“ der Gesellschaft sind insofern politisch inkludiert, sie sind in ihrer Ausgestaltung und Wirkmächtigkeit Resultat eines politischen Handelns, dass nicht einmal dem Schein nach so tut, als würde es diese korrigieren wollen. 3 Marx Diktum, dass je mächtiger der Staat, desto weniger ein Land geneigt ist, den Grund der sozialen Gebrechen zu suchen, besiegelt augenscheinlich das Schicksal des einstigen Hoffnungsträgers Arbeiterklasse. Diese ist längst politisch „inkludiert“ und muss jetzt auch noch erfahren, dass die auf sie gerichteten Maßnahmen der Zwecksetzung Inklusion folgen. Da stellt sich schon die Frage, wie durch den „Einschluss“ in eine Gesellschaft das überwunden werden soll, was den „Ausschluss“ begründet? 1. Der Sozialstaat: „Klassenkompromiss“ als staatsbürgerliche Inklusionspolitik? Die Geschichte der politischen „Inklusion“ der Arbeiterbewegung ist auch die Geschichte der Sozialdemokratie und sie beginnt mit Ferdinand Lassalle, dem Gründer des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins. Dieser wollte die politische Emanzipation der Arbeiterbewegung durch ihre nationale Einheit vorantreiben und er war sich deshalb mit Bismarck darin einig, dass das Mittel dem „deutschen Einheitstrieb“ Wirkung zu verleihen, Kriegspolitik heißt. So sah Lassalle im Krieg gegen Frankreich „ein immenses Glück für die Revolution“ und er schwor darauf, wie…“das Band der „deutschen Treue“ das Volk an seine Regierung binden würde“ (Lassalle an Marx 1859). Die Politisierung der Arbeiterbewegung erreichte ihren nächsten Höhepunkt 1914: dort stimmte die Partei, die Lassalle gegründet hatte, mit einer Gegenstimme, der Stimme Karl Liebknechts, für die Kriegskredite und damit für den Krieg – diesmal ging es nicht gegen die Franzosen, sondern gegen Russland. Lassalles in einem Brief an Bismarck geäußerte Hoffnung, dass „die Krone ihrerseits sich jemals zu dem – freilich sehr unwahrscheinlichen - Schritt entschließen könnte, eine wahrhaft revolutionäre und nationale Richtung einzuschlagen und sich ….in ein soziales und revolutionäres Volkskönigtum umzuwandeln“ ist von diesem nicht nur mit den Sozialistengesetzen, sondern auch mit einer Sozialversicherung beantwortet worden, in der er mit ihren Lohnersatzleistungen (Altersrente, Arbeitslosen- und Krankengeld, Unfallrenten) die aktuell in der Einkommensklasse „abhängige Erwerbsarbeit“ aktiv Beschäftigten dazu zwingt, die Lebensunterhaltungskosten für ihre „passiven“ Mitglieder mit zu übernehmen. Die mit der Verstaatlichung der Arbeiterbewegung beginnende soziale Aktivität des bürgerlichen Staates steht damit ganz im Zeichen des von Marx Diagnostiziertem: als „positive“ Staatstätigkeit zeigt sie sich gegenüber den Gründen für eine den Lebensunterhalt der Klasse sichernden Zwangsabgabe desinteressiert und verpflichtet diese vielmehr darauf, ihre ökonomische Abhängigkeit von Unternehmen, die sie beschäftigen, als Konkurrenz auszutragen und sich damit den Notwendigkeiten der Konkurrenzgesellschaft zu beugen. Der Politische Idealismus eines 4 Staates, der die sozialen Gegensätze der Gesellschaft „vernünftig“ regiert, nimmt damit in der Sozialpolitik Gestalt an: der Staat erkennt die Zwangsgesetze der Konkurrenz nicht nur an, sondern verpflichtet die ganze Gesellschaft darauf, diesen zu folgen und zugleich in unmittelbarer gesellschaftlicher Verantwortung für die Kompensation der Folgen zu sorgen. Sozialpolitik erweist sich damit als Klassenpolitik: die von Erwerbsarbeit lebende Klasse muss mit ihren Lohnbestandteilen dafür sorgen, dass sie als Pool von Erwerbsarbeit erhalten bleibt – ein Anliegen, dass seit der Bismarckschen Sozialversicherung als dauernder Streitgegenstand darüber existiert, wie dieses idealistische Unterfangen korrigiert, entwickelt und verändert werden kann und muss. Mit der politischen Einbindung der Arbeiterklasse in die nationale Kriegspolitik und der politischen Durchsetzung einer die Abhängigkeit von Erwerbsarbeit durchsetzenden Sozialversicherung wird das Projekt der politisierenden Inklusion ein entschiedenes Stück weit vorangetrieben. Fragen des Lebensunterhalts, der Funktionsfähigkeit von Familien, des Pauperismus und seiner Folgen sind von nun an Fragen, die an den Sozialstaat zu richten sind. Die Monopolisierung der Zuständigkeit in Sachen soziale Gebrechen entspricht dabei einer Sichtweise, die die Verpflichtung auf die Zwänge des Privateigentums und damit der bürgerlichen Konkurrenz als Zugeständnis an die Lohnarbeit interpretiert, die damit eine ganz neue Gestalt bekommt und gar nicht mehr durch klassenanalytische Kategorien erfasst werden kann. Das Ideal einer staatlichen Befriedung der sozialen Gegensätze der Gesellschaft existiert nicht nur in der faschistischen Variante, in der diese ganz in einem Volk aufgehoben sind, dass sein Dasein für die Größe der Nation als innerstes Anliegen betreibt, sondern auch in der Variante eines gelingenden Miteinander der als solche gar nicht mehr fassbaren Klassen: Dieses Ideal taucht in den verschiedensten Variationen auf (soziale Integration; innerstaatliche Friedensordnung; Sicherung von Solidarität etc.) und bestimmt den Sozialstaat als eine „Synthese von Klasseninteressen“ (Huster /Boucarde 2012). Die Produktion von sozialer Inklusion erfolgt demnach auf dem Weg des Ausgleichs „sozial unverträglicher Folgen der Marktwirtschaft“ und durch das Zusammenführen widerstreitender Interessen (Lohnarbeit und Kapital). In der politischen Sozialstaatsbestimmung wird dieses sozialstaatliche Agieren zu einem „Einbinden“ der Lohnarbeit in die Gesellschaft und damit zu einem Akt gesellschaftspolitischer Inklusion. Soziale Ausgrenzung findet danach überall dort statt, wo der Inklusionszweck (sozialer Zusammenhalt) gefährdet erscheint, bspw. dadurch, dass soziale Ungleichheit verstärkt und nicht eingegrenzt wird. Ganz im Sinne des 5 alten Staatsidealismus vollzieht sich durch Sozialpolitik die „soziale Integration“ der Individuen wesentlich über deren Zustimmung zur kapitalistischen Wirtschaftsordnung und sie steht damit in guter „moralwissenschaftlicher“ Tradition (Spencer, Durkheim, Simmel u.a.). Diese moralisch inspirierte Sozialwissenschaft betrachtet – ganz bewusst im Gegensatz zu Marx – den Staat nicht nach den politökonomischen Funktionen gegenüber der von ihm rechtlich durchgesetzten und politisch gewollten Konkurrenzgesellschaft, sondern sucht nach Strategien, wie Ökonomie und Gesellschaft durch staatliches Handeln verbessert werden können. Vom „sittlichen Staat“ bis hin zur Suche nach Steuerungsfunktionen bewegt sich dieser politische Idealismus damit eher auf dem Gebiet der Ethik und Moral, was in letzter Konsequenz dazu führt, den Staat als Gegenstand ganz aufzulösen und als ein „Funktionssystem“ neben anderen zu betrachten.1 2. Eigenverantwortung: die Korrektur des „Klassenkompromisses“ im Sinne einer inklusiven Konkurrenzgesellschaft Die Verwüstungen einer staatlich hergestellten und verwalteten Klassengesellschaft haben nicht nur bei den Nationen, sondern auch bei dem einstmals als Hoffnungsträger gehandelten Proletariat Spuren hinterlassen. Mit UNO und Menschenrechten ist der öffentliche Diskurs weitgehend von den Themen Krieg und Hunger diktiert und dazwischen agiert ein belächeltes und bemitleidetes „Prekariat“ als Kulturträger einer Gesellschaft, die sich ihre Vergnügungen streng nach den Gesetzmäßigkeiten ihrer sozialen Hierarchie organisiert. Die Arbeiterklasse ist als Subjekt von Klassenpolitik ebenso aus der Öffentlichkeit verschwunden wie eine Politik, die auf die „Befriedung“ von sozialen Gegensätzen ausgerichtet ist. Die in Nationalstaaten sortierte, vom Realsozialismus befreite Welt, definiert sich selbstbewusst als kapitalistische Weltwirtschaft, deren oberster staatsmaterialistischer Zweck die Produktion von Wachstum ist, was die Staatenkonkurrenz nicht ent- sondern verschärft. 1 Allgemeines Kennzeichen normativ bestimmter Analysen ist die Bestreitung des von Marx behaupteten Tatbestands, dass Normen aus den ihnen zugrunde liegenden politökonomischen Verhältnissen erklärt werden müssen. Normative Theoriebildung geht i.d.R. den umgekehrten Weg: aus der behaupteten Norm (z. B. Herstellung von Inklusion) ergeben sich Anforderungen, auf die hin Staat und Gesellschaft betrachtet werden. Auf diesem Wege werden diejenigen Subjekte, die z.B. eine bestimmte „soziale Lage“ (Behinderung) erst herstellen, zum Adressaten der Verbesserung/Veränderung eben dieser „sozialen Lage“ gemacht. Dieses Vorgehen macht das Begriffslose und Affirmative normativer Theoriebildung aus: sie interessiert sich nicht für das Wirkliche, sondern fragt danach, wie das Wirkliche sein könnte. Normative Theoriebildung steht damit in der Tradition der Neoklassik, die meinte, die Arbeitswertlehre dadurch kritisieren zu können, dass sie sie in „ethische“ Regelungsmöglichkeiten des Wirtschaftsablaufs auflöst. Die soziale Integration vollzieht sich normativ denn auch über „Werte“ – und diese sind – je nach Standpunkt des Autors - wiederum normativ bestimmt. 6 Die Subsumption der „Springquellen des Reichtums“ (Karl Marx), Natur und Arbeit, unter die Verwertungsbedürfnisse eines weltweit agierenden Kapitals ist unter dem Stichwort Globalisierung breit diskutiert worden und auch hier galt die Analyse in erster Linie der besorgten Frage nach der staatlichen Bewältigung der damit einhergehenden Herausforderungen.2 Einsetzend mit der Ölkrise als erster großer Wachstumskrise der kapitalistischen Gesellschaften und forciert durch die Selbstaufgabe der Sowjetunion wird die politische Regulierung der „gesellschaftlichen Gebrechen“ unter ein neues Vorzeichen gestellt. Aus staatlicher Sicht erzeugt der sozialstaatlich durchgesetzte Zwang zum Selbsterhalt Dysfunktionalitäten, die dazu führen, dass die unbedingte Bereitschaft zur „Marktteilnahme“ eingeschränkt sein könnte. Ausgehend von der Diagnose, dass der verschärfte internationale Wettbewerb auch als Vergleich der Arbeitskosten ausgetragen wird, übernimmt der Staat die Aufgabe der Verbilligung der Ware Arbeitskraft, indem er sie sozialpolitisch dazu zwingt, sich zu jedem Preis, auch unterhalb der individuellen Reproduktionskosten, zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig schafft er die sozialstaatlichen Instrumente (in Deutschland: Hartz IV), die mit ihrer ausgeklügelten Dialektik des Fordern und Fördern dafür sorgen, dass arbeitsfähige Individuen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ansonsten so gefordert werden, dass sie dem Zwang des Arbeitsmarkts wie von selbst gehorchen. Zugleich unterzieht der Staat in einer Art staatsmaterialistischer Selbstkritik die von ihm geschaffenen Verwaltungen und Verwaltungsverfahren einem Effizienztest, der auf eine Verbilligung der dafür aufgewendeten Mittel abzielt und zugleich bislang ungenutzte Ressourcen für weiteres Wachstum freisetzen will. Diese als neoliberal etikettierte Politik überlässt es allerdings nicht den Märkten, ob die gewünschten Effekte zustande kommen, sondern sorgt mit einer staatlichen Subventions- und Industriepolitik dafür, dass Marktwachstum sich in nationalem Wachstum niederschlägt und trägt auf diese Art und Weise zur Konkurrenzverschärfung bei. 2 Die geradezu absurde Suche nach politischen Strategien zur Bewältigung eines politisch herbeigeführten und gewollten Zustands ist keine Selbstverständlichkeit. Die zwischen den beiden Weltkriegen und im Anschluss daran stattfindenden Auseinandersetzungen um Perspektiven gesellschaftlicher Veränderung sind Suchbewegungen, die sich an den unzufriedenen Staatsbürger (und/oder Nationalisten) richten. Das macht es oft schwer, zwischen „linken“ und „rechten“ Alternativen zu unterscheiden, manche Sozialtheoretiker springen auch hin und her. Ob Gramsci nach einem hegemonialen Projekt jenseits der Arbeiterklasse sucht, ob Sartre den Intellektuellen als seine Freiheit praktizierenden Rebellen feiert, ob Sorel die Gewalt als Oppositionsmittel entdeckt, ob Foucault die Erklärung von Mikropolitiken der Macht an die Stelle einer Staatsanalyse setzen will – sie alle gehen vom politisierten Staatsbürger als Voraussetzung gesellschaftskritischen Denkens aus. Wenig verwunderlich, dass viele dieser Kritiker dem Staatssozialismus Lenins oder Stalins Sympathien entgegen brachten. 7 Mit der Agenda 2010 (Hegelich u.a. 2011) werden integrierte Reformkonzepte in der Sozialpolitik aufgegriffen, die OECD und EU schon länger propagiert haben, insbesondere eine stärkere Markt- und Wettbewerbsorientierung der nationalstaatlichen Volkswirtschaften, Abbau der Leistungstiefe, Unternehmenssteuersenkung, Privatisierung, eine rigorose Angebotspolitik sowie das Schaffen von Märkten oder Quasi-Märkten in politisch bestimmten und finanzierten Bereichen wie Bildung, Soziales, Gesundheit und Öffentliche Verwaltung. Der so genannte Aktivierende Staat entwickelt ein dem forcierten Standortwettbewerb entsprechendes Sozialmodell, um den Wirtschaftsstandort Deutschland für Investoren attraktiv zu machen, die Lohnkosten der Unternehmen zu senken und die öffentlichen Aufgaben zu begrenzen. Die europäischen Wohlfahrtsstaaten sollen so gestaltet werden, dass „alle in Europa lebenden Menschen (…) die Chance haben, sich an den gesellschaftlichen Wandel anzupassen“ (EU 2000, S. 3). Die EU denkt vor, was nationale Sozialpolitik werden soll: der Umbau von einem „statuskonservierenden“ in einen „sozialinvestiven“ Sozialstaat, der Bildung primär als beschäftigungsorientierte Ausbildung betrachtet, Beschäftigungsstrategien entwickelt, die Beschäftigungsfähigkeit („employability“) der Bevölkerung und den „re-entry“ arbeitslos Gewordener zum Primat der Politik erhebt. Aufgabe des Sozialstaats ist es, das dazu notwendige „Lebenslange Lernen“ zu organisieren, also dasjenige Lernen, das wesentlich im Rahmen einer „beschäftigungsbezogenen Perspektive“ (Pongratz 2008, S. 162 – 163) erfolgt. Die rasante Ausdehnung eines so genannten Niedriglohnsektors kann ebenfalls als Erfolg dieses Sozialmodells verbucht werden und gerade in Deutschland erweist sich das neue Armutsniveau als robuster Faktor nationaler Wirtschaftspolitik in Zeiten der Staatsschuldenkrise (Dahme/Wohlfahrt 2013). Die im Zentrum dieses Sozialmodells stehende Rede von der Eigenverantwortung rückt die Anstrengungen des Konkurrenzsubjekts, sich für den Markt fit und bereit zu halten, in das Zentrum des als „Fordern und Fördern“ umschriebenen Zwangs, mit Erwerbsarbeit um jeden Preis seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die „Subjektivierung“ (Pongratz/Voß 2003, S. 25) der Sozialpolitik erfolgt als Programmatik einer sozialstaatlich betriebenen Senkung des nationalen Reproduktionsniveaus der Erwerbstätigen und bleibt keineswegs auf die Arbeitsmarktpolitik beschränkt: in allen Bereichen sozial- und gesundheitspolitischen Handelns wird durch gesetzliche Maßnahmen der Zwang zu mehr Eigenverantwortung und Selbstvorsorge verstärkt und der Bürger in Gestalt von Zuzahlungsverpflichtungen (Gesundheitswesen), „Angehörigen“ (Pflege) durch Teilkaskoversicherung mit Anreiz zur Privatversicherung oder „Kapitalbildung“ (Rente) in Anspruch genommen. Die Familienpolitik misst den Erfolg ihrer Maßnahmen daran, in wie 8 weit sie Anreize für Frauen setzt, durch eigene Arbeit zum Familienunterhalt beizutragen. Die Sozialpolitik „ringt“ um Beschäftigungshindernisse in der Familienpolitik wie die Familienversicherung in der Gesundheitsversorgung, das Ehegattensplitting oder die Witwenrente. Ausgehend davon, dass die nationalen Ressourcen im globalisierten Standortwettbewerb wesentlich durch die Konkurrenzbereitschaft und –fähigkeit der als Arbeitskraft definierten Population bestimmt sind, geraten bestehende rechtliche Regelungen unter dem Gesichtspunkt ins Visier, ob sie geeignet sind, diese zu fördern und durchzusetzen. Der Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt darf nicht durch familienpolitische Maßnahmen gebremst und blockiert werden, sozialpolitische Regelungen müssen daraufhin überprüft werden, ob sie nicht als Bremse des Zugangs zum ersten Arbeitsmarkt fungieren und selbst gesetzliche Regelungen, die die Sittlichkeit der Gesellschaft zum Gegenstand haben, werden darauf hin begutachtet, ob sie mit Blick auf die geforderte Gleichheit der Konkurrenzbürger noch angemessen sind. Die Gesellschaft freier Privateigentümer, die mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln konkurriert, soll – so die normative Selbstverpflichtung staatlicher Rechtspolitik – sich im Prinzip einer garantierten Teilhabeermöglichung verwirklichen und damit ist ein neues Leitbild der politischen Behandlung der sozialen Gebrechen der Konkurrenzgesellschaft konstituiert: Inklusion. 3. Inklusion: die klassenlose Staatsbürgergesellschaft als Ort von Teilhabe und „gleichberechtigter Partizipation“ „Die Form hat keinen Wert, wenn sie nicht die Form des Inhalts ist“ – die Anmerkung von Marx, die dieser mit Blick auf die damalige Diskussion um rechtliche Verbesserungen getätigt hat (MEW, Bd. 1, S. 146), enthält die Aufforderung Rechtsverhältnisse als Ausdruck der ihnen zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse zu analysieren. Sie bezog sich auf das abstrakte Vertragsrecht, das Menschen als freie und gleiche behandelt, deren sozialer Gegensatz (als Arbeitskraft- und Kapitalbesitzer) in diesen Rechtsbeziehungen als aufgehoben erscheint. Nimmt man die sozial so verschiedenen Charaktere aber in ihrer Eigenschaft als Staatsbürger, dann erscheinen eben diese sozialen Unterschiede in einem anderen Licht. Sie sind möglicherweise eine Folge rechtlicher Sonderregelungen und damit wird die Forderung nach Rechtsgleichheit zu etwas, was sich der bürgerliche Staat, der ja alle seine Bürger mit gleichen Rechten ausstattet, zu eigen macht. „Erst im Horizont gleicher menschen- und bürgerrechtlicher Ansprüche auf soziale Zugehörigkeit (…) werden 9 `Inklusionsrückstände`(…) bzw. Exklusionsprozesse überhaupt erst als mögliche Verletzung von Rechten begründungsbedürftig“ (Wahnsing 2012, S. 383). In einer Zeit, in der die – rechtlich geregelten und verfassungsrechtlich überprüften – sozialen Gegensätze nicht nur eine Mindestlohndebatte, sondern auch eine „Überforderung“ des Sozialstaats auf die politische Agenda bringen, wird das Recht zum Hebel der Wahrnehmung von Inklusion und Exklusion und dementsprechend korrigiert der sozialpolitische Idealismus (gerechte Verteilung) seinen Bezug auf die bürgerliche Gesellschaft im Sinne eines verschärften Rechtsidealismus (gleiche Anerkennung). In Widerspruch zueinander wird dabei der Tatbestand gesetzt, dass der Sozialstaat, gerade weil er sich als Gewährleister der Funktionalität der von Erwerbsarbeit lebenden Klasse versteht, Ausnahmen von der Gleichbehandlung der Konkurrenzsubjekte für notwendig hält. Der Tatbestand von Sondersystemen und Sondermaßnahmen, die zum Zwecke der Förderung von Konkurrenzfähigkeit eingerichtet werden (auch dann, wenn diese gar nicht mehr realistisch erwartet werden kann), gilt vor dem Hintergrund der Rechtsgleichheit als „Exklusion“, also als Ausschluss von einer gleichberechtigten Teilhabe. Wenn der Staat im Rahmen seines Schul- und Hochschulsystems dafür sorgt, dass mittels eines institutionalisierten Leistungsvergleichs eine Art Vorauswahl der Schülerinnen und Schüler auf die durch staatliche Berufsbilder festgelegte Berufswelt erfolgt, bei dem das anzueignende Wissen als Material der Auslese fungiert, dann erscheinen Sonder- und Förderschulen nicht mehr als sozialstaatliche Einrichtungen zur Kompensation eingeschränkter Lern- und damit Konkurrenzfähigkeit, sondern als Ausschluss von der für alle geltenden Leistungskonkurrenz und damit als institutionalisierte Benachteiligung einer Teilnahme am Arbeitsmarkt. Indem die rechtliche Gleichheit von Menschen, die mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ihre individuelle Reproduktion bestreiten müssen, als Anerkennung ihrer Teilhabe an der Gesellschaft bestimmt wird, wird der Kampf um diese Rechtsgleichheit zum entscheidenden Hebel der auf den Staat gerichteten politidealistischen Erwartungen. Die in der polit-ökonomischen Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft existierenden sozialen Gegensätze und die unterschiedlichen materiellen Resultate des Einsatzes der eigenen Erwerbsquelle schrumpfen vor diesem Hintergrund zu einer vernachlässigbaren Größe zusammen, weil es um das Prinzip einer rechtlich garantierten Teilhabemöglichkeit geht. Es steht von vornherein fest und bedarf keiner weiteren Diskussion und Begründung, dass diese staatsbürgerliche Gleichheit der Teilhabe sich nur auf diejenigen erstreckt, die anerkanntes Mitglied der Nation und damit qua Geburt Volksgenossen sind. 10 Die Befreiung des Konkurrenzbürgers aus dem fürsorglichen Zugriff des Staates wird unter das Motto „Selbstbestimmung“ gestellt. „Es geht um soziale Inklusion auf der Grundlage individueller Autonomie und damit zugleich um eine freiheitliche Gestaltung des Zusammenleben in Gesellschaft und Gemeinschaft“ (Bielefeldt 2006, S. 7). In der Forderung nach Inklusion erscheint nicht mehr der Staat, sondern der Staatsbürger als Subjekt der Sicherung von Teilhabe. Das Recht hat lediglich sicherzustellen, dass der Bürger seine Autonomie ohne einschränkende Sonderregelungen praktizieren kann. An die Stelle eines (Sozial-)Staats, der mit Sonderregelungen auf die Herstellung von Konkurrenzfähigkeit dringt, soll die Gemeinschaft treten, die ein diskriminierungsfreies Leben ermöglicht, die Sozialräume sind aufgefordert, „Teilhabe“ zu realisieren und die „Zivilgesellschaft“ wird zum eigentlichen Motor eines selbstbestimmten Lebens. Der Abstraktion von den sozialen Gegensätzen der Gesellschaft entspricht im Begriff der Inklusion die Abstraktion von dem, was das Leben in der „Gemeinschaft“ bestimmt: die Qualität des Wohnens, die Abhängigkeit der Freizeitgestaltung von den verfügbaren Mitteln, die bedürfnisgerechte Gestaltung des eigenen Lebens jenseits der Notwendigkeiten des Gelderwerbs. 3 In dem der Staat Inklusion zum Thema der Gestaltung von Sozialpolitik macht, werden nicht nur die die Konkurrenzgesellschaft betreffenden Sonderregelungen einer kritischen Prüfung unterzogen, sondern die Gesellschaft selbst in die Pflicht genommen. Inklusion ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der sich niemand entziehen kann und soll. Das Ideal, dass die „sozialen Gebrechen“ der Gesellschaft nun Angelegenheit dieser Gesellschaft selbst sind, dass Sozialpolitik wesentlich eine Angelegenheit der „Zivilgesellschaft“ und der Sozialräume ist, fordert die Moral der Bürgerinnen und Bürger. Die Folgen dieser staatlich durchgesetzten Sittlichkeit lassen sich schon jetzt beobachten: Konkurrenzerfolg und –mißerfolg ist eine Sache, die der Bürger sich selbst zuschreibt und selbstbewusst genießt oder verachtet. Dementsprechend blicken die Arbeitsplatzbesitzer mit Häme auf diejenigen, die als „Hartzer“ sowieso schon unter dem staatlichen Verdacht der Leistungsunwilligkeit stehen und im Lager der Konkurrenzverlierer werden psychische Erkrankungen zum Massenphänomen. Die klassenlose Staatsbürgergesellschaft ist mehr denn je davon überzeugt, 3 Die Wahrnehmung dieser Ideologeme führt dazu, dass Inklusion auch als Kontrastbegriff zum Umverteilungsbegriff gedeutet wird: „Man kann im Kriterium der Teilhabe Anklänge der alten liberalen Idee der marktbezogenen Chancengleichheit finden, wonach der Staat durch Rechtsstaatlichkeit und Bildungsinstitutionen für alle Individuen die Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten im Wettbewerb zu garantieren hat. Neu ist dagegen der Aspekt, Teilhabe auf potenziell alle möglichen sozialen Bereiche zu beziehen: Neben der Wirtschaft geht es um die Ermöglichung kultureller und politischer Beteiligung, um soziale Netze, um das Alltagsleben, medizinische Versorgung, Wohnung usw. (...) Teilhabe in diesem Sinne ist also keinesfalls allein oder vornehmlich durch staatliche Zuteilung zu realisieren. Staatlich veranlasste Maßnahmen werden vielmehr in Kombination mit zivilgesellschaftlichen Prozessen gedacht und sollen Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern“ (vgl. Appel/Breuer 2011, S. 430) 11 dass jeder selbst seines Glückes Schmied ist und die staatlich gewährte Freiheit in der eigenen Nutzbarmachung besteht. Sozialpolitik wird damit mehr und mehr zu einem Akt tätiger Nächstenliebe, zum moralischen Akt der Anerkennung der Gescheiterten, denen mit Almosen über die Runden geholfen werden soll. Charity wird zur moralischen Aufgabe und Verpflichtung erfolgreich vermehrten Privateigentums und damit nehmen die „sozialen Gebrechen“ der Gesellschaft, an denen Marx noch grundsätzlich etwas auszusetzen hatte, eine kuriose Wende: sie sind nunmehr Gegenstand der helfenden Tätigkeit derer, die die Inklusion der Armen betreiben. So klassenlos ist die klassenlose Staatsbürgergesellschaft dann doch nicht, dass sie ihre sozialen Gegensätze vergisst. Und selbst die Menschen mit Behinderungen, sozialstaatlich betreut und versorgt, haben einen Anspruch auf Inklusion. Der Staat erkennt ihre Rechte an, gestaltet die sozialpolitischen Leistungen nach seinen gesetzgeberischen Prinzipien und aktiviert die „inklusive Gesellschaft“. 4. Die sozialstaatliche Idealisierung der Konkurrenzgesellschaft: Keiner soll verloren gehen Der Sozialstaat, der Inklusion zum Leitprinzip seiner sozialstaatlichen Maßnahmen erhebt, will Wirtschaft, Gesellschaft und Leistungsträger aktivieren. Er will seine Leistungen so gestalten, dass sie ausschließlich aktivierenden Programmen zur Verfügung stehen und er will Teilhabe zur Bedingung öffentlich geförderter Maßnahmen machen. Er fordert damit von seinen Staatsbürgern, dass sie sein Prinzip „gleiche Rechte für alle“ auch anerkennen und auch dann praktizieren, wenn es ihren Eigeninteressen entgegen steht. Er mutet seinen Bürgern damit auch zu, ihre im Recht gefasste Gleichheit als Staatsbürger jenseits ihrer Partikularinteressen zur Maxime ihres Handelns zu machen, und ergänzt das Leitbild der Inklusion um das der Akzeptanz von Unterschiedlichkeit (Diversity). Das große Ziel einer sich von sich selbst emanzipierenden Sozialpolitik erfordert auch in nicht geringem Umfang den Einsatz finanzieller Mittel: diese dienen einzig und allein dem Zweck, den „gepamperten“ Sozialstaat, in dem es sich dessen Leistungsempfänger viel zu gemütlich eingerichtet haben durch einen konkurrenzfähigen und konkurrenzwilligen Bürger zu ersetzen, der sich die von ihm geforderte Eigenverantwortung so zu Herzen nimmt, dass er seine Teilhabe als Pflicht und Verpflichtung zugleich betreibt. Inklusion verfolgt deshalb konsequent die Philosophie des Vorrangs der Regelsysteme. Kinder aus „schwierigen sozialen Verhältnissen“ sollen möglichst früh in eine Kita, Ganztagsschulen sollen helfen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Schulaufgaben unter 12 Betreuung erledigen können, Jugendliche mit „herausforderndem Verhalten“ sollen in den Schulen gehalten werden und Erziehungshilfen vermieden werden. Im Anschluss an die Schule soll die Vermittlung in ein Ausbildungsverhältnis erfolgen, notfalls mit öffentlicher Unterstützung. Sondersysteme sollen soweit wie möglich abgebaut und durch Kooperation der Regelsysteme ersetzt werden. Kein Abschluss ohne Anschluss heißt das politisch formulierte Ideal einer Aktivierung der mit Bildung, Erziehung und Arbeitsvermittlung beauftragten Institutionen und der Sozialstaat lässt keinen Zweifel daran, dass er diese Baustellen in die gewünschte Richtung umzubauen gedenkt. Das wirkt für die so aktivierten Institutionen herausfordernd, sie machen sich aber trotz aller Bedenken das Prinzip einer funktionell bestimmten Sozialpolitik, die Teilhabe fordert und fördert, zu Eigen, wenn sie ihr Handeln unter die Überschrift stellen: „Keiner darf verloren gehen“. a) Inklusion als Auftrag von Kindertagesstätten und Erziehungshilfen kritisiert, dass in der Schule, aber auch aus Perspektive des Arbeitsmarktes Kinder und Jugendliche als „Problemfälle“ angesehen wurden, die durch ein differenziertes, sozialpädagogisches System von Hilfen, die ein individuelles Engagement ermöglichen sollen, „gesondert“ unterstützt, gebildet und erzogen wurden. „Die Kinder- und Jugendhilfe ist damit in eine `Einzelfalle` geraten: mit dem Inklusionsansatz sind nun aber vor allem die allgemeinen „Regeleinrichtungen“ der Erziehung, Bildung sowie Sorge aufgefordert, sich organisational neu zu entwerfen und den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen selbst, d.h. „regelhaft“ gerecht zu werden“ (Oheme/Schroer 2009). Indem den Regelinstanzen der Erziehung und Bildung der sozialpolitische Auftrag erteilt wird, nicht länger durch sozialpädagogische Sondermaßnahmen und individuell ausgerichtete Förderungen die ihnen gegenüber tretenden sozialen und individuellen Unterschiede auszugleichen, sondern dies im Rahmen des regelhaften Handelns verwirklicht werden soll, wird ein neues Erziehungsideal formuliert, dass besser als das auf Integration ausgerichtete Handeln geeignet sein soll, den öffentlichen Erziehungsauftrag zu realisieren: - Anerkennung von Unterschieden: „Inklusion beginnt mit der Wahrnehmung von Unterschieden zwischen Kindern. Die Beteiligten sollen erkennen, dass man trotz Unterschiede auch Gemeinsamkeiten hat und man gemeinsam wertvolle Erfahrungen sammeln kann. Die wichtigste Grundlage des inklusiven Konzepts ist, dass es normal ist verschieden zu sein (Derman-Sparks 2010); - Unterschiede als Chance: Inklusion versteht individuelle Unterschiede als Ressource. „Dies ist ein Weg, wie Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern bezüglich ihrer 13 Interessen, Fähigkeiten, Begabung, Beeinträchtigung, familiären Hintergrunds u.a. genutzt werden können, um ein intensiveres Spielen und Lernen zu ermöglichen. Differenzen werden nicht mehr als Problem betrachtet, die zu überwinden sind“ (Hinz 2008); - Wohnortnahe Bildung und Erziehung: Im Rahmen von Inklusion sollen alle Kinder eine Gelegenheit erhalten, Bildung und Erziehung in Anspruch zu nehmen. Dazu zählt auch, dass jedes Kind einen spezifischen und einfachen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten erhält. Fördermaßnahmen sollen in ein und derselben Einrichtung erfolgen. „Damit wird wiederum die gemeinsame Partizipation aller Kinder an der Kultur, den pädagogischen Angeboten und Inhalten erhöht und der Ausschluss vermieden“ (Kreuzer/Ytterhaus 2011, S. 36). Gefordert ist also nicht mehr und nicht weniger als eine stärkere Ausrichtung der Fachkompetenzen der Kindertagesstätten an der Organisation von allgemeinen Erziehungsund Bildungseinrichtungen, die für alle und damit eben auch für Menschen mit Behinderung oder durch soziale Ungleichheiten benachteiligte Kinder gelten. Sie sollen – so das Ideal der Umgestaltung dieser Einrichtungen – verhindern, dass Kinder (und Jugendliche) überhaupt als „Fall“ mit besonderem Hilfebedarf sichtbar werden. Es soll nicht durch Diagnostik möglichst frühzeitig am Einzelfall präventiv gehandelt werden, um das „von der Norm abweichende Kind“ in eine Einrichtung zu integrieren, sondern die Kindertagesstätten und Einrichtungen der Erziehungshilfe sollen die Bedürfnisse und sozialen Unterschiede der ihnen gegenübertretenden Kinder und Jugendlichen akzeptieren und im Rahmen ihrer pädagogischen Möglichkeiten bearbeiten und Unterstützung gewähren. Die inklusive Kindererziehung soll – dass ist ihr offensiver und zugleich anspruchsvoller Auftrag – die Resultate einer Konkurrenzgesellschaft, die sich in einer entsprechenden sozialen Lage von Kindern ausdrückt4 – nicht als Aufforderung zur Korrektur, sondern als Chance zu deren Förderung begreifen und dementsprechend sollen auch Kinder mit Behinderungen nicht mehr durch Sonderkitas und Sonderprogramme gefördert und zur Teilhabe erzogen werden, 4 In Deutschland wachsen nach einer neuen Studie der Unicef etwa 1,2 Mio. Mädchen und Jungen in relativer Armut auf. "Es ist enttäuschend, dass Deutschland es nicht schafft, die materiellen Lebensbedingungen für Kinder entscheidend zu verbessern" (Schneider 2012). Die Situation der Mütter und Väter ist den Angaben zufolge ein entscheidender Faktor: In 42,2 Prozent der Fälle, in denen Unicef eine "besondere Mangelsituation" ausmacht, sind die Eltern arbeitslos, 35,6 Prozent haben lediglich einen niedrigen Bildungsabschluss. 14 sondern ihre Teilhabe wird durch ihre Gleichbehandlung in den Regelinstitutionen von vornherein sicher gestellt5. b) Das politische Urteil, dass die sozialstaatlich und bildungspolitisch eingerichteten Sondersysteme zu teuer, zu selektiv und zu wenig wirksam mit Blick auf die „Integration in die Erwerbsgesellschaft“ sind und deshalb durch eine „inklusive“ Öffnung der Regelsysteme ersetzt werden sollen, gilt in besonderem Maße für die Schulen. Die Empfehlungen der Kulturminister der Länder zur inklusiven Bildung knüpfen an die Grundpositionen der „Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 6.Mai 1994) einschließlich der Empfehlungen zu den Förderschwerpunkten an und stellen die Rahmenbedingungen einer zunehmend inklusiven pädagogischen Praxis in den allgemeinbildenden Schulen dar“ (ebenda S.22). Im Wissen darum, dass sie den Schulen mit der neuen politischen Zielsetzung einiges abverlangen, betonen die Kultusminister den ideellen Aspekt ihres inklusiven Vorhabens und tun dabei so, als hätten die unterschiedlichen Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen bislang keine oder eine zu geringe Rolle gespielt: „Die Ausrichtung der Schulen auf die unterschiedlichen Voraussetzungen von Kindern und Jugendlichen ist eine grundsätzliche Aufgabe. Dabei werden die Akzeptanz von Vielfalt und Verschiedenheit erweitert und Möglichkeiten und Fähigkeiten der Schulen im Umgang mit Unterschieden – sowohl auf der individuellen als auch auf der organisatorischen und systemischen Ebene – gestärkt. Sie greifen die Erfahrungen mit der individuellen Förderung in allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen auf“ (ebenda S.3). Die Schulen werden vor ganz neue Anforderungen gestellt, weil damit die bisherige Form des Unterrichts ad acta gelegt wird, sie haben den Unterricht zu individualisieren und zu differenzieren. Gefordert wird der Idealismus der Lehrer, dies auch ohne große personelle oder räumliche Änderungen zu bewerkstelligen, denn diese wird für die Zukunft in Aussicht gestellt und besteht vorwiegend in Beratungs- und Assistenzkräften. „Inklusiver Unterricht berücksichtigt einerseits die Standards und Zielsetzungen für allgemeine schulische Abschlüsse und andrerseits die individuellen Kompetenzen der 5 Das Programm der Rückverlagerung sozialstaatlicher Aufgaben in die Gesellschaft wird ideologisch nicht mehr als Programm des schlanken Staats, sondern als emanzipatorischer Akt der Stärkung von Kinder- und Bürgerrechten begründet. Da das sozialstaatliche Anliegen der Umverteilung zu keinen befriedigenden Resultaten geführt habe, müsse man nun auf Teilhabe umschwenken. Zwar soll damit nicht dem Ersatz materieller Ansprüche durch ideelle Zugeständnisse das Wort geredet werden, aber eine Bedeutungsverschiebung hin zu einer stärkeren Betonung des Werts von Beteiligung soll schon vorgenommen werden. (Vgl. hierzu Appel und Breuer (2010)) 15 Lernenden. Gleiche Lerngegenstände können im Unterricht auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlicher Zielsetzung bearbeitet werden. Dies erfordert geeignete didaktischmethodische Vorgehensweisen und Unterrichtskonzepte, um für alle Lernenden Aktivität und Teilhabe in einem barrierefreien Unterricht zu gewährleisten. Erfolgreiches Lernen in heterogenen Gruppen setzt für einige Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen voraus, dass Unterrichtsinhalte zeitweilig oder längerfristig elementarisiert werden, um den individuellen Lernerfordernissen und Zugangsweisen eines Kindes oder Jugendlichen zu entsprechen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011, S.9). Maßstab der Beurteilung der Schüler ist damit auch nicht mehr die Leistung der Klasse, an deren Durchschnitt die Schüler in gute oder schlechte Lernende unterteilt werden, sondern gemessen werden die Schüler an Bildungsstandards, die die Bildungspolitiker im Rahmen von internationalen Vergleichen ihres Schülermaterials erhoben haben. Studien wie PISA machen deutlich, dass die Politik die Schule als Mittel für die internationale Konkurrenz der Staaten um ihren wirtschaftlichen Erfolg entdeckt und die Bildungspolitik den Schulen den Auftrag erteilt hat, ihre Schüler für diese Konkurrenz wirkungsvoller in Anspruch zu nehmen als dies in der Vergangenheit der Fall war. Deshalb soll der Bildungsstandard gehoben, Sitzenbleiberzahlen gesenkt und individuelle Förderung vermehrt angeboten werden. Wie die Schulen dies alles bewerkstelligen, dazu sind sie in mehr Eigenverantwortung entlassen worden. Das politische Ideal einer Schule, die durch die Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler dafür sorgt, dass deren Tauglichkeit für den Arbeitsmarkt umfassender, weniger selektiv und ohne zusätzliche Aufwendungen hergestellt werden kann, führt auch im schulischen Bereich dazu, dass die bislang anerkannten Gründe für pädagogischen Zusatzund Sondermaßnahmen als Behinderung des Schulerfolgs angesehen werden. „Inklusion bedeutet: Gemeinsamkeit aller Kinder ist normal“ (Schöler 2006, S. 1) heißt es und damit gilt auch für die Schule das Motto: „Es ist normal, anders zu sein“.6 6 Es liegt auf der Hand, dass der bildungspolitischen Forderung nach Gleichbehandlung pädagogisch widersprochen wird. Die „Pädagogik der Vielfalt“, die als alternatives Konzept verfochten wird, bezweifelt, dass in der Inklusion der unterschiedlichen Bedürftigkeit von Schülern ausreichend Rechnung getragen wird (Schröder 2007). Differenzierung und Individualisierung als heilpädagogische Werte würden als Separierung und Diskriminierung denunziert und dies gleiche „ekklesialen Alleinseligmachungsansprüchen“ (Kobi 2008). Zur These, es sei „normal, anders zu sein“, gehöre auch, dass eine Behinderung für die Person selbst als „Normalität“ gelten kann, das andere Formen der Aneignung entwickelt als die Mehrheit der gleichaltrigen Kinder (Schöler 2002). Alle diese Einwände blamieren sich vor dem politischen Willen, mit dem die inklusive Schule als Projekt der Korrektur einer zu wenig auf Beschäftigungsfähigkeit und Bildungsabschlüsse zielenden Sonderpädagogik durchgesetzt wird. 16 c) Auch das Übergangssystem ist Gegenstand einer „inklusiven“ Neuordnung. So wird u.a. über neue Kombinationsmodelle zwischen dualer und vollzeitschulischer bzw. außerbetrieblicher Ausbildung, die die soziale Inklusion bildungsbenachteiligter/-schwacher Jugendlicher ermöglichen, nachgedacht. Ein Megatrend der letzten Jahre, der für den gesamten Bildungs- und Sozialsektor bestimmend ist, besteht in der Dezentralisierung sozialund bildungspolitischer Entscheidungen. Flankiert wird dieser Trend durch eine weitgehende Deregulierung und Ökonomisierung (Vermarktlichung resp. Privatisierung) ehemals staatlichöffentlicher Aufgaben– gerade auch im Bildungsbereich.7 Dabei handelt es sich um einen international zu beobachtenden Trend.8 So war bereits seit den 1990er Jahren – angeschoben durch diverse einschlägige EU-Programme – von der Region als einem „berufsbildungspolitischen Gestaltungsraum“ die Rede, in dem es die „weichen Standortfaktor“ zu identifizieren und zu nutzen gelte (vgl. Dobischat 2006, ders. 2010). Durch regionale Kooperation und Netzwerkbildung sollten vor allem die Bildungs- und Beschäftigungspotentiale „benachteiligter“ Zielgruppen verbessert werden, um deren Eingliederungschancen zu erhöhen. Diese Entwicklungen bezogen sich zunächst vor allem auf die Handlungsfelder Arbeitsmarktund Beschäftigungspolitik und darauf bezogene Förder- und Qualifizierungsprogramme. Betroffen war in Deutschland zunächst primär der wenig formalisierte Weiterbildungsmarkt. Mittlerweile wird die gesamte lokale „Bildungslandschaft“ in den Fokus genommen; das Blickfeld erweitert sich zudem auf die gesamte individuelle Lernbiographie („Lebensbegleitendes Lernen“). Einbezogen ist also nicht nur die nachschulische Bildung, sondern das (berufsbezogene) Lernen von Anfang an: von der Schule und im Übergang von der Schule in Ausbildung bis hinein in das Arbeits- und Berufsleben. Themen wie Eigenverantwortung der schulischen Einrichtungen (Stärkung der Schulautonomie: „Selbständige“ resp. „Eigenständige Schulen“) und der Individuen (Stärkung der Eigenverantwortung: Befähigung zum „Selbstmanagement“) gewannen seither immer mehr an Bedeutung. Die großen Arbeitsmarkt- und Sozialstaatsreformen Mitte der 2000er Jahren („Hartz-Gesetze“) führten zu einer weiteren Dezentralisierung und Deregulierung sozialstaatlicher Aufgaben. Nur vor Ort, so die vielfach geäußerte Überzeugung, können die richtigen Antworten auf die bildungspolitischen Herausforderungen gegeben werden, weil dort unmittelbar an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 7 Zu den Privatisierungstendenzen und den kritischen Diskussionen um „Bildung als Ware“ vgl. exemplarisch die „Privatisierungsreports“ der GEW (http://www.gew.de/Privatisierungsreports.html. 8 Eine Vorreiter- teilweise auch Vorbildfunktion übernahmen dabei insbesondere die USA und Großbritannien, die auf die Arbeits- und Sozialreformen in Deutschland erheblichen Einfluss hatten. 17 angeknüpft werden kann.9 Nur wenn diese Lebenswelten in den Blick genommen werden, könne es gelingen, den Automatismus von Bildungserfolg und sozialer Herkunft zu entkoppeln und eine Teilhabe an Bildung bzw. den Zugang zu ihr für alle zu ermöglichen. „In den letzten Jahren gelang es dem dualen und hochschulischen System nicht, alle Jugendlichen mit einer Berufsausbildung auszustatten. Soziale Inklusion von bildungsschwachen Schülerinnen und Schülern gelingt nicht in unserem gegliederten Schulsystem und setzt sich in der Berufsausbildung fort…Gerade jetzt, in einer Phase der Stärke des Systems der Berufsausbildung und hoher Nachfrage nach Arbeitskräften, sollte die Schwachstelle, mangelnde Inklusion, angepackt und Hamburg marschieren vorneweg. Hier wird der Eintritt in den Übergangsbereich mit einer Bildungsgarantie verknüpft. Gelingt der Sprung in eine betriebliche Ausbildung nicht, wird der Bildungsweg bis zum Ende (Berufsabschlussprüfung bei der Kammer auf Kosten der Landesregierung) fortgesetzt. Der Jugendliche bleibt entweder in der Berufsschule oder ein Bildungsträger übernimmt die Ausbildung“ (Friedrich-Ebert-Stiftung 2013, S. 2). 5. Schlussbemerkung: Teilhabe als Vermeidung von Exklusion - die theoretisch-normative Überhöhung eines politischen Ideals Das politische Ideal einer sich von sich selbst emanzipierenden Sozialpolitik und ihre Überführung in durch Regelinstitutionen garantierte Prozesse der Integration in Erwerbsarbeit beansprucht und verändert den Inklusionsauftrag der die Folgewirkungen der Konkurrenzgesellschaft abarbeitenden Institutionen.. Soziale Ausgrenzung findet danach überall dort statt, wo der Inklusionszweck (sozialer Zusammenhalt) gefährdet erscheint, bspw. dadurch, dass soziale Ungleichheit verstärkt und nicht eingegrenzt wird. Dies aber verschärft die Widersprüche, die im Ideal einer die Folgewirkungen der Konkurrenz überwindenden Sozialpolitik angelegt sind: schon eine oberflächliche Betrachtung moderner bürgerlicher Gesellschaften lässt erkennen, dass deren Zwecksetzung weder die „Inklusion“ noch die „Exklusion“ von Individuen ist. Weder das Bildungswesen noch die Arbeitswelt, weder die Art und Weise des Wohnens, noch der Zugang zu sozialen Leistungen folgen einem Prinzip von Einschluss oder Ausschluss. Bildung ist ein Mittel, Wissensunterschiede herzustellen, die zu unterschiedlichen Eingliederungen in die Berufshierarchie führen, die Arbeitswelt beschäftigt nach dem Kriterium der Rentabilität, was auch einschließt, dass Arbeitslosigkeit benötigt wird, der Wohnungsmarkt ist ein Geschäftsfeld, dass in Folge dessen eine breite 9 „Für die Jugendlichen entscheidet sich vor Ort, ob der Einstieg und die Integration in das Berufsleben gelingen.“ (Stellungnahme der Gruppe der Beauftragten der Arbeitnehmer zum Entwurf des Berufsbildungsberichts 2011). 18 Palette der Qualität des Wohnens bis hin zur Wohnungslosigkeit kennt und der Zugang zu sozialen Leistungen ist von der Sozialversicherung bis zur Fürsorge sorgsam rechtlich geregelt. Weder dem (Sozial-)Staat noch der Wirtschaft geht es um den Ausschluss von Individuen, sondern um ihre Nutzbarmachung im Sinne des Wirtschaftswachstum produzierenden Privateigentums. „Hilfebedürftigkeit“ ist deshalb ein notwendiger Bestandteil funktionierender Kapitalverwertung – ebenso wie der Arbeitsplatz oder die Schulbildung. Ein Gegensatz von „Inklusion“ und „Exklusion“ wird dies nur dann, wenn man von dem, worin „inkludiert“ wird, abstrahiert und mit Hilfe eines Werturteils den Besitz eines Arbeitsplatzes oder die Schulteilnahme als „Teilhabe“ qualifiziert. Nur mit Hilfe eines der Betrachtung dessen, worin es in den jeweiligen Sphären der Gesellschaft geht, vorausgesetzten Urteils, wird dann ein normativer Maßstab gewonnen, der relativ beliebig angewendet werden kann. So wird z. B. der Sozialen Arbeit vor diesem Hintergrund die Aufgabe zugeschrieben, „Inklusion“ zu verstärken und „Exklusion“ zu vermeiden (Bommes/Scherr 1996), was zu der Notwendigkeit führt, eine Theorie der Lebensführung zu entwickeln, „die in der Lage ist, aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen Inklusion und Exklusion zu einer solchen Hilflosigkeit führen, die Leistungen der Sozialen Arbeit veranlasst“ (Scherr 2004, S. 56). 10 Mit der normativen Zuschreibung der Aufgabe der „Exklusionsvermeidung“ hat sich die Bestimmung dessen, was das berufliche Handeln in der sozialen Arbeit auszeichnet, von dem zugrundeliegenden sozialstaatlichen Auftrag („Fälle“ zu bearbeiten, dass sie an sich selbst die Tauglichkeit zur Konkurrenz (wieder) herstellen, im vormaligen BSHG „Hilfe zur Selbsthilfe“ genannt) abgelöst und damit hat die Herstellung von „Inklusion“ auch nichts mehr mit den Verhältnissen, in die inkludiert wird, zu tun.11 Mit dieser begriffslosen normativen Setzung von Inklusion als Sicherung der Teilhabe am kapitalistischen Gesamtgeschehen eröffnet sich ein weites spekulatives Feld, wie sich das so Gedachte auch verwirklichen lässt. So kann es auch den Tatbestand einer „inkludierenden 10 Die sozialstaatliche Aufgabe, personenbezogene Dienstleistungen zu erbringen, wird gewöhnlich als Leitidee der Profession Sozialarbeit/Sozialpädagogik bezeichnet: sie hat „Exklusionsprozesse anderer Funktionssysteme im Modus stellvertretender Inklusion zu neutralisieren“ (Gängler 2011, S. 616). In solchen funktionalistischen oder dienstleistungstheoretisch abgeleiteten Aufgabenbeschreibungen wird die der Sozialen Arbeit vorausgesetzte sozialstaatliche Zweckbestimmung vollkommen ausgelöscht, da man diese - rein affirmativ - lediglich als Teilsystem einer funktionsdifferenzierten Gesellschaft definiert, die Leistungen erbringt, für die es eine gesellschaftliche Nachfrage gibt. Bei Beschreibungen und Funktionsbestimmungen dieser Art handelt es sich mehr um Idealisierungen als um analytische Begriffsbestimmungen. 11 Das Verfahren, Inklusion durch normative Setzung positiv zu bestimmen, ohne danach zu fragen, wohin denn inkludiert wird, lässt sich beliebig variieren, so z.B. auch auf die wirtschaftspolitischen Zielsetzungen der EU: „Im Vertrag von Maastricht haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union u.a. das Ziel gesetzt, gesellschaftliche Ausschließung von Bürgern (social exklusion) zu bekämpfen und auf soziale Integration aller (social inclusion) hinzuwirken (Hauser 2012, S. 125). Wo an anderer Stelle die EU-Zwecksetzung, Europa zum wettbewerbsfähigsten Weltstandort aufzumöbeln, noch als „neoliberal“ gebrandmarkt wird, stellt sich vom Inklusionsstandpunkt das Ganze als ein einziges Programm der Armutsbekämpfung (Benz 2012) dar. 19 Exklusion“ geben, wenn die Individuen an dem, worin sie inkludiert sind, nicht „wirklich teilhaben“ (Kuhlmann 2012, S. 49). Die „Befähigung zur gerechten Teilhabe“ wird damit als ein eigener Gegenstand kreiert (Martha Nussbaum) und eröffnet einen Gerechtigkeitsdiskurs, wo das, was am Anfang ganz banal die Möglichkeit einer lohnabhängigen Erwerbsarbeit war, nun zur Sicherung eines gerechten Lebens theoretisch fortentwickelt wird. Auch für Menschen mit Behinderungen verwirklicht sich mit Inklusion dann nicht die Existenz als Sozialhilfeempfänger mit individuellem Mehrbedarf oder von Erwerbsarbeit lebender Mitbürger, sondern gerechte Teilhabe in Form von Freiheit und Selbstbestimmung. Es ist nicht von ungefähr, dass ausgerechnet diese abstraktesten Ideologien der bürgerlichen Konkurrenz dafür herhalten müssen, den Wert der Inklusion auf den Begriff zu bringen. Denn es existiert ja schon eine Ahnung davon, dass die Wirklichkeit der Konkurrenzgesellschaft (nicht nur) für einen Menschen mit Behinderung in jeder Hinsicht herausfordernd ist. Ganz jenseits seiner Freiheit. Literatur Marx, K., 1972, MEW, Bd. 1, Berlin Huster, E.-U./Bourcarde, K., 2012, Soziale Inklusion: Geschichtliche Entwicklung des Sozialstaats und Perspektiven angesichts Europäisierung und Globalisierung, in: Balz, H.J./Benz, B./Kuhlmann, C. (hg.) Soziale Inklusion, Grundlagen, Strategien und Projekte in der Sozialen Arbeit, Wiesbaden, S. 13 – 34 Hauser, R., 2012, Das Maß der Armut, in: Huster, E.-U./Boeckh, J./Mogge-Grotjahn, H. (Hg.) Handbuch Armut und Soziale Ausgrenzung, Wiesbaden, S. 122 – 146 Benz, B., 2012, Politik sozialer Inklusion in formaler, inhaltlicher und prozeduraler Perspektive, in: Balz, H.-J./Benz, B./Kuhlmann, C. (hg.) Soziale Inklusion, Grundlagen, Strategien und Projekte in der Sozialen Arbeit, Wiesbaden, S. 115 – 140 Pongratz, Hans J./Voß, G. Günter (2003): Arbeitskraftunternehmer. Erwerbsorientierungen in entgrenzten Arbeitsformen, Berlin: edition sigma. Pongratz, L.A. (2008): Lebenslanges Lernen. In: Pädagogisches Glossar der Gegenwart, S. 162-171 Wahnsing, G., 2012, Inklusion in einer exklusiven Gesellschaft. Oder: Wie der Arbeitsmarkt Teilhabe behindert, in: Behindertenpädagogik, 51. Jg., 2012, Nr. 4, S. 381 – 397 20 Bielefeldt, H., 2006, Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Essay No. 5, herausgegeben vom Institut für Menschenrechte, Berlin Kobi, E., 2008, Alternative Integration als integrierte Alternative? In: Heilpädagogik online. 2, S. 13 – 29 Schöler, J., 2002, Nichtaussonderung von „Kindern und Jugendlichen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“. Auf der Suche nach neuen Begriffen. In: Eberwein, H. (Hg.): Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. Weinheim, S. 108 - 115 Hinz, A., u.a. (Hg.), 2008, Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen, Perspektiven, Praxis, Marburg