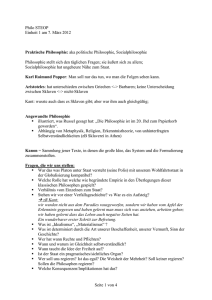Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der
Werbung

Dietrich Böhler Vorlesung im Sommersemester 2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Inhalt I Philosophie als Metaphysik oder strikt als Dialog und Begründung? Vorblick auf die drei Paradigmen. 1 Metaphysik als Seinsschau (Theoria) versus Erkenntniskritik im Subjekt- ObjektSchema versus Lebenswelt- und Kommunikationsreflexion……….....……………...06 1.1 Metaphysik als Studienschwerpunkt und als Zentrum der Philosophiegeschichte oder: Entwicklungslogik der drei Paradigmen: Sein/Metaphysik – Subjekt / Erkenntniskritik – Sprache / Diskursreflexion? …...............…………………………….....…………..06 1.2 Zum Begriff und zur Kritik der Metaphysik…………………………….…………... 10 1.3 Exkurs: Ist Metaphysik nach Kant und nach der pragmatisch-hermeneutischen Wende noch möglich? Das Beispiel von Hans Jonas’ „rationalem Mythos“………...……….17 1.4 Der voraussetzungs- und kommunikationsvergessene Weltbezug der Metaphysik, dessen Fortwirkung im Subjekt-Objekt-Paradigma und Heideggers hermeneutischpragmatischer, aber reflexionsvergessener Ansatz…………...................................…26 1.4.1 Vorgriff auf die pragmatisch-hermeneutische Wende und ihre Probleme: Heideggers „Sein und Zeit“…………………………………………………………...29 2 Über die drei Paradigmen der Philosophie und die (doppelte) Dialogizität des Denkens ………………………………………………………………………………………...34 2.1 Eine Problemübersicht zum Selbststudium: Tilman Lücke, „Mit skeptischen Fragen durch die Philosophiegeschichte“, in: H. Burckhart u. H. Gronke (Hg.), Philosophieren aus dem Diskurs. Beiträge zur Diskurspragmatik. Festschrift für D. Böhler. Würzburg (Königshausen u. Neumann) 2002, S. 45-68…………………………………………………………………….…..34 2.2 Nach der Lektüre: Fragen an D. Böhler und dessen Antworten……………………...94 2 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie II Grundlagen: Diskurs als argumentativer Dialog – systematisch und philosophiegeschichtlich erörtert. Einholung des argumentativen Dialogs als Entwicklungsziel der Philosophie 3.1 Die drei philosophischen Paradigmen und die widergängerische Rhetorik…………..52 3.2 Die Glaubwürdigkeit des Diskurspartners: Sinnkriterium für Diskursbeiträge und Kern der moralischen Identität……………………………………………………………...55 3.2.1 Der Logosgrundsatz oder: Sokrates’ Vorwegnahme und Verfehlung der verallgemeinerbaren Gegenseitigkeit. ……………………………………......56 3.2.2 Vorgriff auf eine Dialogethik im „Thrasymachos“ und „Georgias“………….74 3.2.3 Der Sokratische Elenchos und die Diskurs-Tugend. Wissen und Wollen der Dialogverpflichtungen bei (möglichem) Nichtwissen der Sachen………...… ? 3.2.4 Gemeinschafts- und Geltungsbezug als Basis einer dialogischen Sinnkritik. Die seit Platon verdrängten kommunikativen Dimensionen des EtwasDenkens……………………………………………………………………….? III Diskurs und Begründung im geschichtlichen Spannungsfeld von Seinsschau, Selbst-Bewußtsein und Kommunikationsreflexion. 4 Die klassische Metaphysik 4.1 Platon 4.1.1 Metaphysik, Logos und Ideen Die Entdeckung des Allgemeinen und Platons Ideenlehre…………………....92 4.1.2 Platons strukturale theoria-Ontologie: Vom Diskurs zur einsamen Ideenschau, vom argumentativen und reflexiven Dialog zum totalitären Kosmos-Polis-Mythos………………………………………………………...99 4.1.3 Wann ist eine Norm moralisch verbindlich? Was sich aus Platons naturalistischen Fehlschlüssen (und seinem metaphysischen Intellektualismus) lernen läßt……………………………………………………………….…...114 4.2 Aristoteles 4.2.1 Aristoteles’ teleologische theoria-Ontologie………………………...............117 4.2.2 Der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch: Verbindlichkeit aus dem Diskurs. Aristoteles als Diskurspragmatiker avant la lettre?...........................123 3 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 4.2.3 Die peripatetische Verbannung der Pragmatik aus der Philosophie – Türöffnung für den methodischen Solipsismus………………………..……130 [4.3 Hinweis auf Thomas: Folgenschwere Einordnung der Erkenntnis in das Schema ‚diskursiv versus intuitiv’] 5 Zerfall der mittelalterlichen ordo-Welten und Emanzipationen von deren Macht und theoria...................................................................138 5.1 Sprachsensibilität, Bildungsreichtum und tendenzielle Diskursautonomie des italienischen Humanismus…………………………………………………………...139 5.2 Luthers Reformation versus Humanismus des Cusaners: Verdeutschung der Bibel, behauptete und verweigerte Gewissensfreiheit – innerreligiöse Toleranz und Idee der Menschenwürde………………………………………………………………….….141 5.3 Die kopernikanische Revolutionierung des geozentrischen Weltbildes und die Suche nach einem künstlichen Zentrum…………………………………………………....149 6 Neuzeitliche Stationen der (Praktischen) Philosophie: Descartes, Hobbes und Kant. Oder: Das sich selbst vergewissernde und sich selbstbehauptende Subjekt zwischen instrumenteller Rationalität und praktischer Vernunft 6.1 Metaphysische Hintergrundserfahrung der Neuzeit oder: Kopernikanischer Choc, selbstbewußtes Subjekt und mathematisierte Technologie…………..……....150 6.2 Zwei Formen der Aufklärung – ein Preis: Verdrängung der Kommunikation durch emanzipatorisch gemeinten Solipsismus der Methode……………………….(153) 6.3 Descartes: Selbstvergewisserung durch wissenschaftliche Methode und durch Reflexion des Erkenntnissubjekts…………………………………………………...156 6.4 Thomas Hobbes oder die politische Hintergrundserfahrung der Neuzeit. Die konfessionellen Bürgerkriege als Offenbarung einer Wolfsnatur und die Antwort der zweckrationalistischen Vertragstheorie…………………………….….158 6.5 Immanuel Kants Suche nach praktischer Vernunft oder: Einsehbare Verbindlichkeit in den Grenzen einer Zwei-Welten-Metaphysik und deren Gesinnungsethik………………………………………………………….………….166 6.5.1 Verallgemeinerbarkeitstest als Weg zur Verbindlichkeit……………………170 6.5.2 Recht und Grenze einer idealistischen Vernunftethik in dualistischem Rahmen……………………………………………………….175 4 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 7 ‚Kommunikation’. Die pragmatisch-hermeneutische Entdeckung der Kommunikation als Sinnbasis des Etwas-Denkens: Auf dem Wege zu einem dritten Paradigma der Philosophie. 7.1 Weichenstellungen zur Pragmatik. Sprachphilosophisch: W. von Humboldt, semiotisch und naturwissenschaftstheoretisch: Ch. S. Peirce.1……………………? [7.2 Diskurstheorie (Habermas) versus Transzendentalpragmatik (Apel) versus sokratische Diskurspragmatik.2]………………………………………………………………..? 7.3 Welches sind die Sinnbedingungen des Verstehens und Erkennens? Charakteristische Antworten auf die transzendentalpragmatische Frage: Aristoteles, Tugendhat und Heidegger I versus W. von Humboldt, Wittgenstein II und Diskurspragmatik………………………………………………………………….196 IV Wo bist Du? Hast du etwas unweigerlich in Anspruch genommen und es zu Recht als verbindlich anerkannt, indem du (anderen gegenüber) etwas geltend machst? Aufhebung von Metaphysik und Kritik durch Einholung unserer selbst als Diskurspartner. 1 In der Vorlesung nur angesprochen. Daher empfehle ich zur Lektüre: D. Böhler, H. Gronke, Artikel „Diskurs“, Hist. Wörterbuch der Rhetorik, Band 2, Tübingen 1994, S. 794-798. J. Habermas, „Hermeneutische und Analytische Philosophie. Zwei komplementäre Spielarten der linguistischen Wende“. In: Ders., Wahrheit und Rechtfertigung, Frankfurt a.M., Suhrkamp 1999, S. 65-101. 2 Artikel „Diskurs, a.a.O., S. 811-819. 5 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 1 Metaphysik als Seinsschau (Theoria) versus Erkenntniskritik im SubjektObjekt-Schema versus Lebenswelt- und Kommunikationsreflexion. 1.1 Metaphysik als Studienschwerpunkt und als Zentrum der Philosophiegeschichte oder: Entwicklungslogik der drei Paradigmen: Sein / Metaphysik – Subjekt / Erkenntniskritik – Sprache / Diskurs? Gestatten Sie mir eine kritische Vorbemerkung zum Studienprogramm, die Ihnen gleich Charakteristisches meiner Denkweise offenlegen soll, insoweit sie diese Vorlesung trägt. Sie wissen dann, woran sie mit mir sind und was Ihnen im Hintergrund z.T. auch auf der Bühne dieses Kollegs begegnen wird, und können sich damit auseinandersetzen. Dieses bitte auch in offenen Diskussionen während der Vorlesungszeit. Zu meinem nicht geringen Erstaunen, zu meiner befremdeten Verwunderung scheint Metaphysik wieder Konjunktur zu haben. Und das Institut, dem ich angehöre, hat „Metaphysik / Ontologie“ als Studienschwerpunkt für den Bachelor-Studiengang festgesetzt. Zu meinem Befremden! Warum? Ich fragte mich: Mon Dieu, wie will man Metaphysik als Schwerpunkt eines Studiengangs rechtfertigen? Sollten wir nicht einerseits von den transzendentalen Subjektphilosophen Immanuel Kant und vor allem Edmund Husserl andererseits von dem nachkantischen Kommunikationsphilosophen bzw. dialektischem ‚Aufheber‘ der Transzendentalphilosophie Karl-Otto Apel gelernt haben, daß Philosophie zunächst und immer auch Selbstverantwortung des Denkens bzw. des Denkers für seine Annahme sein sollte? Genaugenommen Selbstverantwortung im Diskurs der Argumente? Erstens wissen wir doch, daß Metaphysik einer Spekulation gleichkommt, die sich schwerlich argumentativ einholen läßt; einer Spekulation, die sich jedenfalls nicht in einer Argumentation mit Skeptikern begründen läßt, welche keine metaphysischen Vorannahmen, gleichsam weltanschauliche Glaubensannahmen, akzeptieren. Jedenfalls die klassische vorkantische Metaphysik – und solche gibt es auch in der Zeit nach Kant, etwa im Werke Ernst Blochs – ist so etwas wie eine große Weltanschauung auf dem schlüpfrigen Grunde frei schwebender Vermutungen, mehr oder weniger eine Spekulation über das Ganze, das Sein als Ganzes, oder, landläufig gesagt, über Gott und die Welt und den möglichen Zusammenhang beider. 6 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie So war mein erster Einwand ein kritischer Verantwortungsimpuls: Metaphysik, das ist etwas, worüber sich nicht strikt argumentativ urteilen läßt, weil oder doch sofern sich ihre Spekulationen nicht ausweisen lassen im Rahmen strenger Vernunft, nicht prüfen lassen im Rahmen eines streng argumentativen Dialogs. Denn der vorkantische Metaphysiker bezieht einen Standpunkt, den ‚wir‘ als Teilnehmer eines argumentativen Dialogs, in dem nur jetzt und hier gleichberechtigt diskutierbare Thesen zugelassen sind, überhaupt nicht einnehmen können. Der klassische Metaphysiker schließt ‚uns‘ Diskurspartner nämlich insofern aus dem Diskurs aus, als er methodisch unterstellt, die (von ihm geleistete) Seinserkenntnis stelle einfach eine Schau auf die Welt von einem Standpunkt außerhalb der Welt dar, den er selber einnehme. Eigentlich beansprucht er einen Gottesstandpunkt. ‚Wir‘ haben aber einen solchen privilegierten ‚Sehepunkt‘ nicht, vielmehr verstehen ‚wir‘ alles in einer Lebenswelt und vor dem Sinnhintergrund von Traditionen‚ Institutionen, Interessen etc. – mithin in einem Geflecht von Kommunikation und Deutungsperspektiven… Mein zweiter Einwand: Warum fragt man nicht nach einer Entwicklungslogik in der Philosophiegeschichte? Ignoriert man, daß auf die unmittelbare, die spekulative, dogmatisch an Begriffen sich entlang hangelnde Metaphysikbetrachtung des Ganzen, oder des Seienden im Ganzen, zu Recht die Kritik, insbesondere die Erkenntniskritik Immanuel Kants gefolgt ist? Die Transzendentalphilosophie? Diese geht aus von der erkenntniskritischen Frage: Welches sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis? Diese Erkenntnisvoraussetzungen müßten die Philosophen aufdecken und bedenken. Die müßten sie als Grenzen ihrer spekulativen Vernunft, der reinen Vernunft, anerkennen wie Kant es ihnen ins Stammbuch geschrieben hat. Das war die kritische Fragestellung seiner Transzendentalphilosophie, weshalb diese dann von ihren neukantischen Vertretern schlicht als „die Kritische Philosophie“ bezeichnet worden ist – etwa von den großen Neukantianern Hermann Cohen in Marburg, Wilhelm Windelband und Heinrich Rickert in Heidelberg. Über die neukantische Subjektphilosophie hinaus führte in gewisser Weise Ernst Cassirer, hervorgegangen aus der Marburger Schule. Denn er vollzieht den Übergang zu einer auf die Kommunikation, auf die Symbolvermitteltheit des Denkens achtenden, dafür sensiblen Philosophie. Also gab es erstens eine Aufhebung der klassischen Metaphysik durch die Erkenntniskritik und, zweitens, auch eine Selbstaufhebungstendenz der bewußtseinsphilosophischen Erkenntniskritik – hin zur Kommunikationsreflexion. Das war gewissermaßen mein zweiter Einwand. Daran schlossen sich noch manche Einwände an. Deswegen habe ich mir gesagt: Du liest, zumal wenn es um Philosophiegeschichte geht, nicht 7 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie bloß über Metaphysik. Das kommt nicht in Frage. Du mußt gleich die transzendentalphilosophische Metaphysik-Kritik in Spiel bringen – und dann auch die transzendentalpragmatische Aufhebungsreflexion der noch subjektphilosophisch eingeschränkten Erkenntniskritik, die nunmehr auf das Denken als Kommunizieren achtet, das Denken als Kommunizieren rekonstruiert und begreift. Dann aber meldete sich ein immanenter Einwand – ein Argument, das gewissermaßen eine gewisse Selbstkorrektur meiner starken Ablehnungstendenz bedeutet, nämlich der Blick auf Sokrates. Ist es nicht etwas Wunderbares, daß schon zu Anfang der Metaphysik der Griechen, von der die ganze metaphysische Tradition zehrt, schon eine methodische Kritik etabliert wird? Und zwar Kritik im Rahmen von Kommunikation und z.T. auch im Blick auf Kommunikation: Kritik als Funktion des Diskurses i.S. eines argumentativen Dialoges. Sokrates ist gewissermaßen die Verkörperung eines Denkens, welches – freilich vor einem metaphysischen Hintergrund, mit spekulativen Kosmosharmonie-Annahmen – und ethisch eudaimonistischen Obertönen – Kritik etabliert im Blick auf das Sich mit Anderen Unterreden, im Blick auf eine Diskussion, in der nichts zählt als ein sinnvolles, jetzt im Diskurs prüfbares Argument. Sokrates hat die Kritik in seiner Lebenspraxis durchgestanden als Diskurs auf der Straße bzw. auf der Agora. Er war auch ein Mann der Straße, ein Mann, der auch auf der Straße die Anderen nötigt, das, was wir heute ihre Geltungsansprüche nennen, durch intersubjektiv geltungsfähige Gründe, durch Logoi, zu rechtfertigen. Er zeigt seinen Gesprächspartnern, daß sie mit ihrer Spruchweisheit, mit vorschnell verallgemeinerten Exempeln aus ihrer Lebenspraxis keinen Logos zu Stande bringen: kein Argument, welches verallgemeinerbar ist; kein Argument, welches auch für Andere, die von anderen Situationen ausgehen als denjenigen, die sie in ihren Beispielen hochstilisieren, nachvollziehbar, prüfbar und dann als wahr akzeptierbar ist. Darauf zielte Sokrates. Dieses positive Wahrheitsziel ist es, das ihn seine Gesprächspartner in die Kritik ziehen und in aporetische Situationen verstricken läßt. Davon geleitet, bringt er sie in die Lage, erkennen zu müssen, daß sie eigentlich gar nicht wissen, was sie zu wissen vorgeben. So sind in dem sokratischen Anfang der Metaphysik schon Kritik und Kommunikation verwoben. Das, meine Damen und Herren, ist es, was aus der bloßen Metaphysik im Abendland Philosophie werden läßt: diskursive, streitend dialogisierende Suche nach Wahrheit und Verbindlichkeit. Bloße, mehr oder weniger unkritisch spekulative Metaphysik gibt es auf dem Wege von archaischen Mythen zu Religionen und Weltaunschauungen der frühen Hochkulturen in der von Karl Jaspers so genannten „Achsenzeit“ vielerorts. Doch im 8 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie klassischen Griechenland, an dieser Wiege Europas, kommt es zur Philosophie, zum argumentativen Denken. Das lohnt es immer neu zu bedenken. Ohne Philosophie kein Europa, aber eben auch: ohne Europa keine Philosophie. Die Entfaltung des Philosophierens durch Verknüpfung von Metaphysik, Kritik und Kommunikation bei ganz unterschiedlicher Gewichtung dieser drei Elemente zu rekonstruieren und zu diskutieren, heißt Philosophiegeschichte zu betreiben, beginnend in Athen. Der erste große systematische Philosoph ist Platon. Er ist der Metaphysiker des theorein, kein Mann der Straße mehr, der sich mit den Leuten in den Dialog hier und da konkret einläßt, vielmehr ein Mann höchster Aristokratie, der ganz am Rande, meistens auf einem Gut außerhalb Athens lebt. In Athen etabliert er seinen Garten Akademos als Lehrort, die später so genannte Akademie, von der die Athener damals kaum Notiz genommen haben. Für sie war die Platonschule nur eine Sekte, wie es viele Sekten in Athen gegeben hat; ein Kreis Eingeweihter, wie es viele Cliquen spekulativer oder mythischer Art gegeben hat. Platon ist viel auf Reisen; ansonsten existiert er zurückgezogen. Systematiker, der er ist, über er gleich eine gewisse Kritik an Sokrates. Denn er gibt sich nicht mehr damit zufrieden, in unmittelbaren, auch zufällig sich ergebenden Dialogen – gleichsam ad personam, ad hominem, auf den unmittelbaren Gesprächspartner bezogen, auf ihn zugreifend – seinen Gegenüber zu verunsichern, und ihn auf den Weg des eigenen Denkens zu bringen. Nein, Platon sucht das, was wir heute, nach der kommunikationsbezogenen Wende des Denkens, als „intersubjektive Gültigkeit“ bezeichnen würden. Deswegen entfaltet er Konzepte wie die Ideenlehre und die Anamnesis, den Weg hin zur Erkenntnis von Ideen, die Annahme, daß man doch schon ein Vorwissen braucht, um überhaupt sinnvoll nach etwas zu fragen zu können. Und so weiter. Freilich: So, wie Platon diese Konzepte entfaltet, wird das eine spekulativ metaphysische Methode im Rahmen einer rational uneinholbaren Kosmos-Spekulation. Und bei Aristoteles können wir das in gewisser Weise auch sagen: Auch hier der Anspruch, mehr Rationalität, mehr intersubjektive Gültigkeit, oder – vorsichtiger gesagt: intersubjektive Geltungsfähigkeit – zu erlangen, um es modern auszudrücken. Und dann doch wieder der ganz handfeste, spekulative Anspruch, ein für alle Mal die Substanz, die ousía, das Wesen der Dinge, zu erkennen: gewissermaßen nicht mehr die Idee hinter der Welt zu erkennen, wie bei Platon, sondern die Idee in der Welt oder in den Dingen, die ousía aneu hўles, das Wesen ohne Stoff, die Form, die Struktur. – Mitten darin aber plötzlich der Rückgriff auf die Reflexion à la Sokrates, wenn es um die Kritik von Gegnern geht, die fragen: wie willst du 9 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie eigentlich deinen eigenen Ansatz, Aristoteles, als Logiker, begründen? Hier greift er auf kritische sokratische Reflexion zurück: Den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch kann man nur begründen, sagt er zu seinen relativistischen herakliteischen Gegnern, wenn man zurückgeht, reflektiert, auf das, was ich, und was du, was wir beide, im Etwas-VerständlichMachen, im Etwas-Sagen, im Für-eine-These-Geltung-Beanspruchen schon vorausgesetzt haben. Damit unsere These überhaupt verständlich und auch für Andere nachvollziehbar ist, haben wir schon vorausgesetzt, diese These widerspruchsfrei vorbringen zu können. Damit haben wir die Gültigkeit des Satzes vom zu vermeidenden Widerspruch bereits in Anspruch genommen und diesen als verbindliche Regel implizit anerkannt. So etwa begründet Aristoteles: Er entdeckt durch Reflexion im Gespräch mit dem Zweifler, daß der Geltungsanspruch der Verständlichkeit unhintergehbar ist – und daß seinen Implikationen allgemeine Verbindlichkeit zukommt. Derart kann man immer wieder zeigen, daß auch innerhalb der Metaphysik so rationale – will sagen: dialogreflexive – Anstöße da sind. So daß sich aus der Metaphysik der Weg zur Kritik gleichsam herauswindet, und aus dieser dann der Weg zur Reflexion darauf, daß auch der Kritiker ein Kommunikator ist, ein Diskursteilnehmer. So kann sich an Kants, noch klassisch vorkommunikativ konzipierte, transzendentale Kritik die Reflexion darauf anschließen, was es bedeutet, mit anderen zu kommunizieren. Normativ gewendet: Habe ‚ich’ mich als Diskurspartner eigentlich schon zu etwas – und wozu genau – verpflichtet, wenn ‚ich’ mit Anderen kommuniziere? Gut. Also das gewissermaßen als nachgeholte Einleitung in diese Vorlesung, als Fingerzeig, wie sie zu verstehen ist, und wie man sich meines Erachtens auch heute noch ernsthaft mit Metaphysik beschäftigen kann und sollte. 1.2 Zum Begriff und zur Kritik der Metaphysik. ‚Was heißt Metaphysik?’ Anders gefragt: Gibt es in der Geistesgeschichte gemeinsame Leitthemen, Gegenstände und Fragen dessen, was wir im Rückblick auf das Denken seit der vorsokratischen und nachsokratischen Antike „Metaphysik“ nennen? Ja. Wir begegnen immer wieder spekulativen Themen, die als solche weder empirisch durch Theorien, Beobachtungen und Experimente i. S. kausaler Gesetzeserklärungen objektivierbar sind, noch durch erkenntnis- und sinnkritische Reflexion auf interne und unvermeidbare, weil erkenntnistragende und eine Erkenntnis oder sinnvolle Erörterung erst ermöglichende, 10 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Voraussetzungen (Kant: „Bedingungen der Möglichkeit“ von Erkenntnis) aufweisbar sind, – Themen, die aber von denkenden Menschen nach den archaisch mythischen Kulturepochen immer wieder aufgebracht werden. Dazu gehören in erster Linie: Anlage 2 1) Das Ganze als Inbegriff dessen, vom dem sich – vermutlich – Existenzaussagen (der Form: ‚p existiert’, ‚p existiert wirklich’) behaupten lassen. Dafür steht seit der griechischen Antike der Kunstausdruck „das Sein“. Metaphysik ist traditionell die Lehre vom „Seienden, insofern es ist“ (Aristoteles) und von dem „Umgreifenden“ (Jaspers), dem Sein als einen Ganzen, das mehr sei (Euklid, Laotse), nämlich „ursprünglicher“ (Aristoteles) als die Summe seiner Teile, d.h. des je einzelnen Seienden. Diese „ontologische Differenz“ werde, so Heidegger, jedoch von der Metaphysik vernachlässigt und von den modernen Wissenschaften, die „gesonderte Gebiete des Seienden“ zum Objekt machen, ganz übergangen, so daß „das Sein selbst vergessen“ werde. 2) Das Ganze a) als Inbegriff eines (vermeintlich) objektiven, unvordenklich vorgegebenen und (vermeintlich nur) teleologisch3 verstehbaren, von einem Schöpfer gegebenen Sinnzusammenhangs (→ objektiv teleologisch angesetzte Seins- bzw. Schöpfungstheologie), b) als Inbegriff eines möglichen Sinnzusammenhangs, d. h.: Wir Menschen können unser Verhältnis zum All so verstehen, daß wir ihm Sinn abgewinnen (→ Sinnentwurf einer hypothetischen Metaphysik als „rationaler Mythos“ i. S. von Hans Jonas). 3) Der Begriff eines Zentrums und ursächlichen Grundes eines solchen Ganzen: In zahlreichen (mythisch-)metaphysischen Traditionen – Sonderfall Buddhismus – ist das »Gott«, z. B. als ‚Demiurg’ oder ‚Schöpfer’, und in den biblischen Traditionen (AT und rabbinische, NT und christliche Lehren) auch als personales Gegenüber, als Inbegriff der Gerechtigkeit und barmherzigen Liebe. Verwandt ist der Gottesbegriff der dritten abrahamitischen Religion, des Islams. 3 Wenn man einen Zusammenhang, der einem selbst geordnet erscheint, objektiv teleologisch versteht, deutet man ihn als zweckvoll angelegt. Dabei unterstellt man häufig ein Subjekt, welches diese zweckvolle Anlage verursacht oder geschaffen hat – einen schöpferischen Geist. 11 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Zeitlich bzw. denkepochal erstreckt sich Metaphysik in verschiedensten Ausprägungen vom mythischen Denken über die griechische theoria bis in die gegenwärtige Philosophie – zum Teil auch innerhalb der, seit Kant, weithin metaphysikkritisch gewordenen Philosophie. Als Überblick bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts empfiehlt sich das exemplarische Werk von Karl Jaspers: „Die großen Philosophen. Erster Band: Die maßgebenden Menschen: Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus. Die fortzeugenden Gründer des Philosophierens: Plato, Augustinus, Kant. Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker: Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna“ (München: Piper 1957, Neuauflage 1981). Mit Ausnahme Kants thematisiert Jaspers in diesem bedeutenden Werk ausnahmslos spekulative Metaphysiker, die also weder erkenntniskritisch im Sinne der Kantischen transzendentalen Rückfrage nach Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis, noch gar sinnkritisch denken, also nicht gemäß der Frage nach den Sinnbedingungen und Sinngrenzen metaphysischer Theorien: ‚Wann wird eine metaphysische Position ein sinnloser Argument in einem jetzt zu führenden Dialog? Nicht mit dem weiten, explizit nachkantischen Horizont von Jaspers, sondern zumal metaphysik-immanent, ja eher dogmengeschichtlich, angelegt, ist das 2001 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienene Buch Jörg Disses, „Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik. Von Platon bis Hegel“. Was den Geltungsstatus metaphysischer Theorien anbelangt, so plädiert jedoch auch Disse dafür, diesen „nur einen grundsätzlich hypothetischen Charakter“ zuzubilligen. Er schreibt aber der Metaphysik die Kraft zu, das auf naturwissenschaftlichen Theorien gründende Wissen „zu einem einheitlichen Verständnis von Welt zusammenzudenken bzw. von einem spekulativen Einheitspunkt aus rückwärts schreitend“ dieses Wissen in seinen wichtigsten Grundzügen einzuholen (!). Befremdlicherweise referiert Disse die Positionen der traditionellen Metaphysik von Platon bis Hegel bloß und hat überhaupt kein Verständnis für die Notwendigkeit einer Sinnkritik der traditionellen Metaphysik. Den Sinnlosigkeitsverdacht, der mit der linguistischen und der pragmatischhermeneutischen Wende des Philosophierens begründeterweise aufgekommen ist, scheint er für eine abwegige Zumutung zu halten und unterstellt einfach, 12 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie daß die Aussagen der traditionellen Metaphysiker sinnvoll sind und daher auch aktuell sein können. Karl Jaspers’ Darstellung ist in diesem Betracht durchaus differenzierter, wiewohl er selbst die linguistische und pragmatisch-hermeneutische Wende nicht nachvollzogen hat und nicht auf deren Niveau philosophiert. Aber Anlage 3 er ist konsequent durch Kant hindurchgegangen. Überdies hat er ein Gespür für das Unzureichende der Subjekt-Objekt-Beziehung und des SubjektWelt-Dualismus, aus dem heraus die neuzeitliche Metaphysik denkt. Da er zudem selbst die Kommunikation mehr und mehr in den Mittelpunkt seines Denkens gerückt hat, ist er auch des methodischen Solipsismus unverdächtig, der die metaphysische Tradition durchzieht. Freilich vermißt man eine sinnkritische Aufarbeitung der metaphysischen Positionen unter der Frage, was von ihnen noch gelten bzw. aufgehoben werden kann, wenn die drei Strukturfehler der Metaphysik, jedenfalls der traditionellen – nicht durch Kants Vernunftkritik noch durch eine (transzendental-)pragmatische Sinnkritik hindurchgegangenen – Metaphysik, beseitigt würden, nämlich das Denken aus einem uneinholbar theoretischen Gesichtspunkt heraus, gleichsam von einem Gottesstandpunkt außerhalb der Welt auf diese ‚schauend‘ – als sei sie (erstens) so etwas wie ein Ding, und als könne man dieses (zweitens) kommunikations- bzw. sprachunabhängig, also methodisch einsam ‚wahrnehmen‘, statt sie traditions- und vorverständnisabhängig deuten zu müssen, also hypothetisch, mithin kritik- und konsensbedürftig; die Unterstellungen eines methodischen Solipsismus, nämlich, daß einer alleine, jeder Metaphysiker für sich, Sinn und Bedeutung sowie Wahrheit und Gewißheit der Wahrheit erlangen könne; d. h. ohne Vermittlung seiner Thesen durch die reale Kommunikationsgemeinschaft (z. B. Tradition) berücksichtigen zu müssen, und ohne als letzten Geltungsmaßstab die sinnvolle Vertretbarkeit und die argumentative Zustimmungswürdigkeit seiner These im Rahmen einer (als regulative Idee vorauszusetzenden) unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft zum Kriterium zu machen; die damit verwobene Erkenntnishaltung einer Subjekt-Objekt-Spaltung bzw. eines Dualismus zwischen Erkenntnissubjekt und Welt als 13 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Inbegriff möglicher Erkenntnisobjekte, welche nach dem Muster dinglicher Gegenstände verstanden, also verdinglicht werden. Diese drei Strukturprobleme sollten wir bei jeder Auseinandersetzung mit der Metaphysik genau im Auge behalten. Ohne den Blick darauf läuft die Beschäftigung mit Metaphysik ins Naive und Dogmatische. Das gilt aber auch für die Diskussion aller anderen philosophischen Positionen, die sich nicht als Metaphysik verstehen. Auch sie genau können diese Strukturfehler haben, schließlich liegen diese nicht offen zutage, sondern werden gleichsam hinterrücks mitgeschleppt. 1.3 Ist Metaphysik nach Kant und nach der pragmatisch-hermeneutischen Ende möglich? Das Beispiel von Hans Jonas’ „rationalem Mythos“. Für die Gegenwart möchte ich Ihnen ein besonders reiches und reflektiertes Beispiel eines eigenständigen metaphysischen Ansatzes vorstellen, nämlich den „rationalen Mythos“ von Hans Jonas. Dazu sei zweierlei bemerkt. Einmal steht dieser Versuch nicht im Zentrum seines Denkens, welches sich nämlich von einer kritischen, nämlich entmythologisierenden Hermeneutik, ausgeübt vor allem an dem Gnostizismus und der Metaphysik von Augustinus, über eine leibphänomenologisch orientierte Evolutionstheorie des Lebens bzw. einer philosophischen Biologie hin zur Ethik der Zukunftsverantwortung in der technologischen Gefahrenzivilisation erstreckt. Zum anderen, und das geht uns jetzt vor allem an, stellt Jonas’ rationaler Mythos einen bemerkenswert metaphysikkritischen metaphysischen Versuch dar. Denn er nimmt – erstens – die erkenntniskritische Wende zum transzendentalphilosophischen Paradigma einer Erkenntnistheorie auf, die nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis fragt und von daher die Grenzen, innerhalb derer ein metaphysischer Versuch gelten kann, eng zieht: Hier sei keine Gewißheit der Wahrheit möglich, so daß es sich nur um eine metaphysische Vermutung handeln könne, welche keinen höheren Geltungsstatus als den der Plausibilität zu erreichen vermöge. Jonas berücksichtigt Kants Kopernikanische Wende von der naiven 14 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Seinsschau zur Rückbesinnung auf die Erkenntnisvoraussetzungen des Subjekts gleich in seinem metaphysischen Versuch. Zweitens gibt er eine logische Kohärenzkritik und eine Sinnkritik an Grundgehalten der jüdischen und christlichen Theologie als dem spekulativen Zentrum europäischer Metaphysik. Zunächst prüft er die Kohärenz der drei Gottesattribute der absoluten Güte, der absoluten Macht oder Allmacht und der Verstehbarkeit. Von diesen Attributen sagt Jonas, sie stünden „in einem solchen Verhältnis, daß jede Verbindung von zweien von ihnen das dritte ausschließt“. Und er fährt fort: „Die Frage ist dann, welche von ihnen sind wahrhaft integral für unseren Begriff von Gott und daher unveräußerlich, und welches dritte muß als weniger kräftig dem überlegenen Anspruch der anderen weichen? Gewiß nun ist Güte, d. h. das Wollen des Guten, untrennbar von unserem Gottesbegriff und kann keiner Einschränkung unterliegen. Verstehbarkeit oder Erkennbarkeit, die zweifach bedingt ist: vom Wesen Gottes und von den Grenzen des Menschen, ist in letzterer Hinsicht allerdings der Einschränkung unterworfen, aber unter keinen Umständen duldet sie totale Verneinung. Der deus absconditus, der verborgene Gott (nicht zu reden vom absurden Gott), ist eine zutiefst unjüdische Vorstellung.“ Schließlich beruhe die Thora darauf, daß wir Gott verstehen können, wir besäßen sein Gebot und sein Gesetz, und Gott habe durch seine Propheten, wenn auch in dem beschränkenden Medium der Sprache einer Zeit, mit den Menschen gesprochen. Daher sei die Annahme eines gänzlich verborgenen, unverständlichen Gottes ein unannehmbarer Begriff. Unannehmbar aber müßte der Gottesbegriff sein, wenn Gott zusammen mit der Allgüte auch Allmacht zugeschrieben würde: „nach Auschwitz können wir mit größerer Entschiedenheit als je zuvor behaupten, daß eine allmächtige Gottheit entweder nicht allgütig oder (in ihrem Weltregiment, worin allein wir sie erfassen können) total unverständlich wäre. Wenn aber Gott auf gewisse Weise und in gewissem Grade verstehbar sein soll (und hieran müssen wir festhalten), dann muß sein Gutsein vereinbar sein mit der Existenz des Übels, und das ist es nur, wenn er nicht allmächtig ist. Nur dann können wir aufrechterhalten, daß er verstehbar und gut ist und es dennoch Übel in der Welt gibt“.4 An diese immanente Kritik einer Kohärenzprüfung schließt Jonas die eigentliche Sinnkritik an dem Begriff „Allmacht“ an: Die Rede von Allmacht sei sinnlos, weil wir bei jeder Verwendung des Begriffs „Macht“ – als dessen Sinnbedingung – voraussetzen müssen und umgangssprachlich bzw. lebensweltlich auch tatsächlich voraussetzen, daß sich eine Macht 4 Hans Jonas: „Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme“. In: Ders.: Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen. Frankfurt a. M.: Insel 1992, S. 203f. 15 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie auf die Existenz von etwas anderem bezieht, das als solches schon eine Begrenzung der Macht ist. Macht sei kein einsames und von daher gänzlich autarkes, sondern ein sozial bezogenes Phänomen, welches Andere als Gegenüber oder Gegenstand voraussetze, worauf die Macht wirken könne. Eine absolute Alleinmacht wäre leere Macht. Das aber wäre, so analysiert Jonas, eine „machtlose Macht, die sich selbst aufhebt. ‚All’ ist hier gleich Null [...]. Kurz, Macht ist ein Verhältnisbegriff und erfordert ein mehrpoliges Verhältnis [...]. Macht kommt zur Ausübung nur in Beziehung zu etwas, was selber Macht hat. Macht, wenn sie nicht müßig sein soll, besteht in der Fähigkeit, etwas zu überwinden; und Koexistenz ist als solche genug, diese Bedingung beizustellen. Denn Dasein heißt Widerstand und somit gegenwirkende Kraft.“ Daher könne es nicht sein, „daß alle Macht auf Seiten eines Wirksubjekts allein sei. Macht muß geteilt sein, damit es überhaupt Macht gibt“.5 Allein aus diesem, wie Jonas sagt, zugleich logischen und ontologischen Grund, daß die Rede von Allmacht sinnlos und das Phänomen einer Allmacht in der Wirklichkeit nicht denkbar sei, müsse auf das Attribut der absoluten Macht Gottes verzichtet werden. Wir bemerken also, daß Jonas’ rationaler Mythos eine metaphysikkritische Metaphysik darstellt, weil sie sowohl Kants Beschränkung des Gültigkeitsstatus aller Spekulationen hinsichtlich möglicher Erfahrung aufnimmt, übrigens gleich zu Anfang des Vortrags „Der Gottesbegriff nach Auschwitz“, als auch den grundlegenden Geltungsanspruch der Verstehbarkeit der Rede, also des Anspruchs auf sinnvolle Rede, ins Spiel bringt, in dem er den metaphysisch-theologischen Begriff der Allmacht an diesem Anspruch mißt und daher das Konzept verwirft. Gestatten Sie, daß ich nach dieser Pointierung des metapysikkritischen Charakters von Jonas’ „unverhüllt spekulativer Theologie“6 dieses Stück in den Kontext seines Denkens rück. So aber, daß der Referierte dabei selber miterscheint, indem ich Ihnen nämlich ein Stück der Berliner Ehrenpromotion von Hans Jonas im Jahre 1992 vor Augen führe: Die Laudatio und die Überreichung der Ehrendoktorurkunde. Gestatten Sie, daß ich nach dieser Pointierung des metapysikkritischen Charakters von Jonas’ „unverhüllt spekulativer Theologie“7 dieses Stück in den Kontext seines Denkens rücke. So aber, daß der Referierte dabei selber miterscheint, indem ich Ihnen nämlich ein Stück der Berliner Ehrenpromotion von Hans Jonas im Jahre 1992 vor Augen führe: Die Laudatio und die Überreichung der Ehrendoktorurkunde. 5 6 7 Ebd., S. 201f. Ebd., S. 190. Ebd., S. 190. 16 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Hans Jonas – von der Hermeneutik der Entmythologisierung zur Ethik der Zukunftsverantwortung8 Laudatio des Dekans, Professor Dr. Dietrich Böhler Verehrter Herr Professor Jonas, meine Laudatio spielt sich nach einem hermeneutischen Auftakt in zwei Teilen ab: »Rationaler Mythos und Aufhebung des Dualismus« zunächst, »Metaphysisch ontologische Wertlehre und 'Prinzip Verantwortung'« sodann. Aus Ihrer frühen Forschung kann ich nur auf ein wertvolles Instrument hinweisen: auf Ihre, in Rudolf Bullmanns theologischem Seminar entwickelte Methode, Dogmen und Mythen rational zu erschließen, Ihre Hermeneutik der Entmythologisierung. Von Heidegger und auch von Hegel belehrt, zeigen Sie in Ihrer Frühschrift "Augustin und das paulinische Freiheitsproblem", Göttingen 1930, daß der Geist nur über den Umweg des Symbols "zu sich kommen könne"; genauer gesagt, über eine Veranschaulichung und Verdinglichung seiner wesentlichen Daseinsprobleme und Daseinserfahrungen. Diese liegen eigentlich in seinem Verhältnis zu sich selbst. Aber in seiner Kindheit, einer unreflektierten Entwicklungsphase, neigt der Geist dazu, sich innere Daseinsprobleme und -erfahrungen zu erklären, indem er sie projiziert auf angeblich objektive Ereignisse oder Mächte außer sich. So erklärt Augustinus - wirkungsträchtig am Anfang des abendländischen Verständnisses von Freiheit und Moralität - das Dilemma des menschlichen Willens, einerseits moralisch sein zu wollen, andererseits aber unmoralischen Willensrichtungen zu folgen, etwa der Selbstliebe, dem Hochmut und dem bösen Begehren bzw. Haben-Wollen, mit dem (m.E. unbiblischen) Mythos der Erbsünde: Augustinus führt also ein Dilemma des Willens zurück auf die vermeintlich schicksalhafte Kausalität von Adams Sündenfall. Indem Sie, Professor Jonas, diesen Mythos als veranschaulichende Objektivierung eines inneren, existentialen Dilemmas enthüllen, wird exemplarisch zweierlei geleistet: rationale 8 Aus: Herausforderung Zukunftsverantwortung. Hans Jonas zu Ehren, hrsg. von D. Böhler und R. Neuberth, Münster: LIT, 2. Aufl. 1993, S. 27-36. 17 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Kritik an einem Mythos, die diesen als Verzerrung eines Existentialphänomens bestimmt, und Rettung des zugrunde liegenden Dilemmas als eines Phänomens unseres moralischen Selbstverhältnisses. Auf diese Weise bewahrt Ihre Methode den Gehalt von Dogmen und Mythen vor einem rationalistischen Verdikt und macht sie uns als Beiträge menschlicher Selbstverständigung zugänglich. Rationaler Mythos und Aufhebung des Dualismus Ihre Methode einer nicht-mythologischen Rekonstruktion von Mythen war also nicht dekonstruktiv sondern sinnerschließend: Rekonstruktion von Erfahrungen und Problemen des Daseins. Daher schuf sie einen Spielraum, den der Geist braucht, um die letzten Fragen, die spekulativen Fragen, stellen und gehaltvoll erörtern zu können; jene Fragen, die uns existentiell und gleichsam gattungsexistentiell angehen, als Personen und als menschliche Wesen in einem materiellen All. Da ist zunächst das Ur-Rätsel: Wie können wir uns verständlich machen, daß aus "den stummen Wirbeln" von Materie Subjektivität hervorgegangen ist? Das ist wohl die erste jener Fragen, deren Antworten stets hinausgehen über die Grenzen unserer möglichen Erfahrung. Für solche Antworten können wir nicht mehr legitim den Anspruch des Wissens und einer rationalen Gewißheit erheben. Immanuel Kant hat uns gezeigt, daß es hier kein Wissen der Wahrheit, keinen Nachweis intersubjektiver Gültigkeit geben kann, obwohl uns diese Fragen umtreiben. Die Vernunft, sagt Kant, wird "durch ihr eigenes Bedürfnis getrieben" zu metaphysischen Fragen, "die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien beantwortet werden können" (KdrV, B 21). Sofern der Mensch homo metaphysicus ist, muß es möglich sein, metaphysische Fragen zu erörtern und sinnvolle Antworten darauf zu versuchen. Erst, wenn wir das tun, verhalten wir homines metaphysici uns dialogisch verantwortlich, weil wir unseren Dialogpartnern nur dann in Orientierungsfragen Rede und Antwort stehen können, wenn wir uns auch metaphysisch oder theologisch befragen lassen: Woher kommen wir? Wie können wir Menschen uns im Ganzen des Seins und dieses im Blick auf uns verstehen? Was hat es mit Gott auf sich? Und wenn es damit etwas auf sich haben mag, was kann es für unser Leben bedeuten? Wer bei solchen Fragen von vornherein auf das Ziel rationaler Gewißheit verzichtet, der darf, so Hans Jonas, im Blick auf "Sinn und Bedeutung sehr wohl über solche Dinge nachdenken".9 9 Hans Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1987. S. 9 18 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Der kann sich im Dialog auch metaphysisch verantworten, indem er sinnvolle Antworten sucht: - Reflektierte Antworten, die auf den Anspruch ausweisbarer Wahrheit, erweisbarer Gültigkeit, von vornherein verzichten, - sinnvoll diskutierbare Antworten, die uns eine Orientierung anbieten, welche logisch stimmig ist und zu unserem Erfahrungswissen nicht etwa in ausschließendem Widerspruch steht, sondern sich daran anschließen läßt. Eine solche hypothetische Antwort nennt Hans Jonas 'rationalen Mythos'. Dreimal, wenn ich richtig sehe, Herr Jonas, haben Sie einen rationalen Mythos entworfen bzw. modifiziert und entfaltet: 1961 in dem Harvard-Vortrag "Unsterblichkeit und heutige Existenz", deutsch in dem 1963 erschienenen Band "Zwischen Nichts und Ewigkeit", 1984 in dem Vortrag bei Entgegennahme des Rabbi Leopold Lucas-Preises, "Der Gottesbegriff nach Auschwitz", und 1988 in der Schrift "Materie, Geist und Schöpfung". Ihr erster Entwurf wie auch die späteren gehen von Grundlagen moderner Welterfahrung aus: von deren bedingungsloser Immanenz und von dem methodischen Atheismus der Wissenschaften. Der moderne Geist bestehe darauf, "unser In-der-Welt-Sein ernst zu nehmen: die Welt als sich selbst überlassen zu sehen".10 Dasselbe fordert Ihr Mythos für "Gottes Inder-Welt-Sein": Ein sinnvoller Gottesbegriff könne Gott zwar als den schöpferischen Grund des Seins charakterisieren, aber doch nur als den absolut machtlosen, dem Abenteuer der Evolution und damit der Menschheit ausgeliefert: "Im Anfang ... entschied der göttliche Grund des Seins, sich dem Zufall, dem Wagnis und der endlosen Mannigfaltigkeit des Werdens anheimzugeben. Und zwar gänzlich: Da sie einging in das Abenteuer von Raum und Zeit, hielt die Gottheit nichts von sich zurück ... Vielmehr, damit Welt sei, und für sich selbst sei, entsagte Gott seinem eigenen Sein; cr entkleidete sich seiner Gottheit... Nachdem er sich ganz in die werdende Welt hineingab, hat Gott nichts mehr zu geben: jetzt ist es am Menschen, ihm zu geben. Und er kann dies tun, indem er in den Wegen seines Lebens darauf sieht, daß es ... nicht zu oft geschehe, und nicht seinetwegen, daß es Gott um das Werdenlassen der Welt gereuen muß. Dies könnte wohl das Geheimnis der 10 Hans Jonas: Zwischen Nichts und Ewigkeit, Göttingen: Vandenoeck & Ruprecht 1963. S. 56 19 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 'sechsunddreißig Gerechten' sein, die nach jüdischer Lehre der Welt niemals mangeln sollen."11 In dem Vortrag "Der Gottesbegriff nach Auschwitz", der ausdrücklich die Brücke zur kabbalistischen Lehre vom Zimzum schlägt und in Analogie zu Schellings Spekulation von der Zusammenziehung, der Kontraktion Gottes auf einen bloßen Punkt, gelesen werden kann, geben Sie mit diesem Mythos eine Antwort auf die, durch Auschwitz wahrhaft abgründig gewordene, Hiobsfrage, die der Antwort des Buches Hiob entgegengesetzt ist: Diese, sagen Sie, "beruft die Machtfülle des Schöpfergottes; meine seine Machtentsagung. Und doch seltsam zu sagen - sind beide zum Lobe: Denn der Verzicht geschah, daß wir sein könnten. Auch das, so scheint mir, ist eine Antwort an Hiob: daß in ihm Gott selbst leidet. Oh sie wahr ist, können wir von keiner Antwort wissen."12 Ihre Schrift "Materie, Geist und Schöpfung" stellt den Mythos in den Rahmen einer "Teleologie, einer aristotelischen Theorie vom zweckvollen und zweckgerichteten Sein, mit der Sie auf die Kehrseite der großen Errungenschaft des abendländischen Denkens im Sinne eines "Einerseits ... andererseits" reagieren. Einerseits rühmen Sie z.B. an Platon und Paulus, Augustinus, Descartes und Kant, Pascal und Kierkegaard, die Entdeckung der Seele, die Herausarbeitung der Subjektivität und Reflexivität des Menschen als Hiatus zur Natur. Es gehe darum, "genug von der dualistischen Einsicht" zu bewahren, "damit die Menschlichkeit des Menschen (...) erhalten"13 werde. Daraus folgt eine Zurückweisung jeder Einheits- oder Ganzheitsanschauung; sei es ein materialistischer Monismus, der selbstwidersprüchlich das Geistes- und Seelenleben auf materielle Determinanten zurückführen will, sei es auch ein ökologischer Holismus, der den Menschen als bloßen Teil der Natur ansieht, als bloßes Moment einer kosmischen Lebensgemeinschaft oder eines Superökosystems. Eine solche Ganzheits- und Einheitsanschauung wäre nicht minder selbstwidersprüchlich, weil jede Theorie, auch eine holistische, sich der Freiheit des Geistes verdankt, die alles bloß Natürliche gerade überschreitet und distanziert; überdies, weil die praktisch normativen Sätze, die Verhaltensforderungen ökologischer Einheitsdenker nur Sinn machen, wenn eben das unterschieden wird, was sie zusammenwerfen: Sein und Sollen, beschreibende Sätze über das Seiende und vorschreibende Sätze über richtiges Verhalten. 11 12 13 Hans Jonas, Zwischen Nichts und Ewigkeit, S. 55, 56 u. 60. Hans Jonas, Der Gottesbegriff nach Auschwitz, S. 48f. Hans Jonas, Zwischen Nichts und Ewigkeit, S. 25. 20 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie So entschieden Hans Jonas mit dem abendländischen Denken die "transzendierende Freiheit des Geistes"14 und damit die Sonderstellung des intelligenten und moralisch freien Menschen im Kosmos betont, so scharf kritisiert er andererseits die dualistische Metaphysik, die vielfach der Preis für deren Herausarbeitung gewesen ist. Von der Gnosis bis zum Existentialismus, von Augustin bis Heidegger findet Jonas einen, in dieser Form nicht haltbaren, Dualismus von Mensch und Natur, Seele und Leib, Geist und Materie oder dessen direktes Fortwirken. Auch bei Heidegger hörte man "nichts vom ersten physischen Grund des Sorgenmüssens: unserer Leiblichkeit, durch die wir ... bedürftig-verletzlich in die Umweltnatur verwoben sind, zuunterst durch den Stoffwechsel".15 Ihre Dualismus-Kritik - genährt vom hebräisch biblischen Denken, bestärkt von dem griechischen Arztsohn Aristoteles - und Ihre Kriegserfahrung der verletzlichen Leiblichkeit brachte Sie in Opposition zu dem Hauptstrom der Metaphysik, wie auch zum szientistischen Naturverständnis. In der Seinsweise, die wir mit allem Lebendigen teilen, dem Organismus, sahen Sie den metaphysischen Dualismus widerlegt; daher erschien "das Ziel einer Philosophie des Organischen oder einer philosophischen Biologie" vor Ihren Augen. "Dafür bedurfte es aber einer Kenntnis der wissenschaftlichen Biologie in ihrem Ertrag und ihrer Methode. Daran wurde ich noch einmal zum Schüler"16 - so beschreiben Sie die Vorbereitung Ihrer philosophischen Biologie "Organismus und Freiheit", die ohne Ihr Studium bei amerikanischen Biologen und Ihren Dialog mit ihnen nicht möglich gewesen wäre. Das Resultat Ihrer philosophischen Biologie ist eine ontologische Wertlehre, die besagt: "Die Materie ist schlafender Geist", alles organische Leben ist wertvoll und daher prinzipiell schutzwürdig, weil sich in ihm Freiheit aufstufe und weil derart sich entwickele, was höchsten Wert habe: das "wirkliche Menschentum“17. In dessen moralischer Freiheit liegt die Fähigkeit zur Verpflichtung und Verantwortung, also das Überschreitenkönnen alles Gegebenen zum Idealen, alles Endlichen zum Unendlichen18, und damit das Überschreitenkönnen vom bloß Faktischen zum Normativen, vom Gegebenen zum Gerechtfertigten und Richtigen, wie ich hinzufügen möchte. Nun haben Sie nie verhehlt, daß Ihre metaphysisch ontologische Wertlehre auf Kriegsfuß oder gar auf Siegesfuß steht zur metaethischen Trennung von Sein und Sollen, Fakten und 14 15 16 17 18 Hans Jonas: Materie, Geist und Schöpfung. Kosmologischer Befund und kosmogonische Vermutung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag 1988. S. 25ff. Hans Jonas: Wissenschaft als persönliches Erlebnis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1987. S. 19. Hans Jonas, Wissenschaft als persönliches Erlebnis, S. 21. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, S. 89. Hans Jonas, Materie, Geist und Schöpfung, S. 25f. 21 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Normen, beschreibenden Sätzen und vorschreibenden Sätzen. Gleichwohl hege ich hier Konsenshoffnung. Zeichnet sich nicht Konsens ab, wenn man in Rechnung stellt, daß eine Ontologie des Organischen und eine Teleologie der Freiheit notwendigerweise geleitet ist von Ideen, die, wie Sie sagen, "über alles je Gehbare und seine Dimension als solche hinaus“19 sind? Dazu gehören: die Idee der moralischen Freiheit und die Idee einer "Selbstunterstellung unter die transzendenten Maßstäbe" des Gewissens und der Verantwortung für das schutzbedürftige Wertvolle.20 Wenn dieser ideale Vorgriff auf moralische Freiheit und auf moralisches Sollen notwendige Bedingung dafür ist, daß wir die Evolution als Entwicklung der Freiheit verstehen können, wie auch dafür, daß wir das organische Leben als prinzipiell wertvoll und schützenswert auszeichnen können, dann ist die Begründung von Ideen, von Maßstäben des Sollens, logisch das Erste. Dann aber wäre - ich weiß nicht, ob Sie mir darin zustimmen - methodisch gesehen, das "Sollen" vom "Sein" zu unterscheiden.21 Darin sehe ich die Bedingung für eine Rechenschaftslegung der Philosophie; zumal einer ontologischen Wertlehre und einer spekulativen Philosophie, die auch zum rationalen Mythos übergehen kann, ohne überschwenglich oder objektivistisch zu werden. Aber wie dem auch sei. Es ist ein leuchtendes Zeichen für die Größe Ihres Denkens, daß es, in mindestens viererlei Hinsicht, über den Dissens innerhalb der Philosophie hinaus hochbedeutsam und fruchtbar, stimulierend und konsensfähig bleiben dürfte: Erstens bedarf es offenbar einer genau zu umreißenden Verhältnisbestimmung und Kooperation von naturästhetischer und naturethischer Heuristik als methodischem Sensus für Wert in der außermenschlichen Natur einerseits und einer Ethik der verbindlichen Normenbegründung, der rationalen Maßstabe für intersubjektive Verbindlichkeit und Pflicht andererseits. Daß eine teleologische Deutung des Seins, eine ontologische Wertlehre keine letztgültigen Aussagen machen kann, sondern eher den Stellenwert einer Wertheuristik behält, haben Sie selbst zu verstehen gegeben: "Letztlich kann mein (metaphysisch teleologisches) Argument nicht mehr tun als vernünftig eine Option begründen, die es mit ihrer inneren Überredungskraft dem Nachdenklichen zur Wahl stellt.22 Gerade als Heuristik ist eine ontologische Wertlehre gut für das diskursive Zusammenspiel mit einer Sollensethik geeignet: Die ontologische Wertheuristik würde für Verantwortung 19 20 21 22 Ibid., S. 25. Ibid., S. 28, 29. Vgl. dazu die Erwiderung von Hans Jonas, in diesem Band, S. 123-125. Hans Jonas: Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen. Frankfurt a. M.: Leipzig: Insel Verlag 1992. S. 140. 22 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie empfänglich machen; die normative Ethik würde Maßstäbe dafür aufstellen, zu welcher Verantwortung wir verpflichtet sind, und Dialogverfahren entwickeln, um diese Maßstäbe anwendbar zu machen. Beide Seiten wären aber nicht unabhängig voneinander anzusetzen, um erst nachträglich in ein Kooperationsverhältnis zu treten; vielmehr müßten sie von vornherein im Verhältnis wechselseitiger Ergänzung und Erläuterung stehen. Dabei käme der ontologischen Wertheuristik das inhaltliche und das Motivations- Prius zu, während die Prinzipienreflexion und die Normenbegründungsdiskurse den logischen Primat beanspruchen könnten. Zweitens: Sinn und Geltung der Ethik hat Hans Jonas durch das "Prinzip Verantwortung" tiefgreifend revidiert, indem er die moralischen Fragen nicht auf die personale Moralität beschränkt, sondern die persönliche Moralität erweitert um die zugleich kollektive und personale Verantwortung für die Zukunftsfolgen unserer hochtechnischen Lebensform und Gesellschaft. Sein kategorischer Imperativ, "Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“23, überschreitet nicht nur die traditionelle Begrenzung der Ethik auf den zwischenmenschlichen Nahbereich sondern hebt auch die Ethik als Gesinnungsethik auf. Das Moralprinzip von Jonas läßt jede Ethik hinter sich, die entweder die Moral auf Pflichten gegen die Mitmenschen einschränkt, statt Pflichten gegen die Menschheit einzubeziehen, oder die Moral tendenziell auf die Reinheit und Prinzipienrichtigkeit des Willens beschränkt - so, als ginge es darum, im Einklang mit moralischen Prinzipien "recht zu handeln", als dürfe man aber die ungewollten Nebenfolgen seines Handelns de facto "Gott anheimstellen"24 Durch das "Prinzip Verantwortung" wird die normative Ethik schwerpunktmäßig eine Ethik der einsehbaren Pflicht zur Zukunftsverantwortung. Drittens, verehrter Herr Jonas, haben Sie auch den Übergang zur Anwendung der normativen Ethik erheblich verändert und neu bestimmt. Dazu mögen zwei Hinweise genügen. Gegenüber den traditionellen Ethiken, sei es der aristotelischen, sei es der kantischen Tradition, betonen Sie, daß keineswegs ethischer Gemeinsinn, moralisches Gefühl und gesunder Menschenverstand ausreichen, um das moralisch Richtige zu treffen. Denn dieses bemesse sich heute und künftig an der Verantwortbarkeit von Handlungsfolgen, Lebensfolgen, Forschungsfolgen. Diese Folgen aber, und das heißt diesen ganz neuartigen Gegenstandsbereich moralischer Beurteilung, können wir uns weder mit unserem gesunden 23 24 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, S. 36. Vgl. Max Weber, Politik als Beruf, in: Gesammelte politische Schriften, hg. von J. Winckelmann, 3. Aufl. Tübingen 1971, S. 551. 23 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Menschenverstand noch mit unserem moralischen Gefühl vorstellen; haben wir es hier doch zu tun mit sehr komplizierten Kumulativwirkungen und äußersten Fernwirkungen unserer hochtechnischen Lebensgewohnheiten und Lebensformen, Produktionen und Produktionsweisen, unseres Konsumverhaltens aber auch unserer Risikoforschungen und riskanten Technologien. Daraus ergibt sich eine neue Rolle des Wissens in der Moral und die Pflicht, sich Wissen zu beschaffen. Freilich stößt diese Wissensbeschaffung an schmerzliche Grenzen. Denn die Kumulativwirkungen, die ökologischen Fernwirkungen etwa, entziehen sich der exakten bedingten Prognose, wie sie in einem geschlossenen System möglich ist. Die Kluft zwischen unserem Prognosewissen und der Wirkungsmacht unserer hochtechnologischen Projekte, Praktiken aber auch Lebensgewohnheiten erzeugt "ein neues ethisches Problem. Anerkennung der Unwissenheit wird dann die Kehrseite der Pflicht des Wissens und damit ein Teil der Ethik".25 Aus diesem Grunde plädieren Sie für eine "Heuristik der Furcht", für "eine Furcht geistiger Art", die uns fähig machen solle, das nichterfahrbare "Unheil kommender Geschlechter" vorauszudenken und uns davon betreffen zu lassen.26 Daraus haben Sie für unsere öffentlichen Dialoge über das, was zu tun sei, und damit für unsere Forschungsplanung, für wirtschaftliche Produktions- und Marktstrategien wie für politische Entscheidungen die Vorschrift abgeleitet, "der Unheilsprophezeiung mehr Gehör zu geben ... als der Heilsprophezeiung"27, also der schlechten Prognose einen Vorrang vor der guten einzuräumen. Sie legen damit eine Dialogregel nahe, die den Befürwortern eines Projekts und den Anwendern einer Technik die Beweislast für die Unschädlichkeit und die Verantwortbarkeit auferlegt. In dubio pro humanitate, und damit: in dubio contra projectum, in dubio contra quaestum würde das regulative Prinzip für unsere öffentlichen Diskurse lauten müssen.28 Viertens: Das "Prinzip Verantwortung" enthält also ein zukunftsethisches Prinzip Vorsicht. Mit diesem gehen das Werk und die politisch-ethischen Stellungnahmen des Verantwortungsethikers vorsichtig um: Sie lassen keinen Zweifel daran, daß ein solches Prinzip jeweils in interdisziplinären öffentlichen Diskursen zu prüfen und nur nach Maßgabe einer solchen Prüfung anzuwenden ist. 25 26 27 28 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, S. 28. Ibid., S. 64, 65. Ibid., S. 70. Dietrich Böhler, Mensch und Natur: Verstehen, Konstruieren, Verantworten - in dubio contra projectum. In Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Jg. 39, Heft 9, S. 999-1019, hier bes. S. 1013 ff. 24 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Gegenüber einer globalen Technikkritik, gegenüber einer modischen Totalkritik an der technologischen Zivilisation, die er als alternativenlos aber entwicklungsfähig ansieht, sagt uns der Weise: "Nur im Bunde mit Wissenschaft und Technik, die zur Menschheitssache gehören, kann die sittliche Vernunft dieser Sache dienen. Dafür gibt es kein einmaliges Rezept, nur viele Wege des Vergleichs, die von Fall zu Fall, jetzt und künftig, in steter Wachsamkeit immer neu zu suchen sind. Bestenfalls kann sich, immer wiederholt, eine Übung dafür einstellen. Darauf ist zu hoffen. Doch zu jener Wachsamkeit anzuhalten ist des Denkens Pflicht.“29 Abschließend zitiere ich aus der Ehrendoktorurkunde: "... In dem hervorragenden Wissenschaftler und Philosophen ehrt der Fachbereich zugleich den Menschen Hans Jonas, dessen Gründlichkeit und Güte, dessen moralische Unbeugsamkeit und Würde ihn zu einem Vorbild künftiger Wissenschaftler und Weltbürger macht. Qui Berolini, qua in urbe Mose Mendelssohn auctore cultura et ludaica et Germano-Iudaica effloruerat, universitatem et per biennium academiam scientiae rerum ludaicarum promovendae adiit, opuscula prima publicavit; Berolini, qua ex urbe dignitatis et legum destructio, civium Iudaicorum numero carentium expulsio atque excisio initium sumpserunt; Berolini, quae urbs libertate, iure, hominis dignitate donata est ex occidente cuiusque libera universitas libertatem, iura, dignitatem hominis colit coletque studiose. Quibus de causis hac in urbe viro doctissimo totiusque orbis terrarum civi honoris quam maximi debentur. Aktualisierendes Nachdenken schulden wir dem Hermeneutiker, der mit seiner Methode einer entmythologisierenden existentialen Interpretation die Aporien der christlich abendländischen Freiheits- und Erbsündenlehre aufwies und uns den spätantiken Geist der Gnosis als Verfremdung der Moderne erschloß. Aktualisierendes Nachdenken schulden wir dem Sucher eines Gottesbegriffs nach Auschwitz und dem eindringlichen Denker der Zukunftsverantwortung. Hans Jonas verdanken wir die Ausweisung und Konkretion des Prinzips einer Ethik für die technologische Zivilisation, von der er zeigt, daß ihr in dem Maße Verantwortung für das Ganze zuwächst, als ihre Fernwirkungen die Zukunft der Menschengattung gefährden. 29 Hans Jonas, Wissenschaft als persönliches Erlebnis, S. 30. 25 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Maxima cum reverentia Hans Jonas homo ludaeus colendus est nobis, qui cum universitates Germaniae adulescenti doctissimo intercluderent aditum pro libertate et iure, pro Iudaeorum incolumitate atque dignitate contendere constituit. Qui miles legionis Iudaicae bello pugnavit, ut in Germania res tandem publica foret, in qua et tertii quod dicitur imperii et inhumanitatis et interfectorum memores, ut condiciones vitae vere humanae in mundo permanerent, curare possemus sequentes iussum illud categoricum, quo homines continuo ad officiorum conscientiam vocat Hans Jonas philosophus. Als Soldat der jüdischen Brigade kämpfte er mit für die Gewinnung eines politischen Raumes in Deutschland, der uns die Erinnerung an die nationalistische Unmenschlichkeit und ihre Opfer ebenso möglich macht wie eine Verantwortungsübernahme für 'die Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden' - im Sinne des kategorischen Imperativs von Hans Jonas.« Sehr verehrter Herr Professor Jonas, ich überreiche Ihnen nun die Ehrenurkunde. Uno actu verleihe ich Ihnen den akademischen Grad eines Doktors der Philosophie ehrenhalber. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem großen Werk.“ 1.4 Der voraussetzungs- und kommunikationsvergessene Weltbezug der Metaphysik, dessen Fortwirkung im Subjekt-Objekt-Paradigma und Heideggers hermeneutisch-pragmatische, aber reflexionsvergessene Metaphysikkritik. Die antike Metaphysik begreift die Erkenntnis der Welt, genauer: die des Ganzen, was da ist, nach dem Muster des Etwas Sehens im Sinne der theoria. Darunter versteht sie ein geistiges Sehen, eine begreifende Schau – was immer das sein mag. Nach Parmenides ist Platon Urheber und Klassiker dieser Auffassung. Lesen Sie etwa im naturphilosophischen Dialog Timaios den kosmologisch-theoretischen Passus 47a bis c (in der Stephanus-Numerierung); Tilman Lücke zitiert ihn einleitend in seinem Essay. Oder lesen Sie, wie Platon in der Politeia, nämlich im Liniengleichnis (511c), von der „dialektischen Wissenschaft“ sagen kann, sie „schaue“ das Seiende und Denkbare. Schaut aber eine Wissenschaft, oder erkennt sie etwas durch Analyse, durch Begreifen etc.? Lesen Sie auch, wie Platon im Kommentar zum Höhlengleichnis die höchste Erkenntnis erläutert, die er zuvor (im Sonnengleichnis) als den Möglichkeitsgrund unseres Etwas 26 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Erkennens und zugleich als dessen Geltungsgrund angenommen hatte (508ff), nämlich als die Idee des Gute; und beachten Sie dabei, welche kognitive Tätigkeit er dieser höchsten Erkenntnis, ganz selbstverständlich, zuordnet: das Etwas-Sehen: „Was ich sehe [...], das sehe ich so, daß zuletzt unter allem Erkennbaren und nur mit Mühe die Idee des Guten erblickt wird, wenn man sie aber erblickt hat, sie auch gleich anerkannt wird als die Ursache alles Richtigen und Schönen – im Bereich des Sichtbaren erzeugt sie gleichsam die Sonne und damit das Licht (welches Erkenntnis ermöglicht); in der Sphäre des Erkennbaren bringt sie allein als Herrscherin Wahrheit und Vernunft hervor. Daher muß, wer vernünftig handeln will, diese [Idee des Guten] sehen“ (517 b/c). Die metaphysische Tendenz, sowohl ‚das Ganze‘ bzw. ‚das Sein‘ als auch die Erkenntnisgrundlage des Seins, bei Platon das Gute als solches, die Idee des Guten nach dem Muster des Sehens von Dingen, mithin unreflektiert direkt, anzugehen, ist Grund genug für einen erkenntniskritischen Rückgang auf die Rolle des Erkenntnissubjekts. Hinter dem Erkennen steht doch das Subjekt der Erkenntnis, welches seine Erkenntnisvermögen ins Spiel bringen muß. Darauf insistiert die Philosophie der Neuzeit (z. B. Descartes, Kant). Die optische Unmittelbarkeit der antiken Metaphysik, dieser Ansatz bei einem vermeintlichen geistigen Sehen des Seins als einem Gegenstand, gab schließlich – in der Moderne – auch den Grund ab für einen pragmatisch hermeneutischen Neuansatz bei dem verstehenden „In-derWelt-sein“ des Menschen (Heidegger). Anstatt die dialog- und denkkonstitutive Klasse der Behauptungsakte als Sprachhandlungen mit Geltungsansprüchen zu thematisieren, betrachten die meisten Metaphysiker seit Platon und Aristoteles (im Wortsinne der theoretischen bzw. kontemplativen Einstellung des Etwas Vernehmenden – phänomenologisch und verstehend – oder des Etwas Beobachtenden – empirisch analytisch und objektivierend) das Thema ihrer Behauptungen, als sei es ein dinglicher Gegenstand: „das Seiende“ und dessen Ganzheit, „das Sein“. Das ist eine folgenschwere Vorentscheidung: die Frage nach dem Ganzen wird nämlich sogleich von dem Vorverständnis, dieses sei nach dem Muster eines dinglichen Gegenstandes zu verstehen, bestimmt, d. h. aber in einer sprach- und kommunikationsverzerrenden Verdinglichung. Noch das folgende Paradigma, das der subjektphilosophischen Erkenntniskritik, setzt diese Perspektive fort, ja verschärft sie im Sinne eines Subjekt-Objekt-Dualismus: Von Kant bis zu seinen modernen Neuentdeckern und Aktualisierern, den Neukantianern, die den Begriff und die Disziplin „Erkenntnistheorie“ entwickeln, geht es immer um das Verhältnis von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisgegenstand. Und der Vollender, zugleich auch Überwinder des Neukantianismus, Ernst Cassirer, rekonstruiert in seiner gewaltigen Problemgeschichte 27 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie „Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit“, vier Bände, das gesamte neuzeitliche Denken als Philosophie der Subjekt-Objekt-Relation. Ebenfalls der Subjekt-Objekt-Beziehung verpflichtet ist Heinrich Rickerts neukantianischer Klassiker „Der Gegenstand der Erkenntnis“, 1892, wiewohl Rickert darin den Primat der praktischen Vernunft begründen will, indem er eine „andere Welt“, die Welt der nichtseienden, aber absoluten „Werte“ nachzuweisen sucht. Doch bezieht er sich darauf wie auf ein Objekt. Die neukantianische „Erkenntnistheorie“ setzt nach dem Vorbild Descartes’ und Kants voraus, daß das Ganze der realen Erkenntnisgegenstände dem Erkenntnissubjekt wie ein Gegenstand im Großen, abgetrennt vom Erkenntnissubjekt, gegenüberstehe: als „Außenwelt“. In dem modernen, insonderheit kantianischen Erkenntnisproblem steckt eine sprachwidrige Verdinglichung der Weltbeziehung des nach seinen Erkenntnismöglichkeiten doch fragenden Menschen, der ja Sprechakte in einem Argumentationszusammenhang vollzieht. Seit Kant führt sie in die Probleme eines Subjekt-Objekt-Dualismus, die zu einem Gutteil Scheinprobleme sind: Wie ist die Außenwelt, wenn doch ihr Wesen – Kant: das „Ding an sich“ unerkannt ist, für das Erkenntnissubjekt erkennbar? Ist sie erkennbar? Ontologisch gewendet: Ist sie etwas Reales? Oder können ‚wir’ Erkenntnissubjekte nur – oder gar allenfalls – die Realität unserer selbst annehmen? Der Kantianismus entsubstanzialisiert die Metaphysik als Weltanschauung, indem er die Geltung ihrer Aussagen zu Vermutungen herabsetzt; aber er führt und perpetuiert Anlage 4 insofern zu dem Erkenntnisschema eines Subjekt-Objekt-Dualismus die metaphysische Verdinglichung des erkennbaren Ganzen durch zwei Grundannahmen (1 und 2), zwei Ausblendungen (3 und 4) und eine Abschattung (5): (1) Verabsolutierung der Subjekt-Objekt- oder InnenAußen- bzw. Ich – Nicht-Ich-Differenz infolge von Descartes’ dualistischer Ontologie: res cogitans – res extensa.30 (2) Die Unterstellung einer Weltlosigkeit des Erkenntnissubjekts;31 30 31 Heidegger, Sein und Zeit (SuZ), S. 60-62. Diese kritisiert eigentlich schon Husserl, insofern er bei der Intentionalität des Bewußtseins ansetzt: E. Husserl, Cartesianische Meditationen, Husserliana Bd. I, Den Haag 1950, §§ 40, 42f., 62 und 64. Vgl. H. Gronke, Das Denken der Anderen, Würzburg 1999, S. 62f., S. 78-82, vgl. 174ff. 28 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie (3) Das Überspringen der Leiblichkeit des Erkenntnissubjekts und seiner Situiertheit in einem organismischen Austauschzusammenhang mitlebendiger und anorganischer Umwelt;32 (4) Das in (3) mitvollzogene Überspringen der Sinn und Bedeutung ermöglichenden bzw. vorgebenden Sprachlichkeit des Menschen; (5) Die in (4) mitgesetzte Abschattung der Gültigkeit (bzw. Wahrheits- und Richtigkeitssuche) ermöglichenden Geltungsansprüche des Denkens als Miteinander-Argumentierens i.S. von Diskurs/Dialog.33 1.4.1 Leib- und Sprachapriori: geschichtlichpragmatische Dimension Reflexionsund Argumentationsapriori: geltungs- bzw. dialogpragmatische Dimension Vorgriff auf die pragmatisch-hermeneutische Wende und ihre Probleme: der frühe Heidegger Die Wende zum dritten Paradigma der Philosophie wurde m. E. zunächst durch eine sprachphilosophische (W. v. Humboldt) und eine handlungs- sowie zeichentheoretische (Charles S. Peirce) Aufmerksamkeit für die ersten beiden Probleme ausgelöst. Anstoß nahm man zumal an den beiden subjektphilosophischen Suggestionen, der etwas als etwas Bestimmtes erkennende Mensch, (subjektphilosophisch genauer: der allererst etwas als etwas erkennen wollende Mensch) befinde sich gegenüber einem Ensemble stummer Gegenstände bzw. unverständlicher ‚Objekte’, welche ‚draußen’ in einer strikt von ihm abgetrennten Außenwelt ‚vorhanden’ seien; und es komme nun darauf an, diese Außenweltobjekte allererst zu entdecken, zu erschließen und sie durch eine Erkenntnisprozedur mit der Innenwelt Anlage 5 des Erkenntnissubjekts zu vermitteln. 32 33 Hans Jonas, Organismus und Freiheit. Göttingen 1973. W. v. Humboldt, Schriften zur Sprachphilosophie, in: Werke in fünf Bänden, hrsg. v. A. Flitner und K. Giel, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1963, Band 3. K.-O. Apel, Transformation der Philosophie, Frankfurt a. Main 1973, Bd. 1: Einleitung, und Teil II, Bd. 2: Teil II „Transformation der Transzendentalphilosophie“. 29 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Einige dieser Vorannahmen der nachcartesischen Kritik und der Erkenntniskritik bzw. Erkenntnistheorie seit Kant deckte Heidegger metakritisch 1927 in „Sein und Zeit“ auf, jedenfalls die Annahmen (1) und (2). Dort lesen wir in dem grundlegenden Paragraphen 13: „Je eindeutiger man nun festhält, daß das Erkennen zunächst und eigentlich ‚drinnen’ ist, ja überhaupt nichts von der Seinsart eines physischen und psychischen Seienden hat [ergänze: vielmehr die Seinsart eines starren Betrachtens], umso voraussetzungsloser glaubt man in der Frage nach dem Wesen der Erkenntnis und der Aufklärung des Verhältnisses zwischen Subjekt und Objekt vorzugehen.“34 In Wahrheit entstehe erst durch diese Vorannahmen das sogenannte Erkenntnisproblem, „die Frage nämlich: Wie kommt dieses erkennende Subjekt aus seiner inneren ‚Sphäre’ hinaus in eine ‚andere und äußere’, wie kann das Erkennen überhaupt einen Gegenstand haben, wie muß der Gegenstand selbst gedacht werden, damit am Ende das Subjekt ihn erkennt [...]?“35 Heideggers Kritik als Sinnkritik erläuternd, können wir sagen: Der neuzeitliche Ansatz bei der Subjekt-Objekt-Spaltung, in gewisser Weise aber schon die antik-griechische Auffassung des Erkennens als eines geistigen Sehens im Sinne von theoria und noein, mache sich blind gegenüber der Sinnbedingung jeder Rede von Erkenntnis. Denn es ignoriere, daß Erkennen „ein Seinsmodus des Daseins als In-der-Welt-sein“ ist. Jedes Erkennen gründe „vorgängig in einem Schon-sein-bei-der-Welt“, weil es auf Lebensinteressen, „auf dem Besorgen“ des Leibes und der ganzen „Existenz“ des Menschen aufruhe.36 Insofern sei in der Lebenswelt immer schon eine Vermittlung des Menschen mit seiner Welt geleistet: Der Mensch existiere verstehend, Welt verstehend, und zwar so, daß er von vorneherein – bei Kant heißt es „a priori“, bei Heidegger „vorgängig“ – Welt und sich in der Welt verstanden hat. Dieses alltagsweltliche Schon-Verstandenhaben sieht Heidegger als notwendige Voraussetzung, als „existenziale“ Bedingung auch jeder wissenschaftlichen Erkenntnis an. Warum und inwiefern? Weil und insofern nur das vorgängige Welt- und Daseins-Verstehen „Bedeutsamkeit“ vorgibt: die Bedeutung von Dasein „hinsichtlich seines In-der-Weltseins“37. Und erst vor diesem sprachlich und zugleich praktisch erschlossenem Sinnhintergrund, erst dank dieses Schon-Verstandenhabens seiner „Lebenswelt“ (Husserl) kann der Mensch auch wissen, was er wissenschaftlich und philosophisch untersuchen, was er zum Gegenstand seiner methodischen Erkenntnis machen will. Von eigentlicher Erkenntnis können wir überhaupt nur reden, weil wir ein vorwissenschafliches Verständnis dessen, was 34 35 36 37 Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag (zit.:SuZ), S. 60. A.a.O. SuZ, §§ 15f, 26, 69a, passim. SuZ, S. 87. Vgl. §§ 18, 31 und 69c. Anlage 6 30 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie methodisch erkannt werden soll, immer schon mitbringen. Ein Begriff von Erkenntnis, der nicht die lebensweltlichen Voraussetzungen möglichen Erkennens, dieses „schon-sein-beider-Welt“, berücksichtige, sei sinnlos. In diesem Sinne stellt Heidegger gegen das dualistische Schema von Subjekt und Objekt oder Ich und Welt die Perspektive einer vorgängigen Vermittlung beider Seiten, eines pragmatischen, handlungsbezogenen In-der-Welt-Seins. Damit radikalisiert er den Ansatz seines Lehrers Edmund Husserl bei der Intentionalität des Bewußtseins als der kognitiven Beziehung, die ein Bewußtsein im Rahmen seiner Lebenswelt zu allen Gegenständen habe, die es ‚meinen‘ könne. Er geht von dem alltäglichen bzw. lebensweltlichen Verständnis aus, welches der Mensch, der lebe und sich am Leben erhalten wolle, immer schon im Sinne eines „apriorischen Perfekts“ besitze: Der alltägliche Mensch habe immer schon den Kontext seiner Lebenswelt ‚erkannt’. Denn er befinde sich „immer schon“ in einer Lebenswelt aus sinnhaften Dingen und Einrichtungen, wie „Zeug“38, Kultur, Institutionen, welche nicht etwa bloß „vorhanden“, sondern dem Alltagsmenschen mehr oder weniger schon „zuhanden“ sind – und daher apriori verstanden39 als Gebrauchsdinge seiner Alltags- und Lebenswelt. Eben deshalb lasse sich die menschliche Lebensform als „verstehendes“ und „besorgendes In-derWelt-sein“ und der Mensch selbst als „Dasein“ bestimmen und nicht als betrachtendes „Subjekt“ gegenüber stummen, fremden Objekten.40 Das ist eine grundlegende Einsicht der pragmatisch-hermeneutischen Wende hin zu einem dritten Paradigma der Philosophie. Das Pragmatische dieses Ansatzes ist die Aufdeckung des interessierten Lebens- und Handlungsbezugs, der auch das wissenschaftliche und philosophische Erkennen des Menschen trägt. Heidegger drückt das plastisch mit dem Begriff der Sorge als eines Besorgens aus, welches den Menschen, weil er sich stets im Dasein halten muß, unablässig begleitet. Die Sorge ist gleichsam der Schatten des Daseins. Das Hermeneutische dieser Perspektive zeigt sich in der ontologischen Tieferlegung der Fundamente unseres kognitiven Weltbezuges. Heidegger setzt nicht erst bei dem Seinsverhältnis eines philosophischen bzw. wissenschaftlichen Theorie-Subjekts zu dessen Gegenständen an, sondern bei dem „besorgenden“ bzw. interessierten Welt-Verstehen, welches auch einem methodischen Erkennenwollen zugrundeliege, ja dessen Sinnbasis darstelle. Dieses alltägliche Verstehen bzw. Schon-Verstanden-haben sei die elementare Form des Interpretierens von etwas Sinnhaftem: die Vorform jener Tätigkeit, welche seit 2000 38 39 40 SuZ, § 23, §§ 15-18. SuZ, S. 85ff, S. 109f.s SuZ, §§ 12-14. 31 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Jahren in Theologie, Jurisprudenz und Literatur zu Methoden und Methodenlehren der Interpretation hochstilisiert und diszipliniert worden ist. Dafür hat sich der Fachterminus „Hermeneutik“ eingebürgert. (Das griechische „hermeneuein“ bedeutet „auslegen“ und „verdolmetschen“. In diesem Zusammenhang steht auch der Name des Götterboten „Hermes“, der den Willen der Götter den Menschen übermittelt und insofern auslegt.) Traditionskritisch pointiert Heidegger am Schluß des Paragraphen 13 von Sein und Zeit das primäre kognitive Weltverständnis des Menschen folgendermaßen: „Im Sich-richten-auf ... und Erfassen geht das Dasein nicht etwa erst aus seiner Innensphäre hinaus, in die es zunächst verkapselt ist, sondern es ist seiner primären Seinsart nach immer schon ‚draußen’ bei einem begegnenden Seienden der je schon entdeckten Welt.“41 Diese Einsicht ist in der Tat ein notwendiges Element des dritten Paradigmas und damit der Philosophie als Lebenswelt- und Kommunikationsreflexion. Aber es ist keine zureichende Einsicht, weil sie die dialog-pragmatische Geltungsdimension des Etwas-als-etwasVerstehens links liegen läßt. Das Etwas-als-etwas-Bestimmtes-Verstehen ist nämlich ein impliziter Sprach- und Kommunikationsvorgang. Dieser enthält von vornherein Geltungsansprüche von Verstehern/Sprechern als Subjekten dieser Ansprüche und als Teilnehmer einer Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft. Denn er setzt solche Geltungsansprüche, logisch gesehen, geradezu voraus – so wie jemand, der etwas versteht, bereits in Anspruch nimmt, daß man das Gehörte oder Erfahrene (normalerweise) richtig verstanden hat, oder daß man es doch, in Zweifelsfällen, richtig verstehen kann. In diesem vorausgesetzten Bezug auf Richtigkeit, diesem Geltungsanspruch unseres Verstehens, kommt etwas von dem zum Vorschein, was seit Descartes und zumal von Kant im Sinne der Begriffe Subjekt, Urteilsautonomie und Kritik gedacht worden ist: das Verhältnis von Geltungsanspruch und dessen kritischer Prüfung vor dem intersubjektiven Forum der Vernunft, in dem jeder, insofern er ein sinnvolles Argument vorbringen mag, seine gleichberechtigte Stimme hat. Den Rückbezug auf das, was im zweiten Paradigma als „Subjekt“ gedacht worden ist, und damit eine ‚Aufhebung’ subjektvergessen und seines Kernbestandes sprachgeltungsvergessen, überspringt insofern Heidegger. Er denkt logosvergessen und diskursvergessen. Radikal (besser: abstrakt) negiert er also den Kern des zweiten Paradigmas. Er sucht keine Aufhebungsperspektive, so daß er dessen wertvolle Errungenschaften ernst nähme – als Argumentationspartner im Wahrheitsgespräch eines philosophischen 41 Ebd., S. 62. 32 Anlage 7 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Begründungsdiskurses. Über seiner hermeneutisch-pragmatischen Entdeckung des Elementarphänomens, daß Menschen, auch Philosophen, die die Welt distanzieren und sie nur beobachten wollen, von vornherein in der Welt sind und diese apriori als ihre Lebenswelt verstanden haben, vergißt er, daß er selbst diese Entdeckung als Argumentationssubjekt behauptet, indem er dafür Wahrheit beansprucht. Die Selbstvergessenheit Heideggers als Diskursteilnehmer, d. h. als eines Subjekts mit Geltungsansprüchen, das sich gegenüber anderen Diskurs-Subjekten für seine Behauptungen zu rechtfertigen hat, führt letztlich zur Selbstimmunisierung seines Denkens und zur Preisgabe des Zentralbegriffs der Philosophie überhaupt, des Begriffs der Vernunft. Es lohnt sich überaus, diese Tendenz bei der Lektüre von „Sein und Zeit“ im Auge zu behalten, will man verstehen, wie Heideggers spätere, 1933 praktizierte und seit dem ‚Humanismusbrief’ von 194642 als „Kehre“ des Denkens verklärte, Preisgabe der Vernunft zugunsten eines ‚Andenkens an das Sein’, das sich selbst als das Ohr und die Stimme des Seins wähnt, möglich war. Mit anderen Worten: Wie Heidegger seine Philosophie um die Distanz und die Verantwortung der Kritik hat bringen können.43 So sehr, daß er die Philosophie als ganze nicht nur blamiert sondern geradezu in „Schande“ und „Bankrott“ getrieben hat, wie Hans Jonas pointiert: Heidegger erniedrigte sie zur Magd des Nationalsozialismus. Denn er erhob den Hitler, den „Führer“, zur Manifestation des Seinsgeschicks,44 statt dessen Ansprüche vor dem „Gerichtshof der Vernunft“ (Kant) zu prüfen, indem er ihnen als autonomes Diskurssubjekt gegenübergetreten wäre, mithin die Nazimythen entlarvt und sich von deren Vernunftzerstörung mit impliziter Menschenverachtung zumindest distanziert hätte. Anlage 8 Mit dieser kritischen Bemerkung lasse ich es jetzt bewenden. Für den weiteren Fortgang dieser Vorlesung und Ihres Selbststudiums bitte ich Sie: Studieren Sie den Essay, den mein früherer Tutor Tilman Lücke im Nachgang zu meinem doch reichlich kühnen, für alle Beteiligten so anstrengenden wie erkenntnisreichen Proseminar „Sein, Selbst-Bewußtsein, Kommunikation“ im Wintersemester 2000/2001 verfaßt hat. Vor allem, was die Inhalte anbetrifft, bietet dieser Text eine gute Übersicht über den paradigmatischen Gang und einige 42 M. Heidegger, Über den Humanismus, Frankfurt am Main, o.J. H. Jonas, Heidegger und die Theologie, 1964, zuletzt in: D. Böhler u. J.-P. Brune (Hg.), Orientierung und Verantwortung. Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Hans Jonas. Würzburg, 2004, S. 39 – 58, bes. S. 54f. 44 Ebd., S. 44ff. 43 33 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Grundfragen dieser Vorlesung, nämlich über die Entwicklungslogik der Philosophiegeschichte als Weg durch drei Paradigmen der Welterkenntnis 2 Über die drei Paradigmen der Philosophie und die doppelte Dialogizität des Denkens als Kommunikation. Text aus: H. Burckhart, H. Gronke (Hg.): Philosophieren aus dem Diskurs. Beiträge zur Diskurspragmatik. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002, S. 45 ff. 2.1 Eine Problemübersicht zum Selbststudium: Tilman Lücke: Mit skeptischen Fragen durch die Philosophiegeschichte Bei einer Tischgesellschaft saß neben Kant ein Mann, der ununterbrochen gleichermaßen dumme wie hochmütige Reden führte und dabei auch noch herauskehrte, welch großer Skeptiker er sei. Schließlich sagte Kant zu ihm: „Sind sie so skeptisch, daß Sie an nichts mehr glauben können?“ – 34 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie „Das nicht, ich glaube nur an das, was ich mit meinem Verstand begreifen kann.“ – „Das“, sagte Kant, „bedeutet im Ergebnis dann ja wohl dasselbe.“45 Einleitung „Sein, Selbst-Bewußtsein, Kommunikation. Grundkurs klassische Texte und Probleme der Philosophiegeschichte“46 – unter diesem Titel kündigte Dietrich Böhler im Wintersemester 2000/2001 am Philosophischen Institut der Freien Universität Berlin ein Seminar an, welches sich auch und besonders an Studienanfänger richtete. Schon im Titel ist auf jene „drei großen Konzeptionen von Philosophie, die sich in unserer Tradition unterscheiden lassen“, verwiesen, nämlich – wie sie Herbert Schnädelbach in seinem ‚Grundkurs Philosophie‘ benennt – „ein ontologisches, ein mentalistisches (...) und ein linguistisches Paradigma“47, die man auch auf die Begriffe „Metaphysik, Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie“ bringen kann.48 Wenn zugleich ein „Grundkurs klassische[r] Texte und Probleme der Philosophiegeschichte“ angekündigt wird, dann könnte man meinen, hier gehe es um eine bloße historische Rekonstruktion. Doch eine solche Rekonstruktion wäre noch nicht Philosophie. Philosophisch wird das Denken frühestens, wenn es sich auch des (philosophischen) Standpunktes klar wird, von dem aus diese Rekonstruktion unternommen wird. Denn man kann „unabhängig von bestimmten Philosophiekonzeptionen nicht definieren (...) was Philosophie sei. Man kann deswegen auch nicht in ‚die‘ Philosophie einführen, ohne zumindest implizit das Philosophieverständnis ins Spiel zu bringen, das man als Einführender selbst besitzt. Man kann somit auch nicht kontextfrei in ‚das‘ Philosophieren einführen; denn auch das Methodenverständnis wandelt sich mit dem allgemeinen Bild von Philosophie.“49 Wenn keine kontextfreie Einführung in die Philosophie denkbar ist, so stellt sich nicht nur die Frage, aus welchen Kontexten heraus sie vermittelt wird, sondern auch, anhand welcher Argumentationsmodelle die in Philosophie Eingeführten sich ihrer eigenen Kontexte klarzuwerden vermögen. Für diese Aufklärung scheinen Fragemodelle skeptischer Art besonders geeignet zu sein, sind sie doch Ausdrucksmittel der „Neigung zum Zweifel am allgemein Anerkannten, ungeprüft Übernommenen oder neu Auftretenden“ – so formuliert es jedenfalls ein angesehenes philosophisches Wörterbuch.50 So gelten die ersten Fragen nicht nur dem Kontext, aus dem heraus heute immer noch Studierende mit Philosophie beginnen51, sondern auch dem Zusammenhang, in dem uns Philosophiegeschichte entgegentritt. Begegnet sie uns in Gestalt „einer kontingenten Folge inkommensurabler Paradigmen“52, wie Richard Rorty53 behauptet? Oder handelt es sich eher 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Abgedruckt (im Kapitel der vermutlich erfundenen Anekdoten) bei Peter Kauder (2000): Hegel beim Billard. München, S. 140; mit Verweis auf Information Philosophie 24 (1996), Heft 5, S. 93. Böhler 2001 c, S. 1. Hervorhebungen in Zitaten sind vom Verf. durchgängig getilgt. Schnädelbach 1986, S. 39. Die an Thomas Kuhn [1962/1967] anknüpfende Rede vom „Paradigma“ beinhaltet Schnädelbach zufolge „immer Vorstellungen vom Gegenstandsgebiet, von einschlägigen Problemstellungen und vorbildlichen Problemlösungen einer Disziplin, d.h. sowohl eine Ontologie (griech. ,tó òn‘ – das Seiende) wie eine Methodologie der Wissenschaft insgesamt“. So z.B. Richard Rorty, zit. n. Habermas 1999, S. 240; ähnlich Karl-Otto Apel und Tugendhat. Schnädelbach 1986, S. 38. Johannes Hoffmeister (Hg.) (1955): Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg2, S. 562. Der Frage „Wozu Philosophie (studieren)?“ soll und kann hier nicht nachgegangen werden. Vgl. hierzu das Unterkapitel ‚Wozu brauchen wir heute noch den philosophischen Diskurs?‘ in Gronke 2001. Habermas 1999, S. 242. Polemisch und anregend (wenn auch mit – im Vergleich zum hiesigen Verfahren – quasi umgekehrter Intention) beispielsweise Rortys Versuch, auf wenigen Seiten die „Geschichte (...) wie die Philosophie qua Erkenntnistheorie sich in der modernen Periode ihrer selbst versichert“ zu erzählen (Rorty 1981, S. 155 ff.). 35 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie um einen dialektischen Zusammenhang, in dem das jeweils „folgende Paradigma (...) die Antwort auf ein Problem, das die Entwertung des vorangehenden Paradigmas hinterlassen hat“, bereithält, wie Jürgen Habermas54 meint? Der hier unternommene kursorische Gang durch die Philosophiegeschichte soll – um diesen Kontext gleich klarzustellen – die letztere Auffassung stützen. Die Zusammenhänge verschiedener philosophischer Paradigmen sollen untersucht und herausgestellt werden, analog zum pädagogischen Ansatz im erwähnten Seminar: Da ging es stets auch darum, Studienanfängern der Philosophie Kompetenz darin zu vermitteln, ihnen begegnende Argumentationsweisen und Positionen in Denkmodelle der Philosophie einordnen und interne Bezüge und solche zu ihrem eigenen Kontext verstehen zu können. Nur so läßt sich – wenn überhaupt – ein Überblick über die unübersehbare Vielfalt philosophischer Schulen gewinnen. So wie es ein gewisses Wagnis ist, einen verstehenden Durchgang durch diese drei Paradigmen innerhalb eines Seminars in einem Semester absolvieren zu wollen (ein Wagnis, das viel Disziplin und konzentrierte Mitarbeit erfordert), erscheint es auch hier vermessen, auf wenigen Seiten dieses Wagnis nachzuvollziehen und kritisch zu rekonstruieren. So gilt für beide Anliegen: Gelingen können sie höchstens unter der Maßgabe, zum einen bloß schlaglichtartig Details der paradigmatisch umrissenen Hauptströmungen zu beleuchten und zum anderen den Schwerpunkt auf den Zusammenhang der Paradigmen, auf die logischen Abhängigkeiten und die ideengeschichtlichen Ablösungsprozesse zu richten. I. Paradigma: Sein Schöne alte Welt – die klassisch-griechische Kosmosfrömmigkeit Exemplarisch für die klassisch-griechische Weltauffassung, die am Anfang unseres Durchgangs durch die Philosophiegeschichte steht, wird ein Auszug aus Platons Dialog ‚Timaios‘ herangezogen. Den Hauptteil des Dialoges macht Timaios’ Rede über das Entstehen der Welt aus. Darin wird die „klassisch griechische Ontologie als ewigkeits- und strukturbezogene Kosmostheologie“55 unter anderem so entfaltet: „Ist aber diese Welt schön und ihr Werkmeister gut, dann war offenbar sein Blick auf das Unvergängliche gerichtet (...), denn sie ist das Schönste alles Gewordenen, er der Beste aller Urheber. So also entstanden, ist sie nach dem durch Nachdenken und Vernunft zu Erfassenden und stets sich Gleichbleibendem auferbaut (...). Indem nämlich Gott wollte, daß alles gut und, soviel wie möglich, nicht schlecht sei, brachte er, da er alles Sichtbare nicht in Ruhe, sondern in ungehöriger und ordnungsloser Bewegung vorfand, dasselbe aus der Unordnung zur Ordnung, da ihm diese durchaus besser schien als jene. (...) [So] verlieh er der Seele Vernunft und dem Körper die Seele und gestaltete daraus das Weltall, um so das seiner Natur nach schönste und beste Werk zu vollenden.“56 54 55 56 Habermas 1999, ebd. Böhler 2001 c, S. 3. Platon, Timaios 28c f. (S. 154 f.). 36 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Die Welt ist hier als Kosmos geordnete Schönheit57 und Abglanz des göttlich-planvollen Ewigen dargestellt. Was ist nun die Rolle des Denkenden in dieser Welt? Ihm ist es aufgegeben, mit seiner Seele, die sich als Teil der wohlgestalteten Ordnung verstehen läßt, in diese Einblick zu nehmen. Die ewigen Ideen, die allem Seienden zugrunde liegen, sind demzufolge Thema und Erkenntnisgebiet der Philosophie; das bloß wandelbar-geschichtliche Auftreten der Dinge, mithin die Praxis gilt es zu überwinden, um so zur reinen Theorie zu kommen. Dann wird der „Philosoph, der mit dem Göttlichen, dem Kosmos und Logosgemäßen umgeht, (...) selber kosmosgemäß und göttlich“58. Für die dem Menschen angeborene Erkenntnisfähigkeit gibt es eine dominante Metapher: das Sehvermögen. Dahinter steht die vorgestellte Analogie, daß wir so, wie wir mit unseren Augen unmittelbar aufnehmen könnten, was ist, in gleicher Weise durch Anschauung von Sachverhalten unmittelbar zu Erkenntnis kämen. Verbunden ist damit die Überzeugung, Philosophie überhaupt sei aus Anschauung der kosmischen Kreisläufe entstanden – so rekonstruiert jedenfalls Timaios „das Wesen Philosophie, als welches ein größeres Gut weder kam noch jemals kommen wird dem sterblichen Geschlecht als Geschenk von den Göttern“59. Die optische Erkenntnisfähigkeit sei uns Menschen gegeben, heißt es weiter, „damit wir beim Erschauen der Kreisläufe der Vernunft am Himmel sie für die Umschwünge unserer eigenen Denkkraft benutzten, welche jenen, die regellosen den geregelten, verwandt sind, und, nachdem wir sie begriffen und zur naturgemäßen Richtigkeit unseres Nachdenkens gelangten, durch Nachahmung der durchaus von allem Abschweifen freien Bahnen Gottes unsere eigenen, dem Abschweifen unterworfenen, danach ordnen möchten.“60 Wie sich wesentliche Elemente dieser Auffassung bis in die römische Stoa erhalten haben, zeigt Hans Jonas, wenn er Ciceros „De natura deorum“ wie folgt zusammenfaßt: Die Welt sei als All „beseelt, verständig und weise, und etwas von diesen Eigenschaften wird auch in manchen seiner Teile sichtbar; (...) der Mensch hat aber zusätzlich zu dem natürlichen Anteil, der ihm als einem Teil der Vollkommenheit des göttlichen Universums zukommt, auch die Fähigkeit, sich selbst zu vervollkommnen, indem er sein Sein dem des Ganzen durch Betrachtung mittels seines Verstandes und Nachahmung in seiner Lebensführung angleicht“61. Die Annäherung an die ewige Vernunft der Kosmos-Gesamtheit soll also als Orientierung der aktuellen Lebenswelt diese selbst transzendieren. Erschütterungen: Sophistik und Gnosis – und klassische Antworten Für Erfahrungswelt und Intuitionen derjenigen, die heute mit Philosophie beginnen, ist zunächst nur schwer eine Anknüpfungsmöglichkeit an dieses Weltverständnis abzusehen. Wir empfinden heute die Welt, auf die sich unsere Praxis bezieht, als krisengeschüttelt und unbeständig. Doch lenkt man den Blick zurück auf Platon, kann deutlich gemacht werden, 57 58 59 60 61 Als pädagogisch fruchtbar erwies sich in diesem Zusammenhang der Hinweis eines referierenden Studenten auf das in die deutsche Sprache eingegangene Wort ‚Kosmetik‘, denn es knüpft (vermittelt durch französische Übernahme) an die griechische ‚kosmetiké techné‘ – ‚Kunst des Schmückens‘ – an. (Vgl. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, erarbeitet im Zentralinstitut für Sprachwissenschaft Berlin. München 1995, S. 721.) So faßt Dietrich Böhler Politeia VI, 500c f. zusammen: Böhler 2001 c, S. 3. Platon, Timaios 47 b f. (S. 169). Ebd. Jonas 1999, S. 292. 37 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie daß diese Krisenerfahrung keine Erscheinung der Moderne ist – Platons Philosophie selbst ist nämlich in gewisser Weise schon eine Antwort auf zwei geschichtliche Krisenerfahrungen62, „die die philosophische Reflexion herausforderten: Einmal die bedrängende Erfahrung eines permanenten geschichtlichen Wandels, der alles erschüttert, verändert und in Frage stellt. Zweitens die nicht minder bedrängende Erfahrung einer in dieser Zeit um sich greifenden Aufklärungs- und Bildungsbewegung der Sophisten.“63 Der ‚Angriff‘ dieser sophistischen Bewegung erschütterte die unhinterfragte Vertrautheit mit dem ontotheologischen Hintergrund der platonischen Philosophie; auch wenn die Sophistik von Weisheitslehre über Rhetorik mehr und mehr zu einem Skeptizismus wurde, der – wie es in der philosophischen Einführung von Wilhelm Windelband und Heinz Heimsoeth dramatisch heißt64 – nur „anfangs eine ernste wissenschaftliche Theorie war, jedoch bald in ein frivoles Spiel überging. Mit der selbstgefälligen Rabulistik ihres Advokatentums machten sich die späteren Sophisten zu Sprechern aller zügellosen Tendenzen, welche die Ordnung des öffentlichen Lebens untergruben.“ Fruchtbar machen lassen sich indessen die Antworten Platons und Aristoteles’ auf diese Erschütterungen. Im Hinblick auf die im Rahmen einer Einführung in die Philosophie entscheidende Einsicht über den Zusammenhang philosophischer Paradigmen erweisen sich insbesondere zwei Grundsätze als wesentlich, die Teil dieser Antworten an die skeptische Herausforderung sind: Logosgrundsatz und Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. 1. Wenn man den Logosgrundsatz rekonstruiert, läßt sich dort ein „fast sinnkritisch dialogpragmatischer Vorgriff aus sokratischem Geist“65 festhalten, den Platon durch Sokrates im Dialog ‚Kriton‘ anführen läßt: „Schon immer habe ich ja das an mir, daß ich nichts anderem von mir gehorche als dem Logos [lógos]66, der sich bei der Untersuchung mir als der beste zeigt.“67 Entscheidendes Kriterium für die Anerkennung einer Rede als wahr oder richtig ist also ihre Überzeugungskraft in argumentativen Diskursen. Nur was sich anhand wohlbegründeter Argumente erweisen läßt, kann als verbindlich gelten.68 Die überzeugendsten Argumente stehen miteinander im Widerstreit; und damit ist vom platonischen Sokrates zugleich notwendigerweise „die Diskursgemeinschaft der sinnvoll Argumentierenden als die einzige Instanz für die Prüfung und für das In-Geltung-Setzen von Normen akzeptiert. Damit hat er sich gegenüber dem Ethos einer realen NormenGemeinschaft auf die Ethik einer idealen Normenbegründungsgemeinschaft berufen.“69 Gleichwohl ist ein wichtiges Defizit festzuhalten: Konsequent gedacht wäre mit dieser Vorstellung der unbegrenzten Rechtfertigungsgemeinschaft nicht mehr jene traditionelle Auffassung zu vereinbaren, welche den inneren seelischen Dialog des Einzelnen (mit sich selbst oder als Schau göttlicher Ideen) als Fundament für Erkenntnis ansieht und den Logos bloß als „Ausfluß von jenem“70. Doch an dieser Vorstellung wird unreflektiert festgehalten; Denken gilt weiterhin als Tätigkeit, „die man prinzipiell einsam, unabhängig von 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Zum faktisch-historischen Kontext der griechischen Polis-Krise detaillierter vgl. Apel/Böhler/ Kadelbach 1984, Bd. I, S. 306 ff. Apel/Böhler/Kadelbach 1984, Bd. I, S. 309. Windelband/Heimsoeth 1957, S. 58. Böhler 2001 c, S. 5. Schleiermacher übersetzt etwas verengend lógos mit „Satz“, obwohl sich mindestens die Bedeutungen „das Sagen, Sprechen, (...) Rede = Darstellung, (...) Rechenschaft, (...) Begründung, Beweis, (...) Denkkraft, Vernunft“ anbieten (Menge 1953, cf. logos, 274). Vgl. Apel/Böhler/Rebel 1984, Bd. II, S. 340 f.; vgl. den Abschnitt ‚Dritte Reflexion der unterstellten sokratischen Bildungsidee: Logos‘ (S. 254-257) in Jürgen Sikora: Bildung als Dialogpraxis. Einige Anmerkungen zu Sokrates, die Grenzen und Möglichkeiten ‚Mitverantwortung‘ zu lehren und zu lernen betreffend. In: Prinzip Mitverantwortung, S. 247-270. Platon, Kriton 46 b (S. 38). Vgl. Böhler 2001 a, S. 47. Apel/Böhler/Rebel 1984, Bd. II., S. 339. Platon, Sophistes 263 e (S. 239). 38 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Kommunikation und Sprache, vollziehen“71 könnte. „Erst heute, wo die Philosophie sprachbewußt wird“,72 kommt ans Licht,73 daß mit der Einsicht in die Rationalität der unbegrenzten Gemeinschaft der Argumentierenden gerade die Kommunikation mit diesen Anderen als das unhintergehbare Erkenntnismodell schlechthin immer schon anerkannt werden muß. 2. Damit zu einer anderen klassischen Antwort auf die skeptische Herausforderung: Aristoteles’ Aufweis der Unbestreitbarkeit des Satzes vom zu vermeidenden Widerspruch – Es kann nicht zugleich und in der selben Hinsicht74 gelten: A und non-A. „Mangel an Bildung“75 wirft Aristoteles den Skeptikern vor, die einen Beweis in klassischer (d.h. deduktiver) Form für diesen Satz vom zu vermeidenden Widerspruch fordern. Aristoteles meint damit eigentlich – so könnte man es modern und weniger autoritär sagen – mangelnde Selbstreflexion. Dies geht aus seiner Erläuterung hervor: Einerseits sei es unsinnig, für alles einen Beweis nach dem Muster der deduktiven Ableitung zu verlangen, dies würde nämlich heillosen „Fortschritt ins Unendliche“76, also infiniten Regreß, nach sich ziehen – denn jeder deduktive Beweis ist von Prämissen abhängig, die selbst wieder in Frage gestellt werden müßten, wenn für alles Beweise dieser Art eingefordert würden. Zum anderen kann ein unbezweifelbarer indirekter Beweis geführt werden, indem gezeigt wird, daß die Gültigkeit des Satzes vom zu vermeidenden Widerspruch nicht mit einer sinnvollen Äußerung bestritten werden kann. Denn wenn eine Äußerung A (zum Beispiel die Äußerung: „Der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch gilt für mich nicht!“) verständlich sein soll, muß sie sich auf etwas Bestimmtes beziehen und die Bedeutung A haben und nicht zugleich die Bedeutung non-A; eine Äußerung, in der A und non-A enthalten sein würden, wäre so allgemein, daß sie nichts Bestimmtes mehr bezeichnen würde und also unverständlich wäre.77 Ein Skeptiker, der die Gültigkeit des Prinzips in Zweifel ziehen will, verwickelt sich folglich in einen „Widerspruch immer dann, wenn er überhaupt redet und denkt. Das ist aber eine Bedingung, die alle nur denkbaren Fälle abdeckt, in denen sich auch nur das Problem erheben könnte (...). Das Prinzip ist also für jeden, gegen den überhaupt zu argumentieren sich lohnt (weil er es selbst tut), unvermeidlich Voraussetzung.“78 Hervorzuheben ist, daß Aristoteles bei der Begründung auf die Dialogpraxis reflektiert und „ganz ausdrücklich einen zentralen Teil seiner Philosophie mit Hilfe dieses Argumenttyps“79 begründet. Die Bedeutung dieser Argumentationsweise im Zusammenhang mit dem in diesem Seminar beabsichtigten Lernfortschritt soll hier betont werden. Denn die indirekte Skeptikerwiderlegung nach diesem Modell ist exemplarisch für die Art und Weise, wie Philosophen es vermögen, aus skeptischen Erschütterungen hergebrachter Vorstellungen Kapital zu schlagen. Die entscheidende Frage, die sie sich, da sie sich in einer Argumentation befinden, vorlegen, lautet: Was ist Voraussetzung eines sinnvollen Redebeitrags? 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Böhler 2001 c, S. 5. Apel/Böhler/Rebel 1984, Bd. II., S. 342. Die selbstverständliche Formulierung „ans Licht kommen“ zeigt erneut, wie sehr bis in unseren heutigen Sprachgebrauch Erkenntnis mit optischer Metaphorik zusammenhängt. Der einschränkende Verweis auf gleiche, mitgedachte und explizierbare Verwendungsweise der Begrifflichkeit A um die es jeweils geht – hier durch die Wendung „in gleicher Hinsicht“ ausgedrückt –, hat sich im Seminar als wichtig erwiesen. Denn andernfalls bringen Seminarteilnehmer leicht Beispiele, in denen A und non-A gleichzeitig zu gelten scheinen, tatsächlich aber verschiedene Kategorien oder Verwendungsweisen zu Grunde liegen. Diese Beispiele sind aber wenig geeignet, weil ‚zu schwach‘, um sich wirklich mit der Stärke des aristotelischen Aufweises messen zu können. Aristoteles Metaphysik 1006 a (zit. n. Kuhlmann 1985, S. 271). Ebd. Ausführlicher vgl. Kuhlmann 1985, S. 273-276. Kuhlmann 1985, S. 275. Kuhlmann 1985, S. 268. 39 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Indes bleibt Aristoteles wegen seiner akommunikativen, gegenstandstheoretischen Sichtweise ein bedeutender unreflektierter Rest vorzuhalten. Er geht einerseits nicht weit genug mit dem reflexiven Ansatz, in dem er sich nicht selbst auf seine Rolle als Argumentierender besinnt: „im Ganzen wird das Argument durchaus aus der distanzierten Position des Theoretikers vorgetragen, der von außen ganz allgemein und unabhängig von seiner faktischen Argumentationssituation hier und jetzt überlegt“80. Andererseits geht er zu weit in der Abwehr sophistischer Rhetorik – dies ist ablesbar u.a. an der Aristoteles-Schule seit Theophrast, der „die pragmatische Dimension der Rede (Kommunikation zwischen Sprecher/Hörer und Hörer/Sprecher) (...) als erkenntnis- und daher philosophisch irrelevant zurückstuft, um die Philosophie von der nicht wahrheitsfähigen Rhetorik etc. zu emanzipieren“81. Der so interpretierte Aristoteles blendet die pragmatischen Bedingungen der Rede, d.h. die Verwendungsweise von Sprache in bestimmten Handlungskontexten, systematisch aus und konzentriert sich allein auf die logischen Voraussetzungen der Rede. Dabei läßt sich sein Modell der Skeptikerwiderlegung – der indirekte Aufweis, in dem die Sinnlosigkeit von Bestreitungsversuchen gezeigt wird –, wie zu sehen sein wird, insbesondere für praktische Kontexte fruchtbar machen. In historischer Perspektive könnte man sagen, daß zur Überwindung dieses gegenstandstheoretischen Rests die völlige Erschütterung der traditionellen Auffassung von Sprache und Welt noch ‚fehlte‘. Als eine der Vorbereitungen dieser Erschütterung kann das Phänomen der Gnosis82 gesehen werden, das sich in den ersten Jahrhunderten nach Beginn unserer Zeitrechnung im Mittelmeerraum in Gestalt zahlreicher Sekten und Glaubensrichtungen zeigte. In ihnen „fand die geistige Krise des Zeitalters ihren verwegensten Ausdruck und gleichsam ihre radikale Antwort“83: eine „jenseitsbezogene, die Welt als heillose Entfremdung verneinende Selbstsorge und Selbsterlösungsreligiosität“84. An Stelle der Auffassung von der einen Welt (in der sich die Zeichen göttlicher Vernunft wiederfinden lassen) predigen gnostische Lehrer nun radikalen Dualismus zwischen Gott und Welt: „Die Gottheit ist absolut außerweltlich, ihr Wesen ist dem des Universums fremd, das sie weder geschaffen hat noch regiert und zu dem sie die vollkommene Antithese bildet: dem in sich geschlossenen und fernen göttlichen Reich des Lichts steht der Kosmos als Reich der Finsternis gegenüber.“85 Im Zusammenhang mit der Erlösungslehre der Gnosis wird die Besinnung auf das Innere des Menschen zum entscheidenden Moment, denn Voraussetzung zur Erlösung ist „das ‚Wissen des Weges‘, nämlich des Weges der Seele aus der Welt hinaus (...). Die unmittelbare Erleuchtung macht das Individuum nicht nur souverän in der Sphäre des Wissens (daher die grenzenlose Vielfalt gnostischer Lehren), sondern bestimmt auch sein praktisches Verhalten.“86 In unserem Kontext der Betrachtung philosophischer Paradigmen ist die damit aufkommende individuelle Souveränität oder Autonomie relevant. Mit dem ‚Fluchtimpuls‘ aus der verkommenen Welt geht eine Herausforderung für die Erkenntnisleistung des Einzelnen einher. Im Dualismus der Gnosis liegt somit „praktisch eine Vorstufe zu einem autonomen Selbst- und Weltverhältnis, welches Normen und Sinn letztlich nicht in der Welt vorfinden kann, sondern begründen bzw. prüfen und selbst erkennen muß.“87 80 81 82 83 84 85 86 87 A.a.O., S. 275 f. Böhler 2001 c, S. 6. Vgl. den Artikel Carsten Colpes in RGG, Sp. 1648-1652. Jonas 1999, S. 55. Böhler 2001 c, S. 9. Jonas 1999, S. 69. Jonas 1999, S. 72 f. Böhler 1999, S. 2. Dieser Impuls bildet den Ansatzpunkt für Hans Jonas’ vergleichende Betrachtung von Gnosis und modernem Existentialismus, die von einer Parallelität von – wie Jonas selbst zugibt – historisch sehr unterschiedlichen Phänomenen ausgeht; aber eben dieser Fluchtimpuls evoziert deren Vergleichbarkeit – s. a. 40 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie II. Paradigma: Selbst Selbstbesinnung bei Augustinus und Descartes Voll in Besitz genommen wird diese Stufe der Autonomie durch Augustinus, der in seiner Jugend dem Manichäismus, einer der wirkmächtigsten gnostischen Bewegungen, anhing. Seine Aneignung und Weiterentwicklung der Vorstellung eines autonomen Ichs lassen Augustinus zu „einem Urheber des modernen Denkens“ werden88. Seine Suche nach einem sicheren Fundament für die Philosophie läßt ihn fündig werden im „Prinzip der selbstgewissen Innerlichkeit, das Augustin zuerst mit voller Klarheit ausgesprochen und als Ausgangspunkt der Philosophie formuliert und behandelt hat. Unter dem Einfluß der ethisch-religiösen Bedürfnisse hatte sich allmählich und fast unvermerkt das metaphysische Interesse aus der Sphäre der äußeren Wirklichkeit in diejenige des inneren Lebens verschoben. An die Stelle der physischen Begriffe waren die psychischen als Grundfaktoren getreten.“89 Damit wird zugleich eine neue Selbstbehauptung des Individuums in der Welt begründet. Seele bzw. Bewußtsein werden (neben Gott und Geschichte) zu zentralen Themen der Philosophie Augustins. „Die Wissenschaft von der Außenwelt, von der Natur, vom Kosmos ist dagegen ganz unwichtig. Die Wendung geht jetzt – das zeigt den Beginn eines neuen Paradigmas an – nach ‚innen‘.“90 Die in der Neuzeit aufkommende „Verinnerlichung des Denkens als Suche nach dem Selbst im Denken und Erfahren bzw. nach dem Selbst als Subjekt des Denkens und Erkennens“91 hat hier einen Ursprung. Die Bedeutung Augustins im Zusammenhang der Untersuchung und Einführung philosophischer Paradigmenwechsel wird noch gesteigert dadurch, daß er sein Interesse auch auf die menschliche Sprache richtet92, und durch seine selbst in Anspruch genommene Rolle als Vermittler platonischer Philosophie.93 Mit dem Vorigen ist schon der Übergang zum methodischen Subjektivismus René Descartes’ angedeutet. Als Wegbereiter wäre ergänzend noch die große mittelalterliche Auseinandersetzung um die Universalien, also um die „Frage nach der metaphysischen Bedeutung der Gattungsbegriffe“94 zu erwähnen, was hier – wenngleich die Folgen der Auseinandersetzung weitreichend sind – nur am Rande geschehen kann. Hier wären vor allem Spielarten des Nominalismus zu nennen, bei denen „das augustinische Gefühlsmoment, welches der individuellen Persönlichkeit ihre metaphysische Würde gewahrt sehen will“95, festzustellen ist. Zugleich macht sich aber auch „die antiplatonische Tendenz der erst jetzt bekannt werdenden aristotelischen Erkenntnistheorie geltend, die nur dem empirischen Einzelwesen den Wert der ‚ersten Substanz‘ zuerkennen will“96. Inwiefern der 88 89 90 91 92 93 94 95 96 die Attraktivität ‚gnostischer‘ Bewegungen in jüngster Zeit (vgl. Hans Jonas: Epilog – Gnostizismus, Existentialismus und Nihilismus. In: Jonas 1999, S. 377-400). Windelband/Heimsoeth 1957, S. 237. Ebd. Kuhlmann 1985, S. 284. Böhler 2001 c, S. 9. Andererseits bietet der Aufweis der augustinischen Defizite auf diesem Gebiet den Vorreitern des dritten Paradigmas Gelegenheit zur Weiterentwicklung eigener Ansätze, s.u. Vgl. Böhler/Gronke 1994, Sp. 775. Windelband/Heimsoeth 1957, S. 232. A.a.O., S. 292. Ebd. 41 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Subjektivismus an den Nominalismus anknüpft, läßt sich an Wilhelm von Occams spätem nominalistischem Modell ablesen (wie es in Windelbands Philosophiegeschichte beschrieben ist): „Die Einzeldinge (...) werden von uns intuitiv (ohne Vermittlung von species intelligibiles) vorgestellt; allein diese Vorstellungen sind nur die ‚natürlichen‘ Zeichen für jene Dinge und haben zu ihnen nur eine notwendige Beziehung, dagegen eine sachliche Ähnlichkeit mit ihnen so wenig, wie dies sonst für ein Zeichen in Hinsicht des bezeichneten Gegenstands nötig ist.“97 Der Zusammenhang mit dem hier schon angedeuteten – und spätestens mit Descartes vollzogenen – Übergang zum zweiten Paradigma, dem der Subjektphilosophie, läßt sich mit Jürgen Habermas so auf den Punkt bringen: „Der Nominalismus hatte die Dinge ihrer inneren Natur oder ihres Wesens beraubt und die Allgemeinbegriffe zu Konstruktionen des endlichen Geistes erklärt. Seitdem fehlte der gedanklichen Erfassung die Fundierung in der begrifflichen Verfassung des Seienden selber. Die Korrespondenz des Geistes mit der Natur konnte nicht mehr als Seinsrelation begriffen werden, die Regeln der Logik spiegelten nicht mehr die Gesetze der Wirklichkeit.“98 Es ist die (wenn auch nicht konsequente, s.u.) Anwendung skeptischer Fragestellungen, die es René Descartes möglich macht, die subjektivistische Wendung zu vollenden. Es gelingt ihm, Skepsis zu „durchdenken und als methodischen Zweifel für begründete Erkenntnis fruchtbar [zu] machen“99. Descartes’ gründlicher und allgemeinverständlich formulierter Neubeginn der ‚ersten‘ Philosophie bewegt Hegel dazu, in seiner ‚Vorlesung über die Geschichte der Philosophie‘ über ihn zu sagen, er sei „so ein Heros, der die Sache wieder einmal ganz von vorne angefangen und den Boden der Philosophie erst von neuem konstituiert hat“100. Voraussetzung für diesen Neuanfang ist dabei eine „Umkehrung der Erklärungsrichtung“.101 Da die Vorstellung einer untrüglichen Korrespondenz zwischen äußerer Wirklichkeit und Erkenntnis nicht mehr zur Verfügung stand, suchte Descartes nach einem alternativen Fundament für gesicherte Erkenntnis: „Wenn das erkennende Subjekt einer entqualifizierten Natur die Maßstäbe der Erkenntnis nicht mehr entnehmen kann, muß es diese aus der reflexiv erschlossenen Subjektivität selbst schöpfen.“102 Es ist wichtig festzuhalten, daß nicht gleich auf jegliche Maßstäbe gesicherter Erkenntnis103 verzichtet werden soll. Denn Descartes verfolgt mit seinem ‚De omnibus dubitandum est‘ nicht die Strategie des haltlosen Skeptizismus; „es hat vielmehr den Sinn, man müsse jedem Vorurteil entsagen – d.h. allen Voraussetzungen, die ebenso unmittelbar als wahr angenommen – und vom Denken anfangen, um erst vom Denken auf etwas Festes zu kommen, einen reinen Anfang zu gewinnen. Dies ist bei den Skeptikern nicht der Fall; da ist der Zweifel das Resultat.“104 Das Ergebnis der Cartesischen Suche nach unbezweifelbarem Grund, wenn sich doch an allen äußeren Erscheinungen zweifeln läßt, ist bekanntlich das cogito, mein ich denke: das Bewußtsein als Zweifelnder, das ich nicht sinnvoll bezweifeln kann, ohne mir selbst zu 97 98 99 100 101 102 103 104 A.a.O., S. 293. Habermas 1999, S. 242. Böhler 2001 c, S. 12. Vgl. Gronke 1999, S. 30 ff. Hegel 1986, S. 123. Habermas 1999, S. 242. Ebd. Insofern geht die Polemik Rortys, wenn er mit Étienne Gilson davon spricht, daß „Descartes’ Hirngespinste“ deshalb so aufsehenerregend gewesen wären, „weil man Fragen ernst nimmt, die zu stellen die Scholastiker (...) zu vernünftig waren“, ins Leere (Rorty 1981, S. 246 f.). Hegel 1986, S. 127. 42 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie widersprechen. Skeptiker, die wirklich an allem zweifeln wollen, werden von Descartes – durchaus in augustinischer Tradition – auf ihr eigenes zweifelndes Bewußtsein verwiesen und auf die Gewißheit, die sie darin finden können, wenn sie sich bewußt machen: „Indem ich zweifle, weiß ich, daß ich, der Zweifelnde, bin; und so enthält gerade der Zweifel in sich die wertvolle Wahrheit von der Realität des bewußten Wesens: denn wenn ich in allem anderen irren sollte, so kann ich darin nicht irren; denn um zu irren, muß ich sein.“105 Oder, wie es dann bei Wittgenstein heißt: „Wer an allem zweifeln wollte, der würde auch nicht zum Zweifel kommen. Das Spiel des Zweifelns selbst setzt schon die Gewißheit voraus.“106 Die Ähnlichkeit zur aristotelischen Zurückweisung desjenigen Skeptikers, der meint, den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch nicht anerkennen zu müssen, ist unübersehbar: Die Zurückweisung des Skeptikers verwendet eine indirekte Argumentation, die ihm nachweist, mit seinem Bestreitungsversuch zugleich Voraussetzungen zu machen – und diese Voraussetzungen muß er reflektierend sofort einsehen, und damit ebenso die Sinnlosigkeit seines Bestreitungsversuchs. Die unhintergehbare Gewißheit des cogito erstreckt sich sogar – mindestens mit dieser Erwägung geht Descartes über Augustinus hinaus – auf die ketzerische (in gnostischen Lehren angespielte) Eventualität, wir würden in dieser Welt von einem bösen Dämon mit Absicht verführt, und alle unsere Wahrnehmungen seien von diesem Dämon eingepflanzte Täuschungen; denn selbst dann, so Descartes, sei ja gewiß, daß ich es bin, der da getäuscht wird. Diese so reflexiv aufweisbare Unhintergehbarkeit ist von Vertretern des dritten, kommunikationsbezogenen Paradigmas der Philosophiegeschichte etwas mißverständlich als ‚Letztbegründung‘ bezeichnet worden – mißverständlich, weil Kritiker sie so verstehen konnten, als sei mit der einmaligen Begründung von Gewißheiten dieser Art die Reflexionsarbeit ein für alle Mal ‚erledigt‘ und deren Ergebnisse müßten fortan dogmatisch anerkannt werden (was Vertretern des Paradigmas den Vorwurf latenten Fundamentalismus’107 eingebracht hat); gemeint ist aber Unhintergehbarkeit im Sinne von jeweils in der aktuellen Auseinandersetzung als unbezweifelbar – d.h. nicht mit sinnvollen, widerspruchsfreien Argumenten bezweifelbar – anerkennungswürdiger Grundlage dieser Argumentation. In diesem Sinne ist Wolfgang Kuhlmann zu verstehen, wenn er schreibt, daß es sich bei der cartesischen Verwendungsweise der reflexiven Wendung „tatsächlich um ein Letztbegründungsargument handelt, ein Argument, mit dem selbst der äußerste Skeptizismus, derjenige, der sogar mit einer uns absichtlich täuschenden Instanz zu rechnen bereit ist, noch zu bezwingen ist.“108 Descartes erweitert dieses Modell jedoch noch in anderer Hinsicht entscheidend gegenüber Augustinus: Die in reflexiver Denkrichtung zu gewinnende Gewißheit steht im Mittelpunkt seiner Philosophie, ja im Mittelpunkt von Wissenschaft überhaupt. Descartes macht das reflexive Argument „zum Zentrum und zugleich zum Prinzip seiner ganzen Philosophie. Zum Zentrum und Angelpunkt insofern, als alle sachhaltigen Aussagen der cartesischen Philosophie in mehr oder weniger direkter Abhängigkeit stehen zu diesem Argument. Zum Prinzip insofern, als mit diesem reflexiven Argument die 105 106 107 108 Windelband/Heimsoeth 1957, S. 238 mit Verweis auf Augustinus, De beata vita 7; Solil., II, 1 ff.; De ver. Rel. 72 f.; sowie De trin. X, 14. Vgl. auch Kuhlmann 1985, S. 287 f. Wittgenstein, Über Gewißheit § 115, zit. n. Habermas 1999, S. 244. Vgl. Karl-Otto Apels Einschätzung in: Primordiale Mitverantwortung. Zur transzendentalpragmatischen Begründung der Diskursethik als Verantwortungsethik. Gespräch von Horst Gronke, Jens Peter Brune und Micha H. Werner mit Karl-Otto Apel. In: Prinzip Mitverantwortung, S. 97-121, S. 118 mit dem Verweis auf Jürgen Habermas 1996; sowie dessen Abschnitt über den „Sinn von ‚Letztbegründungen‘ in der Moraltheorie“ in Habermas 1991, S. 185-199; vgl. Habermas 1999, S. 256 ff. Kuhlmann 1985, S. 290. 43 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie cartesische Philosophie im engeren Sinne, die prima philosophia, ausdrücklich zur Philosophie in der intentio obliqua, zur Reflexion wird, und zwar vor allem zur Reflexion auf das erkennende Subjekt. Bei Descartes verliert das Argument vollkommen den Charakter eines sophistisch spielerisch zu verwendenden bloßen Versatzstückes aus dem Arsenal der nur halb ernst gemeinten Skeptikerdiskussionen.“109 Grenzen der Subjektphilosophie – ‚Metaphysischer Rest‘ bei Augustinus, Descartes, Kant Es bleibt jedoch – trotz all dieser Würdigungen – eine gewisse Ambivalenz festzuhalten, die aus der mangelnden ‚Sprachbewußtheit‘ von Augustinus und Descartes resultiert. Augustinus hatte zwar noch den Erkenntnisprozeß als ‚Dialog‘ verstanden, allerdings als inneren Dialog der Seele mit Gott, also als „sprachfreie Erleuchtung“110. Der Bewußtseinsphilosoph Descartes übersieht hingegen vollends, „daß Sprache und Kommunikation zu den Bedingungen der Möglichkeit sinnvollen Zweifelns gehören“111. Die Folge sind interne Inkonsequenzen: Denn ohne Inanspruchnahme sprachlicher Zusammenhänge müßte die cartesische Gewißheit strenggenommen beschränkt bleiben auf „das mögliche apriorische Wissen, welches ein Erkenntnissubjekt von sich selbst – als real zweifelndem, also sprachfähigem, also auf Andere bezogenem und leibhaftem, also in der Welt befindlichem Kommunikations-Lebewesen etc. – muß haben und daher auch als sicher müßte voraussetzen können“112. Doch dies genügt Descartes eben nicht, er vermengt diese geltungslogische Funktion mit seinem „psychologischen und ontotheologischen Ziel, den Bestand einer individuellen Seele als eigentümlicher Substanz (res cogitans) zu erweisen.“113 Damit verstößt Descartes gegen seine eigene Programmatik, derzufolge er sich doch verpflichtet hatte, nichts anzuerkennen, was sich mit gutem Grund bezweifeln läßt. Statt sich durchgehend reflexiv auf die Voraussetzungen seiner Argumentation zu besinnen, nimmt er wieder eine theoretische Einstellung ein. Von strikter Reflexion läßt er sich nur bis zum Erweis des cogito leiten – wenn „dies feststeht: ‚sum, existo‘, sofort wechselt Descartes die Einstellung: die strikte Reflexion, die einzige Einstellung, in der der drohende Regreß gestoppt werden kann“, verläßt er und „analysiert in theoretischer Einstellung, was es ist, was er da gewonnen hat, und gelangt so zu der überaus problematischen Bestimmung: ‚sum res cogitans‘ und zu (...) ebenso problematischen Brückenprinzipien, die (...) sich offenbar sämtlich ohne Selbstwiderspruch bestreiten [lassen], und damit ist der Letztbegründungseffekt vertan“114. Die breite Inanspruchnahme dieser – von sinnvollen skeptischen Argumenten eben durchaus erschütterbaren – Brückenprinzipien bei Descartes sorgt dafür, daß er als „unfreiwilliger Kronzeuge für die These von der Unfruchtbarkeit reflexiver Argumente in Anspruch genommen werden“115 kann. Es ist aber eigentlich mangelnde Reflexivität, die für diese Defizite verantwortlich ist. Was als Leistung Descartes’ festzuhalten bleibt, ist der Anspruch, daß philosophische Erkenntnisse den Standards wissenschaftlicher Sicherheit zu genügen 109 110 111 112 113 114 115 A.a.O., S. 291. Böhler/Gronke 1994, S. 775. Böhler 2001 c, S. 13. A.a.O., S. 14. Ebd. Kuhlmann 1985, S. 297. A.a.O., S. 291. 44 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie haben, womit „Descartes die Grundform des Anfangs aller wahrhaft wissenschaftlichen Philosophie entdeckt“ hat – „wie sehr er den Sinn dieses Anfangs auch mißverstanden und damit den wirklichen Anfang verfehlt hat“.116 Einen wirklichen unbezweifelbaren Anfang in der Philosophie wollte in vergleichbarer Weise Immanuel Kant gewinnen. Er spielt natürlich in einem Seminar, das Paradigmen der Philosophiegeschichte und ihren Zusammenhang untersucht, eine Schlüsselrolle. Auch Kant verfolgte den Anspruch, daß die zu erreichende „Selbsterkenntnis der Vernunft durch Begrenzung ihrer Ansprüche“117 wissenschaftlichen Anforderungen genügen müsse: In seiner Vorrede zur ‚Kritik der reinen Vernunft‘ gibt er zu, daß bei einem Vorhaben wie dem seinen unter anderem „Gewißheit und Deutlichkeit (...) als wesentliche Forderungen anzusehen [sind, T.L.], die man an den Verfasser, der sich eine so schlüpfriche Unternehmung wagt, mit Recht tun kann“118. Diese wissenschaftliche Sicherheit soll durch strikte Verfolgung der transzendentalen Methode erreicht werden, die kritisch nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis fragt. Auch Kant bedient sich dabei einer indirekten Argumentationsstrategie – derjenigen, „daß die ‚objektive Gültigkeit‘ eines x (sei es eines ‚Prinzips der Sinnlichkeit‘, sei es einer Kategorie, sei es eines ‚Grundsatzes des Verstandes‘, sei es auch z.B. eines ‚teleologischen Prinzips der Zweckmäßigkeit der Natur‘) auch dadurch erwiesen werden kann, daß gezeigt wird: Ohne dieses x, ohne die ‚objektive Gültigkeit‘ dieses x, kann es Erfahrung nicht geben.“119 Kant argumentiert dabei „ganz im Sinne des cartesischen Paradigmas“120. Denn er bemüht sich nicht etwa, den Skeptiker auf klassisch-metaphysische Weise zu überzeugen – also dadurch, daß er „neben sich und seine Erkenntnisbeziehungen zur objektiven Welt tritt und (...) nach dem Muster der ontologischen Wahrheitstheorie durch Vergleich des Subjektiven mit dem Objektiven von einer dritten Position aus die bezweifelte Übereinstimmung (adaequatio) in den fraglichen Punkten“121 zu zeigen versuchte – denn er weiß, daß sich eine solche Übereinstimmung niemals unbezweifelbar erweisen ließe. „Er versucht den Nachweis vielmehr aus der Position des neuzeitlichen Erkenntnissubjekts“122: von der Frage ausgehend, was die Sinnbedingungen dafür sind, „daß ein Vernunftsubjekt objektive Erfahrung überhaupt haben kann.“123 Diese Methode ist auch als Antwort auf den empiristisch-objektivistischen Skeptizismus von Hume zu verstehen. Insofern macht die kantische Vernunftkritik im Hinblick auf das erkenntnissichernde Fundament „Schluß mit unkritischer Ontologie / Metaphysik im Sinne der theoria-Tradition“124. Doch dieser Bruch wird innerhalb der kantischen Philosophie nicht vollendet. Es ist nämlich ein „metaphysischer Rest“125 festzustellen unter dem Aspekt der Erkenntnisorientierung Immanuel Kants. Denn die Erkenntnis richtet sich seinem Modell zufolge jeweils auf das hinter dem Gegenstand der Erfahrung (der Erscheinung) liegende ‚Ding an sich‘ (also quasi außerhalb der Erfahrung) „auf die Dinge, ‚so wie sie an sich selbst 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Edmund Husserl (1956): Erste Philosophie. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion. Hg. v. Rudolf Boehm. Den Haag (Husserliana Bd. VIII), S. 5. Zit. n. Gronke 1999, S. 37. Böhler 2001 b, S. 16. Kant KrV A, S. XV, zit. n. Kant 1956, S. 9. Kuhlmann 1985, S. 300. A.a.O., S. 303; vgl. KrV B, S. 817 ff. Ebd. Ebd. Gronke 1999, S. 39. Böhler 2001 c, S. 21. Ebd. 45 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie sind‘ (reines Wesen)“126. In diesem reinen ‚An-sich-Sein‘ bleiben sie jedoch für uns – „im Unterschied zu dem göttlichen, alles direkt anschauenden Verstand“127 – letzten Endes unerkennbar. Denn wir sind auf Erkenntnis durch Erfahrungsvermittlung notwendigerweise angewiesen. Der Skeptiker kann Kant nun zeigen, daß diese Vorstellung inkonsistent ist. Denn dieses Argumentieren für ein Modell, das sich auf etwas letzten Endes Unerkennbares stützt, ist in sich widersprüchlich, „eine sinnlose Rede“128. Dies wird deutlich, wenn wir Kant selbst mit den Voraussetzungen konfrontieren, die er implizit benötigt, um uns gegenüber diese Theorie zu vertreten. Denn Kant führt die Rede vom für uns prinzipiell unerkennbaren ‚Ding-an-sich‘ im Mund und macht zugleich Aussagen über dieses: „daß es sich um ein ‚unerkennbares Reales‘ handele, behauptet man ja schon erkannt zu haben“;129 und dies, während er das Ziel verfolgt, eine Erkenntnistheorie zu begründen, „die nach ihrem eigenen Verständnis Vernunftkritik auf den Bereich des vom Bewußtsein Erfahrbaren beschränkt“130. Für diese Erkenntnistheorie ist eine solche „immanent widersprüchliche Auffassung“ natürlich fatal;131 entgegen Kants Unterstellung läßt sich „der Begriff eines unerkennbaren Dinges an sich nicht einmal denken“132. So läßt sich dem kantischen Projekt entgegenhalten, daß der Skeptiker nicht ‚besiegt‘ sei, und zwar „solange er noch sinnvoll nach einer Rechtfertigung für das kantische Verfahren fragen könne“133. Wie kommt es zu diesem metaphysischen, unreflektierten Rest? Hauptursache ist, „daß Kant sich im Rahmen der Vernunftkritik statt der an sich für sein Projekt erforderlichen strikten Reflexion ausschließlich der theoretischen Reflexion bedient“134. Kant reflektiert zwar auf die Bedingungen der Erkenntnis, letztlich aber in „theoretisch selbstvergessener distanzierender Reflexion von außen“ 135; und statt von sich selbst – dem Philosophen – als Reflexionssubjekt auszugehen, thematisiert er eigentlich „den Physiker“136 als exemplarisches Reflexionsobjekt. Die skeptische Frage: „Welche Erkenntnisbedingungen kann / muß ich als Transzendentalphilosoph beachten?“137, mithin die quaestio iuris der 138 Transzendentalphilosophie , bleibt ungestellt. Trotz dieser Defizite soll hier noch einmal die Weiterentwicklung des Vernunftbegriffes Würdigung finden, die Kant gegenüber dem klassischen Modell vornimmt und die als ‚kopernikanische Wende‘ in die Philosophiegeschichte eingegangen ist; Kant gibt mit seinen „Überlegungen zur Konstitution des Selbstbewußtseins einen überzeugenden Beleg dafür, daß sein transzendentaler Ansatz, in dem der vorneuzeitliche Vernunftbegriff eines vernehmenden Erfassens zugunsten der Vorstellung einer 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Ebd. Ebd. Ebd. Ebd. „Eine Folge davon ist, daß sich der Philosoph unter der Hand Erkenntnismöglichkeiten zubilligt, die er als vernunftkritischer Denker, der nur das reflexiv Ausweisbare in Anspruch nimmt, nicht haben kann. Kant macht sich etwa nicht klar, daß er sich einen quasi-göttlichen Einblick in das Verhältnis von einer erkennbaren Erfahrungswelt und einer vermeintlich unerkennbaren Welt an sich zugesteht. Wenn man solcherart Einträge in den philosophischen Diskurs unausgewiesen einbringt, weil man nicht reflexiv genug philosophiert, tangiert dies auch den Geltungsstatus der möglichen Ergebnisse dieses Diskurses.“ (Gronke 2001, S. 216 f.) Gronke 1999, S. 49 und Anm. 103. Kuhlmann spricht davon, „daß es überhaupt verheerend sei für ein Unternehmen, welches mit dem Dogmatismus endgültig abrechnen wolle, wenn es selbst des Dogmatismus bezichtigt werden könne.“ (Kuhlmann 1985, S. 306). Gronke 1999, S. 49 und Anm. 103. Kuhlmann 1985, S. 306. A.a.O., S. 308. Ebd. Ebd. A.a.O., S. 42 f. Vgl. Böhler 2001 c, S. 18. 46 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie leistenden, geltungskonstitutiven Vernunft zurückgedrängt wird, gegenüber Descartes’ noch von scholastischen Einflüssen durchwirktem Denken einen wesentlichen Denkfortschritt markiert.“139 III. Paradigma: Sprache Radikaler Skeptizismus als widersprüchliche Konsequenz aus der Kant-Kritik Die skeptischen Anfragen, gegen die man sich innerhalb der kantischen Vernunftvorstellung schwerlich eine schlagende Argumentation denken kann, sind wohl deutlich geworden. Überblicksartig kann gesagt werden, daß diese Erschütterung erneut einen Paradigmenwechsel einleitet und insofern vergleichbar ist mit dem Paradigmenwechsel zwischen klassischer Ontologie und Subjektphilosophie: „Wie der Universalienstreit im ausgehenden Mittelalter zur Entwertung der objektiven Vernunft, so hat im ausgehenden 19. Jahrhundert die Kritik an Introspektion und Psychologismus zur Erschütterung der subjektiven Vernunft beigetragen.“140 Aus dem nun mehrfach angeführten sprachreflexiven Ansatz ergibt sich, in welcher Richtung die Suche nach unhintergehbaren Fundamenten philosophischer Argumentation – die Suche nach ‚Skepsis-resistenten‘ Ergebnissen also – fruchtbar sein kann: im Bereich der Sprache selbst. Ihre Thematisierung als gewißheitsermöglichende Voraussetzung an Stelle der subjektiven Vernunft markiert den Übergang vom zweiten zum dritten Paradigma. „Mit der Verlagerung der Vernunft aus dem Bewußtsein in die Sprache als dem Medium, über das handelnde Subjekte miteinander kommunizieren, ändert sich die Erklärungsrichtung noch einmal. Die epistemische Autorität geht vom erkennenden Subjekt, das die Maßstäbe für die Objektivität der Erfahrung aus sich selber schöpft, auf die Rechtfertigungspraxis einer Sprachgemeinschaft über. Bis dahin ergab sich eine intersubjektive Geltung von Meinungen aus einer nachträglichen Konvergenz von Gedanken und Vorstellungen (...). Aber nach der linguistischen Wende gehen alle Erklärungen vom Primat einer gemeinsamen Sprache aus.“141 Dieser ‚linguistic turn‘ macht es möglich, so nun die These, das „Scheitern von Des-cartes’ und Kants transzendentalphilosophischen Ansätzen“142 zu überwinden. Könnte man nun auch ein anderes Modell vertreten, welches das Scheitern einfach hinnimmt? Also dem radikalen Skeptiker ‚nachgeben‘ und sich dessen Position des „skeptischen Relativisten, der die Möglichkeit einer absoluten Selbstrechtfertigung der Philosophie und einer rationalen Vernunftkritik bestreitet“143, zu eigen machen? Man würde also – von den bisherigen Erfolgen skeptischer Erschütterung ermuntert und im skeptischen Aufspüren ‚metaphysischer Reste‘ geübt – die These vertreten wollen, daß es unhintergehbare Wahrheit im Grunde genommen nicht gibt ebensowenig wie verläßliche Kriterien dafür. Zur Prüfung wollen wir kurz aus dem historischen Durchgang heraustreten und aufzeigen, daß diese Argumentationsweise sich nicht wirklich vertreten läßt, weil sie sich nicht widerspruchsfrei äußern, ja nicht einmal denken läßt. Dietrich Böhler legt – wie viele seiner 139 140 141 142 143 Gronke 1999, S. 42 f. Habermas 1999, S. 243 f. Ebd. Gronke 1999, S. 52. A.a.O., S. 70. 47 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Mitstreiter auch in diesem Band – überzeugend dar, warum es nicht möglich ist, diese Position in einem aktuellen Dialog mit sinnvollen Argumenten zu vertreten. Dies kann dem so auftretenden Skeptiker anhand seiner eigenen Praxis, in der er sich – diese Auffassung äußernd oder denkend – befindet, gezeigt werden. In Dietrich Böhlers Beitrag zum Sammelband ‚Zwischen Universalismus und Relativismus‘144 von 1998 heißt es: „Der Rückgang auf die notwendige, alles menschliche Tun und Lassen zumeist unausdrücklich begleitende, mithin für jeden erfahrbare und erkennbare MetaPraxis des Etwas-Behauptens, welche einen argumentativen Dialog eröffnet oder antizipiert, erschließt uns einen universalen ‚Grund der Verbindlichkeit‘ (Kant) und damit zureichende Kriterien für die Suche nach dem Wahren und Richtigen.“145 Denn diese unhintergehbare Meta-Praxis begleitet eben auch das Tun und Lassen des Skeptikers – erst recht, wenn er versucht, irgendeine Position (zum Beispiel eine skeptische) zu vertreten. Und dies kann dem Skeptiker gezeigt werden, in dem er „in einen dialogreflexiven Test verwickelt“146 wird. Darin wird der Skeptiker erstens „auf die aktuelle Dialogsituation hingewiesen (...), in die er – sich selbst und uns gegenüber – bereits eingetreten ist (...)“; dann wird zweitens „diese Dialogsituation mit seiner Meinung, seinen Aussagen, konfrontiert“; und drittens wird „geprüft (...), ob diese Aussagen von uns, in der Rolle argumentativer Dialogpartner, jetzt als Dialogbeitrag ernst genommen und dementsprechend mit einer begründbaren Rede (einem sinnvollen Dialogbeitrag) beantwortet werden könnten.“ Daß Dietrich Böhler im Zusammenhang mit diesem Modell der Skeptikerwiderlegung147 auf Kant verweist, hat trotz der oben gemachten Kritik an Kants theoretischer Einstellung seine Berechtigung – denn sein Ansatz, der für die Frage nach Wahrheit ja Kriterien wie Allgemeinheit und vernunftgemäße Prüfbarkeit heranzieht, läßt sich sprachlich transformieren. Wie dies möglich ist, zeigt in überzeugender Weise schon die Kant-Kritik des Charles Sanders Peirce. Dessen „Konzeption der Konsensbildung in der ‚Gemeinschaft der Wissenschaftler‘“148 ersetzt die kantische theoria-Einstellung und zugleich den Solipsismus der Subjektphilosophie. Die solipsistisch vorgestellte Gewißheit des Einzelsubjekts wird abgelöst durch die „Experimentier- und Interpretationsgemeinschaft (...) als Konkretisierung des transzendentalen Subjekts bei Kant“149. Wahrheit ist das, worüber in dieser Instanz sich „Konsens in methodisch kontrollierbarer Form herstellen“150 ließe. An die Stelle der von Kant vorgestellten Einheit von Bewußtseinsinhalten tritt „semantische Konsistenz einer intersubjektiv gültigen ‚Repräsentation‘ der Objekte durch Zeichen, die nach Peirce freilich erst in der (...) Dimension der Interpretation der Zeichen entschieden wird.“151 144 145 146 147 148 149 150 151 Böhler 1998. Böhler 1998, S. 136. Dies und die folgenden Zitate: Böhler 2001 a, S. 51. In welcher sprachlichen Gestalt dieser Dialog mit dem Skeptiker im einzelnen ablaufen könnte, dazu Beispiele bei Gronke 1999, S. 93-96 mit dem Verweis auf Wolfgang Kuhlmann (1993): Bemerkungen zum Problem der Letztbegründung. In: Alexander Dorschel u.a. (Hg.): Transzendentalpragmatik. Frankfurt a. M., S. 233-327; und bei Brune 1995, S. 69-73. Apel 1973 Bd. I, S. 12. Ebd. Ebd. Apel 1973 Bd. II, S. 169. 48 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Transformation Kants am Anfang der ‚Transformation der Philosophie‘ Wenn zunächst nur von einer ‚ersetzenden‘ Vorstellung oder ‚Ablösung‘ der kantischen Vernunftinstanz die Rede ist, dann wird damit der Erkenntnisfortschritt noch nicht deutlich genug. Er liegt darin, daß skeptische Kritik an diesem Modell der ‚indefinite community of investigators‘ keinen Ansatzpunkt mehr findet; denn der Kritiker muß, um Kritik an ihm vorzubringen, selbst diese Instanz in Anspruch nehmen – denn genau ihr gegenüber müßte die Kritik des Skeptikers verständlich sein, will er sich überhaupt nur theoretisch die Möglichkeit offen halten, gegebenenfalls bessere Argumente zu haben. Die unbegrenzte Gemeinschaft der Argumentierenden als ‚höchster Punkt‘ der Peirceschen Transformation Kants152 bedarf damit höchstens noch der Explikation, die Karl-Otto Apel so leistet: Darin „konvergiert das semiotische Postulat einer überindividuellen Einheit der Interpretation und das forschungslogische Postulat einer experimentellen Bewährung der Erfahrung in the long run. Das quasi-transzendentale Subjekt dieser postulierten Einheit ist die unbegrenzte Experimentier-Gemeinschaft, die zugleich die unbegrenzte Interpretationsgemeinschaft ist.“153 Im Rahmen dieser Konzeption läßt sich auch die problematische Unterscheidung von ‚Dingan-sich‘ und Erscheinungen verabschieden: An ihre Stelle „tritt in der sinnkritischrealistischen Transzendentalpragmatik die Peircesche Unterscheidung zwischen dem Realen als dem prinzipiell – in the long run – Erkennbaren einerseits und dem hier und jetzt faktisch Erkannten andererseits“154. Für den Übergang zum dritten Paradigma, dem Paradigma der Kommunikation, ist damit etwas Wichtiges geleistet, denn Peirces Auffassung kann ergänzt werden von der „kommunikationsbezogenen Auffassung der Sprache und des Denkens, (...) einer (transzendental-pragmatischen) Rekonstruktion der Bedingungen sinnvoller Rede und wahrheitsfähigen Argumentierens“155. Diese Transformation der Philosophie verändert die Zielrichtung philosophischen Denkens weg „von jedweder Betrachtung (bloße Beobachterperspektive, also subjekt- und dialogvergessen) hin zu einer aktuell dialogbezogen-sinnkritischen Reflexion auf sich und Andere als Partner des jetzigen Dialogs“156. Vollendet werden kann diese Transformation als Reflexion auf die Dialogizität von Sprache überhaupt, wobei sie im Rahmen deutschsprachiger Philosophie anknüpfen kann auch an „Wilhelm von Humboldts kaum rezipierte (mit Kant gegen Kant denkende) Einsicht: Sprechen als miteinander Sprechen und als Aktualisieren einer dualischen bzw. dialogförmigen Struktur der Sprache“157. Bedingung der Möglichkeit des Sprechens ist Humboldt zufolge „Anrede und Erwiderung“158; und dies „hat zur Folge, daß ein Sprecher die eigene Rede nur verstehen, mithin sie auch nur vorbringen kann, weil er immer schon in Erwartung und Erwartungserwartung des resp. der Anderen redet“159. 152 153 154 155 156 157 158 159 Vgl. A.a.O., S. 173. Ebd. Kuhlmann 1985, S. 25. Böhler 2001 c, S. 25. Ebd. Ebd. Wilhelm von Humboldt (1960): Über den Dualis. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Berlin (Akademie-Ausgabe). Bd. VI., S. 27. Zit. n. Böhler 2001 b, S. 168. Böhler 2001 b, S. 168. 49 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Sprachanalyse als Thema der Philosophie nach dem ‚linguistic turn‘ Insgesamt läßt sich der ‚linguistic turn‘ als der „Durchbruch der sprachanalytischen Philosophie zum beherrschenden Paradigma der Philosophie im 20. Jahrhundert“160 beschreiben. Das Verhältnis von Erfahrungssubjekt auf der einen und Welt auf der anderen Seite wird abgelöst: Das von der Gnosis bis Kant als einsames Subjekt gedachte Selbst „stellt sich nun als gar nicht absolut und nicht als autonomer Grenzpunkt der Welt heraus, sondern zeigt sich als realkommunizierender Akteur, der in Welt als einen Sozial- und Sinnzusammenhang von vornherein einbezogen ist“161. Die Beschäftigung mit diesen Kommunikationsprozessen wird zum vorherrschenden Thema der Philosophie. Sprache als Ausdruck dieses Zusammenhanges rückt in den Mittelpunkt philosophischer Analyse, was dazu führt, „daß die Sprache, die lange Zeit nur als ein – freilich stets besonderer – Gegenstand der Erkenntnis figurierte, nun endlich in die ihr eher gemäße Stelle einer entscheidenden subjektiven Erkenntnisvoraussetzung rückt (...). Statt mit zunächst nur privat zugänglich scheinenden ‚Tatsachen des Bewußtseins‘ hat die Analyse es nun mit öffentlich zugänglichen Strukturen von Zeichen und Sprache zu tun, was sowohl die Analyse selbst, wie auch ihre kritische Diskussion, ganz wesentlich erleichtert.“162 Zunächst gilt es, das Phänomen der Sprache zu differenzieren. Neben der semantischen und der syntaktischen Dimension der Sprache entdeckt die Analyse (z.B. bei Carnap und Morris163) die Bedeutung der dritten, der pragmatischen Dimension der Sprache. Hieraus resultiert die Rede von der pragmatischen Wende der (Sprach-)Philosophie; „Sprache ist jetzt etwas, das erst im Gebrauch durch Subjekte Bedeutung erhält; der Gebrauch (das kognitive Verhältnis des Sprechers zur Sprache) wird zentrales Thema unter Titeln wie ‚Was heißt es, einer Regel zu folgen‘ oder ‚How to do Things with Words‘.“164 Das Verständnis von Sprache als ‚Regelfolgen‘ hat am nachhaltigsten Ludwig Wittgenstein aufgebracht. Doch seine Bedeutung im Rahmen des ‚linguistic turn‘ ist insgesamt ambivalent. Denn in seinen frühen Schriften beschäftigte er sich zwar bereits mit Sprache, allerdings ganz und gar in theoretischer Einstellung – was ihn gegenüber skeptischer Kritik schwächt: „Der frühe Wittgenstein eröffnet die Bewegung mit der paradoxen Fassung einer Sprachkritik, welche ganz ausdrücklich für den Sprachkritiker selbst und seine kritischen Aktivitäten keinen legitimen Platz vorsieht.“165 Leitfaden des frühen Wittgenstein ist nämlich sein methodisch-solipsistisches Verständnis von Sprache166 – Wittgenstein ist dabei nicht klar geworden, daß er selbst ja als Kritiker und Argumentierender über Sprache als Regelfolgen zu uns, seinen Lesern spricht und somit bereits eine Meta-Ebene von Sprache in Anspruch genommen hat. Doch beim späten Wittgenstein wird dieser ‚logische Atomismus‘ (Apel) überwunden, indem der „neue Schlüsselbegriff des späten Wittgenstein: 160 161 162 163 164 165 166 Kuhlmann 1985, S. 16. Böhler 1985, S. 65. Kuhlmann 1985, S. 16 f. Daher ist es vielleicht eher zu verschmerzen, wenn das Folgende tendenziell wie eine historische „Nacherzählung“ einiger Stationen des dritten Paradigmas wirkt und zuweilen weniger wie eine gründlich-kritische Würdigung. Vgl. Kuhlmann 1985, S. 17. A.a.O., S. 18. A.a.O., S. 17. Darin „war die Funktion der intentionalen Ausdrücke wie ‚meinen‘ als etwas aufgefaßt, das man nicht selbst wieder meinen, d. h. als etwas ‚bezeichnen‘ kann; ihre Funktion sollte identisch sein mit dem Meinen, d. h. der Bezeichnungsfunktion überhaupt.“ (Apel 1973 Bd. II, S. 71) 50 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie der Begriff des ‚Sprachspiels‘ oder besser gesagt: der ‚Sprachspiele‘“167aufkommt. Dieses Modell ist leistungsfähig zur Illustration der logischen Verbindung von „Handlungssinn und sozialem Handlungskontext“168: Der Sinn einer konkreten Handlung läßt sich nur dann verstehen, wenn auch die Lebenspraxis, auf die die Handlung bezogen ist, bereits – mindestens teilweise – mitverstanden wird. „Ein Akteur muß immer schon ein wie immer unvollständiges Wissen haben, so daß er sich im Totum eines Handlungszusammenhangs (...) in gewisser Weise auskennt, wenn er eine bestimmte Handlungsweise (...) als Handlungsweise einer sozialen Praxis soll richtig verstehen und anwenden können.“169 Wittgenstein überwindet aber niemals vollständig – dies muß als entscheidendes Defizit festgehalten werden – die Aporie seiner Frühschriften, die er sich einhandelt, weil „die Stelle des Zeicheninterpreten, die Stelle des zeichenverwendenden Subjekts, entweder ganz leer bleibt oder nur – halbherzig – im Sinne der empirischen Pragmatik besetzt wird.“170 Wittgensteins Kritik an der klassischen Sprachauffassung und Aufhebung dieser Kritik: Doppelte Dialogizität Zwar wird diese Leerstelle auch vom späten Wittgenstein nicht ausgefüllt; im Rahmen einer auf den Zusammenhang philosophischer Paradigmen konzentrierten Untersuchung ist Wittgenstein dennoch zu würdigen. Denn in Absetzung zu traditionellen Sprachvorstellungen lassen sich die von (oder zumindest mit) Wittgenstein errungenen Fortschritte erkennen: Mit seinen ‚Philosophischen Untersuchungen‘ vollendet er die Kritik des „seit Aristoteles die Sprachlogik beherrschenden Denkmodells“, welches naiv angenommen hatte, „daß die Wörter der Sprache ihre ‚Bedeutung‘ dadurch haben, daß sie ‚etwas bezeichnen‘, und (...) daß die Wörter ‚Namen‘ für ‚vorhandene Dinge‘ oder ‚Gegenstände‘ sind“171. Wittgenstein verabschiedet nun diese Vorstellung ebenso nachhaltig wie das augustinische Modell, Kinder würden sprechen lernen, indem sie die durch die Eltern vorgesagten Bezeichnungen für Gegenstände (auf die diese dabei hinweisen) nachahmen. Dieses Modell hatte nämlich übersehen, „daß ein Kind, das zum erstenmal die Sprache erlernt, hinweisende Erklärungen noch gar nicht verstehen kann, da es weder über eine strukturelle Artikulation der Welt schon verfügt, die ihm sagt, was jeweils durch einen Hinweis gemeint ist (ob z.B. die Farbe oder Form oder Art oder Zahl), noch die Funktion des zu erklärenden Wortes in der Sprache, seine Verwendung, schon kennt. Eine hinweisende Erklärung von Namen versteht nach W[ittgenstein] nur der, ‚der schon etwas mit ihr anzufangen weiß‘ (...).“172 Wittgenstein macht also auf bislang nicht berücksichtigte Voraussetzungen des eingeschränkten Sprachspiels Benennung von Gegenständen aufmerksam und weist es aus als „‚defizienten Modus‘ derjenigen Sprachspiele (...), in denen Kinder zugleich mit der Erlernung ihrer Muttersprache auch eine bestimmte Lebensform und ein bestimmtes strukturell artikuliertes Verständnis der Welt als Situation der Lebenspraxis sich aneignen“173. Und da ohne diese fundierenden Bezüge zu bestimmter Lebensform und -praxis kein Erlernen von Sprache 167 168 169 170 171 172 173 Apel 1973 Bd. II, S. 71. Böhler 1985, S. 202. Ebd. Kuhlmann 1985, S. 25. Apel 1973 Bd. I, S. 253. A.a.O., S. 261 mit Verweis auf Wittgenstein, Phil. Unters. § 31. A.a.O., S. 262. 51 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie denkbar ist, kommt so die Kritik an Augustins174 „apragmatischer, nämlich instrumentalistisch gegenstandstheoretischer und methodisch solipsistischer Sprachauffassung“175 zum vorläufigen Abschluß. Die Reichweite dieses Sprachverständnisses auch beim späten Wittgenstein erweist sich indessen, wie oben angedeutet, aufgrund der unaufgeklärten Irreflexivität als begrenzt. Dieses Defizit arbeitet Audun Øfsti auf, indem er zeigt, daß das Sprachspielmodell nicht geeignet ist, um das Ganze einer Sprache abzubilden. Øfsti ergänzt damit Erkenntnisse der sprachanalytischen Philosophie. Diese zeigt die „Doppelstruktur der Rede“176 aus performativem und propositionalem Teil als denknotwendig: Aussagen können nur verständlich sein, „weil sich die Sprecher immer schon und unvermeidlich in eine performative Distanz zu ihnen bringen, indem sie für sie Geltung beanspruchen. So hat jeder, der etwas [und damit propositionalen ‚Inhalt‘, T.L.] behauptet, weil seine Behauptungshandlung Geltung (mögliche Wahrheit bzw. Richtigkeit) für die Aussage unterstellt [und zwar den Anderen, den Adressaten seiner Behauptungshandlung gegenüber – hierdurch kommt die Performativität ins Spiel, T.L.], die Ebene des argumentativen Dialogs betreten und dadurch bereits die Rolle eines Dialogpartners auf sich genommen.“177 Øfstis Erweiterung zur doppelten Doppelstruktur weist nun darauf hin, daß mit dieser Doppelstruktur stets auch die Bezugsmöglichkeit auf diese einhergeht: Wir können auf diese Doppelstruktur noch einmal reflektieren und diese Reflexion explizieren. Also sei es doch richtiger, so Øfsti, von einer doppelten Doppelstruktur der Rede zu sprechen, um das Ganze einer Sprache ausdrücken zu können: „Notwendig für eine vollständige Sprache und Kommunikationskompetenz ist die doppelte Reflexivität der performativ-propositionalen Äußerung und des Stellungnehmenkönnens zu solchen Äußerungen.“178 Nun ist nach dieser Präzisierung noch einmal an die Geltungsansprüche, die wir mit dem Vorbringen einer Äußerung zugrunde legen, zu erinnern. Da „das Vorbringen und das Erläutern einer Äußerung wiederum die Form von Dialogbeiträgen hat, deren Geltungsansprüche mit der Anerkennung anderer als gleichberechtigter Argumentationspartner etc. verwoben sind“, schlägt Böhler vor, „diese doppelte dialogbezogene Doppelstruktur ‚doppelte Dialogizität der Kommunikation‘ oder ‚doppelte Dialogstruktur der Sprache‘ zu nennen“179. So ist das dritte Paradigma der Philosophiegeschichte vollständig entfaltet, indem die „betrachtende (theoretische bzw. analytische) Einstellung“ verlassen worden ist und statt dessen die Besinnung „auf den jeweiligen Dialog und die Dialogpartnerrolle“180 durchgeführt wird. Die zutage tretenden Bestimmungen der Sprache lassen sich dabei als Differenzierungen der Voraussetzungen verstehen, die mit sinnvollen Äußerungen einhergehen. Um zu prüfen, ob sie skeptischen Anfragen standhalten, können wir sie dem sinnkritischen Test unterziehen: Lassen sich sinnvolle Argumente finden – also Argumente, die sich vom Skeptiker vorbringen lassen, ohne daß er damit selbstwidersprüchlich die Vorbedingungen bestreitet, die er als Argumentierender anerkennen muß –, die die vorgebrachten Thesen bestreiten? Dann müssen diese Thesen verworfen werden. Zeigt sich 174 175 176 177 178 179 180 Z.B. in Confessiones I, Kap. 8. Böhler 2001 c, S. 26. Böhler 2001 a, S. 29 mit Verweis auf Habermas 1991. Böhler 1998, S. 134 f. Böhler 2001 c, S. 26 a. Böhler 2001 a, S. 33 in Anknüpfung an Audun Øfsti (1994): Abwandlungen. Essays zur Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie. Würzburg, S. 139-147, 166-181. Böhler 2001 c, S. 27. 52 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie dagegen, daß sich keine Argumente finden lassen, ja daß keine sinnvoll gedacht werden können, die diesem Sinnkriterium standhalten, dann können die Thesen als bestätigt gelten.181 Dieser sinnkritische Test kann auch Anwendung beispielsweise für diesen Durchgang durch die Philosophiegeschichte finden – und dabei die Frage klären helfen, welche Erkenntnisse der einzelnen Argumentationsweisen und Konzeptionen jeweils als entscheidende (und zu bewahrende) Denkfortschritte gegenüber vorherigen Modellen Gültigkeit beanspruchen können. So kann eine kritisch-logische Einschätzung dieser paradigmatischen Entwicklungen erreicht werden, die mehr und anderes als ihre historische Rekonstruktion182 zu leisten vermag. Analog lassen sich Fehlentwicklungen – sozusagen Sackgassen im ‚Labyrinth der Ideen‘183 – aufdecken, wie Dietrich Böhler es formuliert: „Seit Augustin kommt ein philosophischer Individualismus auf, seit Kant ein transzendentaler Solipsismus, der voraussetzt oder behauptet, einer könne für sich allein (solus ipse) Sinn und Gültigkeit haben. Darin sehe ich das, erst dank KarlOtto Apels gemeinschafts- und diskursbezogener ‚Transformation der Philosophie‘ überwundene, próton pseūdos der abendländischen Bildungstradition, ihren elementaren Denkfehler. Er ist der hohe Preis, den die abendländische Philosophie für ihre vielleicht größten Errungenschaften, die Begründung des kritischen, Vorgegebenes distanzierenden Denkens und der freien, selbständig urteilsfähigen Person, hat entrichten müssen.“184 Ob und inwieweit dieser Preis unvermeidlich ist, kann die dialogreflexive Sinnkritik aufweisen, deren kritische Prüfung und Aneignung philosophischer Paradigmen man in Dietrich Böhlers Seminarpraxis erlernen kann. Literatur Apel, Karl-Otto (1973): Transformation der Philosophie. Bd. I: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik; Bd. II: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt a. M. Ders.; Böhler, Dietrich; Kadelbach, Gerd (Hg.) (1984): Funk-Kolleg Praktische Philosophie / Ethik: Dialoge. 2 Bde. Frankfurt a. M. Ders.; Böhler, Dietrich; Rebel, Karl-Heinz (Hg.) (1984): Funk-Kolleg Praktische Philosophie / Ethik: Studientexte. 3 Bde. Weinheim. Ders.; Burckhart, Holger (Hg.) (2001): Prinzip Mitverantwortung. Grundlage für Ethik und Pädagogik. Würzburg (zit.: Prinzip Mitverantwortung). Böhler, Dietrich (1985): Rekonstruktive Pragmatik. Von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationsreflexion. Frankfurt a. M. Ders. (1998): Dialogbezogene (Unternehmens-)Ethik versus kulturalistische (Unternehmens)Strategik. Besteht eine Pflicht zur universalen Dialogverantwortung? In: Horst Steinmann, Andreas Georg Scherer (Hg.): Zwischen Universalismus und Relativismus. Philosophische Grundlagenprobleme des interkulturellen Managements. Frankfurt a. M., S. 126-178. 181 182 183 184 Ebd. Micha Werner zeigt beispielhaft, wie fruchtbar mit diesem Kriterium im Hinblick auf bestimmte Probleme gearbeitet werden kann und welche Beschränkungen zu berücksichtigen sind. (Micha Werner 2001: „Who counts“, in: Marcel Niquet u.a. (Hg.), Diskursethik. Grundlegungen und Anwendungen. Würzburg, S. 265-292. Die Tatsache, daß hier und im zugrundeliegenden Seminarprogramm Dietrich Böhlers Paradigmen und Philosophen grosso modo entsprechend der historischen Abfolge behandelt werden, hat dementsprechend primär einen pädagogischen Grund – so läßt sich eine (natürlich sehr schematische) Systematisierung wichtiger Strömungen der Philosophiegeschichte vermitteln, die spätere Einordnungen erleichtert. Dieser Erkenntnisfortschritt wurde von den Teilnehmern des Seminars in einer Evaluierung am Ende des Semesters als besonderer wertvoll gewürdigt. Vgl. Böhler 2001 c, S. 1. Böhler 2001 b, S. 154. 53 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Ders. (1999): Gnosis. Existentialismus und Hermeneutik der Entmythologisierung. Interdisziplinäres Seminar zu Hans Jonas [Seminarprogramm Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin]. Typoskript. Ders. (2001 a): Warum moralisch sein? Die Verbindlichkeit der dialogbezogenen Selbst- und Mitverantwortung. In: Prinzip Mitverantwortung, S. 15-67. Ders. (2001 b): Bildung zur dialogbezogenen Mitverantwortung. Zweckrationales und dialogethisches ‚Lernen des Lernens‘. In: Prinzip Mitverantwortung, S. 147-176. Ders. (2001 c): Leitfaden zum Proseminar 16015 ‚Sein, Selbst-Bewußtsein, Kommunikation. Grundkurs klassische Texte und Probleme der Philosophiegeschichte.‘ Institut für Philosophie der Freien Universität Berlin. Typoskript. Ders.; Gronke, Horst (1994): Diskurs. In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Tübingen. Bd. II, Sp. 1256-1298. Brune, Jens Peter (1995): Setzen ökonomische ‚Sachzwänge‘ der Anwendung moralischer Normen legitime Grenzen? In: Ders., Dietrich Böhler, Werner Steden (Hg.): Moral und Sachzwang in der Marktwirtschaft ( = Ethik und Wirtschaft im Dialog VIII). Münster, S. 1-114. Gronke, Horst: (1999): Das Denken des Anderen. Führt die Selbstaufhebung von Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität zur transzendentalen Sprachpragmatik? Würzburg. Ders. (2001): Was können wir im philosophischen Diskurs lernen? Elemente einer sokratischen Pädagogik. In: Prinzip Mitverantwortung. S. 203-226. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1986): Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III. In: Ders.: Werke in 20 Bänden, Bd. XX. Frankfurt. Habermas, Jürgen (1991): Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt a. M. Ders. (1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Philosophie. Frankfurt a. M. Ders. (1999): Wahrheit und Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer Wende. In: Ders.: Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze. Frankfurt a. M., S. 230-270. Jonas, Hans (1999): Gnosis. Die Botschaft des fremden Gottes. Hg. von Christian Wiese. Frankfurt a. M./Leipzig. Kant, Immanuel (1959): Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Originalausgabe, hg. v. Jens Timmermann. Hamburg. Kuhlmann, Wolfgang (1985): Reflexive Letztbegründung. Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik. Freiburg/München. Kuhn, Thomas (1962/1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Chicago/Frankfurt a. M. Menge, Hermann (221953): Langenscheidts Taschenwörterbuch der griechischen und der deutschen Sprache. Berlin. Platon: Kriton. Nach der Übersetzung von F. Schleiermacher. In: Platon. Sämtliche Werke Bd. I. Hg. von Walter F. Otto, Ernesto Grassi, Gert Plamböck. Hamburg 1959, S. 33-47. Ders.: Sophistes. Nach der Übersetzung von F. Schleiermacher. In: Sämtliche Werke Bd. IV., S. 183244. Ders.: Timaios. Nach der Übersetzung von F. Schleiermacher. In: Sämtliche Werke Bd. V., S. 141-213. Religion in Geschichte und Gegenwart (=RGG). Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft (31957). Hg. von Kurt Galling in Gem. mit Hans Frhr. v. Campenhausen; Erich Dinkler, Gerhard Gloege, Knut Løgstrup. Tübingen. Rorty, Richard (1981): Der Spiegel der Natur. Eine Kritik der Philosophie. Frankfurt a. M. Schnädelbach, Herbert (1985): Philosophie. In: Ekkehard Martens, Herbert Schnädelbach (Hg.): Philosophie. Ein Grundkurs. Reinbek. Windelband, Wilhelm; Heimsoeth, Heinz (151957): Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen. 2.2 Nach der Lektüre: Fragen an D. Böhler und dessen Antworten. 54 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 55 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie III Grundlagen: Diskurs als argumentativer Dialog – systematisch und philosophiegeschichtlich erörtert. 3.1 Die drei philosophischen Paradigmen und die wiedergängerische Rhetorik. Wir fragen nach den Sinnkriterien des philosophischen Diskurses. Im Blick auf diese Frage können wir die Etappen der Philosophiegeschichte teleologisch, vom Zielpunkt her, darstellen und kritisch prüfen. Als internes Entwicklungsziel nehmen wir eine zustimmungswürdige, argumentativ konsensfähige Selbsteinholung der Philosophie an, der Philosophie als Sachwalterin des einsehbar Allgemeinen, des Logos. Die Philosophie soll das einholen können, was sie beim Philosophieren in Anspruch nehmen muß. In einer solchen Selbsteinholung liegt die Selbstverantwortung der Philosophierenden. Verantwortlich sind sie in erster Linie für die Klärung des Diskursphänomens, zu dem ihre Denkpraxis gehört, und die Sorge für eine Übereinstimmung ihrer Thesen mit den Grundlagen der kommunikativen Praxis des Diskurses. Die Klärung betrifft das Diskursphänomen in seinen verschiedenen Erscheinungen: elementar als Begleitphänomen aller Formen und Ausdrucksweisen menschlichen Lebens, kultiviert und differenziert sowohl als Medium und Geltungsinstanz der gesellschaftlichen bzw. politischen Kultur wie auch als Medium und Geltungsinstanz der Wissenschaften und der Philosophie selbst. Diese Klärung, hier nur im kursorischen Überblick zu leisten, ist zunächst eine Rekonstruktionsaufgabe und dann die Sache einer selbstkritischen Prüfung der Rekonstruktionsergebnisse, eine Geltungsreflexion. Letztere ist erforderlich, wenn die Philosophie diejenigen Voraussetzungen begründen (und dadurch verantworten) soll, die sie selbst in Anspruch nimmt, wofern sie sich – seit Sokrates, Platon und Aristoteles – als Sachwalterin des Logos und damit als die erste Wissenschaft versteht, als die Grundlegungswissenschaft. Kraft einer Reflexion in dem strittigen Diskurs, in dem sich ein Philosoph mit seinen Thesen gerade befindet, auf die Sinnvoraussetzungen bzw. Geltungsbedingungen jedes argumentativen Diskurses, müssen die Philosophierenden erweisen können, daß sie mit dem argumentativen Diskurs ein kommunikatives und moralisch 56 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie bindendes Verhältnis mit allgemeingültigen Regeln und Grundnormen in Anspruch nehmen: das Argumentieren überhaupt, welches immer schon eine Sache des Erkennens und des gesollten Wollens ist, eine logische und moralische Verbindlichkeit. Die logische Verbindlichkeit des Argumentierens hängt an seinem Ziel, Wahrheitsansprüche einzulösen, indem auf konsistente Weise gute Gründe für eine These erarbeitet werden, so daß sich ein einsehbar Allgemeines ergibt. Damit verwoben ist eine mögliche moralische Verbindlichkeit für praktische Urteile und konkrete Normen: eine verallgemeinerbare Gegenseitigkeit, so daß auch alle Betroffenen, sofern sie den Diskurs konsequent als Argumentationspartner mitvollziehen, dem Urteil oder Normenvorschlag zustimmen würden. Insofern es den Philosophen gelingt, die internen normativen Grundlagen des argumentativen Diskurses als dialogischer, mithin logisch und moralisch verbindlicher Praxis zunächst aufzudecken, nämlich zu rekonstruieren, und sie dann reflexiv zu erweisen, haben sie die Basis dessen eingeholt, was wir „Philosophieren“ nennen. Sie haben dann erkannt und demonstriert, worauf sich jeder, der sich und anderen etwas verständlich machen und uno actu zur Geltung bringen will, bereits eingelassen hat: die Rolle eines Partners im argumentativen Dialog, der auf das logisch Allgemeine und auf die verallgemeinerbare Gegenseitigkeit als Ziel verpflichtet ist. So ergibt sich das interne Entwicklungsziel des Diskursbegriffs durch Reflexion auf die Diskurspraxis selbst. Es ist zuvörderst die Erkenntnis der konstitutiven Regeln und Normen des Dialogs der Argumente, sodann deren Berücksichtigung und Befolgung in der je besonderen Philosophie, Theorie oder auch Lebenskunst. Im Blick auf dieses Telos können wir die unterschiedlichen Beiträge zur Entfaltung dieses Grundbegriffs allen Denkens zwanglos interpretieren und kritisch beurteilen: als einen Fortschritt oder eine Regression, oder auch als beides in verschiedener Hinsicht. Darin sehe ich den kriteriologischen Kern einer philosophischen, reflexiv argumentierenden Begriffsgeschichte und einer Theorie des Diskurses, die auch die praktischen Diskurse einschließt, mithin die moralische Urteilsbildung. Eine solche entwicklungslogisch angelegte, kritische Begriffsgeschichte ist ein Spiegel des Geistes. Historisch zunächst ein Geistesspiegel Europas, kann sie logisch und ethisch ein Geistesspiegel aller Denkenden sein. Warum? Der Geistesspiegel Diskurs ist für alle möglichen Thesen und Fragen offen, über die sich mit Argumenten streiten läßt. Die Idee dieses friedlichen Streits, die Auseinandersetzung allein mit Argumenten, hat im Athen des fünften vorchristlichen Jahrhunderts nicht bloß Schule gemacht, sondern eine neue Kultur des Miteinander-Denkens und Miteinander-Streitens ermöglicht. Deren Urbild ist der Sokratische 57 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Dialog als Institution des Gründe-Gebens, des λόγον διδόναι (logon didonai). Denn Sokrates sucht nach dem geltungslogisch Allgemeinen, nach Wahrheit und richtiger Definition, und führt diese Suche in Form eines dem Gerichtsverfahren entlehnten έλεγχος (elenchos) durch. Daraus entwickelte sich in Europa das Paradigma kritischer Vernunft, in dem die Gerichtshofmetapher – am pointiertesten in Kants „Kritik der reinen Vernunft“185 – eine ausgezeichnete Rolle spielt. Dank seiner Kritik eines Scheinwissens, das unfähig ist, die naiv behaupteten Interessen und Meinungen als Geltungsansprüche einzulösen, und dank seiner Aufnahme juridischer Verfahrenselemente weist der Sokratische Dialog über sich hinaus auf ein kommunikatives Verständnis von „Kritik“ und „Vernunft“, von „Geltung“ aus Gründen und „Gewißheit“ durch Rechtfertigung. Bis auf die Gegenwart nur unterschwellig wirksam oder gar, wie bei Descartes, solipsistisch ausgeklammert, blieben freilich der egalitär kommunikative Verständigungsaspekt und die dialogische Ethik des Diskurses, obzwar beide in Platons sokratischen Dialogen angelegt sind – schon und noch. Das „Noch“ verweist auf die ontologische und ideentheoretische Verdeckung, ja Überformung der freien Verständigung unter Gleichberechtigten und ihrer gemeinsamen moralischen Basis als Dialogpartner: Der Seinstheologe Platon verdrängte den argumentativen Dialog zunehmend durch eine kontemplativ spekulative Wesensschau, die theoria. Ineins damit überformte er den, in Dialogen wie „Apologie“, „Kriton“, „Gorgias“ und „Thrasymachos“ spürbaren, Ansatz einer sokratischen Moralbegründung, nämlich eine dialogische Besinnung auf normative Grundlagen des Denkens. Denn er zwängte den Sokratischen Richtungsstoß zu einem Denken aus dem Dialog in den undialogischen Rahmen einer Seinsschau – einer geistigen Schau des Ganzen und seines Urgrundes. Diesen bestimmte er als das ewig in sich ruhende Gute und Eine. Den Dialogansatz des Sokrates, dessen konsequente Durch- und reflexive Weiterführung ein Denken jenseits einer uneinholbaren Metaphysik erlaubt hätte, ersetzte Platon durch eine ungeschichtlich denkende, spekulative Kosmostheologie. Aus seiner Deutung des göttlichen Kosmos leitete er dann die höchsten Werte und deren normative Gehalte ab – naturalistischer Fehlschluß im Rahmen eines spekulativen Intellektualismus? Platon stellt eine erste Weggabelung unter mehreren dar, die uns vor die Alternativfrage stellen: Wie hätte sich das europäische Denken – hier: nach Sokrates – entwickeln können? Und wie würde es sich im Sinne einer Entwicklungslogik entwickelt haben, wenn Platon und 185 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (zit.: KrV), A XI f; B 697, 767 f, 779f. 58 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie auch sein eigenwilliger Schüler Aristoteles schon reflexiv dialogisch gedacht hätten? Das ist keine müßige rückwärtsgewandte Perspektive. Kraft einer Entwicklungslogik kann die Frage fruchtbare Gedankenexperimente eröffnen, die uns über unsere eigenen Traditionsabhängigkeiten aufklären und uns emanzipatorische Anstöße geben mögen. Eine aufregende Sache. Um sie zu betreiben, versuche ich in dieser Einleitung, die Darstellung stets mit der Auseinandersetzung, die Hermeneutik mit der Kritik zu verbinden. So nämlich, daß wir Zeitgenossen unser Denken wirkungsgeschichtlich in dem der Tradition spiegeln und das der Tradition kritisch mit den Geltungsansprüchen des argumentativen Diskurses konfrontieren. Jene Alternativfrage weist uns einerseits auf das Abenteuer der faktischen europäischen Ideengeschichte hin; andererseits eröffnet sie die Perspektive einer Entwicklungslogik, welche die unverzichtbaren Elemente einer Selbstaufklärung des Denkens als Stufen seiner Selbsterkenntnis aufeinander aufbauen würde. Die Alternativfrage provoziert dazu, derart mit und gegen die tatsächliche Philosophiegeschichte zu denken, daß sich die faktische Genese der Diskursidee mit ihrer normativen Rekonstruktion verbindet: die Frage danach, wie es in der Geistesgeschichte wirklich vor sich gegangen ist, mit der Frage, wie sich die Diskursidee konsequenterweise entwickelt hätte. 3.2 Die Glaubwürdigkeit des Diskurspartners: Sinnkriterium für Diskursbeiträge und Kern der moralischen Identität. In Platons „Kriton“ gibt Sokrates, von seinen Schülern und Freunden zur Flucht aus der Todeszelle gedrängt, eine Antwort, die ihn als glaubwürdigen Mann des kritischen Diskurses berühmt gemacht und sein Selbstverständnis auf eine eingängige Maxime gebracht hat. Man kann sie den Logos-Grundsatz nennen, formuliert sie doch ein Kriterium sowohl für die Diskurspraxis, das λογίζεσθαι (logízesthai), als auch für den lebenspraktischen Umgang mit Diskursergebnissen. Der Satz heißt: „Denn nicht erst jetzt, sondern immer schon habe ich (I) es so gehalten, daß ich (II) nichts anderem in mir (I) gehorche als dem lógos (Rede, Argument), der sich mir (II) in der Argumentation als der beste gezeigt hat."186 186 Platon, Kriton, 46 b. 59 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 3.2.1 Der Logosgrundsatz oder: verallgemeinerbaren Gegenseitigkeit. Sokrates’ Vorwegnahme und Verfehlung der Präzise verständlich ist diese Aussage erst, wenn man klärt, was das „Ich“ des Sprechers jeweils bedeutet. Die erste Person kommt hier offenbar in zwei verschiedenen Hinsichten ins Spiel: einerseits als das biographische Ich (I) des Menschen mit Namen Sokrates, der sein individuelles Leben im Athen des späten 5. Jahrhunderts vor Christus lebt, bestimmte Werte vertritt und seine eigenen Meinungen hat, andererseits als das Stellung nehmende, argumentationsbezogene Ich (II) desselben Sokrates, der sich freilich ausdrücklich auf das Argumentieren im Dialog eingelassen hat, mithin nur nach dem besten Argument sucht. In der Tat, geltungslogisch und diskurspragmatisch betrachtet, nimmt Platons Text bzw. die Selbstaussage des Sokrates für die Form des sokratischen Elenchos zwei Rollen in Anspruch: die alltägliche Rolle dessen, der etwas meint, behauptet und will (Ich I), und die DiskursRolle dessen, der allein sinnvolle Argumente, einsichtige Gründe, gelten lassen will (Ich II). Das Bild, das uns Platon von Sokrates vermittelt, wodurch er im Abendland und in Europa zum Vorbild geworden ist, entsteht aus der Harmonie dieser beiden Rollen. Im „Gorgias“ spielt Sokrates auf deren praktische Einheit in seiner Person an, was sein Gesprächspartner, der Selbstbehaupter Kallikles, als unnatürlich empfindet, als philosophische Verrücktheit. Sokrates sagt dort: „Es wäre besser für mich, daß meine Lyra oder ein Chor, den ich leitete, ganz falsch klänge, und daß noch so viele Menschen mit mir uneins wären, als daß ich, der ich Einer bin, nicht im Einklang mit mir selbst sein und mir [scil: , der ich der Philosophie obliege,] widersprechen sollte.“187 Es kommt hinzu, daß Sokrates diese Harmonie oder Einheit der Rollen auch im Verhältnis des argumentativen Diskurses zur Lebenspraxis gewahrt sehen will, als Einheit von Argumentieren und Handeln, was ja unsere „Kriton“-Stelle deutlich macht. Zu Recht? Machen wir die Probe, fragen wir uns: Können wir jemanden als glaubwürdigen Diskursteilnehmer (N.N. II) erachten und achten, der sich im Leben (N.N. I) nicht bemüht, dem Diskursergebnis, das er als den besten Logos erkennt (N.N. II), praktisch gerecht zu werden und es in die Tat umzusetzen (N.N. I)? In der Tat steht und fällt die Glaubwürdigkeit eines Diskursteilnehmers damit, daß er beide Rollen, die Lebens- und Meinungs-Rolle (Ich I) und die Diskurspartner-Rolle (Ich II) in 187 Platon, Gorgias, 482 b/c. 60 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Einklang bringt, indem er in der Praxis (Ich I) sich an das zu halten bemüht, was er im Diskurs (Ich II) als richtig erkennt.188 Diese zweite Voraussetzung bzw. implizite Einsicht des Sokrates mag man die sokratische Theorie-Praxis-Vermittlung nennen, postuliert sie doch eine Kohärenz von ‚Theorie’ und Praxis, besser: von Diskurs und praktischem Handeln. Da Sokrates das Streben nach Übereinstimmung von Diskurs und Lebenspraxis geradezu verkörpert, konnte er, wie mir scheint, durch die Jahrtausende als moralisches Vorbild anerkannt werden. Was ist es, das Sokrates, mit Karl Jaspers gesprochen, mit Recht zu einem „maßgebenden Menschen“ gemacht hat,189 wenn nicht die Permanenz dieses Strebens? Für den Diskursbegriff wie für die Diskursethik kommt alles, aber auch alles, darauf an, die ursprünglich sokratische Idee der stets anzustrebenden Einheit von Diskurs und Lebenspraxis einzuholen, sie durchzuhalten und fruchtbar zu machen. Anderenfalls entleert sich der Diskursbegriff, verliert seinen Verpflichtungsgehalt und damit seine ethische Orientierungskraft. Die Diskursethik löst sich dann in eine „Diskurstheorie“ (Habermas) auf, die zu keiner Verbindlichkeit mehr fähig ist, so daß ihr Diskursprinzip ‚D’ nur mehr den bescheidenen Stellenwert eines diskursinternen Geltungskriteriums für Diskursbeiträge bzw. für Normenvorschläge von Diskursteilnehmern haben kann. Das ist die Habermassche Konsequenz.190 Man muß sie ziehen, wenn man nicht sokratisch auf sich selbst als Diskurspartner reflektiert, sondern in bloß theoretischer Einstellung über Diskurse nachdenkt. Ethische Substanz und orientierungskräftige Verbindlichkeit gewinnt der Diskursbegriff allein durch eine Erschließung des sokratischen Erbes, die zunächst die Diskursvoraussetzungen rekonstruiert, um dann strikt dialogreflexiv zu fragen: was würde mit der eigenen Diskurspartnerrolle – mit ‚meiner’ Glaubwürdigkeit als Partner im argumentativen Dialog – passieren, wenn ‚ich’ die Gültigkeit und Verbindlichkeit einer solchen Voraussetzung in Zweifel ziehe? Der Begriff der Diskursglaubwürdigkeit und die Frage, was es bedeutet, sie zu gewinnen und zu bewahren, ist der (zugleich geltungslogische und moralische) Angelpunkt der „Diskurspragmatik“. So nenne ich die Selbstbegründung der Philosophie, weil die Philosophie in erster Linie ein Diskurs ist, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das Philosophieren spielt sich zuallererst als Argumentieren und als Rechenschaftslegung über eine jeweils geleistete Argumentation ab und schließlich als Besinnung auf die unverzichtbaren Grundlagen bzw. notwendigen Bedingungen des Argumentierens überhaupt. 188 189 190 Dazu meine, an Hannah Arendts Sokratesinterpretation angelehnte, diskurspragmatische Rollenanalyse: D. Böhler, Warum moralisch sein? (2001), bes. S. 42-51. K. Jaspers, Die großen Philosophen. Erster Band, München/Zürich 1988, S. 105-127. J. Habermas, Moralbewußts. u. kommunik. Handeln (1983), S. 103ff. 61 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Dieser faktisch oder natürlicherweise zuletzt getane Diskursschritt hat den ersten Rang, weil er die Voraussetzungen ans Licht bringt, von denen alles Philosophieren getragen wird: die logischen Regeln des Argumentierens, dessen dialog-ethische Normen. Diese aufzudecken, zu rekonstruieren, und alsdann die einzelnen Resultate der Rekonstruktion, und zwar jedes für sich („X ist eine Sinnbedingung des Argumentierens“), in einem reflexiven Dialog als nicht sinnvoll bezweifelbar zu erweisen – darin besteht das Geschäft der Diskurspragmatik. Sie ist eine zweistufig verfahrende Selbstbegründung der Philosophie: Eine Selbsteinholung ihre und tragenden eine Bedingungen kritische, durch aufdeckende den Zweifel bzw. an explizierende den eigenen Rekonstruktionsannahmen hindurchgehende, Selbstverantwortung. Sie versucht zunächst, die eigenen Sinn- und Geltungsvoraussetzungen durch deren, allerdings fehlbare, Rekonstruktion einzuholen. Sodann verantwortet sie diesen Einholungsversuch in Form eines reflexiven Dialogs mit dem Skeptiker, der an der Gültigkeit eines jeweiligen Rekonstrukts zweifelt: im Dialog der Argumente wird getestet, ob der Zweifel daran sich halten läßt oder aber, hält man ihn aufrecht, den Diskurs zerstört und die Glaubwürdigkeit des Zweiflers als unseres Argumentationspartners zunichte macht. Im Lichte der Diskurspragmatik ergibt sich für uns nun zunächst eine Rekonstruktionsfrage: Welche normativ gehaltvollen Diskursvoraussetzungen sind es, die Platon in der berühmten Sokratischen Selbstaussage zu Recht als unbedingt gültig und moralisch verbindlich beansprucht? Interpretieren wir diese Aussage im stärksten Sinne, den sie haben kann: Nehmen wir sie so als fehle ihr nichts und als sei sie unmißverständlich – im Sinne von Gadamers „Vorgriff der Vollkommenheit“191. Was tun wir, wenn wir dermaßen zuvorkommend mit einem Geschriebenen oder auch einem Gesagten umgehen? Wir befolgen dann keine pure Höflichkeitskonvention, sondern ziehen die interpretationsmethodische Konsequenz aus einer formalen, und zwar normativ geladenen, „Voraussetzung, die alles Verstehen leitet. Sie besagt, daß nur das verständlich ist, was wirklich eine vollkommene Einheit von Sinn darstellt.“ Den Blick auf die Auslegung geschichtlich überlieferter Texte richtend, erläutert Gadamer: “So machen wir denn diese Voraussetzung der Vollkommenheit immer, wenn wir einen Text lesen, und erst wenn diese 191 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 41979 (zit.: Wahrheit und Methode), S. 277 f. 62 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Voraussetzung sich als unzureichend erweist, d.h. der Text nicht verständlich wird, zweifeln wir an der Überlieferung und suchen zu erraten, wie sie zu heilen ist.“192 Eines textkritischen Erratens, der philologischen Kunst der Konjektur, bedarf es nicht, wenn wir den Sokratischen Logos-Satz als Maxime für Diskursteilnehmer würdigen wollen. Nötig ist aber, daß wir über zwei logische Schwächen hinwegsehen. Denn erstens scheint Sokrates seine persönliche Einschätzung, seine subjektive Evidenz, zum Maßstab für „den besten Logos“ zu machen, wenn er ihn mit jenem Logos gleichsetzt, „der sich mir bei der Untersuchung als der beste zeigt“. Denn damit fällt er hinter die Gültigkeitsansprüche der Wahrheit und Richtigkeit zurück, weil diese eben auf Intersubjektivität statt auf Subjektivität zielen. Eine zweite geltungslogische Schwäche ist die fehlende logische Unterscheidung: Das faktische Ergebnis einer Diskursveranstaltung, welches fehlerhaft sein kann, weil diese von allerlei Zufälligkeiten und Dürftigkeiten, etwa von partikularen Interessen, Vorurteilen und Stimmungen, auch von Zeitknappheit etc. beeinträchtigt sein kann, wird in dem Logos-Satz nicht abgehoben von dem Ergebnis eines rein argumentativen Dialogs unter kompetenten Argumentationspartnern, die alle relevanten Argumente zur Situation hinlänglich berücksichtigt hätten. Was hier fehlt, ist die regulative Idee eines rein argumentativen Diskurses in einer idealen Argumentationsgemeinschaft. Das können wir allein sagen, wenn und weil wir ausdrücklich die Rolle eines Argumentationspartners einnehmen, der sich auf deren logische und ethische Voraussetzungen besinnt. Wir stellen das als Diskurspragmatiker fest, indem wir die Sinnund Geltungsbedingungen der Diskurspartnerrolle zu rekonstruieren suchen. Und dabei setzen wir die Begriffs- und Problemerörterung seit der Ideenlehre Platons fort. Nachplatonisch unterscheiden wir zwischen zufälligen empirischen Gegebenheiten (Erscheinungen) und logisch notwendigen Kriterien bzw. Normen (Ideen). Nachkantisch erkennen wir, daß Geltungskriterien nicht das Wesen der Wirklichkeit sind – wohl aber Maßstäbe und Zielbestimmungen, die für unsere Orientierung in der Welt unverzichtbar, höchst fruchtbar und kritisch vorausweisend sind: Sie haben eine „regulative“ Funktion, transzendieren die Faktizitäten unseres Tuns und Lebens, also auch unsere Diskussionsveranstaltungen, unsere Wissenschaftseinrichtungen und sämtlichen Diskurs-Institutionen bzw. realen Argumentationsgemeinschaften. Aber als regulative Ideen tragen sie die Ansprüche auf 192 Op. cit., S. 278. 63 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Geltung, dank derer menschliche Äußerungen überhaupt nur ernstgenommen und begründet, diskutiert und ggfs. (als gültig) anerkannt werden können.193 Kurz und gut; nehmen wir einen idealen Rollentausch mit Sokrates vor,194 indem wir ihm die Rolle eines konsequent verfahrenden (pragmatisch und semantisch konsistenten) Argumentationspartners zuschreiben – wie sie dem ‚vervollkommneten’ Logosgrundsatz entspräche. Das heißt, wir nehmen die Position eines Sokrates ein, der sich nicht allein auf einen faktischen Diskurs (mit all dessen Einschränkungen und Fehlerquellen) bezöge, sondern in diesem kritisch auf den kontrafaktischen Diskurs einer idealen Argumentationsgemeinschaft. Unser Sokrates würde sich demzufolge an einem Logossatz ohne jene beiden geltungslogischen Defizite orientieren – etwa an der Maxime: ‚Ich will es immer so halten, daß ich nichts anderem gehorche, als dem Argument, das sich in einem faktischen Diskurs als das beste zeigt und das auch in einer idealen Argumentationsgemeinschaft (in der alle relevanten Informationen und alle sinnvollen Argumente im Blick auf alle Beteiligten/Betroffenen berücksichtigt würden) Zustimmung fände.’ Wenn Sokrates bzw. wir an seiner Statt den Logos-Satz in diesem Sinne vervollkommnet hätten, dann gäbe unser Grundsatz schon auf den ersten Blick zwei zuverlässige Kriterien für die Verbindlichkeit einer Aufforderung an die Hand: Die für das Sich-Verständigen und für das Etwas-Geltendmachen konstitutiven Bedingungen verpflichten ‚mich’ dazu, im Dialog der Argumente so mitzuarbeiten, daß (1) ‚ich’ letztlich keiner anderen Autorität als der des besten Arguments folge und daß (2) ‚ich’ die Diskurs-Gemeinschaft aller sinnvoll Argumentierenden als die entscheidende Instanz für die Prüfung und Anerkennung von vorgeschlagenen Normen bzw. von behaupteten Sätzen beachte, damit ‚wir’ den Horizont unserer faktischen Gemeinschaft selbstkritisch überschreiten, um möglichst alle Argumente zur Sache und alle involvierten Ansprüche Betroffener gleichermaßen aufzusuchen und zu prüfen. Jedenfalls wenn wir Sokrates in diesem Sinne explizieren, bringt der Sokratische Dialog Selbstverpflichtungen ins Spiel, die nicht irgendwie von den Diskursteilnehmern gesetzt werden, sondern unhintergehbar sind. Genauer gesagt: Sie sind durch keinen sinnvollen 193 194 Auf den Begriff der regulativen Ideen kommen wir zurück. S. u. ?????? Vgl. G. H. Mead, Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1987, S. 305 f. und 358 f. Ders., Gesammelte Aufsätze, Bd. 1, hrsg. v. H. Joas, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1987, S. 408 ff. K.-O. Apel, „Geschichtliche Phasen der Herausforderung der praktischen Vernunft und Entwicklungsstufen des moralischen Bewußtseins“, in: Apel u.a. (Hg.), Funkkolleg Studientexte (1984), Bd. 1, S. 61-63. Th. Bausch: Ungleichheit und Gerechtigkeit, Berlin: Duncker & Humblot 1993, S. 186 ff. und 204 f., vgl. 61 f. 64 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Diskursbeitrag mehr hintergehbar, weil die Prüfbarkeit eines Diskursbeitrags, also seine Diskutierbarkeit, voraussetzt, daß der Diskursteilnehmer nur solche Behauptungen macht bzw. Zweifel vorbringt, die ihren Selbstverpflichtungen entsprechen. Doch hier werden Sie, meine Leser, mit Recht nachfragen, warum diese Selbstverpflichtungen eigentlich logisch gültig und prinzipiell verbindlich, insofern unhintergehbar also, sein sollen. Sie sind es, weil sie an jener Kommunikationsrolle haften, die man schon übernommen hat, indem man (sich und anderen gegenüber) etwas (einen Gedanken, ein Gefühl, ein Erlebnis oder eine andere Art von Sinn) verständlich macht und indem man diesen Sinngehalt durch eine, als wahr unterstellte bzw. behauptete, Äußerung (sich und anderen gegenüber) zur Geltung bringt. Es ist dies die Rolle eines Diskursteilnehmers, der als solcher die Pflichten eines Partners hat. Inwiefern? Nun, diese Rolle wird getragen von generellen dialogbezogenen Verpflichtungen, die wir alle im Diskurs der Argumente haben. Sie sind allgemeingültig, weil sie zu den Sinnbedingungen jeder wahrheitsbezogenen Überlegung und argumentativen Klärung gehören, mit der wir zu unseren Annahmen wie zu denen Dritter Stellung nehmen können. Es sind diskurstragende normative Voraussetzungen. Ohne deren diskurspraktische Anerkennung, ohne ihre Berücksichtigung in dem, was ‚ich’ mir und anderen sage, würde mein Argument sinnlos; es wäre eine unverständliche Argumentationshandlung, so daß andere Diskursteilnehmer nicht wissen könnten, woran sie mit meinem Diskursbeitrag und mit mir als Argumentationspartner sind. Warum? Die Argumentations- und Dialogerwartungen anderer Argumentationsteilnehmer beruhen genau darauf: sie, die ‚mir’ nicht allein zuhören sondern sich mit ‚mir’ auf die Suche nach Wahrheit und Richtigkeit gemacht haben, erwarten kraft dieser Diskursrolle von ‚mir’, meine Rede werde die konstitutiven Diskursbedingungen erfüllen, so daß sie mit ‚mir’ als ihrem Diskurspartner kooperieren können. Aus diesem dialogethischen Wechselverhältnis zieht der sokratische Dialog seine Geltungs- und Orientierungskraft. Dermaßen expliziert, würde Sokrates allein eine solche Rede als wahr gelten lassen und nur eine solche Handlungsaufforderung bzw. Norm als wohlbegründet und daher verbindlich anerkennen, die in rein kommunikativen Diskursen rational verteidigt werden kann, so daß sie die begründete 65 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Zustimmung aller verdient.195 Und das beste praktische Argument, sagten wir, ist dasjenige, welches sich sowohl durch Verständigungsgegenseitigkeit als auch durch Geltungsgegenseitigkeit ausweisen kann, so daß es der kommunikativ erweiterten Urteilsstufe 6 gerecht wird. Lassen Sie uns jetzt diese Explikation des Logosgrundsatzes mit den Argumenten vergleichen, die der Platonische Sokrates im Fortgang des „Kriton“ tatsächlich vorbringt, und berücksichtigen wir zudem Ansprüche, die aus der Sicht der abwesenden Betroffenen, zumal seiner Frau und Kinder, geltend gemacht werden können! Fragen wir uns: Wie würden wir, wenn wir konsequent und umsichtig die Rolle von Argumentationspartnern einnehmen, an Sokrates’ Stelle argumentieren? Lassen Sie uns also den idealen Rollentausch vornehmen, ohne den ein Vorgriff der Vollkommenheit zur Würdigung einer philosophischen Aussage nicht gelingen kann. Es ergibt sich dabei freilich – darauf werden wir gestoßen – die kritische Frage: Argumentiert Sokrates eher im Sinne seiner Vorlieben und Meinungen als ‚Ich I’ oder strikt als Partner in einem rein argumentativen Dialog, der nach verallgemeinerbarer Gegenseitigkeit sucht, mithin als Ich II? Für seinen Entschluß, die Hinrichtung auf sich zu nehmen, statt zu entfliehen, bringt Sokrates vor allem sechs Gründe vor. (I) Der erste Grund bezieht sich noch nicht konkret auf die Handlungssituation, sondern ist eine allgemeine moralische Maxime. Sie erhebt den Anspruch, den besten Logos über das Gut-Leben (ευ ζην, eu zen) darzulegen, daß dieses nämlich „mit dem ehrenhaft und gerecht leben“ identisch sei (48 b 6-8). Diesen Logos gelte es zu berücksichtigen: nicht die Meinung „der Vielen, sondern das, was der Einsichtige und Sachverständige hinsichtlich des Gerechten und Ungerechten „sagen wird, und das, was die Wahrheit selber“ sagt (48a 5-7). Das ist eine radikale kriteriologische Differenz zwischen den faktischen Meinungen und der Wahrheit. Ihre immerhin berechtigte Absicht können wir einholen, indem wir uns klarmachen, daß wir als Argumentierende selbst schon in Differenz zu Meinungssubjekten, uns und Anderen, getreten sind, indem wir Wahrheit beanspruchen – also das beste Argument, welches die Argumentationswilligen und Einsichtigen überzeugen würde. Insofern 195 Vgl. D. Böhler, Philosophischer Diskurs im Spannungsfeld von Theorie und Praxis, in: Funkkolleg Studientexte (1984), II, S. 313-355, hier 339. Ders., HIER EINEN NEUEREN TEXT D.B.s ZUM LOGOS-SATZ ANFÜHREN! 66 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie zeigt es sich, daß Sokrates, geltungslogisch analysiert, eben das voraussetzt und ins Spiel bringt, was die Diskurspragmatik als transzendentale Differenzen der möglichen Geltung erläutert: die Differenz zwischen faktischen Vertretern einer Meinung (Ich I) und strikten Argumentationspartnern (Ich als Diskurspartner), wie auch die damit verwobene Differenz zwischen einer realen Meinungs- bzw. Kommunikationsgemeinschaft und einer reinen oder idealen Argumentationsgemeinschaft. Allerdings denkt Sokrates nicht eigentlich das, was er hier in Anspruch nimmt; und noch weniger denkt er es strikt dialog- und argumentationsgemäß. Vielmehr geht er auf ein Expertenmodell zurück, was die Philosophen und viele andere bis heute immer wieder tun, und allzu gerne. Damit übergeht er nicht nur den dialogischen Aspekt einer Kommunikation unter gleichberechtigten Argumentationsteilnehmern, sondern auch eine Sinnbedingung der Rede von „Argumentation“ und „Argumentationsgemeinschaft“, daß diese nämlich den Plural von Argumentationsteilnehmern und Argumenten voraussetzen, mithin auch deren Verschiedenheit – also die „Pluralität“ (im Sinne Hannah Arendts).196 Er nähert sich der Suggestion eines metaphysischen Singulars, als könne die Wahrheit selber sprechen, so wie ein Sachverständiger spricht. Es ist ein methodischer oder transzendentaler Solipsismus, der hier hervorlugt: ein uneinholbarer, daher unhaltbarer Standpunkt – pure Metaphysik, die sinnlos ist, weil im Denken nicht rechtfertigungsfähig. Denn alles Denken ist ein Erheben von Geltungsansprüchen gegenüber möglichen oder realen Anderen… Ganz unschuldig und Plausibilität heischend kommt die metaphysische Suggestion der einsamen Wahrheit daher. Sokrates führt die Instanz des Sachverständigen bzw. des Einsichtigen am Beispiel des Arztes oder des Turnmeisters ein, um dann die Analogie plausibel zu machen, der Leib verhalte sich zur Seele, wie sich die Gesundheit, die man beim Arzt oder Turnmeister zwecks guten Lebens pflegen oder wiederherstellen lasse, zu der Gerechtigkeit verhalte. Ebenso entsprächen Krankheit und Ungerechtigkeit einander (47 b 48 a 1). Walter Bröcker faßt das bündig zusammen: Wenn diese Analogie angenommen wird, was Kriton, ohne auch nur nachzufragen, tut, dann „ist die Frage beantwortet: Warum soll ich das Gerechte tun und das Ungerechte meiden? Weil ich andernfalls mich selbst, nämlich meine Seele beschädigen würde. Und da sie edler ist als der Leib, ist der seelische Schaden auch schlimmer. Da sich kein Mensch vorsätzlich Schaden zufügen wird, kommt es nur 196 H. Arendt, Vita actica oder Vom tätigen Leben, Stuttgart 1960 und München (Piper) o. J., (zit: Vita activa), S. 14 f., 164 ff., und 214 ff. 67 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie darauf an, ihn zu der Einsicht zu bringen, was gerecht ist und was ungerecht, und daß er mit dem einen sich selbst nützt und mit dem anderen sich selbst schadet. Wenn er das wirklich eingesehen hat, wird er gar nicht anders können als gerecht handeln. Aus der vorausgesetzten Analogie: Leib verhält sich zu Gesundheit wie Seele zu Gerechtigkeit, folgen logisch die berühmten Sätze […], daß Tugend Wissen ist und daß niemand freiwillig das Schlechte tut.“197 Dieser bekannte intellektualistische, besser: theoria-metaphysische und, wie sich zeigen wird, kosmos-mimetische Fehlschluß dient hier dazu, die von Sokrates geltend gemachte moralische Maxime ins Sakrosankte zu erheben, mithin dialogische Argumentationen darüber, ob ihr unbedingte, alle Situationen einschließende, Gültigkeit zukomme oder nicht, als gegenstandslos erscheinen zu lassen. Die berühmte Maxime lautet: Unrechthandeln ist auf keine Weise weder gut noch schön bzw. ehrenhaft, sodaß auch der, dem Unrecht geschehen ist, nicht wieder Unrecht tun darf (49 a 5 - b 6). (II) Sokrates führt den Logosgrundsatz also durch die Maxime weiter, man solle auf ein erlittenes Unrecht nicht mit einem anderen Unrecht reagieren. Unklar ist jedoch, welchen Geltungssinn diese Maxime beanspruchen kann: Soll sie ein Prinzip sein, welches die Berücksichtigung von besonderen Notsituationen und moralischen Ansprüchen Dritter noch zuläßt, also einem verantwortungsethischen Diskurs und möglichen moralischen Strategien noch Raum gibt? Oder ist sie als eine unbedingte Norm gemeint, die unter allen Umständen gilt; also auch dann, wenn man – in einer Notlage – aus berechtigter Fürsorge gegen andere, etwa Frau und Kinder, eine (im Prinzip auch von einem selbst lösbar ist, kann) anerkannte Rechtsnorm verletzen würde? Ein solches verantwortungsethisches Problem, das allein durch eine moralische Strategie- bzw. Konterstrategiebildung (im Sinne unserer Urteilsstufe 7) kann Sokrates aber nicht stellen und angehen. Warum nicht? (III) Er legt sich darauf fest, alle Rechtsnormen, die er als Polisbürger gleichsam durch den Sozialvertrag anerkannt hat (Urteilsstufe 5), uneingeschränkt einzuhalten, was immer sie auch befehlen mögen198. Er pflichtet nämlich den Gesetzen der Polis bei, als diese ihm vorhalten, 197 198 W. Bröcker, Platos Gespräche, Frankfurt a. M. 21967, S. 32. Platon, Kriton, 51 e 4f. Diese Festlegung wird auch nicht dem Wortlaut gerecht, mit dem er den Vertragsgedanken bzw. die Anerkennung der Gesetze eingeführt hat: 50 a 1 ist von den Gerechtsamen (δίκαια, dikaia) die Rede die von den „Gesetzen“ versprochen worden seien. 68 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie „daß er durch die Tat uns gegenüber sein Einverständnis erklärt hat, zu tun, was immer [sic!] wir befehlen.“199 Bedeutet das nicht einen Rückfall auf bedingungslosen Rechtsgehorsam im Sinne von „law and order“ (auf der konventionellen Urteilsstufe 4) und damit die Preisgabe des metakonventionellen Urteilsniveaus? Denn dieses schließt die prinzipienbezogene Prüfung der von einem selbst anerkannten Konventionen und der Implikationen bzw. Folgen freiwilliger Übereinkünfte ein. Das aber bedeutet: Auch die Verbindlichkeit eines einmal gegebenen Einverständnisses kann, ja soll bei gravierenden Zweifeln eingeklammert werden – allgemein zugunsten der Suche nach dem besten Logos und moralisch im Lichte des Prinzips der verallgemeinerbaren Gegenseitigkeit. Denn auch ein im guten Glauben geschlossener Vertrag bzw. anerkannter Verfassungsvertrag kann moralisch bedenkliche, ja illegitime Verbindlichkeiten einschließen. (IV) Außerdem fällt Sokrates hinter seinen Logosgrundsatz zurück, weil er seine faktische Vaterlandsliebe, die ihn als Athener prägt (Ich I), über alles zu stellen scheint, so daß sich aus der Verbindung von meinem Vaterland (Urteilsstufe 3) und unseren Gesetzen (Stufe 4) für ihn de facto eine letzte Geltungsinstanz ergibt.200 Doch als Diskurspartner (Ich II) hat er die Suche nach dem besten Argument und damit die unbegrenzte Argumentationsgemeinschaft, welche dieses anerkennen würde, als letzte Gültigkeitsinstanz vorausgesetzt. Auch ein Vergleich des Arguments (III) mit den biblischen Traditionen fällt übrigens für Sokrates bzw. für den Autor Platon ungünstig aus. Erheben sie doch tendenziell die Nächstenliebe und die Achtung vor dem menschlichen Leben als dem Ebenbild Gottes zum Kriterium dafür, inwieweit man dem Vaterland und seinen Gesetzen Gehorsam schulde. (V) Kaum von der Hand zu weisen ist hingegen die angestellte Erwägung, daß eine Flucht des Sokrates seine Freunde in die Notlage bringen könnte, ihrerseits aus Athen fliehen zu müssen.201 Doch nehmen die Freunde dieses Risiko offenbar im Sinne einer verantwortungsethischen Abwägung (Stufe 7) auf sich, so daß die verallgemeinerbare Gegenseitigkeit hier erreichbar wäre. Dennoch stellte sich u.U. für Sokrates – ebenfalls auf Stufe 7 – die Frage, ob man den Freunden diese Gefahr zumuten dürfe. Diese Frage läßt sich wohl allein in einem realen argumentativen Diskurs mit den Betroffenen klären. Doch wird der moralisch Empfindsame – und Sokrates verkörpert diesen zweifellos – seine Freunde kaum dem Offenbarungseid eines solchen aussetzen mögen. Wie leicht könnte dieser u.U. 199 200 201 Schleiermacher übersetzt: „daß er uns [den Gesetzen] durch die Tat angelobt habe“. Ebd., 51 a 2 - c 5. Ebd., 53 a 8 - b 3. 69 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie existentiell peinliche Diskurs in eine Nötigung umschlagen. Da überlegt man lieber allein für seine Freunde. (VI) Ambivalent ist das Argument, er selbst hätte in Theben oder Megara (vielleicht) kein gutes Leben, das die Flucht lohnen würde, zu erwarten. Warum? Zwei Gründe werden angegeben. Einer im „Kriton“-Dialog, der andere schon in der Verteidigungsrede vor Gericht. Im „Kriton“ weist Sokrates darauf hin, daß man ihn auch außerhalb Athens als Rechtsverächter ansehen könnte.202 Doch kommt dieser Grund über die vorkonventionelle Egoperspektive ‚meines’ Glücks (Stufe 1) und die konventionelle Perspektive der Anerkennung durch je meine partikulare Bezugsgruppe (Stufe 3) eigentlich hinaus? In Widerspruch dazu steht außerdem, daß Sokrates solche faktischen Bezugsgruppen zuvor noch selbst, und zwar kraft seines substantialistischen Wahrheitskriteriums, als „die Vielen“ distanziert hatte (47). Hier aber beruft er sich darauf, als handele es sich um eine Gültigkeitsinstanz im Sinne des besten Logos und der Wahrheit… Das Argument gewinnt auch dadurch nicht unbedingt an Überzeugungskraft und Gültigkeit, daß es abschließend mit dem Hinweis auf den Glaubwürdigkeitsverlust des Gerechtigkeitslobredners Sokrates verknüpft wird, der sich selbst der Herrschaft der Gesetze entzogen hätte203 – und daher wohl bloß in die Gegend Kritons, nach Thessalien, gehen könne, weil „dort ja Unordnung und Ungebundenheit am größten“ seien.204 Auf der reinen Geltungs- und Prinzipienebene wäre das Glaubwürdigkeitsargument allein dann durchschlagend, wenn es nicht bloß auf die faktische Glaubwürdigkeit von Sokrates I in der realen Gesellschaft von Megara und Theben Bezug nähme (Stufe 3), sondern auf den Diskurspartner (Sokrates II) zielte, der sich letztlich auf die ideale Gemeinschaft derer bezöge, die nach dem besten Logos suchen. Davon könnte aber nur die Rede sein, wenn für Sokrates’ Entscheidung gültige Argumente, verallgemeinerbare Gründe im Sinne der Urteilsstufen 6 und 7 sprächen. Dann hätte er den besten Logos auf seiner Seite. Zweifellos ist das auf der idealisierenden Ebene eines reinen Geltungsdiskurses (im Sinne der Prinzipienstufe 6) nicht der Fall. Verantwortungsethische Überlegung Aber könnten wir Sokrates nicht mit einer verantwortungsethischen Argumentation zu Hilfe kommen, indem wir für ihn eine moralische Strategiebildung versuchen? Die läßt sich an eine 202 203 204 Ebd., 53 b 3 - c 8. Ebd., 53 c 5ff. Ebd., 53 d 1ff. 70 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie dritte, in der „Apologie“ vorgebrachte Begründung anschließen: „Das größte Gut für den Menschen ist, täglich sich über die Tugend zu unterreden“205, „zu philosophieren […] und sich selbst sowie andere zu prüfen“206, um so Rechenschaft über die Lebensführung zu geben.207 Wenn aber schon die Athener, Sokrates’ Mitbürger, nicht imstande gewesen seien, dessen philosophisch kritische Lebensweise zu ertragen, so würden andere sie ebensowenig akzeptieren. Also müßte Sokrates in seinem Alter „immer unhergetrieben eine Stadt mit der anderen vertauschen“.208 Eine solche Existenz wäre dem Philosophen und alten Mann nicht zumutbar. Gewiß. (Wir berücksichtigen jetzt freilich –wie es auch Sokrates selbst tut - ’ eigene Argumentation – bloß das Individuum Sokrates in seiner Rolle als Philosophen, nicht Sokrates als Vater und als Ehemann, der für die Ansprüche seiner Familie mitverantwortlich ist.) Nun hängt die Wirksamkeit der philosophisch-kritischen Lebensform, realistisch betrachtet, offenbar von der durchschnittlichen ethischen Orientierung der Polisbürger ab. Und das ist nun einmal eine ebenso schlichte wie eifersüchtige (und auch kleinliche) Fixierung auf Vorbilder (Stufe 3), also hier auf den Philosophen Sokrates, und auf die ‚bei uns’ etablierten Gesetze (Stufe 4). Letztere sind zwar unzureichend und bedürfen dringend einer strukturellen Verbesserung mit der Perspektive auf Menschenrechte, Menschenwürde, auf Prozeßrecht mit prozeduraler Revidierbarkeit erstinstanzlicher Urteile usw. Doch sind sie der Rechtlosigkeit vorzuziehen. Was die Vorbildorientierung anbelangt, so könnte Sokrates ein politisch-ethisches Vorbild dann und nur dann werden, wenn er sich nach athenischem Recht und Gesetz verhält – also die Hinrichtung auf sich nimmt, nachdem er die Möglichkeit der Verbannung verworfen hatte.209 Daß aber Sokrates als Vorbild anerkannt werde, ist die Voraussetzung für die moralische Langzeitstrategie „Aufhebung der stark gerechtigkeitsdefizitären Gesetze Athens in eine menschenrechtsfundierte und rechtsstaatlich revisionsfähige Rechtsordnung“. Also lohnt es das Lebensopfer des alten Mannes Sokrates, sofern sowohl Sokrates selbst - vor der Hinrichtung öffentlich und in einem Vermächtnis als auch seine Freunde später - die Ziele einer solchen Verbesserung der Rechtsordnung und des Polis-Geistes nicht allein entfalten, sondern öffentlich resp. auch politisch strategisch daraufhin wirken. In diesem Sinne könnten wir fast den folgenden Passus der „Apologie“ auslegen: „Ich behaupte also, ihr Männer, die 205 206 207 208 209 Platon, Apologie, 38 a 2. Ebd., 28 e. Ebd., 39 c 7. Ebd., 37 c 7 - d 6. Ebd., 37 c 4 - 38 a 8. 71 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie ihr mich hinrichtet, es wird sogleich nach meinem Tode eine weit schwerere Strafe über euch kommen als die, mit welcher ihr mich getötet habt. Denn jetzt habt ihr dies getan in der Meinung, nun entledigt zu sein von der Rechenschaft über euer Leben. Es wird aber ganz entgegengesetzt für euch ablaufen, wie ich behaupte. Mehr werden sein, die euch zur Untersuchung ziehen, welche ich nur bisher zurückgehalten, ihr aber gar nicht bemerkt habt. Und um desto beschwerlicher werden sie euch werden, je jünger sie sind.“210 Dann käme Sokrates’ Selbstopfer einer moralischen Situationsstrategie gleich, von der gölte, daß sie erfolgsfähig und moralisch verträglich einbezogen würde in eine moralische Langzeitstrategie zur Verbesserung der Rechts- und Kommunikationsverhältnisse Athens. So ließe sich auf Stufe 7 und im Sinne der moralstrategischen Ebene B der Diskurs- und Verantwortungsethik argumentieren. Verantwortlichkeiten für Sokrates’ Allerdings nur dann, wenn auch die Frau und Kinder angemessen berücksichtigt werden könnten: Kann ihnen die Selbstopferung des Ehemannes und Vaters zugemutet werden? Die Fürsorgepflicht des Sokrates gegenüber seiner Familie (Stufe 3) erscheint nämlich von neuem als Frage der moralischen Zumutbarkeit auf der verantwortungsethischen Prinzipienstufe 7; ist also alles andere als leicht zu nehmen. Als Leser von Platons Texten, der „Apologie“, des „Kriton“ oder auch des „Phaidon“ müssen wir freilich ernüchtert feststellen: es gibt wenig Anhaltspunkte für eine politisch-ethische Moralstrategie, wie wir sie eben skizziert haben. Als eine – wie auch immer stark explikative – Interpretation zumal des „Kriton“ wäre unsere verantwortungsethische Skizze wohl zu schwach belegt. Das gilt es zumal dann festzuhalten, wenn wir Sokrates’ Aussagen und Nichtaussagen über seine Familienverantwortung berücksichtigen. Stellt der platonische Sokrates sich diesem Zumutbarkeitsproblem? Oder sind wir drauf und dran ihn verantwortungsethisch hoch zu interpretieren? Von seiner Frau, der Verantwortung ihr gegenüber, und von seiner Familie – Frau, Kinder und Vater zusammen als Lebens- und Verantwortungsgemeinschaft – redet Sokrates überhaupt nicht. Die zu berücksichtigenden Ansprüche, Tugenden und Gerechtigkeitsbeziehungen werden von ‚seinem Vaterland’ aufgesogen. Zu einer Abwägung ‚Familie versus Vaterland’, die nach Maßgabe der Stufen 6 und 7 vorzunehmen wäre, kommt es nicht einmal. Allein von den Kindern spricht er. Warum will er sie nicht auf eine Flucht mitnehmen, und sei es nach Thessalien? Die Antwort: um sie nicht zu Fremdlingen zu 210 Ebd., 39 c 3 - d 2. 72 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie machen, und weil die Freunde in Athen (nach seiner Hinrichtung) sich ihrer annehmen werden, so daß sie, in Athen, besser aufgezogen und ausgebildet werden dürften...211 Ob die Kinder und die Ehefrau eigene, andere Ansprüche haben können und daher die Flucht auf sich nehmen und diese vorziehen würden, fragt Sokrates nicht. Über eine Verständigungsgegenseitigkeit ist der, tendenziell methodisch solipsistisch argumentierende, jedenfalls monologisierende Sokrates, den uns der spätere Kosmostheoretiker Platon hier präsentiert, gänzlich erhaben. Er weiß im vorhinein, welches die Bedürfnisse, Interessen und Werte der Betroffenen sind. Darüber bedarf es keiner Kommunikation mit ihnen. Die hat allein zwischen ihm und den „Gesetzen“ statt. Denen gibt er denn auch das letzte Wort, damit sie versichern können, was dem Logosgrundsatz zuwiderläuft und die Inhumanität von Platons „Politeia“ und „Nomoi“ einläutet: „Achte weder die Kinder, noch das Leben, noch irgend etwas anderes höher als das Recht.“212 Der Law-and-Order-Standpunkt siegt über die Argumentationsgemeinschaft, der Realathener (Sokrates I) überwältigt den Argumentationspartner, Sokrates II. Kein guter Ausgang, sondern eine konventionalistische Regression. Daß Lawrence Kohlbergs Würdigung des „Kriton“ weitaus günstiger ausfällt – „hier steht der Gesellschaftsvertrag der Stufe 5 im Mittelpunkt“213 – fordert zur Diskussion heraus. Man berücksichtige zunächst Kohlbergs Zitatauswahl aus dem „Kriton“: Auszüge 50 a bis 52 e, doch unter Auslassung der rechtspositivistischen Absolutheitsformel „zu tun, was immer wir [die Gesetze] befehlen“. Eben dieser, von Kohlberg unberücksichtigt gelassene, totale Gesetzesgehorsam ist unvereinbar mit dem metakonventionellen Gedankenexperiment eines Gesellschaftsvertrags. Denn ein solches klammert die Geltung der faktisch gegebenen Gesetze und Verfahren ein, weil es deren Legitimität prüfen soll. Sokrates hingegen führt kein solches Gedankenexperiment durch, sondern schließt von dem Faktum seiner bisherigen rechtsgehorsamen Bürgerexistenz in Athen auf die Sollgeltung bzw. Legitimität der athenischen Gesetze und Verfahren. Das bedeutet die Vermeidung einer Legitimationsprüfung, ja ihre Ersetzung durch einen faktischen bzw. naturalistischen Fehlschluß: Sokrates macht nichts geltend als eine ‚normative Kraft des Faktischen’ – gewissermaßen eine Art Gewohnheitsrecht der Institutionen gegen die Rechtsperson. Das ist 211 212 213 Ebd., 54 a - b 1. Ebd., 54 b 2 - 4. L. Kohlberg, Education for Justice. A modern statement of the Platonic view, in: N.F. Sizer & T.R. Sizer (Hg.), Moral education. Five lectures, Cambridge 1970, S. 57-83. Dazu D. Garz, Kohlberg (1996), S. 119f, vgl. 116ff und 60f. 73 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Rechtspositivismus, bestärkt durch einen Institutionalismus, der die angestammten Rechtsinstitutionen, sofern die Rechtsperson sich ihrem Geltungs- und Sanktionsbereich nicht entzogen und durch diese Unterlassung de facto deren Geltung akzeptiert habe, ins Sakrosankte erhebt. Dem steht der kritische, rechtsprüfende bzw. rechtskonstitutive Impetus der Idee des Sozialvertrags diametral entgegen. Dessen Orientierungsfunktion kann Kohlberg zwar als „legalistische Orientierung“ beschreiben; eine solche hat jedoch – eben das unterscheidet die „postkonventionelle“ Urteilsstufe 5 von der konventionellen Law-and-Order-Stufe 4 – das gelungene Legitimationsexperiment, besser: einen von allen Beteiligten argumentativ geführten praktischen Willensbildungsdiskurs, zur geltungsstiftenden Voraussetzung. Anderenfalls könnte Kohlberg den Sozialvertragsgedanken nicht zu Recht als postkonventionelles (logisch: metakonventionelles prinzipien- und gültigkeitsbezogenes) Urteilsniveau auszeichnen. Schon gar nicht könnte er annehmen, daß bereits auf dieser Urteilsstufe individuelle Rechte als vorpositive, rechtstragende Menschenrechte gefordert werden können. Eben das hat er getan – nicht zuletzt, indem er die US-amerikanische „Declaration of Independence“ als „Dokument der Stufe fünf“ würdigte.214 Dazu war Kohlberg, auch problemgeschichtlich gesehen, durchaus berechtigt, ist doch der Sozialvertragsgedanke ein integraler Bestandteil des „Naturrechts“ bzw. Vernunftrechts, der den Nutzenstandpunkt eines Kollektivs, der Nation als Bürgerschaft, mehr oder weniger verbindet mit dem universalen Rechtsstandpunkt der „frei geborenen“ und (qua Gottesebenbildlichkeit) mit der Würde des Anspruchs auf „unveräußerliche Rechte“ ausgestatteten Menschen. Und es ist dieser rechtsmoralische Anspruch der Menschenwürde, der aus Samuel Pufendorfs „De jure naturae et gentium“ Eingang in die US-amerikanische Unabhängigkeitsbewegung gefunden zu haben scheint.215 Von hier aus können wir zum Hauptargument des Kriton-Dialogs zurückkehren, der Vorhaltung, des Vertragsbruchs, den die ‚Gesetze’ Sokrates machen - und damit die Diskussion mit Frau Kinne fortsetzen. Es fragt sich hier nämlich, ob das Sozialvertragsargument Platons, so wie es im ‚Kriton’ vorgebracht wird, einen 214 215 L. Kohlberg, The quest for justice in 200 years of American history and in contemporary American education, in: Contemporary Education, 48. Jg. (1976), S. 5-16, hier S. 11. Hans Welzel hat gezeigt, daß dignitas humana, von Samuel Pufendorf zum „naturrechtlichen Zentralbegriff“ erhoben worden, durch den „Vater der amerikanischen Demokratie“, Pfarrer John Wise – „I shall principally take Baron Pufendorf for my chief guide“ – dem Geist der US-amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung eingepflanzt worden ist: H. Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen 1962, S. 140ff. 74 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie naturalistischen Fehlschluß darstellt. Was ist ein naturalistischer Fehlschluß im differenzierbaren Sinne? Es handelt sich um Schluß von einer bloßen (sei es einer natürlichen, sei es einer sozialeninstitutionellen oder einer handlungsmäßigen) Tatsache und deren Beschreibung: „Sein“ auf eine moralisch gültige, verbindliche Pflicht: „Sollen“. Im „Kriton“ läßt Platon ‚die Gesetze’ der Polis schließen: Du hast den Sozialvertrag durch dein faktisches Verhalten geschlossen (-> situationsbezogener Diskurs in Athen) d. h. uns als deine geltenden Gesetze anerkannt, also ist es deine moralische Pflicht, unseren normativen Implikationen in allem zu folgen. Prämissen: 1) Fallibilität situationsbezogener Diskurse gibt es nicht / ist nicht zu berücksichtigen [Verstoß gegen vorgängiges Dialogversprechen b5) ] 2) Das bloße Faktum einer Anerkennung verschafft dessen Gegenstand unbedingte moralische Gültigkeit im Sinne von Verbindlichkeit. D. h. Die Anerkennungswürdigkeit des faktisch Anerkannten müsse nicht geprüft werden. Dieser Begriff und Maßstab entfällt. So suggeriert es, wenngleich in kritischer Absicht, die Spruchweisheit „Mitgegangen, mitgefangen, (zu Recht?!) mitgehangen.“ Diese Annahme verstößt freilich gegen normative Sinnvoraussetzungen einer Argumentation, insbesondere gegen zwei Geltungsansprüche und Diskursversprechen. Es sind dies die Geltungsansprüche der Legitimität aus Gründen (a4) sowie der Wahrheit (a3) und die vorgängigen Dialogversprechen, - das Universum der sinnvollen Argumente bzw. der sinnvoll argumentierbaren Lebensansprüche als letzte Sinn- und Gültigkeitsinstanz, (selbst- und ergebniskritisch) zu berücksichtigen (b2) - mitverantwortlich zu sein für den Diskurs (als Möglichkeit der Verantwortung, jetzt und in Zukunft (b4) ] Abschließend können wir unseren philosophischen Diskurs zum „Kriton“, dem es nicht um eine historisch hermeneutische Würdigung der Auffassungen des Platonischen Sokrates, sondern um deren Beurteilung als Argumente im Diskursuniversum zu tun ist, in die Form 75 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Stand: 14.04.2009 Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie folgender Tabelle bringen. Horizontal stellt sie Kriterien zusammen, welche Teilnehmer eines argumentativen Diskurses (also auch Platons Sokrates) geltend machen können. In der Vertikalen listet sie Instanzen auf, die wir als Diskurspartner berücksichtigen müßten: die Betroffenen als Anspruchssubjekte im weitesten Sinne – von Sokrates über die Institution „Polis“ bis zur Metainstitution aller geschichtlichen Institutionen, dem philosophischen Diskurs der Argumente. 76 Vorlesung im Wintersemester 2006/2007, Prof. Dr. D. Böhler 77 Metaphysik, Kritik, Kommunikation Mögliche Beurteilung von Sokrates’ Argumenten I bis IV, Kriton 48 c - 54 e Kriterien, Bezugspunkte Betroffene als moralisch Anspruchsberechtigte und andere moralische Instanzen: Sokrates (S.) Person (Ich I) Anspruch auf Wahrheit, Gültigkeit qua Verständigungsund Geltungsgegenseitigkeit Gerechtigkeit Frau Kinder Freunde Polis Philos. Diskurs (alle sinnvollen Argumente, auch Ansprüche der Nachwelt, zu berücksichtigen) Unberücksichtigt: Situationsanalyse fehlt, keine Verständigung Unzureichend: Kritikfähige Situationsanalyse, keine Verständigung (auch nicht advokatorisch) Unzureichend: Kritikfähige Situationsanalyse, keine Verständigung Ja, in der Verteidigung seiner selbst vor Gericht [Argument V] Keine Situationsanalyse, keine Verständigung, daher keine Berücksichtigung von Gerechtigkeits-ansprüchen Daher bezweifelbare Berücksichtigung von Gerechtigkeits-ansprüchen Keine Situationsanalyse, keine Verständigung, daher bezweifelbare Berücksichtigung von Gerechtigkeitsansprüchen Argument II Argument I Antizipation von Stufe (5) mit Regression auf Stufe (4) Ein moral. Gehalt des LogosGrundsatzes, aber nicht metakonventionell, sondern konventionell (regressiv) gehandhabt Diskurspartner (Ich II) [Argument V] Bedeutet die Flucht den Verlust der Diskursglaubwürdigkeit? - Reale vs. ideale Diskursgemeinschaft (6) - [Märtyrertum als moral. Strategie (7) → Wahrung von Rechtsloyalität u. – sicherheit (4 u. 5)?] Argument I Ein moral. Gehalt des Logos-Grundsatzes (6), aber gesinnungsethisch verabsolutiert, mithin eher als Stufe 4-Norm denn als autonom anzuwendendes, metakonventionelles Moralkriterium angesetzt Siehe Spalte Sokrates Argument III faktizistischer Fehlschluß von Sokrates’ Bürgerverhalten (3) auf Legitimität der Gesetze (4) 77 Vorlesung im Wintersemester 2006/2007, Prof. Dr. D. Böhler 78 Metaphysik, Kritik, Kommunikation Kriterien, Bezugspunkte Leben Betroffene als moralisch Anspruchsberechtigte und andere moralische Instanzen: Sokrates (I + II) Frau Kinder Freunde Polis Philos. Diskurs (alle sinnvollen Argumente, auch Ansprüche der Nachwelt, zu berücksichtigen) Argument V Argument VI Argument VI Argument IV Sokrates scheint sich in der Egoperspektive Stufe (1) auf persönliches Glück zu berufen und auf die faktische Akzeptanz durch eine Gruppe (Stufe 3) S. delegiert seine Fürsorgeverantwortung undialogisch und ohne das moralische Prinzip der Zumutbarkeit zu klären In Übereinstimmung mit seiner lebensweltlichen Rolle (3) übt Sokrates Fürsorgeverantwortung für seine Kinder, aber Ausblendung der Fürsorgeobjekte als Diskurspartner Asymmetrische Fürsorgeverantwortung (Ausblendung der Fürsorgeobjekte als Diskurspartner, solipsistisch verkürzende Antizipation von (7)) Unbe-rücksichtigt bleibt und muß die Frage bleiben, ob ein Staat das Recht auf Todesstrafe beanspruchen darf, da die Idee der Menschenwürde fehlt Es fehlt die Frage: Ist ein Sozialvertrag überhaupt legitim, der einem Staat die Todesstrafe zuspricht (Prinzip der Menschenwürde als Rechtskonstituens) bei Ausblendung von Verantwortungspflichten des Familienoberhaupts (3); aber in „Apologie“ mit verantwortungs-ethischer Perspektive: Wirkungsmöglichkeit für kritische Philosophie wahren (Stufe 7)! Menschen würde __________ __________ __________ __________ _______ Menschenwürdegrundsatz unvereinbar mit Todesstrafe → Legitimation der Flucht 78 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 3.2.2 Der Sokratische Elenchos und die Diskurs-Tugend. Wissen und Wollen der Dialogverpflichtungen bei (möglichem) Nichtwissen der Sachen. Wie enttäuschend Platons Argumente am Schluß des Kritondialogs und auch dessen monologischer Charakter für uns als Diskurspartner auch sind, wie tief sie auch unter das Urteilsniveau des Logosgrundsatzes, geschweige des der verallgemeinerbaren Gegenseitigkeit, zurückfallen, so bahnbrechend und im Kern allgemeingültig ist die Logosmaxime selbst und der Kontext, in dem sie entdeckt wird, nämlich Sokrates’ Suche nach einer dialogförmigen Prüfung von Geltungsansprüchen, dem Elenchos. Das sind zwei im Diskursuniversum unverlierbare, für die Argumentationsgemeinschaft unverzichtbare sokratische Errungenschaften: Sie gehören zum eisernen Bestand der Diskurspartnerrolle. Jede Person kann sie sich als Ich II aneignen, wie sehr sie auch die geschichtlichen Kontextbedingungen, Konventionen und partikularen Ansichten eines Ich I – hier die des antiken Atheners Sokrates bzw. seines Schülers Platon – überholen und kritisch distanzieren mögen. Das Verfahren und der Begriff des élenchos bzw. der έλεγξις sind oft weich und können teils moralische, teils juridische Nuancen haben. Beim frühen Platon mündet der Elenchos in eine Kritik des vermeintlichen Wissens, in ein Wissen des Nicht-Wissens. Dieses negative Wissen besagt jedenfalls, daß die naiv behaupteten Meinungen und deren naiver Anspruch, sie präsentierten hinreichendes Sachwissen, dann nicht mehr Bestand haben, wenn sich ihre Vertreter auf das dialegesthai als logízesthai einlassen, auf die strenge Suche nach dem zureichenden Argument. Die naiven, vor-argumentativen und vor-dialogischen Wissensansprüche können nicht mehr bestehen, wenn man heraustritt aus der Arena der alltäglichen Selbstbehauptung und eintritt in den dialogisch-logischen Raum des Erhebens und Prüfens der eigenen Ansprüche als Geltungsansprüche; d.h. als dialogischer Angebote, welche mit Gründen zu versehen sind und anhand von Gründen geprüft werden müssen – gemeinsam im Argumentieren. Was bedeutet es, wenn man sich auf jene Suche begibt? Man läßt die unphilosophische Praxis des puren Fürwahrhaltens seiner jeweiligen Meinung und des Durchsetzenwollens seiner Orientierungen bzw. normativen Vorstellungen hinter sich, distanziert sich insofern ein ganzes Stück von sich selbst und eröffnet die philosophierende Praxis von Argumentationspartnern in einer Gemeinschaft strikten Argumentierens. Das ist der kritische Eröffnungszug des Philosophierens als Diskurs: Durch die Distanzierung der Alltagsnaivität und der bloßen Selbstbehauptung setzt man sein bisheriges, vermeintliches Wissen skeptisch in Klammern, man betrachtet es als ein Nicht-Wissen und sucht nunmehr 79 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie nach begründbarem Wissen, das sich nicht bloß auf ein Meinen und Wollen, sondern auf den einsehbaren Logos soll stützen können. Legen wir den sokratischen Ansatz in dieser Weise aus, dann lassen sich auch die Ironie des Sokrates, ja zum Teil sogar Platons rabulistisches Dreinschlagen,216 als strategische Diskursmittel würdigen – eine harte Schule, die es mit der bornierten Selbstbehauptungspraxis des alltäglichen Etwas-Meinens und Etwas-Wollens zu tun hat und dieser eine Erziehung sowohl zur Autonomie als auch zum Miteinanderargumentieren entgegen setzt. Sicher bleibt, wie Gottfried Martin betont, auch die Ironie des Sokrates zum Teil, wie so vieles an ihm, rätselhaft. Doch dürfte sie des öfteren zur Autonomie provoziert haben, als wolle er bzw. der junge Platon zu verstehen geben: ‚Nein, ich gebe dir keine positive Antwort, die du als fertige Münze einstreichen könntest; denke gefälligst selbst. Eher verstelle ich mich oder ziehe dich belustigt auf, als daß ich dir eine fertige Antwort serviere – lieber erscheine ich euch allen als ein Zitterrochen, der anderen gern elektrische Schläge versetzt.217 Will ich euch doch aus dem bloßen Etwas Meinen und Nachreden von Sprichworten herausschlagen, auf daß ihr ernsthaft zu denken euch bemüht.‘ Offenbar verfährt der kritische, teils ironische, teils strikt aporetische Sokrates nach der Maxime: Ohne schmerzhafte Einsicht in das Nichtwissen des alltäglichen Durchsetzenwollens von Meinungen, Praktiken bzw. Normvorstellungen ist der Weg zur Erkenntnis des Wahren und Richtigen im vorhinein verstellt. Zwar steht die sokratische Negativität nicht nur am Anfang von Dialogen, sondern macht bei dem frühen Platon auch den Beschluß: hier münden die Dialoge in eine Aporie, die Erkenntnis einer Ausweglosigkeit218 oder in die Einsicht, daß das Gesagte nicht mit der Lebensweise übereinstimmt.219 Doch erschließt diese praktische Einsicht eben jene ‚positive‘ Orientierung, die Sokrates im „Kriton“ als seinen Grundsatz formuliert: die Orientierung an der Vereinbarkeit von Verhalten und Sagen, von Handlungsweise und Logos – eben des diskursiv geprüften Logos. Denn als zuhöchst erstrebenswert zeichnet Sokrates die Verträglichkeit von Lebenspraxis und diskursiver Einsicht aus. Selbst Hegels emphatische Kritik der Sokratischen Negativität muß daher zugestehen, daß sich in der Gestalt des 216 217 218 219 Dazu: J. Hirschberger, Die Phronesis in der Lehre Platons vor dem „Staate“, Leipzig 1932 (Philologus Suppl. 25,1), S. 90. Vgl. auch K. Bormann, „Platon: Die Idee“, in: J. Speck (Hg.), Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie des Altertums und des Mittelalters, Göttingen 1978, S. 47 f. Menon 80 a. Zur Ironie: G. Martin, Sokrates in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg 1967, S. 127 ff. Zur Aporie: Menon 80a-86c; Charmides 169c-d; Theaitetos 149e. Dazu B. Waldenfels, Das sokratische Fragen. Aporie, Elenchos, Anamnesis, Meisenheim a. Glan, 1961. Vgl. G. Picht, Wahrheit, Vernunft, Verantwortung. Philosophische Studien, Stuttgart 1969 (zit.: Wahrheit (1969)), bes. S. 91 ff, vgl. S. 87-107. 80 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Sokrates das metakonventionelle Prinzip der Subjektivität mit dem des Logos verbindet – genaugenommen mit dem Prinzip eines in gegenseitiger Achtung zu führenden Dialogs.220 Eben daraus ergibt sich implizit eine positive moralische Orientierung: die zwiefältige Tugend der dialogischen Praxis, die der Diskurspartner als Selbstzweck bzw. Wert an sich hochachtet, und des Strebens nach Übereinstimmung von Leben und Logos, woraus Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit erwachsen. Jedenfalls in dem Maße, in welchem der Logos als Resultat eines argumentativen Dialogprozesses verstanden, mithin auf kommunikative Weise nach Erkenntnis gesucht wird, ergibt sich eine neue Tugend der Tugenden: Glaubwürdigkeit in Gestalt der Kohärenz von Lebenspraxis und Diskurs, von Meinungs- bzw. Interessensubjekt und Dialogpartner. So stellt Platon in der Rede des Feldherrn Laches den Sokrates als Menschen vor, der die Tugend verwirkliche, weil er in der Übereinstimmung von Rede und Taten lebe.221 Sein Leben sei harmonisch gestimmt: „zusammenklingend mit den Worten die Werke“.222 Wie aber bringt er es zu diesem Einklang? Nicht anders, als daß er jeweils kritisch danach sucht. Nach dem Vorbild eines Gerichtsprozesses, in dem ein Rechtsanspruch geprüft wird, läßt er sich auf eine Prüfung der üblicherweise mitgebrachten Wissensansprüche ein. Dabei kommt er – klassisch in der „Apologie“ – zu dem Eingeständnis, diese nicht einlösen zu können: „ich bin Mitwisser, des Tatbestands, daß ich nichts weiß“, bekennt er vor Gericht223. Um dieser paradoxen Aussage einen haltbaren Sinn abgewinnen zu können, sind erneut die Explikationsfragen zu stellen, wer denn jene erste Person sei, die ein – wie immer kritisches – Wissen von sich zum Ausdruck bringt, und wer sich hinter dem Ich verbirgt, über das sie das kritische Urteil fällt, es wisse nichts. Letzteres, von dem behauptet wird, es habe kein Wissen von der gerade verhandelten Sache, ist das naive, seine Meinungen und Annahmen schlicht behauptende Alltags-Ich, das Meinungssubjekt (I). Das andere ‚Ich’ hingegen, welches als kritischer Zeuge auftritt, der das Zu-wissen-Meinen des Selbstbehaupters als Nichtwissen entlarvt, ist der Logos-Sucher ‚Ich’ (II). Dieses zweite Ich agiert als Partner eines Diskurses, in dem nicht Meinungen zählen, sondern einzig gute Gründe, die für oder gegen eine Annahme sprechen. 220 221 222 223 „Dem zufälligen partikulären Innern hat Sokrates jenes allgemeine, wahrhafte Innere des Gedankens entgegengesetzt. Und dieses eigene Gewissen erweckte Sokrates, indem er nicht bloß aussprach: Der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern: Der Mensch als denkend ist das Maß aller Dinge.“ So G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: Werke (1971), Bd. 18, S. 472, vgl. 467, 471, 497 und 514f. Platon, Laches, 188 c - 189 b. Ich folge hier der Auslegung Georg Pichts: ders., Wahrheit (1969), S. 87107, bes. S. 88ff. Platon, Laches, 188 d. Platon, Apologie, 22 c. 81 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie So können wir zusammenfassen: Als Elenktiker lebt Sokrates von einer Zwei-RollenDialektik. Denn der Sokratische Elenchos ist so angelegt, daß die unmittelbare Rolle dessen, der schlicht etwas meint und es naiv zu wissen behauptet (I), konfrontiert wird mit der reflektierten Rolle dessen, der sich in einem argumentativen Diskurs weiß und nun als Diskurspartner (II) zu einer bestimmten Meinung – hier zu einer, die er selbst (als I) vertritt – Stellung bezieht. Die paradox anmutende Selbstaussage in der Apologie entspringt keiner skeptizistischen Attitüde. Sokrates tritt weniger als Skeptiker denn als tendenziell diskursbewußter Dialektiker auf. Auch wenn er z.T. dahinter zurückfällt, so gilt doch: er hat das dialogreflexive Argumentationsniveau markiert. Als Dialektiker kann Sokrates die naiven Ansprüche des Sachwissens einklammern, ja ein Nichtwissen der Sache konzedieren, weil er ein Wissen vom argumentativen Dialog hat. Aufgrund eines, wenngleich nicht näher bestimmten geschweige denn reflexiv ausgewiesenen, sondern unterstellten dialogpragmatischen Vorwissens kann er sich selbst und andere auf das Verfahren des Elenchos, die kritische dialogische Prüfung, verweisen – mithin auf den argumentativen Diskurs als die letzte Geltungsinstanz. Daraus bezieht der Typos Sokrates seine eigentümliche Glaubwürdigkeit, die au fond kritische Tugend der Diskursglaubwürdigkeit. Nun läßt sich Diskursglaubwürdigkeit nicht als eine Tugend verstehen, die man haben kann, wie man einen Besitz oder eine Eigenschaft hat, wohl aber als Bereitschaft zu einer permanenten Aufgabe. Diese Aufgabe hat etwas von einer „regulativen Idee“ (à la Kant, Peirce und Apel) an sich, weil ‚wir‘, auch wenn wir im Diskurs Geltungsansprüche erheben und prüfen, gewiß keine reinen Vernunftsubjekte, sondern leibhafte Menschen sind: endliche und leibliche, affektbeladene und interessengeleitete, auf fallible Informationen und Interpretationen angewiesene Wesen. Doch als reale Diskurspartner wissen wir implizite, in der Weise eines tacit knowledge (Polanyi), zweierlei zugleich: daß wir nach Gültigkeit, nach Wahrem und Richtigem, suchen, und daß wir uns täuschen können. Worin können wir uns prinzipiell täuschen? Vor allem in der Erkenntnis von Sachverhalten und der Einschätzung von Situationen der Welt. In der semantischen Relation der Gegenstandserkenntnis, genauer gesagt, in der Erkenntnis von Dingen der sogenannten Außenwelt, können wir uns so gut wie immer irren. Denn hier sind wir, wenn es um objektivierbare Sachverhalte geht, auf Vermutungen bzw. Hypothesen vor dem Hintergrund einer Theorie angewiesen oder aber, wenn wir Sinnzusammenhänge erschließen wollen, auf Vorverständnisse und Vorgriffe mit dem Hintergrund eines Interpretationsrahmens. 82 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Hypothesen und Theorien sind fallibel, Vorverständnisse und Interpretationsrahmen können unangemessen sein. Vorsicht ist am Platze und kritische Prüfung unverzichtbar. Von einer solchen elementaren Kritikwürdigkeit und Kritikangewiesenheit will freilich die natürliche Selbstbehauptungsperspektive wenig wissen – sie behauptet viel lieber: ‚ich weiß!’. Dagegen setzen der Dialektiker Sokrates und erkenntniskritische Aufklärer wie Lessing und Kant den selbstkritischen, unabschließbaren Erkenntnisprozeß. Das selbstkritisch suchende Denken mit fallibilistischem Vorbehalt bei der Erkenntnis dialogexterner Dinge ist es, welches den Typos Sokrates so lebensvoll macht. Aufgrund dessen erscheint er, im Unterschied zu vielen seiner festgewurzelten und eingefahrenen Gesprächspartner, überaus lebendig – aufgeschlossen und offen für Kritik, für begriffliche Horizonterweiterung und Präzisierung der Rede. Hannah Arendt konnte daher pointieren: „Der Sinn von Sokrates’ Tun lag in diesem selbst. Oder anders gesagt: denken und völlig lebendig sein ist dasselbe, und daraus folgt, daß das Denken immer wieder neu anfangen muß.“224 Doch kann jene kritische Lebendigkeit nicht bedeuten, daß die Tugend des Denkens bzw. des argumentativen Diskurses im puren Offensein bestünde, als ob ihr keine festen, wißbaren logischen Regeln und dialogischen Verpflichtungen innewohnten. Nein, als Wachheit des Geistes speist sich diese kritische Lebendigkeit aus der infalliblen Einsicht in die Verbindlichkeit vorgängiger Dialogversprechen, die Sokrates dadurch abgegeben hat, daß er nach dem besten Logos sucht und die er in dem Logosgrundsatz auf eine Formel gebracht hat. Es sind zunächst die Versprechen, nichts als das beste Argument gelten zu lassen und die Gesprächspartner als Argumentationspartner zu nehmen sowie zu achten. Insofern ist der Sokratische Rückgang auf den kritischen Dialog auch der „erste Versuch einer Sprachethik (besser: Dialogethik)“. Vittorio Hösle belegt diese Interpretationsthese vor allem mit dem Thrasymachos- und dem Gorgias-Dialog.225 Zu Recht. Denn dort finden sich, wie auch im „Kriton“ und der „Apologie“, Vorgriffe auf eine diskurspragmatische Begründung der Ethik durch Rückgang auf die dialogische Praxis. Wird dieser Rückgang reflexiv und konsequent vollzogen, dann erschließt er das dialogische Anerkennungsverhältnis zwischen denen, die ein Problem lösen, eine Erkenntnis erwerben wollen: die moralisch geladene Gegenseitigkeit zwischen Diskurspartnern. Nun wird aber der Sokratische Anstoß zur Besinnung auf die diskurspragmatischen Dimensionen des Gemeinschaftsbezugs und des Wahrheits- bzw. Gültigkeitsbezugs von 224 225 H. Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Denken, München 1998 (zit.: Vom Leben des Geistes (1998)), S. 178; vgl. 166ff. V. Hösle, Wahrheit und Geschichte, Stuttgart-Bad Cannstatt 1984 (zit.: Wahrh. u. Gesch. (1984)), S. 334f, vgl. 314-359. 83 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Platon alsbald ontologisch neutralisiert und kosmostheoretisch konterkariert. Wenn wir die Tragweite dieses Richtungsstoßes würdigen und in die diskurspragmatische Besinnung eintreten wollen, empfiehlt es sich daher, mit Sokrates über Sokrates hinauszudenken und seinen Dialogansatz ebenso aus der Metaphysik Platons wie aus dessen instrumentalistischer Sprachphilosophie herauszulösen. Zuerst wende ich mich seiner Sprachtheorie zu. Erstaunlicherweise scheinen nämlich einige ihrer Elemente selbst heute – nach dem linguistic turn bzw. pragmatic turn der Gegenwartsphilosophie – noch wirksam zu sein, obwohl sie sich sprachpragmatisch nicht halten lassen. So werfe ich zunächst einen Blick auf Platons sprachphilosophischen Dialog „Kratylos“, um vor dieser Folie nach den pragmatischen Dimensionen des Etwas-Denkens zu fragen. 3.2.3 Gemeinschafts- und Geltungsbezug als Basis einer dialogischen Sinnkritik. Die seit Platon verdrängten kommunikativen Dimensionen des Etwas-Denkens Im „Kratylos“ nimmt Platon expressis verbis die Möglichkeit einer sprachfreien Erkenntnis an und stellt das methodologische Postulat auf, man solle die Dinge besser ohne Worte, nämlich durch verwandte Dinge, oder durch sie selbst erkennen (438 e - 439 b). Was in dem, kurze Zeit darauf entstandenen, „Phaidon“ schon als „abgedroschen“ gilt, die Erkennbarkeit der Ideen ohne Worte (100 b), wird im „Kratylos“ entwickelt. Hier sucht Platon nach einem „Paradigma“ für die richtige Benennung und Bedeutungserfassung der Dinge. Diese Suche führt ihn stufenweise aus der Sprachphilosophie hinaus – und in die Ideenlehre als Ontologie hinein. Der Dialog weist einen eidetischen Weg zur „Idee“ der Dinge, welcher vermittels Worten als den „Werkzeugen“ der Benennung zu beschreiten sei. Dieser Weg führe von einem, in verschiedenen Sprachen durchaus unterschiedlichen, Wortausdruck, der aber ein und dieselbe „Idee des Wortes“, also den (idealen) Begriff wiedergeben müsse, auf das Wesen, die Urgestalt der Dinge selbst als dem „bestimmten Sinn“ der Wortidee. Diese reine Dinggestalt sei die sprachunabhängige Idee.226 Das ist die ideentheoretische Ausklammerung des sprachphilosophischen Bedeutungsproblems. Sie trennt die Konstitution der Wortbedeutungen von dem realen geschichtlichen Sprachgebrauch ab und deren Geltung von einem möglichen dialogischen Konsensus. Wie konnte es dazu kommen? 226 Platon, Kratylos, 389 a-390 a; vgl. 422 d-424 e, 428 c-428 d/e und 438 a-439 b. Dazu J. Derbolav, Platons Sprachphilosophie im Kratylos und in den späteren Schriften, Darmstadt 1972, bes. S. 58f, 89 und 95ff. 84 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Platon hat die Tendenz, Sprache als System von Worten, primär von Dingworten, zu betrachten; und er verbindet diese Sprachauffassung mit einer instrumentalistischen Perspektive. So erklärt er die Wortbildung mithilfe eines Werkzeugmodells: Wie ein Werkzeugmacher, etwa der Tischler, beim Verfertigen eines Weberschiffchens auf das Musterbild seines Werkzeugs (είδος, eidos) blicke, so schaue der Wortbildner auf die ίδέα (idea) und gebe sie wieder (389 b 8 - 390 a 7). Doch wer sind die Wortbildner, wenn nicht die realen Sprecher als aktive Teilhaber einer Sprachgemeinschaft und sprachmodifizierende Fortsetzer ihrer Sinn- und Ausdrucksgeschichte? Platons Werkzeugmodell enthebt uns, die geschichtlichen Wortbildner, einer Verständigung über den Sinn eines fraglichen sprachlichen Ausdrucks und seiner Abgrenzung von anderen Ausdrücken. Seine instrumentalistische und verdinglichende Wortsemantik setzt zweierlei voraus: erstens, daß Wortbildung, also Sprachentwicklung, prinzipiell einsam und kommunikationsunabhängig möglich sei, und – zweitens – daß Sprachschöpfung (bzw. Weiterentwicklung der Sprache durch Wortbildung) nach dem akommunikativen Modell des Produzierens von Dingen (hier: eines Instruments) gedacht werden kann – also in einer bloßen Subjekt-Objekt-Relation. Wenn man die urkommunikative Handlung der sprachlichen Sinnverständigung und des Definierens als ein Herstellen begreift – so, als ginge es darum, daß einer, einsam und für sich allein, ein Objekt produziere –, schneidet man sie aus der Welt der Kommunikation heraus. Es ist dieser ganz und gar subjekt-objekttheoretische und herstellungstechnische Zusammenhang, in dem Platon „als erster das Wort ‚Idee’ als ein Schlüsselwort philosophischen Denkens einführte“. Hannah Arendt pointiert, daß er damit einen Begriff zum philosophischen Terminus erhob, der „ursprünglich im Herstellen erfahren war“.227 Ganz konsequent löst Platon im „Phaidon“ und „Phaidros“ auch den anamnetischen Weg des Ideenerwerbs von der kommunikativen Sprachpraxis ab. Denn er bestimmt ihn zum einen wahrnehmungspsychologisch – die Erinnerung werde unmittelbar von der Wahrnehmung eingeleitet228 –, zum anderen entelechetisch ontologisch und erkenntnislogisch: die Erscheinungsmannigfaltigkeiten selbst strebten nach den Ideen229, auf deren Erkenntnis der Mensch wesengemäß aus sei und die er synagogisch erlangen könne230. Daß die Sprache die Sinnbasis auch für Ideen ist und der argumentative Dialog die Geltungsbasis des Denkens, hat Platon, wirkmächtig bis heute, verdrängt. 227 228 229 230 H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München o.J. (zit.: Vita activa), S. 220, vgl. S. 129. Platon, Phaidon, 75 a 5 und 75 e 3ff. A.a.O., 74 d 6-75. Platon, Phaidros, 249 b 6-249 c 3 und 265 d 3-265 d 5. 85 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Einwenden mag man hier, diese Kritik stütze sich vorwiegend auf Platons optisch orientierten Rahmen, die theoria, vernachlässige aber die in diesem teils angesiedelten, teils ihm entgegengestellten dialogischen Aspekte, insbesondere die berühmte dialogbezogene Bestimmung des Verhältnisses von Denken und Reden. Nun: Zuallererst gilt natürlich, daß Verträglichkeit herrschen muß zwischen dem Rahmen und den Elementen eines Denkens. Keine zustimmungsfähige Philosophie ohne innere Kohärenz, die eine stimmige Selbstbegründung ermöglicht, eine Selbsteinholung der Einzelthesen bzw. der einzelnen Einsichten. Anderenfalls würde der Philosoph entweder mit seiner Rahmentheorie oder mit einzelnen Gedanken aus dem argumentativen Dialog herausspringen – ins Abseits. Was aber die Platonische Verhältnisbestimmung von Denken und Reden anbelangt, so hat es damit die Bewandtnis eines „Zwar – aber“: Auf der einen Seite steht die Dominanz der kosmos- und ideenschauenden Vernunft, auf der anderen der sokratische Dialogbezug. Nur, was wird aus diesem in jenem emphatisch theoretischen Rahmen? Die entscheidenden Stellen pro Denken als Dialog finden wir im „Sophistes“ und im „Theaitetos“, die beide um 365/366, vor bzw. nach Platons zweiter italienischer Reise, entstanden sein dürften. In dem späteren „Sophistes“ setzt der Fremde aus Elea zunächst Denken und Reden gleich und präzisiert dann, daß es das innere Gespräch der Seele mit sich selbst sei, was man Denken (διάνοια) nenne.231 Freilich setzt er ohne Umschweife, als ergebe sich das von selbst, eine Definition hinzu, welche sich am ehesten im Sinne eines kommunikationsunabhängigen Denkens verstehen läßt – als Erkenntnisweise, die sich der Sprache bloß als eines Mediums von Lauten und Worten bediene: „Der Ausfluß von jenem [dem Denken] aber vermittels des Lautes durch den Mund heißt Rede (λόγος).“232 Ganz ähnlich, doch differenzierter definiert Sokrates das Denken, διανοέισθαι, in dem wohl nach 365 verfaßten „Theaitetos“ als „eine Rede (λόγος), welche die Seele mit sich selbst über dasjenige durchführt, was sie erforschen will“, und zwar indem sie mit sich selbst rede (διαλέγεσθαι): sich selbst fragend und antwortend, bejahend und verneinend.233 An dieser Definition scheint in der Tat nichts auszusetzen zu sein, kann das Denken doch zweifellos als Selbstgespräch eines Denkenden vonstatten gehen. Und führe nicht auch ich in diesem Augenblick, wo ich, Dietrich Böhler, diese Erörterung verfasse, ein Selbstgespräch nach Platons Definition? Ja und nein. Natürlich bin ich in einem Selbstgespräch. Doch reicht Platons Bestimmung des Denkens als Selbstgespräch zu? ‚Ich’ 231 232 233 Platon, Sophistes, 263 c 3. A.a.O., 263 e 8f. Platon, Theaitetos, 189 e 4 und 189 e 6 - 190 a 2. 86 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie frage doch nicht einfach mich selbst, antworte nicht bloß mir selbst. Außerdem treffe ich nicht allein Ja- und Nein-Stellungnahmen. Freilich wird das Etwas-Denken noch heute häufig auf Ja- und Nein-Stellungnahmen reduziert: So spricht Ernst Tugendhat davon, daß die „Grundmodi“ des Sprachhandelns „wesensmäßig Ja/Nein-Stellungnahmen“ seien.234 Habermas und Knut Erik Tranøy lassen hingegen drei Grundmodi gelten. So konstatiert Habermas: „Die zulässigen Reaktionen [auf eine Äußerung mit Geltungsanspruch] sind Ja/Nein-Stellungnahmen oder Enthaltungen.“235 Auch Tranøys Pragmatik der Forschung hebt diese drei konstitutiven Akte hervor: „die Akte des Verwerfens, Annehmens und der Urteilsenthaltung bezüglich einer Aussage“.236 Diese traditionelle Triade übersieht eine vierte Gruppe von zulässigen Reaktionen, die Rückfragen nach Sinn und Geltung des Gesagten. Harmlos stellt sich hier zunächst die semantische Frage nach der Bedeutung des Gemeinten. Kritisch legt sich die Frage nach der Validität der Begründung nahe. Radikal kritisch können Diskursteilnehmer schließlich die Prüfbarkeit und Zulässigkeit einer Meinungsäußerung als Diskursbeitrag in Frage stellen: ist sie überhaupt ernsthaft diskutierbar? Die letztgenannte Frage ist eine diskurspragmatisch sinnkritische Reaktion. Sie drückt den Zweifel aus, ob das Gesagte überhaupt als Einlösung eines Geltungsanspruchs und damit als prüfbarer Diskursbeitrag verständlich ist, so daß es von Anderen geprüft und diskutiert werden kann. Wer so fragt, fährt gleichsam scharfes Geschütz auf. Er eröffnet eine sinnkritische Argumentation, die zu begründen hätte, daß die Rede pragmatisch nicht verstehbar ist. Was müßte eine solche Begründung leisten? Sie muß zeigen, daß die möglichen Adressaten sich zu dieser Rede nicht als Argumentationspartner verhalten können und daß, vice versa, der Sprecher diese seine Rede seinerseits nicht als Argumentationspartner entfalten und in einem Diskurs, worin nur prüfbare Diskursbeiträge statthaft sind, durchhalten kann, sondern durch seine Aussage in Widerspruch zu den Geltungsansprüchen und Anerkennungsverbindlichkeiten seiner Diskurspartnerrolle gerät. Aus der Adressatenperspektive wäre der pragmatische Sinnlosigkeitsverdacht also so zu erhärten, daß man dem Sprecher zeigt: aus seiner Rede könne ein Adressat gar nicht entnehmen, als was das Gesagte eigentlich zu nehmen sei; als Diskurspartner werde man von dieser Rede düpiert statt ernstgenommen, weil sie einem die Möglichkeit verstelle, ihren argumentativen Gehalt zu erfassen, zu prüfen und begründet 234 235 236 E. Tugendhat, Vorlesungen (1976), S. 518, vgl. 76f, 242f, passim. J. Habermas, Theorie d. kommunik. Handelns, I (1981), S.65. K.E. Tranøy, Pragmatik der Forschung, in: D. Böhler u. a. (Hg.), Die pragmatische Wende (1986), S. 3654, hier: S. 40f. 87 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Stellung zu beziehen. Kurz: das Gesagte sei kein Diskursbeitrag; der Sprecher springe damit aus dem Dialog der Argumente heraus – insofern disqualifiziere er sich und mißachte die Diskurspartner-Rechte. Eine derartige Begründung zieht ihre sinnkritischen Argumente aus dem Diskurs, verstanden als Sinnzusammenhang von Geltungsansprüchen und Gründen zu deren Einlösung – mithin zugleich als Anerkennungszusammenhang von Partnern; denn allesamt haben sie die Diskursrolle eingenommen und dadurch die diskurstragenden Verbindlichkeiten auf sich genommen. Die Begründung des pragmatischen Sinnlosigkeitsverdachts ist eine praktische Begründung aus dem Dialog der Argumente. So begründbar, ist das Geltendmachen eines Sinnlosigkeitsverdachts völlig legitim, ja zur Rettung des Diskurses erforderlich. Es wäre geradezu riskant und gefährdete die Dialog- und Denkkultur, wenn man diese u.U. ganz legitime sinnkritische Reaktionsmöglichkeit übergeht, weil man, wie etwa Habermas, nicht nachfragt, ob eine Urteilsenthaltung wirklich immer zulässig ist bzw. wann sie unzulässig wird. Ist letzteres nicht zumindest dann der Fall, wenn sich hinter der Enthaltung die Weigerung verbirgt, auf das Verhältnis von Geltungsanspruch und propositionalem Gehalt eines Diskursbeitrags zu reflektieren? Denn das käme der Verweigerung gleich, Rechenschaft darüber abzulegen, ob sich das inhaltlich Gesagte überhaupt mit der selbst beanspruchten Rolle eines Partners im argumentativen Dialog vereinbaren läßt. Dann läge eine Selbstimmunisierung gegen dialogische Sinnkritik vor: der Diskursteilnehmer zeigte, daß er nicht bereit ist, seine Verpflichtungen als Diskurspartner ins Auge zu fassen und sie zu befolgen. Sowohl Platons Bestimmung des Denkens als Selbstgespräch wie auch Tugendhats satzsemantische Verengung der Grundmodi des Sprachhandelns auf Ja- und Nein-Sätze und Tranøys bzw. Habermas’ Anerkennung von nur drei zulässigen Stellungnahmen verkürzen die zum Teil moralisch geladene, weil mit Diskurspartner-Pflichten verwobene, kommunikative Geltungsdimension der Pragmatik, welche der sachbezogene Sprecher zwar im Rücken läßt, von denen der Sinn des Gesagten aber getragen wird. Im puren Sachbezug konzentriert sich ein Sprecher auf die satzsemantischen und pragmatisch semantischen Aspekte des Sprachgebrauchs; man verengt den Blickwinkel auf den (assertorischen) Satz als Ensemble propositionaler Ausdrücke, die, wie Wittgenstein festhält, „bipolar“ sind.237 Nur im Zuge einer Ausblendung der Pragmatik kann man überhaupt annehmen, daß unser Sprachhandeln wesentlich aus Ja- und Nein-Stellungnahmen bestehe. Fassen wir zusammen: 237 L. Wittgenstein, Schriften, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1960, S. 188. 88 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Hinsichtlich des Sachbezugs der Rede ist der Blick auf das (Zu-sich-selber-)Ja-oder-NeinSagen zu erweitern durch eine Berücksichtigung der schon erwähnten beiden anderen Redeweisen. Einmal können Sprecher im Dialog auch mit einer Urteilsenthaltung reagieren. Dann lassen sie die Wahrheit oder normative Richtigkeit einer Rede dahingestellt sein238: als unentschieden oder moratorisch oder gar als unentscheidbar. Weitaus signifikanter für das Denken als argumentativen Dialog sind freilich die Verständigungs- und Begründungsfragen. Deren Spektrum reicht von der einfachen Erläuterungsbitte, wie das Gesagte zu verstehen sei, über die Forderung nach Angabe von Gründen für eine Behauptung bis zum sinnkritischen Zweifel an der Nachvollziehbarkeit der Rede als eines prüfbaren Diskursbeitrags. Es ist der letztgenannte, der pragmatisch kritische Fragetyp, der tief im Sokratischen Elenchos angelegt ist, praktiziert er doch ein sinnkritisches Rückfragen, das den Proponenten bei seiner Rolle als Diskurspartner packt – und letztlich die Vereinbarkeit seiner aktuellen These mit dieser Rolle in Zweifel zieht. Da das Denken nicht als einsames Selbstgespräch vonstatten geht, sondern als trans- und intersubjektives Erheben und Prüfen von Geltungsansprüchen, einen geltungsbezogenen Diskurs eröffnend oder fortsetzend, eignet ihm die eigentümlich reflexive und horizontöffnende Möglichkeit, Sinnkritik zu üben. Davon hat schon Sokrates schon einen gewissen Gebrauch gemacht. Allgemein gilt: wenn ein Elenchos zur Selbstaufhebung einer These führt, indem er zeigt, daß sich eine Position nicht als Diskursbeitrag verstehen und durchhalten läßt, dann handelt es sich um eine dialogpragmatische Sinnkritik. Diese radikal kritische Option steht jedem Diskurspartner offen. Da jeder, der über etwas nachdenkt, den dadurch angestrengten Erkenntnisprozeß nur durchführen kann, indem er sich an den Geltungsansprüchen messen läßt, die seinen Erkenntnisprozeß tragen, hat er auch – für die Anderen und für sich selbst – die Möglichkeit einer diskurspragmatischen Sinnkritik. Weil er mit Ansprüchen auf Geltung seiner Gedanken gegenüber Anderen und sich selbst hinsichtlich seiner Erörterung einer Sache bzw. Situation nachdenkt, provoziert er auch Fragen zweiter Ordnung: sinnkritische Fragen, die sich auf die Verstehbarkeit seiner Rede als einer dialogischen Handlung zur Einlösung der charakteristischen Geltungsansprüche beziehen. Zum Beispiel kann der Geltungsanspruch auf Verständlichkeit die Erläuterungsfrage auslösen, wie das Gesagte denn genau gemeint sei; und ‚mein’ Gegenüber kann ‚mir’ entgegnen: „diese Aussage(n) habe ich nicht verstanden“. Und die eigentlichen Gültigkeitsansprüche auf Wahrheit der Sacherörterung und Richtigkeit bzw. Legitimität der implizierten Normen können die sinnkritische Reaktion hervorrufen: „diese deine Behauptung 238 Vgl. K.E. Tranøy, in: D. Böhler u. a. (Hg.), Die pragmatische Wende (1986). 89 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie kann ich gar nicht als Diskursbeitrag verstehen, weil ihr propositionaler Gehalt Geltungsansprüchen zuwiderläuft, die du als Diskurspartner ins Spiel gebracht hast. Ich kann sie nicht als Diskursbeitrag verstehen, weil sie nicht prüfbar, mithin im argumentativen Dialog sinnlos ist.“ Solche typischen Diskursakte sind eben weder Ja-oder-Nein-Stellungnahmen noch Urteilsenthaltungen, sondern fragende Entgegnungen, die den Sprecher mit tragenden Ansprüchen seiner Rolle als eines Diskurspartners konfrontieren. Sie bringen keine Meinung des Opponenten über die Sache ins Spiel; vielmehr erinnern sie den Proponenten an seine diskurskonstitutiven Verpflichtungen, die er dadurch eingegangen ist, daß er sein Gedachtes/Gesagtes geltend macht und damit die Rolle eines Partners im Diskurs übernommen hat. Fragen dieser Art setzen den sozialen und daher normativ geladenen Anerkennungs- und Handlungszusammenhang gegenüber einem Sprecher und dessen These in sein Recht. Uno actu machen sie – durch den normativen Basisgehalt der gemeinsamen Institution Diskurs legitimiert und mandatiert – ihre Diskursrechte gegen den Sprecher geltend. Platons Definition des Denkens als Selbstgespräch der Seele verdeckt diesen sozialen und normativen Handlungszusammenhang des Diskurses. Sie blendet aus, daß sowohl die Ja-undNein-Stellungnahmen als auch die ausgeklammerten sinnkritischen Entgegnungen immer zugleich logische und normativ soziale, nämlich dialogische Akte sind. Durch sie beziehe ‚ich’ mich sowohl auf mögliche konkrete Andere – jetzt z.B. der Autor dieses Buches auf Platon, Tugendhat und Habermas – als auch auf alle möglichen Anderen. Zu diesen zählen Sie, meine Leserin, mein Leser, ebenso wie jedes andere intelligente Kommunikationswesen, das meine Fragen, meine Thesen verstehen und beurteilen könnte. Inwiefern und warum? ‚Ich’ kann, wenn ‚ich’ etwas denke (oder ‚du’ etwas denkst), mich gar nicht anders verhalten als so, daß ‚ich’ (resp. ‚du’) sowohl die Verstehbarkeit als auch die mögliche Gültigkeit meines Versuchs im ganzen und seiner einzelnen Schritte beanspruche – gegenüber bestimmten realen Anderen, über deren Thesen ‚ich’ rede, aber auch allen möglichen Anderen gegenüber. Wenn wir uns auf einen sinnkritischen sokratischen Dialog mit einem Skeptiker einlassen, der das Gegenteil zu behaupten versucht, erkennen wir leicht, daß eine Bestreitung (oder auch nur eine Bezweiflung) des sozialen Verhältnisses der Geltungsansprüche eine sinnlose Behauptung ist. Sinnlos, weil für Andere und für mich selbst nicht mehr verständlich als Rede, die man aufnehmen bzw. in ihrem Sinn nachvollziehen und hinsichtlich ihrer Wahrheits- oder Richtigkeitsfähigkeit beurteilen kann: ohne Verstehbarkeitsanspruch 90 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie bestünde keine Fragemöglichkeit, wie ein Gesagtes genau gemeint sei; und ohne Gültigkeitsanspruch hätten wir keinen Anhaltspunkt, von dem Sprecher Gründe (oder bessere Gründe) für seine These zu verlangen, und ebenso fehlte uns das Mandat, seine These zu kritisieren und ihn in eine kritische Prüfung zu ziehen. Kurzum, ohne Geltungsansprüche könnten wir keinen Diskurs mit einem Sprecher führen – und ebensowenig er mit sich selbst. Wir wüßten nicht, worüber wir mit wem diskutieren könnten. Eine Diskussion könnte es nicht geben. Nun müßten wir uns noch zweierlei klarmachen: wer zu den realen Anderen gehört, auf die ‚wir’ uns als Diskursteilnehmer mit Geltungsansprüchen von vornherein beziehen; und warum ‚wir’ uns mit unseren Geltungsansprüchen – um Himmels willen – auf alle möglichen Argumentationssubjekte und deren Argumente müssen beziehen sollen. Zum ersten Punkt: Es leuchtet ein, daß der Sprecher seine Geltungsansprüche denen gegenüber erhebt, mit denen er sich auseinandersetzt, hier vor allem gegenüber Platon. Doch damit sei, so mag man annehmen, der Kreis der realen Kommunikationssubjekte, auf die sich ein Diskursteilnehmer beziehen muß, auch erschöpft. – Nein, weit gefehlt. Bedenke doch, daß du, indem du eine bestimmte Sprache sprichst, an der gesamten Gemeinschaft derer teilnimmst, die diese Sprache bis auf den heutigen Tag gesprochen haben und sie dadurch mitgebildet haben; du setzt diese Sprachkultur fort und sprichst auf ihren Wegen weiter. Also beziehst du dich implizit auf eine empirisch kaum begrenzbare reale Kommunikationsgemeinschaft, z.B. auf die Gemeinschaft aller, die bislang deutsch gesprochen haben. Dieser reale Traditions- und Gemeinschaftsbezug bildet die Sinn vermittelnde geschichtlich pragmatische Dimension, die die Rede immer schon im Rücken hat: Etwas als etwas Bestimmtes meinend bzw. sagend, zehren wir von dem lebensweltlichen Hintergrund tradierten und mehr oder weniger institutionalisierten Sinns.239 Als Mitglieder einer umgangsund bildungssprachlichen, real geschichtlichen Kommunikationsgemeinschaft oder mehrerer Sprachgemeinschaften, schöpfen wir mit jedem Satz aus dem Sinnreservoir, das die Sprecher ganzer Generationenketten angesammelt haben. Mit ihnen sind wir unausdrücklich verbunden; sie begleiten uns als unsere impliziten Mitsprecher, wenn wir laut oder leise reden, in Gespräch oder Selbstgespräch, vom Assoziieren bis zum Argumentieren. So ergibt sich schon aus diesem Grund, nämlich aus der geschichtlichen Traditionsvermitteltheit unseres möglichen Redens und Etwas-Denkens, auf die der rhetorische Humanismus und das hermeneutische Sprachdenken (etwa Humboldt, Gadamer, 239 D. Böhler, Rek. Pragm. (1985), S.360ff. 91 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Apel) aufmerksam machen, daß unser Etwas-Denken nicht einfach ein Selbstgespräch unserer Seele mit sich ist, sondern ein Selbstgespräch in hintergründiger Kommunikation mit Anderen, die aus unseren Traditionszusammenhängen gewissermaßen mitsprechen. Das heißt: Auch wenn unsere Gedanken überhaupt nicht ausdrücklich auf Andere Bezug nehmen, sind sie (und durch sie wir selbst) im vorhinein auf reale Andere aus Geschichte und Gegenwart bezogen. Dieses kommunikative Vermitteltsein unserer Gedanken und unserer selbst läßt sich mit Apel als „das Apriori der realen Kommunikationsgemeinschaft“240 einer intersubjektiven Sinnverständigung durch geschichtliche Sprachen begreifen und mit Hans-Georg Gadamer als „das Prinzip der Wirkungsgeschichte“241. Aus diesem philosophisch- bzw. transzendental-hermeneutischen Grund, nämlich aus dem „apriorischen Perfekt“ (Heidegger) der Sinnvermitteltheit möglicher Rede folgt bereits, daß ein Selbstgespräch bloß als defizienter Modus einer intersubjektiven Sinnverständigung begriffen werden kann – mithin nicht als Paradigma des Etwas-Denkens taugt. Dieses Paradigma ist vielmehr in dem argumentativen Dialog mit dessen geschichtlichem Kontext zu suchen, also im Blick auf die sprachliche Sinn- und Traditionsvermittlung. Darauf weist die nachfolgende Abbildung mit der unteren geschweiften Klammer hin; insgesamt veranschaulicht sie die Dimensionen der Zeichenverwendung (Semiose), indem sie die drei von Charles W. Morris unterschiedenen semiotischen Dimensionen, die semantische, die syntaktische 240 241 und die umgreifende pragmatische, weiter differenziert. Vgl. K.-O. Apel, Transf. d. Philos., II (1973), S. 338ff, 397-435, 178-219 und Transf. d. Philos., I (1973), S. 22-76. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode (1965), S. 250-290, 324-395. 92 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Die semiotischen Sinn-Dimensionen des Über-Etwas-Redens bzw. Etwas-Denkens dialogisch-pragmatische Dimension: Primat d. Geltungsansprüche u. Geltungsrechtfertigung – „Apriori d. idealen Kommunikationsgemeinschaft“ S2, 3, ... referentiell-semantische Dimension: Situations- bzw. Sachbezug pragmatisch-semantische Dimension: Wortgebrauch Z Z SxÆ∞ Z Syntaktische Dim.∗ Sit Z S1 Z Sn, n 1, n 2, ... geschichtlich-pragmatische Dimension: Prius der lebensweltlich-kulturellen Vermittlung u. Institutionalisierung von Sinn – „Apriori der realen Kommunikationsgemeinschaft“ Erläuterungen: Sit Z S1 Situation bzw. Sache Sprachzeichen Sprecher als über etwas (Sit) nachdenkendes (oder auch in Bezug darauf handelndes) Subjekt faktische Argumentations- und Kommunikationsgemeinschaft, auf die sich S1 bezieht S1 _____________ Z pragmatisch-semantische Dimension der Sprachverwendung eines Sprechers/Denkenden dialogisch-pragmatische Dimension der Voraussetzung bzw. Erhebung S1 -----Z ------S2 / SxÆ∞ und Prüfung von Geltungsansprüchen im Diskurs S2, 3, ... Z .............................. Sn, Sn1, n2 ... geschichtlich-pragmatische Dimension der Traditionsvermittlung und Institutionalisierung von Sinn Sn, Sn1, n2 ... lebensweltliche Sprach- und Kulturgemeinschaft, von der jeder schon Sinn und Bedeutung übernommen hat ∗ Das Schema gibt der Einfachheit halber die syntaktische Dimension nur einmal wieder; diese wäre überall dort, wo „Z“ (für Sprachzeichen) steht, mitzudenken. Denn ein sprachlicher Ausdruck (Zeichen) verweist immer auf einen sprachlich ausdrückbaren Kontext, aus dem er (es) nur in Bezug auf andere verständlich ist. 93 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie S xÆ ∞ kontrafaktische Argumentationsund Kommunikationsgemeinschaft als Beurteilungsinstanz für Geltungsansprüche von S1, und S2, S3, ... 94 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Für die Auseinandersetzung mit Platons Definition des Denkens als Selbstgespräch der Seele ist die, in der Abbildung getroffene, Unterscheidung der „geschichtlich-pragmatischen SinnDimension“ von der „dialogisch-pragmatischen Geltungsdimension“ von besonderer Bedeutung. Denn beide Begriffe verweisen auf einen in gewisser Weise eigenständigen Aspekt des Kontextes der möglichen Rede, der sich jedoch auf den anderen Aspekt intern bezieht. Inwiefern? Argumente, für die wir als Denkende bzw. als Diskursteilnehmer Geltung beanspruchen, blieben leer und semantisch unverständlich ohne den Kontext einer realen Sprach- und Traditionsgemeinschaft, aus der sie erst den sprachlichen Sinn und die Wortbedeutung beziehen. Umgekehrt müßte die sprachgemäße Wortverwendung, Sinnübernahme und Sinnschöpfung in Sprechakten blind und rechtfertigungsunfähig, also bloß willkürlich oder gänzlich heteronom bleiben, wären sie nicht verknüpft mit tragenden Geltungsansprüchen, hinsichtlich derer die Behauptungen (und die als sinnvoll etc. behaupteten Fragen), überprüft werden könnten. Den von einer Rede nicht abzuziehenden Geltungssinn, der den Mitdenkenden, darunter dem Sprecher selbst, erst das Mandat der Kritik vermittelt, hat Platon zweifellos gedacht – so im Begriff des richtigen Logos (ορθός λόγος, orthos logos) und im Begriff der Idee. Nicht zuletzt damit hat er dem europäischen Denken einen kritischen Impetus, ja eine kritische Gesinnung übermittelt. Doch siedelt er diese, die Denkenden zur Kritik seines Etwas-Meinens und Sagens anhaltenden Begriffe einfach in der Beziehung des Denksubjekts auf den gedachten, und zwar intelligiblen Gegenstand an – übertragen auf unser semiotisches Schema: in der metaphysisch überhöhten referenzsemantischen Dimension der reinen Strukturen und Muster bzw. „Paradigmen“. Damit verdeckt er „das eigene Wesen der Sprache“ (Gadamer) gründlich.242 Wieso? Er ignoriert den zweifachen Gemeinschaftsbezug der Sprache als Rede, genauer: das zwiefache soziale, dialogische, daher mehrstellige Verhältnis zwischen einem Denk- bzw. Redesubjekt und anderen solchen Subjekten. Es ist eingelagert in den Sachbezug des Denkens/Redens, und es trägt diesen, indem es sowohl Bedeutung als auch Geltung ermöglicht. Sein Modell ist nicht die Teilnahme an einer Gemeinschaft und deren Diskurs, es ist das je einsame Schauen eines Bildes bzw. eines Musters oder der Gestalt eines herzustellenden Dinges, so wie er es im X. Buch der „Politeia“ am Handwerkermodell erläutert.243 Geleitet und verführt vom Schein der theoria-Metapher, die das Etwas-Denken nicht als Verständigung über Sinn und als Kooperation über Geltung (Wahrheit und Richtigkeit), 242 243 So H.-G. Gadamer, a.a.O., S. 385. Platon, Politeia, 595 c 7 - 597. 95 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie sondern als einsam mögliches Erschauen unterstellt, verharrt Platon in einer Subjekt-ObjektRelation, die als solche bloß zweistellig ist. Infolgedessen überspringt Platon neben der Sinnbeziehung des Gesagten auf eine reale geschichtliche Kommunikationsgemeinschaft auch die Geltungsansprüche eines Gedankens als Diskursbeitrag, also die Geltungsbeziehung einer Rede auf das ideale Diskursuniversum. Dieses ist freilich ein regulatives Prinzip: Inbegriff eines Diskussionsforums, auf dem einzig sinnvolle Diskursbeiträge zählen würden und wo alle, samt und sonders alle, sinnvollen Argumente zur Sache die gehörige Berücksichtigung fänden. Wer an die ewigen Seins-Ideen glaubt und vermeintlich den Zugang zu ihnen besitzt, bedarf einer solchen regulativen, daher zur Selbstkritik auffordernden Geltungsinstanz nicht. Er ist sich des Wahrheitsbesitzes sicher. 96 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie III Diskurs und Begründung im Spannungsfeld von Seinsschau, SelbstBewußtsein und Kommunikationsreflexion. 4 Die klassische Metaphysik Hinter Platons handwerklichem Produktions- bzw. Poiesismodell verbirgt sich seine Metaphysik des geistigen Sehens der Ideen, der Bauformen der Dinge. Sein Handwerkermodell ist gewissermaßen die technisch handfeste Außenseite seiner spekulativen Kosmostheoria. Seine monologistische, ja methodisch solipsistische Deutung der technischen Tätigkeit und der Erkenntnistätigkeit führt ihn dazu, die einsame theoria an die Stelle des kommunikativen Diskurses zu setzen – oder den philosophischen Diskurs als einsam geistige Schau zu denken. 4.1 Platon Über einen Zeitraum von weit mehr als zwei Jahrtausenden hat Platons Entscheidung für einsame Theorie gegen kommunikative Argumentation und damit auch für eine Reflexion in theoretischer Einstellung anstelle einer Besinnung auf Diskursvoraussetzungen in dem je geführten Dialog das abendländisch mittelmeerische Denken, die europäische und über diese auch die moderne Philosophie in der Welt geprägt. Sie tat dies direkt und indirekt, nämlich in Nachvollzug, aber auch in der Kritik. Der tiefen Wirkung dieser Grundentscheidung können wir vielerorts begegnen, naturgemäß innerhalb des ontologisch metaphysischen Paradigmas, aber auch im bewußtseinsphilosophischen Paradigma und in der widergängerischen Rhetorik, ja sogar – wir haben es schon bemerkt – inmitten des kommunikationsbezogenen Paradigmas. 4.1.1 Metaphysik, Logos und Ideen Die Entdeckung des Allgemeinen und Platons Ideenlehre Was in der Metaphysik (als geistig-abendländischer Spekulation über das ‚Ganze’, den Inbegriff des Wirklichen und Erkennbaren, die in der Einstellung eines ,geistigen Sehens’ und tendenziell auf einem Gottesstandpunkt vorgenommen wird) weist hinaus über diesen spekulativen Horizont mit sinnlosen, argumentativ nicht einholbaren Annahmen? Die Entdeckung des Logos als des begrifflichen und des transzendental erfragten Allgemeinen (a) und (b) des Dialogs und der argumentativ dialogischen Methode, seit Platon meist „Dialektik“ genannt, als dem Weg der Untersuchung bzw. 97 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie [µέθ/οδος -> Weg, Gang, Fortgang, µετά : in, zwischen, durch, gemäß] der Verfahrensweise, den richtigen Logos zu finden und zu erkunden. Die Was-ist-Frage als Anfang von Erkenntnis und Wissenschaft. Das Allgemeine und Geltungsbezogene in der Metaphysik oder: metaphysica generals als Suche nach dem Logoshaften, das dem wahrgenommenen mal besprochenen bzw. benannten Vielen und Besonderen gemeinsam ist; und zwar so, dass es uns die Möglichkeit gibt, jenes Viele als ein Eines zu Verstehen, indem wir einen Begriff dafür verwenden: die vielen Erscheinungen als etwas zu bestimmen, das von ein und derselben Art ist, so dass wir in dem Vielen Eines erkennen. Eben danach fragen Sokrates und Platon mit der Was-ist-Frage, z. B. Was ist die Tapferkeit? (Laches) Was ist die Besonnenheit? (Charmides) Was ist die Frömmigkeit? (Euthypron) Was ist die Tugend? (Menon) Was ist die Episteme? Theaitetos Was ist das Sein? Sophistes Der beste Logos gilt Sokrates als Resultat eines argumentativen Dialogs, Platon hingegen als Ausdruck einer Idee, d. h. als Resultat einer Dialektik, deren Erkenntnisweise als geistiges Sehen bestimmt wird. Die Antwort auf die Was-ist-Frage besteht in einem Logos. Diesen bestimmt Sokrates als das beste Argument, das sich ihm beim Logizesthai oder Dialegesthai als der am besten begründete herausstellt (z. B. Kriton, 46b). Platon bestimmt ihn als Wiedergabe einer Erkenntnis, die im Sinne eines geistigen Sehens die Idee (Aussehen, Gestalt, reine Form, Struktur) eines Seienden, z. B. die geometrisch definierbare und konstruierbare Schau als Bewegungsform des Kosmos, zum Gegenstand hat – oder das Paradigma (Muster, Vorbild) eines Verhaltens bzw. Handelns der Vernünftigen. 98 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Die Dialektik als Umkehrungstechnik und ihr kosmostheologischer Hintergrund Wenn wir den Hintergrund der Ideenlehre und der Dialektik näher betrachten, bemerken wir, daß es nicht einfach ein ontologischer, sondern zugleich ein kosmostheologischer Hintergrund ist. Martin Heidegger hat von der Ontotheologie Platons gesprochen.7 Etwa in diesem Sinne reden wir von Platons Vernunft als einer Kosmosvernunft, das heißt von dem nous als innerem Auge der Seele, das nicht das Vergängliche, Leibhafte und SinnlichErscheinende wahrnimmt, sondern das Immer-Seiende, Göttliche und als Kosmos Sichtbare: die vollkommene, weil autarke, das heißt selbstgenügsame und in sich ruhende Bewegungsform des Kreises und dadurch die ewig selbige, göttliche Wohlordnung des wahren Seins. Der menschliche nous ist aber nur ein unvollkommenes Abbild des göttlichen nous: von diesem sagten schon Homer und Hesiod, er sei das alles zugleich sehende Auge des Zeus; der Sänger und Dichter Xenophanes - der als Begründer der „Eleatischen Schule" gilt, die über Parmenides erheblichen Einfluß auf Platon ausgeübt hat - lehrt von Gott: „Er ist als ein Ganzer nous."8 Dieser göttliche nous durchwaltet das All und verleiht ihm die ewige Kreisform, so daß es eine Wohlordnung, ein unwandelbarer Kosmos ist. Zwar hatte, wie wir andeuteten, diese Kosmostheologie seiner Zeit schon Tradition. Auch ist die Kosmosfrömmigkeit im klassischen wie noch im späten Griechentum (Stoa!) tief verwurzelt. Aber ein spekulatives Denken in diesem Rahmen, das ein für das menschliche Auge unsichtbares, ewiges Wesen des Seienden annimmt, steht völlig quer zum griechischen Gemeinsinn. Deshalb fordert Platon wie schon Parmenides eine radikale Umkehrung des normalen Bewußtseins. Denn diese sei die Eingangsbedingung des Philosophierens. Er charakterisiert die Dialektik sogar als die Kunst (téchnē) der Umwendung (periagogē) des Bewußtseins von der Welt des sinnlich Wahrnehmbaren zur Welt der Ideen; denn der philosophisch ungebildete Mensch nehme bloß die sinnlichen Erscheinungen wahr, weil er eng an die Leibhaftigkeit und den Horizont der Sinneswahrnehmung gebunden sei. Diese Lage drückt Platon im „Staat" durch das Bild einer unterirdischen Höhlenexistenz aus: Die natürlichen, ungebildeten Menschen lebten gleichsam gefesselt in einer Höhle, in der ein Feuer brennt. Sie seien nur fähig, die Schatten der Geräte und Bildsäulen, die hinter ihrem Rücken im Feuerschein vorübergetragen würden, wahrzunehmen. Diese ihnen vertrauten Schattenbilder hielten sie „für das Wahre" (514a-515c). 7 8 M. Heidegger: Identität und Differenz. Pfullingen 1957, S. 35 ff., bes. S. 55. Homer: Ilias 16, 688; Hesiod: Theogonie 267; Xenophanes: Fragment B 24. In: H: Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker. Hamburg 1957, S. 19. 99 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Man müsse sie erst entfesseln und dazu zwingen, „aufzustehen, den Hals herumzudrehen, hinauszugehen und gegen das Licht zu sehen". Das aber bereite ihnen wegen des flimmernden Glanzes Schmerzen und würde sie ganz verwirren, so daß man sie nur „mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang" schleppen könne, bis sie „an das Licht der Sonne gebracht" wären, wo sie aber zunächst nur geblendet seien und nur Schatten erkennen könnten. Erst durch Gewöhnung kämen sie dazu, die Dinge selbst und zu allerletzt die Sonne zu sehen. So könnten sie schließlich begreifen, „daß sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft, und alles ordnet in dem sichtbaren Raume, die gewissermaßen auch die Ursache dessen ist, was sie darin sehen" (515c-516c). Die Sonne aber, die sie zuletzt und nur mit Mühe erblickten, sei die Idee der Ideen, nämlich die Idee des Guten. Platon bestimmt sie zweifach: als Ursache des wahren Seienden sowie als Quelle der Wahrheit und der besonnenen Praxis (517 b und c). Mit der Annahme der Ideen und der Idee des Guten macht Platon eine zweifache Unterscheidung, die zugleich ontologisch und erkenntnislogisch ist, also zugleich die Seinslehre (Ontologie) und die Erkenntnislehre betrifft: - zwischen dem leibhaft zeitlichen Sein der sinnlich erfahrbaren Welt und dem göttlich ewigen Sein der geistig erschaubaren Ideen, - zwischen dem Sein überhaupt und der Idee des Guten, die jenseits des Seienden ist: sowohl als der Ursprung der Existenz wie auch als Grund für die Erkennbarkeit des Seins. Die Unterscheidung von Ideenwelt und Sinnenwelt PLATON unterscheidet die Sinnendinge, die wir durch sinnliche Wahrnehmung erfahren, von den Ideen, die wir durch intuitive Vernunft (nous), durch eine Art geistigen Sehens oder intellektueller Anschauung erfassen. Er geht also davon aus, daß zwei verschiedene kognitive Leistungen - die er freilich beide nach dem Modell des „Sehens“ versteht - zwei verschiedene Wirklichkeiten erschließen: das Reale und das Ideale. Zwischen beiden Wirklichkeitsbereichen bzw. Seinsarten verläuft eine scharfe Trennung. Man hat oft von der Zwei-Welten-Theorie Platon gesprochen. Aber eine radikale dualistische Deutung dürfte verfehlt sein; denn er geht von der Vermittlung des Real-Seienden mit den Ideen aus. Seine Ideenlehre behauptet nämlich, daß alles 100 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Real-Seiende an den Ideen teilhat und daß erst diese Teilhabe der Grund dafür sei, daß etwas ist und zugleich, warum etwas so ist, wie es ist. Diese Lehre von der Teilhabe (méthexis) führt Platon dann im „Phaidon“ und im „Timaios“ dazu, die Ideen als den eigentlichen Grund des Seienden bzw. als die eigentliche Ursache des Seienden zu charakterisieren. Freilich betont er, das sinnlich wahrnehmbare Real-Seiende habe nur abbildhaft an den Ideen teil. Die Ideen seien die Urbilder (Paradigmen) des Real-Seienden und damit auch das eigentlich Seiende. Schema 1: Die altgriechischen onto-theologischen Unterscheidungen Homers und Hesiods Menschen Gott bzw. Götter Unterscheidungsebenen Zeitlich seiend eingespannt zwischen Vergangenheit und Zukunft immer seiend wahres Sein in ewiger Gegenwart onto-theologisch Wissen bloß vom Hörensagen und durch sinnliche Wahrnehmung (Scheinwissen) alles sehend, alles wissend epistemologisch (erkenntnistheoretisch) Leib, Seele u. menschlicher nous reiner, absoluter nous epistemologisch und psychologisch Die Unterscheidung zwischen dem wahren Sein (Ideen) und der Idee des Guten Wie können nun das sinnlich nicht wahrnehmbare Wesen des Welthaft-Seienden (die Ideen) und die - in der menschlichen Handlungswirklichkeit ebenfalls nicht erscheinenden Vorbilder der Tugenden erkannt werden? Das Sonnengleichnis der „Politeia" gibt darauf die Antwort: Wie das Sonnenlicht die beschienenen Dinge für das menschliche Auge sichtbar macht, so mache die Idee des Guten das unsichtbare Wesen und damit die verborgene Wahrheit des Seienden offenbar. Aber damit ist die Sonnen-Analogie noch nicht ausgeschöpft. Platon zieht auch die Wirkung der Sonne auf die Natur heran. Die Sonne verleihe „dem Sichtbaren nicht nur die Möglichkeit, gesehen zu werden, sondern auch das Werden und Wachstum und Nahrung". Ebenso könne man sagen, daß das Gute nicht nur Erkenntnis ermögliche, sondern auch „das Sein und das Wesen" bewirke. Die Idee des Guten ist also sowohl der letzte Grund für die Erkennbarkeit wie auch die erste Ursache für das eigentliche Sein, für die Form und den Bestand. Eben 101 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie deshalb nennt PLATON die Idee des Guten „Göttlich"; denn sie ermöglicht die Erkenntnis der für das bloße Auge unsichtbaren Strukturen, die dem welthaft Seienden Bestand verleihen, und die Erkenntnis der idealen Vorbilder (Paradigmen), durch die erst ein heilsamer und nützlicher Gebrauch der Normen, Werte und Tugenden möglich wird. Die praktisch-philosophische These der Ideenlehre lautet also: Erst die Idee des Guten, also die Einsicht in das wahrhaft und an und für sich Gute, das nicht etwa als Mittel für anderes, sondern um seiner selbst willen erstrebenswert ist, ermöglicht die richtige Beurteilung und den heilsamen Gebrauch von Normen, Tugenden, Werten und Lebensgütern. Wir haben soeben Grundzüge der Ideenlehre rekonstruiert, die eindeutig spekulativ metaphysisch sind, aber hinausweisen und in wirkungsgeschichtlich über diesen spekulativen Rahmen den Paradigmen der Erkenntniskritik wie auch der Kommunikationsphilosophie – darauf stößt man allenthalben – eine grundbegriffliche Bedeutung erlangen konnten. Zur Abrundung einer Interpretation der Ideenlehre aus dem Höhlengleichnis möchte ich Sie mit Walter Bröckers immanent ansetzendem Kommentar bekanntmachen: „Wir Menschen leben wie in einer Höhle. Das, womit wir alltäglich umgehen und was wir ganz selbstverständlich das Seiende nennen, ist in Wahrheit nur ein Schatten und gar noch ein Schatten von Nachbildungen der Dinge. Der Alltagsverstand will sich nur schwer einreden lassen, dass diese ihm so vertraute Welt nicht die wahre Welt sei, sondern dass es etwa in Wahrheit nur die Atome und das Leere gäbe, wie Demokrit lehrt, nach dessen Meinung das für gewöhnlich für das Seiende Gehaltene nur geltungsweise (νόµω) ist, d. h. nur als Seiendes gilt, ohne es doch zu sein. Entsprechendes gilt auch für die pythagoreische Astronomie. Die Bewegungen der Planeten, die wir unmittelbar am Himmel beobachten, sind nicht ihre wahren Bewegungen, sondern eine durch den Standort des Menschen bedingte Perspektive, von der her wir erst auf die wahren Bewegungen zurückschließen müssen. Bei dem Versuch, das zu tun, wurden schon die Griechen bis zum heliozentrischen System geführt, und Kopernikus kannte seine Vorgänger. Aber in einer Hinsicht ist die Lage heute anders als damals. Damals erschien die Wahrheit der Wissenschaft höchst unglaubwürdig gegenüber der ungeheuren Autorität der davon abweichenden Alltagswelt. Heute dagegen hat die Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, eine solche Macht 102 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie über unser Leben und eine solche Autorität gewonnen, daß wir geneigt sind, unsere Alltagswelt für nichts anderes zu halten als für das Weltbild einer etwas zurückgebliebenen und noch sehr unvollkommenen Wissenschaft. Daß sie das nicht ist, sondern etwas Ursprüngliches und Reiches, aus dem die Welt der Wissenschaft ein höchst künstliches Abstraktionsprodukt ist, haben wir erst neuerdings, besonders seit Heidegger, zu bedenken gelernt. Daß aber die von den Griechen neu gefundene Welt der Wissenschaft, die für sie eine Errungenschaft war und etwas, worauf sie stolz waren, doch noch nicht das wahrhaft Seiende sei, daß man noch über sie hinausgehen müsse zu dem, was Plato die Ideen nennt, dass erst dieser Übergang die wirkliche Befreiung bedeutet, das drückt das Gleichnis aus. Nachdem Sokrates das Gleichnis von der Höhle erzählt hat, gibt er selbst die Deutung: die Welt der Schatten in der Höhle ist die sinnliche Welt, der Aufstieg nach oben aber ist der Weg der Seele in den intelligiblen Raum (τόπος). Die Idee des Guten ist das, was in diesem Bereich zuletzt und nur mit Mühe gesehen wird. Wer sie aber sieht, der muß auch schließen, daß sie für alles die Ursache des Richtigen und Schönen ist, daß sie im Bereich des Sichtbaren die Helligkeit und ihren Herrn, die Sonne, erzeugt hat, im intelligiblen Bereich aber selbst als Herrin Wahrheit und Vernunft gewährt, daß diese also sehen muß, wer in privaten oder öffentlichen Angelegenheiten einsichtig handeln will (517c.) Wenn nun (so erklärt Sokrates weiter) der Seele der Aufstieg zu der höchsten Höhe der Idee des Guten gelingt, dann ist es kein Wunder, daß diejenigen, die bis dahin gelangt sind, keine Neigung haben, sich wider mit den menschlichen Angelegenheiten abzugeben, sondern mit der Seele immer dort oben verweilen möchten. Wenn sie sich aber doch zurückwenden, dann werden sie eine ebenso schlechte Figur machen wie im Höhlengleichnis die Befreiten, die in die Höhle zurückkehren. Sie, die die Idee der Gerechtigkeit geschaut haben, sollen jetzt streiten über ihre Schattenbilder, und dazu mit solchen, die die Idee nie gesehen haben (517d). Aus dem Gesagten folgt, daß die gängige Vorstellung über die Paideia falsch ist. Man meint nämlich, man könne jemand, in dessen Seele kein Wissen ist, das Wissen einsetzen, als könnte man blinden Augen das Sehvermögen einsetzen. Vielmehr ist schon in jeder Seele ein der Sehkraft des Auges entsprechendes Vermögen vorhanden; wie man, damit einer sehe, der die Sehkraft besitzt, das Auge mitsamt dem ganzen Leibe aus dem Dunkel in den hellen Raum bringen muß, so muß entsprechend das Denvermögen zugleich mit der ganzen Seele aus dem Raum der metaphysischen Dunkelheit, d. h. der Region des Werdens, herausgeführt 103 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie werden, bis er beim Seienden und beim Glänzendsten darunter auszuhalten gelernt hat, dem Guten nämlich. Solches leistet die Kunst der Umwendung (περιαγωγή 518d). Die periagogē zielt darauf ab, die Denkkraft „so umzuwenden, daß sie vom Sinnlichen abgewendet wird. Es ist nach Plato dieselbe Denkkraft, mit der wir erkennen, daß Sokrates gerecht ist, und mit der wir das Wesen der Gerechtigkeit selbst und als solches erblicken. Aber nur im letzteren Falle betätigt sie sich im Raum der metaphysischen Helligkeit und bringt daher wirkliches Wissen hervor, im anderen Falle aber tappt sie im metaphysisch dunklen Raum des Werdens und bringt nur Meinung hervor.“244 Erstaunlicherweise kommt der späte Platon nicht mehr auf seine anfängliche Begründung der Ideenlehre zurück, auf sein fast transzendentalphilosophisch anmutendes Konzept der Ideenerkenntnis durch eine methodisch angeleitete Wiedererinnerung, die in der Philosophiegeschichte, insonderheit im Paradigma der transzendental fragenden Erkenntniskritik, große Karriere gemacht hat. 4.1.2 Platons strukturale theoria-Ontologie oder: Vom Diskurs zur einsamen Ideenschau, vom argumentativen und reflexiven Dialog zum totalitären Kosmos-Polis-Mythos. Seit dem mittleren Platon – klassisch im „Menon“ – entwickelt Platon eine spekulative Dialektik. Sie soll kognitive und moralische Intuitionen zu Bewußtsein bringen und in ein begriffliches Wissen transformieren. Ihr Kernstück ist die Erinnerungslehre der Seele. Geleitet von einer Dialektik als Technik des Fragens (nach dem wahren, ewigen Seienden) und des Antwortens (als Formulieren von Ideen), könne der vernunftbegabte Teil der Seele sein implizites Vorwissen wieder erinnern (Anamnesis), es dabei explizieren und in Besitz nehmen, indem er es in die Form des Logos bringt, also dessen Gehalt auf Allgemeinbegriffe bringt, genauer: auf Begriffe mit Kriterienfunktion.245 Im „Phaidon“ begründet Platon die Anamnesis-Lehre ausdrücklich. Er verweist auf die Wiedererinnerung der von der Seele vor der Geburt eines leibhaften Individuums geschauten Urgestalten des Seienden. Durch eine Reflexion auf notwendige Idealisierungen in einer faktischen Erkenntnis will er zeigen: wir wissen immer schon mehr, als wir in der Sache und ausdrücklich wissen. Denn wer z. B. gleiche Holzstücke sehe, der wisse im Grunde auch, daß diese nur annähernd, nicht aber vollkommen gleich sind. Wie aber könnte man das in der Erfahrung Gegebene als defizient 244 W. Bröcker, Platos Gespräche, Frankfurt a. M. 21967, S. 283-285. 245 Vgl. G. Martin, Einleitung in die allgemeine Metaphysik, Stuttgart 1974. 104 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie gleich, gut, seiend usw. erkennen, besäße man nicht ein „Vorwissen“ (προειδέναι, proeidenai) von dem, was vollkommen und an sich gleich, gut, seiend usw. ist. Dieses Wissen vom Vollkommenen könne nicht aus der sinnlichen Erfahrung stammen, vielmehr liege es ihr zugrunde – als ein Maßstab-Wissen a priori.246 Allein mit Bezug auf die Ideen, gewissermaßen im Vergleich mit den Ideen, könne das sinnlich Gegebene als defizient gleich, als defizient gut oder groß oder gerecht erkannt werden. In dieser These steckt die erste Gruppe von Prämissen der Ideen- und AnamnesisLehre. Genaugenommen macht Platon hier drei Voraussetzungen: Einmal die eidetische Gleichsetzung von Erkennen und Sehen, von Etwas Erkennen mit dem Sehen einer Gestalt bzw. Firn demgemäß die Gleichsetzung begrifflichen Wissens und Kriterien-Wissens (bzw. Vorwissens) mit dem Gesehenhaben einer Form, Proportion oder Gestalt. Damit verwebt er ganz unausdrücklich und vermutlich auch unbewußt naiv die vorkommunikative Unterstellung, daß einer für sich alleine ein kriteriales Wissen haben könne. Diesem methodischen Erkenntnis-Solipsismus liegt ein ebensolcher Solipsismus des Verstehenkönnens bzw. Regelfolgens zugrunde. Es ist das die – dritte – Voraussetzung: einer könne überhaupt prinzipiell alleine – eben aus der je eigenen Seele – Sinn und Bedeutung besitzen, ohne daß darüber eine Verständigung in einer realen Gemeinschaft (als Bedingung der Möglichkeit solipsistischen intersubjektiver Unterstellungen Beziehungen) sind typisch erforderlich für die sei. Diese klassische eidetisch- Sprach- und Erkenntnisauffassung: den Sinn der Rede versteht sie gegenstandstheoretisch, die Funktion der Sprache sieht sie in der Beziehung von Dingen, und den Erkenntnisvorgang deutet sie nach dem Muster des – wiederum vorsemiotisch, ganz unmittelbar genommenen – Sehens von Dingen. Diese Annahmen haben sich tief ins abendländische Denken eingesenkt und werden uns immer wieder begegnen. Fragt man nun, wie Menschen ein Wissen der Ideen erhalten haben können, so antwortet Platon darauf mit einem Mythos, einer spekulativen Erzählung, die eine (für hellenische Kosmosfromme) plausible Vorstellung vermittelt. Das leistet der Mythos von der Präexistenz der Seele vor ihrer Einkörperung in den Menschen. Die Voraussetzung dieses Mythos entzieht sich freilich einer Prüfung im Diskurs. Es sind die Glaubensannahmen, daß ein Dualismus von Seele und Leib bestehe und daß die Existenz der Seele nicht an die des Leibes gebunden sei. Diese Seelenmetaphysik bildet den Kern der zweiten Prämisse, aufgrund derer Platon das Problem zu lösen versucht: 246 Vgl. L. Oeing-Hanhoff, Art. „Anamnesis“, in HWPh, Bd. 1 (1971), S. 263. 105 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Wie ist ein kriteriales begriffliches Wissen, ein Wissen von Ideen möglich? 1. Prämisse: Das kriteriale eigentliche Wissen ist ein Erinnern an die Schau der Urgestalten / Strukturen des Seienden. 2. Prämisse: Der Ort jenes Wissens ist die Seele als unabhängig vom Leib. Conclusio: Das Ideenwissen kann der Mensch nicht aus seiner jetzigen und sinnlichen Erfahrung gewinnen, sondern nur dadurch, daß er ein Vorwissen als „Zuvorgesehenhaben“ der Ideen hat, und zwar vor seiner Geburt: dank seiner Seele, die die Ideen bereits geschaut hat. Daran muß er sich nur wieder erinnern. Wenn man z. B. das Bild des Simmias sehe, dann - erinnere man sich an den wirklichen Simmias247, - zugleich bemerke man, daß das Bild in der Ähnlichkeit hinter der wirklichen Gestalt des Simmias zurückbleibe248, - und dieses Vergleichen des Abbilds mit dem Original sei nur möglich, weil die Seele „das Gleiche“, „das Vollkommene“ bzw. „das Eigentliche“ schon einmal gesehen habe, denn ein solches Struktur-, Urgestalt- bzw. Ideen-Wissen könne sie nicht aus der sinnlichen Erfahrung – z.B. der Anschauung des Bildes ‚Simmias vor dem Haus bei der Begrüßung von…’ – haben, doch benötige sie es dazu.249 Mit diesem Schluß, der Platon selbst nicht recht zu befriedigen scheint, springt er in einen Mythos – den einer Präexistenz der Seele. Er nimmt einfach an, die Seele habe jeweils vor der Geburt eines Menschen (d.h. vor ihrer Einwohnung in einen Leib) jene Erkenntnis von „dem Gleichen“ etc. empfangen. Und so hätten wir auch „schon vor und bei dem Akte der Geburt [erkannt] sowohl das ‚Gleiche’ und das ‚Größere’ und das ‚Kleinere’ als auch die ganze Fülle solcher Wesenheiten.“ An der zitierten Stelle erweitert Platon die Reihe der vorgewußten Begriffe mit Kriterienfunktion zugleich auf die Gebiete der Ästhetik und der Ethik, die er (als Kosmostheologe) nicht nur nicht trennt, sondern die er (als Pythagoräer) auch nicht von der Mathematik und Geometrie scheidet, weil er diese als Wissenschaft von den Proportionen des Kosmos versteht. So fährt er fort: „Nunmehr steht bei unserem Gespräch genau so wie das ‚An-sich-Gleiche’ im Vordergrunde auch das ‚An-sich-Schöne’, das ‚An-sich-Gute’ und das ‚Gerechte’ und das ‚Fromme’ und, wie ich meine, alles, dem wir das Siegel des ‚an-sich’ 247 248 249 Platon, Phaidon, 73 e 6 - 10. Ebd., 74 a 5 - 7. Ebd., 75 c 4 - d 5. 106 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie aufprägen bei der Bewegung de Gedanken, in der Red und Antwort stehen. So ist der Schluß notwendig, daß wir von alledem ein Wissen bereits vor der Geburt empfangen haben“.250 Platon kann dem, als „Idee“ bestimmten, richtigen Logos zugleich den ontologischen Rang einer Seinsstruktur und den transzendentalen Stellenwert einer internen Erkenntnisbedingung zumessen. Denkt er etwa ontologisch und transzendentalphilosophisch in einem? Jedenfalls hat Kant mit Blick auf das Problem der synthetischen Erkenntnis a priori Platon gewürdigt,251 wenngleich er dessen „mystische Deduktion der Ideen“ als ontische Hypostasierung verwarf.252 Ihm dem kritischen Transzendentalphilosophen, der nach den Bedingungen der Möglichkeiten der Erkenntnis im Erkenntnis-Subjekt fragte und als solche die reinen Anschauungsformen, Verstandesbegriffe und die regulativen Vernunftideen rekonstruierte, mußte Platon ontologisches Ideenkonzept als schwärmerisch und dogmatisch erscheinen. Doch konzediert er, daß die überschwenglich hypostasierende Sprache Platons „einer milderen und der Natur der Dinge angemessenen Auslegung ganz wohl fähig ist“.253 Eine solche rettende Auslegung gibt der Begründer der Transzendentalpragmatik, Karl-Otto Apel, in metaethischer Hinsicht: „Die Ideen des Guten, Schönen, Gerechten, der Tugend usw. sind nach Platon […] das ‚wahrhaft Seiende’, im Unterschied zu den Erfahrungsgegenständen, die immer nur vorübergehend und in einer bestimmten Hinsicht gut, schön, gerecht, tugendhaft usw. sein können. Eben durch diese ontologische Unterscheidung hat Platon jedoch erstmals die gedankliche Voraussetzung auch für die Unterscheidung zwischen den Normen und beschreibbaren Tatsachen des menschlichen Handelns geschaffen. Die modernen – nicht mehr metaphysisch-ontologischen – Unterscheidungen zwischen Fakten und Normen, zwischen (erfahrbarem) Sein und (aufgegebenem) Sollen, zwischen Realität und Ideal und die wichtige Einsicht, daß das eine nicht auf das andere zurückgeführt zu werden vermag, können und müssen als Abwandlungen der Platonischen Grundunterscheidung zwischen der sinnlich erfahrenen Realität und den Ideen begriffen werden. Kurz: ohne den Platonischen Begriff der ‚Ideen’ ist auch der moderne Begriff der ‚Normen’ nicht zu verstehen. Darin liegt die bleibende Bedeutung des Platonischen Idealismus gerade für ein Denken, das sich ethischen Idealen als ‚regulative Prinzipien’ (Kant) unterstellt. […] Die bleibende Bedeutung des Platonischen Idealismus wird jedesmal dann besonders deutlich, wenn Philosophen im Namen eines Naturalismus oder Materialismus 250 251 252 253 den Anspruch einer ethisch engagierten Kritik an bestehenden Platon, Phaidon, 75 c 7 - d 5; nach der Übersetzung von Franz Dirlmeier. I. Kant, KrV, B 370f. I. Kant, KrV, B 371, Anm. Ebd. 107 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Gesellschaftsordnungen erheben. Denn, wie recht sie auch immer mit ihrer Entlarvung der materiellen, z. B. ökonomisch bestimmten >Interessen als Ursachen realer gesellschaftlicher Zustände haben mögen: ihre eigene Kritik an diesen Zuständen und ihr Engagement im Sinne einer Veränderung der bestehenden Zustände haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht auch Ideen, regulative Prinzipien oder Normen voraussetzen, die die vorfindbare Realität überschreiten. Denn allein aus den feststellbaren Tatsachen dieser Realität, aus den Tatsachen dessen, was ist, kann niemals eine Norm, die besagt, was sein soll, abgeleitet werden. Wie leicht aber wird dieser Fehlschluß [… ein naturalistischer Fehlschluß] immer wieder begangen!“254 In der Tat: Wie oft wird in Publikationen und Diskussionen die von Platon nahegelegte Unterscheidung zwischen Norm und Tatsache übersprungen. In Kantischer Perspektive haben die Neukantianer Wilhelm Windelband und Paul Natorp die Ideenlehre gewürdigt. 255 Vittorio Hösle charakterisiert die Anamnesis-Lehre als „mythische Verkleidung der Entdeckung synthetischer Erkenntnis a priori“.256 Zweifellos hat Platon damit den Reflexionserrungenschaften der neuzeitlichen Bewußtseinsphilosophie, dem Zentrum der „Kritik der reinen Vernunft“, vorgearbeitet. Freilich decken weder Hösle noch die Neukantianer auf, daß der reife Platon kommunikationsvergessen, mithin eigentlich undialogisch denkt, wenngleich er in Dialogform schreibt. Im Rahmen seiner maieutischen Dialektik inszeniert der Ideen- und Anamnesistheoretiker den elenktischen Diskurs als ein von Sokrates, dem ‚Hebammenkünstler’ („Maieutiker“), angeleitetes Zwiegespräch der Seele mit sich selbst. Der Elenchos wird zum angeleiteten Seelenmonolog. Zugeschärft wird diese Entdialogisierung des Sokratischen Dialogs, weil Platon tendenziell sprachwidrig denkt –in semantischer wie in pragmatischer Hinsicht. Semantisch konzipiert Platon den Sachbezug im Sinne eines geistigen Sehens, so daß er die Sachverhalte, besser: die Strukturen der Dinge, buchstäblich vorstellt. Darauf zielt die sprachanalytische Kritik der formalen Semantik von Tugendhat.257 In pragmatischer Hinsicht geht Platon gegen den kommunikativen Sinn der Sprache an, indem er die Tätigkeit des Denkenden nicht kommunikativ und intersubjektiv versteht, sondern als ein virtuell einsames Sehen. Die Erkenntnisrelation begreift er daher nicht zugleich als dialogisches Verhältnis, vielmehr unterstellt er sie als eine bloße SubjektObjekt-Beziehung. Hier setzt die transzendentalpragmatische Kritik an.258 254 255 256 257 258 K.-O. Apel, Zur geschichtlichen Entfaltung der ethischen Vernunft in der Philosophie (II), in: Funkkolleg Studientexte (1984), I, S. 90f. P. W. Windelband, Lehrbuch ( 151975), S. 83-102. P. Natorp, Platos Ideenlehre, Leipzig 21922. V. Hösle, Wahrh. u. Gesch. (1984), S. 360ff. E. Tugendhat, Vorlesungen (1976), S. 18ff, vgl. 36ff, passim. K.-O. Apel, Transf. d. Philos., II (1973), S. 334ff; D. Böhler, Wittgenstein und Augustinus, in: A. Eschbach, J. Trabant (Hg.), Foundations of Semiotics 7: History of Semiotics, Amsterdam/Philadelphia 1983, S. 343-369 (zit.: Wittgenstein u. Augustinus (1983)), S. 352ff. 108 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Je länger, desto stärker ordnet Platon den Sokratischen Diskursansatz der θεωρία (theoria) als Schau der ewigen Strukturen bzw. Ideen des Kosmos unter und führt so das Paradigma einer (im Grunde) einsamen Erkenntnis ein: Erkenntnis als geistige Schau der göttlichen und daher ewigen, unwandelbaren, immer selbigen Strukturen. Allein die kosmosmythischen Gottesprädikate von Parmenides – ewig, unwandelbar, immer selbig etc. – scheinen ihm eine wahre Erkenntnis zu ermöglichen. Er sucht eine im kosmosmetaphysischen Sinne wahre Erkenntnis – als Schau des Wahren. Dieses Wahre sei eben das unwandelbare Sein hinter den wandelbaren Erscheinungen, wie es die Parmenideischen Gottesprädikate charakterisieren, und das heißt: so, wie es der göttliche νούς (nous), das geistige Auge Gottes, erschaue. Platons Wahrheitskriterium ist es, daß die Methode, dank derer der Philosoph zu seinen Aussagen über das, was ist, gelange, jenem göttlichen Schauen entspreche. Eine solche Entsprechung bewerkstellige die anamnetische Dialektik. Sie zielt darauf, das unstete zeitlich Seiende, die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung und des Meinens (δόξα, doxa), durchschauen, um die Ideen, die ewigen Seinsstrukturen, auszusprechen259. Der Dialektiker soll die ewige Gegenwart des wahren Seins zu einer intellektualen Anschauung bringen. Den philosophischen Diskurs legt Platon bis in die Neuzeit auf metaphysische Grundunterscheidungen fest – zunächst auf eine ontologische und eine epistemische bzw. erkenntnistheoretische. Dabei ergibt sich diese aus jener, weil er von der Ontologie ausgeht, genauer: von der ontotheologischen Differenz zwischen dem zeitlich Seienden, das der vorphilosophischen doxa als das Wahre erscheine, und den immer selbigen Strukturen bzw. Ideen und Paradigmen, weil daran das wahre und eigentlich göttliche Sein hafte. Platons Erkenntnisproblem ist: wenn es bloß das zeitlich Seiende gäbe, welches entsteht, sich wandelt und vergeht, würde daraus folgen, daß sich alle Dinge permanent veränderten. Als theoria-Ontologe schließt er daraus, daß es dann unmöglich wäre, überhaupt etwas Bestimmtes zu erschauen und diese eindeutige Sicht der Dinge in eine Feststellung zu bringen, einen Logos, der das Wahre buchstäblich festhalten könnte. Dieser zugleich optischtheoretische und ontologische Fehlschluß von der Beschaffenheit der Dinge als Gegenständen einer geistigen Schau auf den Geltungssinn von Aussagen und Behauptungen ist das metaphysische Erkenntnisproblem. Seit Heraklit hat es die griechischen Seinsdenker beunruhigt. Dieser eigentümliche Fehlschluß ist für die sprach- und diskurswidrige Denkweise der theoria-Ontologie charakteristisch. Platons Lösung dieses ‚Problems’ ist der Versuch, sich und die Polis in absolute Sicherheit zu bringen vor der Bedrohung durch das 259 Vgl. G. Picht, Wahrheit (1969), S. 36-87, bes. 76ff, ferner S. 112-131. 109 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Bewegliche und Unstete, die Veränderlichkeit und Geschichtlichkeit. Nichts scheint freilich die gesuchte totale Sicherheit zu gewährleisten als die ewige Gleichförmigkeit des Kosmos und das unwandelbare Insichstehen der Ideen, der reinen Formen. Diese Welt-, Geschichtsund Praxisflucht ist von erkenntnisphilosophischer und politischer Bedeutung. Ihre politische Konsequenz ist sein ordnungsfunktionalistisches Gerechtigkeitsverständnis260 und sein totalitäres Eintrachtsmodell der Polis. Platon wollte sich und Athen retten vor der Geschichtlichkeit, der Wandelbarkeit, von der er das Zusammenleben bedroht sah. Am liebsten ein für alle mal wollte er die krisengeschüttelte, eine Demokratie suchende Stadtkultur Athens ordnungsaristokratisch nach dem Vorbild des harmonischen Regelkreises „Kosmos“ formieren.261 Dieser Formierungswille führt ihn in der „Politeia“ zu zwei, auf unterschiedliche Weise von der Natur als Bewertungsgrundlage ausgehenden, Untersuchungen über Gerechtigkeit, verstanden als Tugend der Polis. Schon in dem ersten, kürzeren „Weg“, der die Lehre von der Philosophenherrschaft und damit auch die Ideenlehre noch ausklammert, setzt er – wie auch im „Gorgias“ – voraus, daß bloße Vereinbarungen über Normen (θέσει, thesei) nicht moralisch verbindlich sein könnten, wohl aber das, was „von Natur aus“ (φύσει, physei) für die Menschen gut sei. Und da die Menschen nicht etwa, wie Gott, autark, sondern bedürftig und zur Bedürfnisbefriedigung auf eine funktionsfähige Gemeinschaft mit anderen Menschen angewiesen seien,262 sucht Platon nach einer Gesellschaft, die so geschlossen und einträchtig wie möglich geordnet sei,263 damit dort alle Klassen ihre Aufgaben zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse optimal ausführen. Die gesuchte reibungslos funktionierende und absolut stabile Polis soll, wie ein Individuum, möglichst eine Ganzheit sein.264 Diese Funktionsganzheit versteht Platon, in Analogie zu der eines gesunden organischen Körpers, als die naturgemäße „Gerechtigkeit“ einer Polis.265 Daß diese Einführung Verbindlichkeitsfrage von verfehlt, Gerechtigkeit ist klar. bzw. Karl-Heinz politischer Ilting, Gerechtigkeit dessen Analyse die des Gerechtigkeitsmodells nach Platons erstem, leichteren Weg (in den Büchern II bis IV) ich gerade skizziert habe, schließt zu Recht: „Wenn dieser ganze Staat rein nach 260 261 262 263 264 265 Dazu K.-H. Ilting, Bedürfnis und Norm. Platons Begründung der Ethik, (1978), in: ders., Grundfragen der praktischen Philosophie. Hg. v. P. Becchi u. H. Hoppe, Frankfurt a. M. 1994 (zit.: Grundfragen (1994)), S. 296-325, bes. S. 304-318. Platon, Politeia, 500 c/d und Timaios, 47 a-c. Kritisch dazu: H.P. Schmidt, Frieden, Stuttgart/Berlin 1969 (zit.: Frieden (1969)), S. 37-57, bes. 48ff. Ders., Die Erfahrung des Bösen, in: Funkkolleg Studientexte (1984), III, S. 677-731, bes. 691-695. Platon, Politeia, 369 b 5 - c 11. Ebd., 422 a 8 und e 8, 423 b 10, 433 a 5, 462 b 1-2 u. ö. Ebd., 462 c 7-10, 464 b 1. Ebd., 444 c 1-7. 110 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Zweckmäßigkeitserwägungen konstruiert ist, so sind alle seine Gesetze nichts als Ratschläge der Klugheit, denen jeder, wenn er vernünftig ist, nur soweit folgt, als dies im Interesse seines wohlverstandenen Eigenwohls liegt. Moralisch verbindliche Normen sind sie durchaus nicht, da Platon ja keinerlei über den Gesichtspunkt des Eigeninteresses hinausweisende Gründe ihrer Verbindlichkeit namhaft zu machen versucht hatte.“ Er scheine nicht einmal gesehen zu haben, „daß auch nach seiner Konstruktion eines Idealstaats die Frage noch immer offen ist, wieso denn eigentlich die in seinem Staatsmodell vorgesehenen spezifischen Aufgaben für die Mitglieder der politischen Gemeinschaft verbindliche Pflichten und Rechte sind. […] Daß Platon auf dem von ihm verfolgten Wege das Problem einer Begründung der Ethik verfehlen muß, zeigt sich womöglich noch klarer, wenn man prüft, wie er anschließend (434 d 2 – 444 a 9) auch die Gerechtigkeit eines menschlichen Individuums, analog zur Gesundheit eines organischen Körpers als Funktionsgerechtigkeit seiner ‚Seele’ und ‚Seelenteile’ zu interpretieren versucht. Indem er das menschliche Individuum bzw. dessen ‚Seele’ als eine Art Mikrostaat auffaßt, verzichtet er von vornherein darauf, die Anerkennung und Befolgung von Normen und die moralischen und rechtlichen Beziehungen zwischen Individuen als das Kernproblem der Gerechtigkeit zu erörtern. ‚Gerecht’ ist nach dieser Deutung ein Individuum nicht im Hinblick auf verbindliche Normen und auf seine Mitmenschen, sondern primär in bezug auf sich selbst: wenn nämlich seine ‚Seele’ gesund ist (443 c 9-d 1). Platon unterstellt zwar, wenn auch ohne große Plausibilität, daß solche ‚Gesundheit der Seele’ die beste Garantie gerechten Handelns ist. Aber ein anderes Interesse an der Gerechtigkeit als das des wohlverstandenen Eigenwohls kann er auch hier nicht geltend machen.“266 Erst in dem zweiten, dem „längeren Weg“267 der „Politeia“, in den Büchern V bis VII, kommt mit dem Postulat der Philosophenherrschaft die Ideenlehre zum Zuge. Sie ist Platons Antwort auf die herakliteische Beunruhigung. Karl Raimund Popper hat sie gewissermaßen erkenntnispsychologisch rekonstruiert.268 Seine Hauptquelle ist Aristoteles. Dieser berichtet in der „Metaphysik“, Platon habe es für unmöglich gehalten, „daß es eine allgemeine Definition für ein Sinnesding gebe, weil die Sinnesdinge in dauernder Veränderung begriffen seien.“ Hingegen habe er die intelligiblen Dinge, die Strukturdinge bzw. reinen Formen, auf die sich die Definitionen bezögen, Ideen genannt und die These entwickelt, daß die veränderlichen 266 267 268 K.-H. Ilting, Grundfragen (1994), S. 309f. Platon, Politeia, 504 b 2. K.R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde I. Der Zauber Platons, Bern 1957 (zit.: Die offene Gesellschaft (1957)), S. 56ff. 111 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Sinnesdinge nur dank einer ‚Teilhabe’ (µέθεξις, methexis) an jenen Ideen und Urbildern bestünden.269 Aristoteles’ Bericht zeigt, daß Platon die ontologische Differenz der Metaphysik: ‚zeitlich Seiendes versus ewige Seinsformen’ mit der epistemischen Unterscheidung ‚sinnliche Wahrnehmung versus intellektuelle Anschauung bzw. intuitive Vernunfteinsicht’ zusammendenkt. Die epistemische Differenz ergänzt Platon durch die methodologische Differenzierung zweier Erkenntnisweisen, welche auf akommunikativen Voraussetzungen beruhen und insofern einen methodischen Solipsismus unterstellen.270 Er unterscheidet eine schauende, intuitive Vernunfteinsicht von einer analytischen und konstruktiven διάνοια (dianoia) als diskursiver Verstandeserkenntnis. Die Vernunft (νούς, nous), verstanden als das Auge des Geistes, bezieht Platon auf das, was von dem wahren göttlichen Sein sichtbar ist, auf den Kosmos. Gemäß parmenideischer Tradition und mit pythagoreischen Obertönen verkündet er „den Kosmos-Mythos [...] in geläuterter Gestalt“ (Hans P. Schmidt)271: von dem göttlichen nous durchwaltet, habe der Kosmos die schlechthin vollkommene Gestalt der Kugel, und alles in ihm, auch die Zeit, schwinge in der Harmonieform des Kreises, befinde sich mitten in einer ewigen Stetigkeit. Neben dem VI. Buch der „Politeia“ ist der kosmologische Dialog „Timaios“ die wichtigste Quelle für diesen Ansatz einer intuitiven Kosmos-Vernunft. Der „Timaios“, den sich die römische Welt durch eine Teilübersetzung Ciceros, die christliche durch die kommentierte Edition des Neuplatonikers Chalcidius (um 400 n. Chr.) aneignete, konnte bis in die Neuzeit als Platons Hauptwerk gelten. Er hat noch Kant ein physikotheologisches Hintergrundsverständnis für seine methodologische Ethik vermittelt. In dem Dialog „Timaios“ bestimmt Platon das Verhältnis von göttlichem nous, Kosmos und menschlichem Denken (der hier unspezifisch gebrauchten διάνοια), indem er das Vermögen des Sehens als das höchste menschliche Gut auszeichnet: „Nun aber hat der Anblick von Tag und Nacht, vom Umlauf der Monate und Jahre, von Tagund Nachtgleiche und den Sonnenwenden die Zahl ans Licht gebracht und uns die Erkenntnis der Zeit und die Suche nach der Natur des Alls gespendet. Hieraus haben wir die Herkunft der Philosophie gewonnen, und ein höheres Gut ist nie gekommen noch wird jemals kommen zum sterblichen Geschlecht als Gabe der Götter [...]. Gott hat die Sehkraft für uns erfunden 269 270 271 Dazu Aristoteles, Metaphysik, 987 b 7ff; vgl. 1078 b 10-1079 a 4. Die von Aristoteles (Metaphysik 987 a 30-b 18) rekonstruierten Gedankenschritte auf dem Weg zur Ideenlehre spürt Popper vor allem im „Phaidon“ (65 a-66 a, 70 e, 74 a f und 99 f), im „Kratylos“ (439 c ff), in der „Politeia“ (485 a/b, 508 b ff, 509 c-511 e und 523 a-527 c), im „Sophistes“, im „Theaitetos“ (174 b und 175 c) und im „Timaios“ (28 a29 d und 48 e-55 c) auf. Vgl. D. Böhler, Kosmos-Vernunft und Lebens-Klugheit, in: Funkkolleg Studientexte (1984), II, S. 343369. H.P. Schmidt, Frieden (1969), S. 52. 112 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie und uns damit begabt, damit wir die Umläufe des göttlichen Geistes [des nous] am Himmel erblicken und sie als Vorbild für die Umläufe unseres eigenen Denkens [dianoia] gebrauchen, welche jenen verwandt sind – den Unverwirrbaren die Verwirrten. Wenn wir sie aber gelernt und uns die der Natur entsprechende Richtigkeit ihrer Berechnungen angeeignet haben, dann sollen wir die ganz und gar unablenkbaren Umläufe des Gottes nachahmen und so die schweifenden Umläufe [des Denkens] in uns selbst ordnen. Von der Stimme und dem Gehör gilt wieder dasselbe, daß dieses Geschenk eben deshalb und zu demselben Zwecke uns von den Göttern verliehen sei; denn die Rede [logos] hat den selben Zweck und trägt das meiste zu dessen Erreichung bei. Soviel aber von der Musik der Stimme nützlich ist, so wurde es dem Gehör zum Zwecke der Harmonie geschenkt. Die Harmonie aber, welche verwandte Bewegungen hat wie die Umläufe der Seele in uns selbst, ist dem, der sich den Musen hingibt gemäß der Vernunft [nous], nicht zum Genuß einer irrationalen Lust, so wie man es heute meint, gegeben; vielmehr ist sie uns von den Musen als Beistand verliehen worden gegen die in uns aufgekommenen unharmonischen Umläufe der Seele, um sie zur Ordnung und mit sich selbst in Einklang [συµφωνία, symphonia] zu bringen“272. Das menschliche Denken, sofern es auf den Kosmos schaue, und die menschliche Seele, sofern sie auf die Harmonie der kosmischen Sphärenmusik höre, würden in eine Mimesis dieser Wohlordnung hineingezogen und so aus der Unordnung der Affekte herausgebracht. Das Denken bezieht Platon mimetisch auf den göttlichen nous als das Urbild allen Denkens. Eine ungeheuer folgenträchtige Bezugnahme: bis zu Kant und Hegel, ja bis zu Husserl wird die reine Kontemplation des (ursprünglich göttlichen) nous als Archetyp der Vernunft gelten... Georg Picht, an dessen Übersetzung ich mich soeben angelehnt habe, kommentiert unsere Stelle: „Im Hintergrund steht die pythagoreische Lehre, daß die Bewegungen der Gestirne und die Bewegungen der Musik identisch sind, weil sie der gleichen Mathematik gehorchen. Wie Damon gelehrt hat, daß sich die Haltung des Menschen durch die Gewöhnung den geordneten Bewegungsabläufen der Musik angleicht, so kann der Mensch auch durch die Betrachtung der Sterne die Bewegungen seiner Seele dem Kosmos angleichen und so seine ursprüngliche Verwandtschaft mit dem die Sterne bewegenden νούς entdecken. Dies ist der geschichtliche Boden von Kants berühmtem Wort aus dem Beschluß der Kritik der praktischen Vernunft: ‚Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: 272 Platon, Timaios, 47 a 5 - 47 d 6. 113 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.’ Der Begriff ‚Kosmos’, der bei Platon den Gedanken trägt, bezeichnet die Ordnung in der Bewegung. Deshalb kann der gleiche Begriff auf die Bewegung der Sterne und Gezeiten und auf die Bewegung der Musik bezogen werden. Diese Bewegungslehre bildet, wie wir aus dem ‚Timaios’ erfahren, jene Brücke zwischen Musik und Astronomie, die es Platon im ‚Staat’ erlaubt, die Lehre des Damon auf die Betrachtung des Kosmos zu übertragen.“273 Im VI. Buch der „Politeia“ spricht er die kosmosmimetische Funktion ausdrücklich der Philosophie zu. Von daher bestimmt er die philosophische Begründung des rechten Verhaltens als Rückgang auf die göttlich-natürliche Ordnung des Alls. Das ist Platons eigentümlich kosmologisch-naturalistischer Fehlschluß. Naturtheologisch suggestiv, hat er spekulativen Konsens erzeugt und Metaphysikgeschichte gemacht. Ist es doch die weithin einflußreiche Stoa, die Platon hierin folgen und – über Cicero – auch der Rhetorik eine naturalistische Hintergrundsmetaphysik vermitteln wird. Nicht weniger wirkungsträchtig ist der Bildungsbegriff, den Platon an die ethische Kosmos-Mimesis anschließt. Die ethische und politische Orientierungsaufgabe des Philosophen bestimmt er als Hineinbildung der Besonnenheit und der Gerechtigkeit in die Sitten und in die Polis: „Der Philosoph also, der mit dem Göttlichen und Wohlgeordneten umgeht, wird auch wohlgeordnet [κόσµιος] und göttlich, soweit es dem Menschen möglich ist. […] Ihm entsteht eine Notwendigkeit, Sorge zu tragen, wie er das, was er dort sieht, auch in die Sitten der Menschen, der persönlichen und der öffentlichen, ein-bilden könne, und nicht allein sich selbst zu bilden.“274 Die Bildungsziele, welche die Kosmosmimesis mit sich bringt, sind „das der Natur nach (physei) Gerechte, Schöne, Besonnene und alles dergleichen“.275 Die nach diesem „göttlichen Paradigma“ zu bildende Polis und keine andere könne „glücklich“ sein.276 Nicht also die moralische Verbindlichkeit, die Anerkennungswürdigkeit von Normen, ist das letzte politisch-ethische Ziel des, der Kosmos- und Ideenschau hingegebenen und zur Fürsorge um die Polis genötigten, Philosophen, vielmehr ist es die gott- und naturgemäße Beglückung der Polis und durch dieses Kollektiv auch der Menschen als Poliszugehörige. Ein naturtheologisch geheiligter Eudaimonismus hat das letzte Wort. Die Philosophie öffnet dann weder Raum für eine öffentliche Verständigung über das, was die Bürger wollen und 273 274 275 276 G. Picht, Wahrheit (1969), S. 120. Platon, Politeia, Buch VI, 500 c 9 bis d 1, vgl. 500 d 3 - d 6. κόσµιος ist, wie Georg Picht betont, „ein im Griechischen geläufiges Wort zur Bezeichnung der Menschen, die sich in Zucht zu halten wissen. Aber in unserem Zusammenhang gewinnt es, wie wir sehen, einen anderen Sinn. Es wird damit gespielt, daß κόσµιος auch heißen könnte: dem Kosmos ähnlich, ein Abbild des Kosmos. Dieser Gedanke wird dann im ‚Timaios’ ausgebaut. Hier ist der Ursprung des Gedankens vom Menschen als einem Mikrokosmos.“ (G. Picht, Wahrheit (1969), S. 121.) Platon, Politeia, 501 b. Ebd., 420 b 7f, 420 c 1-4, 421 b 6f, 472 c 9. 114 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie worin sie politische Bedingungen ihres – das heißt aber: ihres individuellen – Glückes bzw. ihrer Werte sehen, noch ist sie selbst ein Diskurs zur Rechtfertigung von Normen mit dem Ziel ihrer begründeten, freien Anerkennung durch die Normadressaten. Sie hat überhaupt keinen Platz für einen öffentlichen Diskurs. Sie anerkennt daher auch keineswegs eine autonome Einsicht von Diskurspartnern in das, was sie den Bürgern normativ vorgibt, also das, was sie jeweils praktisch und politisch sollen – den konkreten normativen Gehalt von Gerechtigkeit, Schönheit und Besonnenheit. Sind Diskursteilnehmer, geschweige denn Diskurspartner, dann überhaupt noch am Platze? Nötig und vorgesehen ist allein der Philosoph, und zwar zuerst als Auge und Mund des die Naturordnung schauenden sowie vermittelnden Geistes, sodann als Hineinbildner der geschauten Naturordnung in die menschliche Welt. Ein gigantischer Fehlschluß von dem, was das natürliche Sein in Wahrheit sei, auf das, was die Polis glücklich mache und was die Menschen, man höre, daher als ihre Pflichten bzw. Rechte in der Polis praktizieren sollen. Auch das, was Platon auf dem „längeren Weg“ der Politeia vorbringt, ist kein moralisches Verbindlichkeits-, sondern ein eudaimonistisches Klugheitsargument von der Form eines problematisch-hypothetischen Imperativs. Diese Klugheitsregel versieht er mit apodiktischer, weil kosmostheologischer Autorität: einer naturtheologisch entliehenen, logisch freilich erschlichenen Verbindlichkeit. Sie geriert sich, als sei sie ein kategorischer Imperativ, da die Handlungsweise des kosmotheoretischen Polisbildners von ihr „als an sich gut vorgestellt“ wird. Eben das zeichnet Kant als Merkmal eines Kategorischen Imperativs aus.277 Platon suggeriert, was er begründen müßte, aber glücksethisch und kosmosspekulativ erschleicht: moralische Verbindlichkeit. Die tiefgreifenden Folgen sind: Verdrängung eines möglichen praktischen Diskurses zur Rechtfertigung von Normen, Entmenschlichung und Entgeschichtlichung der Lebenswelt zugunsten der „besten Polisordnung“, die ihm „das wahrhaft Göttliche ist“, während „alles andere bloß menschlich“ sei.278 Platon beschreibt die politisch-ethische Bildungsaufgabe des Philosophen nach dem Muster eines Malers, der in seinem Gemälde ein göttliches Urbild darstellen will. Um das zu bewerkstelligen, müsse der Maler die Polis und die Sitten der Menschen wie eine Wachstafel reinigen, um dann das Göttliche in sie einprägen zu können.279 Die kosmosgemäße und 277 278 279 I. Kant, GMS, S. 414. Was sich aus der Perspektive des Platonlesers als ein problematisch-hypothetischer Imperativ aufgrund einer möglichen, ihm angesonnenen Absicht darstellt, ist für Platons Philosophen, den die Kosmosschau zur Bildung der Einheitsordnung einer idealen, kosmosgemäßen Polis nötigt, ein assertorisch-hypothetischer Imperativ. Dieses assertorische Moment wird von Platon freilich mit einem kategorischen Vernunft-Schein versehen, indem er sich auf die göttliche Kosmosvernunft beruft. Platon, Politeia, 497 b/c. Im Lichte der kosmosmetaphysischen „theoria” kann „das menschliche Leben“ ohnehin nicht „als etwas Großes“ gelten: 486 a 8ff. Ebd., 501 a 2 - c 2. 115 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie gottgefällige Bildung bestimmt Platon also nicht etwa, wie es der christliche Neuplatonismus seit Nikolaus von Kues tun wird, als Bildung zur Idee des Menschen – eine solche gibt es bei Platon im Ernst nicht. Vielmehr geht es ihm um das Ein-Bilden des Göttlichen in das bloß Menschliche. Dessen geschichtliche und plurale Natur sei radikal zu verändern: durch ‚Bildung’ als „Technik der Umkehrung“280 (περιαγωγή, periagoge) und durch eine Bildungspolitik, die im Sinne einer ποίησις (poiesis), d.h. nach dem Muster einer zweckgemäßen Herstellung gedacht ist. Alle erfolgsführenden Mittel scheinen dann recht zu sein. So ersteht eine kosmostheologisch gerechtfertigte, insofern bedenkenlose Poiesis des Politischen, deren Zweck der ordo-Idealstaat ist und zu deren notwendigen Mitteln die Überwindung des unstet Geschichtlichen, mithin die Beherrschung der Pluralität gehört. Doch Pluralität ist die Bedingung menschlicher Existenz – auch in dem emphatischen Sinne eines menschenwürdigen Daseins. Hannah Arendt, die die Pluralität als conditio humana des Politischen entwickelt hat, urteilt scharfsichtig, wenn sie Platons idealpolitische Utopie als au fond tyrannische Spielart einer ‚monarchischen’ Politik kritisiert. Inwiefern? Der Versuch, der Pluralität, mithin der Individualität und Verschiedenartigkeit, „Herr zu werden“, sei „immer gleichbedeutend mit dem Versuch, die Öffentlichkeit überhaupt abzuschaffen“.281 Wie weit Platon von diesem Problembewußtsein und von dem moralisch rechtspolitischen Prinzip der Öffentlichkeit, ja auch nur von deren Wertschätzung als einem Gut entfernt ist, demonstriert er auch durch seine Theorie der Tyrannis. Mit ihr reagierte er auf die Anarchie, von der er behauptet, sie ergebe sich in der Demokratie zwangsläufig. Demokratie sei eben der Überschuß an „Freiheit der Menge“, der in der Gleichstellung von Hintersassen, ja sogar von Sklaven mit den Polisbürgern gipfeln könne und daher zur Anarchie führe. Diese nötige dann die Tyrannis herbei.282 Den systematischen Grund für Platons Abgleiten in die Tyrannis sieht Hannah Arendt darin, daß sein Modell einer Philosophenherrschaft „die Schwierigkeiten des Handelns“ so lösen und auflösen soll, „als handele es sich um Erkenntnisprobleme“.283 Genauer gesagt: Platon vertritt einen Primat der kosmos-metaphysischen theoria und will daher die moralischen Fragen behandeln, als seien es metaphysische Erkenntnisaufgaben, welche durch spekulative Schau, von göttlichem Standpunkt und Sehepunkt her, gelöst werden könnten. Öffentlichkeit, Dialog, kommunikative Auseinandersetzung ergeben unter diesem Primat keinen Sinn. Auch 280 281 282 283 Ebd., 518 d 3f. H. Arendt, Vita activa, § 31, S. 215. Platon, Politeia, 562 f, bes. 563 a 1f und 563 b 3-6. H. Arendt, a.a.O. 116 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie eine freie Anerkennung der den Bewohnern seiner utopischen Polis auferlegten Pflichten und der den Wächtern sowie den Philosophenherrschern zugeschriebenen Rechte ist unter diesem Primat kein Thema mehr. Ebensowenig bedarf es einer Verständigung über den Sinn des Glücks, dessen die Polis teilhaftig werden soll, indem sie der funktionalen Gerechtigkeit zugeführt wird, so daß jede Klasse das Ihrige und jeder „das Seinige tue“, „wozu nämlich seine Natur [sic!] sich am geschicktesten eignet.“284 Platons utopische Bildungspolitik ist im Ansatz inhuman, gewalttätig und totalitär; gilt es ihr doch als ausgemacht, daß die menschliche Natur „von Kindheit an gehörig beschnitten und das ihrer Abstammung Verwandte (ihrer Genese Zugehörige) ausgeschnitten werden [muß], das sich nämlich wie Bleikugeln an die Gaumenlust und andere Lüste und Weichlichkeiten anhängt und das Gesicht der Seele nach unten wendet“.285 Für das Hineinbilden des Göttlichen vermittels Herausschneidens des Menschlichen sollen die Herrscher des Idealstaates – „zum Wohle der Beherrschten“ – nicht nur zu Lüge, Täuschung und Betrug greifen.286 Sie sollen sogar, insgeheim, staatlichen Kindermord praktizieren, damit sichergestellt sei, daß ausschließlich jene Sprößlinge der Herrscherklasse aufgezogen werden, die sich als die tüchtigsten erwiesen haben: Politeia 459 d - 460 c und 461 c 4f. Eingeschoben wird die rassehygienische Behauptung, das Geschlecht der Wächter müsse eben „rein“ sein.287 Wem stockt bei dieser Lektüre nicht der Atem? Einer solchen ‚politischen Bildung’ ist offenbar – kosmostheologisch – fast alles erlaubt. Sie kennt nicht die, in dem andersgearteten Geist der Bibel angelegte, Norm der Menschenwürde. Ebenso ist sie unberührt von dem normativen Begriff eines rein kommunikativen Handelns, der den zwischenmenschlichen Umgang jesuanisch bzw. mosaisch und prophetisch an das Gebot der Nächstenliebe bindet288 oder ihn (letztlich) an den Normen mißt, die ‚wir’ als Partner eines gewaltfreien, argumentativen Dialogs bereits in Anspruch genommen haben und auch anerkennen sollten, weil wir sie ohne Selbstwiderspruch nicht in Zweifel ziehen können. Zwar suchte Platon, wie Hans Jonas sagt, „nach einem Staat, in dem Sokrates nicht zu sterben braucht“289, doch läßt sein idealstaatlicher Entwurf keinen Raum mehr, um den Sokratischen 284 285 286 287 288 289 Platon, Politeia, 433 a 6-9. Platon, Politeia, 519 a 8 - b 4. Ebd., 459 c-d. Ebd., 460 c 6, vgl. 459 e 1f. Darauf kommen wir im Zusammenhang mit Augustinus zurück. H. Jonas, Prinzip Verantwortung (1979).Befremdlicherweise übt Hans Jonas an Platons Utopie nicht eine anthropologische Sinnkritik, wie er sie in aller Schärfe Ernst Bloch gegenüber vorträgt, obgleich auch von ihr gilt, daß sie kein sinnvolles „Wunschbild menschlichen Glücks“ bietet, weil sie unvereinbar ist mit „der 117 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Logosgrundsatz als Diskursgrundsatz zu vertreten, also im Blick auf verallgemeinerbare Gegenseitigkeit und damit auch auf zu achtende Menschenwürde. Gemessen an einer Kohlbergschen Entwicklungslogik des moralischen Urteils, läuft Platon mit der Idee des Guten zwar auf die moralische Prinzipienstufe 6 vor, wenngleich nur in eudaimonistischer, verbindlichkeitsunfähiger Perspektive. Doch entzieht er ihr sowohl die Gewissensfreiheit als auch die dialogbezogene Anerkennung der Anderen und des Individuellen. Infolgedessen fällt er von der metakonventionellen Moralebene zurück auf ein Rollen-Tugend-Ethos der Stufe 3 und ein rigides Ordnungs-Institutionen-Ethos im Sinne von Stufe 4, das aber von rechtsstaatlichen Grundsätzen wie dem der Gleichheit der Rechtspersonen weltenweit entfernt ist – getrennt durch den Abstand zur biblischen Normenwelt der Menschenwürde als Gottesebenbildlichkeit ebenso wie durch die Kluft zur metakonventionellen Autonomie- und Prinzipienorientierung jener Aufklärung, die mit Kants Kritiken der Vernunft den logischen und ethischen Universalismus erreichen wird. Karl Raimund Popper, der die „Politeia“ in seinem Exil, auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus und angesichts des kommunistischen Totalitarismus gelesen hatte, wertete Platons Anwendung der Ideenlehre auf das gesellschaftliche Leben als paradigmatischen, Geschichte machenden Angriff auf „die offene Gesellschaft“290, wenngleich deren Idee, ein Kind der Aufklärung und eines normativen Liberalismus à la Kant, durch die Wirkungsgeschichte der Platonischen Politik eher verzögert und dann erst konterkariert worden ist. In der Tat lassen sich Platons idealstaatliche Überlegungen und deren unmenschliche Folgerungen nicht als Überzeichnung resp. Übertreibung oder gar als Ironie bagatellisieren. Vielmehr sind es die Konsequenzen aus seinem Ansatz: zumal aus seinem durch und durch akommunikativen Vernunftbegriff, der nicht den Dialog und die argumentative Berücksichtigung bzw. Geltungsprüfung realer Ansprüche zum Prinzip macht, sondern die Schau einer vorgeblich göttlichen Einheits-, Ruhe- und Ewigkeitsordnung des Kosmos. Die ist freilich ein spekulativer Ordnungsmythos und mündet in eine „totalitäre Gerechtigkeit“291, die die Maximen „Bringt die politischen Veränderungen zum Stillstand!“ und „Ersetzt die Pluralität durch Eintracht!“ aus einer Kosmostheoria abzuleiten versucht. 290 291 Permanenz echten“, d.h. seiner Würde, Freiheit und ‚Gebürtigkeit’ i. S. Hannah Arendts entsprechenden, „menschlichen Lebens“ (vgl. ebd., S. 378). K.R. Popper, Die offene Gesellschaft, I (1957). Zur Unvereinbarkeit von Platons kosmostheologischem Idealismus und dem christlich humanistischen Neuplatonismus, der die Idee der Menschenwürde vorbereitet, vgl. D. Böhler, Ethische Motive der humanistischen Neuzeit, in: Funkkolleg Praktische Philosophie/Ethik. Studienbegleitbrief 0, hrsg. vom Deutschen Institut für Fernstudien, Weinheim/Basel 1980 (zit.: Ethische Motive (1980)), S. 108-118, bes. 110-113. K.R. Popper, Die offene Gesellschaft, I (1957)., S. 126 und das gesamte Kapitel „Totalitäre Gerechtigkeit“, S. 126-168. 118 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 4.1.3 Wann ist eine Norm moralisch verbindlich? Was sich aus Platons naturalistischen Fehlschlüssen (und seinem metaphysischen Intellektualismus) lernen läßt. Sowohl Kommunikation mit möglichen Betroffenen über ihre Werte, Interessen und Ansprüche, also eine Sinnverständigung, ist ausgeschlossen, wie auch ein kommunikativer Diskurs über deren Berechtigung, im Sinne der Geltungsgegenseitigkeit, wenn man wie Platon denkt: als metaphysischer Intellektualist, der eine theoria auf den natürlichen Kosmos richtet und dann aus dessen spekulativ erschlossene Strukturen Normen für das politische Leben ableitet. Darin sehe ich die eigentümlich Platonische Spielart des naturalistischen Fehlschlusses, die den Mittelteil der „Politeia“ durchherrscht.292 Karl-Heinz Ilting hat das in unerbittlicher Schärfe herausgearbeitet: Was immer Platon „zweckmäßig zu sein oder seinen eigenen Wertvorstellungen zu entsprechen schien, nannte er ‚natürlich’. Daher erklärte er sein Modell eines Idealstaates und die dort vorgesehene Herrschaftsordnung ganz unbefangen für naturgemäß und glaubte sich damit jeder weiteren Frage nach rationaler Begründung enthoben. Daß Normen und Werturteile sich im übrigen prinzipiell nicht aus Tatsachenfeststellungen und Naturbeschreibungen ableiten lassen, war ihm dabei ebensowenig klar wie irgendeinem anderen Autor vor Hume. Einen besonderen Grund hatte diese Unklarheit bei Platon in seiner Neigung, die vermeintlich naturgemäßen Normen und Ordnungen mit Hilfe seiner Ideenlehre als etwas unveränderlich Seiendes zu deuten, das in Akten intellektueller Anschauung unmittelbar erfaßbar sei. Ohne sich viel um den fundamentalen Unterschied zwischen seiner teleologischen Naturauffassung bzw. Güterlehre und seiner Lehre von den erfahrungsunabhängig erkennbaren Ideen zu kümmern, faßte er vielmehr beide Konzeptionen im Mittelteil der ‚Politeia’ unbedenklich in einer Lehre von der teleologischen Idee des Guten zusammen. ‚Natur’ und ‚Idee’ wurden für ihn dadurch zu miteinander vertauschbaren Ausdrücken.“293 Im Mittelteil der „Politeia“ kosmologisch ansetzend schließt Platon von der Natur des Kosmos, deren Ordnung sich dem Ideenblick des Philosophen zeigt, auf die Ordnung, die sich die Menschen geben sollen. Weil dieses Sollen, dieser normative Orientierungsgehalt, damit er gelten kann, Anerkennungs- und Zustimmungswürdigkeit seitens der Menschen 292 293 Auch Hans P. Schmidt, Frieden (1969), S. 49ff. Vor allem: Politeia 507 a 7-519 c 7. K.-H. Ilting, K.-H. Ilting, Artikel „Naturrecht“, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. v. O. Brunner, W. Conze u. R. Koselleck, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 245-313, hier: S. 252 (zit.: „Naturrecht“). 119 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie voraussetzt, Platon diese aber nicht aufzeigt, bleiben seine Sollenszumutungen ohne zureichenden Grund. Die Verbindlichkeitsfragen, warum man seine Seele unbedingt in jene Harmonie bringen solle, und weshalb diese Seelenordnung auch das normative Fundament für die Pflichten und Rechte der Menschen als Polisbürger sei, bleiben ohne Antwort. Ja, sie werden nicht einmal gestellt. Wenn ein Sollen allein aus natürlichen Gegebenheiten oder anderen Fakten abgeleitet wird – also ohne Gründe für die einsehbare, aus freien Stücken anerkennungswürdige Verbindlichkeit einer Orientierung an den hervorgehobenen Gegebenheiten, dann ist der Schluß ungültig: ein naturalistischer oder faktizistischer Fehlschluß eben. Dasjenige, was sich metaethisch, wenngleich ex negativo aus der „Politeia“ lernen läßt, und zwar insgesamt: aus ihrem Eudaimonismus, ihrer Ideenlehre und ihrer (unbestimmten) Idee des Guten, worin beide gipfeln, ist vor allem dreierlei. (1) Keine Ethik kann das Verbindlichkeitsproblem umgehen, wenn anders sie dem naturalistischen Fehlschluß ausgeliefert ist und daher ihre Glaubwürdigkeit im Diskurs einbüßen kann; sie ließe sich dann in einem argumentativen Diskurs nicht glaubwürdig vertreten. (2) Die Verbindlichkeit moralischer Normen setzt freie Anerkennung der Normadressaten voraus, wie etwa Popper und Ilting betonen. Aber das Faktum einer freiwilligen Anerkennung, die zu einer Übereinkunft bzw. einem Vertrag führt, ist nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für dessen Verbindlichkeit. (3) Wer annehmen wollte, die freie Anerkennung einer Norm sei hinreichend, deren Verbindlichkeit zu begründen, wie es der Dezisionismus, Liberalismus und Konventionalismus unterstellen, der beginge einen neuerlichen naturalistischen Fehlschluß und müßte sich selbst als Diskurspartner widersprechen.294 Denn diese, von jedem, der etwas denkt und geltend macht, im vorhinein eingenommene kritische Rolle hängt zur Gänze davon ab, daß ihre Grundunterscheidungen, nämlich ‚faktische Anerkennung versus hinreichend begründete Anerkennung’ und ‚faktische, begrenzte Kommunikationsgemeinschaft versus reine, unbegrenzte Argumentationsgemeinschaft’ im Denken und Diskutieren berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich: Die bloße Tatsache, daß eine Norm von einer Gruppe anerkannt worden ist, kann noch nicht der hinreichende Grund ihrer Verbindlichkeit sein; vielmehr ist deren Anerkennungswürdigkeit aus universalisierbaren Gründen anzustreben. Praktisch 294 Vgl. K.-O. Apels Auseinandersetzung mit K.-H. Ilting: „Faktische Anerkennung oder einsehbar notwendige Anerkennung?“, in: Auseinandersetzungen (1998), S. 221-280. 120 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie verlangt das einen argumentativen Diskursprozeß, der sich der regulativen Gültigkeitsidee einer reinen, unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft unterstellt. Wo Platon unterminologisch von dianoia als menschlichem Erkenntnisvermögen spricht, kann er dieses Vermögen in den Dienst der intuitiven Vernunft als Kosmos- und Ideenschau stellen. Wo er hingegen die höhere Erkenntnisweise der Vernunftschau abgrenzt von den unteren Erkenntnisweisen der reinen Wissenschaften, und zwar nach dem Paradigma der Geometrie, spricht er terminologisch von dianoia (im engen Sinne). Damit meint er eine Verstandeserkenntnis, welche durch lückenlose Schußfolgerungen, unterstützt von anschaulichen Zeichnungen, „direkt zu einer Lösung, einem ‚quod erat demonstrandum’ der vorgelegten Aufgabe“ führt.295 Diese Unterscheidung trifft und erläutert er im Liniengleichnis. Die Geometrie gilt ihm deshalb als Muster der dianoia, weil ihr Verfahren Hilfsmittel der sinnlichen Anschauung verwende, und auf unbewiesenen Hypothesen aufbaue. Obwohl es ihr um Ideen wie die des Geraden und Ungeraden der geometrischen Formen und Winkel gehe, arbeite sie – zeichnend – stets mit Abbildern als Hilfsmitteln der sinnlichen Anschauung. Hingegen sei die noesis eine rein geistige Anschauung, die über einen großen Umweg nach einem unbedingten Grund suche, dem Prinzip des Ganzen (αρχή του παντός, arche tou pantos).296 Platon versteht die dianoia nach dem Muster der Geometrie und diese wiederum allein hinsichtlich ihres Bezugs auf ideale Gegenstände (Zahlen und Formen), geht aber nicht darauf ein, daß auch dieser Gegenstandsbezug und die geometrischen Konstruktions- sowie Beweisverfahren der Interpretation in einer Sprachgemeinschaft bedürfen. Aus diesem Grund, und zumal weil er deren Verfahren zugleich im Blick auf die intellektuale Anschauung der noesis als deren defizienten Modus erläutert, sperrt er das Selbstverständnis des Denkens ab von dessen intersubjektiver Kommunikationsfunktion. Daher würdigt er den Logos nicht als ein Ergebnis eines argumentativen Dialogs. Vielmehr gelangt er zu einer „radikalen Unterscheidung des Denkens von der Sprache als bloß sekundärem Ausdruck oder Werkzeug (όργανον, organon) der Gedanken“, wie Apel zuspitzt.297 Platons Selbstverständnis zufolge liegt der Geltungsgrund der sokratischen Dialoge nicht in der dialogischen Argumentation, sondern in der geschauten Idee. Die dialogische Kompetenz gilt ihm daher bloß als maieutische. So muß er versuchen, seine Definition des Denkens in 295 296 297 E.A. Wyller, Der späte Platon. Tübinger Vorlesungen 1965, Hamburg 1970, S. 20. Platon, Politeia, 509 d - 511, bes. 510 b 4 - 512 d 6. K.-O. Apel, Der transzendentalhermeneutische Begriff der Sprache, in: ders., Transf. d. Philos., II, (1973), S. 335. 121 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie geltungslogischer Hinsicht durch den Mythos einer Präexistenz der Seele und die Annahme einer reinen Ideen-Intuition zu retten. Wenn diese Prämissen jedoch als nicht tragfähig erkannt werden, bleibt nur der transzendentalpragmatische Schritt zur Idee der Argumentationsgemeinschaft und damit zu der transzendentalpragmatischen These: Geltung beanspruchen kann ein Denken allein im Bezug auf mögliche Dialoge und auf einen Konsens, der selbst in einer unbegrenzten und noch dazu idealen, weil nichts als sinnvolle Argumente zulassenden Gemeinschaft standhielte. Den sokratischen Weg des Geistes in die Dialoggemeinschaft hat Platon nachhaltig blockiert, indem er den Logos (Rede und Sprache) von der Erkenntnis und dem Denken als einem, im Grunde sprach- und gemeinschaftsunabhängigen, intuitiven Selbstgespräch der Seele ablöste. Nach Denkweise und Wirkung ist Platon der erste große Ambivalente im philosophischen Diskurs. Sowohl seine Unterordnung der Kommunikation unter das (als einsame Erkenntnisfähigkeit durch Ideenschau verstandene) Denken, andererseits seine dialogbezogene Kritik des vermeintlichen Wissens und seine Rekonstruktion des impliziten Wissens haben die abendländische Philosophiegeschichte zutiefst geprägt. Durch beides hat Platon den philosophischen Diskurs in Stil, Logik und in einem zwar erkenntniskritischen, aber akommunikativen Selbstverständnis vorgeformt. Seine Amalgamierung von sokratischem Dialog und undialogischer theoria hat eine einzigartige Wirkung entfaltet, so daß sich die abendländische Metaphysikgeschichte in der Tat, nach Alfred N. Whiteheads Bonmot, als „eine Serie von Fußnoten zu Platon“ lesen läßt.298 Auf den Krisenschwellen der Philosophie ist jedoch auch Platons Sokrates, wenngleich in ganz unterschiedlichen Formen, anverwandelt worden: Augustinus, Nikolaus von Kues, teilweise auch der Humanismus und Galilei, dann Montaigne und Descartes, Kants kritischtranszendentalphilosophischer Ansatz bei der quaestio juris und Habermasens bzw. Apels sprachpragmatische Reformulierung des Diskursbegriffs geben charakteristische Beispiele. 4.2 Aristoteles 4.2.1 Aristoteles’ teleologische theoria-Ontologie Platons mit Abstand bedeutendster, doch eigenwillig kritischer Schüler und innerhalb der theoria-Ontologie bald sein Widerpart, war der makedonische Arztsohn Aristoteles (384-347 v. Chr.). Mit gefächertem Interesse für Phänomene, Strukturen und Logik macht er sich einerseits daran, Phänomene zu beschreiben und zu klassifizieren – der erste interdisziplinäre 298 A. N. Whitehead, Process and Reality, New York 1929, S. 63. (Dt.: Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie, Frankfurt a. M. 31987, S. 91.) 122 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Phänomenologe großen Stils; andererseits richtet er, und darin Schüler Platons, einen theoriaBlick auf das „Sein“, der in der Vielfalt und im dynamischen Prozeß des „Seienden“ eine Einheit des „Wesens“ (ουσία, ousia, Substanz) sucht. Mit besonderer Aufmerksamkeit für das Leben, die Lebewesen und ihre Entwicklung, versucht er diese dynamische Vielfalt verstehend zu strukturieren: alles Seiende strebe wie das Lebendige nach einer, in ihm keimhaft angelegten, Gestalt und Seinsform; diese sei der jeweilige Endzweck (τέλος, telos) seiner Dynamik bzw. seiner naturgemäßen Entwicklung. Es ist ein zweckgerichtetes, teleologisches Verstehen, mit dem Aristoteles an die Natur – freilich an die gesamte, nicht nur die organische Natur – und zugleich an die menschliche Sozialwelt herangeht. In dieser Perspektive entwickelt er sowohl den Kern seiner Seinslehre, der Ontologie, als auch seine Lehre von den viererlei Ursprüngen eines Seienden. Die Wirklichkeit sieht er als einen zielgerichteten Prozeß, in dem sich – ich folge der Zusammenfassung Günther Patzigs – drei Momente unterscheiden ließen: ein Wesen bzw. eine „Substanz (ουσία), an der er sich vollzieht, eine Form (ειδος), auf die er zustrebt, und die dieser entgegengesetzte ‚Beraubung’ (στέρησις), von der er ausgeht. Das Seiende ist Stoff (υλη), sofern es (in der ‚Beraubung’) die Möglichkeit (δύναµις) höherer Formung an sich hat; es ist Form, sofern es die Verwirklichung (ενεργεια, εντελεχεια) einer Form ist. Form und Stoff, Möglichkeit und Wirklichkeit sind korrelative Begriffe: jeder Stoff hat schon eine bestimmte Form, jede Form ist nur an ihrem bestimmten Stoff möglich. Die ungeformte Urmaterie (πρώτη υλη) ist nur ein Grenzbegriff, dem keine Realität zukommt. Erste Annäherung an die Urmaterie sind die Elemente (Feuer, Luft, Wasser, Erde), geformt von den Gegensatzpaaren Warm-Kalt, Trocken-Feucht. Stofflose Form hingegen existiert: der unbewegte Beweger, göttlicher Ursprung und Gipfelpunkt zugleich jener Hierarchie, die sich im kontinuierlichen Aufstieg von niederer zu höherer Form verwirklicht. Neben die Lehre von den drei Momenten in allem Werden tritt die Theorie von den vier Ursachen: causa materialis, efficiens, formalis und finalis. Wenn ein Haus entstehen soll, müssen Steine und Holz bereitliegen (Materialursache), muß ein Baumeister mit Hilfe eines Bauplans die Materie organisieren (Wirkursache), muß das Endprodukt das Wesen ‚Haus’ verkörpern (Formalursache); und brauchte man nicht ‚schützende Hüllen für Menschen und deren Besitz’, baute man kein Haus (Endursache). Entsprechend bei Lebewesen: der Vater teilt als Wirkursache der vom mütterlichen Organismus vorgeformten Materie das ειδος mit; der embryonale Prozeß wird von dem Ziel (τέλος) gesteuert, ein neues Exemplar der Spezies, dem Vater gleich, hervorzubringen. Wirk-, Formal- und Endursache fallen im ειδος 123 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie zusammen. Nur ‚ein Mensch kann einen Menschen zeugen’, das fertige Bild des Hauses ‚in der Seele des Baumeisters’ bringt ein Haus hervor. […] Endursachen regieren die Welt. Die Welt im ganzen ist ewig, denn alles Werden setzt schon ein Substrat voraus. Die reine Form des ‚ersten Bewegers’ muß also der Welt eine ewige Bewegung mitteilen. Nun können in endlichem Raum nur Kreisbewegungen unaufhörlich fortgehen: unmittelbare Wirkung des Göttlichen νους ist daher das Kreisen des Fixsternhimmels. Gott ist stofflos und kann also nicht mechanisch wirken: er bewegt, selbst ruhend, die Welt, so ‚wie das Geliebte’ (Met. Λ, 7), selbst unbewegt, den Liebenden anzieht. Der Fixsternhimmel ahmt durch ewiges Kreisen die Ewigkeit Gottes auf seine Weise nach. Dass A[ristoteles] das reine Wesen, die stofflose Form Gottes als ‚Denken’ bestimmt, entspricht seiner Gleichsetzung des Begriffs mit dem Wesen, der Wahrheit mit dem Sein. Nicht, daß er Denken und Sein identifizierte; er läßt sie in einer naiven, zugleich tiefsinnigen Weise undifferenziert.“299 Deutlich von Platon und dessen Kosmostheologie beeinflußt, umspannt die Aristotelische Metaphysik Ontologie, Physik und Theologie als Suche nach den allen Dingen innewohnenden Zwecken und Formen, auf die sie gleichsam programmiert seien. Der in jedem Seienden angelegte Endzustand ist für Aristoteles gleichbedeutend mit dessen Natur. Er hat einen strikt teleologischen Entwicklungsbegriff von „Natur“, demzufolge „die Natur nichts sinn- und zwecklos tue“.300 Natur definiert er als „das, was aufgrund eines immanenten Prinzips in kontinuierlicher Bewegung einem Zweck entgegeneilt“301, womit er sich der quantitativ mechanistischen Atomtheorie Demokrits entgegenstellt, die Natur mit den „Atomen, die im Raum umhergeschleudert werden“, gleichsetzt. Aristoteles sieht ein Seiendes stets im Blick auf seine Anlage und damit auf seine Entwicklung hin zu dem jeweiligen Soll- bzw. Endzustand. Der vorprogrammierte Endzustand zeige sich in dem fertigen, wirklichen Einzelding als dem konkreten Wesen (ουσία, Substanz); und zwar an dessen Form (ειδος) bzw. Gestalt (µορφή). Daher falle der Zweck (das Worum Willen, το ου ένεκα) zusammen mit der einprogrammierten Form eines Dinges. So bringt Aristoteles drei der unterschiedenen Ursprünge – seit der Scholastik auch causae, also ‚Ursachen’ genannt – in seiner Theorie der bewegten, dynamischen Wirklichkeit aufs engste zusammen, den Zweckursprung (causa finalis) mit der Wirkursache (causa efficiens) und diese mit dem Formursprung (causa formalis). Die Form, das Eidos, hebt er als das Wesen hervor, sie sei die ουσία ανευ υλης,, das Wesen ohne Materie. 299 300 301 G. Patzig, Artikel „Aristoteles“, in: Religion in Geschichte und Gegenwart (zit.: RGG), 3. Auflage, Bd. 1, Tübingen 1957, S. 597-602, hier: S. 599f. Aristoteles, De coelo B, 11; 291 b 13. Ders., Physik B, 8; 199 b 15. Empfehlenswert dazu: J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie, Bd. I, Frankfurt a.M. o.J., bes. S. 198ff. 124 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Die spekulative Annahme von Naturzwecken, nach denen die Dinge streben, führte zu einem teleologischen Naturverstehen, insbesondere einem Verstehen organischer Prozesse: Aristoteles betrachtet die Natur verstehend, das heißt, er verfährt analog zum Verstehen intentionaler Handlungsabläufe und zum Sinnverstehen eines Textes. So konnte sich die aristotelische Naturbetrachtung mit dem Topos vom ‚Buch der Natur’ bzw. liber naturae verbinden. Es ist dieser Topos, woran sich die Naturerkenntnis und die natürliche Theologie, die Lehre von der Gotteserkenntnis aus der zweckvoll eingerichteten Natur orientiert hat – und das bis in die Neuzeit.302 Eine solche qualitative, sinn- und zweckverstehende Sichtweise ist unvereinbar mit der modernen objektivierenden Außenansicht, die nach den kausalen Bedingungen fragt, welche ein bestimmtes Naturereignis gesetzmäßig verursachen und einen bestimmten Prozeß ebenso gesetzmäßig auslösen. In dieser nomologischen Perspektive versucht man ein Naturereignis nicht etwa zweckbezüglich und gewissermaßen von innen als Phänomen nachzuverstehen; vielmehr konstruiert man es mit Hilfe bestimmter Gesetzesannahmen als Fall eines allgemeinen Natur-Gesetzes, genauer: als Fall einer nomologischen Theorie. So tritt an die Stelle eines teleologisch verstehbaren Phänomens, von dem angenommen wird, es zeige sich von sich selbst her, das sinnleere bzw. stumme Objekt einer theoretischen Erklärung. Es bedurfte einer Denk- und Methodenrevolution, damit es in der Neuzeit, eindeutig mit Galileo Galilei und Isaac Newton, zur mathematisierten, konstruktiv kausalerklärenden Naturwissenschaft kommen konnte.303 Allerdings hatte dieser Paradigmenwechsel einen organismustheoretischen und ökologischen Preis, weil er einen Objektivismus der Betrachtungsweise und Methode einschließt – ambivalent für die Biologie und für den Umgang mit der Natur riskant. Biologisch blendet er ab, daß die Lebensprozesse in der außermenschlichen wie in der menschlichen Natur ohne die auch die elementaren Quasi-Zwecke der Organismen, nämlich das Funktionieren des Stoffwechsels, die Selbsterhaltung und die angelegte Selbstentfaltung des Organismus nicht begreiflich sind.304 Ökologisch ist ein Objektivismus unsensibel für das Wechselverhältnis 302 303 304 Vgl. D. Böhler, Naturverstehen und Sinnverstehen, in: F. Rapp (Hg.), Naturverständnis und Naturbeherrschung. Philosophiegeschichtliche Entwicklung und gegenwärtiger Kontext, München 1981 (zit.: Naturverständnis (1981)), S. 70-95. Vgl. A.C. Crombie, Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissenschaft, München 1977. K.-O. Apel, Das Verstehen – eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte), in: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. I , Bonn 1955, S. 142-199 (zit.: Das Verstehen (1955)). J. Mittelstraß, Das Wirken der Natur. Materialien zur Geschichte des Naturbegriffs, in: F. Rapp (Hg.), Naturverständnis (1981), S. 36-69. D. Böhler, In dubio contra projectum, in: ders. (Hg.), Ethik für die Zukunft. Im Diskurs mit Hans Jonas, München 1994 (zit.: Ethik für die Zukunft (1994)), S. 244-276. Dazu: H. Jonas, Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Göttingen 1973 (zit.: Organismus und Freiheit (1973)), bes. S. 22ff, 34ff, 53ff, 103ff, 124f und 130ff. K.-O. Apel, Die Erklären : Verstehen-Kontroverse in transzendentalpragmatischer Sicht, Frankfurt a. M. 1979, bes. S. 307ff. 125 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie von Organismus und Umwelt als dessen Lebenszusammenhang. Organismen hängen von einer zuträglichen Umwelt ab. Nun ist aber die faktische Umwelt von Pflanzen, Tieren, Menschen gesellschaftlich – durch menschliche Kultivierung, Industrie und Technologie – derart folgenschwer verändert worden, daß es einer lebenssensiblen, ökologisch perspektivierten Technologie bedarf, deren Selbstverständnis und Methode einer Umweltethik entgegenkommt. Es ist deshalb kein Zufall, daß seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als Hermeneutik, Pragmatik und Ökologie einander in der Kritik des methodologischen Objektivismus begegneten, der aristotelische Verstehenszugang zur Natur wissenschaftstheoretisch, naturphilosophisch und kritisch differenziert und ökologisch aktualisiert werden konnte: nach Hans Jonas’ Pioniertat einer „philosophischen Biologie“ (1966) zumal von Karl-Otto Apel mit transzendentalpragmatisch wissenschaftstheoretischer Fragestellung (1979) und von Robert Spaemann sowie Reinhard Löw (1981) in ontologischer Sicht.305 Kehren wir zu Aristoteles, dem Enkelschüler des Sokrates zurück, und fragen nach seinem Philosophieverständnis, so fällt gleich auf, daß er in erster Linie gegenstandstheoretisch, nämlich substanzontologisch, dachte, nicht etwa sokratisch dialogisch. Demgemäß begriff er die Philosophie nicht als methodischen Dialog und als dessen Reflexion, sondern als theoria des Seins. Er suchte eine durch Prinzipien gesicherte Erkenntnis des Seienden, insofern es ist.306 Eine solche Erkenntnis nennt er Philosophie und stellt sie sowohl der Dialektik, die es bloß zum Wahrscheinlichen bringe und beim Erkenntnisversuch stehenbleibe, als auch der Sophistik entgegen, da diese zwar Philosophie zu sein scheine, jedoch keine sei.307 Unter Prinzipien (αρχαι) verstand er in erster Linie Quellen bzw. Ursprünge des Seienden, die diesem objektive Grundcharaktere verleihen wie die Selbigkeit der Form (ειδος) und die Strebigkeit zum naturgemäßen Zustand, dem Telos. Zudem kann er darunter Erkenntnis- und Verfahrensgrundsätze bzw. Beweisaxiome verstehen. Als das erste Verfahrensprinzip gibt er den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch an. Doch versteht er diesen logischen Grundsatz zugleich ontologisch; denkt er ihn doch als verwoben mit den Ursprüngen bzw. tragenden Charakteren des Seins, in diesem Fall mit der Selbigkeit eines Wesens dank der Identität seiner einprogrammierten natürlichen Form. 305 306 307 Zu Jonas und Apel siehe Anm. 162; R. Spaemann, R. Löw, Die Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, München/Zürich 1981; R. Löw, Zur Wiederbegründung der organischen Naturphilosophie, in: D. Böhler (Hg.), Ethik für die Zukunft (1994), S. 68-79. Aristoteles, Metaphysik, 1003 a 21-32, vgl. 1005 a 24 u.ö. A.a.O., 1004 b 17-26. 126 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Folgt er hierin nicht seinem Lehrer Platon, insofern dieser die Ideen zugleich als Seinsstrukturen und Erkenntnisvoraussetzungen angesetzt hatte? Jedenfalls interpretiert er den logischen Satz vom Widerspruch als ontologisches principium: als Formel für die Selbstidentität der Substanzen. Davon geht er im vierten Buch seiner Metaphysikvorlesungen, in dem er den Satz vom Widerspruch als gültiges Axiom erweist, offenkundig aus, sowohl im ersten wie im dritten Kapitel. Er bekräftigt diese substanzontologische Deutung308 im Fortgang des vierten Kapitels mit gegenstandstheoretischen Argumenten, undialogisch und gegen die natürliche Sprachpragmatik denkend. Die gegenstandstheoretische Perspektive wird sein Nachfolger in der peripatetischen Schule, Theophrast, als die philosophische Perspektive auszeichnen und sie der vermeintlich unphilosophischen Pragmatik entgegensetzen. Ontologie bestimmt Aristoteles als jene Erkenntnisweise, die das Seiende so erkenne, wie es an sich selber ist, d.h. in seiner Identität und damit in seinem aktuellen Was- und Eines-Sein, um es in der Sprache des Thomas zu sagen. Eben diese Seinserkenntnis würdigt Aristoteles als die „erste Philosophie“ oder ‚erste Wissenschaft’.309 Damit erkennt er der Metaphysik, der Substanzontologie, den Vorrang vor Logik und Erkenntnistheorie zu. Warum? Jene sei absolut wahrheitsfähig, weil sie von dem handele, was so sei, wie es ist und nicht anders sein kann – ganz im Unterschied zur Praktischen Philosophie, zu Politik und Ethik. Denn diese habe es mit den veränderlichen bzw. schwankenden Angelegenheiten der Handlungswelt zu tun.310 Also vor seinem ewigkeitsontologischen Hintergrund und dank seiner Offenheit für unterschiedliche Phänomene bzw. Erkenntnisgegenstände entdeckt er, daß die theoria, der Erkenntnisrahmen des Ontologen und dessen Suche nach ewigen Seinsstrukturen, quer steht zur geschichtlichen und sozialen Welt. Sie tauge nicht eigentlich zur Erkenntnis der Polisbildung und Polisleitung noch werde sie dem Orientierungsanspruch der Staatskunst und Ethik gerecht. Denn das seien praktische Wissenschaften, deren Ziel nicht im Erkennen (ewiger Wahrheit), sondern in situationsbezogenem Handeln liege. [Fortsetzung folgt!] Was andere Erkenntnismethoden anbelangt, kann er auch den Gegensatz zur Dialektik betonen, weil die es bloß zum Wahrscheinlichen bringe und beim Erkenntnisversuch stehenbleibe. Erst recht setzt er seine ontologische Philosophie der Sophistik entgegen, da diese zwar Philosophie zu sein scheine, jedoch keine sei.311 308 309 310 311 Die thomasische Auslegung, derzufolge Aristoteles den Satz vom Widerspruch „offenbar in Zusammenhang mit dem Seinsmerkmal des Identischen (Selbigen), von dem er in Kapitel 3 sprach“, gesehen habe, trifft m.E. zu. So der Kommentar Horst Seidls in der Meiner-Ausgabe der „Metaphysik“: Hamburg 1991, S. 349, vgl. 351ff. Aristoteles, Metaphysik, 1004 a 3ff. Aristoteles, Nikomachische Ethik, I, 1094 b 12-27. Aristoteles, Metaphysik, 1004 b 16-26. 127 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Für das Selbstverständnis wie auch für die Inhaltsbestimmung der Philosophie war Aristoteles von kaum zu überschätzender Wirkung: seit seiner Wiederentdeckung und theologischphilosophischen Aneignung durch Albertus Magnus und Thomas von Aquin hat er die Philosophie erneut auf das Paradigma einer metaphysisch teleologischen Ontologie festgelegt. Selbst nach dem Paradigmawechsel, nämlich in dem neuzeitlichen, modernen Paradigma der Subjekt- bzw. Bewußtseinsphilosophie lebt die Aristotelische Ontologie begrifflich fort. Doch auch für ein strikt nachmetaphysisches Denken, für die Selbstaufklärung des Philosophierens als eines Denkens im Dialog und als eines Begründens aus dem Dialog ist Aristoteles von Bedeutung. 4.2.2 Der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch: Verbindlichkeit aus dem Diskurs. Oder: Aristoteles als Diskpragmatiker avant la lettre? Diese Aktualität zeigt sich heute bei der Entwicklung eines dritten, kommunikationsbezogenen Paradigmas der Philosophie. Jetzt erst nehmen wir den Richtungsstoß wahr, den er für ein sokratisch dialogisches Selbstverständnis des Denkens als kommunikativ reflexiven Diskurses gegeben hat. Paradoxerweise ist es nämlich der metaphysische Seinsdenker, der – auf der Suche nach den ersten Quellen des Seins und den ersten Grundsätzen bzw. Beweisaxiomen der Seinslehre – den Sokratischen Elenchos als genuin philosophische Begründungsweise ins Spiel bringt. Wird der Ontologe gegen sein Selbstverständnis zum Sokratiker und Dialogiker? Als Ontologe sucht Aristoteles das „sicherste Prinzip von allen Dingen“, über das „kein Irrtum möglich ist“312. Dieses müsse das zugleich ontologische Prinzip der Identität und das logische des Satzes vom Widerspruch sein. In seinen Vorlesungen über eine erste Philosophie, die viel später, nach der Anordnung seiner Vorlesungen, den Namen „Metaphysik“ – die nach der Physik – erhalten sollte, stellt er im vierten Buch die Philosophie als diejenige Wissenschaft heraus, die einerseits vom ursprünglichen Wesen dessen, was ist, handelt und andererseits von den „allergewissesten“ Axiomen bzw. ersten Grundsätzen. In einer Diskussion mit relativistischen Skeptikern – offenbar mit Herakliteern, die die Gültigkeit dieses doppelten Prinzips bestreiten und von ihm dessen Beweis, nämlich eine αποδειξις (apodeixis), eine Deduktion abverlangt haben –, gerät der junge Aristoteles offenbar in Beweisnot. Gegenüber seinen Gegnern kann er nicht einfach im Sinner seiner 312 Ebd., 1005 b 10-17. 128 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Ontologie weiterargumentieren. Ebenso wenig kann er sich auf die von seinen Gegnern vorausgesetzte formallogische Beweismethode, nämlich auf die Deduktion des zu Beweisenden aus Obersätzen, verlassen. Denn diese würde – wir kommen darauf – nur in drei Verlegenheiten führen, in ein Trilemma. In dieser Beweisnot entwirft der junge Aristoteles einen anderen Begründungsweg: eine reflexiv sinnkritische Argumentation. Denn allein auf eine solche reflexive Weise, nicht aber durch eine Deduktion aus Obersätzen, sei es möglich, ein in der Tat fundamentales und irrtumsfreies Prinzip zu erweisen: ein Prinzip, das für jeden als Dialogpartner unhintergehbar ist. Allein reflexiv, und gewissermaßen praktisch, d.h. durch Rückgang auf das, was auch ein Skeptiker, insofern er sich am Dialog beteiligt, voraussetzen muß, lasse sich überhaupt die Gültigkeit jenes elementarsten und sichersten aller Grundsätze erweisen.313 Warum? Nun, jeder, der überhaupt etwas Bestimmtes zu verstehen gebe (σηµαίνειν, semainein) und geltend mache, also jeder, der überhaupt etwas denke und es zu sich oder zu einem anderen sage,314 der habe dieses Prinzip – jedenfalls als Satz des Widerspruchs – bereits als gültig vorausgesetzt und es implizit als Grundregel der Rede anerkannt. Das sieht in der Tat nach einem schlagenden Argument aus. Doch läßt sich aus der Moderne, aus dem Denken seit Hume und Kant, nicht doch ein geltungslogischer Einwand dagegen vorbringen? Versuchen wir es: ‚Nun gut’, könnte ein moderner Skeptiker einwenden, ‚so mag es sein. Doch schließt du damit nicht von einem bloßen Faktum auf die Verbindlichkeit einer Norm? Das wäre ein faktizistischer bzw. naturalistischer Fehlschluß eigener Art.’ Dieser Einwand läßt sich nur entkräften, wenn man demonstrieren kann, daß jenes Voraussetzen des Widerspruchssatzes als eines gültigen Prinzips ebenso dialogisch wie logisch notwendig ist – durch kein sinnvolles Argument hintergehbar. Dazu tut Aristoteles einen wichtigen Schritt. Denn er kann, wie jeder von uns, hier eine Sinnbedingung des EtwasDenkens ins Spiel bringen; mithin etwas, das nicht bloß faktisch von N.N. anerkannt worden ist – dann hätte das Anerkannte einen bloß zufälligen Charakter, so daß ihm keine allgemeine Verbindlichkeit zukäme –, vielmehr etwas, das sich gar nicht sinnvoll in Zweifel ziehen läßt, weil es zur Sinnbasis eines jeden möglichen Dialogs gehört. So können wir mit Aristoteles reflexiv sinnkritisch argumentieren: Eine Person, die sich selbst bzw. Anderen etwas verständlich macht, kann dieses Gesagte/Gedachte allein dadurch als Beitrag in einem Diskurs zur Geltung bringen, daß sie eine verpflichtende Partnerrolle eingenommen hat: die Rolle eines Partners in einem Dialog, worin allein diskutierbare 313 314 Ebd., 1005 b 17f und 1005 b 33f. Ebd., 1006 a 21-23; hiermit paraphrasiert er übrigens Sokrates nach Platon, Theaitetos 189 e 4 - 190 a 2. Vgl. 1006 b 7-9. 129 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Argumente zählen. Denn diese Voraussetzung stellt, so läßt sich Aristoteles explizieren, eine argumentativ unhintergehbare Sinnbedingung der Rede bzw. eines Logos dar. Das macht er schlagartig klar: Jeder, der sich nicht davonstehle oder sich stumm wie eine Pflanze verhalte, sondern Rede und Antwort stehe, müsse – wenn er nur im Dialog auf die Sinnbedingungen des Rede-und-Antwort-Stehens achte – zugeben, daß die These, alles könne „so“ und zugleich „nicht so“ sein, in ihrer Bedeutung eigentlich nicht nachvollziehbar und als Argument mit Geltungsanspruch nicht prüfbar sei. Also sei der bezweifelte Grundsatz vom zu vermeidenden Widerspruch als Prinzip wahr und als Diskursregel verbindlich. Aristoteles konstatiert, daß diese kritische Argumentation den Satz vom Widerspruch durch Widerlegung seiner Bezweiflung beweise.315 Fragt sich nur, ob diese formallogische Bewertung hinreichend bzw. angemessen ist. Trifft sie die Form des Erweises? Sowohl das Erweisziel als auch die Erweismethode sind sinnkritischer Art: das, was erwiesen werden soll, ist die Unhintergehbarkeit des Prinzips; die Art des Erweises ist eine diskurspragmatische Sinnkritik. Das Resultat lautet daher: Die These von N.N. ist nicht diskutierbar. Was sich aber nicht auf seine Wahrheit oder Falschheit hin diskutieren läßt, das ist nicht widerlegungsfähig. Wer derlei behauptet, ist bereits vor jeder Wahrheitsprüfung gescheitert. Sein Dialogbeitrag ist sinnlos. Er ist mit diesem Beitrag aus dem argumentativen Dialog ausgeschieden. Das Fazit müßte also nicht „Widerlegung der Beweisführung“ lauten, sondern Sinnlosigkeit der Bezweiflung (als Dialogbeitrag) bzw. dialogische Sinnlosigkeit. Denn weder eine Rede insgesamt, also als Beitrag in einem Diskurs, noch eine Aussage als Satz, die widersprüchlich ist, kann überhaupt eindeutig identifiziert, intersubjektiv nachvollzogen und auf mögliche Wahrheit hin geprüft werden. Sie ist sinnlos. Dasjenige aber, an dessen Gültigkeit sich nicht mit einer verständlichen, sinnvollen Rede zweifeln läßt, das ist gültig. Und sofern dasjenige, an dessen Gültigkeit sich nicht mit einer verständlichen, sinnvollen Rede zweifeln läßt, einen normativen, moralischen Gehalt besitzt, ist es verbindlich. Diese diskurspragmatische Konsequenz zieht der Ontologe und Logiker nicht; dafür bietet sein Selbstverständnis als theoria-Denker keinen Raum. Will man Aristoteles’ Argument sinnkritisch interpretieren und durchführen, so scheinen sich zwei Wege anzubieten, nicht allein der dialogpragmatische, sondern auch ein satzsemantischer. Diesen will Ernst Tugendhat einschlagen. Doch seine Pointe lautet: ‚Eine Aussage, die in ein und derselben Hinsicht Verschiedenes besagt, nämlich zugleich A und non-A geltend macht, ist nicht diskutierbar.’316 Freilich hat er mit dem Kriterium der 315 316 Ebd., 1006 a 15-18 und 1006 a 22-28. Vgl. E. Tugendhat, U. Wolf, Logisch-semantische Propädeutik (1983), S. 50-59. 130 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Diskutierbarkeit implizit schon einen diskurspragmatischen Standpunkt bezogen. Denn damit argumentiert er als Diskurspartner, der vom Sprecher des Satzes erwartet, daß dieser in einem unausgesprochenen Behauptungsakt („Ich behaupte hiermit als verständlich und wahr: A ist zugleich A und non-A“) bestimmte diskussionsermöglichende, weil prüfbare Geltungsansprüche erhoben hat. Das heißt aber, daß auch der sprachanalytische Philosoph, der Satzsemantiker, eine diskurspragmatische Perspektive in Anspruch nehmen muß. Er kommt nicht umhin, den zu prüfenden Satz als den propositionalen Teil eines kompletten, formal vollständigen Diskursbeitrages in einem Dialog zu verstehen. Mithin nimmt er selbst (virtuell) die Rolle des Diskurspartners ein. Also denkt er eigentlich nicht bloß satzanalytisch, nicht allein in der theoretischen Einstellung dessen, der einen Satz von außen und nur auf seine Semantik hin analysierte. Vielmehr versteht er a priori das pragmatische Eingebettetsein des Satzes in einen Diskussionsbeitrag, für den der Sprecher Geltung beansprucht. Im Widerspruch zu seinem satzanalytischen Selbstverständnis setzt er von vornherein bei dem geltungslogisch pragmatischen Sinn eines Satzes als Diskursbeitrag mit Geltungsanspruch ein. Seine sinnkritische Begründung des Satzes vom Widerspruch ergibt sich just aus der Perspektive, die er als Satzanalytiker außen vor läßt, nämlich aus der Perspektive eines Diskursteilnehmers… Das zeigt, daß eine bloß satzsemantische Analytik gewissermaßen dialogparasitär ist; lebt sie doch von einem Geltungssinn, den sie als Analyse nicht einholen kann. Dieser Befund berechtigt dazu, die umfassende dialogbezogene Perspektive einzunehmen und Aristoteles’ negativen Erweis auf die ganze Rede zu beziehen: Gerade ein formal vollständiger Diskursbeitrag – ein performativer Akt, der Geltungsansprüche erhebt, in Verbindung mit einer Proposition, für die Geltung beansprucht wird – ist für Diskurspartner (und auch für den Sprecher als Diskursteilnehmer) allein dann verständlich, wenn im Verhältnis beider Teile zueinander, also Geltungsanspruch und Proposition, kein Widerspruch besteht. Anders gewendet: in dialogreflexiver Einstellung läßt sich demonstrieren, daß man eine pragmatisch bzw. performativ widersprüchliche Rede überhaupt nicht als Diskussionsbeitrag aufnehmen kann, weil man sie weder als etwas von bestimmter Bedeutung verstehen noch auf ihre Geltung hin prüfen kann. Man kann sie eben nicht diskutieren. Wer derlei vorbringt, hat durch diesen Akt den argumentativen Dialog verlassen. Er hat sich – mit dieser Rede – disqualifiziert, so daß sein Votum ausscheidet; es zählt nicht. So hätte der dialogpragmatische Coup des jungen Aristoteles aussehen können. Und in gewisser Weise scheint er für einen Blitzschlag die reflexive Einstellung und den ultimativen Status eines sokratischen Elenchos, dessen Rang als dialogreflexiven Gültigkeitserweis eines 131 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Prinzips, erspürt zu haben – die Möglichkeit einer Prinzipienbegründung durch Reflexion im Dialog auf Sinnvoraussetzungen eines Dialogbeitrags eröffnend. Freilich ist die geniale sokratische Intuition des Peripatetikers weder von ihm selbst noch von der Philosophiegeschichte in seiner reflexiven Methodik erkannt geschweige denn ausgeschöpft worden. Umso mehr verlohnt es, bei ihm zu verweilen und ihn zu explizieren – mit Bezug auf Wolfgang Kuhlmanns reflexiv pragmatische Rekonstruktion317. Aristoteles entdeckt eigentlich, sagten wir, daß eine Rede, die nicht dem Satz vom zu vermeidenden Widerspruch folgt, nicht verständlich ist. Folge sie ihm nämlich nicht, dann könne niemand, weder der Sprecher noch die Hörer, wissen, wovon eigentlich die Rede sei, was also diskutiert und auf seine Gültigkeit hin geprüft werden solle. In solchem Falle bringe der Redende eine These (einen Zweifel oder eine Bestreitung) vor, die sich nicht identifizieren und als Diskussionsbeitrag nicht verstehen lasse. Das heißt: ein solcher Gegner diskutiert gar nicht. Zwar scheint er einen Diskurs zu eröffnen, indem er die Rolle eines Diskurspartners einnimmt (oder prätendiert); doch hält er diese Rolle nicht durch, vielmehr entzieht er sich durch seine widerspruchsvolle Rede dem Dialog der Argumente, weil er etwas vorbringt, das Argumentationsteilnehmer nicht als Argument nachvollziehen und prüfen können. Diese, bei dem jungen Aristoteles zumindest angelegte, reflexive Sinnkritik kann, sofern sie diskurspragmatisch expliziert und demgemäß durchgeführt wird, sechs Dinge demonstrieren: Jeder Gedanke basiert auf dem dialogbezogenen Geltungsanspruch, als Diskursbeitrag verständlich zu sein (1). Dieser Verständlichkeitsanspruch impliziert die Anerkennung, daß der Satz vom (zu vermeidenden) Widerspruch logisch gültig (2) und für alle möglichen Diskursteilnehmer dialogisch verbindlich ist (3) – ein unhintergehbares Sinn- und Geltungsprinzip des Denkens als Diskurs. Der erhobene Geltungsanspruch auf Verständlichkeit läßt sich nicht elementarsemantisch verengen auf die Nachvollziehbarkeit eines sprachlichen Ausdrucks, sondern geht primär auf den direkten Kontext einer Redehandlung als Diskursbeitrag, der sich auf seine Gültigkeit oder Ungültigkeit hin diskutieren läßt. Der Verständlichkeitsanspruch ist also, weil er darauf zielt, daß man das Gesagte als Diskursbeitrag ernstnehmen und hinsichtlich seiner Geltungswürdigkeit prüfen kann, verwoben mit Ansprüchen der Gültigkeit, nämlich mit dem theoretisch-empirischen Geltungsanspruch auf Wahrheit und dem praktischen auf Richtigkeit bzw. Legitimität (4). 317 W. Kuhlmann, Refl. Letztbegründung (1985), S. 267-278. 132 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Der dialogpragmatische Schluß auf die Sinnlosigkeit eines Zweifels an der Gültigkeit und Verbindlichkeit des Satzes vom Widerspruch ist schlagend. Ein dialogreflexiver Schluß zeigt sich als eigenständiger Beweis. Wir haben es hier mit einer ganz anderen Beweisart zu tun, als es die aussagenlogische Deduktion eines Satzes aus Obersätzen ist: hier liegt ein sinnkritisch reflexiver Aufweis oder Elenchos vor (5). Die sinnkritische Evidenz des dialogreflexiven Elenchos unterscheidet ihn scharf von einer formallogischen Ableitung. Denn ein deduktiver Beweisgang führt in einen unendlichen Regreß auf wiederum bezweifelbare, beweisbedürftige Axiome oder zur dogmatischen Festsetzung eines „ersten“ Axioms, die den Begründungsdiskurs abbricht, oder aber zu einem logischen Zirkel, weil auf begründungsbedürftige Aussagen zurückgegriffen wird. Das ist die Einsicht in das von Jakob Friedrich Fries (1773-1843) und Hans Albert dargelegte Münchhausentrilemma (6a). Hingegen eröffnet der reflexive Rückgang auf interne Sinnbedingungen des Diskurses einen abschließenden Gültigkeits- oder Verbindlichkeitserweis, eine „reflexive Letztbegründung“ (W. Kuhlmann) bzw. einen dialogreflexiven Erweis (6b)318. Denn wenn ein Dialogpartner dem anderen reflexiv aufzeigt, daß dieser die logische Geltung und dialogische Verbindlichkeit eines als Prinzip behaupteten Satzes nicht ohne pragmatischen bzw. performativen Selbstwiderspruch (zu der von ihm selbst in Anspruch genommenen Rolle eines Diskurspartners) bezweifeln kann, so demonstriert er sinnkritisch, und zwar unhintergehbar, daß eben dieser Satz gültig und für einen Diskursteilnehmer verbindlich ist – ein absolutes Prinzip des Denkens als Diskurs. Das ist die Pointe einer aktuellen, sokratisch sinnkritischen Dialogreflexion. Karl-Otto Apel hat sie in der Auseinandersetzung mit Hans Albert angebahnt und auf die Formel „Reflexion auf den Diskurs im Diskurs“ gebracht.319 Die Diskurspragmatik zeichnet eine solche Dialogreflexion als den eigentlichen philosophischen Beweis aus: allein sie könne die Grundlagen des Philosophierens als denknotwendig und allgemeinverbindlich erweisen. Das, was der frühe Aristoteles in der Diskurssituation der Prinzipienbegründung entdeckt oder doch gegenüber Prinzipienbezweiflern in Anspruch genommen hat, die Umstellung des Etwas-Denkens zu einer aktuellen Reflexion auf dessen Sinnbedingungen in dem gerade geführten Dialog, kann er jedoch weder als Ontologe, der theoretisch spekulativ denkt, noch später als Logiker, der bloß theoretisch analytisch verfährt, in Besitz nehmen. Denn wer allein in theoretischer und analytischer Einstellung über etwas nachdenkt, statt auf seine dialogische 318 319 Vgl. W. Kuhlmann, Refl. Letztbegründung (1985). Vgl. D. Böhler, Rek. Pragm. (1985), bes. S. 296-308, 363-384, vgl. 335ff; H. Gronke, Die Praxis der Reflexion, in: Burckhart und Gronke (Hg.), Philosophieren (2002), bes. S. 34ff. K.-O. Apel, Auseinandersetzungen (1998), S. 179. 133 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Praxis zu reflektieren, der vergißt methodisch, was er dialogisch tut bzw. je schon getan hat, daß er nämlich selbst Geltungsansprüche gegenüber Anderen erhoben hat. So vergißt der spätere Aussagenlogiker Aristoteles das – für die Selbsteinholung des Diskurses und damit für die Letztbegründung von Prinzipien ausschlaggebende – dialektische Zugleich von theoretischer Einstellung und aktuell reflexiver Einstellung, wenn er den Elenchos nur als analytisches Instrument entwickelt: als indirektes Verfahren eines Beweises durch Widerlegung einer aufgestellten Behauptung.320 Der Elenchos habe „die Form der reductio ad absurdum, welche den Schluß auf die Negation der widerlegten Aussage erlaubt“321. Doch behandelt ein solches formallogisches Beweisverfahren die (in unserem Zusammenhang als unbezweifelbar gültig) zu erweisende Präsupposition (hier: ‚der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch ist unhintergehbar’) nur wie eine Prämisse in einem Syllogismus. Für den, der so verfährt – bloß analytisch technisch, ohne sich und die Anderen als Diskussionspartner zu berücksichtigen –, gilt dann tatsächlich, was Alfred Berlich irrtümlich gegen die transzendentalpragmatische Idee der reflexiven Letztbegründung vorgebracht hat: daß „das elenktische Argument vom transzendentalen Charakter des zu Begründenden Gebrauch macht, nicht ihn begründet“322. Das ist das Begründungsdefizit des Aristoteles. Er fällt damit hinter seinen eigenen Ansatz oder doch Anstoß zurück, der auf einen reflexiven Gültigkeitserweis des transzendentalen Prinzips der Logik abzielt. Indem er in seiner Ersten Analytik eine bloße Aussagenlogik entwickelt und nunmehr den Sokratischen Elenchos bloß „aus der Perspektive der apodeiktischen Logik analysiert“323, hat er das dialektische Zugleich des Elenchos, nämlich zugleich Rede über etwas und Reflexion auf die Redehandlung zu sein, im vorhinein abgespannt. Als theoretisch eingestellter Analytiker von Aussagen begibt er sich der sokratisch reflexiven Begründungsperspektive und damit auch ihres Ertrags. Denn der besteht darin, daß die Gültigkeit des zu begründenden Prinzips im Dialog durch Reflexion auf die von ‚mir’ in Anspruch genommenen Sinnbedingungen des Dialogs erwiesen wird: als nicht hintergehbar von ‚mir’. Von ‚mir’? Wer ist dieses Ich? Jeder kann es sein, insofern er überhaupt etwas zu verstehen gibt und zur Geltung bringen will. So bin ich es selbst, der ‚ich’ in der Rolle eines 320 321 322 323 Aristoteles, Analytica priora I, 6, 28b, 21; I, 23, 41a, 23ff sowie II, 20, 66b, 11 u.ö. A. Berlich, Elenktik des Diskurses, in: Kuhlmann und Böhler (Hg. 1982), S. 251-287, hier S. 279, vgl. D. Böhler, Transzendentalpragmatik und kritische Moral, in: a.a.O., S. 83-123, bes. S. 85-92. A. Berlich, a.a.O., S. 261f. K.-O. Apel, Auseinandersetzungen (1998), S. 172. 134 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie glaubwürdigen Diskurspartners einen bestimmten Zweifel als Diskursbeitrag vorbringe oder einen anderen Gedanken verständlich und geltend mache. Der Aussagenlogiker Aristoteles verspielt diese dialogisch reflexive Begründungspointe des Sokratikers. Damit beraubt er den Elenchos seiner Bedeutung als Selbstaufhebungsargument, als Erweis einer Sinnlosigkeit. Denn der Elenchos kann ein bezweifeltes Prinzip negativ begründen, indem er den dagegen vorgebrachten Geltungszweifel als sinnlos vorführt – als Zerstörung des Geltungsbodens, auf dem der Zweifelnde als Sprecher, der einen Gedanken verständlich und geltend machen will, doch selber steht. 4.2.3 Die peripatetische Verbannung der Pragmatik aus der Philosophie – Türöffnung für den methodischen Solipsismus Es ist kein Wunder, daß die theoretische Denkeinstellung in Aristoteles’ Philosophie den Sieg über eine reflexiv sokratische davonträgt. War diese doch ein ungesicherter Versuch, jene aber übermächtig etabliert in der griechischen theoria-Tradition. So kann der Platonschüler – seiner Kritik an der Ideenlehre zum Trotz und im Gegenzug zu seiner erfahrungsbezogenen Orientierung – das „theoria“-Konzept seines Lehrers in wichtigen Stücken fortsetzen. Beispielsweise, indem er die theoretische Lebensform des Philosophen (βίος θεωρητικός, bios theoretikos) als Inbegriff eines glückseligen Lebens auszeichnet: die kontemplative Lebensweise oder Haltung der theoria sei nämlich, wie er ganz platonisch annimmt und wertet, die Annäherung der menschlichen Existenz an die vollkommen autarke, nur sich selbst schauende und erkennende Vernunft Gottes. Sokratiker ist Aristoteles eher in seiner Dialektik. Diese konzipiert er als Methode zur Prüfung schwacher Geltungsansprüche, wie sie für (bloß) wahrscheinliche Sätze erhoben werden. Nach der dialektischen Methode sollen „wir über jedes aufgestellte Problem aus wahrscheinlichen Sätzen (ένδοξα, éndoxa) Schlüsse ziehen können“, so daß wir, „wenn wir selbst Rede stehen sollen, in keine Widersprüche geraten.“324 Im Gegensatz zu den Sophisten schlägt er diese Methode auch nicht der Rhetorik325 zu, sondern sieht sie als kommunikative Hilfsdisziplin der Philosophie an: Als Prüfungskunst habe sie „nicht denjenigen, der sicheres Wissen hat, im Blick, sondern denjenigen, der dieses nicht hat, es aber zu wissen beansprucht. 324 325 Aristoteles, Topica I, 1, 100 a, 18ff. Vgl. E. Braun, Zur Vorgeschichte der Transzendentalpragmatik. Isokrates, Cicero und Aristoteles, in: A. Dorschel u. a. (Hg.), Transzendentalpragmatik, Frankfurt a.M. 1993 (zit.: Vorgesch. Transzendentalpragmatik (1993)), S. 23; H.-B. Gerl, Philosophie und Rhetorik bei Johannes von Salisbury, in: H. Schanze, J. Kopperschmidt (Hg.), Rhetorik und Philosophie, München 1989 (zit.: Rhet. u. Phil. (1989)), S. 108-119, hier 109f. Aristoteles, Metaphysik I, 2, 104 b, 17ff. 135 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Wer nun das Allgemeine sachgemäß betrachtet, ist ein Dialektiker, wer dies bloß vorgibt, ist ein Sophist.“326 Bei der dialektischen Prüfung wahrscheinlicher Sätze müsse der Dialektiker kommunikativ verfahren, nämlich „seine Argumentationspartner ständig einbeziehen und sich auf diese einstellen“. Sei es doch darum zu tun, „daß sowohl der Vorgang der Prüfung als auch deren Resultat an das Gespräch gebunden sind“, wie Edmund Braun herausarbeitet.327 So weit, so gut. Insofern nimmt Aristoteles einen wichtigen Platz in der Geschichte des dialogisch-diskursiven Denkens ein. Aber er hat von seiner kommunikativen Dialektik keinen fundamentalphilosophischen Gebrauch gemacht, hat sie nicht auf sich selbst als Ontologen oder „ersten Philosophen“ angewandt. Vielmehr blieb er einem platonisch-theoretischen Selbstverständnis verhaftet – „erste Philosophie“ gilt ihm als eine geistige Schau der ersten Prinzipien, worunter er die eigentlichen Ursprünge, die Quellen dessen versteht, was ist. So hat er, bei aller Kritik an seinem spekulativen theoria-Lehrer, den Kern der Philosophie nicht in den Prinzipien des Dialogs, der gemeinschaftsbezogenen Praxis des Etwas-Denkens und Etwas-Erkennens, gesucht und sie konsequent dort verortet. Wenn anders, hätte er auch der philosophieverführerischen Tendenz zu einem methodischen Solipsismus den Boden entzogen. Stattdesen verfestigte er das Parmenideisch-Platonische Verständnis der Philosophie als theoria durch eine verdinglichende Sprachauffassung, der zufolge das Wesen der Sprache dem geistigen Etwas-Sehen entspreche. Denn der Wesenszweck einer Sprache sei die Bezeichnung und Darstellung eines Gegenstands, den Aristoteles nach dem Muster eines sichtbaren oder vorgestellten Dings versteht. Die Philosophie-, die Geistes- und Wissenschaftsgeschichte dürfte ganz anders verlaufen sein, wenn Aristoteles seine Philosophie aus der dialogisch reflexiven Einstellung entwickelt hätte, die er im Begründungsstreit um den Satz des Widerspruchs hat aufblitzen lassen. Als Logiker, der den Elenchos als Beweisfigur rekonstruiert, bleibt er der reflexionsvergessene Analytiker, und als Fundamentalphilosoph ein „theoretischer“ Ontologe in der Schule Platons, der die Beziehung der Aussagen auf mögliche Wahrheit im Sinne einer gegenstandstheoretischen Ontosemantik interpretiert und sie daher als im Grunde kommunikationsunabhängig ansieht. Denn er bestimmt sie nicht etwa als den Geltungsanspruch auf Wahrheit, der vom Sprecher/Denker behaupteten Aussage. Vielmehr sieht er darin ausschließlich das Verhältnis einer Aussage als Gedanke zu dem Sein selbst, und zwar im Sinne einer Übereinstimmung beider ‚Seiten’. Das ist spekulativ ontologisch gedacht, vom Sein selbst her, und im Sinne eines Vorstellens von Dingen; so als wäre der Gedanke und Kunstbegriff „Sein“ etwas 326 327 Aristoteles, Sophistici elenchi 11, 171 b 3ff. E. Braun, Vorgesch. Transzendentalpragmatik (1993), S. 26; vgl. ders., Zur Einheit der aristotelischen Topik, Köln 1959, S. 36f. 136 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Dingliches – und nicht vielmehr das Ergebnis einer sprachlichen Interpretation, sei es von lebensweltlich erschlossenen Sinnzusammenhängen der Kultur, sei es von vorgedeuteten bzw. vorverstandenen Sachverhalten der Natur, die ihrerseits z.T. von Kultur schon durchdrungen ist. Aristoteles setzt die theoria-Tradition fort: Erkenntnis versteht er nach dem Muster des Betrachtens und Vorstellens von Dingen. Dementsprechend setzt er die Wahrheit von Aussagen, die Bedeutung von Aussagenwahrheit, mit dem dinglich vorgestellten Seienden gleich, welches ewig so ist, wie es an sich ist. Aristoteles nimmt dabei den metaphysischen, genauer: seinstheologischen Standpunkt einer göttlichen Vernunft ein, die das Ewige so erschaue, wie es an sich ist – was immer das bedeuten soll. Diese ontotheologische Spekulation verbindet er mit einem gegenstandstheoretischen Bedeutungs- und bezeichnungstheoretischen Sprachbegriff. So setzt er voraus, daß der durch die Aussage formulierte Gedanke nicht in seinem kommunikationspragmatischen Bezug, im Sinne von „Etwas-Denken“ als Etwas-gegenüberAnderen-Behaupten“ oder als eine andere kommunikative Sprachhandlung zu verstehen ist, sondern als prädikative Aussage über etwas, das sich betrachten läßt wie ein Ding. So etabliert er das Subjekt-Objekt-Schema des Denkens, als bewegte sich das Etwas-Denken und Etwas-Aussagen bloß in der Relation zwischen dem, der etwas sagt/denkt und dem Gegenstand seines Denkens/Aussagens. In der Moderne wirkt diese Ausklammerung der kommunikationspragmatischen Voraussetzungen des Denkens überall dort fort, wo man die Wende der Philosophie zur Sprache nur logisch strukturell versteht, als einen bloß satzsemantischen „linguistic turn“. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Damit aber nicht genug. Auch die Sinnkonstitution macht Aristoteles von der gesprochenen Sprache, von der Kommunikation in einer Sprachgemeinschaft, tendenziell unabhängig. Führt er doch die Bedeutung der Gedanken auf innerseelische Vorstellungen zurück, welche eigentlich sprachunabhängig seien. Sprachliche Zeichen würden den Vorstellungen, die die Seele vor jeder sprachlichen Kommunikation habe, dann bloß konventionell zugeordnet.328 Im Rahmen dieser Sprachauffassung läßt sich die Dialektik nicht als ein Verfahren verständlich machen, das prinzipiell auf öffentliche Rede und kommunikativen Diskurs angewiesen ist. Daher führt von Aristoteles kein Weg zu einer Pragmatik, die den kommunikativen Diskurs als Basis für intersubjektive Geltung auszeichnet.329 328 329 Aristoteles, De interpretatione I, 16 a I. Anders E. Braun, Vorgesch. Transzendentalpragmatik (1993), S. 27f. 137 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Auch Theophrast (322-287 v.Chr.), Aristoteles’ Nachfolger im Peripatos, ist in diesem Zusammenhang nicht als Abweichler von einem vermeintlich kommunikativ dialektischen Wege des Aristoteles, sondern als konsequenter Fortsetzer von dessen theoriabestimmter Philosophie-, Erkenntnis- und Sprachauffassung zu beurteilen. Er ist es, der die Auswirkungen dieser Sprachauffassung für die Beziehungen zwischen Gesprächsteilnehmern augenfällig macht: die kommunikativ-„pragmatischen“ Dimensionen der Rede reduziert er auf eine Vermittlung von Sinn- und Erkenntnisgehalten und daher auf die rhetorische Beziehung des Redners zu seinem Auditorium. Im Einklang damit verkürzt er den philosophischen Wahrheitsbezug, also die Gewinnung und In-Geltung-Setzung von Information, auf eine referenzsemantische Satz-Ding-Beziehung, von welcher „der Sprechende den Hörern eine Überzeugung beibringen will.“ 330 Diese, im Peripatos beheimatete, aber noch heute wirkungskräftige „common senseAufassung“ der Sprache im Sinne der „konventionellen Bezeichnungsfunktion“ hat wohl niemand entschiedener kritisiert als Karl-Otto Apel, der sie auch problemgeschichtlich auf Aristoteles zurückführen konnte.331 Da sie so suggestiv ist, daß es noch heute, wie Apel bemerkt, außerordentlich schwer fällt, sie in Frage zu stellen, und weil sie sich einer Diskurspragmatik geradezu entgegenstemmt, lohnt es, ihr kritische Aufmerksamkeit zu schenken. Schon Aristoteles hat die implizite, aber von vornherein mitverstandene Einbettung jeder Aussage und jeder Wortverwendung in eine formal vollständige Äußerung (als Sprachhandlung)332 und in den reziproken Erwartung-Erwartungs-Zusammenhang eines Dialogs ist verdrängt – und damit eine folgenschwere Weichenstellung der Philosophiegeschichte vorgenommen. Diese doch sinnkonstitutive Einbettung des präpositionalen Gehalts in den Zusammenhang einer Verständigung mit Anderen erklärt Theoprast in aristotelischer Ausdrücklichkeit zu einer geltungsmäßig irrelevanten, bloß empirischen Angelegenheit. Dieser kommunikative Kontext sei allein rhetorisch und poetisch von Belang. Die direkten und indirekten Bezüge eines Sprechers auf andere Menschen werden so auf die direkte Sprecher-Hörer Beziehung verkürzt. Diese beschränkt er noch dazu auf den empirischpsychologischen Vorgang einer Übermittlung von Effekten, die der Sprecher durch die rhetorische Einkleidung des Aussagegehalts bei den Hörern erzielen kann bzw. will. Eine solche rhetorische ‚Einkleidung’ gilt natürlich als in der Sache irrelevant. Dem Sinn des 330 331 332 Ammonius, In Aristotelis De Interpretatione Commentarius. Hg. v. A. Busse, Berlin 1887, S. 65f. K.-O. Apel, Transf. d. Phil., II, (1973), S. 334ff. Dazu: A. Øfsti, Abwandlungen (1994). 138 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Gesagten könne sie nur wenig, vernachlässigenswert wenig, seiner Gültigkeit aber nichts hinzutun. Folglich gehe die – derart empirisch-psychologisch reduzierte – Pragmatik den Philosophen nichts an. Denn der Philosoph habe es einzig mit der Geltung der Rede zu tun. Die aber verstehen Aristoteles und Theophrast nach dem Muster der Wahrheit von Aussagen über Dinge. Im Sinne dieses aussagenlogischen Philosophieverständnisses und dieser Beschränkung der „Logosfunktion“ der Sprache, ihres Geltungsbezugs, auf einen benennenden und einem Ding Eigenschaften zusprechenden Aussagesatz hat Theophrast eine falsche und bis heute nachwirkende Unterscheidung getroffen: er schneidet die semantische Bedeutungsrelation der Rede als Ort der Wahrheit ab von der pragmatischen Beziehung auf Hörer als Medium von Effekten (z.B. Überzeugungseffekten): „Da die Rede [λόγoς] eine zweifache Beziehung hat [...] eine zu den Hörern, für welche sie etwas bedeutet, die andere zu den Dingen, von welchen der Sprechende den Hörern eine Überzeugung beibringen will, so entstehen im Hinblick auf die Beziehungen zu den Hörern die Poetik und die Rhetorik [...] im Hinblick aber auf die Beziehung der Rede zu den Dingen wird der Philosoph vorzüglich dafür Sorge tragen, das Falsche zu widerlegen und das Wahre zu beweisen.“333 Damit verbannt Theophrast die Pragmatik aus der Philosophie. Die folgende Abbildung vermag diesen noch heute nachwirkenden Vorgang zu verdeutlichen: 333 Kritisch dazu: K.-O. Apel, Der transzendentalhermeneutische Begriff der Sprache, in: Ders., Transf. d. Phil., II, (1973), bes. S. 336ff. 139 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Abb. X: Philosophie Wahrheit bzw. logische Geltung Semantik Dinge Rede Poetik und Rhetorik psychische Effekte Pragmatik Hörer Teils verkürzt, teils verdrängt wurden damit die drei von uns unterschiedenen pragmatischen Dimensionen, also jene Funktionen der Interpretation von Sprachzeichen, die konstitutiv sind für den Verwendungssinn und Geltungssinn des inhaltlich Kommunizierten, des propositionalen Gehaltes, mithin auch konstitutiv für jeden möglichen Dialog. Was die sinnkritische Dialogreflexion anbelangt, derer sich Aristoteles ein einziges Mal ansatzweise bedient hat, so ist sie philosophiegeschichtlich implizit und auf paradoxe Weise wirksam geworden: als sokratisches Selbstaufhebungsargument, doch bloß in theoretischer statt in kommunikativ dialogischer Form. So bei Augustinus, Descartes, Kant und Husserl. Offenbar ist sowohl die drastische Verkürzung der kommunikativ pragmatischen Dimensionen der Rede als auch die Assimilation eines aktuell reflexiven Elenchos an die theoretische Einstellung in zwei Kernstücken der theoria-Tradition angelegt. Es ist das einmal das instrumentalistisch bezeichnungstheoretische Verständnis von Sprache und Rede, in dem selbst die Antipoden Heraklit und Platon übereinkommen, zum anderen die durch Platon vorbereitete, vom Neuplatonismus etablierte Unterscheidung der vermeintlich intuitiven Vernunfteinsicht (nous) von der bloß diskursiven Verstandeserkenntnis (dianoia), welche nicht als kommunikativer Diskurs, sondern als monologisches Schlußverfahren angesetzt 140 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie gedacht wird. Auf diesem Boden konnten dann die wirkungsträchtigen Neuplatoniker Philon, Plotin, Syrian und Proklos die Erkenntnisdichotomie der Scholastik, intuitiv versus diskursiv, denken. Sie stellen das vermeintlich intuitive Erschauen des nous als das eigentliche, der Ewigkeit zugehörige Erkennen, dem alles gegenwärtig sei, gegen das endliche, diskursive Überlegen und Reden (διεξοδικός λόγος, diexodikos logos), die intellektuelle Anschauung des intelligiblen Seins in seiner Wesenheit gegen die syllogistischen Analysen und Demonstrationen der Akzidentien. Dem diskursiven Denken überlassen sie bloß das Unwesentliche. Vor allem die, in der Platonischen und der Aristotelischen Version der theoria enthaltene und seither machtvoll tradierte Unterstellung einer unabhängig von Sprache möglichen Erkenntnis – Theorie und Diskurs ohne Kommunikation – hat das abendländische Denken zutiefst geprägt, bis heute. verstehenstheoretische, Genaugenommen zwei sind geltungstheoretische es vier Unterstellungen, eine und eine vergewisserungs- bzw. evidenztheoretische. Erstens wird unterstellt, einer allein – solus ipse, daher „methodischer Solipsismus“ – könne für sich und ohne Vermittlung durch virtuelle Kommunikation (Sprachgebrauch und Tradition) oder durch aktuelle Kommunikation Sinn bzw. Bedeutung haben. Zweitens und drittens wird vorausgesetzt, daß einer als prinzipiell Einsamer Gültigkeit, nämlich Wahrheit von Tatsachenbehauptungen und ebenso Richtigkeit/Legitimität von Normsätzen, gewinnen und daß er diese – viertens – als solche erkennen könne, also auch die Gewißheit der Wahrheit erlangen könne. Das ist die Quadrupelthese des methodischen Solipsismus: 141 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Abb. X: Die Quadriga des methodischen Solipsismus, d.h. der Thesen, daß Privatsprache (a), Privaterkenntnis (b) und private Evidenz (c) möglich sind Fragestellung These Anwendungsbereich Wie ist Sinn möglich? (a) einer allein (und nur einmal) kann etwas als etwas von bestimmter Bedeutung verstehen, mithin charakterisieren → einer Regel folgen Sprachphilosophie und Hermeneutik Wie ist Gültigkeit möglich? (b1) nicht bloß kann einer allein... [wie (a)], sondern er kann auch Erkenntnis- und Wahrheitstheorie → Wahrheit allein, d.h. ohne jeden sprachlich-kommunikativen und zumal argumentativen Bezug auf andere / Kommunikationsgemeinschaft, erkennen → begründen, daß jene Charakterisierung zutrifft, also wahr ist Wie ist Gültigkeit möglich? (b2) nicht bloß kann einer allein... [wie (a)] sondern er kann auch → Richtigkeit, Verbindlichkeit allein, d.h. ohne jeden sprachlich- kommunikativen und zumal argumentativen Bezug auf andere / Kommunikationsgemeinschaft, erkennen → begründen, daß die so charakterisierte Handlungsweise etc. richtig/legitim und verbindlich ist (c) nicht bloß kann einer allein... [wie (a)], sondern er kann auch Wie ist Gewißheit möglich? → Zweifelsfreiheit Ethik / Praktische Philosophie Beweistheorie/Sinnkritik allein, d.h. ohne jeden sprachlich-kommunikativen und zumal argumentativen Bezug auf andere / Kommunikationsgemeinschaft, Zweifel an der Wahrheit seiner These oder an der Verbindlichkeit einer Aufforderung bzw. Norm als gegenstandslos erkennen und erweisen 142 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 5 Zerfall der mittelalterlichen ordo-Welten und Emanzipationen von deren Macht und theoria. z Der Zerfall der mittelalterlichen Welt als Einheit von Reich (imperium) und Priesteramt (sacerdotium) z Die kopernikanische Wende des wissenschaftlichen Weltbildes z Die konfessionellen Bürgerkriege in West- und Mitteleuropa Jede dieser drei Krisenerfahrungen läßt sich auf ihre Weise als Herausforderung an die sich ausbildende instrumentelle Vernunft verstehen, die man zunehmend für fähig hält, die jeweilige Krise zu meistern. Das gelingt ihr in gewisser Weise in den italienischen Stadtstaaten des 15. Und 16. Jahrhunderts; denn hier trat an die Stelle des kirchlich-weltlichen Einheitssystems des christlichen Mittelalters der souveräne Stadtstaat, der in Theorie und Praxis die überkommenen sittlichen Bindungen abstreifte: zugleich mit der Entwicklung der Technik entsteht die Sozialtechnik Machiavellis, die die strategische Rationalität des politischen Handelns freisetzt. Als durch die astronomischen Erkenntnisse des Kopernikus die Unendlichkeit des Alls erfahren wird und offenbar ist, daß der Mensch sich nicht länger als die natürliche Mitte des Seienden verstehen kann, weil er seinen vorgegebenen Orientierungspunkt verliert, hilft ihm die naturwissenschaftlich-technische Rationalität, durch Messen, Berechnen und den Einsatz von Intrumenten (Fernrohr, Kompaß) eine künstliche Orientierung zu gewinnen. Aus dem Mittelpunkt des Weltalls gleichsam in die Unendlichkeit gefallen, setzt sich der Mensch nunmehr selbst künstlich als Zentrum: messend, rechnend, analysierend und Naturgesetze über die Bewegung der Körper (Mechanik) aufstellend (Kopernikus, Gallilei, Descartes). Als schließlich die Einheit von politischer Gemeinschaft und Glaubensgemeinschaft, von Kaiserreich und katholischem Christentum endgültig zerfällt und Europa in das Chaos blutiger konfessioneller Bürgerkriege stürzt, ist die Stunde der strategischen Rationalität endgültig gekommen: nur eine moralisch wertneutrale Staatskonstruktion scheint den gesellschaftlichen Frieden, das Überleben und die Selbsterhaltung zu ermöglichen (Hobbes). 143 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 5.1 Sprachsensibilität, Bildungsreichtum und tendenzielle Diskursautonomie des italienischen Humanismus. Wenngleich der dreifache Zerfall der mittelalterlichen Welt in seine Zeit fällt oder sich in dessen Anfangsphase vorbereitet, läßt sich der Geist des Humanismus schwer auf einen Nenner bringen – etwa als Antwort auf diesen Zerfallsprozeß. Die große Spanne vom frühen 14. Jahrhundert, dem Trecento Dantes, Petrarcas und Bocaccios, über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus, als nach Thomas Morus und Huldrich Zwingli auch Erasmus, Luther, Melanchthon und Petrus Ramus aus dem Leben schieden, umfaßt eine zu vielfältige Zeit der Aufbrüche, Neuorientierungen und Reformationen, zugleich der Handelsexpansion und Entstehung des Finanzkapitals, der Emanzipation von Technik, Künsten und Forschung, als daß sie sich – sei es in Italien oder Frankreich, sei es nördlich der Alpen – als eine überschaubare Entwicklungsphase beschreiben ließe. Und der Geist der Zeit? Er ist nur wenig übersichtlicher. Auch wenn man, die Reformation vernachlässigend, eine romanische Perspektive einnimmt und den Zeitgeist auf den (jedoch erst 1808 von Hegels Freund Niethammer geprägten) Begriff „Humanismus“334 zu bringen versucht, tut man gut daran, Kristellers vorsichtiges Urteil über den italienischen Humanismus auf den humanistischen Geist insgesamt zu beziehen: „Die Humanisten haben nicht so sehr bestimmte Gedanken miteinander gemein wie vielmehr ihren Stil, ihre Probleme und ihre antiken Quellen.“335 Mit Ausnahme einiger Schriften wie der sokratischen Laien- bzw. Idiota-Dialoge des Nikolaus von Kues oder einiger reformatorischer Thesen und Schriften Martin Luthers, findet der Zeitgeist selten die Form und das Niveau argumentativer Auseinandersetzungen – selbst nicht mit der durchweg polemisch und zum Teil ungerecht auf Distanz gebrachten Scholastik336. Wohl aber finden wir ein Ensemble auflockernder Impulse für die Kultur des Diskurses. Betont sei die hier nicht aufzufächernde Vielfalt dieser Impulse. Sie reicht von den, durch 334 F.J. Niethammer, Der Streit des Philantropismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer Zeit, Jena 1808. Zu Begriff und Epoche vgl. G. Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus, Berlin 1859; J. Burckhardt, Die Cultur der Renaissance in Italien, Leipzig 1860; W. Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit der Renaissance und Reformation. Ges. Schriften II, Göttingen 101957; E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig/Berlin 1927/41974 (zit.: Individuum und Kosmos (1974)); P.O. Kristeller, Humanismus und Renaissance I, Humanistische Bibliothek I, Abh. 21, München 1974. 335 P.O. Kristeller, Der italienische Humanismus und seine Bedeutung. Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel, X, Basel u. Stuttgart 1969, S. 15. 336 Vgl. W. Kölmel, Aspekte des Humanismus, Münster 1981 (zit.: Aspekte (1981)), S. 154ff. 144 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Petrarcas Cicero-Erlebnis eröffneten337, literarisch-rhetorischen Studia humaniora resp. humanitatis zur neuplatonischen Theologie der Florentiner Akademie und vom Neuplatonismus des Cusaners zur natürlichen Vernunftreligion Jean Bodins – aber auch zu den naturalistischen, technischen und erfahrungswissenschaftlichen Gegenströmungen innerhalb des rhetorischen „Humanismus“, und das in so unterschiedlichen Gestalten wie Machiavelli, Leonardo und Galilei, aber auch Francis Bacon. Hinzu kommen, fast schon post festum, die autobiographische und anthropologische Lebens- bzw. Diskursessayistik Montaignes und schließlich die geschichts- sowie sprachphilosophische Antwort Giambattista Vicos auf Descartes.338 Weit verbreitet, ja implizit durchgängig ist eine emanzipatorische Motivation der rhetorisch sprachhumanistischen studia. Die Parolen sind: Befreiung von der (als unfruchtbar angesehenen) scholastischen Dialektik, weg von der verdinglichenden Sprache und Weltauffassung der Scholastik. Zudem deutet sich eine anthropologische Abkehr von den Studia divinitatis und ihrem Primat der Theologie an und, darin wirksam, eine Tendenz zur Diskursautonomie. Diese wird von Sokrates und Platon339, von Seneca340 oder von Horazens „Sapere aude“ entlehnt. Zum anderen steckt hinter den studia humanitatis oft eine Dialektikkritik, die mit einer impliziten rhetorisch-humanistischen Sprachphilosophie einhergeht. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die autoritäre Begrenzung, der die scholastische Dialektik, insonderheit die Disputation, unterlag. Üblich war ja der Rückgang auf Autoritäten bzw. auf fraglose Topoi, so daß später die moderne Scholastikkritik sogar von einer „Methode der Autorität“ (Ch. S. Peirce341) sprechen und die Form eines geschlossenen bzw. dogmatischen Diskurses argwöhnen konnte. Doch polemisieren die Humanisten nicht allein gegen die Unfruchtbarkeit der scholastischen Dialektik und der disputatio als eines bloßen „actus syllogisticus“, auch unterwerfen sie die 337 Vgl. J. F. Petrarca, Brief an Luce von Penna (April 1374), in: H. Nachod u. P. Stern, Briefe des Francesco Petrarca (1931); Teilnachdruck in: H. W. Eppelsheimer (Hg.), Petrarca - Dichtungen, Briefe, Schriften, Frankfurt a.M. 1956, S. 166ff; vgl. W. Rüegg, Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchungen über Petrarca und Erasmus, Zürich1946 (zit. Cicero und der Humanismus (1946)). 338 Vgl. K.-O. Apel, Idee (1963), S. 326-380; G. Cacciatore, Storicismo problematico e metodo critico, Neapel 1993, S. 17-58; A. Damiani, La dimension política de la Scienza Nuova, Buenos Aires 1997; ders., Domesticar a los Gigantes. Sentido y Praxis en Vico, Rosario 2005; V. Hösle, Vico und die Idee der Kulturwissenschaft, Einleitungen zu: G.B. Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker, Teilband 1, Hamburg 1990. 339 So in den Idiota-Dialogen des Nikolaus von Kues, bes.: Idiota de mente, Kgs I. Vgl. Seneca, Ad lucilium epistolae morales, 33, 7-11; dazu Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen, übers. v. H. W. Rüssel, Zürich 1988, S. 46. 340 341 Ch.S. Peirce, Collected Papers. Hg. v. Charles Hartshorne und Paul Weiß, 1931-1935, Vol. I, § 5.380ff. 145 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Dialektik nicht allein „dem anmutigen Diktat der Rhetorik“.342 Nein, in ihrem Spott über die Sprache der aristotelisch-scholastischen Ontologie, über Substantivierungen wie entitas, quidditas, haecceitas schwingt sich eine neue Denkweise auf,343 ein lebendiger poetischer Sprachgestus bricht sich Bahn. Das humanistische Sprachgefühl und die rhetorische Orientierung an der „lebendigen geschichtlichen Sprache“344, an Dantes „vulgaris locutio“ oder L. Vallas consuetudo loquendi erspüren, daß „das Volk besser spricht als der Philosoph“ – will sagen als der Scholastiker345. Die italienischen Humanisten empfinden, daß Sinn und Bedeutung die Leistung der gesprochenen, mit Handlungsweisen verwobenen Sprache ist, nicht die Leistung einer, die Wesenheiten zunächst wie Dinge schauenden und dann wie dingliche Substanzen benennenden, begrifflich ontologischen Kontemplation. Von Dante bis Vico nähern sie sich der Einsicht, daß die geschichtliche Sprache das Apriori menschlicher Welt- und Selbstbeziehung ist: sowohl öffentliche „Institution der Institutionen“346 als auch – Humboldt avant la lettre – sinnschöpferische und ursprünglich poetische Weltkonstitution. Auf dem tief kultivierten römischen Sprachboden Italiens konnte sich die humanistische Erneuerung mit gutem Grund als rinascita verstehen und vollziehen. Anders nördlich der Alpen. Hier konnte die Einsicht in die Sprache als Fundament der Welt- und Selbstbeziehung nicht durch Erneuerung einer öffentlichen Sprachkultur praktisch werden, hier kam alles auf die Erschließung einer neuen Sinn- und Sprachwelt an – bei gleichzeitiger Eroberung des Freiheitsraums für Sinnäußerungen und Geltungsansprüche. 5.2 Luthers Reformation: Verdeutschung der Bibel, Behauptung und Destruktion von Gewissensfreiheit und Menschenwürde. In dem dialektzerklüfteten deutschen Sprachraum fehlte es nicht allein an einer literaturfähigen Umgangssprache, sondern überhaupt an einer gemeinsamen Volkssprache. Hier mußte eine gigantische hermeneutisch poetische Leistung, Martin Luthers Bibelübersetzung,, mit einem Schlag zugleich das Pendant zu einer humanistischen 342 343 344 345 346 H. Marti, Disputation. So E. Cassirer in bezug auf Lorenzo Valla, Pico, Ramus, Marius Nizolius und auf Leibnizens Kritik an letzterem: E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit, I, Berlin 1922 (Neudr. 1974) (zit.: Erkenntnisproblem (1922)), S. 122ff, 133f, 144ff, 149ff; vgl. auch W. Kölmel, Aspekte (1981), S. 158. K.-O. Apel, Idee (1963), S. 99. L. Valla, Dialectica disputationes, in: Opera omnia, Basel 1540, Neudr. hg. v. E. Garin, Turin 1962, 658. 684; vgl. W. Schröder, Teil-Artikel „Die italienische Renaissance“, in: HWPh., Bd. 7, 657, Artikel „Philosophie“. K.-O. Apel, Idee (1963), Kap. V. 146 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Sprachempfindsamkeit und den Sprachhumus selbst hervorbringen, auf dem eine Sprachkultur gedeihen kann. Dieser Horizontwandel und Sprachsprung ging ebenfalls mit einer massiven Scholastikkritik und einer emanzipatorischen Motivation einher. Nur war beides derber und radikaler als in Italien, weil religiös existenziell geladen. Zudem war es mit der Aneignung einer ganz anderen Sprachwelt verbunden, der hebräischen, die von Rom niemals integriert worden war. Der Augustinermönch Martin Luther (1483-1546), zunächst getrieben von der Frage „Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“, machte „die Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) geltend und nahm damit die allgemeine Gewissens- und Denkfreiheit in Anspruch. Ihr brach er Bahn durch seine Verteidigung vor Kaiser und Reich, auf dem Wormser Reichstag 1521. In diesem Sinne setzte er der „weltlichen Obrigkeit“ freiheitsrechtliche Grenzen: „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ (1523). Augustinisch den äußeren, leiblichen Menschen von dem inneren, seelischen unterscheidend, versteht Luther diesen als Bürger „in Gottes Reich unter Christo“, und einzig jenen als Bürger „in der Welt Reich unter der Obrigkeit“. Aufgrund dieser Unterscheidung zweier Reiche könne man wissen, wie lang der Arm der Obrigkeit und „wie fern ihre Hand reiche, daß sie sich nicht zu weit strecke und Gott in sein Reich und Regiment greife. Und das ist sehr not zu wissen. Denn unerträglicher und greulicher Schaden daraus folget, wo man ihr zu weit Raum gibt. [...] Denn über die Seele kann und will Gott niemand lassen regieren, denn sich allein. [...] Wenn man ein Menschengesetz auf die Seele legt, daß sie glauben soll so oder so, wie derselbe Mensch vorgibt, so ist gewißlich das nicht Gottes Wort.“347 Aus der augustinischen Scheidung zweier Reiche zog Luther die geistespolitische Konsequenz eines diskursiven Pluralismus, der auch den religiösen Wettbewerb freigibt: „Es müssen Sekten sein und das Wort Gottes muß zu Felde liegen und kämpfen.. [...] Man lasse die Geister aufeinanderplatzen und -treffen.“348 Kraft dieses protestantischen Plädoyers für die notwendige Toleranz in Heils- und Wahrheitsfragen gewannen zunächst der deutsche Bildungs-Humanismus, dann die deutsche Aufklärung – auch gegenüber der lutherischen Orthodoxie – den legitimierten Entfaltungsraum der Gewissens-, Denk- und Meinungsfreiheit. Der frühe Pietismus und die Frühaufklärung, Kant und Herder, Schiller und Goethe, Hegel und Heine sahen darin das politisch ethische Hauptverdienst Luthers. Daß Luthers Befreiung von dem Einheitsideal und der Einheitsmacht der fides catholica sich weniger in lateinischer als vielmehr in der Landessprache vollzog, ja daß dieselbe erst im 347 348 M. Luther, D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883ff (zit.: WA), 11, S. 261f. M. Luther, WA, 15, S. 218f. 147 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Zuge einer solchen Emanzipation gewissermaßen geschaffen worden ist, hat der deutschen Reformation eine umfassende Bildungswirkung gesichert. Luther gab der Geistesfreiheit einen Leib, die reale Kommunikationsbasis: „er schuf die deutsche Sprache. Dieses geschah, indem er die Bibel übersetzte.“349 Niemand hat so klar und eindringlich den internen Zusammenhang der reformatorischen Befreiung von Einheitszwang und Scholastik mit der bibelhermeneutischen Sprachschöpfung erkannt wie der jüdische Hegelschüler Harry alias Heinrich Heine. Er wußte, was es bedeutet, daß Luthers Bibelübersetzung zugleich die Entdeckung und Anverwandlung der hebräischen Bibelsprache war. Er konnte das mit emanzipatorisch dichterischem Pathos aussprechen: „In der Tat, der göttliche Verfasser dieses Buchs scheint es ebensogut wie wir andere gewußt zu haben, daß es gar nicht gleichgültig ist, durch wen man übersetzt wird, und er wählte selber seinen Übersetzer und verlieh ihm die wundersame Kraft, aus einer toten Sprache, die gleichsam schon begraben war, in eine andere Sprache zu übersetzen, die noch gar nicht lebte. Man besaß zwar die Vulgata, die man verstand, sowie auch die Septuaginta, die man schon verstehen konnte. Aber die Kenntnis des Hebräischen war in der christlichen Welt ganz erloschen. Nur die Juden, die sich, hie und da, in einem Winkel dieser Welt verborgen hielten, bewahrten noch die Traditionen dieser Sprache. Wie ein Gespenst, das einen Schatz bewacht, der ihm einst im Leben anvertraut worden, so saß dieses gemordete Volk, dieses VolkGespenst, in seinen dunklen Gettos und bewahrte dort die hebräische Bibel; und in diese verrufenen Schlupfwinkel sah man die deutschen Gelehrten heimlich hinabsteigen, um den Schatz zu heben, um die Kenntnis der hebräischen Sprache zu erwerben. Als die katholische Geistlichkeit merkte, daß ihr von dieser Seite Gefahr drohte, daß das Volk auf diesem Seitenweg zum wirklichen Wort Gottes gelangen und die römischen Fälschungen entdecken konnte, da hätte man gern auch die jüdische Tradition unterdrückt, und man ging damit um, alle hebräischen Bücher zu vernichten, und am Rhein begann die Bücherverfolgung, wogegen unser vortrefflicher Doktor Reuchlin so glorreich gekämpft hat. Die Kölner Theologen, die damals agierten, besonders Hoogstraeten, waren keineswegs so geistesbeschränkt, wie der tapfere Mitkämpfer Reuchlins, Ritter Ulrich von Hutten, sie in seinen ‚Litteris obscorum vivorum’ schildert. Es galt die Unterdrückung der hebräischen Sprache. Als Reuchlin siegte, konnte Luther sein Werk beginnen. In einem Briefe, den dieser damals an Reuchlin schrieb, scheint er schon zu fühlen, wie wichtig der Sieg war, den jener erfochten, und in einer 349 H. Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, in: Sämtliche Werke. Hg. v. H. Kaufmann, Bd. IX, München 1964, S. 192. 148 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie schwierigen Stellung erfochten, während er, der Augustinermönch, ganz unabhängig stand; sehr naiv sagt er in diesem Briefe: ‚Ego nihil timeo, quia nihil habeo.’“350 Es nimmt nicht wunder, daß im deutschen Sprachraum auch der aus Italien entlehnte Humanismus von dem Lutherschen Sprachleib und Freiheitsgeist zehrte. Das ist die eine Seite. Die andere ist kein Ruhmesblatt der Lutherschen Reformation, sondern deren dunkler Fleck: die Manifestation von Luthers Antijudaismus zwischen 1538 („Wider die Sabbather. An einen guten Freund“) und 1543 („Von den Juden und ihren Lügen“). In dem Maße, wie Luther erkennt, daß die Juden die Dogmen der Gottheit Christi, der vorweltlichen Existenz Christi als göttlichem Logos, der Jungfrauengeburt und der göttlichen Dreifaltigkeit beharrlich bestritten und mit bissiger Polemik überzogen, ja daß sie „auch uns, das ist die Christen an sich locken“351 und „die Sprüche der Schrift verehren“, um „unseres Glaubens Grund umzustoßen“,352 – in eben dem Maße vergeht seine relative, auf Bekehrung wartende Toleranz. Sein Warten schlägt um in ein Wüten. Er bedient sich aus alten und zeitgenössischen Polemiken, teilweise aus der Feder getaufter Juden wie Paulus von Burgos († 1435) und Antonius Margaritha († 1490)353. Vor allem den jüdischen Ausschließlichkeitsanspruch, das alleinige Volk Gottes zu sein, und die Diffamierung Jesu als eines Zauberers weist er emphatisch zurück. Ja er verlangt staatliche Gewaltmaßnahmen gegen die Juden: Zwangsarbeit, Anzünden der Synagogen und Zuschütten ihrer Ruinen.354 Freilich waren die meisten Synagogen, zumindest 300, von dem Würzburger Brandanschlag 1349 bis hin zu Kaiser Maximilians Verbrennung der Nürnberger Synagoge im Jahre 1509 ohnedies schon vernichtet. Von körperlichen ‚Strafen’ oder gar Tötung rät er jedoch ausdrücklich ab. Den freien interreligiösen Diskurs zerstört Luther hier barbarisch. Und die Menschenwürde beschneidet er, indem er deren Existenzbedingungen, Gewissens- und Geistesfreiheit, gegenüber den Juden ebenso zurücknimmt wie zwei elementare Realisierungsbedingungen des Diskurses: die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Der reformatorische Spielraum für eine Anerkennung der Juden war offenbar von Anfang an christologisch verengt, nicht anders als Luthers biblische Hermeneutik. Stand diese doch unter der christologischen Doppelnorm, die Bibel sei stets auf Christus hin auszulegen – als ob auch die 350 351 352 353 354 Ebd., S. 192f. M. Luther, Vorwort zu: „Von den Juden und ihren Lügen“, in: WA, 53, S. 417. Ebd. Vgl. den Artikel „Antonius Margaritha“, in: Jüdisches Lexikon, begründet von G. Herlitz und B. Kirschner, Bd. III, Berlin 1929, S. 1380. Zu Luther: W. Bienert, Martin Luther und die Juden, Frankfurt a. M. 1982. Auch D. Böhler, Reformation und praktische Vernunft, in: Universität des Saarlandes (Hg.): Martin Luther 1483-1983. Ringvorlesung der Philosophischen Fakultät Sommersemester 1983, Saarbrücken 1983, S. 173 ff (zit.: Reformation (1983)). [Fußnote fehlt!] 149 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie hebräisch jüdische Bibel, das von den Christen so genannte Alte Testament (!), bereits auf Jesus als den Messias, den Sohn Gottes und dem sich opfernden Erlöser angelegt sei! In dieser „christologischen“, das christliche Dogma spiegelnden Hinsicht sollen die Christen sich die jüdische Bibel auch aneignen, nämlich allein, „soweit sie Christum treibet“. Heinrich Heines wirkungsgeschichtliche Würdigung Luthers schönt also die historische Wahrheit. Diskursgeschichtlich bedeutet sowohl Luthers christozentrische Einengung der biblischen Hermeneutik als auch seine gegen die Juden betriebene Kirchenpolitik einen erheblichen Rückfall hinter die diskursbezogene Anerkennung der Vielfalt religiöser Formen bzw. Riten als eines Wertes, welche der katholische Kirchenpolitiker Nikolaus von Kues alias Cusanus (1401-1464) aus humanistisch neuplatonischem Geist vorgedacht hatte. Fast drei Generationen vor dem Reformator hatte der konzilsfreundliche und sokratisch gesonnene Kardinal „das Bild eines möglichen Religionsfriedens“ entworfen, der „durch ein ‚Konzil’ im Himmel zustande kommt, an dem Philosophen als Vertreter der verschiedenen Religionen sowie Christus, Petrus und Paulus teilnehmen.355 Zielpunkt der ausführlichen Diskussion ist die These, daß es nicht viele Religionen gebe, sondern lediglich ‚una religio in varietate rituum’, nur ‚eine Religion in der Vielfalt der Riten’356.“357 Dank seiner Verbindung des Ideenbegriffs mit seinem christlichen Vorverständnis der zentralen Themen einer Religion kann der Cusaner alle Religionen anerkennen, weil er in jeder eine andere rituelle Gestalt der so verstandenen Idee der Religion sieht und diese nicht in Doktrin und Ritus ansiedelt, sondern im Glauben (fides) der Menschen. Im Unterschied zu Luther und in der Nähe zu Kant versteht er fides als ethisch religiöse Größe, als Gesinnung und guten Willen. Im besten Verstande gesinnungsethisch läßt Nikolaus auf dem himmlischen Konzil der verfeindeten Religionen als Versöhner den Apostel Paulus auftreten: Die Erlösung hänge nicht von den Werken ab, von der Erkenntnis und Beachtung äußerer Regeln, Sitten und Riten, sondern eben von dem Glauben. Denn „wer überhaupt das Göttliche verehre, der setze bereits die Idee des Göttlichen voraus. Diese Idee aber gilt als unwandelbar. Lediglich die vielen Erscheinungsformen des Glaubens, die Sitten und Institutionen, seien verschieden und veränderlich. Als solche aber stellten sie allesamt nur unzureichende Zeichen für Gott dar – und damit für die absolute Wahrheit und das absolut Gute.“358 So kann der christliche Humanist Raum für innerreligiöse Toleranz schaffen. Deren Kriterium ist freilich nicht der Anspruch aller Menschen auf Achtung ihrer Würde. Zur Idee der 355 356 357 358 Nikolaus von Kues, De pace fidei. Vom Frieden im Glauben, in: Philosophisch-theologische Schriften, hrsg. u. eingel. v. L. Gabriel, 3. Bde., Wien 1989, S. 705-799. Ebd., S. 710. M. Bongardt, Einführung in die Theologie der Offenbarung, Darmstadt 2005, S. 178. D. Böhler, Ethische Motive (1980), S. 110. 150 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Menschenwürde als universalem moralischem Rechtsgrund kann das Gedankenexperiment eines himmlischen (Religions-)Konzils naturgemäß nicht vorstoßen, wohl aber zu dem Ansatz einer natürlichen Religion vor allen religiösen Riten und Institutionen. Toleranz gegenüber allen Religiösen – das ist es, was sich in diesem Rahmen einer religio naturalis denken läßt, Achtung aller Menschen (als moralischer Anspruchssubjekte und Rechtssubjekte) noch nicht. Hingegen hat Luther nicht einmal den normativen Begriff einer innerreligiösen Toleranz. Verficht er doch eine christozentrische Ethik, die letztlich eine Anerkennung anderer Religionen, zumal die der Judenheit, von der Bereitschaft, Christus als Sohn Gottes anzuerkennen, abhängig macht. Der Antiplatoniker und Nonphilosoph Luther kann – ohne den Begriff der Idee, welcher die Wirklichkeit und die kulturellen Differenzen transzendiert, – weder Toleranz noch gar Menschenwürde als Prinzip denken. Das ist moralphilosophisch und auch theologisch desaströs, weil ihm der Begriffsrahmen fehlt, dessen es bedarf, um den moralisch universalistischen Verpflichtungsgehalt der Nächstenliebe und der Hütung des Ebenbildes zu erkennen – eben die Grundnorm „achte die Würde jedes Menschen!“. Luthers Defizit an Philosophie, zumal seine Nichtbeerbung des Ideenbegriffs, hatte böse praktische und politische Folgen, weil die Kirche der lutherschen Reformation dadurch abgekoppelt wurde von der natur- bzw. vernunftrechtlichen Entwicklung hin zu einem unbedingten Prinzip der Menschenwürde. Nicht eine Ethik der Menschenwürde und der aus diesem Prinzip gespeisten Toleranz, sondern nur eine christozentrische „Ethik der Buße“ empfing der Protestantismus aus den Händen Luthers.359 Nicht Luther, sondern der Cusaner hatte den Richtungsstoß für die Achtung der Menschenwürde gegeben. 1437 sendet ihn „Papst Eugen IV. als Mitglied einer Delegation des Basler Konzils nach Konstantinopel [...], um dort mit der Ostkirche Vorbereitungsverhandlungen für das Unionskonzil (1438 in Florenz und Ferrara) zu führen. Mit den führenden Denkern und Theologen des Ostens, wie Georgios Gemistos Plethon, kehrt er zu Schiff zurück. Im ständigen Gedankenaustausch mit ihnen entscheidet er sich gegen Aristoteles für Platon“360, den er sich freilich in der Perspektive eines christlichen Humanisten anverwandelt. Er löst den Ideenbegriff aus Platons ontotheologischem Zusammenhang, orientiert ihn nicht mehr exklusiv an dem Göttlichen, sondern bezieht ihn auf den Menschen: zunächst in christologischer Deutung, aber auch in geistes- und erkenntnisphilosophischer Hinsicht. Im dritten Buch seiner sokratisch-platonisch inspirierten Schrift „De docta ignorantia“ (Von der belehrten Unwissenheit) ruft er – so pointiert Ernst Cassirer – „die 359 360 So D. Böhler, Reformation (1983). D. Böhler, Ethische Motive (1980), S. 108f. 151 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Christus-Idee zur Rechtfertigung, zur religiösen Legitimation und Sanktion der Idee der Humanität“ auf.361 Denn es ist der „geistig universelle Gehalt des Menschentums [...], den Cusanus in Christus beschlossen sieht“,362 weil dieser die „mittlere Natur“ zwischen dem Endlichen und Unendlichen, dem Menschlichen und Göttlichen darstelle – die „Klammer der Welt“363. Wie Christus der Ausdruck für die ganze Menschheit sei, so schließe andererseits das Wesen des Menschen das All der Dinge, den Makrokosmos, in sich. Dieser kosmosspekulativen Christus-Mensch-Analogie fügt Nikolaus von Kues einen erkenntnisphilosophischen und werttheoretischen Gedanken hinzu. Als habe er sich aus dem Bann der augustinischen Erbsündenlehre gelöst, stellt er die Freiheit des Menschen und das menschliche Vermögen, Wert zu setzen, in den Mittelpunkt. Dank seiner Freiheit vermöge es der Mensch, sich Gott anzugleichen und Gottes Gefäß zu werden,364 und als Setzer von Wert sei der Mensch selbst ein freier Schöpfer. Denn ohne den menschlichen Intellekt ließe sich überhaupt nicht wissen, „ob es einen Wert gibt. Ohne die Kraft der Beurteilung und des Vergleichens hört jegliche Schätzung auf, und mit ihr müßte auch der Wert wegfallen. Hieraus ergibt sich die Köstlichkeit des Geistes, da ohne ihn alles Geschaffene ohne Wert gewesen wäre. Wollte also Gott seinem Werke Wert verleihen, so mußte er neben anderen Dingen die intellektuelle Natur erschaffen.“365 Da es ohne den Menschen keine Wahrnehmung von Wert, also auch keinen Wert gäbe, kommt dem Menschen die höchste Würde im Kosmos zu. So nähert sich der Cusaner jenem Gedanken, den wir bei Platon vermissen: der Idee des Menschen. Die humanistischen Neoplatoniker von Florenz schritten auf diesem Denkweg fort. Marsilius Ficinus (1433-1499) pries in seiner „Platonischen Theologie“ die Seele des Menschen als die geistige Mitte der Welt; der junge Pico della Mirandola (1463-1494) führt dann in seiner berühmten Rede „De hominis dignitate“ den Begriff der Menschenwürde ein. So wird Platon christianisiert und humanisiert. Eigentlich trennen sich mit dieser Idee der Humanität die Humanisten von Platon. Denn „nie hat ein Grieche im Ernst von der Idee des Menschen gesprochen – nur spielend erwähnt Platon sie einmal, als er sie mit der Idee des Feuers und des Wassers verbindet –, und dann folgt die Idee des Haares, des Schmutzes und des Drecks.“366 Zudem ist an dieser Stelle im Dialog „Parmenides“ bloß von der körperlichen Gestalt des Menschen die 361 362 363 364 365 366 E. Cassirer, Individuum und Kosmos (1974), S. 40. Ebd., S. 41. Nikolaus von Kues, Excitationes, Lib. IX, fol. 639: „Et in hoc passu mediatio Christi intelligitur, quae est copula hujus coincidentiae, ascensus hominis interioris in Deum, et Dei in hominem“ (zit. bei E. Cassirer, a.a.O., S. 41). Nikolaus von Kues, Excitationes, Lib. V, fol. 498. Ders., De ludo globi (Vom Globusspiel), Lib. II, fol. 236f (zit. bei E. Cassirer, a.a.O., S. 46). So Bruno Snell in Bezug auf Platons „Parmenides“, in: B. Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg 31955, S. 334. 152 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Rede, nicht aber von der moralischen Identität der Person und einer möglichen Würde dessen, was Menschenantlitz trägt.367 Das Menschenwürdeprinzip entwickelte sich aus der Cusanischen Verbindung von Platons Ideenbegriff mit biblischen Gehalten und der vernunftrechtlichen Suche nach den moralischen Rechtsansprüchen des Menschen. Diese Suche wird schließlich den Berliner Hofhistoriographen, den Natur- und Völkerrechtler Samuel Pufendorf (1632-1694), zu der klaren normativen Fassung von Menschenwürde als Ur-Rechtstitel führen.368 Sie ist dann, in eben diesem Sinne, von Kant mit der Selbstzweckformel des Kategorischen Imperativs (1785) philosophisch abgeschlossen worden. Doch war sie schon zuvor, 1776, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zur Formulierung „unveräußerlicher“ Menschenrechte vorgestoßen – nicht ohne Orientierung an Pufendorf,369 doch mit der rechtstheologischen Begründung, daß alle Menschen gleich erschaffen und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden seien. Ein weiter Weg! Vom Luthertum ist er so selten mitgegangen worden, daß unter dem Nationalsozialismus selbst die „Bekennende Kirche“ kein eindeutiges Engagement für die Würde der jüdischen Menschen, jedenfalls nicht in den ersten Jahren ihrer Entrechtung, an den Tag gelegt hat: Ich meine ein staatsbürgerliches rechtsethisches Engagement, das über die Fürsorge für jüdische Gemeindemitglieder hinausgegangen wäre. Zu den Ausnahmen zählt, vor allen anderen, Dietrich Bonhoeffer. Er war ohnehin zu einer Grundsatzkritik der Lutherschen Reformation aufgebrochen. Das Luthertum kritisierte er zugleich aus der säkularen Perspektive einer „mündigen Welt“ und kraft einer christlich ethischen Verantwortung für die eine Welt, die sich nicht augustinisch lutherisch aufspalten lasse in einen geistlichen und einen profanen Raum, einen innerlichen und einen leiblichen Menschen.370 Mutig, tatkräftig und traditionskritisch macht er, um jene Verantwortung 367 368 369 370 D. Böhler, Ethische Motive (1980), bes. S. 110ff. Im Gegenzug zu Hobbes führt Pufendorf den rechtsmoralischen Begriff der eigentümlichen Würde des Menschen ein. Sie zeige sich nämlich in der Einschränkung seiner natürlichen Willkürfreiheit durch Grundnormen des Naturrechts, wie Karl-Heinz Ilting pointiert: „Requirebat humanae naturae dignitas et praestantia, qua caeteras animantes eminet, ut certam ad normam ipsius actiones exigerentur; quippe citra quam ordo, decor, aut pulcritudo intelligi nequit (Pufendorf, De jure naturae et gentium 2,1,2). Entscheidend an diesem neuzeitlichen Begriff der Menschenwürde ist, daß sie nicht als eine der menschlichen Natur als solcher zukommende Wertqualität, sondern als Rechtstitel verstanden wird, auf den jedes menschliche Individuum als potentieller Adressat allgemein verpflichtender Grundnormen Anspruch erheben darf. Klarer als Pufendorf hat dies selbst Kant nicht auszudrücken vermocht.“ (K.-H. Ilting, „Naturrecht“, S. 289.) Vgl. H. Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen 41962, S. 130-144. D. Bonhoeffer, Ethik. Hg. v. E. Bethge, München 1949, Kap. II, S. 174-197. 153 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie wahrnehmen zu können, „Civilcourage“ geltend: die „freie, verantwortliche Tat auch gegen Beruf und Auftrag“. Deren Begriff und Praxis fehle den Deutschen noch.371 5.3 Die kopernikanische Revolutionierung des geozentrischen Weltbildes und die Suche nach einem künstlichen Zentrum Im ermländischen Dom zu Frauenberg, am Frischen Haff gelegen, bekleidete von 1495 bis zu seinem Tode 1543 Nikolaus Kopernikus die wohlgesicherte, mit wenig Verwaltungspflichten verbundene Stellung eines der sechzehn Domherren, so daß er viel Zeit für astronomische Beobachtungen, Berechnungen und Theoriebildung nutzen konnte. Klugerweise erst im Jahr seines Todes ließ er seien Werk „De Revolutionibus Orbium Coelestium“ (Über die Kreisbewegungen der Himmelskörper) erscheinen, in dem er ein System von Sphären annahm, in deren Mittelpunkt nicht mehr die Erde, sondern die Sonne stand. Er behauptete hier, daß sich die Erde drehe. Denn mit dieser Hypothese, so begründete er (durch Schluß auf die beste Erklärung), ließen sich die astronomischen Beobachtungen der Bewegungen der Himmelskörper weitaus genauer erklären. Wiewohl er seine Annahme vorsichtig als „Hypothese“ vortrug und nur methodologisch als Schluß auf die beste Erklärung rechtfertigte, wurde sie schließlich, worauf sein Sinn gar nicht gerichtet war, weltbildstürzend. Infolgedessen konnte man später den harmlosen Ausdruck „revolutio“ (Umlauf, Umdrehung, Kreisbewegung) im Sinne von „Umsturz, Umbruch, Umwälzung“ verstehen – eben als „Revolution“ im modernen Sinne.372 6 Neuzeitliche Stationen der (Praktischen) Philosophie: Descartes, Hobbes und Kant. Oder: Das sich selbst vergewissernde und sich 371 372 Ders., Widerstand (1951), S. 14. Vgl. Funkkolleg Geschichte, SBB 8, S. 24ff. und Artikel „Revolution“ in Bd. 5 von: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart 1981. 154 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie selbstbehauptende Subjekt zwischen instrumenteller Rationalität und praktischer Vernunft. 6.1 Metaphysische Hintergrundserfahrung der Neuzeit oder: Kopernikanischer Choc, selbstbewußtes Subjekt und mathematisierte Technologie Die moderne Deutung, derzufolge Kopernikus als Revolutionär gefeiert wurde, dramatisierte nicht, sondern war angemessen. Sie brachte einen überaus dramatischen Vorgang zum Ausdruck. Der Astronom war der Zerstörer des aristotelisch-christlichen Weltbilds: die Erde als Zentrum und der Mensch als Krone der Schöpfung: wohlbehütet in der Mitte, mit beiden Beinen auf der Erde stehend und diese als das ruhende Zentrum eines Kosmos, so wie ihn Platon im „Timaios“ ausgemalt hatte – als die vollendete Harmonie eines in sich kreisenden Systems. Das Mittelalter hatte aus der antiken Astronomie die Ansicht übernommen, die Erde sei eine Kugel in der Mitte des Universums, um die die Wandelsterne kreisten. Den Abschluß des Universums bilde „die gewaltige Kristallschale des Himmelsgewölbes, die Fixsternkugel, die sich in majestätischer Ruhe um sich selber dreht. […] Die Schöpfungsgeschichte ergänzt dieses Bild durch die Vorstellung eines himmlischen Ozeans oberhalb des Himmelsgewölbes. […] Oberhalb des himmlischen Ozeans wäre dann der dritte Himmel als der eigentliche Wohnort Gottes zu suchen.“373 Das alte Weltbild stellte den Menschen wohlbehütet und kosmostheologisch eingefügt in ein göttliches Sphärensystem und politisch in eine christlich verbrämte Ordnungswelt mit dem hierarchischen Gefüge von Bauern, Handwerkern, Rittern, Fürsten, Kaiser und darüber bzw. daneben der Papst. Nun aber „rollt der Mensch aus dem Zentrum ins X“, wie der selbsternannte Prophet des Nihilismus, Friedrich Nietzsche, dreieinhalb Jahrhunderte später diagnostizierte.374 Daher mußte der neuzeitliche Mensch, der Forscher, jetzt eine neue Orientierung suchen. Das tat er auf zweierlei Weise: indem er sich auf sich selbst als denkendes Ich stellte und sich seiner existierenden Subjektivität vergewisserte; so findet Descartes das „unerschütterliche Fundament“ der Erkenntnis im zweifelnden Rückgang auf sich als kognitives Subjekt: „cogito ergo sum“/ ich denke, also bin ich, oder: indem ich denke, existiere ich; - indem er die Natur, richtiger: die Naturwissenschaft und die damit intern verbundene Technologie, mathematisierte und mechanisierte, so daß er sich als Messender und 373 374 Günter Howe, Der Mensch und die Physik, Wuppertal 1955, S. 20. F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente. In: Werke. Hrsg. Von G. Colli und M. Montinari. Bd. XIII/1 Berlin 1974, S. 125. 155 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Berechnender selbst als Bezugspunkt setzte und von diesem Pol aus den unendlichen Raum durch Experimente, durch methodischen Einsatz von Meßinstrumenten und Orientierungsinstrumenten (Kompaß, Fernrohr) erst theoretisch, dann auch technisch zu beherrschen begann. Durch diese Subjektorientierung und Weltbeherrschung erwies sich die moderne, von Kopernikus und Kepler angestoßene, von Galilei begründete Naturwissenschaft zumal dank ihrer Technik als ungeheuer „praktisch“. Hier ist auch der Ursprung der modernen umgangssprachlichen Kategorienverwechslung von „technisch“ mit „praktisch“, von naturbeherrschend und prozeßobjektivierend bzw. Prozesse kontrollierend mit gemeinsam handelnd und sich kommunikativ zueinander verhaltend. Als Nutznießer und Bediener von Techniken nennen wir zahllose technische Apparaturen und deren Funktion „praktisch“: z.B. vom Bedienen des Lichtschalters über den allseits bequemen Bürosessel und das multifunktionale Mobiltelefon bis zur ausgeklügelten Computertechnik. Aristoteles hatte hingegen praxis unterschieden von poiesis, welche von den Regeln einer Kunstlehre, einer techne, angeleitet wurde. Der Arzt, der Architekt oder Bildhauer braucht das Regelwissen seiner Kunst, seiner Technik, um z.B. richtig mit Material umzugehen und ein bestimmtes Produkt herzustellen. Für die Praxis komme es aber auf Klugheit und Besonnenheit an, die Achtsamkeit auf sich ändernde Situationen und schwankende Gegebenheiten von Lebenswelt und Staat.375 In der Neuzeit jedoch wird das Technische absolut zum Vorbild der Praxis. René Descartes (1596-1650) erblickt dann, wie seither zahlreiche Denker bis zum Ausgang des 20. Jahrhunderts, in der neuen mathematisierten Physik sogar die Verheißung einer „praktischen Philosophie“. Die Physik werde uns die Kraft und Wirkungsweise des Feuers, des Wassers, der Luft, der Sterne, der Himmelsmaterie und aller anderen Körper, die uns umgeben, ebenso genau kennen lehren, „wie wir die verschiedenen Techniken unserer Handwerker kennen, so daß wir sie auf ebendieselbe Weise zu allen Zwecken, für die sie geeignet sind, verwenden und uns so zu Herren und Eigentümern der Natur machen können (maîtres et possesseurs de la nature).“376 Descartes und der dreißig Jahre ältere englische Lordkanzler Francis Bacon (1561–1626) bestimmen die Hauptaufgabe der Wissenschaft als Naturbeherrschung durch Technik. Vor allem Bacon sieht die Naturwissenschaft als die Basis einer rationalen Gestaltung der 375 376 Aristoteles, Nikomachische Ethik, VI 4 f. R. Descartes, Discours de la Méthode. Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. Übersetzt und hrsg. von L. Gäbe, Hamburg 1960,S. 101. 156 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Gesellschaft an – ja ihrer sozialtechnischen Beherrschung. Die Vernunft (ratio, raison, reason) soll in technischem Sinn „praktisch“ werden: als Wissen zur Beherrschung der Natur, einschließlich der menschlichen Natur. Die Ratio gilt als Instrument der menschlichen Selbstbehauptung gegen die Natur und Herrschaft über die Natur. Zuerst Machiavelli, dann Bacon und schließlich dessen zeitweiliger Sekretär Thomas Hobbes denken auch die Praxis, das soziale und politische Handeln der Menschen untereinander, nach dem Modell der Technik: als durch Wenn-dann-Regeln beherrschbar. Die von Aristoteles eingeführte, wenngleich schon von ihm nicht durchgehaltene, Unterscheidung von praktischem Handeln und technisch angeleitetem Herstellen wird zurückgenommen – total und ungleich folgenschwerer als bei Aristoteles. Denn die Technik, von der er ausging, war ganz die des Handwerkers. In der Neuzeit aber wird Technik zur Technik des Ingenieurs, die alsbald in der neuen Produktionsstätte der Manufaktur (etwa 1500–1780) und der maschinellen Großindustrie (etwa seit 1780) zur entscheidenden Produktivkraft wurde.377 Nunmehr, in der industriellen Moderne, herrscht die Technologie als Anwendung der Physik und als Umsetzung ihres Erkenntnisinteresses an kontrollierter Verfügung über objektivierbare Naturprozesse, wobei diese Naturbeherrschung seit Galilei ganz und gar auf Mathematik und Mechanik beruhte. Das mechanistische Verständnis von Naturwissenschaft wurde seit Bacon peu à peu auf die Verfügbarmachung der sozialen Welt, der Gesellschaft und der Produktion übertragen. Letztere konnte seit der industriellen Revolution als Zentrum oder “Basis” (Marx) der sozialen Welt verstanden werden. Seit der industriellen Produktionsweise wurde Technologie im doppelten Sinne zum Herzstück der industriellen Produktionsweise: Technologie als die Anwendung der Naturwissenschaft, welche schon in deren experimentell prognostischer Perspektive vorgebildet ist, und Sozialtechnologie als Übertragungsversuch der Mechanik auf menschliche Handlungsweisen, zunächst auf die Tätigkeiten des modernen Fabrikarbeiters. Es entwickelt sich das Kontrollpathos und Kontrollmechanismen eines Herrschaftswissens über den Menschen in der Gesellschaft. 6.2 377 Zwei Formen der Aufklärung – ein Preis: Verdrängung der Kommunikation emanzipatorischen Solipsismus durch Vgl. K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1867). Dreizehntes Kapitel. MEW, Bd. 23, bes. S. 388 ff, 443 ff und 511 ff. 157 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Erschüttert von dem Kopernikanischen Choc und dem Zerfall der mittelalterlichen ordo-Welt, setzte in der Neuzeit ein philosophischer und wissenschaftlicher Orientierungsprozeß ein, welcher schließlich – so können wir heute im Rückblick interpretieren und bewerten – auch einen Paradigmenwechsel der Denk- und Erkenntnisauffassung mit sich bringt. Schon in der Selbstüberholung des Humanismus, bei Machiavelli und Galilei, schließlich bei Montaigne, ist das fundamentale Interesse an einer sicheren und autonomen Erkenntnis überhaupt, an theologie- und autoritätsunabhängiger, vorurteils- wie irrtumsfreier Rationalität markant hervorgetreten. Im Zeitalter Bacons und Descartes’ nimmt es nicht allein eine szientifischemanzipatorische Form an (Physik als Grundlage der Praxis), vielmehr sucht sich dieses Interesse ein Fundament, welches zugleich die Autonomie des Erkennenden und die Vergewisserung der Wahrheit verbürgen soll. Wo ist dieses Fundament zu finden? Die subjekt- bzw. bewußtseinsphilosophische Antwort lautet: Nirgendwo anders als im Erkenntnissubjekt selber, im Bewußtsein des Erkennenden, das der Selbstprüfung und Selbstvergewisserung fähig ist, und zwar aus eigener Kraft, aus eigenem Recht und zweifelsfrei autonom. Diese Autonomie bedeutete zuallererst: emphatische Unabhängigkeit von der Tradition, deren griechisch ontologisches Paradigma in der Scholastik zur Lehrautorität erhoben worden war, indes der Humanismus die römische Rhetorik als Vorbild ehrte. Ein Wechsel des Denkrahmens, des Paradigmas. Wo einst Schau des Seins war, des göttlich wohlgebauten, soll jetzt Reflexion des Subjekts sein, statt Ontologie Subjektphilosophie. Wie immer vorbereitet oder direkt bestärkt von den Autonomiemotivationen der Sokratesschule, von der Innenwendung des Hl. Augustinus, von der emanzipatorisch anthropologischen Tendenz des Humanismus, auch von Galilei und Montaigne, kommt das Denken eigentlich erst durch die Bewußtseinsphilosophie dazu, sich aus seiner eigenen Tätigkeit, verstanden als Akt des (Selbst-)Bewußtseins bzw. der Subjektivität, zu begründen. Hatte sich die Philosophie seit den Athenern vorzugsweise über ihren Gegenstand, das Sein, oder ihren Gegenstandsbezug, die Ontologie, begründet, so will sie sich jetzt auf sich selbst stellen – meint, sich zur Gänze im Selbst-Bewußtsein, im Erkenntnis-Subjekt zu finden. Darin liegt der Wechsel des Denkrahmens, des philosophischen Paradigmas. Von Descartes bis Kant läßt er sich, ein wenig überbelichtet, so pointieren: Wo Schau des Seins war, soll Reflexion des Subjekts sein, wo Ontologie herrschte, soll Erkenntnistheorie walten – Subjektphilosophie statt Seinsphilosophie. Und wo traditionsgeleitete Metaphysik war, Kontemplation des Seins vom Standpunkt Gottes aus, soll jetzt ausweisbare, rationale 158 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Methode werden, vorurteilsfreie mathematische Erklärung der Naturphänomene mit Experiment und Prognose, daher mit Technologie. Diese Wendung setzt Kritik voraus, Kritik in zweierlei Gestalt: negativ als Autonomie ermöglichende Befreiung von Traditions- und Vorurteilsabhängigkeit, konstruktiv als Selbstvergewisserung der Erkenntnisgrundlagen bzw. Erkenntnisbedingungen. Das Zeitalter der Aufklärung zieht herauf. Nun ergreift das Interesse an autonomer und vergewisserbarer, mithin an ausweisbar sicherer Erkenntnis vollends von der Philosophie Besitz, und zwar in zwei komplementären Ausprägungen und Richtungen: einerseits im britischen Empirismus, andererseits im kontinentalen Rationalismus, der später in den Idealismus, den deutschen zumal, übergeht. Um die gesuchte Rationalität zu gewährleisten, sucht man den logischen Ort der gewissen, daher sicheren Erkenntnis. Evidenz wird die Parole. Hier wie dort will man Vorurteils-, Autoritäts- und auch Irrtumsunabhängigkeit gewinnen, indem man ein Erkenntnisvermögen präpariert, das einer anderen Sphäre als derjenigen angehören soll, in der Autoritäten, Vorurteile und Irrtümer vorherrschen können. Das ist die Sphäre der sprachlichen Traditionsvermittlung und Kommunikation. Wann ist hingegen ein Zugang zum Evidenten gewährleistet? Immer dann, wenn und nur dort, wo das Augenscheinliche unabhängig von Vorurteilen ist: in der methodisch erzeugten und methodisch vergewisserbaren Erkenntnissphäre des autonomen Subjekts als solus ipse. Den Empirismus von Hobbes, Bacon, Locke und Hume führt die Evidenzsuche auf die sinnliche Erfahrung als vermeintlich sichere Basis der Erkenntnis. Nach Locke ist das Bewußtsein rein perzeptiv; sprachfreie impressions rufen auf der Netzhaut sprachfreie ideas hervor, wohingegen Descartes das fundamentum inconcussum letztlich in der Reflexion des zweifelnden Erkenntnissubjekts findet, in der methodischen Kontrolle des Bewußtseins durch methodischen Zweifel. Hier wie dort greift man zu der Idee eines, sich methodisch von dieser Welt (mit ihrer sprachlichen Traditions- und Vorurteilsvermittlung) isolierenden und dadurch Erkenntnisunmittelbarkeit gewinnenden, einsamen Bewußtseins (des Empirikers oder des Philosophen). Das Bewußtsein als solus ipse, jetzt im Unterschied zu Augustinus strikt autonom angesetzt und von der Kommunikation mit Gott mehr und mehr abgelöst, gilt als die autarke, weil kommunikationsunabhängige Erkenntnisinstanz: „Words in their primary or immediate significations stand for nothing but the ideas in the mind of him that uses them“ (Locke).378 Mit der Aufklärung bildet sich der bewußtseinsphilosophische Hintergrundkonsens heraus, daß der Erkenntnisdiskurs prinzipiell einsam sei. Er muß es angeblich sein, um die 378 J. Locke, Essay Concerning Human Understanding, Bd.II, Buch III, 2.2., London 1690. 159 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Autonomie, und, über diese, die Gewißheit der richtigen Erkenntnis sicherzustellen. Daher gehört die instrumentalistische Bezeichnungstheorie der Sprache zur bewußtseinsphilosophischen Morgengabe der Moderne: dem emanzipatorisch gesonnenen methodischen Solipsismus.379 Für ihn ist Sprache nichts als ein nachträgliches Kommunikationsinstrument der Ratio. Es dient bloß zur Bezeichnung dessen, was wir ohne die Sprache erkennen, erschauen können. Der von der Aufklärung für das Autonomieideal entrichtete Preis ist die Verdrängung von Sprache und Kommunikation als Denkvoraussetzungen und interner Erkenntnisbedingungen. Den Fortschritt an Autonomie, den Gewinn an philosophischer Emanzipation, hat die Aufklärung mit dem Verlust des kommunikationsphilosophischen Potentials, das im rhetorischen Humanismus von Cicero über Petrarca bis zu Giambattista Vico entwickelt worden war380, teuer bezahlen müssen: Sprache und Kommunikation fallen aus dem Subjektparadigma heraus. Als Konstituentien der Erkenntnis und Rahmenbedingungen des Subjekts spielen sie für die Philosophen, seien sie Empiristen oder Rationalisten, keine Rolle. Hier zeigt sich wohl ein entwicklungslogisches Gesetz, das der Entwicklung der Philosophie zugrundezuliegen scheint: Gesetz der produktiven Vereinseitigung dessen, was neu entdeckt wird. Hier ist es der neue Standpunkt des autonomen, auf sich selbst reflektierenden Subjekts, welches alles andere, Natur wie Gesellschaft, zum Gegenstand des Rechnens und kausalen Erklärens macht – zum Objekt einer instrumentellen Ratio, die ihr Vorbild in der Naturwissenschaft hat. Die radikale, vereinseitigte Einnahme des Standpunkts der Autonomie und der Selbstvergewisserung (dieser Art) führt dazu, die Sprache zu einem Instrumentenkasten der Ratio herabzusetzen und die sprachliche Kommunikation, da man nie wisse, was da vermittelt wird, eher unter den Generalverdacht der Vermittlung von Vorurteilen zu stellen, als die neuartige Reflexionsfrage, Kants „transzendentale“ Frage nach internen Bedingungen der Erkenntnis, nun auch auf Sprache und Kommunikation zu beziehen. So geht mit der philosophischen Entdeckung des Erkenntnis- bzw. Diskurssubjekts (cogitatio bei Descartes) die Verdeckung seiner kommunikativen Praxis einher. Freilich vergißt man dabei, daß auch der einsame Denker Descartes immer schon kommunizieren muß: Er hat gelesen, er schreibt, macht Gedankenexperimente, spricht mit anderen; auch wenn er mit der Einsamkeit kokettiert, ist er nicht allein, sondern in Kommunikationsgemeinschaft. 379 380 Vgl. D. Böhler: Rek. Pragm. (1985), S. 69-76. Vgl. K.-O. Apel, Idee (1963). 160 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 6.3 Descartes: Selbstvergewisserung durch wissenschaftliche Methode und durch Reflexion des Erkenntnissubjekts Descartes und der dreißig Jahre ältere englische Lordkanzler Francis Bacon (1561 1626) – beide waren Wissenschaftler und Wissenchaftstheoretiker – bestimmen die Hauptaufgabe der Wissenschaft als Naturbeherrschung. Vor allem Bacon betrachtete die (Natur-) Wissenschaft als Basis einer rationalen Gestaltung der Gesellschaft. Die Vernunft (ratio, raison, reason) soll in technischem Sinn praktisch werden. Wie? Indem sie zunächst als konstruktivmathematisches Naturverstehen konzipiert wird, welches schließlich zum mathematischtechnischen Herrschaftswissen über die Natur, einschließlich der menschlichen Natur führt. An dieser Intention haftete ein ungeheurer Enthusiasmus: eine zweite Schöpfung. So hatte es schon Nikolaus Cusanus vorausgedacht.381 In der Neuzeit wird dieser Enthusiasmus für alle Bereiche bestimmend werden: messen, erklären, beherrschen. So gilt schließlich Vernunft, Ratio, als Instrument der Selbstbehauptung gegenüber der Natur. Zuerst Machiavelli, dann Bacon und schließlich dessen zeitweiliger Sekretär Hobbes denken freilich auch die Praxis, das soziale und politische Handeln der Menschen untereinander, nach dem Modell der Technik: als beherrschbar durch Wenn-dann-Regeln. Eine folgenschwere Umorientierung, eine Umwälzung der Tradition, die das Selbstverständnis tiefgreifend verändert. Die von Aristoteles eingeführte, aber nicht durchgehaltene Unterscheidung von praktischem Handeln und technisch angeleitetem Herstellen wird eingeebnet – ungleich folgenschwerer als bei Aristoteles: denn die Technik, von der er ausging, war wesentlich die des Handwerkers. Nun aber wird Technik zur Technik des Ingenieurs, die alsbald in der neuen Produktionsstätte der „Manufaktur“ (etwa 1500–1780) und der maschinellen Großindustrie (etwa seit 1780) zur entscheidenden Produktivkraft wurde, Die Neuzeit wird von einem ungeheuren Enthusiasmus der Herrschaft des Menschen eingeleitet und begleitet. Einerseits beruht er auf der Selbstvergewisserung durch die methodische Rationalität der neuen Wissenschaft, die die gesamte Natur zu berechnen, messen, erklären und zu beherrschen erlaubt, andererseits auf einer zwiefach reflektierenden Selbstvergewisserung des Menschen, nämlich auf zwei Gedankenexperimenten, die den Autonomie-Anspruch der Ratio philosophisch methodisch zur Geltung bringen: 381 Vgl. Karl-Otto Apel, Das Verstehen (eine Problemgeschichte als Begriffsgeschichte). In: Archiv für Begriffsgeschichte, Bd. I, Bonn 1955, S. 142-199, hier: S. 148-152. 161 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie - Es ist Descartes’ Selbst-Vergewisserung durch Besinnung auf ein „absolutes“, von aller Einbeziehung in eine sinnhafte Welt, von allem vorgegebenen Wissen, allen Lehr-Autoritäten und Traditionen abgelöstes, nur auf sich selbst reflektierendes Ich. - Es ist andererseits die Hobbes’sche Sozial-Vergewisserung durch Rückgang auf ein isoliertes, von allen lebensweltlich sittlichen Normen und institutionellen Bindungen abgelöstes, nacktes Individuum als Inbegriff asozialer, aggressiver Selbstbehauptung, das nichts als die Ratio eines Vorteilskalküls mitbringe. Max Weber wird dies später Zweckrationalität nennen. Was Descartes anbelangt, so ist er zwar als Jesuitenschüler mit seinem Apparat an scholastischen Begriffen, von denen er nie ablässt, mit seinem Versuch, katholische Grundlehren wie die Unsterblichkeit der Seele und die Existenz Gottes zu beweisen, und vor allem mit seinem „Beweis“, daß Gott allein Welt und Ich vermitteln könne, ein traditioneller Denker. Aber sein Denkmittel, sein Denkweg, seine Denkmethode ist spezifisch neuzeitlich. Es hat über Kant, Fichte, Schelling und Hegel bis zu Husserl die Philosophie als „Philosophie der Subjektivität“ bestimmt.382 Entsprechend kann Hegel ihn derart würdigen: Erst mit Descartes „treten wir eigentlich in eine selbständige Philosophie ein, welche weiß, daß sie selbständig aus der Vernunft kommt und daß das Selbstbewusstsein wesentliches Moment des Wahren ist. Hier, können wir sagen, sind wir zu Hause und können, wie der Schiffer nach langer Umherfahrt auf ungestümer See, ›Land‹ rufen; Cartesius [latinisierte Form von Descartes] ist einer von den Menschen, die wieder mit allem von vorn angefangen haben; und mit ihm hebt die Bildung, das Denken der neueren Zeit an.“383 Nach dem Zerfall der alten Welt und des alten Weltbildes scheint es nichts Sicheres mehr zu geben – nichts, woran nicht gezweifelt werden könnte, so daß man als Philosoph nunmehr fragen muß: „Wer bin ich? [...] Doch wohl ein Mensch. Aber was ist das ›ein Mensch‹? Soll ich sagen: ein vernünftiges, lebendes Wesen? Keineswegs, denn dann müßte man ihn hernach fragen, was ein ›lebendes Wesen‹ und was ›vernünftig‹ ist, und so geriete man aus einer Frage in mehrere und noch schwierigere. Auch habe ich nicht so viel Zeit, daß ich sie mit derartigen Spitzfindigkeiten vergeuden möchte“. [– Die selbstverständliche Basis des christlicharistotelischen Geistes, daß der Mensch ein vernünftiges Lebewesen sei, ist also eine 382 Dazu W. Schulz: Philosophie in der veränderten Welt. Pfullingen 31976, bes. S. 257ff., 348ff. – Ders. Ich und Welt. Pfullingen 1979. 383 G. W. F. Hegel: Geschichte der Philosophie, 3. Teil, 2. Abschnitt. In: Werke in 20 Bänden. Hrsg. von E. und K. M. Michel. Frankfurt 1979, Bd. 20, S.120, vgl. S. 123ff. 162 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Spitzfindigkeit! – Vielmehr will ich] „alles von mir fernhalten, was auch nur den geringsten Zweifel zuläßt [...] und ich will solange weiter vordringen, bis ich irgend etwas Gewisses [...] erkenne [...] Ich setze also voraus, daß alles, was ich sehe, falsch ist.“ Aber wenn ich das tue, bleibt doch eines übrig: mein Denken.384 Der methodische Zweifel, also die „Fiktion, daß nichts, was mir jemals in den Kopf gekommen, wahrer wäre als die Trugbilder meiner Träume“, findet doch an einem Punkt sein Ende: daran nämlich, daß ich es bin, der denkt. Daher ist „diese Wahrheit: ›Ich denke, also bin ich‹ so fest und sicher [...], daß die ausgefallensten Unterstellungen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten.“385 Insofern macht Descartes das auf sich reflektierende einsame Ich, auf das sich der neuzeitliche Mensch durch die kopernikanische Auflösung des sinnvollen zweckmäßigen Kosmos und den Zerfall der universalen christlichen Gemeinschaft (unter Papst und Kaiser) zurückgeworfen sieht, zum neuen Orientierungs- und Ausgangspunkt. In der Philosophie herrscht seitdem ein methodischer Solipsismus vor, der unterstellt, einer für sich allein könne verstehen und Wahrheit haben. Descartes verzichtete darauf, aus diesem radikalen Ansatz praktische, ethische und politische Konsequenzen zu ziehen. Das tut dann Hobbes. 6.4 Thomas Hobbes oder die politische Hintergrundserfahrung der Neuzeit. Die konfessionellen Bürgerkriege als Offenbarung einer Wolfsnatur und die Antwort der zweckrationalistischen Vertragstheorie Descartes verzichtete darauf, einen ethischen Gebrauch von dem neuen Ansatz zu machen. Vielmehr greift er auf die aristotelische Klugheit zurück und beläßt es bei einer vorläufigen Moral (morale par provision). In einer Zeit der alles bedrohenden Glaubenskriege und des Verlustes universaler religiöser wie moralischer Überzeugungen empfiehlt er, sich die lebensnotwendige praktische Orientierung aus der überlieferten und etablierten Sittlichkeit des jeweiligen Landes zu holen386: Er hält sich sicherheitshalber an die konventionellen Urteilsstufen drei und vier, wie wir sie im Schema Lawrence Kohlbergs kennen gelernt haben. Wo Descartes aufhört, setzt Thomas Hobbes an. Er ist durchdrungen von der Gefahr des brutalsten zu befürchtenden Krieges – Hobbes’ Geburtsjahr 1588 war das Jahr des Angriffs der Spanischen Flotte auf britische Gewässer – und geprägt vom Grauen der 384 R. Descartes: Meditationes de prima philosophia. Hrsg. von L. Gäbe. Hamburg 1959, Bd. II., S. 43-49. R. Descartes: Discours, a.a.O., S. 53. 386 R. Descartes: Discours, a.a.O., S. 37-43. 385 163 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Wolfsnatur, die sich ebenso im Religionskrieg wie in der Gesinnungsherrschaft über Ungläubige folternd Bahn bricht. Geleitet von diesem Erfahrungs- und Erwartungshorizont muß er das naturrechtliche Credo des Abendlandes verwerfen, welches auf den Aristoteliker Thomas von Aquin zurückgeht: homo est naturaliter socialis. Die in der abendländisch christlichen Tradition zutiefst verwurzelte aristotelische Grundannahme, „daß der Mensch von Natur ein zur Gesellschaft geeignetes Wesen sei“, sieht Hobbes als falsch an. „Denn wenn die Menschen einander von Natur, d. h. bloß weil sie Menschen sind, liebten, wäre es unerklärlich, weshalb nicht jeder jeden in gleichem Maße liebte, da sie ja alle in gleichem Maße Menschen sind.“387 Hobbes räumt den traditionellen, zugleich ontologischen und ethischen Naturbegriff zur Seite und wendet den wertneutralen Naturbegriff von Galileis Mechanik auf den Menschen an. Auch die Philosophie versteht er nach dem Vorbild der neuen Naturwissenschaft als „rationelle Erkenntnis der Wirkungen oder Erscheinungen aus ihren bekannten Ursachen oder erzeugenden Gründen und umgekehrt der möglichen erzeugenden Gründe aus den bekannten Wirkungen“. „Vernunft“ definiert er als Berechnung, die auf die beiden Operationen „Addition“ und „Subtraktion“ zurückgeht: „Vernunft ist nichts anderes als Rechnen, d. h. Addieren und Subtrahieren“, wobei auch mit Begriffen gerechnet werde: „mit allgemeinen Namen, auf die man sich zum Kennzeichnen und Anzeigen unserer Gedanken [die also vorsprachlich und ohne Kommunikation möglich sein sollen!] geeinigt hat.“388 Denken können wir jedoch als solus ipse, jeder einsam für sich. Die Natur und die Wirklichkeit insgesamt sind für Hobbes nichts als Körper und Bewegung, also die von vermeintlich innerem Sinn und innerer Zielbestimmung entleerte Natur im Sinne von Galileis Mechanik.389 Auch deren Methode übernimmt er, nämlich den Zweischritt von „Resolution“ als Zerlegung des zu Erklärenden in seine Grundelemente und dann „Komposition“ als zusammensetzende Konstruktion der Elemente zum Ganzen. So will er den bürgerlichen Zustand, den Staat, als politischen Körper zunächst analysieren und dann neu zusammensetzen. Um jene Grundelemente im ersten – resolutiven – Schritt zu finden, unternimmt er das Gedankenexperiment eines „Zustandes der Menschen außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft“. Wie Galilei, der, als er die Gesetze vom freien Fall der Körper konstruierte, zunächst von dem Gedankenexperiment des luftleeren Raumes ausging, so geht Hobbes von der fiktiven 387 Th. Hobbes: De cive 1,2 – deutsch: Vom Menschen, vom Bürger. Elemente der Philosophie II/III. Eingeleitet und hrsg. von G. Gawlick. Hamburg 1959. S. 74f. 388 Th. Hobbes: De corpore I, 1,2 deutsch: Vom Körper. Elemente der Philosophie I. Hrsg. von M. FrischeisenKöhler. Hamburg 21967, S. 6 und: Ders,: Leviathan I, 5 – deutsch: Ders.: Leviathan. Hrsg. und eingeleitet von I. Fetscher. Darmstadt/Neuwied 1966, S. 32. 389 Th. Hobbes: De corpore I, 1,9 – deutsch: a.a.O., S. 13. 164 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Annahme eines politisch-rechtlich-sittlich leeren Raumes aus: vom Vakuum eines vorbürgerlichen Zustandes. Unter Voraussetzung des rein quantitativen Naturbegriffs der galileischen Physik nennt Hobbes jenes politische Vakuum „Naturzustand“ – welch kopernikanische Wende der Philosophie! Dieses Gedankenexperiment soll den Blick für die unverfälschten Ursachen der Bewegungen der menschlichen Körper, also für die Ursachen der menschlichen Handlungen, freigeben. Auf diese Weise findet er zwei Hauptursachen der menschlichen Bewegung: das Begehren bzw. Erstreben von etwas und die Abneigung bzw. die Furcht. Diese beiden Bewegungs- und Handlungs-Ursachen bilden nach Hobbes das menschliche Selbsterhaltungsinteresse. „Jeder verlangt das, was gut, und flieht das, was übel für ihn ist; vor allem flieht er das größte der natürlichen Übel, den Tod; und zwar infolge einer natürlichen Notwendigkeit, nicht geringer als die, durch welche ein Stein zur Erde fällt.“390 Diese natürlichen Antriebe sind bloß natürlich und daher weder gut noch böse. Aber das Begehren führt zur Lebensbedrohung, weil oftmals viele Menschen „denselben Gegenstand begehren“, woraus sich Kampf und sogar Kampf auf Leben und Tod ergeben kann; und zwar prinzipiell ein Kampf aller gegen alle. Dabei ist selbst der stärkste Mensch leicht verletzlich, weil noch der Schwächste, durch List oder durch Verbindung mit anderen, auch den Stärksten – der bei den Tieren für Ordnung sorgen würde – überwältigen und töten kann. Im Grunde sind also die Menschen gleich stark und haben die gleiche Angst vorm Tode. Es besteht daher eine negative Gleichheit der Menschen in der Möglichkeit zu töten und in der Furcht, getötet zu werden.391 Weil in einem bloßen Naturzustande, also in diesem fiktiven, nur angenommenen rechtlichpolitischen Vakuum, mit der absoluten Willkürfreiheit der Individuen auch absolute Unsicherheit und Furcht herrschen würde, lassen sich nach Hobbes folgende „Gebote der rechten Vernunft“ hinsichtlich der „möglichst langen Erhaltung des Lebens“ ableiten: - daß man den Frieden suche, soweit er zu haben ist; - daß man die Willkürfreiheit als natürliches „Recht aller auf alles“ einzuschränken willens ist; - daß man diesen Willen gegenseitig durch Verträge verbindlich macht; - daß man die eingegangenen Verträge halte.392 390 Th. Hobbes: De cive 1,7 – deutsch: a.a.O., S. 81. Vgl. Leviathan I,6 – deutsch: S. 39f. Th. Hobbes: Leviathan I, 13 – deutsch: a.a.O., S. 94ff. 392 Vgl. Th. Hobbes: De cive 2,2 bis 3,1 – deutsch: a.a.O., S. 87–98. Vgl. Leviathan I, 14 – deutsch: a.a.O., S. 99f. 391 165 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Diese Gebote bezeichnet Hobbes auch als „von der Vernunft ermittelte, grundlegende Gesetze der Natur“. Denn sie werden durch das Gedankenexperiment eines bloßen „Naturzustands“ (also durch die Hypothese eines politisch-rechtlich-sittlich leeren Raumes) methodisch erzeugt, so daß sie von jedem Denkenden ebenso gefolgert werden müßten und daher intersubjektiv gültig sind. – Das aber können sie nur sein, wenn die Voraussetzungen stimmen, von denen Hobbes ausgeht. Können, so müssen wir uns fragen, seine Annahmen über die natürlichen Eigenschaften bzw. Handlungsantriebe der Menschen – über die von Hobbes gemachten besonderen Erfahrungen hinaus – als verallgemeinerbar gelten oder nicht; sind seine solipsistischen und mechanistischen Annahmen tragfähig? Sind sie vereinbar mit jenen sozialen Voraussetzungen, die Hobbes ebenso gemacht hat wie wir alle, indem wir etwas als etwas denken und es anderen gegenüber zur Geltung bringen? Deutlich ist: Hobbes’ Vernunftgebote sind bloß „hypothetische Imperative“ im Sinne Kants. Die Vernunft, die sie hervorbringt, entwickelt nicht selbst eine Motivation, die moralisch verpflichten könnte; sie ist also nicht orientierend. Weder ist sie moralisch „gesetzgebend“ im Sinne Kants, noch begründet sie im Sinne einer argumentationsreflexiven Ethik letzte Maßstäbe dafür, was es bedeutet, „vernünftig“ und „praktisch vernünftig“ zu sein. Vielmehr geht Hobbes von dem vermeintlich „natürlichen“ Faktum des Selbsterhaltungsinteresses aus und verbindet es mit dem Kalkül der wertfreien Rationalität. Der Mensch, der als Lebewesen im Willen zum Leben seinen obersten Zweck schon mitbringt, muß nun lediglich die geeigneten Mittel zu dessen Realisierung suchen. Im Sinne eines Kalküls der „Zweckrationalität“ (so Max Weber – eigentlich spräche man besser von „Mittelrationalität“) entwickelt Hobbes eine Lehre vom Staatsvertrag, den die Menschen aus natürlichem Selbsterhaltungsinteresse eingehen. Und zwar ist es nicht – darin liegt ein wesentlicher, heute gern eingeebneter, Unterschied zur Ethik Kants – der moralisch gesetzgebende Wille des Menschen als eines Vernunftwesens, sondern der empirische Lebenswille des Menschen, der als Basis des Sozialvertrags angesetzt wird, der – so Hobbes – zu einem friedlichen Zusammenleben führt. Es handelt sich also beim Willen zur Selbsterhaltung (als Grundlage eines vernünftig geordneten Zusammenlebens) nicht um eine moralische Basis, so daß wir als Argumentierende unwiderlegbare Gründe für das Eingehen und Einhalten eines Sozialvertrags (etwa eines Staatsvertrags) geltend machen können. Vielmehr handelt es sich um eine natürlich wirkende Ursächlichkeit im Sinne unausweichlicher Naturgesetzlichkeit, die von einer empirischen Wissenschaft der menschlichen Natur und ihrer Gesetze festgestellt werden soll. 166 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Aus der Sicht Immanuel Kants, der die Ethik auf die Vernunft gründet, ist eine solche ethische Basis bloß „heteronom“: Hobbes Vertragstheorie etabliert eine Fremdbestimmung des vernunftfähigen Willens. Das läuft nach Kant auf eine Entmündigung hinaus, auf eine Beschneidung des menschlichen Vermögens zur moralischen Selbstbestimmung (im Sinne einer freien, diskursiven Orientierung des Verhaltens an der verallgemeinerungsfähigen Gesetzgebung). Statt moralischer Autonomie durch praktische Vernunft herrscht Fremdbestimmung durch natürliche Ursachen wie „Affekte“ und „Neigungen“ und daraus abgeleiteten Regeln. Die Begründung einer praktischen Vernunft, die von Kant teils beabsichtigt, teils schon entworfen wurde, läßt sich nicht mit einer zugleich naturalistischen und utilitaristischen Vertragstheorie harmonisieren – auch wenn einige, wie Ottfried Höffe, es versucht haben –, genaugenommen weder mit einer naturalistischen noch mit einer utilitaristischen Politik oder Ethik. Vielmehr gibt sie gerade den Blick auf die Begründungsverlegenheiten von Hobbes frei. Dies sind zunächst zwei: • Hobbes ersetzt die klassisch naturrechtliche Form des naturalistischen Fehlschlusses durch eine naturwissenschaftlich orientierte Version – er leitet das bürgerliche Sollen nicht mehr aus dem Sein der göttlich geordneten Natur ab, sondern aus dem Sein einer empirischen Naturkausalität in Verbindung mit der (freilich durch natürliche Affekte angestoßenen) moral- und wertfreien Rationalität des Menschen als KalkülVermögen. • Hobbes ist nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, warum Menschen auch dann Verträge schließen oder einhalten sollten, wenn das nicht ihrem egoistischen Selbstinteresse dient und daher als zweckrational ‚geboten‘ erscheint. Erläutern wir zunächst diesen zweiten Einwand. Um den Vertragsbruch zugunsten des eigenen Vorteils zu verhüten, stattet er die Staatsmacht, die aus dem Staatsvertrag hervorgeht, nicht nur mit allen Vollmachten eines absoluten Souveräns aus, sondern verleiht ihr absolute Autorität und installiert sie als irdischen Gott, als Leviathan.393 Insofern haben wir hier eine ähnliche Paradoxie wie bei Platon: Einerseits überschreitet Hobbes das konventionelle, bei Descartes noch ungebrochene Ethos und gründet die Moral auf einen Vertrag, den die Bürger selbst zustandebringen (Stufe 5 nach Kohlberg), andererseits entzieht er eben diesen Bürgern die Möglichkeit eines kritischen Dialogs zur eventuellen Revision der staatlichen Normen. Das bedeutet: er versucht die kritische Spannung zwischen dem etablierten Ethos und der 393 Th. Hobbes: Leviathan II, 17 – deutsch: a.a.O., S. 134. 167 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Vernunftethik, zwischen der jeweiligen realen Staatsgemeinschaft und der idealen Argumentationsgemeinschaft aufzuheben. Wie bei Platon kommt auch dieser Rückfall in die bloß konventionelle Moral der allmächtigen Staatsinstitution, deren Gewalt ungeteilt beim Souverän liegt,394 nicht ohne Anknüpfung an eine un-eschatologische Theologie aus. Knüpfte Platon an die zukunftslose, auf das ewige Kreisen der Gestirne als göttliche Erscheinungen bezogene Kosmostheologie an, so vertritt Hobbes eine entchristianisierte, der eschatologischen Spannungen zwischen irdischem Staat und Reich Gottes beraubte Theologie der absoluten Willkürmacht Gottes. Wie die absolute Verbindlichkeit eines göttlichen Befehls auf der unwiderstehlichen Willkürmacht Gottes beruhe, so auch die Verbindlichkeit staatlicher Grundsätze auf der ungeteilten und unkritisierbaren Macht des Souveräns. Allein der Souverän sei – auf Erden – der Herr über Leben und Tod, weshalb auch die Todesstrafe ein unverzichtbares Attribut der Staatsmacht darstelle. (Ein Gedanke, der auch in die französische Staatsverfassung eingegangen ist. Bis zu den Zeiten Mitterands gab es in Frankreich die Todesstrafe, als Mittel der Abschreckung durch die Furcht vor einem gewaltsamen Tode. Dies sei die causa der Bewegung des menschlichen und politischen Körpers.) Allein der Souverän verbürge auf Erden ein Friedensreich. Die staatliche Friedensordnung setzt Hobbes tendenziell sogar mit dem Reich Gottes auf Erden gleich.395 Eben dadurch ebnet er die normativ-kritische Distanz zwischen positiver Rechtsordnung und idealer moralischer Ordnung, zwischen Legalität und Moralität, ein und nimmt der christlichaugustinischen Idee des Reichs Gottes ihre kritische Funktion. Hobbes verwirft das ihm gefährlich scheinende Erbe der Augustinischen Lehre von den zwei Reichen. In dieser Lehre hatte Augustinus in gewisser Weise die Reich-Gottes-Hoffnung aus dem revolutionären Geist des frühen Christentums und der jüdischen Apokalyptik gerettet, geschichtstheologisch entfaltet und dadurch dem Abendland einen utopieträchtigen Unruheherd und eine kritischmoralische Gegeninstanz zur jeweiligen realen politisch-sittlichen Ordnung vermacht.396 Über die Diesseitigkeit des autoritär absolutistischen Friedenssicherungsstaates hinaus will Hobbes nichts gelten lassen. Dies sei das Höchste, wonach der Bürger streben dürfte und von woher er diese gewaltige Staatsmacht, diesen sterblichen Gott, wie er sagt, überhaupt kritisieren könnte. Weder kritische Dialoge über die Legitimität der Staatsordnung oder einzelner ihrer Teile, noch Fernziele und fernhinzielende Wunschvorstellungen politisch- 394 Hobbes verurteilt ausdrücklich jede Teilung der Staatsgewalt: Leviathan II, 17 – deutsch: a.a.O., S. 134f. Kritisch dazu: Dietrich Braun: Der sterbliche Gott oder Leviathan gegen Behemoth. Zürich 1963. 396 Augustinus: De civtate Dei libri XXII. Stuttgart 1928/29. Deutsch: Vom Gottesstaat, 2 Bde. Übertragen von W. Thimme. München 1977. 395 168 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie sozialer Utopien, weder kritische Moralansprüche noch utopische Glücksperspektiven darf es in Hobbes’ Staat geben, weil sie den politischen Frieden bedrohen könnten. Die Hobbessche politische Liquidierung von Diskurs und Utopie wirkt deutlich nach bei Arnold Gehlen397, Helmut Schelsky, Herrmann Lübbe und anderen, die in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts den Anspruch einer politischen „Tendenzwende“ gegen den Anspruch der späten sechziger Jahre auf „mehr Demokratie“ gesetzt hatten.398 Die politische Aktualität von Hobbes geht aber noch tiefer. Denn er verkörpert gleichsam – und damit kommen wir zu unserem zweiten Einwand – das moralphilosophische Begründungsdefizit der (wohl bis heute) im Westen vorherrschenden, wertfrei-liberalen Staatsideologie. Diese bestreitet ja die Möglichkeit rationaler Begründung ethischer Normen, also die Möglichkeit ethischer Vernunft, und will es bei der faktischen Anerkennung einer Rechtsordnung durch die Bürger sowie bei der „Legitimation durch Verfahren“ bewenden lassen.399 Wenn aber – so betont K.-O. Apel – „eine Begründung intersubjektiver Gültigkeit ethischer Normen tatsächlich unmöglich ist, dann besteht keinerlei Verpflichtung dazu, freie Übereinkünfte einzugehen oder sie einzuhalten. Beides – und damit das gesamte Ethos liberaler Demokratie – reduziert sich dann auf zweckrationale Klugheitsveranstaltungen der Interessenten, wie sie prinzipiell auch in einer Gemeinschaft von Gangstern denkbar sind; und die Verbindlichkeit oder normative Geltung der Übereinkünfte und der auf sie gegründeten Gesetze läßt sich dann, strenggenommen, auf ihre faktische Effektivität angesichts einer weiterbestehenden Interessenkonstellation zurückführen. Das heißt, jeder ist genau dann und [nur] insofern ›verpflichtet‹, Übereinkünfte einzugehen bzw. sie einzuhalten, wenn bzw. sofern er sich davon Vorteile verspricht bzw. wenn oder sofern er für den Fall eines anderen Verhaltens Nachteile befürchten muß.“400 Hatte schon Machiavelli das Sozialverhalten der Menschen aus Trieben und Affekten wie aus Naturgesetzlichkeiten erklären wollen, so erklärt Hobbes auch den Schritt der Menschen zum Staatsvertrag – und noch die Einhaltung des Staatsvertrags sowie der bürgerlichen Ordnung – aus dem Interessen-Kalkül in Verbindung mit einer natürlichen Anlage des Menschen, dem Selbsterhaltungsinteresse, und mit einem natürlichen Affekt, der Furcht.401 Es sind also Naturgegebenheiten, letztlich die Furcht vor einem gewaltsamen Tode im rechtlosen 397 Zu Gehlen vgl. die Beiträge von J. Habermas und D. Böhler in: K.-O. Apel u.a. (Hrsg.): Praktische Philosophie/Ethik. Frankfurt 1980, S. 32ff. und 46ff. 398 Vgl. H. Schelsky: Die Arbeit tun die anderen. Opladen 1975 und ders., Die Hoffnung Blochs. Stuttgart 1979. 399 Vgl. Niklas Luhmann: Legitimation durch Verfahren. Neuwied 1969. 400 K.-O. Apel: Die Konflikte unserer Zeit und das Erfordernis einer ethisch-philosophischen Grundorientierung. In: K.-O. Apel u.a. (Hrsg.): Praktische Philosophie/Ethik, a.aO., S. 280f. 401 Th. Hobbes: Leviathan I, 13; II, 17 – deutsch: a.a.O., S. 96ff. und 131. De cive. Vorwort; 1,13; 5,12 und 6,4. – Vom Bürger, S.68ff, 84, 129ff. und 133. 169 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie „Naturzustand“ eines egoistischen Kampfes aller gegen alle, die Hobbes als Beweggrund für den Abschluß eines Staatsvertrags angibt. So geht er zwar nicht mehr von einer unmittelbar verstehbaren teleologischen Naturordnung aus, aber von einer theoretisch erklärbaren, empirischen Naturkausalität und verbindet diese mit dem Kalkül einer instrumentellen ratio, einer, wie Horkheimer sie nannte, „instrumentellen Vernunft“. Wiewohl Hobbes – der als Bewunderer Galileis dessen Mechanik auf die Gesellschaft zu übertragen suchte – an der Ablösung des metaphysischen durch den wissenschaftlichen Naturbegriff vollen Anteil hat, überwindet er die klassisch-ethische Argumentationsweise nicht, die das moralische Sollen aus dem natürlichen Sein ableitet.402 Das aber heißt, er beruft sich auf eine außerargumentative Instanz, also auf einen Standpunkt, den er als Diskurspartner, der nur prüfbare Argumente sucht und nur solche vorbringen darf, nicht einholen kann. Er verlässt damit den Diskurs der Argumentationspartner und springt aus der Autonomie des Argumentationspartners in eine Heteronomie, eine Perspektive der Fremdbestimmung. Erst ein Jahrhundert später zieht der schottische Philosoph David Hume (1711-76) aus dieser Ablösung des metaphysischen Naturbegriffs die moralphilosophische Konsequenz, daß aus dem Sein (der Natur) kein Sollen (des sozial Handelnden) abgeleitet werden kann, daß also Normen nicht aus Fakten begründet werden können. Genauer gesagt: auch Hume legt diese Konsequenz nur nahe.403 Aber sie ist gleichsam fällig: Der deutsche Philosoph Christian August Crusius (1715-75), der selbst noch in der, durchaus aristotelisch geprägten, Tradition des Naturrechts der Aufklärung steht, aber schon Grundgedanken der Kantischen Ethik vorwegnimmt, setzt das Sein der quantitativen Natur, als Objekt der Physik, vom Sollen der moralischen Gesetzgebung als Thema der Ethik in aller Schärfe ab: „Die physikalische Wirklichkeit ist, nach welcher etwas ist, die moralische, nach welcher es sein soll.“404 6.5 Immanuel Kants Suche nach praktischer Vernunft oder: Einsehbare Verbindlichkeit in den Grenzen einer Zwei-Welten-Metaphysik und deren Gesinnungsethik 402 Vgl. C. B. MacPherson: Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Übers. von A. Wittekind. Frankfurt 1973, S. 87, 91ff. 403 D. Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur. Übers. von Th. Lipps. Hamburg 1973. Buch III (über Moral), Erster Teil, 1. Abschnitt, S. 211f., vgl. 204ff. Dazu Lewis White Beck: ›Was – must be‹ and ›is – ought‹ in Hume. Philosophical Studies 26 (1974), S. 219ff. 404 Christian August Crusius: Anweisung vernünftig zu leben. Leipzig 1744, S. 204. 170 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Immanuel Kant, 1724 in Königsberg geboren, dort ein neugieriger, allseitig informierter, gastfreundlicher Weltbürger und Revolutionär der Philosophie, hart arbeitend und 1804 daselbst gestorben, ist der philosophische „Alleszermalmer“, wie ihn Zeitgenossen zu Recht genannt haben. Er revolutioniert in der Tat die theoretische und die praktische Philosophie, indem er beide auf kritische Vernunft zurückführt und nichts als diese gelten lassen will. Spät reifend, mit vielen Schriften aus seiner vorkritischen Arbeitsphase und spät zum Professor berufen, wird er sich immer klarer, wird auch immer entschiedener autonom und republikanisch. Der größte Denker nach Platon und Aristoteles, der wahrhaftigste nach Sokrates. Bereits in der „Vorrede“ seiner Grundlegung der Ethik bringt er wie selbstverständlich das Wahrhaftigkeitsgebot als Paradigma „sittlicher Gesetze“ ins Spiel.405 Und er eröffnet den „Ersten Abschnitt“ dieser Grundlegungsschrift, indem er das Attribut „gut“ für den guten Willen reserviert, den er dann als den wahrhaften Willen bestimmt, weil ein guter Wille ein vernünftiger sein müsse, als solcher aber kein lügenhaftes Versprechen rechtfertigen könne.406 Wenngleich er eine umfassende Philosophie der Vernunft nicht hinterlassen hat, sagt Kant uns doch in einer Fußnote, welche den Atheismusstreit um den verstorbenen Lessing schlichten sollte, worin er die Einheit der Vernunft erblickte: in jenem Selbstdenken, das sich stets um das Verallgemeinerbare bemüht, weil Vernunft auf das begründete Allgemeine ziele. In diesem Sinne enthalte die Vernunft die Maxime der Aufklärung. In der abschließenden Fußnote seines Aufsatzes „Was heißt: sich im Denken orientieren?“ lesen wir: „Selbstdenken heißt den obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst (d.i. in seiner eigenen Vernunft) suchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung. Dazu gehört nun eben soviel nicht, als sich diejenigen einbilden, welche die Aufklärung in Kenntnisse setzen; da sie vielmehr ein negativer Grundsatz im Gebrauche seines Erkenntnisvermögens ist […] Sich seiner eigenen Vernunft bedienen will nichts weiter sagen, als bei allem dem, was man annehmen soll, sich selbst fragen: ob man es wohl tunlich finde, den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem, was man annimmt, folgt, zum allgemeinen Grundsatze seines Vernunftgebrauchs zu machen?“407 Obzwar die Bestimmung der Vernunft durch eine Maxime der Aufklärung eher den praktischen als den theoretischen Vernunftgebrauch im Sinne hat, so daß auch hier die Einheit der Vernunft unterbelichtet bleibt, deutet sie doch genugsam auf die gemeinsame Basis des Vernunftgebrauchs hin: auf das begriffene Allgemeine. Dieses bestehe in zwei verschiedenen Formen der Erkenntnis a priori. Am Schluss der „transzendentalen Elementarlehre“ der Kritik 405 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademie-Ausgabe, S. 389, 2.Abs. Ebd., S.393 und 402 f. 407 I. Kant, Was heißt: sich im Denken orientieren?, A 330. 406 171 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie der reinen Vernunft, im Kapitel über „das Ideal der reinen Vernunft“ begnügt sich Kant, wie er betont, mit folgender Bestimmung: Das begriffene Allgemeine trete in zwei Formen des Vernunftbegriffs auseinander: in den theoretischen, „durch den ich a priori (als notwendig) erkenne, daß etwas sei, und [in den] praktischen, durch den a priori erkannt wird, was geschehen solle.“408 Dort, wo er den kritischen Charakter der Vernunft herausarbeitet und ihn (in der das Hauptwerk beschließenden „transzendentalen Methodenlehre“) abhebt von einer dogmatischen Methode, die bisher geherrscht habe, nimmt er auch eine interne Ethik und Politik der Vernunft an. Das Verfahren der Vernunft fordere von den Vernunftsubjekten ein sokratisches Ethos, die Bereitschaft zu Kritik und Selbstkritik. Von dieser subjektiven Bedingung unterscheidet Kant eine objektive, politische und rechtliche Existenzbedingung der Bedingung: Keine Existenz der Vernunft ohne persönliche Freiheit und freie Öffentlichkeit in der Gesellschaft, also ohne den Rechtszustand und Friedenszustand einer Republik, in der Meinungsfreiheit und Publikationsfreiheit herrschen: „Die Vernunft muß sich in allen ihren Untersuchungen der Kritik unterwerfen, und kann der Freiheit derselben durch kein Verbot Abbruch tun, ohne sich selbst zu schaden und einen ihr nachteiligen Verdacht auf sich zu ziehen. Da ist nun nichts so wichtig in Ansehung des Nutzens, nichts so heilig, daß [es] sich dieser prüfenden und musternden Durchsuchung, die kein Ansehen der Person kennt, entziehen dürfte. Auf dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondern deren Ausspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger [sucht], deren jeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein veto ohne Zurückhalten muss äußern können.“409 Welchen Stellenwert und welchen Verpflichtungssinn hat diese Überlegung und hat ihr Resultat? Moderne Interpreten, die sich diese Frage stellen, könnten zu zwei ganz unterschiedlichen Antworten kommen: je nachdem, welchen Geltungssinn sie der Vernunft beimessen. Ob sie die Geltung dieses Denkmediums und Vermögens der Vernunft als gänzlich abhängig von einer beliebigen subjektiven Entscheidung ansehen, sich seiner zu bedienen oder nicht zu bedienen, oder ob sie die Vernunft und den eigenen Gebrauch der Vernunft als zugleich logisch notwendige und moralisch gehaltvolle Voraussetzung dafür ansehen, überhaupt etwas als Argumentationsbeitrag anderen gegenüber verständlich und geltend zu machen – eine These oder einen Anspruch. Denn davon hängt es ab, wie sie das „Müssen“ verstehen, nämlich als „hypothetischen“ oder als „kategorischen Imperativ“, wonach Kant den Gebrauch von „Müssen“ unterscheidet. Handelt es sich hier um die 408 409 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 633 / B 661. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 738f. / B 766f. 172 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Konsequenz einer beliebigen Entscheidung oder aber einer Entscheidung, für die allgemeingültige Gründe sprechen? Im ersten Fall (I) blieben wir als Subjekte, die den Anspruch auf Verständlichkeit bzw. Intersubjektivität haben, als Intersubjekte sozusagen, unberührt davon, ob wir uns für oder gegen die Anwendung von Vernunft entscheiden würden. Dann hat die Wahl selbst, die Entscheidung, überhaupt nichts mit Rationalität zu tun; vielmehr ist sie eine bloße Wahl, eine beliebige und zufällige Entscheidung, die man so oder auch anders treffen mag: als würfelte man. Der Entscheidungsakt ist willkürlich, ist arational. Allerdings weiß man, daß die Wahl Konsequenzen hat. Man weiß ja, daß „Vernunft“ etwas bedeutet; wie man die Grammatik anderer Sprachspiele kennt, so auch die des vernünftigen Verhaltens, nämlich konsistent, kritisch bzw. selbstkritisch und konsensbereit zu verfahren. Im letzteren Fall (II) aber, wenn es nicht nur allgemeinverständliche, sondern allgemeingültige und moralische Gründe für die Wahl des Mediums Vernunft gibt, begäben wir uns in Widerspruch zu uns als rationalen Intersubjekten, genauer: als anerkannten Teilnehmern an dem ‚Sprachspiel’ der Vernunft – wenn diese ‚schiefe’ Redeweise hier einmal erlaubt ist, weil Vernunft kein Sprachspiel unter anderen ist, sondern eine Bedingung der Möglichkeit, Sprachspiele zu unterscheiden, sie zu spielen und zu beurteilen – und damit als Partnern der moralischen Gemeinschaft der Vernünftigen. Wenn es nämlich allgemeingültige und moralische Gründe für die Entscheidung, vernünftig zu verfahren, gibt, dann könnten wir eine Perspektive, eine Praxis, die der Vernunft zuwiderliefe, nicht ernsthaft verteidigen, sondern müssten uns selbst widersprechen. Wir handelten dann wider besseres Wissen, jedenfalls gegen das uns mögliche Wissen. Damit kassierten wir den eigenen Anspruch, wir selbst zu sein (Identität), und als wir selbst verständlich zu sein (Intersubjektivität). Denn wir kassierten unseren vorgängigen Anspruch, anerkannter Partner in der umgreifenden Vernunftgemeinschaft sein zu können, also ein „Ich II“. Inwiefern? Wir missachten die Allgemeingültigkeit der Vernunft (wider mögliches besseres Wissen) und stellten uns den anderen nicht als Vernunftpartnern zur Verfügung, und achteten sie nicht als unsere Partner: als Kritiker und freie gleichberechtigte Teilnehmer an der Suche nach Wahrheit und Richtigkeit. Im ersten Fall (I) interpretiert man Kant so, als ginge es hier um hypothetische Imperative, um Ratschläge der Klugheit, also zweckrationale Direktiven der Art: ‚Wenn du „Vernunft“ als deinen Oberzweck gewählt hast, dann mußt du folglich auch (1) bereit sein zur Kritik, Selbstkritik und Konsenssuche, und 173 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie (2) mußt du dann für freiheitliche Rechtsverhältnisse Sorge tragen! Andernfalls wärest du dumm, und semantisch unverständlich, nämlich (hinsichtlich deiner Entscheidung) formallogisch widersprüchlich.‘ Das wäre die liberalistische, dezisionistische und vom Kritischen Rationalismus vertretene Anknüpfung an Kant. Im letzteren Fall (II) liest man Kant hier sogleich im Hinblick auf kategorische Imperative: ‚Du sollst unbedingt deine Thesen und Handlungsorientierungen (1) der Kritik unterwerfen und du sollst unbedingt (2) für freiheitliche Rechtsverhältnisse Sorge tragen!’ Wer so interpretiert, der steht vor dem Begründungsdesiderat der Letztverbindlichkeit dieses Imperativs der freien kritisch öffentlichen Vernunft. Der müßte, sei es aus Kants Texten, sei es aus eigener Kraft demonstrieren können: Die Wahl der kritischen Vernunft ist nicht irrational oder willkürlich, für sie sprechen vielmehr unwiderlegliche Gründe. D.h. sie ist eine argumentativ unhintergehbare Wahl, weil einzig diese Entscheidung in einem argumentativen Dialog mit guten Gründen verteidigt werden kann, so daß alle Vernunftsubjekte sie als die richtige und zustimmungswürdige Wahl anerkennen, mithin ihre praktischen Implikationen auch als moralisch verbindliche Orientierungen befolgen würden. Das Begründungsproblem der Vernunft löst Kant bekanntlich nicht. Eine transzendentale Deduktion der praktischen und in ihrem moralischen Verpflichtungssinn einsehbar verbindlichen Vernunft hält Kant seit seiner Kritik der praktischen Vernunft für ebenso unmöglich wie unnötig. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten nahm er noch an, es als allgemeingültig erweisen zu können. In der Folge der Kritik der praktischen Vernunft zieht er sich jedoch zurück: es ist nicht möglich, es ist aber auch nicht nötig, es als allgemeingültig zu deduzieren. Als Bedingung der Möglichkeit müssen eindeutig alle die Erfahrung mitbringen. Das Programm ist, transzendental zu denken: objektivierende Erfahrung, die den Siegeszug der Naturwissenschaften ermöglichte. Ohne wüßten wir nicht, wie die Welt funktioniert. Das Moralprinzip gehört zur Autonomie. Zur Freiheit des Vernunftwesens gehört es, dieses Prinzip zu erkennen. Objektivität bedeutet kausale Notwendigkeit als Natur, als Dasein, das Dinge nach Naturgesetzen tut, aber keine Freiheit. Eine Begründung ist nicht nötig, wäre vergebliche Liebesmüh. Es gilt das Faktum der reinen praktischen Vernunft: wir setzen für uns alle Freiheit, Autonomie und Moral voraus. Am Beispiel des Gewissens zeigt sich das Faktum der praktischen Vernunft. Kant zeigt im Ersten Abschnitt der Grundlegung 174 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie zur Metaphysik der Sitten, daß es eine allgemeine Tendenz zur praktischen Vernunft gibt, im common sense, das intuitives Wissen vorhanden ist, ernsthaftes Wollen. Legitim ist nur, was Du auch als Allgemeingesetz wollen kannst. Partikularität kann nicht als moralisches Gesetz angesehen werden. Kant schreibt den „Donnersatz“ (Jonas): „Es ist überall nichts in der Welt [...], was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.“ Ein guter Wille, der den Eigennutz am Verallgemeinerbaren mißt und nach diesem strebt. Warum wir diesen guten Willen aufbringen sollten, warum es nicht auch einen vernünftigen, intelligenten Nazi geben sollte, daß eine Letztbegründung des Moralischseins nötig sein sollte, ist nach Kant nicht nötig, da die Tendenz dahin offensichtlich ist. Ein harter Rückzug, dieser Verzicht auf eine Letztbegründung. Daher konnte in der Moderne die dezisionistisch-liberalistische Auffassung dominieren - und mit ihr die Voraussetzung (oft als stillschweigende Annahme): Vernunft bzw. Rationalität ist nicht aus sich heraus praktisch verbindlich, sie ist lediglich eine Art Kalkül (Hobbes), ein Rechnen, eine bloße Zweck- und formelle Rationalität. So haben wir es schon von Hobbes gehört, der den Rationalitätsbegriff mit einer instrumentalistischen Auffassung von Sprache und Kommunikation verbindet. Vernunft wäre also nur ein pures kognitives Instrumentarium, für alles und jedes einsetzbar. Das ist die Auffassung des modernen Mainstreams. In Berlin ist sie am scharfsinnigsten tendenziell von Ernst Tugendhat vertreten worden.410 6.5.1 Verallgemeinerbarkeitstest als Weg zur Verbindlichkeit. Wir hatten gesehen, daß die moderne Ablösung des metaphysisch-teleologischen Naturbegriffs durch einen quantitativen Naturbegriff, der Natur als messbar versteht, zur Lehre vom naturalistischen Fehlschluß führt. Kant ist eine Hauptstation auf diesem Wege. Er unterscheidet im Anschluss an Hume das, was bloß ist, strikt von dem, was würdig ist, getan werden zu sollen. Diese Unterscheidung steht am Anfang seiner Lehre von der praktischen Vernunft. Und das zu Recht. Warum zu Recht? Aus drei Gründen: 1. Praktische Vernunft, die ihrem Begriff gerecht wird, muß den Rahmen für eine Handlungsorientierung abgeben, welche die möglichen Akteure autonom einsehen 410 E. Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt a.M. 1993: „Das plausible Moralkonzept“, S. 85ff (97-79), bes. S. 88 ff und 85ff. 175 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie und frei anerkennen können. So nämlich, daß die praktische Vernunft, aus der der gute Wille eine jeweilige moralische Maxime bzw. Richtschnur gewinnen kann, diese Autonomie zur ersten Voraussetzung hat: Sie beruht auf „der Idee der Würde eines vernünftigen Wesens, das keinem Gesetze gehorcht, als dem, das es zugleich selbst gibt“.411 In diesem Sinne bestimmt Kant auch den Kategorischen Imperativ, der zugleich Geltungskriterium und Grundnorm des Moralischen ist, als „das Prinzip der Autonomie des Willens.“412 Das Prinzip bestehe nämlich darin, „keine Handlung nach einer anderen Maxime zu tun als so, daß es auch mit ihr bestehen könne, daß sie ein allgemeines Gesetz sei, und also nur so, daß der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemeingesetzgebend betrachten könne.“413 2. Praktische Vernunft muß den Rahmen für begründete Verbindlichkeiten resp. Pflichten abgeben und daher den Begriff von Verbindlichkeit im Sinne uneingeschränkter Befolgungsgültigkeit zum metaethischen Bezugsbegriff machen. Das bedeutet ein Paradigmenwechsel, nämlich von der bis dahin vorherrschenden aristotelischen Ethik der Natur des Menschen und des vermeintlich Natürlichen, Guten und des lebensweltlich für gut Gehaltenen hin zu einer strikt normativen Ethik als „einer reinen Moralphilosophie“414 oder, was dasselbe ist, im Sinne einer Rekonstruktion der reinen praktischen Vernunft. Damit führt Kant gegen die bis dahin herrschende aristotelische Tradition (Aristoteles: alles strebt von Natur aus zum Guten) einen neuen Moralbegriff ein, so daß als moralisch nunmehr allein dasjenige gilt, was „als Grund einer Verbindlichkeit“ anerkennungswürdig ist. Diese traditionsstürzende Moraldefinition kann er in der Vorrede der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten als so evident ansehen, daß er sie schlicht im Nebensatz einführt: „Jedermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn es moralisch, d.i. als Grund einer Verbindlichkeit, gelten soll [...]“415 In dieser kleinen Bestimmung sagt er schon das Entscheidende: moralisch ist nur das, was den Grund einer Verbindlichkeit mit sich führt. Moralisch ist eine Pflicht, wenn wir einen zureichenden Grund für ihr striktes praktisches Geltensollen angeben können. Eine solche Begründung ist, logisch gesehen, strikt allgemein und also in ihrer Gültigkeit unbeschränkt: Weder duldet sie Ausnahmen hinsichtlich des Adressatenkreises, noch kann sie von besonderen Fakten und Naturbeschaffenheiten abhängig gemacht werden. Sie ist für alle 411 I. Kant, GMS, Akad. A, S. 434. Ebd., S. 433. 413 Ebd., S. 434. 414 Ebd., S. 381. 415 I. Kant, GMS, S. 389. 412 176 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie möglichen vernünftigen Wesen als vernunftfähige Wesen gleichermaßen gültig. So lautet die Stelle im Zusammenhang: „Jedermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn es moralisch, d.i. als Grund einer Verbindlichkeit, gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse; daß das Gebot: du sollst nicht lügen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftige Wesen sich aber daran nicht zu kehren hätten, und so alle übrigen eigentlichen Sittengesetze; daß mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in der Natur des Menschen, oder den Umständen in der Welt, darin er gesetzt ist, gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich in Begriffen der reinen Vernunft, und daß jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet, […] zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann“416. Mit Kant weiterdenkend ließe sich ein dritter Grund anführen: (3) Jede mögliche Deutung ‚des Seins‘ überhaupt, dies war das Geschäft der Philosophie seit Alters her, ist eine spekulative Metaphysik, die sich nicht rational prüfen läßt. Jede Kausalerklärung eines natürlichen Zusammenhangs, die eine Naturwissenschaft leistet, und ebenso jede Interpretation von Umständen der Welt des Menschen hat nur den Stellenwert einer falliblen Theorie bzw. einer Interpretation, die mehr oder weniger fehlgehen kann. All diese Wege führen also nicht zur Einsicht in Verbindlichkeit, zu praktischer Vernunft. Da praktische Vernunft aber nichts anderes sein kann als eben der Weg zu einsehbarer Allgemeinverbindlichkeit, also zu etwas, das absolut soll gelten und orientieren können, revolutioniert Kant die Moralphilosophie. Er löst sie aus der antiken und scholastischen Metaphysik, zudem aus aller Kosmostheorie oder Theorie der Menschenwelt heraus. Er fragt nurmehr nach den Bestimmungsgründen unseres Willens, um zu klären, welche davon einsehbar verbindlich sind.417 Kants Ethik zielt also, ebenso unaristotelisch wie antihobbesianisch, strikt auf das praktisch Verbindliche (nicht etwa auf das Zweckdienliche, wenn ich nur mit Nützlichkeit argumentiere (Hobbes), dann könnte jemand sagen, wenn ich unbeobachtet bin, wäre es irrational, wenn ich den Vertrag nicht breche: hier gibt es keine Verbindlichkeit), das ein Mensch, insofern er ein vernünftiges Wesen ist, als allgemeingültige Handlungsregel selbst wollen können muß, so nämlich, daß er mit sich selbst (als fiktivem Gesetzgeber) in Übereinstimmung bleibe: „Der kategorische Imperativ, der überhaupt nur aussagt, was Verbindlichkeit sei, ist: handle nach einer Maxime, welche zugleich als allgemeines Gesetz gelten kann. - Deine Handlungen mußt du also zuerst nach ihrem subjektiven Grundsatze betrachten: ob aber dieser Grundsatz auch objektiv gültig sei, kannst du nur daran erkennen, daß, weil deine Vernunft ihn 416 417 I. Kant, GMS, S. 389. I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 29. 177 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie der Probe unterwirft, durch denselben dich zugleich als allgemein gesetzgebend zu denken, er sich zu einer solchen allgemeinen Gesetzgebung qualifiziere.“418 Hier haben wir Kants Gedankenexperiment der praktischen Vernunft vor uns. Der kategorische Imperativ gibt die Regel zur Durchführung dieses Gedankenexperiments an. Es besteht in einer „Probe“ (einem kritischen Test) der subjektiven Willensregel, eine Handlung tun oder lassen zu sollen und zu wollen. Der Maßstab, anhand dessen geprüft wird, ist die widerspruchsfreie Verallgemeinerbarkeit des von mir Gewollten. Kants moralisches Prüf-Verfahren ist also der Verallgemeinerungstest einer Maxime des Willens bzw. der Gesinnung. Das Geltungskriterium des Testverfahrens lautet: >Taugt eine Maxime für die moralische Gesetzgebung in der idealen Gemeinschaft aller vernünftigen (logos-fähigen) Wesen, dem „Reich der Zwecke“? < Dieses Verfahren gilt Kant als in doppelter Hinsicht praktisch vernünftig: 1. Es folgt einer argumentativ unbestreitbaren, daher schlechthin intersubjektiven – bei Kant freilich „objektiven“ – und deshalb (im diskursbezogenen Sinne) vernünftigen Regel zur Prüfung der Gesinnung, genauer: zur Prüfung „der Maximen des Willens”, die sich eine Person bewusst setzt – oder zumindest bewusst machen kann, wenn sie sie übernommen hat (weil nur dann das Handeln „willentlich“, also moralisch zurechenbar ist).419 2. Es soll vernünftige Maximen zur Folge haben: das wären Handlungsregeln, die als allgemeine moralische Gesetze („in einer bestimmten Situation (S) soll jeder nach der Maxime M handeln“) gerechtfertigt werden können. Vor wem? Vor dem unbegrenzten Forum aller vernünftigen Wesen, worin auch ein jeder Mensch seine Stimme hat, insofern er sich selbst der praktischen Verallgemeinerungsregel unterwirft (und nicht etwa sein bloßes Eigeninteresse durchzusetzen versucht). Dieses Forum praktischer Vernunft postuliert Kant als ein ideales „Reich der Zwecke” und der Autonomie. Die Autonomie versteht sich negativ als Unabhängigkeit der Vernunft sowie des Vernunftsubjektes von argumentationsfremden Instanzen (Macht, Attraktivität etc.), positiv als Selbstbestimmung aus verallgemeinerbaren Gründen. In der Grundlegung zur „Metaphysik der Sitten“ gewinnt Kant für die Ethikbegründung eine qualitativ neue Reflexionsebene, indem er „den Grund der Verbindlichkeit” sittlicher 418 419 I. Kant, Metaphysik der Sitten, Akad.-Ausg., S. 225. I. Kant, GMS, A 225. 178 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Gesetze weder in dem Faktum eines Naturzustandes oder einer Naturgeschichte der Menschengattung noch in dem Faktum einer sozialvertraglichen Übereinkunft von Bürgern sucht, sondern im Gedanken einer idealen Gemeinschaft der Vernunftwesen zur freien Setzung und vernünftigen Prüfung der Zwecke. Damit hat er ein altes theologisch ethisches Motiv, welches wie die Gnosis und die jüdische Apokalyptik zwei einander entgegengesetzte Welten annimmt, die reale, sinnlich irdische und eine ideale lichtvoll göttliche Welt, moralphilosophisch beerbt – ein ebenso fruchtbares wie heikles Erbe. Die Konvergenz einer Willensmaxime als realer Handlungsweise mit der Gesetzgebung in der idealen Welt setzt er als Geltungskriterium für das „praktisch Gute” an. Problem- und begriffsgeschichtlich gesehen, begegnen wir hier der spekulativeschatologischen, auf Augustinus' Begriff der „civitas dei” zurückgehenden, Idee einer „Welt vernünftiger Wesen (mundus intelligibilis) als eines Reichs der Zwecke” (438)420. Kant definiert diese ideale Vernunftgemeinschaft als „die systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen” allein aufgrund solcher Gesetze (433), die würdig sind, als praktisch gut zu gelten, weil sie in eben dieser Gemeinschaft hinsichtlich universalisierbarer Gründe anerkannt würden. „Praktisch gut ist [...], was vermittelst der Vorstellungen der Vernunft, mithin [...] aus Gründen, die für jedes vernünftige Wesen als ein solches gültig sind, den Willen bestimmt” (413). Hier wird erstmals formuliert, was ein praktischer Diskurs, als argumentative Suche nach dem praktisch Vernünftigen und daher Verbindlichen in der Gemeinschaft der Argumentierenden, als Geltungskriterium voraussetzt, was aber in der Tradition als natürliches Gesetz, als naturgemäße Zielbestimmung des Menschen interpretiert worden war. Denkt Kant den normativen Gehalt der regulativen Idee einer universalen, reinen Argumentationsgemeinschaft? Nimmt er das dialogische Rechtfertigungsprinzip und die regulative Geltungsidee einer idealen Kommunikationsgemeinschaft in metaphysisch-theologischen Begriffen vorweg? 6.5.2 Recht und Grenze einer idealistischen Vernunftethik in dualistischem Rahmen 420 Die in den Klammern stehenden Seitenzahlen verweisen auch im Folgenden auf I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Akademie-Ausgabe). 179 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist schwer zu finden. Einerseits kann er dank jenes metaphysisch-theologischen Rückgriffs den notwendigen idealen Bezugsrahmen einer eindeutig normativen Ethik in die Philosophie bringen, die unverrückbar kontrafaktische Beurteilungsinstanz aller faktischen Antriebe und Orientierungen – die reine Vernunftgemeinschaft eines Reichs der freien Zwecksetzung und Zweckprüfung. Andererseits kann er wegen des dualistischen Hintergrunds dieses Rückgriffs – hier die unfreie, naturgesetzlich determinierte reale Welt der Erscheinungen samt den Bedürfnissen und Neigungen der Menschen, dort das freie, moralisch autonome Reich der vernünftigen Wesen – überhaupt nicht verständlich machen und einholen, worauf es ihm damit ankommt: Erstens will er eine Gemeinschaft „verschiedener [mithin unterschiedliche Intentionen haben könnende] vernünftiger Wesen“ denken, die ein Interesse an Gemeinschaftsbildung, an Gerechtigkeit etc. haben421, weil sie Interessenkonflikte kennen und eine moralische Konfliktlösung (in solidarischer Gemeinschaft) suchen (433). Zweitens will Kant die Beziehung einer solchen moralischen Gemeinschaft als regulativer Geltungs- und Kritik-Instanz auf die reale Sozialwelt der vor- oder auch nonmoralischen „Gefühle, Antriebe und Neigungen“, der „Marktpreise“ usw. denken (434f). Diese Beziehung erhält aber nur dann den Sinn (Funktion) einer kritischen Orientierung für Menschen, welche in der vor- bzw. nonmoralischen Welt moralisch handeln wollen, wenn sie verantwortungsethische Strategien freigibt, ja den Rahmen für die Entwicklung und Prüfung solcher strategischer Konfliktlösungsmittel darstellt. Das jedoch ist nicht der Fall, weil Kant gar keine Vermittlung jener beiden Welten, des metaphysischen „Reichs der Zwecke“ und der realen natürlichen Bedürfnis- sowie Interessen- und Markt-Welt denkt resp. denken kann. Drittens gelangt Kant eigentlich gar nicht zu einem Begriff von Gemeinschaft, weil er deren Glieder nicht als verbunden durch lebensweltlich kommunikative Erfahrung ansieht, sondern als autarke, einsame Vernunftsubjekte. Sein dualistisches System – hier Dinge der Natur, die nach allgemeinen Gesetzen wirken, da vernünftige Wesen, die „nach der Vorstellung der Gesetze, d. i. nach Prinzipien“ handeln können (412) – hat für die sprachliche Verständigung und den kommunikativen Diskurs interessierter Menschen, leibhafter Wesen, keinen logischen Ort.422 Der Handlungsbegriff löst sich bei Kant auf. Freilich setzt Kant ein kommunikatives Verbundensein der Menschen in der Lebenswelt, ein universales Sich-Verständigenkönnen in moralischer Hinsicht über moralische Konflikte voraus. Ja, er baut seine Ethik in gewisser Hinsicht auf dieser Vorraussetzung auf. Denn er 421 Dazu W. Kuhlmann, Solipsismus in Kants praktischer Philosophie und die Diskursethik. In: Ders., Kant und die Transzendentalpragmatik, Würzburg 1992, S. 100-130, bes. 107 ff, 116 ff. 422 Dazu D. Böhler, Rekonstruktive Pragmatik, S. 256 ff und 296-306, vgl. S. 23f und 55-64. 180 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie rekonstruiert ihren normativ ethischen Ansatzpunkt insofern aus dem „gemeinen Menschenverstande“, also dem sensus communis bzw. common sense, als jeder diesen kraft seines Überlegens in der Lebenswelt, d.h. ohne der „Wissenschaft und Philosophie“ zu bedürfen (S. 404), zum Verallgemeinerungs-Standpunkt, dem Standpunkt der Moral, entwickeln könne. Und man kann hinzufügen – wir haben das durch Rückgang auf die Tendenz zum moralischen Universalismus im Geist der Achsenzeit (Kapitel I.3 und I.4.1 mit Einführung einer Urteilsstufe 5 ½ ) bereits getan – daß sich eine solche Entwicklung auch im objektiven Geist der Lebenswelt geschichtlich verkörpert hat: in Form des Dekalogs, des Bundesgedankens, der Ethik der Propheten und interkulturell in Form der „Goldenen Regel“, deren universalistische Tendenz – mehr als eine solche bietet sie freilich nicht – Kant jedoch nicht würdigt (S. 430, Fußnote). Kants Rekonstruktionsbasis ist jedenfalls die vorphilosophische „gemeine Menschenvernunft“, die gemeine sittliche Vernunfterkenntnis, die „aus praktischen Gründen“ bis zum vernünftigen, moralischen „Prinzip des Wollens“ gelange, dem kategorischen Imperativ (400ff). Darum geht es im „Ersten Abschnitts“ der Grundlegungsschrift. Ohne dieses lebensweltliche Fundament eines sich über das Moralprinzip Verständigenkönnens hinge der Geltungsanspruch, die Intersubjektivität, seiner normativen Ethik in der Luft. Der Bau seiner Moralphilosophie stürzte in sich zusammen. Aber Kant holt diesen stillschweigend intersubjektivistischen Ansatz nicht in sein System ein. Trotz dieser starken intersubjektivitätstheoretischen Voraussetzungen – und darin liegt der Hauptwiderspruch – bleibt sein System der Ethik, bleiben das Selbstverständnis und die Methode des Moralphilosophen Kant an das Paradigma des einsamen Subjekts gebunden. Nimmt er doch an, man könne einsam und allein, durch Anwendung des „Kategorischen Imperativs”, moralisch relevante Situationen vernünftig beurteilen, ohne daß man – nach Möglichkeit – einen Diskurs mit den Anderen führen oder (wenn sie direkt nicht da oder auch nicht bereit zum Diskurs sind) die Kommunikation mit ihnen doch hypothetisch vorwegnehmen sollte, mit denen also, die in die Situation verstrickt sind bzw. unter den Folgen leiden können, die das Verhalten gemäß der jeweiligen Maxime mit sich bringt. Kants Ethikbegründung ist, wie wir jetzt gesehen haben, in mancherlei Hinsicht zwiespältig, sprich widersprüchlich. Eine Hinsicht möchte ich noch eigens herausstellen: den Zwiespalt zwischen dem intersubjektiven Geltungsrahmen des „Reichs der Zwecke“ als Gemeinschaft der vernünftigen Wesen und dem subjektbeschränkten Gegenstand des einzelnen Willens. 181 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie - Als Vernunftethik, die ein a priori notwendiges Prinzip der Moral für alle Vernunftwesen rekonstruiert, ist Kants Moralbegründung universal gemeinschaftsbezogen, - während sie sich als Gesinnungsethik als Ethik des Willens, die die moralische Urteilsbildung des einzelnen auf dessen Willensbestimmung beschränkt, auf ein solus ipse (ein einsames alleiniges Selbst) bezieht. Die Vernunftethik, die ein letztes Kriterium zur Begründung einer allgemeinen Verhaltensnorm („Prinzip der Moral", „Sittengesetz") sucht, bezieht sich auf die Idee einer reinen praktischen Vernunftgemeinschaft und unterstellt dabei das dialogische Prinzip der uneingeschränkten Reziprozität der vernünftigen Wesen als „moralischer Gesetzgeber”, das heißt als Argumentierender, die mittels Verallgemeinerung Handlungszwecke und Normen kritisch prüfen und moralische Maximen begründen (434). Hierbei setzt Kant stillschweigend die volle dialogische Reziprozität voraus: die Wechselseitigkeit von Anspruch und Eingehen auf den Anspruch im gemeinsamen Medium der Argumentation, also in Form von Geltungsansprüchen. Denn sie ist es, die eine „systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen“ durch Prüfung und Anerkennung „gemeinschaftliche[r] Gesetze“ (433) allererst ermöglicht. Als Gesinnungsethik, die den moralischen „Wert“, das praktisch uneingeschränkt Gute in dem „guten Willen” einer Person lokalisiert (393f.), bestimmt Kant aber die praktische Vernunft nicht als gemeinschaftsbezogene dialogische Metapraxis, die sich in Diskursen vollzieht und dabei eine ideale Beurteilungsgemeinschaft vorwegnimmt, sondern als einsames Vermögen des autonomen, vernünftigen Willens, nach der Vorstellung universalisierbarer Gesetze zu handeln (412) (eine Vorstellung braucht keine Kommunikation) und auf diese Weise (derweise) den je eigenen Willen von seiner „natürlichen Dialektik“ zu reinigen, von dem „Hang, wider jene strengen Gesetze der Pflicht zu vernünfteln“ (405). Dieser Ansatz, den Gehlen, obzwar polemisch, so doch nicht zu Unrecht, als die Fiktion kritisiert hat, man könne „die Normen des Verhaltens aus der eigenen Brust ziehen“, geht von Voraussetzungen aus, die es erlauben, ihn als „methodisch-solipsistischen Ansatz” zu charakterisieren. Denn vorausgesetzt ist hier: Einer allein kann eine Handlungssituation, ohne Kommunikation über den Sinn und die Verallgemeinerbarkeit der Interessen anderer, nur anhand des kategorischen Imperativs moralisch richtig beurteilen und eine „praktisch gute“ Maxime für das Handeln durch einsame, unmittelbare Anwendung des kategorischen Imperativs auf die Situation ableiten. 182 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Kants Ansatz blendet den dialogischen Bezug der ethischen Urteilsbildung von vornherein aus: Weder führt er - i.S. einer Explikation des Aristoteles - für den Normalfall einer Anwendung gegebener Normen das pragmatisch-dialogische Klugheitskriterium der Situationsgerechtigkeit bzw. „Billigkeit“ ein, das ist das Problem eines Richters: eine allgemeine Regel auf eine konkrete Situation anzuwenden, einen hermeneutischen Zirkel zu durchlaufen, um sowohl der Norm als auch der Situation angemessen zu urteilen, noch entwickelt er für die kritischen Fälle einer Abwägung zwischen widerstreitenden moralischen Normen oder einer Ausschließung von Betroffenen aus dem realen Diskurs ein dialogisches Rechtfertigungsprinzip – ein Prinzip, das der tragende Grundsatz wäre sowohl zur vernünftigen Lösung von Normenkonflikten mit den Beteiligten und Betroffenen als auch zur Auszeichnung einer legitimen verantwortungsethischen Strategie gegen nonmoralische Akteure bzw. Mächte, die z.Zt. nicht am Diskurs teilnehmen dürfen, weil ihre Beteiligung unverantwortlich gegenüber Dritten wäre. Ein solcher Grundsatz – es wäre der eine Grundsatz praktischer Vernunft oder das Diskursprinzip – würde etwa lauten müssen: Nur die Handlungsweise kann als moralisch gelten, die auch hinsichtlich ihrer Folgelasten bzw. ihres möglichen adialogischen Strategiecharakters in einer idealen Argumentationsgemeinschaft s o verteidigt werden kann bzw. könnte, daß sie uneingeschränkt intersubjektive Anerkennung aus guten Gründen fände. Wir hatten (in Abschnitt 4.2. von Teil I) mit Blick auf Dietrich Bonhoeffer und den heranwachsenden Michael Degen einen Normenkonflikt zwischen Wahrhaftigkeit und Lebensschutz unter moralrestriktiven Handlungsbedingungen, die eine verantwortungsethische Strategiebildung mit Ausschließung Beteiligter und Betroffener aus dem aktuellen Diskurs nahelegten, eingehend verantwortungsethischen diskutiert. Orientierung Dabei haben hinsichtlich der wir das möglichen Erfordernis einer Folgelasten eines gutgemeinten, gesinnungsethisch lauteren Handelns erkannt. Mußten wir doch einsehen, daß man sich in der realen Sozialwelt gerade dann, wenn man seine Handlungsweise angesichts möglicher Folgelasten sub specie der moralischen Rechtsansprüche Betroffener soll rechtfertigen können, sich nicht vorbehaltlos verständigungsorientiert und unmittelbar wahrhaftig verhalten darf, sondern auch verdeckt strategisch agieren muß. In großem Maßstab gilt das, wie Max Weber in Bezug auf Machiavelli hervorgehoben hat423, für das politische Handeln - und zwar sowohl unter den „üblichen” Bedingungen der Parteienkämpfe im 423 M. Weber, Politik als Beruf. In: Gesammelte politische Schriften. Mit einem Geleitwort von Th. Heuß hrsg. von J. Winckelmann, Tübingen ³1971, S. 558. 183 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Rechtsstaat und der internationalen Interessenkämpfe zwischen Staaten im Frieden als auch unter den extremen Ausnahmebedingungen eines Unrechtsstaates. Jene Einsicht hat manche Christen im „Dritten Reich” motiviert, Eide zu brechen, zu lügen, ja zu morden, nämlich den Mord an Hitler vorzubereiten bzw. zu versuchen. Man denke an Dietrich Bonhoeffer und Klaus Graf Schenk von Stauffenberg.424 Aber ein moralstrategisches Handeln ist - geltungsmäßig - keineswegs methodisch einsam sondern durchaus dialogisch strukturiert. Denn es kann unter Bedingungen einer reinen Argumentationsgemeinschaft gegenüber allen begründeten Einwänden durch Güterabwägung kommunikativ-diskursiv gerechtfertigt werden: als Handeln, das einer moralischen Strategie folgt, die als solche nicht unmittelbar auf Übereinkunft mit allen Beteiligten und Betroffenen gründet, sondern diese (mehr oder weniger) ausschließt und darüber hinaus „um des Nächsten willen Schuld übernimmt” (Bonhoeffer). Die Nächsten waren hier alle, die noch Hitlers Opfer hätten werden können. Ein Hauptgrund für das Verantwortungsdefizit in Kants Ethik scheint mir zu sein, daß er die Frage, was wir tun sollen, auf die neuplatonisch-christliche Frage zurückführt, wie die Herrschaft der Vernunft über die sinnlichen Begierden und Neigungen im Menschen praktisch werden kann. Kant versteht den Menschen – im Einklang mit seiner Zwei-Welten-Metaphysik und in der Tradition Augustinus’ sowie Luthers – als Doppelnatur: äußerlich ist er ein sinnliches Wesen, „knechtischen” Neigungen und dem Naturmechanismus unterworfen; innerlich kann er ein vernünftiges Wesen sein, das unabhängig von Neigungen nur der Vernunft folgt. Aufgrund dieser Voraussetzungen kann er das monologische Problem der Beherrschung des unteren durch das obere Seelenvermögen in der Seele des einzelnen in seinem Willen zu seinem ethischen Ausgangspunkt machen. Ein solches Ausgangsproblem führt nicht zu einer Ethik des Handelns hinsichtlich kommunikativ zu verstehender, zu beurteilender und sowohl recht als auch billig zu beantwortender Situationen, sondern zu einer personalen Moral der guten Gesinnung – eben durch Beherrschung der Sinnlichkeit des (Egoismus) „mit Bedürfnissen und sinnlichen Bewegursachen affizierte(n) Wesen(s)“ Mensch.425 Das philosophisch-ethische Schlüsselproblem heißt für ihn daher: Wie ist eine möglichst gute Gesinnung des einzelnen als eines Mitglieds des ‚Reichs der Zwecke‘ möglich? Kant, der den personalen Gott als das „Oberhaupt“ im Reich der Zwecke und den Schöpfergott als Oberhaupt des Naturreiches anerkennt,426 unterstellt zwar mit dem Gedanken der ethischen 424 Vgl. D. Bonhoeffer, Ethik, herausgegeben von E. Bethge, München 1961, S.190f. I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 32. 426 I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, A 433, A 439f. 425 184 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Urteilsbildung durch Anwendung des kategorischen Imperativs in gewisser Weise das dialogische Prinzip. Denn durch die Prüfung „meiner“ Maximen am kategorischen Imperativ als der Grundregel des Reichs der Zwecke beziehe „ich” mich indirekt auch auf dessen Oberhaupt, das allein einen „heiligen Willen” hat und deshalb diese Regel verkörpert, sowie auf alle anderen Glieder dieses Reiches. Aber diese dialogische Beziehung im Rechtfertigungsdiskurs ist nur eine weltabgewandte Beziehung der des guten Willens bzw. des Gewissens auf das „Reich der Zwecke”, die „mich” sowohl von einem Dialog mit anderen als vernunftfähigen realen Anderen, die ihre Bedürfnisse und Interessen als berechtigte Ansprüche an „mein” Handeln geltend machen würden, freistellt als auch von dem scheinbar schmutzigen Geschäft, einen Verantwortungsdiskurs über die jetzt ausgeschlossenen Betroffenen und Beteiligten zu führen, um eine moralische Strategie zu finden. Denn es geht in Kants Diskurs anhand des kategorischen Imperativs wesentlich um die Moralität der Person - also darum, wie „ich” einen guten Willen bzw. eine reine Gesinnung bekomme, die bereit ist, sich anzustrengen und handelnd „alle Mittel aufzubieten”. Kant will gewiß keine bloße Gesinnung. Aber er gelangt nicht zu einer diskursbezogenen Ethik mit Verantwortung für die reale Welt, welche auch die Bildung moralischer Strategien müßte anleiten und kontrollieren können. Für Kants Defizite will ich abschließend einige Gründe in Erinnerung rufen: 5) Aufgrund seiner Zwei-Welten-Metaphysik (innerhalb einer neuplatonisch-christlichen Tradition mit lutherischen Elementen) macht Kant die Herrschaft des guten Willens über die triebhaften Neigungen bzw. Bedürfnisse zum Schlüsselproblem. Dadurch wird der kategorische Imperativ vor allem zur Prüfung der persönlichen Absichten und zur Läuterung der Person wichtig. Er wird insofern auf den Bereich der Moral einer Person zurückgeschnitten. 6) Kants Argumentationen halten sich nicht durchgängig auf dem Niveau einer reflektierenden Vernunftethik, sondern fallen zum Teil dahinter zurück; und zwar dann, wenn er den kategorischen Imperativ nicht als Geltungskriterium für die Handlungsbeurteilung und damit als Metanorm für ein praktisches Diskursverfahren einsetzt, sondern ihn mit einem inhaltlichen („heiligen, unbedingt gebietenden“) Gebot verwechselt427 – einer konkreten Norm, wie wir sie aus der religiösen Gebotsethik („Du sollst nicht lügen“) kennen. 427 Vgl. I. Kant, „Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen“, GMS, Bd. VIII, S. 639; Akad.-Ausg., S. 427. Dazu: Marcus George Singer: Verallgemeinerung in der Ethik. Frankfurt 1975, S. 264 ff. und STE 4.2.2 185 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie 7) Kant verwendet den kategorischen Imperativ nicht konsequent als Metanorm zur Prüfung der „Verallgemeinerungsfähigkeit der Interessen“428 bzw. Wertpräferenzen, welche andere Menschen in ihren realen Lebenssituationen als Ansprüche an eine (sich einsam eine Maxime setzende) Person geltend machen können. Die im kategorischen Imperativ enthaltene Geltungs-Gegenseitigkeit bezieht er also nicht eigentlich auf die, erst zu verstehenden, Interessen bzw. Werte als mögliche Ansprüche der anderen, die von „meinem“ moralisch gemeinten Handeln nach der Maxime M betroffen werden können. 8) Aus dem im kategorischen Imperativ enthaltenen Prinzip der Geltungs-Gegenseitigkeit zieht Kant nicht die (notwendigen) Konsequenzen, - daß die monologische Gewissensprüfung des Einzelnen (anhand des kategorischen Imperativs) nur ein hypothetischer Ersatz des dialogischen Diskurses in Form einer Beratung und Diskussion ist, - und daß der Grund für die Geltung und Verbindlichkeit eines moralischen Gesetzes eben in der Idee eines – freilich diskursiven – „Reichs der Zwecke“ – das heißt aber, im Gedanken einer unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft Verschiedenartiger – liegt, deren Ansprüche als „Ansprüche der Vernunft“, d.h. als Geltungsansprüche zu diskutieren sind.429 9) Kant unterstellt offenbar – wie es die traditionelle Ethik (und Psychologie bzw. Anthropologie) seit Platon tut – einen ungeschichtlichen Begriff von menschlicher Natur und meint daher, es bedürfte keiner Verständigung über die Ermittlung des konkreten Sinns jeweiliger menschlicher Bedürfnisse, Interessen etc.430 Deshalb auch fällt bei ihm die dialogförmige Verständigungs-Gegenseitigkeit aus dem Moralprinzip heraus. Die Folge ist, daß er die prinzipiell einsame Anwendung des, als kategorischer Imperativ formulierten Moralprinzips für völlig problemlos hält – als wäre „mein“ Analogieschluß auf das Interesse bzw. den Wert der anderen überhaupt keine Fehlerquelle. Dann wäre allerdings eine Verständigung mit anderen überflüssig. 428 J. Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt 1973, S. 149 bis 161. G.H. Mead, Philanthropy from the Point of View of Ethics: In: A. Reck (Hrsg.): G.H. Mead, Selected Writings. Indianapolis 1964, S. 404. Zit. nach: H. Joas: Praktische Intersubjektivität. Frankfurt 1980, S. 135. 430 Vgl. Habermas, a.a.O., S. 124f. 429 186 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Abschließend möchte ich im Sinne der hier vertretenen kommunikationsphilosophischen, genauer: diskurspragmatischen, Gründung der Moral auf praktische Vernunft den über Kant hinausweisenden Hauptpunkt hervorheben: Um das Moralprinzip als verbindlich begründen und den, von ihm notwendig vorausgesetzten, Sinn der verallgemeinerbaren Gegenseitigkeit begreifen zu können, muß –gegen(über) Kant – gezeigt werden, daß es allein auf dem Boden möglicher Kommunikation als moralisches Gesetz gültig sein kann. Die kontrafaktische Vorwegnahme konsensualer Kommunikation in einer unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft ist die Geltungsbedingung eines moralischen Gesetzes. Auf der Basis einer ausgeführten diskurspragmatischen Reflexion, ihrer Unterscheidung von Verständigungs-Gegenseitigkeit und Geltungsgegenseitigkeit und ihrer realitätsbewußten Virtualisierung des Dialogs zumal mit nicht diskurswilligen bzw. diskursfähigen Beteiligten / Betroffenen läßt sich dieses Diskursprinzip begründen, und zwar zugleich als letzter Maßstab der Moral (als Geltungskriterium) und als moralische Grundnorm, als Norm, die mich verpflichtet. Ob resp. weshalb und inwiefern das Diskursprinzip auch die verbindliche Orientierung für die neuartigen(en) Menschheitsprobleme der Zukunftsverantwortung eröffnet – Probleme, die zu Zeiten des großen Kant noch nicht einmal erahnbar waren. 7.3 Welches sind die Sinnbedingungen des Verstehens und Erkennens? Charakteristische Antworten auf die transzendentalpragmatische Frage: Aristoteles, Tugendhat und Heidegger I versus W. von Humboldt, Wittgenstein II und Diskurspragmatik 187 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Nach intensiver Beschäftigung mit Aristoteles, in Marburger Vorlesungen und Seminaren, an denen zum Beispiel Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt und Hans Jonas teilgenommen haben, hat Heidegger in „Sein und Zeit“ eine quasi-transzendentale Analyse des EtwasVerstehens und alltäglichen Etwas-Erkennens gegeben, und er nennt diese Analyse ‚existenzial’, weil er die Seinsart der menschlichen Existenz selber als Verstehen dessen bestimmt, was dem Dasein in seiner Lebenswelt begegnet und was es darin zunächst wahrnimmt: das wahrgenommene Begegnende, zunächst die Gebrauchsdinge des Alltags, das ‚Zeug’, mit dem wir alltäglich umgehen und das uns in seiner Verwendungsweise von vornherein als etwas Bestimmtes erschlossen ist. Und insofern es uns im vorhinein ‚erschlossen’ ist, haben wir es bereits in seiner Bewandtnis bzw. in seiner praktischen Bedeutsamkeit verstanden. Unter ‚Existenzialität’ versteht Heidegger den Zusammenhang der Seinsstrukturen der Existenz. Heideggers existenziale Fragestellung soll die transzendentalphilosophische Frage Kants nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung und Erkenntnis eines Subjekts gewissermaßen aufheben. Denn Heidegger setzt nicht mehr bei einem Subjekt an, welches als ein Innen der Welt als einem Außen gleichsam cartesisch entgegengestellt wird.431 Sein Bezugsbegriff ist das verstehende Dasein verstehende Dasein, welches sich als verstehendes „immer schon“ in einer „erschlossenen“ Welt vorfinde: Als Dasein habe der Mensch seine Welt je schon verstanden. Darin sieht Heidegger das „apriorische Perfekt“ der Erschlossenheit von Welt.432 Hieraus ergebe sich, daß der Mensch nicht etwa wie ein Theoretiker der Welt als einem Gegenstand oder Gegenstandsbereich gegenüberstehe, sondern immer schon in der Welt sich befinde. Als Dasein sei der Mensch ein verstehendes und je schon Welt verstanden habendes „In-der-Welt-Sein“. Der phänomenologisch hermeneutische Ansatz von „Sein und Zeit“, den Heidegger als „Daseinsanalytik“ mit dem Status einer „Fundamentalontologie“ einführt,433 überwindet insofern die Subjekt-Objekt-Spaltung und den cartesischen Begriff der Welt als res extensa,434 als Inbegriff quantifizierbarer und sinnleerer Objekte, zu welchen der Mensch kein verstehendes Verhältnis sondern nur die äußerliche Relation einer Theorie und Technik habe. Heidegger reflektiert auf uns als lebendige Wesen, die bereits in einer vertrauten Alltagswelt 431 432 433 434 Sein und Zeit, §§ 12-22. Ebd., S. 85. Ebd., S. 34 ff. und §§ 4, 5, 7, 9-11. ??? 188 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie wohnen und darin ihre Interessen wahrnehmen, insbesondere das Elementarinteresse, überhaupt zu leben und sich in dieser Welt einzurichten. Dieses Interesse nennt er „Sorge“. Und ein Wesen, welches dieses Interesse zu seinem eigenen macht, habe die „Seinsart des Besorgens“.435 Ja er kann „das Sein des Daseins selbst als Sorge“ bestimmen und den Grundzug seines Verhaltens eben als Besorgen. ‚Besorgen’ führt er „als ontologischen Terminus (Existenzial)“ ein: Es bezeichnet das „Sein eines möglichen In-der-Welt-seins“.436 Die Sorge des Daseins um sich selbst prägt nach Heidegger auch das kognitive Weltverhältnis des menschen, also das Etwas- als-etwas-Verstehen. Und es liege auch allem wissenschaftlichen Erkennen schon zugrunde: Keine Erkenntnis ohne Interesse, genauer gesagt: kein wissenschaftliches Erkennen von Welt ohne die Perspektive des besorgenden Interessiertseins an der Welt, in der sich auch der Wissenschaftler immer schon als besorgtes endliches Dasein befindet. Die Antwort, die sich aus „Sein und Zeit“ auf die Frage nach den Sinnbedingungen des Verstehens und damit auch des Erkennens von Welt entnehmen läßt, lautet: Alles Verstehen hat die (prädikativ-propositionale) „Struktur des Etwas als Etwas. […] Das im Verstehen Erschlossene, das Verstandene ist immer schon so zugänglich, daß an ihm sein ‚als was’ ausdrücklich abgehoben werden kann. Das ‚Als’ macht die Struktur der Ausdrücklicklichkeit eines Verstandenen aus; es konstituiert die Auslegung. Der umsichtig-auslegende Umgang mit dem umweltlich Zuhandenen, der dieses als Tisch, Tür, Wagen, Brücke ‚sieht’, braucht das umsichtig Ausgelegte nicht notwendig auch schon in einer bestimmenden Aussage auseinanderzulegen. Alles vorprädikative schlichte Sehen des Zuhandenen [das heißt des in der Alltagswelt Bekannten und von uns regelmäßig Gebrauchten, D.B.] ist an ihm selbst schon verstehend-auslegend. […] Das Sehen dieser Sicht ist je schon verstehend-auslegend. Es birgt in sich die Ausdrücklichkeit der Verweisungsbezüge (des Um-zu), die zur Bewandtnisganzheit gehören, aus der her das schlicht Begegnende verstanden ist. Die Artikulation des Verstandenen […] am Leitfaden des ‚Etwas als etwas’ liegt vor der thematischen Aussage darüber. In dieser taucht das Als nicht zuerst auf, sondern wird nur erst ausgesprochen, was allein so möglich ist, daß es als Aussprechbares vorliegt. Daß im schlichten Hinsehen die Ausdrücklichkeit eines Aussagens fehlen kann, berechtigt nicht dazu, diesem schlichten Sehen jede artikulierende Auslegung, mithin die Als-Struktur 435 436 Sein und Zeit § 12, bes. S. 54 u. 57. Ebda., S. 57. 189 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie abzusprechen. Das schlichte Sehen der nächsten Dinge im Zutunhaben mit … trägt die Auslegungsstruktur […] ursprünglich in sich“.437 Das ist nichts anderes als eine aktualisierende Auslegung des Aristotelischen Logos-Begriffs. Etwas Ähnliches finden wir bei Ernst Tugendhat, der im Umkreis Heideggers Aristoteles studiert und seine Dissertation über diesen geschrieben hat. Auch er bestimmt die VerstehensStruktur als „prädikativ-propositionale“ Charakterisierung des Verstandenen nach dem Muster eines Aussagesatzes, in dem etwas als etwas Bestimmtes „charakterisiert“ wird.438 Freilich setzt Tugendhat bloß satzsemantisch an; er berücksichtigt ausschließlich die Beziehung zwischen dem Sprecher und seinem Thema. Den von Heidegger rekonstruierten praktischen Sinn- und Handlungszusammenhang der Alttagswelt, die „schon mitverstandene Bewandtnisganzheit“ der Gebrauchsdinge („Zeug“) in ihrem lebensweltlichen Kontext – etwa eine Wohnung, ein Betrieb, eine Stadt – läßt der Satzsemantiker Tugendhat außen vor. Insofern fällt er hinter Heidegger, den Mit-Initiator einer pragmatisch hermeneutischen Wende der Philosophie, durchaus zurück – und auch hinter Wittgenstein II, den Pragmatiker der Sprache. Er versteht sich auch ausdrücklich als Vertreter einer „formalen Semantik“439 und nicht etwa einer formalen Pragmatik wie Habermas. Hingegen bettet Heidegger die Als-Struktur des Verstehens eben in den Sinn- und Handlungszusammenhang einer „Zeugganzheit“440 bzw. des alltäglich „Zuhandenen“ ein. Dadurch gewinnt er einen gewissen Anschluß an die geschichtlich-pragmatischen Dimension der realen Handlungs- und Kommunikationsgemeinschaft. (Dazu unser Schema „die semiotischen Sinndimensionen…“ – geschweifte Klammer rechts unten.) Allerdings entfaltet er nicht, was er dadurch an Pragmatik gewinnen kann, weil er das Dasein und dessen Verstehen ganz traditionell, nämlich monologisch auffaßt. 437 438 439 440 Ebda., S. 149. Tugendhat, Vorlesungen zur Einleitung in die sprachanalytische Philosophie, Ffm. 1976. S.180 f. und 366 ff. Vgl. ebd., S. 53 ff., S. 197 ff., passim. Sein und Zeit, S. 68. 190 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Charakteristische Antworten auf die (nachkantische) transzendentalpragmatische Frage: Welches sind die Sinnbedingungen des Verstehens und Erkennens? Als-Struktur ohne Dialogizität (samt moralischen Implikatio-nen) Aristoteles: Die Rede (Logos) ist ein Etwas als etwas Bestimmtes Verstehen und zu Verstehengeben (semaineìn) aufgrund der prädikativ-propositionalen Als-Struktur in (monologischer) Beziehung auf Dinge. Tugendhat: Die Rede ist ein Etwas als etwas Bestimmtes Verstehen und zu Verstehengeben in satzsemantischer Beziehung auf 441 ein Thema = Charakterisierung kraft Als-Struktur Heidegger: Diese (monologische) „Als-Struktur“ liegt dem Verstehen als „Sein können des Daseins“ zugrunde und hat dem Dasein immer schon die Bedeutsamkeit von Welt (als „Zeugganzheit“ und als „Mitsein mit Anderen“) 442 erschlossen. Wittgenstein Sprechen ist virtuell öffentlich und hat die (monologische) Form eines „Sprachspiels“443 (Verwobensein von Handlung und Worten) im Rahmen einer Lebensform (als Sinnwelt). Humboldt: Transzend entale Sprachund Diskurspragmatik 441 442 443 Notwendige Bedingung des Denkens (auch in Einsamkeit) ist das dialogförmige Sprechen mit anderen.444 Das Etwas-Verstehen und –Denken hat die dialogische Form einer (a) Äußerung zu anderen = virtueller Dialogbeitrag mit: (a1) einer Proposition (s.o. Aristoteles) als bezogen auf (a2) einen performativen Akt samt impliziten Geltungsansprüchen445 und vorgängigen Dialogversprechen, verwoben mit (b) einem möglichen Begleitdiskurs: und zwar über (a1) aufgrund von (a2) als (virtuelle) Rechtfertigung/Verantwortung gegenüber (virtuell anerkannten) realen/ idealen Anderen → mögl. Übergang zum praktischen Diskurs. monologische AlsStruktur und Kommunikationsstruktur → Sich-mit-anderenüber-etwas-Verständigen sowie Dialog und Andere Anerkennen (Moral!) Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, 1976: Vorlesungen 4, 11, 12 u. 21. Heidegger, Sein und Zeit, § 32, S. 144, § 15, §26. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, §§ 2-31, (76-84). 191 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Erläuterung zu b): Zu einer formal vollständigen Äußerung gehört die Möglichkeit, zu dieser erläuternd und begründend Stellung zu nehmen. Dann redet man nicht mehr wie in (a) über ein Thema (Situation) und dabei gegebenenfalls auch mit anderen (themenzentrierte Kommunikation); vielmehr redet man über eine vollzogene Kommunikation zu anderen. Das ist die Metakommunikation eines Begleitdiskurses. Die hier vollzogenen einzelnen Sprachhandlungen haben wiederum die Form einer kompletten Äußerung mit performativem Akt und formal dazu passender Proposition. Deshalb spricht A. Øfsti von der „doppelten Doppelstruktur“ einer „formal vollständigen Sprache“446, Böhler hingegen von ihrer (impliziten) Dialogstruktur, weil die Geltungsansprüche die Möglichkeit eines Diskurses voraussetzen und ein Dialogverhältnis zu anderen prätendieren.447 Menschen haben die Möglichkeit, über ihre Äußerungen wie auch ihre nonverbalen Handlungen einen Begleitdiskurs zu führen. D.h.: Sie sind imstande, (b1) ihr Verstandenes und Gedachtes bzw. Gesagtes gewissermaßen vor sich zu bringen:Sie können sich darüber Rechenschaft geben und ihre Gedanken in einen größeren Zusammenhang rücken, eine Argumentation anlegen, planen und korrigieren. Darauf beruht die einzigartige reflexiv kommunikative Kompetenz, das jeweils Gemeinte bzw. Gesagte einzuholen und zu verantworten. Menschen können Rede und Antwort stehen über Sprachhandlungen und nonverbale Handlungen. Was bedeutet das? Aufgrund der kommunikativen Verständigungsstruktur des Etwas-Verstehens als Wechselseitigkeit von Performanz und Proposition (a) und der Möglichkeit des Begleitdiskurses (b) haben die Menschen 444 445 446 447 W. v. Humboldt, Schriften zur Sprache, Reclam 1973, S. 24f, 451, 482,52. Habermas über die Doppelstruktur der Rede (als kompletter Äußerung): Vorstudien u. Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Ffm 1984, S. 404 ff. A. Øfsti, Abwandlungen, Würzburg 1994, S. 71 ff. D. Böhler u. M. Werner, Alltagsweltliche Praxis und…, in: F. Jaeger, J. Straub (Hg.), Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 2, Stuttgart u. Weimar 2004, S. 72 f. u. 76 ff. 192 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie (c) das monologische und themenzentrierte Verhältnis des Etwas-als-etwas-Verstehens und Sagenkönnens, mithin gleichsam die Subjekt–Objekt–Relation, immer schon überschritten: Sie befinden sich von vornherein in einem dialogförmigen und auf Reflexion angelegten Verhältnis, hinsichtlich ihrer impliziten Geltungsansprüche und bezüglich der realen oder möglichen Gesprächsteilnehmer als anzuerkennender Anspruchssubjekte. (c1) Aufgrund dieser reflexiven Dialogverhältnisse sind Menschen in der Lage und können dazu herausgefordert werden, Begleitdiskurse (mit Argumenten/Gründen) zu führen: ‚Warum ist es wahr, daß ich/wir die jeweilige Situation, das erörterte Thema so und so verstehe(n)? → theoretischer Diskurs. Oder es stellt sich die normativ ethische Frage: ‚Ist es richtig und folgen-verantwortbar, daß ich/wir in der vorgeschlagenen Weise auf die Situation antworten? praktischer Diskurs. (c2) Dank des reflexiven Dialogverhältnisses der formal vollständigen Rede sind Menschen befähigt, sich auch unsere transzendentale Eingangsfrage, welche internen Bedingungen ein Etwas-Verstehen und Etwas-Erkennen ermöglichen, sowohl zu stellen, als auch diese Frage – in einem reflexiven philosophischen Begründungsdiskurs – dialogethisch zu konkretisieren: ‚Gibt es unabweisbare Verpflichtungen, die ich durch mein Ins-Spielbringen von Geltungsansprüchen unausdrücklich anerkannt habe? Wenn ja, welche sind das?’ Ein solcher philosophischer und zugleich philosophiereflexiver Begründungsdiskurs ist eine Besinnung auf unsere Rolle in Diskursen. Sie müßte sich in zwei Schritten vollziehen: – Rekonstruktion von Sinnbedingungen eines argumentativen Diskurses, – Prüfung der Rekonstruktionsergebnisse im reflexiven (sokratischen) Dialog mit einem Skeptiker in Form einer → aktuellen Dialogreflexion. 193 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Auch Heidegger und Wittgenstein rekonstruieren Sinnbedingungen des Etwas-Verstehens und (damit) des Etwas Sagens. Aber: 1. Sie thematisieren nicht bzw. rekonstruieren nicht die Reflexivität, die darin liegt, noch die darin enthaltene Dialogizität. Vielmehr präsentieren sie das Verstehen und Reden, als handele es sich sowohl um monologische Vorgänge, die keine Kommunikation mit anderen voraussetzen, als auch um ein Geschehen (so bei Heidegger) oder Handlungsweisen (Wittgenstein), für die ein Reflektieren, das Zurückgehen auf den Verstehenden oder Handelnden als ein Subjekt, jedenfalls nicht von grundlegender Bedeutung ist. Damit verkürzen sie die von ihnen selbst doch ins Auge gefaßte pragmatische Dimension des Sinnverstehens und der Sprache entscheidend. Denn die Reflexivität liegt der geltungslogischen, nämlich dialogisch-pragmatischen Dimension der Geltungsansprüche und Geltungsrechtfertigung zugrunde (vgl. unser Schema „Die semiotischen Sinndimensionen…“ – geschweifte Klammer rechts oben). Die Kommunikationsstruktur des Verstehens und Denkens verweist sowohl auf diese dialogisch-pragmatische Dimension als auch auf die geschichtlich-pragmatische Dimension: Einmal finden unsere realen Kommunikationen immer schon in dem Traditionszusammenhang einer realen Sprach- und Kommunikationsgemeinschaft statt, zum anderen hat die Traditionsvermittlung von Sinn und Bedeutung selbst die kommunikative Form des Sich-mit-Anderen-über-etwas-Verständigens, selbst dann, wenn sie faktisch autoritär oder als ein Lernen im Sinne von „Abrichtung“ (Wittgenstein) stattfinden mag. 2. Heidegger und Wittgenstein denken so selbstvergessen, wie Kant seine transzendentale Analyse des Erkenntnisvermögens angesetzt hat. Sie vergessen, daß ihre Untersuchungen der Alltagspragmatik – bei Heidegger der immer schon vorverstandenen Welt der Gebrauchsdinge, des Zeugs, und des schon „im Seinsverständnis des Daseins“ enthaltenen Verständnisses anderer, bei Wittgenstein die Analyse der Sprachspielpraxis mit einer vorausgesetzten Abrichtung – Geltungsansprüche voraussetzen, die sie als Theoretiker ihren Lesern gegenüber müßten einlösen können, so daß sie als Diskurspartner für diese ihre Diskursbeiträge verantwortlich sind. Es sind die Geltungsansprüche auf Wahrhaftigkeit bzw. Ernsthaftigkeit eines Diskursbeitrags, auf dessen Verständlichkeit, auf dessen sachliche Wahrheit und auch auf die moralische Richtigkeit der normativen Elemente, die in ihren Untersuchungen enthalten sind. Heidegger legt darüber hinaus im zweiten Abschnitt von 194 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie „Sein und Zeit“, „Dasein und Zeitlichkeit“, eine normative Orientierung nahe, indem er ein „eigentliches Seinkönnen“, die „vorlaufende Entschlossenheit“, als existentiell vorbildlich darlegt. In diesen Kapiteln, in denen er auch das Gewissen und die Schuld rekonstruiert (§§ 55-60), erhebt er seinen Lesern gegenüber natürlich zugleich den Anspruch auf Wahrheit der phänomenologischen Rekonstruktion und den auf moralische Richtigkeit der nahegelegten existentiellen Orientierung. Jedoch fragt Heidegger ebenso wenig wie Wittgenstein, was es bedeutet, Geltungsansprüche zu erheben. Beide fragen sich nicht, ob sie damit etwas implizit versprochen haben, was sie zunächst und in erster Linie durch ihre Darlegungen, durch ihren philosophischen Diskurs müßten einlösen können. Die von Kant ins Auge gefaßte Einheit von theoretischer und praktischer Vernunft blenden sie aus. Daher kommen sie auch nicht auf die Schwelle einer Ethik des Diskurses, wiewohl sie doch durch ihre Geltungsansprüche in einen argumentativen Dialog mit ihren Lesern eingetreten sind. Heideggers Antwort auf die transzendentalpragmatische Frage lautet eigentlich: ‚Die Sinnbedingungen des Etwas-Verstehens und Erkennens liegen in der monologischen AlsStruktur der menschlichen Weltwahrnehmung. Diese propositional-prädikative Struktur erweitert sich alltagspragmatisch durch unseren interessierten bzw. besorgten Umgang mit Zeug zu einer Etwas-als-Etwas-um-zu-Struktur: Wir nehmen etwas in der Alltagswelt immer schon wahr, um etwas damit tun zu können, was im Sinne unserer Daseins-Sorge liegt.’ Zudem deutet Heidegger noch eine zweite Erweiterung der Als-Struktur an. Diese scheint auf das kommunikative Handeln zu führen. Es ist das Existenzial des „Mitseins“. Doch führt Heidegger den Bezug auf das Mitsein nicht von vornherein als eine Grundeinstellung des Daseins ein, die gleichursprünglich wäre mit der sorglichen bzw. interessierten Als-UmzuStruktur. Und dessen Charakter bestimmt er nicht als wechselseitige Interaktion mit zugrunde liegenden Ansprüchen, für die sich argumentieren ließe, so daß man Geltungsansprüche dafür erheben kann – zumal den der Legitimität bzw. moralischen Richtigkeit. Eine Gleichursprünglichkeit der Als-Struktur der Weltwahrnehmung und des Verstehens Anderer verdeckt Heidegger. Fragt er doch nicht transzendentalhermeneutisch, ob bzw. inwiefern bereits das je einsame Etwas-als-etwas-Bestimmtes-Verstehen vermittelt ist durch vorausgehende Verständigung in Form von Tradition. Er berücksichtigt nicht, daß auch einem traditionsgeleiteten Verstehen sowohl die Verständigung voraufgegangener Generationen als auch deren Aneignung durch den gegenwärtig Verstehenden zugrunde liegt. Dem Prozeß des Tradierens, der in allem Weltverstehen schon am Werk ist, liegt aber die, von Humboldt 195 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie hervorgehobene, dialogische Wechselseitigkeit von Frage und Antwort, Rede und Erwiderung zugrunde. Und daran schließt sich wiederum die geltungslogische Gegenseitigkeit von Anspruch und möglicher Zustimmung an. Kurzum: Das, was Wilhelm von Humboldt als die Gegenseitigkeitsstruktur allen Sprechens und sprachlichen Verstehens traditionsgeleiteten rekonstruiert, Weltverstehen ist von auch in vornherein allem Tradieren wirksam: die und allem dialogförmige Gegenseitigkeit. Und eben deshalb besteht immer schon eine Dialektik der geschichtlich pragmatischen Dimension der Rede bzw. des Verstehens, also der Traditionsvermittlung, einer realen Dimension, Kommunikationsgemeinschaft also der Diskurse vor und der der geltungslogisch Geltungsinstanz pragmatischen einer idealen Kommunikationsgemeinschaft (vgl. unser Schema der semiotischen Sinndimensionen – geschweifte Klammer rechts oben). Heidegger biegt das „Mitsein“ jedoch in ein monologisches Verhältnis um. Denn er beschreibt es als ein immer schon im Dasein enthaltenes „Verstehen des Mit-Daseins“, welches dem einzelnen Dasein offenbar eingeschrieben sei und ihm monologisch zur Verfügung stehe. Das von Heidegger ins Spiel gebrachte Verstehen des Mitdaseins – gemeint ist doch wohl ein Gegenseitigkeitsverhältnis zu anderen – eröffnet keine Verständigungsbemühungen, von denen die Rede wäre. Es verweist offenbar nicht auf mögliche Begleitdiskurse. „Die zum Mitsein gehörige Erschlossenheit des Mitdaseins Anderer besagt: Im Seinsverständnis des Daseins liegt schon, weil sein Sein Mitsein ist, das Verständnis Anderer.“448 Diese Art von Intersubjektivität ist also dem Dasein schon eingeschrieben, sie fordert nicht zur Verständigung mit anderen heraus. Die Pluralität der anderen und ihre Gleichberechtigung als möglicher Diskursteilnehmer, welche dieselben Geltungsansprüche für ganz unterschiedliche und oft konfligierende Ziele und Interessen erheben – beides bleibt im Dunkel, ja es wird gänzlich verdeckt von dem ontologischen Singular „das Mitsein“. Der Ontologe bleibt im Banne der Scholastik. Dabei hätte hier der junge Heidegger von Humboldt und den Dialogikern lernen können, der späte von Hannah Arendt. In „Vita activa“ arbeitet sie die Pluralität als Charakteristikum des menschlichen Handelns heraus, als eine condition humaine, die mit der „Gebürtlichkeit“ bzw. Natalität des Menschen immer schon gegeben sei.449 In ihrem philosophischen Spätwerk 448 449 Sein und Zeit, S. 123. H. Arendt, Vita activa oder: Vom tätigen Leben, München o.J., S. 164ff, 230ff, 14-18. 196 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie „Vom Leben des Geistes. Das Denken“ hebt sie – mit Sokrates und gegenüber Heidegger – die dialogische Struktur des „Zwei in Einem“ als Bedingung der Möglichkeit des Denkens hervor: „Das Denken ist, existentiell gesehen, etwas, das man allein tut, aber nicht einsam: allein sein heißt mit sich selbst umgehen; einsam sein heißt allein sein, ohne sich in das Zweiin-Einem aufspalten zu können, ohne sich selbst Gesellschaft leisten zu können.“450 Zusammenfassend können wir zweierlei hervorheben: 1. Heideggers Daseinsanalytik überspringt das Verwobensein der alltagsweltlichen Etwas-alsEtwas-um-zu-Struktur mit Reflexion und Kritik, besser gesagt: mit der Möglichkeit eines Begleitdiskurses. Sie ignoriert, daß auch in dem Etwas-als-Etwas-um-zu, in dieser Einstellung des Etwas-Besorgens, hintergründig Geltungsansprüche stehen, mit denen sich der Verstehende und Handelnde virtuell auf andere bezieht. Solche Geltungsansprüche lassen sich nur durch das Miteinander-Argumentieren/das Teilnehmen an einem Diskurs einlösen, das heißt, in Form eines kommunikativen Handelns mit anderen in dem gemeinsamen Rahmen eines dialogischen Anerkennungsverhältnisses und letztlich vor der Geltungsinstanz einer idealen und unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft. Ideal ist diese Instanz, weil sie nichts anderes zuließe als eine argumentierende Kommunikation; nämlich sinnvolle Argumente, deren propositionaler Gehalt sich im Einklang mit den normativen Sinnbedingungen der Rolle eines Argumentationspartners befindet. Unbegrenzt ist diese Instanz, weil sie alle möglichen Argumente zur Sache, mithin auch alle möglichen Anspruchssubjekte als mögliche Argumentationspartner einbezieht. 2. Das interessierte Etwas-Verstehen läßt sich also nicht denken, ohne daß man apriori einen nicht etwa monologischen, sondern kommunikativen und zugleich reflexiven Typ der Kognition und der Praxis ins Spiel bringt: a) das kommunikative Sich mit anderen über etwas Verständigen und b) das kommunikative Handeln als Interagieren mit anderen in dem gemeinsamen Rahmen von Anerkennungsverhältnissen. Letzteres ist im Rahmen der pragmatischen Wende von dem amerikanischen Pragmatisten G. H. Mead als Verhältnis des Role taking entwickelt worden. Mead weiß ebenso wie Humboldt, was der Daseinsanalytiker unterschlägt: Das monologische Welt- und Ding-Verstehen ist 450 H. Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Denken, München 1998, S. 184. Vgl. D. Böhler, Warum moralisch sein? In: K.-O. Apel und H. Burckhart (Hg.), Prinzip Mitverantwortung, Würzburg 2001, S. 25ff, 47ff. 197 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie verwoben mit einem kommunikativen Sich-Verständigen über Sinn und Bedeutung, sei es von Worten und Redewendungen, sei es von Weltinterpretationen angesichts neuer oder abweichender Situationserfahrungen oder neuer Selbstverständnisse und Sinnereignisse. Auch die von Heidegger rekonstruierte lebensweltliche Erfahrung des Etwas-als-etwas-umzu-Verstehens hat zur Voraussetzung, daß das verstehende Dasein schon mit anderen kommuniziert hat. Aber mit wem eigentlich? „Das Dasein“ ist ja ein kollektiver Singular, dem der Anlaß zur Kommunikation mit anderen Menschen als verschiedenartigen Interessensubjekten fehlt. Auch dann, wenn wir für die regulierte, institutionalisierte, mehr oder weniger festgelegte Alltagswelt mit Heidegger, übrigens auch mit Wittgenstein, annehmen wollen, daß es darin wenig Verständigungsbedarf gibt, insofern alle Benutzer von Zeug über dessen Gebrauch schon mehr oder weniger verständigt sind, so handelt es sich bei diesem Verständigtsein doch um eine geronnene kommunikative Erfahrung, eine geronnene Kommunikation. Das ist ein Angelpunkt meiner „Rekonstruktiver Pragmatik“. Vielfach ist aber die moderne, nämlich hoch technisierte Alltagswelt und deren Zeugverständnis, zumal wenn es sich um hochtechnologisches Zeug handelt, keineswegs unproblematisch. Heideggers Blickwinkel einer handwerklichen Alltagswelt des Schwarzwaldes und analog Wittgensteins Konzentration auf einfache institutionalisierte „Sprachspiele“ blenden lediglich den Verständigungsbedarf aus. Ihre Unterdrückung einer transzendentalpragmatischen Sprach- und Selbstreflexion verdeckt die Diskursoffenheit des Sprechens und Verstehens überhaupt. Infolgedessen werden sie auf desaströse Weise unmodern: unsensibel für das Kritik- und Diskurspotential einer hochmodernen Lebenswelt und unseres Sich-in-dieserWeltVerstehens. 198 Vorlesung im Sommersemester 2009, Prof. Dr. D. Böhler Dialog und Begründung zwischen den drei Paradigmen in der Geschichte der Philosophie Verehrte Hörer und Leser! Da ich den Schluss dieser Vorlesung, die Kapitel IV 7.3 und das wichtige Kapitel V, aus Zeitgründen nur noch andeuten konnte, möchte ich Sie auf die hierzu einschlägige Vorlesung um Sommersemester „Selbsteinholung, Verstehen und Handeln. Ethik im Rahmen von Hermeneutik und Pragmatik.“ hinweisen. Zudem empfehle ich Ihnen, den Essay „Glaubwürdigkeit des Diskurspartners“ zu lesen, in: Th. Bausch, D. Böhler u. Th. Rusche (Hg.): Wirtschaft und Ethik. Strategien contra Moral? EWD-Schriftenreihe Band 12, Münster: LIT-Verlag 2004, S. 105-148. Vgl. dazu die pdf-Datei auf der Homepage des Hans Jonas-Zentrums unter folgendem Link: http://www.hans-jonas-zentrum.de/aktuell/aktuell8.html . Haben Sie Dank für Ihre Teilnahme! Ihre Kritik ist mir willkommen. Freundlich grüßt Sie Ihr 199