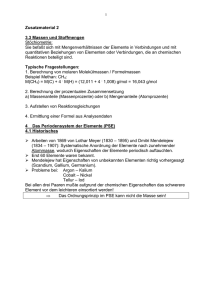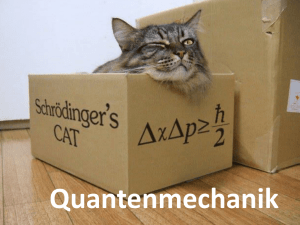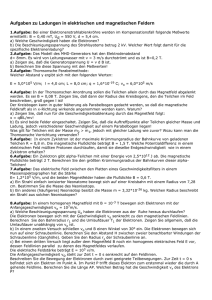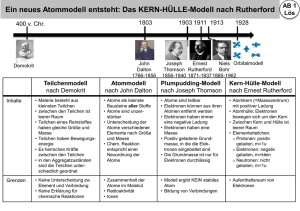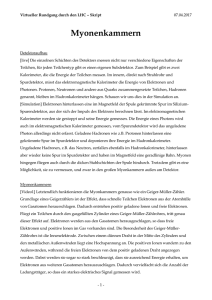Ortsauflösende Gasdetektoren
Werbung

Ortsauflösende Gasdetektoren von Johannes Roßnagel Seit über 20 Jahren sind ortsauflösende Gasdetektoren ein unverzichtbarer Bestandteil der Hochenergiephysik. Man verwendet sie zum Beispiel zur Impulsbestimmung von Protonen oder Elementarteilchen in Verbindung mit einem abbildenden Spektrometer (so am MAMI). Der Vorteil der Gasdetektoren liegt in der kostengünstigen Herstellung und in der Realisierbarkeit großer Detektorflächen, bei immer noch guter Ortsauflösung. Ein Teilchendektor allgemein dient zum Nachweisen von durch ihn hindurch fliegenden Teilchen. Im Gasdetektor geschieht dies über den Prozess der Ionisation des Füllgases durch die einfallenden Teilchen (oder auch Strahlung). Prinzip eines Gasdetektors Geladene Teilchen lösen im Gas entlang ihrer Bahn Elektronen aus der Hülle der Gasatome, die - bei genügend hoher kinetischer Energie - ihrerseits wieder Gasatome ionisieren können. Entlang der Spur des Teilchens entstehen Pakete von ionisierten Gasatomen, sog. „Cluster“. Damit die entstandenen Elektronen und Ionen nicht wieder rekombinieren, legt man ein elektrisches Feld an. Ist die Feldstärke hoch genug, werden sämtliche Elektronen und Ionen getrennt, driften an die jeweiligen Elektroden, und können als elektrisches Signal registriert werden. Diese Anordnugn nennt man Ionisationskammer. Die Anzahl der entstandenen e--Ion Paare im Gas hängt vom Energieverlust der Teilchen ab. Sie liegt in der Größenordnung von 100 ionisierten Atomen, oder 30 Clustern, pro Zentimeter Gas. Um das so erzeugte Signal im Gas zu verstärken, erhöht man die äußere Spannung, wodurch die Elektronen zwischen ihren Stößen mit den Gasatomen ausreichend kinetische Energie gewinnen, um diese ionisieren zu können. Es entstehen Elektronen-Lawinen, die sog. Gasverstärkung. Die Stärke des induzierten Signals hängt vom Ort der Primärionisation ab. Eine zylindersymmetrische Anordnung bringt zwei wesentliche Vorteile mit sich: Durch die 1/r-Abhängigkeit der elektrischen Feldstärke reichen geringere Spannungen aus, um dicht am Anodendraht eine Gasverstärkung zu erzielen, und durch die erst spät einsetzende Verstärkung bleibt das induzierte Signal proportional zur Anzahl primär ionisierter Atome. In diesem Bereich arbeitende Kammern nennt man Proportionalkammern. Erhöht man die Spannung weiter, geht diese Proportionalität verloren, da ,zusätzlich zur Ionisation, harte Photonen entstehen, die ihrerseits Atome ionisieren können. Bei sehr hohen Spannungen kann auf diese Weise das gesamte Gas ionisiert werden, und es sind nur noch Ratenzählungen möglich. Nach diesem Prinzip arbeitet das GeigerMüller Zählrohr. Abb. 1: Detektorkennlinie (aus Kleinknecht) Ortsauflösende Draht- und Driftkammern Das Prinzip eines ortsauflösenden Gasdetektors ist die Aneinanderreihung vieler Proportionalkammern. In der Praxis spannt man hierfür viele Anodendrähte in einer Ebene zwischen zwei Kathodenplatten. Eine solche Kammer nennt man „multi wire proportional chamber“, oder kurz MWPC. Dies war die erste Umsetzung eines ortsauflösenden Gasdetektors. Mit einer solchen MWPC kann man Ortsauflösungen von bis zu σ = 0,5mm erzielen. Ein weiterer großer Schritt in der Entwicklung der ortsauflösenden Gasdetektoren war die Erfindung der Driftkammern. Hier geschieht die Ortsbestimmung regressiv über die Driftzeitmessung, bei bekannter Driftgeschwindigkeit. Wichtig hierfür ist der Effekt, dass die Driftgeschwindigkeit der Elektronen über einen weiten Feldbereich konstant bleibt. Der Grund Abb. 2: MWPC (von en.wikipedia.org) dafür sind Interferenzen der DeBroglieWellenlänge der Elektronen mit den Hüllenelektronen der Gasatome, die häufigere Stöße mit den Atomen bedingen (Ramsauer-Effekt). In der Umsetzung bedient man sich wieder einer Drahtebene zwischen zwei Kathodenplatten, wobei hier abwechselnd Kathoden- und Anodendrähte eingezogen werden. Dies hat zum Effekt, dass das Elektrische Feld in der Drahtebene waagerecht zwischen den Drähten verläuft, und man so eine genauere Kenntnis über die Driftstrecke erlangt. Fliegt nun ein Teilchen durch die Kammer, so ionisiert es Gasatome entlang seiner Bahn. Hinter der Kammer wird ein Szintillations-Detektor angebracht, durch dessen Signal eine Stoppuhr gestartet wird. Die ionisierten Elektronen driften zu den Anodendrähten, wodurch die Zeitmessung gestoppt wird, und so der Abstand vom Ort der Ionisation zum Anodendraht gemessen werden kann. Diese Kammern können in zwei verschiedenen Geometrien betreiben werden. Zum einen können sie senkrecht in den Teilchenstrahl gebracht werden, sodass immer nur einer der Anodendrähte anspricht. Hierbei ist die horizontale Drift des zum Draht nächsten Elektrons die entscheidende, weshalb man Abb. 3: VDC (aus Distler) solche Kammern „horizontal drift chambers“, kurz HDC, nennt. Mit Kammern dieses Prinzips lassen sich Auflösungen von σ = 200µm erreichen. Bringt man sie hingegen unter einem gewissen Winkel in den Teilchenstrahl, so werden mehrere Drähte ansprechen, man erhält also mehrere Ortspunkte und kann so die Teilchenbahn rekonstruieren. Da hier die entscheidende Drift vertikal zur Drahtebene verläuft, nennt man diese Kammern „vertical drift chamber“, oder VDC. Durch diese Methode lässt sich die Messgenauigkeit auf σ = 100µm reduzieren. Je nach gegebenen äußeren Umständen, nach Zielen der Messung und nach der zur Verfügung stehenden Mittel, muss von Fall zu Fall neu entschieden werden, welcher der Detektortypen am geeignetsten ist. Literatur: W. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments (Springer-Verlag) K. Kleinknecht: Detektoren für Teilchenstrahlung (Teubner) D. Perkins: Hochenergiephysik (Addison-Wesley) M. Distler: Aufbau und Test einer vertikalen Driftkammer (1990)