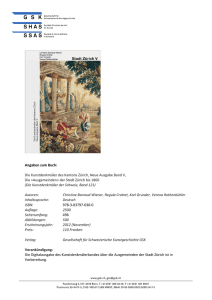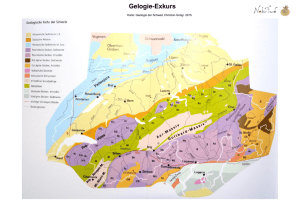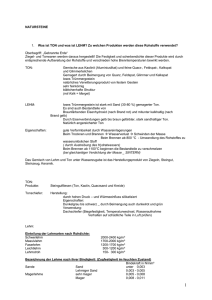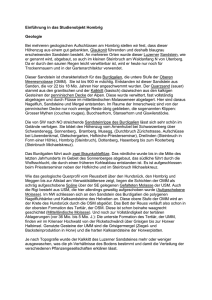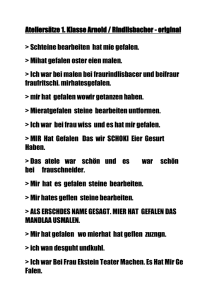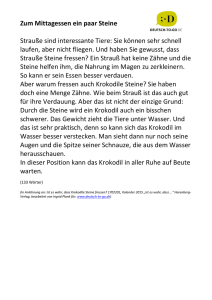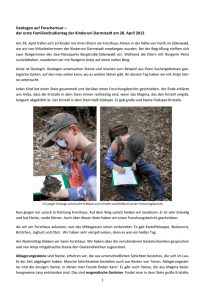steinmoden – gestern und heute
Werbung

Thema STEINMODEN – GESTERN UND HEUTE DR. KONRAD ZEHNDER UND DR. RAINER KÜNDIG Steine, die von Menschen bearbeitet wurden, haben viele Bedeutungen. Als Bausteine erfüllen sie in erster Linie eine technische, darüber hinaus oft auch eine ästhetische Funktion. Als Gedenksteine, Grabsteine und bildhauerische Werke allgemein tragen sie eine Botschaft weiter. Es sind in Stein gehauene Symbole. Steinmoden, wie Moden allgemein, kommen dort zum Ausdruck, wo ein Material und dessen Bearbeitung über das Notwendige hinausgehen. Überall, wo die äussere Erscheinung eines Werkes nicht gleichgültig ist, sondern geschmackvoll, schön etc. sein soll, spielt der Zeitgeschmack eine dominierende Rolle. «Mode» ist zeitabhängig. Sie kann sozusagen über Nacht auftreten und sich schnell ändern. Aber immer tritt 4 3/2010 sie mit jeweils typischen Merkmalen hervor. Auch die Verwendung von Steinen unterliegt nicht nur technischen und wirtschaftlichen, sondern ebenso sehr modischen Aspekten. Dies allerdings nur in wirtschaftlich gut situierten Zeiten, Gegenden und Gesellschaften. An der aus Stein gebauten Architektur werden der Zeitgeschmack und dessen ständiger Wandlungsprozess in der Verwendung von Steinen sichtbar, wenn man Bauwerke aus verschiedenen Epochen eingehend betrachtet. Dazu sollen im Folgenden einige Schlaglichter auf frühere und heutige Steinmoden an Bau- und Bildwerken geworfen werden. Der Gang durch Gegenden und Jahrhunderte ist allerdings sehr sprunghaft, gewiss auch einseitig und unvollständig. Ein Grossteil der Informationen ist dem Werk von Francis de Quervain (1902– 1984) entnommen, der sich als Professor für Technische Petrografie an der ETH Zürich intensiv mit der historischen Steinverwendung befasste. Dabei entstand auch seine Karteikartensammlung «Gesteinsarten an historischen Bau- und Bildwerken der Schweiz», die jetzt als Datenbank und online verfügbar ist (siehe Beitrag der Autoren in «Kunst+Stein» 2/2010). Weitere aufschlussreiche Hinweise zu historischen und aktuellen Trends werden Tobias Eckardt, Toni Labhart, Philipp Rück, Emilio Stecher und Stefano Zerbi verdankt. Mode ist, was kopiert wird De Quervain schreibt: «Man ist öfters erstaunt, zu bemerken, wie ein unscheinbares Gestein plötzlich in Ausbeute kommt und verbreitete Verwendung findet. In zahlreichen Fällen lässt sich deutlich nachweisen, dass ein Stein in Mode kam. Das beste Anzeichen dafür, dass eine Steinwirkung Mode ist, besteht in der Imitierung, sei es in farbigem Stuck, in bemaltem Holz oder besonders deutlich in übermaltem Stein, der aus der Mode gekommen ist.»¹ Die historisch beliebteste und heute wohl allgemein bekannteste Steinimitation ist die Marmor-Imitation, wobei Marmor nicht im petrografischen Sinn, sondern umgangssprachlich als buntfarbiger Kalkstein zu ver- stehen ist. Eine mit Fotos belegte, reiche und repräsentative Sammlung von Marmorimitationen, die im 17. und 18. Jahrhundert auf verputzte Fassaden gemalt wurden, bietet übrigens das Buch «Farbige Fassaden»². Aber nicht nur Marmor, sondern auch gelber Jurakalk, dunkler Alpenkalk, Granit, Serpentinit, Sandsteine und viele weitere Gesteine wurden durch Bemalung imitiert. Dies einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, wo der Transport des Natursteins über grössere Distanzen teurer war als dessen auf billigem lokalem Stein oder Putz aufgemalte Imitation. Zugleich schützte diese «Steinfarbe» als Bemalung aber auch verwitterungsempfindliche Steine wie zum Beispiel Molassesandsteine besser gegen Witterungseinflüsse. Man spricht von Steinfarbe, wenn sie im Farbton der Farbe des Steins ähnelt. Doch auch hier spielte die Mode hinein. Weil im 18. Jahrhundert Grau Modefarbe war, bekamen zum Beispiel in Basel rote Buntsandsteine eine graue Fassung. Die Erfindung der Natursteinfolie – das «Steinfurnier» – stellt vielleicht die ▲ ▲ Bern, Innenhof des Burgerspitals mit klassizistischem Brunnen von 1739/42. Ursprünglich war die gesamte Anlage aus alpinem Kalkstein von Zweilütschinen. Das Becken wurde 1761 in Solothurner Kalkstein erneuert. Der jetzt hellgrau angewitterte Aufbau war einst dunkelgrau und weiss geadert, was der damaligen Mode entsprach. ▲ Favorit unter den Natursteinen auf unseren Baustellen ist zurzeit römischer Travertin. 717 massive Fassadenelemente aus diesem Material prägen das neue «E-Sciene Lab HIT» der ETH Zürich-Hönggerberg. Die rechtwinklig zur Gebäudeflucht versetzten Platten dienen nicht nur als architektonisches Gestaltungselement, sondern auch als Blendschutz. Ein weiteres aktuelles Grossprojekt unter Verwendung von römischem Travertin ist das Mobimo-Hochhaus in Zürich. neueste, raffinierte Form von Steinimitation dar. Aus Onyx werden märchenhaft farbige Fenster oder transluzente Duschkabinen, und beliebig geformte Architekturoberflächen werden mit einer Granitoder Sandsteinfolie überklebt, so dass sie wenigstens für ungeübte Augen so aussehen, als wären sie aus einem Block gehauen. «Eine der auffallendsten Steinmoden des 17. und 18. Jahrhunderts verlangte schwarzen Stein.»³ Man begegnet schwarzen Marmoren, d.h. polierten schwarzen Kalksteinen, an prunkvollen Portalen – beispielsweise an der Klosterkirche Engelberg, am Zürcher Rathaus und an vielen barocken Bauwerken der Stadt Bern –, Kirchenausstattungen und Grabmälern. Schwarze Kalksteine kommen in den nördlichen Kalkalpen an vielen Stellen von St-Triphon im Westen bis nach Sargans im Osten vor. In der damaligen Zeit wurde allerdings kaum anstehendes Festgestein abgebaut, sondern nur die leichter zugänglichen Blöcke von Bergstürzen und ins Mittelland hinein verfrachteten Findlingen. Schwarzer Stein ist genauso wie weisser Stein zum Klassiker geworden und es bis heute geblieben. Als Beispiel sei die schwarz-weisse Wandverkleidung aus Negro marqina und Carraramarmor im S-Bahnhof unter dem Zürcher Hauptbahnhof (1990) genannt. Prominenter Buntmarmor Die bunten Marmore von Arzo – bekannt als «Brocatello» und «Macchia vecchia» – sind ein weiteres Beispiel einer prominenten Steinmode des 16. bis 18. Jahrhunderts. Auch hier handelt es sich nicht um Marmore im petrografischen Sinn, sondern um bunte, polierbare Kalksteine. Im Tessin, Misox und in umliegenden Regionen Norditaliens gibt es über 1000 Kirchen mit Ausstattungen aus Arzogestein! Ganz selten wurde es auch nördlich der Alpen verwendet, so zum Beispiel in der Kathedrale von Solothurn und der Domkirche von Arlesheim. Auf heutige Augen wirkt dieses äusserst spannende und wunderschöne Material – wen wundert es – sehr «barock», um nicht zu sagen «altmodisch» und befremdlich. Der Steinbruch in Arzo musste kürzlich wegen mangelnder Nachfrage geschlossen werden, was einmal mehr das Auf und Ab von Mode und Prestige zeigt. Weisser Marmor ist ein klassisches Gestein mit hohem Symbolcharakter, das seit der Antike und bis heute für hochrepräsentative Objekte verwendet wurde. Beispielsweise in Graubünden war es der grobkristalline weisse Marmor aus dem Vinschgau, der in karolingischer Zeit für Chorschranken und Ornamentplatten, im 17. und 18. Jahrhundert für Grabplatten und heraldische Bodenplatten verwendet wurde.4 Um 1900 erlebte der Marmor von Saillon – damals bekannt als «Cipolin vert», «Cipolin grand antique» etc. – eine kurze intensive Blütezeit. In den 1870er Jahren entdeckt, gelangte er wegen seiner Ähnlichkeit mit dem im antiken Rom geschätzten Cipolin von Euböa rasch zu Weltruf, nachdem er 1878 an der Weltausstellung in Paris gezeigt wurde. Als eines der gesuchtesten Gesteine der Welt wurde es nach Frankreich, Deutschland, England, Holland und den USA exportiert. Drei der wenigen in der Schweiz erhaltenen Anwendungen sind die Innenausstattung der Bank Leu in Zürich (1913– 1915), die Pfeilerverkleidungen im Kunsthaus Zürich (1910) und die Verkleidungen von Heizkörpern in der Wandelhalle des Parlamentsgebäudes in Bern (1894–1902).5 Heute wird in der Schweiz nur noch Die Zeit um 1900 experimentierte sehr kreativ mit Natursteinen und Formen. An diesem Haus von 1905 an der Ottikerstrasse in Zürich stehen die roh behauenen Bossen der Sockelsteine aus granitischem Sandstein im Kontrast mit den feinen Steinmetzarbeiten über dem Portal aus einem braunen Sandstein, der aus Deutschland oder Frankreich stammt. 3/2010 5 Karteikarte aus «Gesteinsarten an historischen Bau- und Bildwerken der Schweiz» von F. de Quervain 1984. Sie bezieht sich auf die Figur an der Karl-Schmid-Strasse in Zürich. in Peccia im Tessin, und auch hier nur bedarfsweise weisser Marmor abgebaut. Eine bisher letzte grössere Anwendung erfolgte 2007/08 an der ETH in Zürich, wo die Innenhöfe des Hauptgebäudes mit Platten aus Cristallinamarmor verkleidet wurden. Zürich, Kioskhäuschen neben dem Landesmuseum, erbaut 1913. Damals bestand eine Vorliebe für groblöcheriges Gestein. Hier wurde jedoch nicht Kalktuff, sondern ein merkwürdiges, sonst selten anzutreffendes Material verwendet: ist dieses kalkreiche Konglomerat ein Randen-Grobkalk? 6 3/2010 Alltagsmoden Steinmoden gibt es aber nicht nur in der Luxusklasse, sondern auch bei gewöhnlichen Gesteinen. Ein Beispiel ist aus der Stadt Zürich des 17. und 18. Jahrhunderts bekannt. Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts und dann wieder nach Mitte des 18. Jahrhunderts wurde für Hausteinarbeiten fast ausschliesslich sogenannter Granitischer Sandstein verwendet. In der Periode dazwischen wurde jedoch für die gleiche Verwendungsart Plattensandstein weit bevorzugt.6 Beide Sandsteine stammen aus der mittelländischen Molasse um den Zürichsee. Sie wurden an nahe beieinander liegenden Orten abgebaut und konnten relativ einfach per Schiff nach Zürich transportiert werden. Obwohl beide Sandsteine auf den ersten Blick recht ähnlich aussehen, wurde der etwas dunklere, feinkörnige und grünlichgraue Plattensandstein – im Handel als Bächer und Rorschacher Sandstein bekannt – zum barocken Modegestein. Der Granitische Sandstein – als Bollinger und St. Margrether Sandstein bezeichnet – ist ungleichkörniger, neutral grau und bräunlich anwitternd. Muschelkalkstein der Molasse aus dem Aargau (Würenlos und Mägenwil) und dem Broyebezirk (Estavayer-le-Lac) war schon den Römern als ausgezeichnetes Baumaterial bekannt. Im Mittelalter wurde er nur noch lokal in den Abbaugebieten selbst als Hausteinmaterial verwendet. Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert etablierte sich Muschelkalkstein zum überregional begehrten Stein für Brunnenbecken. Das beginnende 20. Jahrhundert entdeckte ihn neu für Fassaden von Repräsentativbauten. Ein Beispiel ist die Nationalbank in Zürich von 1922. Der groblöcherige Stein wurde sogar für Bildwerke modisch. Bemerkenswert ist auch, dass die Fassaden der ETH-Neubauten für Naturwissenschaften von 1915 mit einem Kunststein gestaltet wurden, der dem Muschelkalkstein sehr ähnlich sieht. Das in den 1930er Jahren erbaute EWZ-Gebäude an der Werdmühlestrasse in Zürich hat als einer der ältesten Plattenverkleidungsbauten von Zürich eine Verschalung aus Muschelkalkstein. Dieses Material behielt seine Attraktivität bis heute. So wurde der 1996 fertig gestellte Nordosttrakt des Zürcher Hauptbahnhofes mit Muschelkalkstein verkleidet. Ab Mitte 18. bis Mitte 19. Jahrhundert wurde Solothurner Kalkstein zum überregional wichtigsten Stein für Brunnenbecken. Beispielsweise in Basel, Bern und Zürich sind viele Brunnen aus diesem Material und dieser Zeit erhalten. Mit dem neuen europaweiten Eisenbahnnetz in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Transport von Steinen über grosse Distanzen zu günstigen Preisen möglich, was das Angebot und die Palette der verwendeten Bausteine enorm erweiterte. Tessiner Gneis sowie Kalksteine von Solothurn und von St-Triphon wurden schweizweit zu marktführenden Sockelgesteinen. Der von Savonnières in Frankreich importierte Kalkstein avancierte zum gediegenen Form- und Skulpturenstein an Fassaden. Doch auch einheimischer Kalktuff hatte an Fassaden des ausgehenden 19. Jahrhunderts kurz Hochkonjunktur. Bekannte Zürcher Bauten sind das Landesmuseum (1889) und die Kirche Enge (1894). In einem grossen Teil der Schweiz kam Berner Sandstein als billiges Hausteinmaterial in Mode. Nicht nur die zwischen 1852 und 1902 erbauten Bundeshäuser in Bern7, sondern viele kleine und grössere Bauwerke in Städten von Genf bis St. Gallen wurden daraus errichtet. Wobei allerdings auch Steine minderwertiger Qualität zum Einsatz kamen, die an der damals stark schwefeldioxidhaltigen Industrieluft rasch verwitterten. Beispielsweise am ETH-Hauptgebäude in Zürich musste der Berner Sandstein um 1915 durch einen Kunststein ersetzt werden. Der Ersatz erwies sich inzwischen als sehr beständig und täuscht selbst Geologen, die ihn für einen natürlichen Sandstein halten. Und heute? Die Plattenkleider moderner Stahlbetonbauten zeigen deutlich, dass auch der heutige Zeitgeschmack von Moden geleitet wird. Bauten der 1980er Jahre waren mit Vorliebe in warmes Braun gehüllt – der Kirchheimer Muschelkalk ist ein Beispiel dafür. Bis etwa zur Jahrtausendwende kamen die in einer ungestüm wachsenden Palette von importierten Gesteinen neu entdeckten, wilden Exoten zum Zug – so etwa die braun-rot-schwarzen Migmatite aus Brasilien und Indien. Aber nicht nur. Auch einheimische Gesteine wie beispielsweise der dunkle Castione nero oder die grünen Gneise aus Andeer wurden in Zürich, Careum (Gloriastrasse 16). Die Skulptur aus lose zusammengefügten Blöcken des Rorschacher Sandsteins wurde 2007 installiert. Wird die ausgefallene Vision von bewegten Sandrippeln eines Meeresstrandes, die zu grauem Stein erstarrt und auf spaltroher Fläche wieder sichtbar sind, modische Nachahmung finden? den 1980er bis 1990er Jahren sehr geschätzt. Die dunkelgrünen Gneise und Quarzite aus dem Valsertal waren plötzlich gefragt, nachdem ein berühmter Architekt ihre Schönheit am Neubau der Valser Therme von 1996 demonstrierte. 2004 wurde der neu gestaltete Bundesplatz in Bern mit Bodenplatten aus Valser Gneis eröffnet. Nach derart kräftigen Farben erinnert man sich heute gerne wieder an diskrete, beige bis weisse Farbtöne, die mediterranes Klima evozieren. Das HIT-Gebäude der ETH auf dem Hönggerberg strahlt in römischem Travertin, und der im Bau befindliche MobimoTurm in Zürich wird mit dem gleichen Material verkleidet. Ein neuer Novartis-Bau in Basel bekam ein weisses Gewand aus Carraramarmor. Auch als Bodenplatten sei Travertin – gemäss einer Aussage im deutschen «Natursteine-blog» – der heute beliebteste Naturstein.8 Wer durch ein beliebiges nord- schweizerisches Dorf spaziert wird erstaunt feststellen, dass in den neu angelegten Gärten um Einfamilienhäuser nicht der lokale helle Jurakalk, sondern der etwas weiter her geholte dunkelgraue, weiss geaderte Alpenkalk modisch ist. Was wiederum an barocke Kirchenausstattungen erinnert; aber auch daran, dass das am frischen Stein edle Dunkelgrau-Weiss-Muster mit den Jahren ausbleichen und in ein verwaschenes Hellgrau übergehen wird. Dies sollte dann hoffentlich der Schönheit des Gartens nicht abträglich sein und den künftigen Nutzern vor Augen führen, dass Steine ein Stück Natur sind und ihr manchmal überraschendes Eigenleben haben. Zum Schluss möge man bedenken, dass neue Moden seltsamerweise von Leuten initiiert werden, die sich scheinbar nicht um Moden kümmern, sondern etwas Neues wagen. Wer viel Phantasie hat, findet Moden langweilig. 1 F. de Quervain (1979): Gesteinskunde und Kunstdenkmäler. In: Steine schweizerischer Kunstdenkmäler.- Manesse, Zürich. 2 von Mane Hering, erschienen 2010 im Verlag Huber. 3 F. de Quervain (1979): Gesteinskunde und Kunstdenkmäler. In: Steine schweizerischer Kunstdenkmäler.- Manesse, Zürich. 4 F. de Quervain (1979): Kristalline Marmore aus den Alpen. In: Steine schweizerischer Kunstdenkmäler.- Manesse, Zürich. 5 Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz (1997), Seite 195.- Schweizerische Geotechnische Kommission, Zürich. 6 F. de Quervain (1979): Zwei Molassesandsteine an historischen Anwendungen der Zentral- und Ostschweiz. In: Steine schweizerischer Kunstdenkmäler.- Manesse, Zürich. 7 T. Labhart (2002): Steinführer Bundeshaus Bern.Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, Thun. 8 www.natursteine-blog.de 3/2010 7