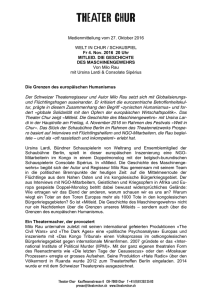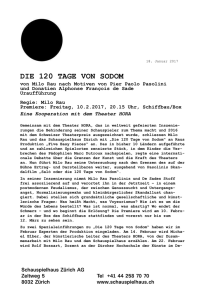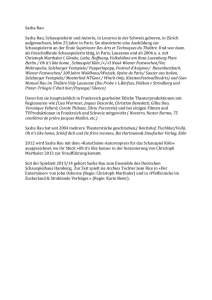schaubühne am lehniner platz Pressespiegel
Werbung
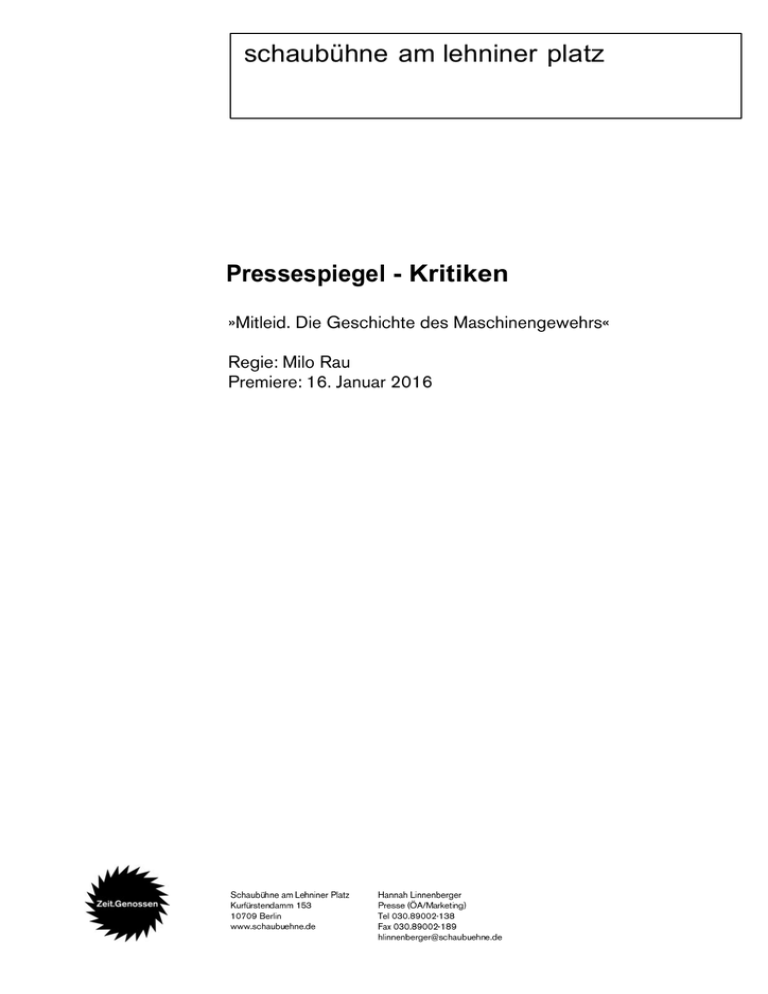
schaubühne am lehniner platz Pressespiegel - Kritiken inforadio, 17.1.2016 'Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs' von Milo Rau in der Schaubühne Der Schweizer Milo Rau ist einer der gefragtesten Regisseure Europas. Streitbar sind seine politisch-realistischen Inszenierungen immer. An der Berliner Schaubühne wurde jetzt "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs" uraufgeführt. Unsere Kritikerin Ute Büsing war dort. Die Geschichte des Maschinengewehrs wird nicht erzählt. Viel mehr wird in diesem theatralen Essay abgehandelt, was es in den Händen entfesselter Mörderbanden anrichtet. Und "Mitleid", das meint uns hier im Herzen Europas, unsere Empathiefähigkeit und ihre eng gesteckten Grenzen. Ausgehend von dem syrischen Flüchtlingsjungen, der zwischen dem türkischen Bodrum und dem griechischen Kos ertrank, und der kontinentalen Mitleidwelle, die sein Foto auslöste, hinterfragt Milo Rau in dem nachdenklich stimmenden Anderthalbstünder die mangelnde Bereitschaft, uns mit den Millionen Opfern der Genozide in Zentralafrika, namentlich im Kongo, in Burundi und Ruanda, auseinanderzusetzen. "Starke" Inszenierung Er hält Narzissmus und Rassismus einen Spiegel vor, indem er die absolut überzeugende Schauspielerin Ursina Lardi in die Rolle einer unbedarften NGO-Mitarbeiterin schlüpfen lässt, die als jugendliche Hilfskraft im Kongo stationiert wird. Dies geschieht kurz vor dem Völkermord der Hutus an den Tutsi in Ruanda. Bald hört sie die titelgebenden Maschinengewehre sirren und die Schreie der Ermordeten. Eine Million Menschen flüchten in den Kongo - darunter auch die Milizionäre, die das große Schlachten angerichtet haben. 1000 NGO's werden aufgeboten, sie zu betreuen. Dann marschiert die neue ruandische TutsiArmee ins Camp ein und mordet ihrerseits. Aus der sicheren Distanz eines "Feldherrenhügel" beobachtet das die Ich-Erzählerin. Sie steht während der gesamten Aufführung in den verbrannten Trümmern des Lagers. Die Aussagen über ungehemmte Massaker und hilflose Helfer basieren auf Raus Recherchen. Für das Theater hat er sie mit dem Ödipus-Mythos zusammengeführt. Heraus kommt ein klassisches Aufklärungsdrama: Mitwisserschaft mündet in die tragische Einsicht der Mittäterschaft. Blank liegt der Zynismus der Mitleidindustrie, die sich afrikanische und syrische Flüchtlinge zur Bestätigung des eigenen Gutmenschentums zunutze macht. Milo Rau rechnet auch ab mit Flüchtlingschören auf den Bühnen und: mit seiner Art, politisch-realistisches Theater zu machen. Hinter dem Authentizitätseffekt verschwindet, so zeigt er, die notwendige Doppeldeutigkeit von Kunst. Die in Burundi geborene und bei belgischen Adoptiveltern aufgewachsene Schauspielerin Consolate Sipérius spielt hier im Prolog und im Epilog umwerfend authentisch tatsächlich sich selbst - und verdeutlicht so die beabsichtigte Brechung: Gute Absichten allein reichen nicht. Am Ende, so heißt es, kommt es darauf an, wer die Maschinengewehre hat... Stark! BerZ, 18.1.2016 Milo Rau inszeniert „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ Von Doris Meierhenrich „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ dreht sich um pure Aktualität. Es geht um die Hilfsbereitschaft und Politik der Hilfe, die angesichts aktueller Flüchtlingsankünfte speziell in Deutschland Hochkonjunktur hat. Schrecklich ist dieser Abend und erschütternd. Wenn Milo Rau ein neues Stück ankündigt, dann sind die markigen Leitartikel, die er ihm vorausschickt, so unverzichtbar wie andernorts Voraufführungen. Kein anderer Theatermacher arbeitet so intensiv an seiner medialen Wirkung, daran, öffentlich zu wirken mit seinen Projekten, wie Milo Rau. Und so waren auch dieses Mal zahlreiche Manifeste des Regisseurs unterwegs, die das Terrain systemkritisch aufzubereiten hatten für „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“. Das zu erwähnen ist wichtig, denn ohne all die außertheatralen Verweise fehlt seinem Theater die Hälfte der Referenz. Alle sind Arschlöcher „Mitleid“ nun dreht sich dazu um pure Aktualität. Es geht um die Hilfsbereitschaft und Politik der Hilfe, die angesichts aktueller Flüchtlingsankünfte speziell in Deutschland Hochkonjunktur hat. Hilfe ist gut, meinen wir alle. Vielleicht denkt auch Milo Rau insgeheim so. In der Schweizer „Sonntagszeitung“ aber ließ er erst einmal ausrichten: „Alle sind Arschlöcher!“ und meinte damit nicht die Flüchtlinge, sondern uns (sich eingeschlossen), die kurzsichtigen Gastgeber und Hüter der Zuflucht. Regisseur und Bühnenautor Wer helfen will, so Rau, soll keine Herzchen auf Notunterkünfte malen – „zynischen Humanismus“ nennt er das – sondern der eigenen Schuld an dieser Flucht auf die Schliche kommen. Und diese Schuld verbirgt sich nicht in Afrika oder dem Nahen Osten, sondern in dem, was wir selbst hervorbringen: die „systemische Ungerechtigkeit und der Rassismus“ globaler Marktwirtschaft, auf der Europa fußt. Was sich wie Wahlslogans anhört, birgt komplexe Wahrheiten. Zusammen mit einer Vielzahl Zeugen, Juristen und NGO-Experten belegte Rau das im vergangenen Sommer am Beispiel Zentralafrikas in seinem „Kongo-Tribunal“. Nach der Verhandlung in Bukavu tagte es auch drei Tage in Berlin und auch in das Zwei-Personen-Stück „Mitleid“ wirkt dieses große Recherche-Projekt noch hinein. Die Spielfläche der Schaubühne ist komplett mit Müll übersät: Hier ist so ein Ort, vor dem die Menschen fliehen, um zu leben. Oder wohin Europäer reisen, um als Helfer Meriten zu ernten. Die burundische Schauspielerin Consolate Siperius musste schon als Kind 1993 ihre Heimat verlassen, weil Hutu und Tutsi sich gegenseitig abschlachteten. Ursina Lardi spielt eine NGO-Helferin, die dagegen meinte, Frieden in das ausgebeutete und umkämpfte Zentralafrika bringen zu können. Beide Frauen erzählen von sich in erster Person, doch Lardi spricht Texte, die Rau in mehreren Interviews mit solchen Helfern gesammelt hat. Kein Wort sei erfunden, so Rau, und doch ist Lardis Erzählung eben (Ver)Dichtung. Dokumentarisch will Rau sein Theater daher nicht nennen, ebenso wenig „Recherchetheater“, „engagiertes Theater“ oder „politisches Theater“, die er alle für unmöglich erklärt. Rau will dagegen real werden, weshalb er allenfalls Alexander Kluges Bezeichnung „Real-Theater“ für sich geltenlässt. Was nun in der Schaubühne zur Aufführung kam, ist natürlich nicht „realer“, als jede andere Aufführung. Und doch muss man diesem seltsamen Zwei-Monologe-Stück etwas sehr Besonderes bescheinigen, denn hier entsteht eine Art Theater zweiter Ordnung: die Geburt eines Meta-Theaters aus dem Geiste des Zynismus. Überhaupt der Zynismus! Er ist das heimliche Thema dieses herausfordernden, widersprüchlichen Abends und überraschenderweise ist er auch sein stärkstes Mittel. Denn wie Rau gerade den Lardi-Text montiert hat, wie sie langsam erst unbeeindruckt von den in ihren Augen luxuriösen Verhältnissen in den heutigen Auffanglagern an der EU-Grenze erzählt, wie sie dann immer betroffener in ihre Afrika-Erinnerungen eintaucht, in die täglichen kleinen Rassismen und die Massaker, deren Opfer wie Täter sie in ihren Lagern „durchfüttern“ mussten, dann zeigt das erst einmal nicht nur die erschütternde Sinnlosigkeit dieser organisierten „Hilfe“. Es führt zugleich die furchtbare Ökonomisierung der Anteilnahme vor. Wohldosierter Zynismus Es ist der selektive Blick, das Sehen des einen und Übersehen des anderen Leids, das Rau uns in Gestalt der zynischen, sanft-rassistischen Ursina-Lardi vor Augen hält: ein wohldosierter Zynismus, den wir im Gefolge der Mainstreammedien täglich vollziehen. Einen „TheaterEssay“ hat Rau „Mitleid“ selbst genannt. Und trotzdem auf den ersten Blick nichts essayistisch an den (pseudo)-biografischen Monologen der beiden erscheint, bewegen sich ihre Erzählungen doch auf so subtil doppelbödigem Niveau, schlagen sie unentwegt so dünne Fäden zu den nur mitgedachten, weltgeschichtlichen Hintergründen, dass man sehr bald ihr Artifizielles erkennt. Schrecklich ist dieser Abend und erschütternd und mit allem Vor und Danach ein erstaunliches Reflexionsspiel. SZ, 19.1.16 NZZ Online, 19.1.16 ro zu chen ncto sung - Flucht in Beethoven taz, 19.1.16 THEATER An der Schaubühne Berlin brachte der Regisseur und Autor Milo Rau „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ heraus, die das NGO-Engagement hinterfragt er ist Norm Geld Wille mal men. - ein sich ssen, ei zu rden, wir!“. nten auch n zu dabei tung at in stem n. Da ken.“ enen - ohne , für haus h ein mehr - h gibt auch nen. Ursina Lardi in „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ Foto: Daniel Seifert VON KATRIN BETTINA MÜLLER Sie hießen „Teachers in conflict“, „Heal Africa“ oder „Konvoi der Hoffnung“. Sie wollten helfen, nach dem Völkermord in Ruanda, in einem Flüchtlingslager in Goma am Kiwusee. Zwei Millionen Hutu waren auf der Flucht vor der TutsiBefreiungsarmee in den Kongo gekommen. Vermutlich an die 1.000 NGOs waren vor Ort. Daran erinnert sich die Schauspielerin auf der Bühne, die damals, mit 19, Teil dieser Weißen gewesen war. Was haben sie sich zugetraut? Was wurde von ihnen erwartet? Mit Workshops, mit Friedenserziehung, mit Beten, Tanzen und Singen das nächste Massaker zwischen Hutu und Tutsi verhindern? Ursina Lardi spielt an der Berliner Schaubühne diese Schauspielerin, die einmal aus Enthusiasmus und weil es sich gut macht im Lebenslauf, als Entwicklungshelferin im Kongo war. Sie spricht im schlichten blauen Kleid ins Mikro, sie spricht in die Kamera, sie redet das Publikum direkt an, vorsichtig durch den Schutt, den Müll auf dem Bühnenboden staksend. Sie vergleicht ihre Arbeit im Theater mit der als Helferin. Wenn sie Ödipus spiele, der getrieben wird von einer Scham und einer Schuld, die Immer steht dabei die Frage im Hintergrund, wie ertragen wir das Elend der anderen, warum schauen wir es an? er lange nicht erkennen kann – oder nicht erkennen will –, gleicht das dann nicht dem Einsatz derer, die getrieben von der Schuld des Kolonialismus jetzt versuchen, die Folgeschäden zu bekämpfen? Folgen nicht beide Rollen einem ähnlichen Muster? „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ ist das neueste Stück von Milo Rau überschrieben, in dem der Schweizer Regisseur mit Hilfe von zwei Schauspielerinnen in zwei Monologen auch eine kritische Bestandsaufnahme der eigenen Arbeit als politischer Regisseur unternimmt. Der Text beruht auf vielen Interviews mit NGOMitarbeitern, mit Geistlichen und Kriegsopfern, geführt entlang der gegenwärtigen Flüchtlingsrouten, aber auch im Kongo. Immer steht dabei die Frage im Hintergrund, wie ertragen wir das Elend der anderen, warum schauen wir es an? Der Text beruht aber auch auf einer Analyse des klassischen Schauspiels, der Notwendigkeit von Empathie und ihrer professionellen Vermittlung im Theater. Beide Perspektiven überschneiden sich, fragen aus unterschiedlichen Richtungen nach der Funktion und Funktionalisierung von Mitleid. Das macht die Inszenierung aufregend, dieses stete Hinterfragen der eigenen Gründe. Milo Rau, der in seinen großangelegten Recherche- und Inszenierungsprojekten wie den „Moskauer Prozessen“ und dem „Kongo-Tribunal“ versuchte, die Hebelwirkung der Instrumente des Theaters bis in die Realität selbst hinein zu verlängern, nimmt sich selbst, die Figur des Regisseurs, nicht aus der Kritik europäischer Überheblichkeit und Überschätzung aus. Afrikanische Schicksale Aber das ist wiederum nur ein Teil der komplexen Geschichte. Immer wieder scheint eine Verbundenheit mit und ein Berührtwerden von den afrikanischen Schicksalen auf, die neben der Erkenntnis des eigenen Zynismus wie eine zweite Spur mitläuft. Das sticht besonders am Anfang und am Ende hervor, wenn die belgische Schauspielerin Consolate Sipérius auftritt, die in Burundi geboren wurde und die erzählt, dass sie vier Jahre alt war, als ihre Familie ermordet wurde. Sie ist Überlebende und Zeugin des Völkermords; und sie ist eine Künstlerin, die die Antike liebt, die großen tragischen Heldinnen. Rachefantasien à la Tarantino, oh ja, die liebt sie auch, damit hat sie sich schon aus einer depressiven Phase geholfen. Aber das Angebot des Regisseurs, sagt sie, auf der Theaterbühne auf ihr weißes Publikum mit dem Maschinengewehr zu zielen als Figur der Rache für erfahrenen Rassismus, lehnt sie dann doch dankend ab. Die Stadt Kigali, der Kiwusee, die Grenzstadt Goma, die Flüchtlingslager im Kongo oder in Ruanda, sie sind in der Inszenierung nur in der Sprache präsent und in wenigen, ausgesuchten Geräuschen. „Mitleid“ ist auch ein Stück gegen die Überwältigungsästhetik der Bilder in den alltäglichen Medien, gegen das dramatische Erzeugen von Gefühlen mit den Nachrichtenbildern, gegen die Permanenz der Steigerung ins Schlimmere. Die weiße Schauspielerin erzählt in der Rolle der ehemaligen Entwicklungshelferin, wie sie sich in die höchst dramatische Musik von Beethoven geflüchtet und darin verbarrikadiert habe, um Abstand zu halten zu dem Sterben und Morden der Massaker, die sie miterlebte. Diese Flucht in eine gewaltsame Ästhetik, mit der man sonst nicht eben geizt an der Schaubühne und an anderen Theatern, um das Schreckliche des realen Geschehens zu betonen, Milo Rau lässt sie aus. Und das macht seinen Text stark, ebenso wie die sehr präzise Arbeit der Schauspielerinnen. Milo Rau ist nicht nur ein interessanter Theaterregisseur, sondern auch ein guter Propagandist der eigenen Projekte. Seine Interviews gleichen Manifesten. Ohne Anteile von Größenwahn, ohne die Gabe, die Realität in der Imagination überschreiten zu können und andere dahin mitzuziehen, hätte er wohl für viele seiner Arbeiten nie die notwendige Unterstützung, die vielen Teilnehmer gefunden. Er ist ja selbst manchmal wie ein Missionar unterwegs. Und das hat wohl auch seinen Blick geschärft auf die Projektionen und Fiktionen, die sich die Helfer mit ihrer Macht aufbauen. F.A.Z. E-Paper: die F.A.Z. jetzt online lesen, auch für das iPad 1 von 3 http://www.faz.net/e-paper/?GETS=pcp;faz-net;pcc;epaper.navitab#F... F.A.Z., Montag den 18.01.2016 FEUILLETON 13 FAZ, 18.1.2016 Wir Kapitalisten des Leidens Wie friedlich auch die Absichten, am Ende entscheidet immer die Gewalt: Milo Rau bringt sein Stück „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ an der Berliner Schaubühne zur Uraufführung. Was für ein Saustall! Auf der halbrunden Spielfläche in der Berliner Schaubühne herrscht das nackte Chaos – als hätte jemand seine Wohnung entrümpelt und alles wüst auf die Straße geworfen, und dann hätten andere Leute noch ihren Sperrmüll dazugeschmissen: Autoreifen, Holzkisten, Plastikfolien, Papierfetzen, Tragetaschen, Blechdosen, Kissen, zerbrochene Möbel, getrocknete Zweige, undefinierbare Splitter, einen defekten Kühlschrank, ein gemustertes, angebranntes Sofa, darauf eine Wanduhr, stehengeblieben um zwanzig vor zwölf. Was der Bühnenbildner Anton Lukas da für die Uraufführung von Milo Raus Zweifrauenstück „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ zusammengewürfelt hat, soll an diesem Abend nicht mehr und nicht weniger als die heutige Welt in ihrem desaströsen Zustand darstellen. Alles schreit nach Heilung, Struktur, Ordnung. Aber wie soll das gehen, sind doch bereits so viele Hoffnungen, Utopien, Verbesserungskonzepte in Bausch und Bogen gescheitert? Dumm gelaufen, räumt der 1977 in Bern geborene Regisseur, Journalist und Soziologe Milo Rau zwar ein, ohne sich deshalb lang entmutigen zu lassen. Er möchte eben auf seine Art die Welt retten, und wenn das nicht klappt, hat er es zumindest probiert. Wer das für albern hält, wird an seinen nüchtern konzentrierten Theaterstücken keine Freude haben, allerdings auch vor Rau keine Gnade finden. Der nämlich wirft den Europäern Ignoranz und Blindheit gegenüber den Schrecknissen jenseits ihres Kontinents vor, für die ihr turbokapitalistisches Wirtschaftssystem, ihr imperialistisches Auftreten, ihre Firmen und Waffen verantwortlich seien. Dabei schont er die eigene Zunft mit ihrer „Mitleidsästhetik des Westens“ nicht, nimmt sich selbst von diesen „Kapitalisten des Leidens“ nicht aus: „Wir schlagen einfach aus den Opfern und Toten unserer Wirtschaft noch ein zweites Mal Kapital, indem wir sie im Kunstraum inszenieren und bemitleiden.“ Milo Rau hat eine Mission, spricht darüber engagiert wie eloquent in Essays, Zeitungsbeiträgen, Interviews – und auch im Theater, das er als demokratische Institution für politische Bildung und Aufklärung betrachtet. Er nutzt meist die Kunstform des „Reenactments“, um komplexe historische Vorgänge mit Originaltexten dokumentarisch 18.01.2016 09:52 F.A.Z. E-Paper: die F.A.Z. jetzt online lesen, auch für das iPad http://www.faz.net/e-paper/?GETS=pcp;faz-net;pcc;epaper.navitab#F... nachzustellen und wie in einer Therapiesitzung verborgene Wahrheiten ans Tageslicht zu bringen, etwa den Prozess gegen den rumänischen Diktator Nicolae Ceauşescu, das Verfahren gegen die russische Punk-Band Pussy Riot, das Manifest des rechtsextremen Attentäters Anders Breivik. Für „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ hat er mit zwei Schauspielerinnen einen Monolog entwickelt, der sich neben einigen biographischen Passagen im Wesentlichen auf Gespräche mit zahlreichen Mitarbeitern von Nichtregierungsorganisationen in Krisengebieten stützt. Die Hauptfrage dieses thematisch vielfältig verästelten Textes lautet: Ist die Situation auf der Welt wirklich dermaßen aussichtslos, dass jede Hilfe misslingen muss? Weil mit Mitleid reagiert wird, wo Gerechtigkeit sein müsste? Und weil Charity keine Solidarität ersetzt? Harter Stoff, gewiss, aber als Autor wie als Regisseur bringt ihn Milo Rau präzise und bewegend auf die effektvoll zugemüllte Bühne. Ursina Lardi gibt eine Schweizer Lehrerin, die es 1994 in den Kongo verschlagen hatte, wo sie Entwicklungshilfe in Form von „Friedensarbeit“ an der Universität und alsbald in Flüchtlingslagern leistete. Gänzlich „krisenunerfahren“, wurde sie dort mit dem Völkermord im Nachbarland Ruanda konfrontiert. In einem eleganten blauen Strickkleid und hellen Pumps erzählt sie, damenhaft zwischen all dem Unrat auf ein Stehpult gestützt, von Ödipus, der seine Schuld so lange nicht begreifen will und den sie im Jugendtheater spielte, von ihren traumatischen Erlebnissen in Zentralafrika und wie übertrieben ihr erscheint, was mit der „Flüchtlingskrise“ jetzt hierzulande als „größte humanitäre Katastrophe des Jahrhunderts“ bezeichnet wird – schließlich hat sie dem Grauen damals direkt ins Gesicht geblickt, dem Genozid und wie Ende Juli 1994 zwei Millionen Menschen „völlig unorganisiert“ in kürzester Zeit aus Ruanda in den darauf überhaupt nicht vorbereiteten Kongo geflohen waren. Lardi wirkt sehr gefasst und sachlich, als hielte sie einen Vortrag vor jungen Lehrern, die – wie einst sie – weit wegwollen. Die Erinnerungen treiben ihr später dennoch fast die Tränen in die Augen, doch sie strengt sich merklich an, um nicht zur weinerlichrührseligen Weißen zu werden. Zwischendurch zeigt sie Landkarten und Fotos von heutigen syrischen Flüchtlingen: „Alle sehen aus wie Hipster.“ Ursina Lardi spielt den Monolog einer zerrütteten, verzweifelten, von ihren Erfahrungen überrollten und bis zum Zynismus hellsichtigen Europäerin mit heißem Verstand, kalter Wut und vor allem mit entschiedener Liebe. So gewinnt ihre Lehrerin ungeschützte Erträglichkeit wie arrogante Unerträglichkeit und ihre Erzählung eine geradezu obszöne Wahrhaftigkeit. Denn trotz sämtlicher redlicher Bemühungen und friedlicher Absichten kommt es schlussendlich immer nur darauf an, „wer die Maschinengewehre hat“. Am Anfang und am Ende des Abends meldet sich die in Burundi 2 von 3 18.01.2016 09:52 F.A.Z. E-Paper: die F.A.Z. jetzt online lesen, auch für das iPad http://www.faz.net/e-paper/?GETS=pcp;faz-net;pcc;epaper.navitab#F... geborene Consolate Sipérius zu Wort. Sie schildert, wie ihre Familie bereits 1993 infolge des mörderischen Konflikts zwischen Hutu und Tutsi vor ihren Augen umgebracht und sie von belgischen Eltern adoptiert worden war. Sie sitzt hinter einem Mischpult und schaltet sich manchmal in Ursina Lardis Suada ein, indem sie Geräusche wie Regenschauer oder Vogelgezwitscher einblendet. Als Genozidüberlebende verschafft sie dem Stück mit ihrem Zeitzeugen-Bonus das Gütesiegel der Authentizität. Beide Frauen werden gefilmt, ihre Köpfe auf eine riesige hängende Leinwand projiziert. Damit präsentiert Milo Rau einerseits noch die Realität, andererseits schon ein Bild von ihr und stellt seine beklemmende Rekonstruktion selbst zur Debatte. Viel Neues ist nicht zu hören, das hätte wohl kaum jemand erwartet, bloß wie diese kühle theatralische Lektion in Sachen Politik und Geschäft erteilt wird, ist eine unbequeme und dabei elektrisierende Herausforderung. Die Welt wird in knapp zwei Stunden bestimmt nicht gerettet, aber schlechter wenigstens auch nicht. IRENE BAZINGER 3 von 3 18.01.2016 09:52 Deutschlandfunk, 17.1.2016 "Mitleid" an der Schaubühne Die unerbittliche Logik des Gewehrs Warum wiegt ein ertrunkener Flüchtlingsjunge an den Toren Europas moralisch offenbar mehr als zum Beispiel 1.000 Tote in den kongolesischen Bürgerkriegsgebieten? Das fragt der Schweizer Theatermacher Milo Rau in seinem neuesten Stück "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs" an der Berliner Schaubühne. Dafür hat er sich auch wirklich in den Kongo begeben. Von Eberhard Spreng "Es gibt im europäischen Theater einfache und schwere Übungen. Die einfachen Übungen sind: Das Auswendiglernen von Figurentext. Die Performance. Oder das sogenannte dokumentarische Theater." Milo Raus Vertrauen in die Kraft der Bühne ist beschränkt. Vor allem glaubt er nicht, dass die Bretter die Welt bedeuten können, oder dass ein Schauspieler das verkörpern kann, was sich vor dem Engel der Geschichte unentwegt an Elend, Mord und Qual aufschichtet. Aber, woran er mit seiner Protagonistin Ursina Lardi in seinem Essay vom Mitleid und dem Maschinengewehr glaubt, ist, dass er von der Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit einer Europäerin erzählen kann, die als junge Frau mal in einer NGO im Kongo aktiv war und später Schauspielerin wurde. Eingerahmt wird die Reise ins Herz der Finsternis einer Wohlmeinenden von einem Pro- und Epilog: Die in Burundi geborene belgische Schauspielerin Consolate Sipérius sitzt hinter einem Tisch, ihr Gesicht erscheint groß auf einer Leinwand hinter der halbrunden Bühne. Ihre Eltern waren 1993 vor ihren Augen ermordet worden, berichtet sie, erschossen mit Maschinengewehren. Später kam sie als Adoptivkind nach Belgien, in ein Dorf, wo sie als einzige Schwarze begafft wurde. Consolate bleibt während Lardis Solo stumme Zeugin, als Nachweis des Authentischen im Dokumentartheater des Milo Rau. Natürlich weiß der Autor und Regisseur um sein Spiel mit der schwarzen Hautfarbe und der Opferrolle der Schauspielerin. "Schwarz ist immerhin ein klares Statement" sagt die Lardi provozierend, ironisch in ihrem Monolog. Milo Rau verletzt Klischee-Botschaften der medialen Erregungsproduktion Sie steht inmitten einer zerstörten Einrichtung: ein halb verkohltes Sofa, kaputte Plastikstühle, zerfetzte Kleidung. Vor ihr ein Mikrofonständer, hinter ihr die breite Leinwand, mit ihrem Video-Abbild. Das Foto des zwischen dem türkischen Bodrum und dem griechischen Kos ertrunkenen Jungen Ailan hält sie vor die Videokamera und dann erzählt sie zunächst von einem Besuch in einem Flüchtlingslager an der mazedonischen Grenze und den jungen syrischen Männern, die alle wie Hipster aussehen, sich zieren, Wasser aus einem Container zu trinken, bevor sie in klimatisierte Busse einsteigen. "Es tut mir Leid Aber ich verstehe das nicht: Das soll die Katastrophe unserer Zeit sein? Das? Eine Helferin sagte mir: Es ist 1.000 Mal schwieriger, ein ACDC-Konzert zu organisieren als so ein Lager." Milo Rau verletzt Klischee-Botschaften der medialen Erregungsproduktion. Die Dinge sind nicht, was sie scheinen sollen, hinter jeder Bildebene steckt eine andere, Verborgene. Aber im Kern geht es ihm um die bittere Erkenntnis einer jungen Frau, die ihre hehren Vorstellungen in ihrer Arbeit als junger Helferin in der NGO "Teachers in Conflict" verraten muss. Das war in dem Sammelsurium der im Kongo aktiven Nicht-Regierungs-Organisationen, die die nach dem Völkermord an den Tutsis aus Ruanda geflohenen Hutu-Mörder versorgten, bevor Kagames Tutsi-Armee die Grenze überquerte und diese Lager ihrerseits in ein Blutbad verwandelte. Ein Soldat habe der "Weißen auf ihrem Feldherrenhügel" ein paar Mal zugewinkt, und Freude habe sie empfunden beim Geräusch der Maschinengewehrsalven, die die Völkermörder trafen. In einem Traum wird sie von lachenden Männern gezwungen, ihre ehemalige Freundin zu bepinkeln, auch um ihre Haut zu retten. Filme wie von Triers "Dogville" und Tarantinos "Inglorious Basterds" werden zitiert, wenn es um die Folgen der Selbsttäuschung und das Recht auf Rache geht. Milo Rau schreibt nach eigenen Recherchen, lässt sich aber ebenfalls inspirieren von dem Roman "Hundert Tage" des Landmannes Lukas Bärfuss. "Was geschieht, wenn die Verdrängung nicht mehr funktioniert, wenn einen die Realität plötzlich heimsucht?", hatte der gefragt. Im Kongo findet, so will Rau offen legen, seit langem das wohl best-verschwiegene Massensterben der Gegenwart statt, ein Holocaust, dem der Regisseur schon in seinem groß angelegten Kongo-Tribunal gerecht werden wollte. Die Hintergründe: Abbau von Rohstoffen, von Koltan, von Kobald, Kupfer, Gold und Diamanten. Dies aber ist ein kleiner Abend. Er zeigt mit Brecht, dass niemand gut sein kann, wenn die Verhältnisse nicht so sind, mit Adorno, dass es nichts Richtiges im Falschen geben kann. Niemand, und vor allem kein Mensch aus dem Abendland, richte sich also ein im Glauben an die eigene Wohltat. Das ist nach Jahrhunderten von Kolonialismus und Neokolonialismus, Imperialismus und Neo-Imperialismus nicht mehr möglich. "Was ist deine Situation" bleibt Raus zentrale Frage beim Ausloten des moralisch Möglichen und er bemerkt lakonisch: "Am Ende des Tages kommt es drauf an, wer die Maschinengewehre hat." Ein verstörender Abend. Und hochaktueller Beitrag zu laufenden Debatten. TSP, 18.1.2016 BERLINER THEATER-DOPPEL Milo Rau an der Schaubühne und Hallervorden spielt Hauptmann Gute Menschen gibt es nicht Labor der Empathie: Milo Raus Provokation „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ Von Sandra Luzina „Ich bin auch nur ein Arschloch“, bekannte der Theatermacher Milo Rau jüngst in der Schweizer „Sonntagszeitung“. Damit wollte er sich nicht etwa als eitler Regiedespot outen, der seine Schauspieler schikaniert. Vielmehr rechnet er mit dem „zynischen Humanismus“ ab, der für ihn derzeit die dominierende europäische Lebensphilosophie ist. „Alle sind Arschlöcher“, lautet nun auch das wenig erbauliche Motto des dokumentarischen Theaterstücks „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“, das an der Ursina Lardi Schaubühne Premiere hatte. Der war mit dem Doppelmonolog von Regisseur Ursina Lardi und Consolate Sipérius auf fragt nach den Gren- Recherche zen unseres Mitleids und den Grenzen in Bodrum des europäischen Humanismus – auf polemisch zugespitzte, ja provokante Weise. Rau ist ein Theatermacher, der polarisiert. Hier zieht er nicht nur gegen die Hilfsindustrie der NGOs und eine westliche „Wohlfühl-Ethik“ zu Felde, er macht auch dem Theater den Prozess. Ursina Lardis Sorge gilt bei ihrem ersten Auftritt sich selbst. Sie stellt sich ihr Alter und ihre zunehmende Gebrechlichkeit vor. Und fragt dann in den Zuschauerraum hinein: „Wer sieht uns, wenn wir leiden? Wer sieht uns, wenn wir zugrunde gehen?“ Letztlich ist es die Frage nach dem abwesenden Gott, die hier gestellt wird. Doch Lardi verdreht hier schon auf bemerkenswerte Weise den Mitleidsdiskurs. Die Schaubühnen-Aktrice reklamiert für sich die Kunst der Einfühlung, um dann völlig ungerührt über das Foto von Alan Kurdi zu sprechen. Der ertrunkene syrische Junge, der an der Küste von Bodrum angeschwemmt wurde, wurde zur Ikone und löste überall Mitleid aus. Lardi hat, so erzählt sie dem Publikum, zusammen mit dem Regisseur eine Recherchereise entlang der Flüchtlingsroute unternommen, von Bodrum aus fuhren sie in ein Flüchtlingslager an der mazedonischen Grenze. Aber auch in den Kongo sind sie gereist. Ursina Lardi war früher selbst für eine NGO tätig. Ihre Erfahrungen sind in den Monolog eingeflossen. Es ist nicht immer genau zu entscheiden, wer hier spricht: Lardi selbst oder eine fiktive Entwicklungshelferin, die es in den Kongo verschlägt und die bald er- Waten durch Müll. Ursina Lardi (rechts) und Consolate Sipérius reflektieren das Flüchtlingselend. kennen muss, das es so etwas wie einen guten Menschen nicht gibt. Lardi stapft im blauen Strickkleid über die mit Müll übersäte Bühne. Zugleich ist sie überlebensgroß auf einer Leinwand zu sehen. Manchmal betrachtet sie ihr mediales Abbild und scheint auf Distanz zu sich zu gehen. Sie zeigt Fotos von jungen Männern, die sie an der mazedonischen Grenze getroffen hat und stellt mit unverhohlenem Sarkasmus fest, die Syrer sähen doch alle wie Hipster aus. Unsere mediale Aufmerksamkeit und unser Mitleid endet an der Außengrenze der EU, das ist für Milo Rau der Skandal. Seine Inszenierung – und das ist das eigentlich Provozierende – schlägt den Bo- gen vom medial gut ausgeleuchteten Flüchtlingstreck zu den anhaltenden Morden in Zentralafrika. „Ich war blutjung und dumm“, berichtet Lardi über ihren Einsatz im Kongo. Und berichtet dann, wie völlig unbedarfte junge Europäer auf Kriegsopfer losgelassen werden und abstruse Workshops abhalten. In ihren Schilderungen stellen die humanitären Hilfsorganisationen, die Namen wie „Konvoi der Hoffnung“ oder „Freunde der Naturvölker“ tragen, ein absurdes Business dar, das Profit aus dem Elend schlägt. In ihrem beißenden Spott muten die Szenen gelegentlich wie politisches Kabarett an. Die Aktivistin erzählt auch von Massakern, die sie miterlebt hat. Foto: Daniel Seiffert Schließlich wird auch sie gezwungen, eines der Opfer zu demütigen. Rau strapaziert die Fabel arg, um zu demonstrieren, dass jeder inder Bürgerkriegshölledie moralische Integrität verliert. Er mutet seiner Darstellerin einiges zu: Lardi muss sogar auf die Bühne pinkeln. Das Stück schildert aber nicht nur eine Desillusionierung, es verweist auf ein grundsätzliches Dilemma. „Am Ende der Geschichte kommt es daraufan,wer die Maschinengewehre hat“, resümiert Ursina Lardi. Die von ihr verkörperte Figur, die narzisstische und rassistische Züge trägt, ist zwar das Zentrum des Abends, doch den Prolog hält die aus Burundi stammende Consolate Sipérius. „Ich bin eine Zeugin“, Wenn dem Prinzipal das Lächeln vergeht stellt sie sich vor. Sie musste als Kind mit ansehen, wie ihre Eltern bei einem Genozid ermordet wurden. Später wurde sie von einem belgischen Paar adoptiert. Sie sei aus einem „Ikea-Katalog für Waisen“ ausgewählt, spottet sie. Ihre Erfahrungen im belgischen Mouscron fasst sie so zusammen: „Dies ist eine Welt ohne Mitleid.“ Sie spielt hier bewusst nur eine marginale Rolle. Aufmerksam lauscht sie dem Monolog der Einfühlungskünstlerin Lardi und rücktsie schon durch ihre Präsenz, ihren Blick in ein anderes Licht. Mit „Fear“ von Falk Richter, das sich mit den Entwicklungen am rechten politischen Rand beschäftigt, gelang der Schaubühne zuletzt ein Abend mit großem Erregungspotential. Die AfD, die sich provoziert fühlte, forderte sogar die Absetzung. Milo Rau schießt sich nun nicht auf Demagogen und Pegida-Zombies ein, er attackiert die Selbstgerechtigkeit und das Humanitätsgedusel von aufgeklärten Europäern und betrachtet auch die Mitleidsfabrikation des Theaters kritisch. Damit beute man das Leiden der Anderen lautet sein VorEr attackiert aus, wurf. Doch er selbst die polemisiert von eimoralischen PoBorniertheit ner sition aus, erhebt der ach so sich über Zyniker, aufgeklärten Leidenskonsumenten und EmpaEuropäer thie-Athleten – und macht sich dadurch angreifbar. In ihrem Schlussmonolog berichtet Consolate Sipérius davon, wie sie sich den Tarantino-Film „Inglourious Basterds“ angeschaut habe. Besonders beeindruckt hat sie die Szene in dem Pariser Kino, in der das Gesicht der Jüdin Shosanna in Großaufnahme auf der Leinwand erscheint und auf die versammelte Nazi-Elite herabschaut. Diesen mitleidlosen Blick der Rache wollte auch ihr Regisseur haben, erzählt Sipérius. Doch als er sie aufforderte, mit dem Maschinengewehr auf das Publikum zu zielen, habe sie sich geweigert. Ja, auch Milo Rau ist ein Arschloch, er stilisiert sich jedenfalls dazu. „Mitleid“ ist ein verstörender Abend, der mit einfachen Gewissheiten aufräumt. Aufwühlend auch dank der großartigen Darstellerinnen. Das Stück ist nicht nur Anklage. Gerade wenn es die moralischen Ambivalenzen der hilflosen Helfer ausleuchtet, wird es zum Appell für Menschlichkeit. — Wieder am 29. und 30. Januar, 20.30 Uhr, sowie am 31. Januar, 19 Uhr Zitty, 3/2016 B.Z., 17.1.2016 Uraufführung Aufwühlend: Humanismus und Mitleid in der Schaubühne „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ handelt von der Unfähigkeit Europas, an den Krisenherden unserer Welt Gutes zu tun - keine einfache Kost. Erschreckend, aufwühlend und brandaktuell! „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ handelt von der Unfähigkeit Europas, an den Krisenherden unserer Welt Gutes zu tun. Der Schweizer Autor und Regisseur Milo Rau inszenierte das Stück an der Schaubühne Berlin. Premiere am Samstagabend. In den Hauptrollen: Ursina Lardi und Consolate Sipérius. Das Stück führt den Zuschauer über Flüchtlings-Routen im Mittelmeer in den zentralafrikanischen Bürgerkrieg. Es erzählt die Geschichte von zwei Frauen: einem HutuMädchen aus Burundi, deren Familie in dem bewaffneten Konflikt abgeschlachtet wurde, und einer Entwicklungshelferin aus der Schweiz, die den Genozid in Ruanda im Nachbarland Kongo miterlebt. In einem Doppel-Monolog berichten die Frauen von ihrem Schicksal. Das Mädchen aus Burundi wurde von einer belgischen Familie adoptiert. In dem Städtchen ist sie eine echte Attraktion: das „erste Negermädchen“. Die Entwicklungshelferin muss einsehen, dass ihr humanitärer Einsatz nichts Gutes bewirkt – im Gegenteil. Immerhin: Beide Frauen haben am Ende noch etwas, das ihnen Hoffnung macht. „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs ist keine einfache Kost. Schonungslos und direkt wird der Zuschauer mit den unfassbaren Geschehnissen auf der anderen Seite der Welt konfrontiert. Als sich die Hauptdarstellerin auf der Bühne erleichtert, herrscht im ganzen Raum betretene Stille. Wie sollen wir mit dem Irrsinn umgehen? Diese Frage dürfte sich beim Verlassen des Theaters jeder stellen. Darum ist es ein gutes Stück, ein wichtiges Stück! von Olaf Mehlhose Der Freitag, 20.1.16 Weinen, wo man gar nicht weinen darf Die Schaubühne führt Milo Raus »Mitleid. Die Geschichte des Maschinegewehrs« auf Neues Deutschland Online, 21.1.16 Von Alexander Isele Am Ende des Stückes widersetzt sich die Schauspielerin Consolate Sipérius den Anweisungen ihres Regisseurs Milo Rau: Dieser wollte, dass sie mit dem Maschinengewehr in jenes Publikum schießt, das sich am Leid anderer bestenfalls ergötzt, oft genug sogar daran verdient. Sipérius ist Überlebende und damit Zeugin eines Massakers in Burundi, bei dem ihre Eltern starben. Sie selbst wurde von einer belgischen Familie »aus dem Katalog« ausgesucht und adoptiert. Ob als Opfer oder Zeugin: Ihr Platz auf der Bühne, links im Hintergrund, ohne viel zu sagen, ist allein deshalb gerechtfertigt, weil sie den Zuschauer mitfühlen lässt am Schicksal der Armen und Hilfsbedürftigen dieser Welt. Milo Raus »Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs« feierte in der Schaubühne Premiere. Das Stück ist größtenteils ein Monolog, die Bühne eine große Müllhalde, der Fantasie des an »Nachrichten« geschulten Blickes wird die Verortung des Schauplatzes überlassen. Eine Reise zu den Zentren der heutigen menschlichen Katastrophen beginnt, entlang der Flüchtlingsrouten, in die Türkei, mit der Fähre nach Griechenland, schließlich nach Zentralafrika, ins kongolesische Bürgerkriegsgebiet. Erzählt wird diese Geschichte von Ursina Lardi. Es ist aber auch eine Reise in Lardis Vergangenheit als – ja, als was genau? – als Entwicklungshelferin, Friedensdienstleistende oder als Touristin? Sie liefert Beweise, dass alles so stattgefunden hat. Fotos mit ihr als 19-Jährige in Goma. Sie erzählt von ihren Erfahrungen als völlig überfordertes »blutjunges und dummes Mädchen« im Auslandsdienst der »Teachers in Conflict«, einer Nichtregierungsorganisation (NGO). Von dieser wurde sie aufgrund ihrer »Standhaftigkeit« im Auswahlverfahren »rekrutiert«. Sie erzählt, wie sie mit 20 Jahren Workshops für traumatisierte Offiziere anleiten musste, die gerade einen Völkermord begangen hatten und sich nun aussöhnen sollten. Von Freunden und Bekannten, die sie, mit ihrem eigenem Geld, vor dem Tod bewahrte, und die sie Jahre später wiedertraf – im Dienste des Militärs. Nach und nach kommen Zweifel auf. Nicht an dem Gesagten und Erlebten, dazu sind Lardis Empfindungen auf der Bühne zu fein, zu präzise, ihr Schauspiel zu überzeugend, zu wuchtig, um sie zu hinterfragen. Es ist Vom Leid der Anderen profitieren: Ursina Lardi die Menge des Erlebten, das zu viel für eine Person zu sein scheint. In der Tat speist sich der Monolog nicht nur aus Lardis Erlebnissen, sondern auch aus Milo Raus eigenen Erfahrungen, denen vieler NGO-Mitarbeiter, Geistlicher und Kriegsopfer, die der Regisseur während seiner Arbeit in Zentralafrika interviewt hat. Lardi nimmt sich ihrer an, verkörpert den ganzen Schmerz, den man bei dieser Arbeit erlebt, die unfassbaren Leiden, die sich beim Anblick von Folter und Massenmord, von Armut, Hunger und Flucht in die Seele ätzen und Nacht für Nacht in Albträumen emporkriechen. Aber auch das Hochgefühl, das sich einstellt bei der Ankunft, wenn man mit 20 denkt, die Welt zu retten und sich dabei von Schwarzen bedienen lässt. Ursina Lardi ist grandios! Sie fesselt, obwohl sie fast nichts macht, außer am Pult zu stehen und zu erzählen. Sie häutet sich förmlich auf der Bühne, Schicht um Schicht fällt der selbstgerechte Anspruch ab, Gutes zu tun, ihr Mitleid verkommt zu einer herablassenden Haltung. Nach und nach offenbart sich die Eigenheit einer Industrie, die recht gut davon lebt, das Leiden der anderen zu verwalten. Die Frage ist, welche Industrie verkörpert sie gerade – die Entwicklungsindustrie, die Theaterindustrie? Lardi ist sich ihrer Rolle vollkommen bewusst, sie lässt teilhaben an ihrem Erinnerungsprozess, der nur einen Schluss zulässt: »Hier also zu weinen. Das wär’ das allerletzte«, sagt sie. Und während sie das sagt, kann sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Milo Rau führt mit »Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs« ein in sein Konzept des »zynischen Humanismus«. Nicht, dass man nicht weinen darf, muss, in Anbetracht des Elends auf der Welt. Nur darf man nicht vergessen: »Ich profitiere von der Ungerechtigkeit der Welt! Ich bin ein Foto: Daniel Seiffert Arschloch!«, wie Rau kürzlich in der Schweizer »Sonntagszeitung« schrieb. Das Stück ist somit auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Theater selbst, mit der Rolle des Au- Ursina Lardi häutet sich förmlich auf der Bühne, Schicht um Schicht fällt der selbstgerechte Anspruch ab, Gutes zu tun. tors, der Schauspieler und auch der des Publikums. Das Stück fragt, wie es sein kann, dass ein Foto eines toten geflüchteten Jungen im Mittelmeer ganz Europa in Trauer stürzt, während der sich abzeichnende Genozid in Burundi es kalt lässt. Lardi sagt: »Und die Moral: erschieß’ sie, al- le! Am Ende kommt es darauf an, wer die Maschinengewehre hat.« Wir alle sind Arschlöcher, unfähig zu helfen. Zurück zu Consolate Sipérius. Pround Epilog hält sie, sitzend, mehr an die Kamera gerichtet als ans Publikum. Opfer und Zeugin ist sie, das reicht im Authentizitätszwang des Theaters für eine Rolle auf der Bühne. Antigone war sie schon, hat die weibliche Hauptrolle in Shakespeares »Romeo und Julia« gespielt. Sie müpft auf gegen Rau. Sie braucht diese Rolle nicht. Sie muss kein Zeugnis ablegen, weder über den Bürgerkrieg noch über ihre Berechtigung, auf der Bühne zu sein. Und ganz sicher hat sie kein Publikum nötig, das anhand ihrer Geschichte Mitleid empfindet. Sie legt den Zynismus offen, den wir uns angewöhnt haben. Und spielt ihn nicht mit. Nächste Vorstellungen: 29.-31. Januar Tiroler Tageszeitung, 17.1.16 nachtkritik, 17.1.2016 Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs – An der Schaubühne Berlin kitzelt Milo Rau das zentraleuropäische schlechte Gewissen Europa, du In-Kontinent! von Sascha Ehlert Berlin, 16. Januar 2015. Ursina Lardi hat Pippi in den Augen. Sie rafft ihr Kleid, schaut konzentriert ins Bühnenrund, und dann: ein Rinnsal. Sie erzählt aus einem Alptraum, die Pfütze zwischen ihren Beinen allerdings, die ist echt. Jene Szene, in der die als idealtypische Vertreterin der herrschenden Klasse treffsicher besetzte Schaubühnen-Darstellerin im strengen blauen Kleid davon erzählt, wie sie ihrer afrikanischen Freundin auf den Kopf uriniert und anschließend einen grausamen Tod sterben lässt, markiert den späten Wendepunkt einer Inszenierung, die bis dahin kaum überraschte. Vor allem deshalb, weil das Vorabrauschen im Blätterwald so laut gewesen war, dass man zwangsläufig wusste, worum es an diesem Abend gehen würde, bevor man überhaupt am Lehniner Platz stand. Charity und Betroffenheits-Posts auf Facebook sind nett gemeint, aber eigentlich nicht mehr als zynischer Ausdruck von zentraleuropäischem Egozentrismus – und wir beziehungsweise unser Reichtum letztendlich verantwortlich für Massenarmut und Massenmorde auf dem afrikanischen Kontinent. Der Schweizer Theatermacher und Aktivist Milo Rau gibt im Namen dieser Erkenntnis Interviews und schreibt Essays, die voll aufklärerischem Furor nicht weniger als das Ende der Festung Europa einfordern. "Retten wir gemeinsam die Welt", ruft der Idealist Rau ins Presserund. "Warum sollten wir nicht, wenn auch nur für eine Saison, die alte Schlingensief-Rolle der ironischen Negation aufgeben und, sagen wir es offen: staatstragend arbeiten?" Hilfe, wo ist meine Yoga-Matte? Raus Inszenierung "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs" in der Schaubühne Berlin nun folgt bis zu besagter Piss-Szene so programmatisch dieser Direktive, dass man sich zwischendurch zu langweilen beginnt. Nachdem Consolate Sipérius, in Brüssel lebende Schauspielerin aus Burundi, der Kamera ihre persönliche Fluchtgeschichte erzählen durfte, übernimmt schnell Ursina Lardi das Zepter. Zunächst auch auf der Leinwand, dann in physischer Gestalt. Kurz beäugt sie ihr Leinwand-Ich kritisch, aber dann erzählt sie in Einklang mit diesem mit staatstragender, expressiver Mimik. Guckt mal, der arme Flüchtling! Ursina Lardi © Daniel Seiffert Sie spielt sich selbst als unerträglich zynische und rassistische Schauspielerin, die zu Recherchezwecken in den Kongo zurückkehrt, wo sie einst für eine NGO gearbeitet hat. Wenn etwas nicht ihr bekannten Regeln folgt, dann schreit sie und ruft nach ihrer YogaMatte. Typisch deutsch! Sich an die natürliche Langsamkeit des afrikanischen Lebens anzupassen, käme ihr nicht im Traum in den Sinn. Kurzum: Sie ist eine unerträgliche Person. Nachdem Lardi die Bühne betreten hat, muss Sipérius mucksmäuschenstill sein. Klar, die weiße Frau redet über die Leid-geplagten Afrikaner – ein Monolog, kein Dialog. Raus Karikatur eurozentristischer Ignoranz gerät aber leider über weite Strecken so penetrant, dass sie selbst wirkt wie die "Zeigefinger-Kritik", die er in einem im Programmheft abgedruckten Interview entschieden ablehnt. Grand Finale mit Kalaschnikows Ausnahme ist das Ende. Nachdem Lardi fertig ist mit Pinkeln, ruft sie: "Jesus gibt mir Kraft!" und geht ab. Auftritt Sipérius, die von der großen Leinwand herab von der "Rache des Riesengesichts" aus Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds" erzählt. Sie berichtet, wie die Jüdin Shoshanne Dreyfuß in einem Kino auf der Leinwand auftaucht und Rache an NaziDeutschland nimmt, wie sie Goebbels und Hitler mit Maschinengewehren erschießen lässt. Als das Riesengesicht von Sipérius dies ausführt, muss sie lächeln: "Mein Regisseur meinte, ziel doch mit der AK-47 auf das Publikum, während du das sagst." Obwohl Rau hier doch immerhin andeutet, die Genozide in Afrika, für die Europa Mitverantwortung trägt, seien gleichzusetzen mit dem Holocaust, fällt der Schlussapplaus der Seidenschalträger im Schaubühnen-Globe generös aus. Vermutlich wäre "Mitleid" ehrlicher und wirkungsvoller, hätte Rau zum Grande Finale echte Kalaschnikow-Menschen in den Gängen aufmarschieren lassen. Auf jeden Fall wäre es tatsächlich radikal. pagewizz.com, 17.1.2016 Schaubühne Berlin: "Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs". Premiere im Globe Theater. Eine theatrale Reportage über die desaströsen Verhältnisse in Afrika. Ist der Westen für Genozid und Ausbeutung in Afrika verantwortlich zu machen? Der Titel ist irreführend. Wer von der Geschichte des Maschinengewehrs hört, fühlt sich in die Mitte des 19. Jahrhunderts versetzt, als die ersten Vorläufer der heutigen hochentwickelten vollautomatischen Schusswaffen präsentiert wurden. Es geht um etwas ganz anderes: Am Ende gewinnt jene Seite, die das Maschinengewehr besitzt bzw. das bessere. Gegen Ende der Inszenierung hält die Schauspielerin Ursina Lardi demonstrativ ein Maschinengewehr in Richtung Publikum. Während des Abends erfahren die Zuschauer, dass etliche Entwicklungsgelder des Westens gen Ruanda in die Waffenbeschaffung geflossen sind. Folglich gab es beim Völkermord in Ruanda 1994 eine - für hiesige Verhältnisse bescheidene - Hochrüstung. Fast explizit ist das eine indirekte Mitschuld, als hätten sich die Hutus und die Tutsis ohne westliche "Beteiligung" friedlich in den Armen gelegen. Für den Regisseur Milo Rau, der sogar den Ödipus-Mythos mobilisiert, ist die Sache klar: An allem Unglück in den Staaten Afrikas und des Nahen Ostens ist der forciert kapitalistische Westen zumindest mitschuldig, wenn nicht mehr. Eine sehr monokausale Erkenntnis. Ursina Lardi, mitten im Müll und live auf Video (Bild: © Daniel Seiffert) Die Festung Europa und ihre wirtschaftlichen Vergehen Auf der Bühne agieren die Belgierin Consolate Sipérius und die immer populärer werdende, leinwanderprobte Helvetierin Ursina Lardi. Eine Interaktion findet nicht statt, beide monologisieren. Sipérius, die ihre Wurzeln in Burundi hat und dort als Kind einen ethnisch bedingten Völkermord miterlebte, übernimmt den Anfang und das Ende. Auch sie zieht, so will es der Regisseur, die westlichen Wirtschaftskolonisatoren in die blutige Mitverantwortung. Rachegelüste steigen auf, euphemistisch ausgedrückt eine Nemesis. Ursina Lardi, die eine junge Entwicklungshelferin und Lehrerin spielt und zwischen Betroffenheit und Zynismus hin– und herschwankt, liefert rein mimisch eine grandiose, bezaubernde Performance ab. Das ist eine neue Akzentuierung des auf sachliche Nüchternheit setzenden Dokumentationsspezialisten Milo Rau, der selbstverständlich mit Lardi eine wochenlange Recherchetournee in besagte Krisengebiete absolviert hat, nur um seine vorgefasste Meinung bestätigt zu sehen. Der Ankläger der "Festung Europa" kommt einem vor, als wolle er auf einen fahrenden Zug aufspringen. Besser: Er läuft einem abgefahrenen Zug hinterher. Milo Rau prangert Zustände an, die bereits in den 80er-Jahren von der deutschen Linken lebhaft diskutiert wurden: Deutschland, das westliche Europa tragen ihren Wohlstand auf dem Rücken Afrikas aus. Der kritische Intellektuelle Milo Rau versucht nicht nur einen Reload zu liefern, sondern einen um einige Einsichten erweiterten Update. Ursina Lardi (Bild: © Daniel Seiffert) Mitten im Müll In einigen Punkten hat er durchaus Recht. Die Coltan- und Kupferförderung mit Hilfe von afrikanischen Mimimallohnempfängern ist tatsächlich eine moderne Form der Ausbeutung, zumal die Produkte anschließend um das Dutzendfache zu Weltmarkpreisen verkauft werden. Die immer wieder erwähnten nichtstaatlichen Hilfsorganisationen (NGOs), altruistisch und egoistisch zugleich, mögen zwar den Einheimischen wie annexionsunwillige Kolonisatoren vorkommen, aber sie versuchen auch mit ihren lebenslaufsstärkenden Aktivitäten eine Teilverwaltung der Ordnung zu organisieren. Milo Rau, der NGO-Beschäftigte hauptsächlich diskreditiert, fordert authentisches Mitleid, keine ästhetisierten Betroffenheitsgesten. Er kritisiert das oberflächliche aktuelle politische Theater und glaubt, mit seiner Theatervariante etwas Glaubwürdigeres geschaffen zu haben. Ursina Lardi, die wie nach einem Massaker mitten im Müll steht und die Wirklichkeit teilweise ausblendet, ist aber durch ihre hinreißende, hohe Schauspielkunst ein Ästhetisierungsphänomen, das differenziert strukturierte Zuschauer zwar zu goutieren vermögen, aber die eigentlichen politischen Pläne und Bedürfnisse des eminent auskunftsfreudigen, pressegierigen Regisseurs konterkariert. Kurz: Rau sucht seine wirtschaftspolitischen Vorwürfe durch Kunst zu verbrämen und macht im Grunde genau das, was er an Kollegen kritisiert. Die am Ende urinierende Ursina Lardi sieht man doppelt: Einmal live auf der Bühne und dann in Großformat auf Video. Wen ein already-heard-Erlebnis überkommt, der kann sich wenigstens an ihrem meistens gelungenen Zusammenspiel von Gestik und Gesagtem erfreuen. Insgesamt ein zwiespältiger Abend. Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs von Milo Rau Regie: Milo Rau, Bühne und Kostüme: Anton Lukas, Video und Sound: Marc Stephan, Dramaturgie: Florian Borchmeyer, Mitarbeit Recherche/Dramaturgie: Mirjam Knapp, Stefan Bläske, Licht: Erich Schneider. Mit: Ursina Lardi, Consolate Sipérius. Schaubühne Berlin Premiere vom 16. Januar 2016 Dauer: 100 Minuten, keine Pause