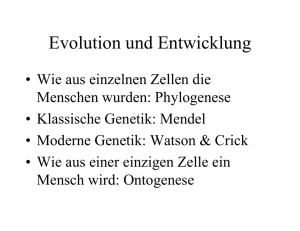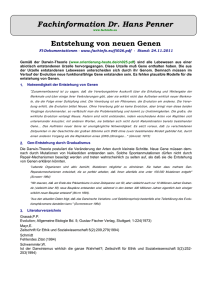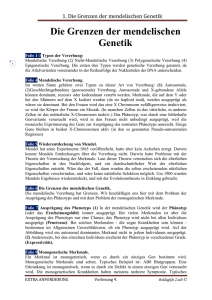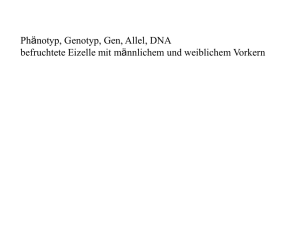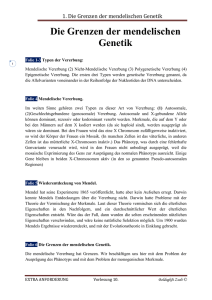Kapitel 10 - Zwischenbilanz: das moderne Gen als
Werbung

Befreiungsbiologie 2 Kapitel 10 - Zwischenbilanz: das moderne Gen als Rückschritt Das historische Studium der Biologie ist deshalb so wichtig, weil es etwas zeigt, was kein noch so intensives Studium der aktuellen Forschungsliteratur zeigen kann: dass die Geschichte des Gens der konstante Versuch war, die Idee präformativer Erbfaktoren auf eine materielle Basis zu stellen; die viel mehr herbeigezauberte denn tatsächliche Einlösung des alten Versprechens, es müsse irgendwo in der Zelle ein ordnendes Prinzip geben, das die arttypische Erscheinung eines Lebewesens hervorzubringen vermag. Die Geschichte des Gens ist nicht so sehr empirisch wie programmatisch. Gene wurden nicht entdeckt, sondern postuliert. Als Mendel seine formbildenden Elemente imaginierte, tat er es vor dem Hintergrund der alten Idee des Keimes, dem die Kraft, neues Leben zu schaffen, innewohnte. Derselben Idee, die die Präformationisten dazu geführt hatte, Eioder Samenzellen mit vorgeformten Miniaturorganismen zu bevölkern. Dahinter wiederum steckte der noch ältere Gedanke, dass Lebewesen eine Form innewohnt, die sie zu dem macht, was sie sind: Menschen, Pferde oder Apfelbäume. Mit dem Postulat der arttypischen Form tauchte automatisch die Frage auf, wie diese über Generationen hinweg bewahrt werden konnte. Aus der Vereinigung zweier Menschen entsprang nicht plötzlich ein Pferd oder ein Apfelbaum, sondern stets wieder ein Mensch. Dieser Ergebnis war so unvermeidlich wie das tägliche Aufgehen der Sonne. Mit dem Aufstieg der modernen Wissenschaft ab dem 17. Jahrhundert wurde aus der Frage ein Problem, ein veritables Rätsel. Was geschah bei der Reproduktion, was es dem wachsenden Keim ermöglichte, dieselbe Form wie seine Eltern anzunehmen? Gott hat es gerichtet, sagten die Präformisten. Das war keine Ausrede. Gott war ein integraler Bestandteil des Weltbildes und ein legitimes Erklärungsmittel. Der Gott der Präformationisten hatte am Anfang der Zeit die Arten als ewig und unveränderlich geschaffen. Vorgeformte Miniaturen waren sein Weg, den arttypischen Phänotyp zu bewahren. Die Epigenesisten versuchten sich an einer moderner anmutenden Erklärung ohne göttliche Einwirkung. Form musste etwas sein, was in der Ontogenese geschaffen wurde, Schritt für Schritt, aufgrund natürlicher Kräfte. Damit gerieten sie in ein Dilemma: keine der existierenden Naturkräfte schien in der Lage, die Komplexität von Organismen hervorzubringen. Man postulierte eine neue, noch unbekannte Lebenskraft und endete in der unangenehmen Position, sich auf etwas berufen zu müssen, was nicht viel weniger mysteriös und übernatürlich zu sein schien als eine göttliche Intelligenz. Man hört manchmal, die Epigenese hätte dann doch noch gesiegt, als zunehmend beobachtbar oder zumindest vorstellbar wurde, wie die Kräfte und Felder der modernen Physik zu vielfältigen molekularen Wechselwirkungen Anlass geben konnten, die in ihrer Summe durchaus die erstaunlichen Eigenschaften biologischer Orangismen erklären konnten. Das Rätsel des Lebens schien im Prinzip gelöst. Die Wahrheit ist aber eine andere. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts postulierten Weismann und andere unabhängig von Mendel partikuläre Determinanten der Morphogenese. Während einige Forscher der Zelle als Ganzes lebensschöpfendes Potential zuschrieben, setzte sich allmählich Weismanns Sichtweise durch, nur der Zellkern enthalte die Erbfaktoren. Mendels Wiederentdeckung bestärkte eine Reihe einflussreicher Biologen in ihrem Glauben an “Einheitscharaktere” aus denen ein Organismus wie ein Mosaik 1 Befreiungsbiologie 2 zusammengesetzt werden konnte. Diese Päckchen aus Erbfaktor und Merkmal sollten kombinatorischen Regeln gehorchen wie chemische Elemente bei der Enstehung neuer Verbindungen. Die Populationsgenetik sollte sich 30 Jahre später ähnlich vereinfachter Modelle bedienen, in denen Organismen nicht mehr waren als Genotypen, die jeweils einen einzigartigen Phänotyp produzierten. Die Genkonstellation bestimmte in eindeutiger Weise den Phänotyp, so dass in solchen Modellen das Wort “Genotyp” bald für den Organismus als Ganzes zu stehen kam. Alles Nicht-Genetische, was sonst noch einen Phänotyp beeinflusste, wurde ignoriert, da im damaligen Verständnis ausschliesslich Gene vererbt wurden und sonst nichts. Das hiess, dass nicht-genetische Einflüsse zwar existieren konnten, aber nicht systematisch vererbt wurden und deshalb als statistisches Rauschen abgetan werden konnten. Auch die klassische Genetik führte, trotz Morgans Vorbehalten, unweigerlich zur Überzeugung, die anfangs noch hypothetischen Gene müssten real existierende materielle Partikel sein. Wer konnte angesichts von Genkarten, die die exakte Reihenfolge dieser Entitäten auf den Chromosomen angaben, oder der Mutabilität solcher Entitäten durch radioaktive Strahlung dieser Schlussfolgerung langfristig widerstehen? Die biochemisch orientierte Genetik der 40er und 50er-Jahre schien schliesslich den unzweifelhaften Beweis für die Existenz von Genen zu liefern. DNA war das materielle Substrat der Vererbung, und wie bereits von Schrödinger antizipiert, schien sie einen Code zu verkörpern, der die Baupläne sämtlicher Proteine enthielt. Kannte man die DNA, kannte man die Proteine, und, da diese die Schwerarbeitermoleküle der Zelle waren, die deren Aufbau und Form bestimmten, kannte man im Prinzip auch den Phänotyp. Das war das Versprechen, das die Molekularbiologie der Welt machte. Allerdings beruhte dieses Versprechen auf einem billigen Trick: der Zuschreibung instruktiver Information an die Gene. Der ganze Hype des Humangenomprojekts um bevorstehende Revolutionen im Verständnis des Lebens und Durchbrüche in der Behandlung von Krankheiten basierte auf nichts anderem als den Genen angedichteten Wunderkräften. Dasselbe gilt für die hochgeschraubten Erwartungen der Gentherapie und, in geringerem Masse, der heute aktuellen Personalisierten Medizin. Aber auch weniger publikumsträchtige Entwicklungen in der Biologie fanden unter dem Banner des deterministischen Gens statt. Die Embryologie bzw. Entwicklungsbiologie, die sich traditionellerweise um echte Erklärungen ontogenetischer Vorgänge bemühte, die ohne Abkürzungen via genetische Spezialeffekte auskamen, wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Molekularbiologie vereinnahmt und als Entwicklungsgenetik wiedergeboren. Das hiess nun, dass man schwierigen Fragen nach den Details biologischer Prozesse, die die Morphogenese antrieben, zumindest teilweise ausweichen konnte, indem man sie als Teil des vorbestehenden genetischen Programms eines Organismus deklarierte. Als solche waren sie scheinbar von einem weitergehenden Erklärungsbedarf abgeschottet, denn was vorprogrammiert ist, läuft einfach gemäss Programm ab und braucht keine weitere kausal-mechanistische Elaboration. Ab den 80er Jahren wurde diese Art Scheinerklärung auf die Spitze getrieben. Im Lehrbuch meines eigenen Biologiestudiums in den frühen 90er-Jahren tauchen nicht-genetische Kausalfaktoren in der Erklärung der Ontogenese gar nicht mehr auf: „Die Erbinformation enthält ein genaues Entwicklungsprogramm, das die Entwicklung von der befruchteten Eizelle bis zum erwachsenen Organismus steuert… Diese Befunde unterstützen eine 2 Befreiungsbiologie 2 allgemeine genetische Theorie der Entwicklung, die es erlaubt, die Entwicklungsprozesse aufgrund der Wirkungen und Wechselwirkungen von Genen zu verstehen.“ (Wehner & Gehrig???) Die moderne Biologie hatte es geschafft, einen der kompliziertesten Vorgänge im bekannten Universum, die Entstehung eines ausgewachsenen Organismus aus einer winzigen Eizelle, beruhend auf verschiedenartigsten Strukturen, Mechanismen und Prozessen auf verschiedenen Grössen- und Zeitskalen, auf die “Wirkungen und Wechselwirkungen von Genen” zu reduzieren. Ein Triumph ist das nicht, viel eher ein Armutszeugnis. Überraschend kommt es allerdings nicht, denn die Informationsmetapher ist nichts anderes als der neuste Versuch, die schon lange antizipierte Rolle der Gene als Determinanten des Phänotyps in ein modernes wissenschaftliches Gewand zu kleiden. Die schnelle Übernahme des Informationsbegriffs in die Molekularbiologie widerspiegelt nicht etwa einen kontrollierten Prozess, in dem das empirische Studium der DNA zusammen mit theoretischen Überlegungen zu dem fundierten Schluss geführt hätte, dass die “Gene” genannten Abschnitte von DNA mit einer Form von Information ausgestattet sind, die sie zu Bauplänen, Programmen oder Instruktoren der Ontogenese machen. Vielmehr kam das Informationskonzept Genetikern gelegen, ihre bereits vorbestehenden Erwartungen solcher Gen-Fähigkeiten durch die Vereinnahmung eines Konzepts, das zufälligerweise zur rechten Zeit am rechten Ort war, oberflächlich zu rechtfertigen. Überprüft worden war dieses Konzept jedoch kaum. Vielleicht passte es einfach zu gut auf die den Genen zugedachte Rolle, um einen Analysebedarf überhaupt aufkommen zu lassen. Die Situation hat sich heute teilweise geändert. Es findet in der Literatur eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der genetischen Information statt, bezeichnenderweise jedoch hauptsächlich in den Reihen der Wissenschaftsphilosophen, nicht der Wissenschaftler selbst. Ein grosser Teil dieser Arbeit kritisiert das Konzept in derselben Weise, wie ich es hier getan habe. Einige Autoren versuchen auch, dem Konzept eine fundierte Theorie zugrunde zu legen. Keines der vorgeschlagenen Konzepte genetischer Information aber verteidigt die Art von starker, semantischer Information, die in der Genetik zur Anwendung kommt (Gamma 2013 und weitere refs therein???). Oben habe ich geschrieben “Die Wahrheit ist aber eine andere.” Was ist die Wahrheit? Dies: Die genetische Informationsmetapher ist nichts weiter als eine Neuauflage des Präformationismus. Die Epigenese hat nicht über den Präformationismus gesiegt, jedenfalls nicht in der Genetik (Lewontin???). Bereits Ende des 19. Jahrhunderts tauchte (erneut) die Idee auf, die Form eines Organismus, seine Merkmale und Eigenschaften, müssten von einem vererbaren Substrat in der befruchteten Eizelle bestimmt sein. Spätere Entwicklungen führten zu einer zunehmend fokalen Lokalisierung dieses Substrats: zuerst im Zellkern, dann in den Chromosomen, und zuletzt in den Genen der chromosomalen DNA. Das Gen wurde zum Träger der „Erbsubstanz“: der erblichen materiellen Anlagen für den Organismus. Was früher der präformationistische Homunculus war, wurde zum präformationistischen Gen. Die buchstäbliche anatomische Vorgeformtheit des Homunculus wurde zu einer abstrakteren genetischen Vorformung mittels kodierter Instruktion. Die Gene bestimmten die Form des adulten Organismus nicht durch ihre physische Ähnlichkeit mit demselben, sondern dadurch, dass sie ihn repräsentierten, indem sie Information über seine Form enthielten. Die Gene waren eine Spezifikation oder ein Rezept, das in der Ontogenese originalgetreu umgesetzt wurde. Und damit diese Umsetzung richtig funktionierte, wurde den Genen nicht nur die Fähigkeit zugeschrieben, die Bauanleitung eines Organismus zu speichern, sondern auch, dessen Ausführung zu überwachen. Mit solchen Superkräften ausgestattet war es für das Genom nicht mehr allzu schwierig, ein Lebewesen von A bis Z zu kreieren. 3 Befreiungsbiologie 2 Diese Form des Präformationismus ist etwas subtiler als ihr Vorgänger im 18. Jahrhundert, aber Präformationismus ist es dennnoch. Die Rolle des Homunculus spielt nun das Konzept der Information, das sich in Begriffen wie „Code“, „genetisches Programm“ oder „Bauplan“ ausdrückt. Ganz klar wird dieses Konzept als materialistisches verstanden. Information ist eine bona fide physische Entität und das Grundprinzip der Computer- und Kommunikationstechnologie. Selbst Gehirne werden heutzutage als informationsverarbeitende Systeme beschrieben. Somit ist im Selbstverständnis der Biologie der genetische Präformationismus im materialistischen Erklärungsgefüge der modernen Naturwissenschaften verankert. Hat man jedoch das zugrundeliegende Konzept der Information einmal unter die Lupe genommen, wird schnell klar, dass die Informationsmetapher eine Scheinerklärung ist, die jeder Grundlage entbehrt, nicht unähnlich dem blindem Irrglauben, den die heute so populären Skeptiker den Anhängern von Religionen und alternativen Heilmethoden vorwerfen, wenn jene an Gott oder die Wirksamkeit von Homöopathie glauben. Der Glaube an Instruktionen im Genom ist kein bisschen besser begründet, als es die Homunculus-Theorie oder der Glaube an spezielle Lebenskräfte im 18. Jahrhundert war. Gemessen am historischen Selbstvertstädnis der Biologie stellt der moderne genetische Präformationismus gleich einen doppelten Rückschritt dar: erstens legt er sich als Grundstein ein Informationskonzept, dessen Existenz und materialistische Referenzen höchst fragwürdig sind, und zweitens tut er dies nicht einmal im Dienste eines fortschrittlichen Konzepts der Epigenese, sondern kehrt zum angeblich überwundenen präformationistischen Prinzip vorgeformter Anlagen zurück. Zu guter Letzt wirft ein Studium der Biologiegeschichte auch Licht auf Mendels Beitrag zu Theorien der Vererbung. Es ist zweifellos wahr, dass Mendel einige der methodischen Grundlagen der modernen Genetik, wie Segregations- und Linkage-Analysen, gelegt hat. Das populäre Geschichtsverständnis erweist sich allerdings in einer wesentlichen Hinsicht als falsch. Nicht nur hat Mendel Gene nicht entdeckt, sondern lediglich postuliert, er hat auch nicht gezeigt, dass biologische Vererbung stets diskret ist. Wie konnte er auch? Er wählte für seine Versuche gezielt einen Organismus mit diskreten und diskret vererbten Merkmalen aus und liess andere potentielle Versuchspflanzen, die sich via Mischvererbung fortpflanzten, links liegen. Er hat überhaupt nur diskret vererbte Merkmale studiert, somit konnte er nichts darüber aussagen, wie universell das Phänomen der diskreten Vererbung ist. Man stelle sich vor, jemand führe eine Studie zu Digitaluhren eines bestimmten Typs durch und die Welt behaupte dann, es gebe überhaupt nur Digitaluhren. Genauso verhält es sich mit der Behauptung, Mendel habe bewiesen, dass biologische Vererbung aussschliesslich diskret sei. 1 An dieser Schlussfolgerung ändert sich auch nichts, wenn man 'diskrete Vererbung' auf die Rekombination von Genen (Allelen) und nicht auf phänotypische Merkmale bezieht, so dass Mendels Beitrag derjenige wäre, gezeigt zu haben, dass sich Gene in der Vererbung nicht vermischen und somit die erbliche Variation nie ausgeht. Aber wiederum: selbst wenn Mendel die Diskretheit rekombinierter genetischer Elemente gezeigt hätte, hätte er sie nur für diskret vererbte Merkmale gezeigt, nicht aber für quantitative Merkmale, für die Mischvererbung auftreten kann und die genau der Knackpunkt für Darwins Theorie waren. Dieses Problem wurde erst im nächsten Jahrhundert gelöst, und auch nur mathematisch, als gezeigt werden konnte, dass die Rekombination diskreter Erbfaktoren kontinuierliche phänotypische Variation erzeugen konnte, wenn der Phänotyp das Resultat der Wirkung einer unendlichen Zahl solcher Erbfaktoren war, von denen jeder nur einen 1 4 Befreiungsbiologie 2 infinitesimalen Beitrag zum Phänotyp leistete (Fischer 1918, ref. In Sarkar, genetics and reductionism???). 5