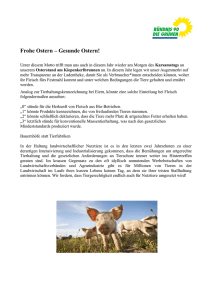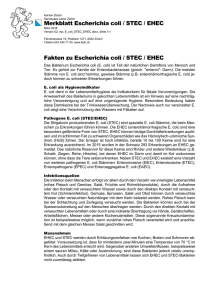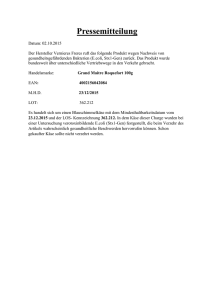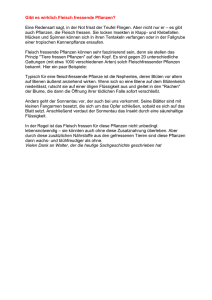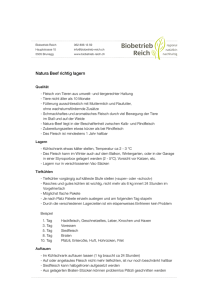Non-O157-shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) im Boden
Werbung

Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach (2011) 50, Nr. 193 – Praxis-Informationen Non-O157-shigatoxinbildende Escherichia coli (STEC) im Boden: Vorkommen und Überleben Quelle: Journal of Applied Microbiology 111 (2011), 484-490. Es ist seit langem bekannt dass Wiederkäuer ein primäres Reservoir für VTEC (E. coli, die eine zytotoxische Wirkung auf Verozellen ausüben; synonym auch für STEC oder Shigatoxin bildende E. coli) sind und der Verzehr von kontaminiertem Fleisch eine Hauptrisikoroute der Infektion darstellt. In jüngster Zeit jedoch scheint sich das zu ändern. Man geht davon aus, dass in den letzten Jahren mehr Ausbrüche auf den direkten Kontakt mit Tieren und ihren Fäzes oder verunreinigtem Wasser zurückzuführen sind als auf den Verzehr von kontaminiertem Fleisch. Die Anwendung von natürlichem Dünger führt zur Kontamination des Bodens mit STEC. Ein Wiederkäuer scheidet nach BESSER et al. (2001) zwischen 102-108 STEC pro Gramm Fäzes aus. Den Autoren (D. J. BOLTON, A. MONAGHAN, B. BYRNE, S. FANNING, T. SWEENEY und D. A. McDOWELL) zufolge besteht ein großes Interesse daran zu erfassen, wie lange solche Keime im Boden überleben, um daraus die zeitlichen Abstände abschätzen zu können, die zwischen Düngung und einer weiteren Nutzung des Bodens, z. B. Grasschnitt oder dem Heuen, liegen sollten. Die Autoren geben weiterhin einen Überblick über Literaturdaten, die die Aufnahme von Stäuben durch Menschen quantifizieren, die auf dem Land leben oder arbeiten. Die Schätzungen reichen von 30-200 mg pro Tag, manche liegen auch höher. In Erwägung der niedrigen Infektionsdosis (10 Zellen werden als ausreichend angesehen) würde bereits eine Kontamination mit 50 Zellen pro Gramm Boden zu einer Infektion führen können. Verteilt über einen Zeitraum von 12 Monaten wurden 600 Bodenproben von 20 Farmen in Irland genommen. Sie wurden nach Anreicherung auf Selektivagar ausplattiert und die Bakterienkolonien mit PCR auf das Vorkommen von Shigatoxin 1 und 2 überprüft. 162 Bodenproben waren positiv. Die Belastung stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der Jahreszeit. Prozentual am höchsten belastet waren Proben im Frühjahr (51 %) und am geringsten im Winter (22 %). Für die Überlebensversuche von non-O157 STEC wurden Bodenproben von den zwei für Irland typischen Bodenarten genommen, dabei handelt es sich um sandige und tonige Lehmerden. Diese wurden von groben Bestandteilen und von allem organischen Material befreit und auf ihren Mineralgehalt (Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Zink, etc.) sowie den pH-Wert untersucht. Dann wurden sie homogenisiert und auf die Abwesenheit von E. coli Vt1 und 2 (Stx1 und 2) DNA getestet. Die Bodenproben wurden aliquotiert und für eine Beimpfung mit jeweils einem von 14 verschiedenen E. coli Serovaren (alle non-O157) vorbereitet, die aus den oben genannten Bodenproben isoliert worden waren (darunter befand sich aber nicht das Serovar O104:H4 des aktuellen Ausbruchskeimes). Inokuliert wurden je 10 g Bodenmaterial der beiden Bodentypen parallel mit je 105 Zellen eines einzigen Serovares. Die Lagerung fand bei 10°C bis zu 201 Tagen statt. Eine Probenname erfolgte in monatlich Abständen. Die Ergebnisse der Überlebensversuche in diesen Bodenproben zeigten, dass STEC auf sandigen Lehmböden erheblich besser überlebte als in tonigen. Die D- Werte (Reduktion um 1 Log-Stufe, gemessen in Tagen) betrugen bei den sandigen Böden (pH 7,0) für alle Serovare mehr als 60 Tage, dagegen in den tonigen Lehmböden (pH 5,0) durchschnittlich nur ca. 40 Tage. Die Ursache dafür wurde vor allem dem Unterschied im pH-Wert zugeschrieben. Die Toxizität von Metallen wurde diskutiert. Vor allem Kupfer und Zink sind bekannt dafür, 187 Mitteilungsblatt Fleischforschung Kulmbach (2011) 50, Nr. 193 – Praxis-Informationen dass sie ein Überleben negativ beeinflussen. Die Konzentrationen waren aber in beiden Böden vergleichbar. Es gab auch Schwankungen in den D-Werten, die anscheinend serovartypisch sind. Manche Serovare überlebten besser als andere, und zwar meist in beiden Bodentypen gleichermaßen. Die Autoren diskutierten, dass Umweltbedingungen und andere klimatische Einflüsse zwar nicht berücksichtigt wurden, diese Versuche aber trotzdem als Grundlage für eine wissenschaftlich basierte Risikoabschätzung herangezogen werden können, da bisher kaum Daten für non-O157 STEC existieren. LICK Was macht das Milchsäurebakterium L. sakei so besonders geeignet für das Leben im Fleisch? – Aktuelle Microarrayanalysen von 18 Isolaten geben einen Einblick in die genetische Ausstattung und damit ein tieferes Verständnis für eine besondere Anpassung an die Umgebung Fleisch Quelle: Molecular Genetics and Genomics 285 (2011), 297-311. Lactobacillus sakei ist ein Milchsäurebakterium, das in der Lebensmittelmikrobiologie und besonders bei Fleisch- und Wurstwaren eine kommerziell wichtige Rolle als Starter- und Schutzkultur spielt. Es hat die Fähigkeit, im Fleisch durch die Produktion von Milchsäure sowie anderen Substanzen konservierend zu wirken. 2005 wurde das Gesamtgenom eines ausgewählten L. sakei Stammes mit der Stammbezeichnung 23K von einer französischen Arbeitsgruppe sequenziert und veröffentlicht. Diese und andere Sequenzinformationen lieferten den Autoren (O. L. NYQUIST, A. MCLEOD, D. A. BREDE, L. SNIPEN, A. AAKRA, und I. F. NES) die Ausgangsbasis für ein Microarray zur vergleichenden genetischen Typisierung von weiteren 18 L. sakei Stämmen. 16 Isolate stammten aus Fleisch, ein Isolat aus Fisch und ein weiteres war aus Sake isoliert. Sake, der japanische Reiswein, ist der Namengeber für diese Spezies, da diese Art aus diesem Getränk isoliert und erstmals beschrieben wurde. Das Interesse der Autoren galt den Eigenschaften, die die Isolate voneinander unterscheiden, aber auch solchen, die sie im Gegensatz zu anderen Milchsäurebakterien gemeinsam haben und damit eine besondere Anpassung an das Medium Fleisch vermitteln. Mittels Typisierung oder „molekulargenetischem Fingerprint“ werden bestimmte Eigenschaften erfasst, die auf die Individualebene oder Stammebene abzielen. Das ist vergleichbar mit dem, was man üblicherweise mit der Vorstellung des physikalischen „Fingerabdruckes“ verbindet. Zu einer dieser wichtigen Methoden zählen die Microarrays (micro = klein, array = aufreihen). Es handelt sich dabei um modifizierte Objektträger, wie sie in der Mikroskopie bekannt sind, auf die hunderte bis mehrere tausend kleine Nukleinsäuresonden aufgedruckt bzw. aufgereiht sind. Jede dieser vielen kleinen Sonden steht für eine Eigenschaft. In einer umgekehrten Hybridisierung wird das in wässriger Lösung vorliegende, fluoreszenzmarkierte Probenmaterial (hier das gesamte genetische Material von L. sakei 23K) mit den Sonden auf 188