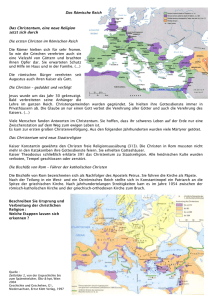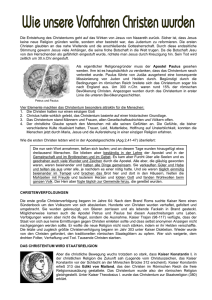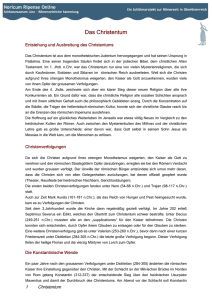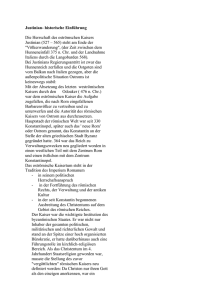1.1.2 Gott und die weltliche Macht / Kommentar zu Arbeitsblättern
Werbung

Bernhard Oßwald: Gott und die weltliche Obrigkeit Kommentar zu den Arbeitsblättern/Materialien Vorbemerkung I (inhaltlich) Der Titel für die vorliegenden Arbeitsblätter – „Gott und die weltliche Obrigkeit“ – mag überraschen. Geläufig ist die Formulierung „Kirche und Staat“. Warum wurde diese Formulierung nicht auch hier gewählt? Die Erklärung ist einfach: Hier soll mehr in den Blick gebracht und behandelt werden, als die Formulierung „Kirche und Staat“ umfasst. Außer dem theoretisch reflektierten und geschichtlichen Verhältnis der zwei Gewalten oder Reiche geht es auch um grundlegende Fragen wie die, inwieweit Gottes Herrsein den Menschen als Einzelnen wie als Gemeinschaft im politischen Kontext in die Pflicht nimmt und bestimmt, in welchem Zusammenhang göttlicher Heilsplan und Geschichtsverlauf stehen oder ob die christlich-religiöse Freiheitserfahrung nicht von selbst nach „irdischer“ Verwirklichung in Staat und Gesellschaft verlangt. Dieser „Weiterung“ entsprechend wurde schon in der Eingangssequenz auf die Fragestellung „Gott und Politik“ abgehoben, und auch die zweite Sequenz, die biblische Texte behandelt, ist erheblich breiter angelegt als in Unterrichtseinheiten zum Thema „Kirche und Staat“ üblich. Wenn sonst im biblischen Teil nur Jesus („Steuerfrage“) und Paulus (Röm 13,1–7) zu Wort kommen, wird hier auch der geistes- und religionsgeschichtlich bedeutsame Beitrag des Alten Testaments zum Spannungsfeld Gott und weltliche Obrigkeit aufgegriffen. Für den im Richter- und ersten Samuelbuch formulierten Gedanken einer Entgegensetzung zwischen Königtum und Gottesherrschaft sind in der Umwelt des Alten Testaments bisher keine Parallelen gefunden worden. Altorientalische Königsideologien stimmen alle darin überein, dass sie Königtum und göttliche Herrschaft eng verbinden: Man ging vom göttlichen Ursprung der Institution aus und sah den König als Statthalter oder Sohn der Gottheit oder als Gottheit selbst. Diesem Idealbild des Königtums setzen die beiden genannten alttestamentlichen Bücher Monarchiekritik und die prinzipielle Aussage entgegen, dass die Institution des Königtums Gottes exklusive Herrschaft verletzt. Jeremias dem Volk von Juda im Auftrag Jahwes verkündete Botschaft, sich unter das babylonische Joch zu beugen, und sein Rat an die nach Babylonien Verschleppten, dort sesshaft zu werden und sich um das Wohlergehen des Landes zu bemühen, waren zu seiner Zeit höchst brisant und führten zu heftigen Anfeindungen. Theologisch höchst bedeutsam ist Jeremias Begründung: Jahwe, der Gott Israels, habe König Nebukadnezar als seinem Bevollmächtigten die Macht verliehen, alle Völker zu unterwerfen. Erst wenn die Zeit des babylonischen Reichs abgelaufen sei, werde er dem Volk die erhoffte Zukunft schenken. Jeremias Verkündigung an das Volk von Juda (zu Hause und in der Verbannung) wurde von den frühen Christen wieder aufgenommen. In dem Bewusstsein, dass Gott dem Kaiser die Herrschergewalt gegeben hat, fühlten sie sich verantwortlich, den Kaiser zu ehren, ihm zu gehorchen und für ihn zu beten (vgl. Theophilos von Antiocheia, An Autolykos 1,11). Das Wissen um Gottes Überordnung oder Oberhoheit beinhaltete aber auch, dass immer dann, wenn ein kaiserliches Gebot mit Gottes Gebot in Konflikt geriet, dem Kaiser der Gehorsam zu verweigern war – und sei es um den Preis des Todes. Davon geben die „Märtyrerakten“ ein beredtes Zeugnis. Im Zusammenhang mit der Konstantinischen Wende, die das Christentum nicht nur mit der römischen Religion gleichstellte, sondern ihr gegenüber bevorzugte, betraf die theoretische Auseinandersetzung um die wahre Religion gerade auch das Verhältnis von Gott und weltlicher Obrigkeit. Was immer Konstantin vor der Entscheidungsschlacht an der Milvischen Brücke in einer Vision gesehen haben mag, so ist doch so viel sicher: Nach seinem Sieg 1 über Maxentius war er überzeugt, dass er seinen militärischen Erfolg dem Gott der Christen zu verdanken habe und folglich dieser Gott in politischen Dingen ein höchst wirkmächtiger Gott sei. Die heidnische Opposition, die sich mit der Bevorzugung des Christengottes durch Konstantin und seine Nachfolger nicht abfinden mochte, hielt dem entgegen: Die von Rom verehrten Götter hätten dem Staat jahrhundertelang größte Erfolge beschert und ihn in prekären Situationen vor den Feinden beschützt; jetzt aber, nach der Abkehr von der altrömischen Religion und der Zuwendung zum Christentum, häuften sich die Katastrophen und das römische Reich gehe nieder. Als dann der Westgotenkönig Alarich im Jahr 410 Rom eroberte und plündern ließ, sahen die Verfechter der alten Religion hierin den endgültigen Beweis, dass die Annahme des Christentums das Strafgericht der Götter heraufbeschworen habe. Aber auch die Christen verunsicherte der Sacco di Roma zutiefst und ließ sie an der Mächtigkeit und Vorsehung ihres Gottes zweifeln. Der Kirchenvater Hieronymus, der zu dieser Zeit als Einsiedler in der Nähe Betlehems lebte, schrieb dazu erschüttert: „Meine Stimme stockt und mein Schluchzen unterbricht die Worte, die ich schreibe: Die Stadt ist bezwungen, die den Erdkreis bezwang.“ In dieser Situation begann Augustinus sein großes Werk „De civitate Dei“ zu schreiben, um Antwort auf die durch den Fall Roms provozierten Fragen zu geben. Mit Blick auf die römische Geschichte versuchte er zu zeigen, dass die von den Römern verehrten Götter weder äußere Schicksalsschläge abgewandt noch die Größe Roms bewirkt hätten. Entscheidende Bedeutung hatte aber die von Augustinus entfaltete Auffassung, dass es unmöglich ist, in weltgeschichtlichen Ereignissen Gottes Heilsplan aufzuspüren: „Großmächte steigen auf und gehen unter in der Weltgeschichte, und keiner kann behaupten, einen klar erkennbaren Grund dafür angeben zu können. Wir durchschauen die Gesamtordnung nicht“ (De civ. Dei). Allein das Ziel der Geschichte stehe für die Menschen fest – die von Gott verheißene Erlösung am Ende der Zeit. Mit diesem Gedanken setzte sich Augustinus von den meisten Theologen seiner Zeit ab. Wie der Kirchenvater Hieronymus waren diese davon überzeugt, dass der Heilsplan Gottes Christentum und römisches Reich aufs engste verbunden habe. Dank göttlicher Vorsehung habe Kaiser Augustus mit der Pax Romana die Voraussetzung für das Kommen Christi geschaffen, und Kaiser Konstantin habe mit seinen Maßnahmen die von Gott gewollte Staatskirche für das römische Reich begründet. Dagegen war für Augustinus die ganze Geschichte von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende von einem dynamischen Dualismus bestimmt, den er als Kampf zwischen zwei Reichen beschrieb. Das eine Reich, die civitas caelestis, ist Gott zugeordnet; zu ihm gehören entsprechend die Menschen, die nach Gott leben. Das andere Reich, die civitas terrena, ist vom Prinzip des Bösen bestimmt, das die Menschen von Gott entfremdet. Die beiden Reiche sind freilich Ideen, die in Reinform in dieser Welt gar nicht vorkommen. Weder ist die sichtbare Kirche die civitas caelestis (Dei), da sie nicht nur für das Gute steht, noch ist der irdische Staat die civitas terrena, da er nicht nur für das Böse steht. In der Welt gibt es in beiden Gebilden, in der Kirche und im Staat, sowohl Ungerechtigkeit wie Gerechtigkeit, Unfrieden wie Frieden, Selbstsucht wie Selbstlosigkeit … Die Grenze von civitas Dei und civitas terrena geht quer durch alle weltlichen Gemeinschaften. Erst beim Jüngsten Gericht am Ende der Zeit erfolgt die endgültige Scheidung der zwei Reiche. Im Mittelalter wurde Augustins Lehre von den zwei Reichen höchst wirkungsvoll. Aber man beachtete nicht, dass er von zwei Ideen oder Idealbildern gesprochen hatte, die bis zum Ende der Zeit unsichtbar bleiben. Stattdessen identifizierte man die civitas caelestis mit der Papstkirche und die civitas terrena mit dem vom Kaiser beherrschten Reich. Diese "Verweltlichung“ der Zwei-Reiche-Lehre musste dann von selbst die Frage aufwerfen, ob dem einen Reich in dieser Welt mehr Gewicht zu geben sei als dem anderen. Der erste, der 2 hiezu eine folgenreiche Stellung bezog, war Papst Gelasius I. (gest. 496). Er lehrte über das Verhältnis von Kirche und Staat: Beide Gewalten sind göttlichen Ursprungs und auf ihren Gebieten selbständig und gleichberechtigt; doch ist die priesterliche Gewalt höher zu werten als die königliche. In späteren Auseinandersetzungen um die Oberhoheit wurde oft der Satz aus einem Brief des Gelasius an Anastasios I. vom Jahr 494 zitiert: „Zwei Dinge sind es, durch die grundsätzlich die Welt gelenkt wird: die geheiligte Autorität der Priester und die königliche Gewalt. Von ihnen ist das Ansehen der Priester umso gewichtiger, als sie auch für die Könige der Menschen im göttlichen Gericht Rechenschaft abzulegen haben.“ Unter dem Königtum der Karolinger entwickelte sich das Verhältnis von päpstlicher Gewalt und königlicher Gewalt aber zunächst als wechselseitiges Geben und Nehmen. Mit Zustimmung des Papstes Zacharias schickte Pippin d. J. den letzten Merowingerkönig Childrich III. ins Kloster und ließ sich 751 in Soisson vom fränkischen Adel zum König wählen. Die religiöse Legitimation erhielt er danach durch einen Gesandten des Papstes, der ihn zum König salbte. Im Gegenzug sagte Pippin dem Papst, den die Langobarden bedrohten, seinen Schutz zu. Zuvor hatte sich der Papst vergeblich bei dem oströmischen Kaiser um Hilfe bemüht und war nun persönlich bei Pippin erschienen. Zusammen mit dem Schutzversprechen gab Pippin dem Papst die Garantie, dass die von den Langobarden besetzten ehemaligen byzantinischen Gebiete um Ravenna an Rom zurückgegeben werden sollten. In zwei Feldzügen gegen die Langobarden konnte Pippin tatsächlich die Rückgabe dieser Gebiete erzwingen. (Ihre Übergabe an den Papst ist als „Pippinsche Schenkung“ in die Geschichte eingegangen; sie war die Gründung des Kirchenstaats.) Als Gegenleistung erneuerte der Papst die Königssalbung und verlieh Pippin und seinen Söhnen den Titel „Patricius Romanorum“ (Schutzherr der Römer). Von Pippins Sohn Karl – später genannt „der Große“ – wurde dieses enge und komplementäre Verhältnis von Papst- und Königtum fortgeführt. Nachdem Papst Leo III. von der römischen Adelsopposition aus Rom verjagt worden war, eilte König Karl zu Hilfe und setzte ihn wieder ein. Darauf krönte Papst Leo III. Karl zum Kaiser und machte ihn so zum Nachfolger der römischen Caesaren. Karl trug nun in der Kaiserbulle die Losung: „Renovatio Romani imperii“ – Erneuerung des römischen Reichs. Obgleich Karl d. Gr. sich mit dem Papst gleichgestellt sah, sind bei ihm doch schon Anzeichen einer Überordnung zu erkennen. In Auslegung des Augustinischen Werks verstand er sich nicht nur als Verteidiger, sondern auch als Führer eines Gottesstaats auf Erden. Und speziell für die fränkische Kirche beanspruchte er die Rolle des Oberherrschers, der auch unabhängig vom Papst in religiösen Fragen Entscheidungen treffen kann. Die Vorstellung, dass König oder Kaiser in einer exklusiven Nähe zu Gott bzw. Christus stehen und als „auctor ac stabilitor christianitatis et christianae fidei“ auch für das religiöse Heil der Menschen sorgen, erreichte bei Otto III. einen Höhepunkt, jedenfalls dann, wenn man sein Herrscherbild in dem von ihm in Auftrag gegebenen „Aachener Evangeliar“ zur Deutung heranzieht. Politisch knüpfte Otto III. bewusst an dem von Karl d. Gr. formulierten Programm einer „Renovatio imperii Romanorum“ an. Seit ihn sein Vetter Brun(o), den er selbst zum neuen Papst bestimmt hatte, als Gregor V. zum Kaiser gekrönt hatte, führte er den Titel „Romanorum imperator Augustus“. Darin war auch seine besondere Verantwortung für den Papst in Rom eingeschlossen. Obwohl Otto III. an einem einträchtigen Zusammenwirken mit dem Papst lag, war er doch auf die Wahrung des kaiserlichen Vorrangs bedacht. Er erklärte die seinem Großvater Otto I. als authentisches Dokument präsentierte Ausfertigung der Konstantinischen Schenkung für gefälscht und wies damit die hieraus abgeleiteten 3 territorialen Ansprüche des Papsttums zurück, um dann die fraglichen Gebiete dem Papst aus kaiserlicher Machtvollkommenheit zu schenken. Das Herrscherbild Ottos III. im „Aachener Evangeliar“ ist in vier Bildebenen gegliedert. Der Kaiser selbst erscheint in der dritten Bildebene und ist unübersehbar der Majestas Domini nachgebildet. Wie dort Christus, so wird hier der Kaiser in der Mandorla mit herrscherlichem Gestus auf dem Thron sitzend dargestellt, umgeben von den Evangelistensymbolen. Darüber ist noch eine vierte Bildebene zu erkennen. Ein Kreis umschließt die Hand Gottes. Das Haupt Ottos III. ragt in diesen Kreis hinein; ihm wird von Gottes Hand die Krone aufgesetzt. Diese Darstellung kommt einer Herrscherapotheose sehr nahe: Otto soll zwar nicht selbst als Gott-König erscheinen – dies hätte den Horizont mittelalterlichen Denkens gesprengt –, aber er vergegenwärtigt den kommenden Gott-König, Christus den Weltenrichter, in seiner Person, er ist die „figura Christi“. Für den gegenteiligen Anspruch des Papstes, dass ihm als „vicarius Christi in terris“ auch die „plenitudo potestatis in temporalibus“, die Vollgewalt in irdischen Dingen, zukomme, gibt es ebenfalls eine höchst eindrucksvolle Bildgestalt. Es handelt sich um den Konstantin- und Silvesterzyklus in der neben der römischen Titelkirche Santi Quattro Coronati gelegenen Kapelle San Silvestro, der im Jahr 1246 geschaffen wurde. Der Zyklus besteht aus acht Szenen, die die Legende des Papstes Silvester I. darstellen, soweit sie mit Kaiser Konstantin d. Gr. zusammenhängt. Bis zur sechsten Szene folgt der Freskenzyklus der Erzählung der „Actus Silvestri“, die erstmals im Jahr 501 bezeugt sind. Szene sieben und acht wurden dagegen einer anderen Quelle entnommen – der Urkunde über die Konstantinische Schenkung (Constitutum Constantini); sie zeigen Kaiser Konstantin, der sich Papst Silvester in huldigender Gebärde nähert und ihm das Phrygium – die spätere Mitra – übergibt (Szene sieben) sowie den feierlich hoch zu Ross in Rom einziehenden Papst Silvester I., dem Kaiser Konstantin zu Fuß den Zügeldienst (officium stratoris) leistet (Szene acht). Als dieser Zyklus entstand, tobte gerade ein heftiger Streit zwischen Kaiser und Papst. Kaiser Friedrich II. war von Papst Gregor IX. zum zweiten Mal mit dem Bann belegt und anschließend vom Ersten Konzil von Lyon in aller Form seines Amtes enthoben worden. Damit wollte sich Friedrich II. freilich nicht abfinden und hinderte den Papst daran, von Lyon nach Rom zurückzukehren … Dem Auftraggeber des Zyklus Rinaldo, einem Neffen Gregors IX., ging es im Kontext dieser kirchen- und machtpolitischen Tagesfragen zweifellos um Meinungsbildung – um Propaganda zugunsten des Papstes. Als zur Zeit Martin Luthers die Bauern, aber auch die Bergknappen und die Stadtbewohner gegen ihre Knechtschaft zu revoltieren begannen, erhielt Paulus’ Botschaft von den durch Christus zur Freiheit befreiten Menschen (vgl. Gal 5,1) eine besondere Brisanz. In seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) bringt Martin Luther die von Christus gewirkte Freiheit durch zwei Sätze zum Ausdruck:1. „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan“. 2. „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ Die paradox formulierten Sätze wurden je nach Rezipient – Knecht oder Herr – zugunsten des eigenen Interesses aufgefasst. Der zehnt- und fronarbeitspflichtige Bauer berief sich auf den ersten Satz, der Fürst oder Feudalherr auf den zweiten Satz. Die historische Entwicklung – die „Erhebung des gemeinen Mannes“ – zwang Luther dazu, seinen Standpunkt zu konkretisieren. Zunächst hielt er in seiner Stellungnahme vom April 1525, die sich auf „Die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ bezog, die Waage zwischen den Fürsten/Herren einerseits und der Bauernschaft andererseits. Die Feudalherren forderte er auf, nicht länger „gegen das heilige Evangelium zu toben“ und, statt hochmütig und vermessen zu handeln, dem armen 4 Mann Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und die Bauernschaft „vermahnte“ er, dass die unbestrittene Ungerechtigkeit der Obrigkeit „Rotterei und Aufruhr“ nicht entschuldige; vielmehr habe ein Christ „Unrecht zu leiden und das Übel zu dulden“. Doch schon einen Monat später gab Luther in der Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ (Mai 1525) seine Ausgewogenheit auf, weil die Bauern trotz seiner „Vermahnung“ den Aufstand fortgesetzt und „mit Frevel“ Klöster und Schlösser geplündert hatten. Er berief sich auf den Römer-Brief (insbesondere auf Röm 13,1 und 13,4) und behauptete, es sei Pflicht der Herren, die Bauern zu „stechen“, zu „schlagen“ und zu „würgen“. Andere Theologen dieser Zeit stellten sich bei der Frage nach der Freiheit des Christenmenschen entschieden auf die Seite der Bauern. Einer von ihnen ist Thomas Müntzer, der sich vom Anhänger Luthers zu dessen Gegner entwickelt hatte. Für ihn sind die Fürsten – bezogen auf Röm 13 – nicht die Herren, sondern die Diener des Schwerts. Sie dürfen ihre Führungsrolle nie eigennützig, sondern immer nur im Interesse des Volkes ausüben. Tun sie das nicht, hat der gemeine Mann das Recht, sich von ihrer Herrschaft zu befreien, damit Gott allein Herr über das Volk wird … Bevor Luther im Bauernkrieg Stellung bezog, hatte er bereits in anderem Kontext die Frage behandelt, wo die Grenze des christlichen Gehorsams gegenüber der Obrigkeit sei.1523 hatten einige Fürsten in ihren Territorien infolge des Wormser Edikts (1521) nicht nur Luthers Schriften, sondern sogar seine Übersetzung des Neuen Testaments verboten. In dieser Situation versuchte Luther mit seiner Schrift „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ seinen Anhängern Antwort zu geben, wie sie sich zu verhalten hätten. Er setzte dabei sehr grundsätzlich an und griff auf Augustins Unterscheidung zwischen Civitas Dei und Civitas terrena zurück. Gott hat, so Luther, „zwei Regimente verordnet“, das „geistliche“ und das „weltliche“. Zum geistlichen Regiment (Reich Gottes) gehören alle Rechtgläubigen in Christus, zum weltlichen Regiment (Reich der Welt) alle, die nicht (rechte) Christen sind. Die zum Reich Gottes Gehörigen bedürfen des weltlichen Schwerts und Rechts nicht. Da sie Gottes Geist im Herzen tragen, der sie zum Guten bestimmt, handeln sie auch ohne Gericht und Strafe einer weltlichen Obrigkeit nie unrecht. Wären alle Menschen dieser Welt (rechte) Christen, bräuchte es folglich gar keine weltliche Obrigkeit zu geben. Doch die Welt ist anders. Der größere Teil der Menschen ist nämlich gar nicht rechtgläubig in Christus, sondern dem Übel und dem Bösen zugetan. Gäbe es da nicht das weltliche Regiment, das mit Schwert und Recht für Ordnung sorgte, würde der eine den anderen fressen und Hass und Krieg bestimmten die Welt. Unter diesen Bedingungen, die die Welt verwüsteten, könnten auch die Christen nicht Gott dienen. Deshalb muss die weltliche Obrigkeit auf Erden sein: „Potentiam in terra esse, non est per se malum“. Freilich – und da kommt Luther auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen – hat das Reich der Welt eine klar begrenzte Verfügungsgewalt. Ihre Gesetze „strecken sich nicht weiter denn über Leib und Gut und was äußerlich ist auf Erden“. Sobald sich die weltliche Obrigkeit anmaßt, die Leute mit ihren Gesetzen und Geboten zu zwingen, so oder so zu glauben, vermisst sie sich. Vorbemerkung II (didaktisch) 1. Bezug zum Bildungsplan Diese Unterrichtseinheit ist für den Unterricht der Kursstufe konzipiert. Die Texte und die darauf bezogenen Fragen der Arbeitsblätter sind komplex und manchmal ausgesprochen schwer (Augustinus; Luther) und verlangen ein schon weit entwickeltes Verständnisvermögen. Einige Arbeitsblätter können aber, ohne die Schülerinnen und Schüler zu überfordern, auch bereits in Klasse 10 behandelt werden, nämlich A 6 und A 7 (die 5 Christen im römischen Staat und die Konstantinische Wende) sowie A 9 und A 10 (der Streit um die Oberhoheit im Mittelalter). Die Anbindung an den Bildungsplan Gymnasium/Baden-Württemberg ist nicht ganz einfach. Direkte Bezugspunkte gibt es nur wenige. Gleichwohl hängt diese Unterrichtseinheit curricular nicht in der Luft. Für den katholischen Religionsunterricht in Klasse (9/)10 legt der Bildungsplan als ein verbindliches Themenfeld fest: „Kirche – Staat – Gesellschaft“. Trotz der Ähnlichkeit der Themen ist die Schnittmenge aber gering, um nicht zu sagen: fast Null. Das liegt daran, dass die inhaltliche Konkretisierung des Themas im Bildungsplan Klasse 10 den Fokus auf die Gegenwart richtet und die geschichtliche Entfaltung nur bis zur Zeit des Nationalsozialismus zurückreicht. Der Blick auf den Bildungsplan für die Kursstufe (Katholische Religionslehre zwei- und vierstündig) scheint ebenfalls zu bestätigen, dass der Inhalt dieser Arbeitsblätter hier nicht vorgesehen ist. Wohl ist das Thema „Kirche“ eines der sechs Unterrichtsthemen, die den Stoff des katholischen Unterrichts in der Kursstufe ausmachen. Doch die gegliederte Darstellung des Themas bietet bei dem zwei- wie bei dem vierstündigen Unterricht nur wenig Anknüpfungsmöglichkeiten, weil die historische Betrachtung und Analyse der Kirche nahezu ausfällt. Unter dem Stichwort „Suche nach der rechten Gestalt von Kirche“ (Wahlmodul, zweistündig) bzw. „Suche nach der rechten Gestalt von Kirche in Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen“ (vierstündig) findet sich als Konkretisierung aber immerhin: „Mk 12,13-17; Röm 13,1-7 [nur vierstündig]; Konstantinische Reichskirche; Bischof von Rom; Investiturstreit; einzelne Päpste“. In Verbindung mit den „Vorbemerkungen“ zum Bildungsplan für das Fach Katholische Religionslehre in der Kursstufe birgt dieses Stichwort, das seiner Konkretisierung entsprechend nur einen kleinen Teil der vorliegenden Unterrichtseinheit abdeckt, dann aber ein weit größeres Potential. Es lässt sich ohne weiteres ableiten, dass es bildungsplankonform ist, diese Unterrichtseinheit in der Kursstufe nicht nur fragmentarisch, sondern ganz durchzuführen. Die Vorbemerkungen „Katholische Religionslehre 2-stündig“ bestimmen: Die zwei verpflichtenden Themen (die aus sechs Themen insgesamt abwechselnd paarweise festgelegt werden) sind in zwei Kurshalbjahren zu behandeln. In den beiden verbleibenden Halbjahren müssen zwei weitere Unterrichtseinheiten behandelt werden. Für die Gestaltung dieser beiden Einheiten gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, so auch die, ein Modul der übrigen vier Themen zu erweitern und zu einer Halbjahres-Unterrichtseinheit auszubauen. Das bedeutet für diese Arbeitsblätter: Wenn das Thema „Kirche“ kein verpflichtendes Thema ist, kann das Wahlmodul „Suche nach der rechten Gestalt von Kirche“ zur HalbjahresUnterrichtseinheit „Gott und die weltliche Obrigkeit“ entwickelt werden, ohne dass Abstriche nötig wären. Die Vorbemerkungen „Katholische Religionslehre 4-stündig“ führen zu einem ähnlichen Resultat. Es gilt: Außer den beiden verpflichtenden Themen, die in zwei Kurshalbjahren behandelt werden, ist von den übrigen Themen ein weiteres ebenfalls ein halbes Jahr zu behandeln. In der restlichen Zeit (viertes Kurshalbjahr) kann aus dem Bildungsplan Katholische Religionslehre 2-stündig ein geeignetes Modul zu einer eigenen Unterrichtseinheit ausgebaut werden – Konsequenz siehe oben! 6 2. Didaktisch-methodische Hinweise Das Thema „Gott und die weltliche Obrigkeit“ wird in diesen Arbeitsblättern bibeltheologisch und historisch behandelt. Umso wichtiger ist es, das Thema durch die Eingangssequenz in einen aktuellen Zusammenhang zu stellen. Dadurch begreifen die Schülerinnen und Schüler, dass das, was in den folgenden Arbeitsblättern sozusagen rückwärtsgewandt behandelt wird, eine Dimension in die Gegenwart hinein hat und deshalb von bleibender Bedeutung ist. Gerade bei der vorliegenden Thematik gilt der Satz: Die Vergangenheit verstehen heißt die Gegenwart verstehen. Die „Gegenwart verstehen“ meint dabei auch: im Heute urteils- und entscheidungsfähig zu sein und begründete Standpunkte beziehen zu können. Die Unterrichtseinheit wurde so konzipiert, dass die Arbeitsblätter der Chronologie entsprechend nacheinander be- und erarbeitet werden. Im Vordergrund steht das Lernen von Wissen; damit einhergehen soll das Üben von Text- und Bildanalyse mit Hilfe eines methodischen Vorgehens. Da die Arbeitsaufgaben zu den Texten und Bildern vorrangig auf den Inhalt abzielen, ist der/die Unterrichtende mit Blick auf methodische Anweisungen gefordert. Zum Lernen von Wissen im Rahmen dieser Unterrichtseinheit ist eine Bemerkung nötig. Die Inhalte der Arbeitsblätter sind so angelegt, dass es hier nicht um Fach- im Sinne von Spezialwissen geht. Vielmehr handelt es sich, wenn das Babylonische Exil, die Steuerfrage, Römer 13, die Konstantinische Wende, Augustins Gottesstaat, die Silvesterlegende und die Konstantinische Schenkung sowie Luthers Lehre von den zwei Reichen Gegenstand des Unterrichts sind, um Allgemeinbildung. (Was Allgemeinbildung in meinem Verständnis ist, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter erläutern. Ich verweise stattdessen auf meine Ausführungen in: Vorüberlegungen zum Unterrichtsentwurf „Streifzug durch die Geschichte der biblischen Hermeneutik“, Abschnitt „Idee des Bildungskanons“; URL: http://www.irpfreiburg.de/index.php/Unterrichtsimpulse/138/0/ [12.04.2010].) Da die Unterrichtseinheit – von der Eingangssequenz abgesehen – in vier inhaltlich gleichgewichtige Sequenzen gegliedert ist, bietet sich auch eine andere Unterrichtsorganisation an. Es ist durchaus möglich, die Sequenzen in arbeitsteiliger Gruppenarbeit erarbeiten zulassen. Die Lehrperson muss zum Ablauf der Gruppenarbeit aber genaue Anweisungen geben, die folgende Fragen beantworten: Wie viel Zeit hat die Gruppe? Inwieweit sind zusätzlich zu den vorhandenen Arbeitsblättern weitere Materialien heranzuziehen? Wie und in welcher Länge ist die Präsentation der Ergebnisse zu gestalten? Hat die Gruppe neben der Präsentation die Ergebnisse noch schriftlich zusammenzufassen (Handout)? Um den relativ großen Textumfang von Sequenz II und Sequenz III auszugleichen, könnten für diese Sequenzen je zwei Gruppen gebildet werden (IIa: Erstes Testament; IIb: Zweites Testament; IIIa: Bis zur Konstantinischen Wende; IIIb: Augustins Lehre von den zwei Reichen). Eine Variante zur arbeitsteiligen Gruppenarbeit mit abschließender Präsentation ist das Gruppenpuzzle. Wer diese Form der Gruppenarbeit nicht kennt, kann sich schnell im Internet kundig machen, z. B. unter folgender URL: http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/UNTERRICHTSFOR MORD/Unterrichtsform.html [12.04.2010]. 1.1.2.1 Gott und die weltliche Obrigkeit – ein aktuelles Thema Wie Gott und eine von Gott her zu denkende Ordnung einerseits und die Politik andererseits in Beziehung stehen, ist noch immer eine aktuelle Frage. 7 Gegenwärtig am brisantesten ist das Thema im Kontext des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester. Hier hat die Kirche bis zum Jahr 2001 – und vereinzelt auch länger – nach der Devise gehandelt, dass kirchliches Recht als göttliches Recht Vorrang habe vor dem staatlichen Recht. Jedenfalls wurden viele Fälle sexuellen Missbrauchs von den Ordinariaten nicht angezeigt (und dem Rechtsstaat übergeben), sondern im kircheninternen Verfahren nach der Maxime „Gnade vor Recht“ abgewickelt. Zu den Missbrauchsfällen in Deutschland fehlt freilich noch das letzte kirchliche Wort; trotz verschiedener Gelegenheiten hat der Papst noch keine Stellung bezogen. Außerdem ist für Deutschland auch sachlich nicht restlos geklärt, in welchem Maß und mit welcher Absicht die vorgesetzten Stellen – in der Regel die Ordinariate – bei sexuellem Missbrauch nicht entschieden genug reagiert und die staatliche Strafverfolgung einbezogen haben. Wegen der umrissenen „Schwebesituation“ der Missbrauchs-Thematik ist für den Einstieg ein anderes Thema gewählt worden, das auch Brisanz hat (gerade wenn man die Rede vom „christlichen Europa“ im Hinterkopf hat): die Auseinandersetzung um die Nennung Gottes in einer EU-Verfassung. 1.1.2.1.1 Gott in der EU-Verfassung? Der Streit um „Gott in der EU-Verfassung“ wurde veranlasst durch den Beschluss, im Zuge der Erweiterung der EU durch acht ehemalige Ostblockländer sowie Zypern und Malta die bis dahin gültigen Grundlagenverträge abzulösen und in einem neuen „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ das gemeinsame Wertefundament und die Richtung der gemeinsamen Politik abzustecken. Ein Anfang 2002 eröffneter Europäischer Konvent erarbeitete dann bis zum Juli 2003 den maßgeblichen Entwurf des EU-Verfassungsvertrags. Neben vielem anderen war in diesem Konvent besonders strittig, ob in der Präambel der EUVerfassung ausdrücklich auf Gott Bezug genommen werden sollte. M1 Der Text informiert darüber, wie im 2002 eröffneten Europäischen Konvent, der einen „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ erarbeitete, um eine Nennung Gottes (in der Präambel) gerungen wurde und am Ende als Kompromissformel herauskam: „Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen Überlieferungen Europas …“ Der Inhalt des Textes kann durch einen Lehrervortrag oder im Lehrer-Schüler-Gespräch vermittelt werden. Fragen für das Lehrer-Schüler-Gespräch: 1. Aus welchem Anlass und mit welcher Zielrichtung sollte der 2002 eröffnete Europäische Konvent eine EU-Verfassung erarbeiten? 2. Welche Positionen wurden innerhalb und außerhalb des Europäischen Konvents zur Frage des Gottesbezugs in der EU-Verfassung vertreten? 3. Inwiefern ist die schließlich gefundene Formulierung eine „Kompromissformel“? 4. Wie beurteilen Sie diese „Kompromissformel“? 8 M2 Pro und Contra „Gott in der EU-Verfassung“ sind hier gegenübergestellt. Der Pro-Text stammt von dem Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Prof. Dr. Martin Hein, der Contra-Text von dem Journalisten und Publizisten Robert Leicht, Chefredakteur der Wochenzeitung DIE ZEIT von 1992 bis 1997 und Ratsmitglied der EKD von 1997 bis 2003. Die Argumentation der beiden wird arbeitsteilig in Kleingruppen erarbeitet, d. h. von 4 (6) Gruppen befassen sich 2 (3) mit dem Hein-Text und 2 (3) mit dem Leicht-Text. Nach der Erarbeitung, deren Ergebnis von den Gruppen schriftlich festzuhalten ist, entsendet jede Gruppe eine Vertreterin oder einen Vertreter in eine Diskussionsrunde. Auf der Grundlage der von Hein und Leicht formulierten Argumente versuchen sich die Schülerinnen und Schüler an einem Diskurs. Die Lehrperson moderiert das Gespräch. Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit: 1. Lesen Sie den Text einzeln für sich und unterstreichen Sie dabei die Stellen, die jeweils den Kern eines Arguments bilden. (Benützen Sie für jedes Argument eine andere Farbe!) 2. Stellen Sie in der Gruppe gemeinsam fest, wie viele Argumente im Text enthalten sind. 3. Formulieren Sie die Argumente in Form von Kausalsätzen (Gott sollte [nicht] in der EUVerfassung erwähnt werden, weil …). 4. Bestimmen Sie eine(n), welche(r) die Gruppe in der anschließenden Diskussion über „Gott in der EU-Verfassung“ vertritt. Ergebnisse der Gruppenarbeit: Pro-Argumente (Hein) Gott sollte in der EU-Verfassung erwähnt werden, weil die Formel „Verantwortung vor Gott“ die Völker Europas daran erinnern kann, dass nie wieder Diktaturen (wie der Nationalsozialismus) Geltung erhalten sollen, die staatliche Gewalt zu Lasten der Menschen absolut setzen es sich bei der Formulierung „Verantwortung vor Gott“ um keine unmittelbare Anrufung Gottes und somit um kein Glaubensbekenntnis handelt Verantwortung in letzter Konsequenz immer nur aus einer Quelle begründet werden kann, die sich menschlicher Verfügung entzieht (ob man diese Quelle nun explizit „Gott“ nennt oder nicht) der Bezug auf Gott vor absoluten Erwartungen an die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik bewahren kann. Contra-Argumente (Leicht) Gott sollte in der EU-Verfassung nicht erwähnt werden, weil die allerdings höchst notwendige Selbstbegrenzung von Staat und Politik auch anders auszudrücken ist als durch die verbale Nennung eines „Gottes“ eine moderne Verfassung auch für entschiedene Atheisten und Agnostiker kompatibel sein muss. Die Argumente für einen Verzicht auf den verbalen Gottesbezug gelten aber nur unter zwei Voraussetzungen: 9 1. Die Präambel der EU-Verfassung beruft sich ausdrücklich auf die religiösen Überlieferungen Europas. 2. Die kollektive Religionsfreiheit, also das Recht der Kirchen, in der Öffentlichkeit für ihre Sache zu streiten, wird in ganz Europa anerkannt. 1.1.2.2 Gott und die weltliche Obrigkeit in der Bibel Es wäre zweifellos eine Verkürzung der biblischen Botschaft, über das Verhältnis des Menschen zu Gott und der weltlichen Obrigkeit nur die Stimme des Neuen Testaments zu hören. Zu den für das Thema einschlägigen Texten des Neuen (Zweiten) Testaments sollen hier gleichrangig Texte des Alten (Ersten) Testaments treten, die zur Spannung von Gottesgehorsam und Staatsgehorsam – auch abhängig von den historischen Gegebenheiten – Stellung beziehen. 1.1.2.2.1 Königtum und Gottesherrschaft (Erstes Testament) Im Ersten Testament wird die Institution des Königtums ambivalent beurteilt. Auf der einen Seite befürwortet eine Vielzahl von Texten das Königtum unter politischem und/oder theologischem Aspekt. Diese positive Sicht gipfelt in der Vorstellung eines „messianischen“ Königs, der die Vollendung der Geschichte herbeiführt. Auf der anderen Seite gibt es einschlägige Texte, die das Königtum als „unfruchtbar“ und „nutzlos“ verspotten oder seine Einrichtung als Abfall von JHWH verwerfen, weil JHWH allein der König Israels ist. Der wohl berühmteste monarchiekritische Text des Ersten Testaments ist die im Richterbuch enthaltene sog. Jotamfabel (Ri 9,7ff. = M 3). Die Deutung dieser Erzählung ist allerdings umstritten. Viele Exegeten verstehen die Fabel als scharfe und prinzipielle Ablehnung des Königtums. Sie folgen hierin dem viel zitierten Diktum Martin Bubers, bei der Jotamfabel handle es sich um „die stärkste antimonarchische Dichtung der Weltliteratur“. Daneben bestreitet eine Reihe von Exegeten, dass die Fabel politisch programmatisch zu interpretieren sei. Der Text wolle auf satirische Weise nur bestimmte Aspekte der Königsherrschaft lächerlich machen, ohne deshalb das Königtum von vornherein oder grundsätzlich in Frage zu stellen. Diese Auffassung unterstützt eine neuere Untersuchung von R. Müller mit guten Argumenten (R. Müller: Königtum und Gottesherrschaft. Tübingen : Mohr Siebeck, 2004). Wie immer die Fabel gedeutet wird, so ist in jedem Fall ihre Profanität auffällig. Eine theologisch begründete Verwerfung des Königtums kommt hier nicht in Sicht. Anders ist das bei dem ebenfalls im Richterbuch enthaltenen Gideonspruch (Ri 8,22f. = M 4). Nachdem Gideon die Midianiter besiegt hat, tragen ihm die Israeliten die dynastische Herrschaft an. Doch Gideon lehnt ab, indem er auf die (exklusive) Herrschaft JHWHs über Israel verweist. Die im Gideonspruch formulierte Antithese ist umso bedeutungsvoller, als dazu in der Umwelt des Ersten Testaments noch keine Prallelen aufgetaucht sind. So sehr sich die Königsideologien aus dem ägyptischen und mesopotamischen Raum unterscheiden, so kommen sie doch in einem Punkt überein: Die Institution des Königtums ist göttlichen Ursprungs, und der König ist Statthalter des Götterherrschers oder Sohn der Gottheit. Demgegenüber ist die Entgegensetzung von Königtum und Gottesherrschaft – nach dem bisherigen Kenntnisstand – ein Proprium des Ersten Testaments. Es kann freilich nicht übersehen werden, dass den beiden monarchiekritischen Texten des Richterbuchs im selben Buch eine positive Beurteilung des Königtums entgegenläuft. Es ist 10 in der ersttestamentlichen Forschung inzwischen Gemeingut, dass im Richterbuch zahlreiche Texte verschiedenen Alters auf der Grundlage eines Rahmenwerks zusammengefügt worden sind. Dieses Rahmenwerk hat eine heilsgeschichtliche Konzeption, in der die Einrichtung des Königtums als Ziel der Richterzeit anvisiert ist. In dem auf das Richterbuch folgenden Buch 1 Samuel begegnet diese Spannung wieder. Als Samuel alt geworden ist, setzt er seine Söhne zu Richtern über Israel ein. Aber seine Söhne sind schlechte Richter, sie lassen sich bestechen und beugen das Recht. Deshalb – und um den andern Völkern gleich zu sein – verlangt nun das Volk die Einsetzung eines Königs. In den drei Reden, die Samuel hierauf hält (1 Sam 8 = M 4; 10,17ff.; 12), spricht er im Auftrag JHWHs unmissverständlich aus, dass Königtum und Gottesherrschaft unvereinbar sind. Widersprüchlich dazu fordert ihn aber JHWH im selben Zusammenhang mehrmals auf, dem Verlangen des Volkes stattzugeben und einen neuen König einzusetzen. Uneingeschränkt positiv erscheint dagegen das Königtum in Ps 101 (= M 5). Der Regent gibt hier sein „Inthronisationsgelübde“ ab. Dabei bestimmt er sein Denken und Handeln aber nicht aus eigener Macht. Er weiß sich von JHWH dazu berufen, das Gottesrecht der Bundescharta im Bundesvolk durchzusetzen. Im Bild des idealen – gottgefälligen – Königs kommt auch schon der messianische Heilsbringer in den Blick. M1 Das Bild, das Davids Krönung zeigt, stammt aus dem Pariser Psalter (Codex Parisinus), einer byzantinischen illuminierten Handschrift aus der Mitte des 10. Jahrhunderts. Die Darstellung ist, was generell für mittelalterliche Kunst (mit biblischen Motiven) gilt, anachronistisch. Weder wurde David auf den Schild gehoben noch wurde ihm eine Krone aufgesetzt. Er wurde vielmehr gesalbt (vgl. 2 Sam 5,3). Der Anachronismus wird aber nicht weiter thematisiert. Jetzt interessiert, dass das Bild die ambivalente Beurteilung des Königtums im Ersten Testament in den Blick bringt, auch wenn der Maler diese Intention gar nicht verfolgte. Es ist augenfällig, dass in der Menschengruppe, die sich um den auf das Schild gehobenen David schart, manche nicht auf ihn, sondern von ihm weg schauen. Auch die beiden Personen, die im Hintergrund aus dem Fenster schauen, haben einen skeptischen Gesichtsausdruck. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt M2 Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler vor der Analyse einzelner Texte vorab einen Überblick über die zwei Seiten, die für die Beurteilung des Königtums im Ersten Testament kennzeichnend sind. So gewinnen sie eine Verständnisgrundlage, die Einordnungen ermöglicht. Statt eigener Textlektüre der Schülerinnen und Schüler kann die Lehrperson sie auch in einem Kurzvortrag informieren. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt M3 Die Jotamfabel wird (wegen der Wirkung) laut gelesen. Danach äußern die Schülerinnen und Schüler ihren ersten Eindruck vom Text und formulieren Fragen, die sie an den Text haben. 11 Diese Fragen führen zum Arbeitsauftrag, durch den die Fabel (in Einzel- und/oder Partnerarbeit) auf drei Ebenen untersucht wird: Erzählkontext – Erzählstruktur – Deutung. Ergebnisse zu Aufgabe 1: Gideon, Richter in Israel, ist gestorben. Nachfolgefrage! Alleinherrschaft von Gideons Sohn Abimelech oder gemeinsame Herrschaft seiner 70 Halbbrüder (Herrscherkollegium)? Mordauftrag an Abimelech durch die Herren von Sichem – Ermordung der Halbbrüder – Erhebung Abimelechs zum König. Abimelechs Halbbruder Jotam, als einziger dem Blutbad entronnen, hält den Herren von Sichem eine große Anklagerede, die er mit der Fabel eröffnet. Ergebnisse zu Aufgabe 2: Absteigende Reihenfolge nach der Größe der Bäume Exposition – Kurzdialog I – Kurzdialog II – Kurzdialog III – Kurzdialog IV Kontrast I – III Parallele Gestaltung formale und inhaltliche Differenz zu I – III Ergebnisse zu Aufgabe 3: Deutung I: Antimonarchische Dichtung Deutung II: Karikatur der Königsherrschaft Die für das Königtum geeigneten Fruchtbäume lehnen die Königsbitte ab; halten ihre Produktivität mit der Königsherrschaft zu Recht für unvereinbar Die für das Königtum geeigneten Fruchtbäume lehnen die Königsbitte ab; halten ihre Produktivität für wichtiger als die Königherrschaft (überschätzen sich!) Nur der ungeeignete Dornstrauch, der weder Frucht trägt noch Schatten spendet, ist zur Königsherrschaft bereit Aufforderung des Dornstrauchs („bergt euch in meinem Schatten“) ist – für die Adressaten offenkundig – nicht ernst gemeint (kein leeres Schutzversprechen, sondern Ironie) dto. Die Bäume, die trotz dreimaliger Abfuhr an ihrem Vorhaben, einen König zu salben, festhalten und schließlich den Schlechtesten fragen, erscheinen in ihrer Hartnäckigkeit lächerlich Zurückweisung des Königtums als „unproduktiv“; Plädoyer für eine nicht monarchisch verfasste Gesellschaft Verschiedene Aspekte der Königsherrschaft werden karikiert, ohne das Königtum grundsätzlich in Frage zu stellen 12 M4 Ri 8,23 und 1 Sam 8,1ff. bezeugen eine theologisch begründete antimonarchische Haltung – die erste Stelle im so genannten Gideonspruch, die zweite Stelle in einer längeren Erzählpassage. Die Herrschaft des Königs und die Herrschaft JHWHs werden – im Unterschied zur Königsideologie in der Umwelt des Alten Testaments – als unvereinbar entgegengesetzt. In 1Sam 8,1ff. ist die Aussage noch dadurch zugespitzt, dass die Forderung des Volks, einen König einzusetzen, von JHWH seiner Verwerfung gleichgestellt wird. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt M5 Psalm 101 zeichnet das Bild des idealen Königs, der sich von JHWH dazu berufen weiß, im Bundesvolk das Gottesrecht der Bundescharta durchzusetzen. Der Psalm, den man als „Inthronisationsgelübde“ (A. Deissler) bezeichnen kann, gliedert sich in drei Abschnitte: Vers 1 nennt das Thema des Psalms; in den Versen 2–4 gelobt der König, im eigenen Denken und Handeln „lauteren Herzens“ der Bundesweisung zu folgen; von Vers 5 ab kündet der Regent davon, seine Herrscher- und Richterpflichten entschieden zu erfüllen und das Gottesrecht ohne Nachsicht durchzusetzen. Die Härte, mit der der König gegen alle, die JHWHs Weisung brechen, vorzugehen gelobt, bereitet dem heutigen Verständnis Schwierigkeiten. Im Unterrichtsgespräch ist darüber zu reden, inwieweit wir den Willen zur Vernichtung und Ausrottung aller Gottlosen und Übeltäter nach unserem Maßstab beurteilen können. 1.1.2.2.2 Israel, Gott und die Fremdherrschaft (Erstes Testament) Das Buch Jeremia vertritt eine sehr dezidierte Auffassung zu dem Themenfeld Israel, Gott und die Fremdherrschaft. Als um 590 Zidkija, König von Juda, unter dem Einfluss nationalistisch gesinnter Hofkreise die Vasallentreue gegenüber Babylon aufkündigen und sich mit Ägypten verbünden will, fordert Jeremia dazu auf, sich auch weiterhin dem babylonischen Joch zu beugen (Jer 27,1-14). Doch nicht nur in Juda, auch bei den vom babylonischen König Nebukadnezar im Jahr 598 nach Babylon verschleppten Juden gibt es Leute, die falsche Hoffnungen wecken. Sie stellen dort die baldige Heimkehr aus dem Exil in Aussicht. Gegen diese „Propheten und Wahrsager“ schreibt Jeremia einen ernüchternden Brief an die Vertriebenen. Im Namen JHWHs fordert er sie auf, sich mit der Verbannungssituation zu arrangieren („Baut Häuser, siedelt, pflanzt Gärten ...“) und für das Wohl Babylons zu beten (Jer 29,1ff.). MM1 1 Das bekannte Bild E. Bendemanns „Die trauernden Juden im Exil“ wird im Lehrer-SchülerGespräch betrachtet. Nach der Bildbeschreibung analysieren die Schülerinnen und Schüler, wie die Trauer der Juden ausgedrückt wird. Dabei können sie eine Fülle von Einzelheiten entdecken: bei der Körperhaltung, der Gestik, der Mimik, bei Attributen (Kette, niedergelegte Musikinstrumente). Der Text links und rechts oben im Bild ist ein Zitat aus Psalm 137,1. Um 13 die Trauer der Juden im Babylonischen Exil in einem wichtigen Punkt zu verstehen, ist die Frage zu stellen: Was bedeutet der Satz: „Wir weinten, als wir an Zion gedachten“? Zion – auf diesem Berg in Jerusalem hatte Salomo den Tempel bauen lassen, dort war der Wohnsitz Gottes gewesen. Doch die Babylonier hatten bei der Eroberung Jerusalems den Tempel zerstört. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt M2 Die Schülerinnen und Schüler erhalten in diesem Text Grundinformationen über die großpolitische Situation zur Zeit des Jeremia, die judäische Außenpolitik und den politischen Standpunkt Jeremias. Der Lehrperson bleibt es unbenommen, an die Stelle der Textarbeit einen Lehrervortrag zu setzen. Folgende grafisch-geografische Skizze – ob von den Schülerinnen und Schülern selbst erarbeitet oder von der Lehrperson vorgegeben – dient dem einfachen Überblick und damit dem Verständnis: M3 JHWH spricht durch seinen Propheten Jeremia zu Zidkija, dem König von Juda, und zu den Königen der umliegenden Völker. Er fordert sie auf, sich König Nebukadnezzar von Babylonien zu unterwerfen. Wer seinen Nacken nicht unter das babylonische Joch beuge, werde umkommen. Er – JHWH – selbst habe als Herrscher der Welt und Geschichte Nebukadnezzar bevollmächtigt, alle Völker [des Orients] sich untertan zu machen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten diesen Inhalt in Partnerarbeit anhand von drei Fragen. Die Ergebnisse halten sie schriftlich fest. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt 14 M4 JHWHS Worte, die Jeremia an die nach Babylonien Verschleppten schreibt, dürften für viele ähnlich skandalös geklungen haben wie die Worte an König Zidkija (M 3). Gegenüber der unter den Exulanten verbreiteten Hoffnung, dass die baldige Heimkehr bevorstehe, ist die Botschaft des Briefs ernüchternd: Sie sollen in der Fremde heimisch werden und für das Wohl der Babylonier beten. Die Begründung dieser Botschaft entspricht der König Zidkija gegebenen: Es ist JHWHs Wille, dass Babylonien die Menschen von Juda beherrscht; die von ihm dem Babylonischen Reich bestimmte Zeit ist noch lange nicht abgelaufen. Der Text ist kurz und bietet dem Verständnis keine Schwierigkeiten; statt in schriftlicher Einzelarbeit kann er auch mündlich analysiert werden. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt 1.1.2.2.3 Dem Kaiser, was des Kaisers ist? Zu Mk 12,13–17 Jesu Antwort auf die Frage, ob es erlaubt sei, dem Kaiser Steuer zu zahlen (vgl. Mk 12,13– 17 parr.), hat die widersprüchlichsten Deutungen erfahren und ist in ihrem Sinn bis heute umstritten. Die Alte Kirche verstand das „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ meist im Rahmen einer gewissen Distanz zur Obrigkeit: Die Christen seien zur Loyalität gegenüber dem Staat und seinen Repräsentanten verpflichtet, aber sie müssten Gott mehr gehorchen als weltlicher Macht. Einschlägig ist hier eine Stelle bei Johannes Chrysostomos: „Wenn ihr das Wort hört: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, dann versteht darunter Dinge, die dem Gott geschuldeten Dienst nicht entgegen sind; denn wären sie ihm entgegen, dann wäre es kein Tribut an den Kaiser mehr, sondern ein Tribut an den Satan“ (Hom. 70 in Matth.). Später wird Jesu Antwort auf die Steuerfrage als Aufforderung zur staatstreuen Untertanenhaltung aufgefasst (zu M. Luther vgl. A 11/M 7). Diese Auffassung prägte auf verhängnisvolle Weise auch im Nationalsozialismus das Verhältnis der Kirchen zum Staat. In der Gegenwart herrscht bei den Exegeten die Meinung vor, dass der Parallelismus in Jesu Antwort inhaltlich keine Nebenordnung bedeute; vielmehr überbiete das zweite Glied das erste. Details sind aber durchaus noch strittig. Es wird z. B. darüber diskutiert, ob „geben“ die richtige Übersetzung sei oder ob es nicht „zurückgeben“ heißen müsse. Doch selbst die Entscheidung für die Übersetzungsvariante „zurückgeben“ lässt eine gegensätzliche Interpretation des von Jesus Gemeinten zu. M1 Dem Bibeltext Mk 12,14–17 ist eine kurze Information über die politische Situation in Palästina z. Zt. Jesu vorangestellt. Um die an Jesus gerichtete Steuerfrage und seine Antwort zu verstehen, müssen die Schüler mindestens wissen, dass - ganz Israel dem Kaiser von Rom unterworfen war und Judäa direkt von einem römischen Prokurator regiert wurde - die Menschen in Israel durch die regelmäßigen Steuerabgaben – die Kopf- und die Bodensteuer – schwer belastet wurden. 15 Der Lehrkraft ist es unbenommen, die knappe Grundinformation zu ergänzen und auszuweiten. Der Bibeltext zur Steuerfrage (Mk 12,14–17) kann im Unterrichtsgespräch anhand folgender Impulse erarbeitet werden: 1. Ob dem Kaiser Steuer zu zahlen sei, war unter den Israeliten strittig. Warum? 2. Obwohl die Pharisäer und Herodianer Jesus eine echte Streitfrage vorlegen, spricht er von Heuchelei und Versuchung. Wie ist seine Einschätzung zu erklären? 3. Jesus argumentiert nicht theoretisch, sondern mit dem Erscheinungsbild der Kaiser-(= Steuer-)Münze. Worin liegt die Überzeugungskraft dieser Argumentation? 4. Wie ist Jesu Antwort zu verstehen? Plädiert er für eine klare Trennung von weltlichem und religiösem Bereich? Fordert er die politische Unterwerfung unter den Kaiser? Ergebnisse: Zu 1. Der Kaiser war Repräsentant einer heidnischen Okkupationsmacht, der ein (patriotischer) Jude nicht das Recht zuerkannte, ihn in die Untertanenpflicht zu nehmen. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Kaiser göttliche Würde zuschrieb und diesen Anspruch auf der Steuermünze in Schrift und Symbolik zum Ausdruck bringen ließ (vgl. Abb. des Tiberius-Denars). Dadurch entstand für den frommen Juden ein Konflikt mit dem ersten Gebot. Zu 2. Die Frager wollen nicht eine für sie selbst problematische Situation klären und von Jesus eine Lösung dazu hören, sondern ein politisch-religiöses Dilemma, um Jesus eine Falle zu stellen. Zu 3 Jesus umgeht das Dilemma der Steuerfrage, indem er sich ganz pragmatisch auf das faktisch Vorgegebene bezieht. Die Steuermünze zeigt, was Sache ist: Sie bildet den Kaiser ab und bekundet so deutlich, wem sie gehört, wessen Eigentum sie ist. Zu 4. Jesu Antwort lässt die Steuerfrage letztlich offen. „Gebt dem Kaiser, was des Kaiser ist“ klingt so, als wolle Jesus sagen: ‚Zahlt dem Kaiser die Steuer, wie es eure Pflicht ist.’ Doch warum dann die Fortsetzung: „und Gott, was Gottes ist“? Der Hörer wird dadurch aufgefordert, sein Gott-Verhältnis ins Spiel zu bringen. Er selbst muss nun entscheiden, welches Verhältnis zur Staatsgewalt sich daraus für ihn ergibt. M2 Der Text stammt aus einer Predigt Kardinal Lehmanns und ist, wie es diesem Genre entspricht, prononciert und leicht verständlich. Er führt die Überlegungen des Unterrichtsgesprächs zu Mk 12,14–17 weiter und bringt sie auf den Punkt. Arbeitsauftrag (schriftlich): 1. Wie wird das Dilemma, in das die Frage Jesus stürzt, beschrieben? 2. Wie deutet Lehmann Jesu Antwort auf die Steuerfrage? Stellen Sie seine Auffassung thesenartig zusammen. M3 Tizians berühmtes Bild „Der Zinsgroschen“ stellt die Situation der Steuerfrage in einem denkbar knappen Ausschnitt dar: Gezeigt werden Jesus und ein Pharisäer als Halbfiguren, 16 am Bildrand auch vertikal beschnitten, auf Tuchfühlung aneinander gerückt. Jesus nimmt den größten Teil des Bildes ein, vom Pharisäer sind nur der Kopf, der Hals und der linke Arm (mit hoch gekrempeltem Ärmel) zu sehen. Die Bildgestaltung ist vom Kontrast bestimmt. - Auf das Gesicht Jesu fällt Licht, das Gesicht des Pharisäers befindet sich im Halbschatten. Die Gesichtszüge Jesu sind ebenmäßig, weich eingeschlossen von Bart und Haar, sein Gesichtsausdruck wirkt offen, sanft und gleichwohl bestimmt; das Gesicht des Pharisäers ist kantig, im Ausdruck ist es verkniffen (zusammengezogene Brauen, nach unten gezogene Mundwinkel). - Der Oberkörper Jesu ist nach links vom Pharisäer weggewandt, in seiner Haltung erscheint Jesus ruhig, der Pharisäer dagegen wendet sich zudringlich zu Jesus hin. - Jesu Hand ist feingliedrig, gerade und wie schwebend, die Hand des Pharisäers ist kraftvoll („nervig“), gekrümmt und an die Münze geklammert. - Jesus ist größer oder steht höher als der Pharisäer, sein Blick geht von oben nach unten, der Pharisäer schaut zu Jesus auf. In der Kontrastierung lässt Tizian Jesus als überragende Persönlichkeit erscheinen, die von der Brisanz der Steuerfrage unberührt bleibt. Tizians Bildgestaltung ist eine Entdramatisierung der Konflikt-Situation: Durchgeistigt und selbstbeherrscht ist Jesus souverän Herr der Lage. 1.1.2.2.4 Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt? Zu Röm 13,1–7 Es gibt keinen biblischen Text, der für das christliche Verständnis des Staates und überhaupt für das politische Verhalten der Christen eine größere Bedeutung gehabt hätte als Röm 13,1–7. Der von Paulus geforderte (generelle) Gehorsam gegen die Obrigkeit war zu jeder Zeit eine große Herausforderung, vor allem aber dann, wenn die Obrigkeit dem Christentum feindlich gegenüberstand oder sich in ihrem politischen Handeln ganz augenscheinlich dem Bösen und der Ungerechtigkeit verschrieben hatte. Angesichts der biblischen Autorität dieses Paulus-Textes stellte sich in bestimmten Situationen immer wieder die Frage: Sind Widerstand und Aufstand gegen die staatliche Gewalt für einen Christen überhaupt erlaubt? Das Spektrum der Antworten, die von Fall zu Fall gefunden wurden, spannt sich sehr weit. Zwei „Lösungen“ sind besonders bemerkenswert und sollen eigens hervorgehoben werden: - Bereits wenige Jahre, nachdem Paulus seine Gehorsamsforderung niedergeschrieben hatte, begann eben jene Gewalt, der „jedermann“ laut Röm 13,1– 7 „Folge leisten“ sollte, die Christen grausam zu verfolgen. In den nächsten 250 Jahren veranlassten römische Kaiser immer wieder neue Verfolgungen, der viele Christen zum Opfer fielen. Gleichwohl wurde die paulinische Mahnung zum Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Selbst Märtyrer bekannten sich dazu, der staatlichen Gewalt, von Gott verordnet, Ehre zu erweisen. Und die Kirche hörte nicht auf, in den Gottesdiensten für den Kaiser zu beten. Doch lehrten die Verfolgungen die Kirche immerhin, die paulinische Gehorsamsforderung durch die „clausula Petri“ (vgl. Apg 5,29: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“) zu beschränken: Der Glaube und Gottes Gebote dürfen nicht verleugnet werden. Verlangt die Obrigkeit dies, muss man sich ihr widersetzen. - Im Anschluss an Augustinus stellt Martin Luther zu der Frage, wie weit man der weltlichen Obrigkeit Gehorsam schuldig sei, fest: Das „weltliche Regiment erstreckt sich nur über Leib und Gut und was äußerlich ist auf Erden“. Über die Seele aber 17 kann niemand regieren als Gott allein. Die Staatsgewalt beschränkt sich also auf die äußerlichen Güter, sie zu ordnen und zu regieren auf Erden. Die Dinge des Glaubens sind ausgenommen. Freilich lässt Luther keinen Zweifel daran: Im Reich der Welt sind Christen wie alle Menschen gegenüber der Obrigkeit zu absolutem Gehorsam verpflichtet, ein Recht auf Freiheit gibt es hier nicht (vgl. A 11/M 7). M1 Die Schüler sollen Röm 13,1–7 unvoreingenommen und unbefangen lesen, um so selbst die Brisanz und Problematik dieses Textes zu erfassen. Die Lehrkraft gibt also vorweg keine einführenden Hinweise – weder auf den geschichtlichen Hintergrund noch auf die Wirkungsgeschichte des Textes. Nach der Lektüre fordert sie die Klasse auf, Eindrücke und spontane Gedanken zu äußern. In der Regel sind die Schüler verwundert oder kritisieren sogleich schon, wie entschieden Paulus die übergeordnete Gewalt (von Gott her) legitimiert und zum Gehorsam ihr gegenüber auffordert. Wahrscheinlich wird auch die Verständnisfrage gestellt, was denn Paulus mit „Gewalt“ hier genau meine. Im Unterrichtsgespräch ist für die Verständnisfrage zu klären, dass Paulus die staatliche Obrigkeit in Gestalt der römischen Staatsmacht meint. Hieran könnte sich ein kurzer Exkurs der Lehrkraft anschließen, in dem sie darlegt, dass in der mittelalterlichen Rezeption von Röm 13,1–7 der Begriff der „Gewalt“ auf den Staat und die Kirche bezogen wurde. Weiter sollte im Unterrichtsgespräch darüber reflektiert werden, ob sich im Text Anhaltspunkte finden lassen, die eine Relativierung der Gehorsamforderung indizieren (vgl. dazu M 3, Text 1 [E. Spiegel]). M2 Die Schüler werden hier in aller Kürze über die frühe Geschichte des römischen Christentums und über die aktuelle Lage (zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs) informiert. Diese Informationen sind notwendig, um die Bedingtheit und auch Begrenztheit der paulinischen Aussagen zu erkennen und einer normativen Auslegung von Röm 13 eine relativierende Interpretation entgegenzustellen. Für die (mündliche oder schriftliche) Textarbeit können folgende Fragen gestellt werden: 1. Welcher Zusammenhang lässt sich zwischen der Paulus bekannten Geschichte der römischen Christen und seiner Forderung des Gehorsams gegenüber der staatlichen Obrigkeit herstellen? 2. Welches aktuelle Ereignis in Rom könnte Paulus bei seiner Mahnung zum Gehorsam im Blick gehabt haben? M3 Auch wenn man Röm 13,1–7 auf den historischen Kontext bezieht und von daher relativiert, bietet der Text noch Verständnisprobleme genug. In der heutigen Exegese ist vor allem die Frage strittig, ob Paulus bei seiner Ausführung eine Grenze des Gehorsams mitgedacht hat – oder ob er zum generellen Gehorsam auffordern wollte. Weiter wird darüber diskutiert, inwieweit Paulus in Röm 13,1–7 (nicht nur auf die römische Gemeinde, sondern) auf das grundlegende Verhältnis der Christen zum Staat abzielte. Die drei Textauszüge lassen deutlich die Meinungsunterschiede in der Exegese erkennen. 18 Der Arbeitsauftrag an die Schüler, die in den drei Texten vorliegende Interpretation von Röm 13,1–7 in zwei (bis drei) Sätzen zusammenzufassen, sollte zu folgenden Ergebnissen führen: E. Spiegel Die von Paulus erhobene Gehorsamsforderung ist nicht unbeschränkt. Die Grenze des Gehorsams liegt dort, wo die Staatsgewalt den Willen Gottes missachtet und der Verwirklichung des Guten im Wege steht (s. des Paulus eigener wiederholter Ungehorsam gegen die Obrigkeit). Reformiert – online Paulus argumentiert im Sinne der frühjüdischen Tradition. Wie diese will er die Pflicht gegenüber Gott (erstes Gebot) und die Pflicht gegenüber der römischen Staatsmacht (Loyalität) in Einklang bringen. Dabei hebt Paulus vor allem auf den zweiten Aspekt ab: Die Christen sollen von sich aus keinen Anlass geben, dass man an ihrer Loyalität zweifeln könnte. U. Wilckens Paulus verlangt den Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt generell und absolut. Sein Text bietet an keiner Stelle einen Anhaltspunkt zur Relativierung der Gehorsamspflicht – weder im Sinne eines legitimen Widerstandsrechts noch aufgrund des eschatologischen Horizonts. 1.1.2.3 Die Christen und der römische Staat Dass das Christentum im römischen Weltreich Fuß fassen, sich immer weiter ausbreiten und schließlich über die heidnische Religion siegend zur Staatsreligion werden konnte, war nicht selbstverständlich. Eine Reihe von Gründen sprach eher dafür, dass die Existenz des Christentums nur eine kurze Episode in der (spät)antiken Geschichte sein würde. Von seinem Anfang her war das Christentum selbst gar nicht auf Dauer angelegt. Es begann als eine enthusiastische Bewegung, die mit der Wiederkunft Christi das endgültige Kommen des Gottesreichs erwartete. Die ersten Christen verstanden sich als „Fremdlinge“ und „Heimatlose“ (1 Petr 2,11), die notgedrungen noch in dieser Welt lebten, obwohl sie ihrer ganzen Intention nach „Bürger im Himmel“ waren (Diognetbrief 5). Je länger freilich die Wiederkunft Christi ausblieb, desto mehr wurde es für die ersten Gemeinden notwendig, sich diesseitig zu orientieren und am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben zu beteiligen. Durch diese Diesseitsorientierung wurde die Spannungssituation des Anfangs aber nicht einfach aufgehoben, sondern setzte sich in einer neuen Ambivalenz fort: Auf der einen Seite ermahnten die Leiter der christlichen Gemeinden die Mitglieder, in ihrem Lebenswandel und ihrem Geschäftsgebaren sich der Norm entsprechend zu verhalten und keinen Anstoß zu erregen. Auf der anderen Seite standen die Grundsätze der christlichen Lehre und Ethik der angemahnten Integration der Christen in der Gesellschaft entgegen. Nicht nur galt eine ganze Reihe von Berufen als unvereinbar mit einer Aufnahme in die christliche Gemeinde (z. B. Magier, Zauberer, Wahrsager, aktive Soldaten, höhere Staatsämter); auch an bestimmten gesellschaftlichen Ereignissen und Handlungen teilzunehmen, war den Christen erschwert (z. B. Schauspiele, Wagenrennen, Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe). Die desintegrative Tendenz des Christentums machte es verdächtig und führte teilweise zum Hass der Nichtchristen. Dem Verständnis der Christen, als Fremdlinge in dieser Welt zu leben, entsprach das Verständnis der römischen Gesellschaft, die Christen als Fremdkörper 19 aufzufassen (vgl. zum ganzen Abschnitt F. Winkelmann: Geschichte des frühen Christentums. München : Beck, ²2001, S. 79f.). Die von Christen und Heiden empfundene Fremdheit des Christentums innerhalb der (spät)antiken Gesellschaft war sicher ein Grund für die Christenverfolgung, die bereits im Jahr 64 n. Chr. unter Kaiser Nero einsetzte. Über die genaueren Umstände und Motive dieser ersten und der nachfolgenden Verfolgung herrscht bei den Wissenschaftlern noch immer Unklarheit. Obwohl das Thema Christenverfolgung die Schüler sehr interessiert, kommt es in diesen Arbeitsblättern nur ansatzweise – mit Bezug auf die römischen Katakomben – zur Sprache. Auch das Verhältnis der Christen zum Staat zur Zeit der Christenverfolgung wird relativ kurz behandelt. Das ist in der Absicht begründet, einem der einschneidendsten Vorgänge in der Geschichte des Christentums – der „Konstantinischen Wende“ – den entsprechenden Raum geben zu können. Dieser Wende ging – sozusagen als Bedingung ihrer Möglichkeit – voraus, dass sich das Christentum trotz teilweise exzessiver Verfolgung institutionell durch die Entwicklung fester Leitungsstrukturen und eine normierende Bekenntnisbildung gegenüber dem Heidentum etablieren konnte. Die Wende selbst ist dann gewiss entscheidend von dem Mann mit herbeigeführt, dessen Namen sie trägt: Konstantin. Aber es sind hier eine Reihe von Missverständnissen auszuräumen, die von einer voreingenommenen Theologie propagiert wurden und vielleicht auch schon die Köpfe der Schüler erreicht haben. Solch ein Vorurteil ist ganz besonders die Auffassung, Konstantin habe 312/13 fast schlagartig mit dem Heidentum gebrochen und sich zum Christentum „bekehrt“. Es lässt sich aber zeigen, dass die Abkehr von den alten Göttern bei Konstantin ein langsamer und keineswegs geradliniger Weg war, und selbst nachdem er 326 in Rom den öffentlichen Gang zum Kapitol verweigert und damit den römischen Götterkult verweigert hatte, blieb sein Christentum von heidnischen Einflüssen – so z. B. der Vorstellung des sol invictus – mit geprägt. Obgleich Kaiser Julianus Apostata rund dreißig Jahre nach Konstantins Tod mit politischen Maßnahmen und einer selbst verfassten Streitschrift vergeblich versucht hatte, gegen die fortschreitende Christianisierung der römischen Gesellschaft die alte Religion neu zur Geltung zu bringen, blieb der Widerstand des Heidentums gerade in der Adels- und Bildungsschicht noch jahrzehntelang lebendig. Exemplarisch ist der Streit um den ViktoriaAltar. Auf Betreiben der Christen hatte bereits Kaiser Constantius II., der Sohn Konstantins, diesen Altar aus der Senatskurie in Rom entfernt, doch Kaiser Julianus hatte ihn wieder zurückgebracht. Als dann Kaiser Gratian 382 den Altar erneut beseitigen ließ, setzte sich der römische Stadtpräfekt Symmachus zusammen mit anderen Senatoren beim Kaiser dafür ein, diese Maßnahme rückgängig zu machen und den Kult der Viktoria wieder zu beleben. In seinem Schreiben an den Kaiser argumentierte Symmachus: „Auf (nur) einem Weg kann man nicht zu einem so großen Geheimnis, wie es der göttliche Geist ist, gelangen.“ Der Ansatz des Symmachus und seiner Mitstreiter, für die heidnische Religion die gleiche Existenzberechtigung einzufordern wie für die christliche (zumal die Götter in der Geschichte Roms ja vielfach ihre Wirksamkeit erwiesen hätten), konnte sich gegen den Exklusivitätsanspruch des Christentums nicht durchsetzen. Der Kirchenlehrer Ambrosius, Bischof von Mailand, stellte in mehreren Briefen der Toleranzidee des Symmachus die Offenbarung der Bibel als „religio absoluta“ entgegen und überzeugte den anfangs noch schwankenden jungen Kaiser auch dadurch, dass er ihm die Exkommunikation androhte (vgl. N. H. Ott: Rez. F. Prinz: Von Konstantin zu Karl dem Großen. In: DIE ZEIT 51/2000). Die Eroberung Roms im Jahr 410 durch den Westgotenkönig Alarich gab dem Heidentum noch ein letztes Mal Auftrieb, weil es diese Katastrophe als Strafe der Götter für die Annahme des Christentums deuten konnte. Mit seinem großen und wirkungsgeschichtlich höchst bedeutsamen Werk „Der Gottesstaat“ (De civitate Dei) reagiert Augustinus auf diesen 20 Vorwurf. Seine Lehre von den zwei Reichen soll denen eine Orientierung geben, die nach dem Zusammenbruch Roms an der Wahrheit des Christentums zweifeln. 1.1.2.3.1 Ambivalentes Verhältnis zum römischen Staat im frühen Christentum Das Verhältnis der frühen Christen zum römischen Staat zeigt praktisch und in zeitlicher Nähe, wie Jesu Antwort auf die Steuerfrage und die Gehorsamsforderung des Paulus aufgefasst werden und welchen Stellenwert diese beiden Texte besitzen konnten. Dabei ist freilich im Blick zu behalten, dass die frühchristliche Haltung gegenüber der Obrigkeit nicht nur von biblischen Vorgaben bestimmt wurde, sondern auch vom Verhältnis des römischen Staats zum Christentum. So konnte außer diesen beiden Bibelstellen auch die extreme Polemik der Johannes-Offenbarung virulent werden, weil sie der Seelenlage der vom römischen Staat verfolgten Christen entgegenkam. M1 Wenn vom Anfang des Christentums im römischen Staat und speziell in der Stadt Rom die Rede ist, assoziieren viele „Katakomben“. Die Assoziation impliziert von Seiten der Obrigkeit die Verfolgung der Christen, von Seiten der Christen die Gegenreaktion des SichVersteckens und Untertauchens. M 1 knüpft an diesen Vorstellungskreis an. Das Foto eines Gangs der Kallisto-Katakomben in Rom gibt den Schülern den Impuls, ihr Wissen über die Katakomben stichwortartig zusammenzustellen. Es ist davon auszugehen, dass hier die gängige, aus Romanen und Filmen herrührende Legende zur Sprache kommt; danach wären die Katakomben unterirdische Geheimverstecke der Christen in der Zeit ihrer Verfolgung und regelmäßiger Treffpunkt für heimliche Gottesdienste gewesen. Diesen falschen Gemeinplatz sollen die Schüler anschließend selbst korrigieren – mit einer InternetRecherche auf der Website der Kallisto-Katakomben. Die Informationen dieser Website führen zu folgendem Ergebnis: Die Katakomben waren unterirdische – aus Tuffstein herausgehauene – Begräbnisstätten in der antiken und spätantiken Zeit, vor allem in Rom. Von den Christen wurden sie ab dem 2. Jh. gegenüber den oberirdischen Friedhöfen bevorzugt. Für die Bevorzugung sind zwei Hauptgründe zu nennen: 1. Die Christen lehnten aus religiösen Gründen (Auferstehung des Leibs!) den heidnischen Brauch der Totenverbrennung zugunsten der Körperbestattung ab. Dadurch entstand ein Platzproblem, das unterirdisch besser zu lösen war, da die Grabnischen in den Katakomben auf mehreren Ebenen angelegt werden konnten. 2. Die Christen verstanden sich als Gemeinschaft, die auch im „Schlaf des Todes“ beieinander sein wollte. In den Katakomben als exklusiven Begräbnisstätten war dies möglich, auf oberirdischen Nekropolen wurden die Christen zusammen mit Heiden bestattet. In den Katakomben kamen die Christen nicht allein zu den Beerdigungen zusammen, sondern auch zum Jahresgedächtnis-Gottesdienst für die Verstorbenen und die Märtyrer insbesondere. In Zeiten schwerer Verfolgung dienten die Katakomben gelegentlich auch als Zufluchtsort für die Feier der Eucharistie. 21 M2 Die „Kirchen“ (= Versammlungs- und Kulträume) der frühen Christen waren oft in Privathäuser integriert. Dies hing zusammen mit der kleinen Gemeindegröße dem Status einer religio illicita, der für das Christentum öffentliche Kultbauten nicht zuließ. Das Foto in M 2 zeigt einen Blick in das berühmte Haus von Dura Europos (Syrien), das Privatwohnung und zugleich Versammlungs- und Liturgiezentrum einer ca. 60 Personen umfassenden christlichen Gemeinde war. Durch die Frage, weshalb die frühen Christen in Privathäusern zusammenkamen, kommt die besondere Situation der christlichen Gemeinden der ersten Jahrhunderte in den Blick. Im Zuge der Trennung von Juden- und Christentum nahmen die Christen nicht mehr an den Gottesdiensten in den Synagogen teil, sondern entwickelten einen eigenen Kultus. Anders als die jüdische Religion, die unter dem formalen Schutz des römischen Rechts ausgeübt werden konnte, wurde die christliche jedoch zur Heimlichkeit gezwungen. Wie aus dem berühmten Briefwechsel zwischen Plinius, Statthalter der kleinasiatischen Provinz Bithynien, und Kaiser Trajan deutlich wird, war die Rechtslage so, dass allein schon das (nicht widerrufene) Bekenntnis, ein Christ zu sein, mit dem Tod bestraft wurde. (Worin dieses rigorose Vorgehen begründet war, ist unter Historikern bis heute umstritten. Denn der römische Staat war an sich großzügig gegenüber fremden Religionen. Die christliche Ablehnung des Kaiserkults dürfte jedenfalls nicht die Hauptrolle gespielt haben. Immerhin hatten auch die Juden Schwierigkeiten mit der Kaiserverehrung, ohne deshalb Repressalien ausgesetzt gewesen zu sein. Der entscheidende Punkt dürfte in dem anklingen, was Plinius nach Verhören von Christen an Kaiser Trajan berichtet: „Ich fand nichts als einen verworrenen, maßlosen Aberglauben“ (Ep. 10,96,8). Dabei wird man nicht fehlgehen, wenn man den Vorwurf der Absurdität vor allem auf die christliche Lehre eines gekreuzigten Gottes bezieht.) Die Heimlichkeit der Religionsausübung, zu der das Christentum als verbotene Religion genötigt war, forcierte die ablehnende Haltung des Heidentums (vgl. Frage 2): Man unterstellte den Christen, dass sie bei ihren Riten etwas zu verbergen hätten, und so waren bald die ungeheuerlichsten Gerüchte im Umlauf. Beispielweise wurde kolportiert, dass sie an Festtagen zum Gelage zusammenkommen und dann, nach vielen Gängen, wenn die Gesellschaft erhitzt ist und in der Trunkenheit die Glut unreiner Begierde erwacht, sich schamlos in unerhörter Gier „in die Umschlingungen stürzen, wie der Zufall es bringt“ (Minucius Felix, Dialog „Octavius“ 9). M3 In diesem Text beschreibt Friedhelm Winkelmann, emeritierter Professor für Kirchengeschichte und einer der besten Kenner der Frühgeschichte des Christentums, die zwei unterschiedlichen christlichen Haltungen gegenüber der Obrigkeit: auf der einen Seite die Linie einer gemäßigten Distanz, auf der anderen Seite das Streben nach einer guten Verbindung. Der Text ist leicht verständlich und kann von den Schülern einzeln erarbeitet werden. 22 Arbeitsauftrag (schriftlich): 1. Kennzeichnen Sie mit eigenen Worten die durch Röm 13,1–7 und Mk 12,14–17 grundgelegte frühchristliche Haltung gegenüber dem römischen Staat. 2. Fassen Sie zusammen, auf welche Weise die andere Linie eines guten Verhältnisses zum Staat bei Lukas, Athenagoras und Tertullian in Erscheinung tritt. 1.1.2.3.2 Die Konstantinische Wende Der Begriff der „Konstantinischen Wende“ wird auf zweifache Weise gebraucht. Manchmal wird er punktuell verstanden und nur auf die Ereignisse in den Jahren 312/13 (Schlacht an der Milvischen Brücke; Mailänder Konstitution) bezogen, die im römischen Reich zur Gleichstellung des Christentums mit den anderen Religionen führten. Meistens bezeichnet er aber den ganzen Prozess, der unmittelbar nach der schwersten Christenverfolgung des römischen Staats unter Kaiser Diokletian das Christentum zunächst zur erlaubten, dann zur begünstigten und schließlich zur allein berechtigten Religion werden ließ. In diesem zweiten Sinn wird der Begriff auch hier verwendet. Die Veränderung im vierten Jahrhundert, die das Christentum aus der verfolgten Religion zur Staatsreligion machte, war eine der einschneidendsten und weitreichendsten in der Geschichte des Abendlands. Die Kennzeichnung der Wende als „Konstantinisch“ ist insofern zutreffend, als Kaiser Konstantin I. (oder „der Große“) entscheidende Impulse gegeben hat. Dabei ist unter Historikern freilich bis heute umstritten, welche Motive Konstantin veranlassten, den Schutz des Römischen Reichs immer mehr dem christlichen Gott anzuvertrauen und entsprechend die christliche Religion von Seiten des Staats zunehmend zu fördern und zu stärken. War es Frömmigkeit, war es Berechnung? Mit Manfred Clauss wird man feststellen dürfen: „Beides zusammen ergibt erst ein vollständiges Bild“ (M. Clauss: Konstantin der Große und seine Zeit. München : Beck, 1996, S. 7). Bei aller Bedeutung Konstantins darf im Übrigen auch nicht außer Acht gelassen werden, dass für die „Wende“ eine Reihe anderer Gründe und Faktoren hinzukommen musste. Zum Beispiel war das Christentum seiner neuen Rolle, staatstragend an die Stelle des heidnischen Kults zu treten, nur gewachsen, weil sich im 3. Jh. in der Kirche feste Leitungsstrukturen herausgebildet hatten und das Bekenntnis zu Jesus Christus in Lehrleitfäden gefasst war. Oder es ist zu sehen, dass die Religionspolitik Konstantins nicht möglich gewesen wäre, wenn ihr nicht das Toleranzedikt des Galerius – eines der Tetrarchen im Römischen Reich (s. u. M 1) – 311 vorausgegangen wäre. In diesem Edikt gab Galerius das Scheitern der von ihm mit veranlassten Christenverfolgung zu und verfügte die öffentlich-rechtliche Anerkennung des christlichen Kults. M1 Konstantin konnte die entscheidenden Weichenstellungen für den Aufstieg des Christentums nur vornehmen, weil er im römischen Reich immer mehr Macht gewann und schließlich Alleinherrscher wurde. Seine politische Karriere begann im Rahmen des von Diokletian eingeführten Systems der Tetrarchie. Die Abbildung der Porphyrgruppe von San Marco (Venedig) zeigt die vier ersten Tetrarchen, die sich seit 293 die Herrschaft im römischen Reich teilten: die Augusti Diokletian und Maximinian und deren designierte Nachfolger, die Caesares Constantius Chlorus und Galerius. Zwei Bemerkungen zu diesem Monument sind angebracht: 23 1. Die Porphyrgruppe besteht genau genommen aus zwei Paaren, die ursprünglich getrennt an je einer Säule unterhalb des Kapitells in ca. 5–6 m Höhe angebracht waren. Die niedrige Anbringung über Eck an der Kirche San Marco erfolgte Anfang des 13. Jahrhunderts, nachdem die beiden Stücke vermutlich aus Konstantinopel per Handelsschiff nach Venedig gebracht worden waren. 2. Der – vor allem in der älteren Literatur – betriebene Versuch, jede Figur als einen bestimmten Tetrarchen zu identifizieren, ist wohl aussichtslos. Die Gestaltung zielt ja augenscheinlich darauf ab, auf Unterscheidungsmerkmale gerade zu verzichten und die Figuren in Physiognomie, Körperhaltung und Kleidung so ähnlich wie möglich erscheinen zu lassen. Allenfalls ließen die auffälligen Bärte der jeweils links stehenden Tetrarchen eine Differenzierung zu, doch muss man annehmen, dass die Bärte eine spätere Zugabe sind. Die Schüler erhalten den Arbeitsauftrag, über das System der Tetrarchie sich selbst in Literatur und Internet zu informieren (= Teil 1 des AA, s. Arbeitsblatt). Ergebnis der Recherche 1 Diokletian, der 284 vom Militär – wie längst üblich – zum Kaiser gewählt worden war, proklamierte 286 seinen Feldherrn Maximinian zum Mitkaiser. Einen entscheidenden Schritt zur politischen Neuordnung des Reichs taten die beiden dann 293: Aus der Zweierherrschaft machten sie eine Viererherrschaft (Tetrarchie), indem sie Constantius, den Vater Konstantins, und Galerius zu Caesares erhoben und ihnen den Rang von Mitherrschern und designierten Nachfolgern gaben. Der Idee nach sollte die Tetrarchie so funktionieren: Die Augusti treten nach einer bestimmten Zeit (z. B. nach 10 Jahren) ab, die Caesares übernehmen ihre Stelle als Augusti und ernennen ihrerseits neue Caesares, die dann wieder nach einer bestimmten Zeit zu Augusti werden. Die Idee verdankte sich der Absicht, dem Auftreten von Ursurpatoren vorzubeugen und statt dynastischer Nachfolge auf die Auswahl der Besten zu setzen. De facto scheiterte das System bereits nach dem ersten Wechsel. 305 waren Diokletian und Maximian noch, wie es geplant war, zurückgetreten und hatten ihre Caesares zu Augusti ernannt, d. h. in ihren Rang erhoben. Die neuen Augusti ihrerseits ernannten wieder neue Caesares. Doch als der Augustus Constantius 306 in Britannien starb, rückte nicht der Caesar an seine Stelle, sondern das dort versammelte Heer rief Konstantin, den Sohn des Constantius, zum Augustus aus. (Konstantin kam also als Ursurpator an die Macht.) Die Schüler sollen sich außerdem über die Herrschertheologie informieren, die von Diokletian und seinen Mitregenten zur Legitimation und Stabilisierung ihrer Herrschaft ins Spiel gebracht wurde (= Teil 2 des AA, s. Arbeitsblatt). Ziel der Aufgabe ist es, von dieser Theologie her die Motive verstehen zu lassen, die ab 303 zur systematisch betriebenen größten Christenverfolgung im römischen Reich führten. Ohne ein Verständnis dieser Motive bliebe den Schülern unbegreiflich, dass unmittelbar auf die heftigste Christenverfolgung die staatliche Anerkennung des Christentums folgen konnte. Ergebnis der Recherche 2 Diokletian und seine Mitregenten begriffen sich als Glieder einer göttlichen Familie, zu der sie als Herrscher gehörten. Jeder bezog sich auf einen persönlichen Gott als Schutzgottheit: Diokletian auf Jupiter, Maximian auf Hercules, Constantius auf Sol und Galerius auf Mars. 24 Aufgrund ihrer Gottesnähe und Gottesverwandtschaft beanspruchten die Tetrarchen „allein dafür verantwortlich zu sein, die Kommunikation mit den Göttern zu regeln und die religiösen Beziehungen in Ordnung zu halten“ (M. Clauss: Konstantin der Große. München : Beck, 1996, S. 15). Die vier Herrscher waren der Überzeugung, dass die Götter nur dann das Heil des Staates garantierten, wenn an der tradierten religiösen Ordnung festgehalten werde. Von einer neuen, besonders der christlichen Religion aus die überkommene zu tadeln, verstoße gegen göttliches Gebot und sei entsprechend schädlich. Für das Wohlergehen des Staats sei vielmehr ein gemeinsames kultisches Handeln aller Reichsbewohner unerlässlich. Prüfstein dafür, ob die Untertanen zugunsten der Existenz des Staats ihren Beitrag für die Pflege der überlieferten römischen Religion zu leisten bereit waren, war der Kaiserkult. Indem die Christen kultische Handlungen für den Kaiser als Götzendienst verwarfen, untergruben sie aus Sicht der Herrscher letztlich die bewährte Religion als Fundament staatlichen Wohlergehens und mussten infolgedessen mit allen Mitteln verfolgt werden. M2 Der Text erklärt und erläutert auf leicht verständliche Weise, welche Bedeutung der christliche Gott für Konstantin im Kontext der Schlacht an der Milvischen Brücke gewann. Ein besonderer Akzent wird vom Autor darauf gelegt, dass Konstantins berühmte Vision ihn nicht einfach unversehens überkam, sondern dass er eine Vision dieser Art aufgrund der für ihn negativen militärischen Ausgangslage als „Stimulans für sich und seine Truppen“ dringend benötigte. Arbeitsauftrag (schriftlich): 1. In welcher Situation befand sich Konstantin, als er seine Vision empfing? 2. In welchen zwei Versionen wurde Konstantins Vision vor der Schlacht an der Milvischen Brücke überliefert und wie wurden sie miteinander verknüpft? 3. Welche Bedeutung gewann der Christengott für Konstantin nach seinem Sieg an der Milvischen Brücke? M3 Die Bildbetrachtung dient hier mehreren Zwecken: Zum einen bietet sie den Schülern in diesem Arbeitsblatt, in dem sie viel Text lesen und bearbeiten müssen, eine Abwechslung. Zum anderen stellt sie ihnen die Schlacht an der Milvischen Brücke höchst dramatisch vor Augen. Und drittens können die Schüler verschiedene Details, die im Bericht über die Schlacht (vgl. M 2) genannt werden, im Bild auffinden (so dass Text- und Bildrezeption sich wechselseitig unterstützen). Pieter Lastmann, der Maler des Bilds, wurde um 1583 in Amsterdam geboren und starb dort am 4. April 1633. Von 1604–1606 hielt er sich zu Studienzwecken in Venedig und Rom auf, danach lebte er wieder in Amsterdam. Schon bald galt er als berühmter Historienmaler mit einer angesehenen Werkstatt. Kurzfristig, um das Jahr 1623, war auch Rembrandt sein Schüler. 25 Lastmann legt sein Bild in zwei großen Kompositionslinien an, die zusammen ungefähr die Form einer Ellipse ergeben. Ausgangspunkt der Komposition ist der Feldherr Konstantin, den wir an der linken Bildseite knapp oberhalb der Mitte erkennen. Die eine Linie, die von ihm weggeht, führt über die Masse der fliehenden Soldaten auf der Brücke und den mit dem Pferd herabstürzenden Reiter zu dem im Fluss auf seinem Pferd flüchtenden Maxentius, die andere Linie bewegt sich von Konstantins zum Stoß erhobener Lanze über die Figuren des zum Fluss hetzenden Reiters und des erschlagenen Kriegers wieder auf Maxentius zu. Aus der Fülle der Einzelbeobachtungen sind folgende herauszuheben: Hinter dem anstürmenden Heer Konstantins erstrahlt am Himmel helles Licht, über dem Heer des Maxentius dagegen ist der Himmel verdunkelt. Die Lanzen der konstantinischen Soldaten zeigen wohlgeordnet parallel nach oben, die des maxentinischen Heers kreuzen sich (und signalisieren Chaos). Über die Lanzen der konstantinischen Soldaten hinaus ragt eine Standarte mit dem Kreuzzeichen. Der Lichtschein, der von links oben ins Bild einfällt, taucht auch die beiden fliehenden Reiter in helles Licht, doch die scheinen sich entsetzt vom hellen Licht abzuwenden. (Zu den Informationen über P. Lastmann und sein Bild vgl. <http://www.zum.de/psm/div/historienbild.php> [12.04.2010]). M4 Der Text ist eine gekürzte Fassung der Mailänder Konstitution (313), durch die das Verhältnis zwischen römischem Staat und Christentum von Grund auf verändert wurde (weitere Informationen s. Arbeitsblatt, Einleitung zu M 4). Arbeitsauftrag (schriftlich): Beantworten Sie stichwortartig: 1. Wie wird von den Kaisern die Frage nach der Verehrung der Gottheit (bzw. nach der Religionsausübung) entschieden? 2. Wie begründen sie ihre Entscheidung? 3. Welche grundlegende Bedeutung hatte die kaiserliche Entscheidung für das Christentum? 4. Was setzen die Kaiser „im Blick auf die Stellung der Christen“ fest? M5 Hier wird dargestellt, auf welche Weise Konstantin das Christentum seit 313 unterstützte. Zum einen ist sind es Maßnahmen und Gesetze, die das Christentum den staatlich anerkannten Kulten gleichstellten, zum anderen Regelungen, die das Christentum bevorzugten bzw. ihm einen Vorteil verschafften. Entsprechend lautet der Arbeitsauftrag (schriftlich): 1. Stellen Sie in einer Übersicht zusammen, durch welche Regelungen Konstantin das Christentum seit 313 unterstützte. Unterscheiden Sie dabei zwischen Maßnahmen, die 26 das Christentum der Staatsreligion gleichstellten, und solchen, die das Christentum begünstigten. 2. Beschreiben Sie, mit welcher Intention Konstantin den Tag der Sonne zum Ruhetag erklärte und was die Gesetze über die Sonntagsruhe für die Christen bedeuteten. M6 Der Konstantin-Experte M. Clauss wendet sich gegen das Klischee, Konstantin habe sich schlagartig zum Christentum bekehrt und damit das Heidentum ganz abgelegt. Richtig sei vielmehr, dass in der römischen Gesellschaft und so auch bei Konstantin Heidentum und Christentum neben- und miteinander existierten. Die Ambivalenz des Glaubens Konstantins veranschaulicht der Autor anhand von zwei berühmten Münzen aus der konstantinischen Zeit: dem Silbermedaillon, auf dem Konstantin mit dem (winzigen!) Christusmonogramm abgebildet ist, und der Goldmünze, die Konstantin zusammen mit dem Sonnengott darstellt. Die Aussagen des Textes über den Glauben Konstantins sollten – nach der ausgiebigen schriftlichen Textanalyse, die vorausgegangen ist – mündlich erarbeitet werden. 1.1.2.3.3 Augustins Lehre von den zwei Reichen Nachdem Konstantin und Licinius das Toleranzedikt von Mailand im Jahre 313 erlassen hatten, gewann das Christentum immer mehr an Bedeutung, und das Heidentum wurde immer mehr zurückgedrängt. Freilich setzten sich die Vertreter des Heidentums, die im römischen Senat und in der Intellektuellenschicht noch zahlreich waren, jahrzehntelang heftig zur Wehr. Sie argumentierten, allein der Glaube an die römischen Götter und ihr dadurch gewonnenes Wohlwollen habe den Erdkreis unter die römische Herrschaft gezwungen und Rom vor gefährlichen Angriffen etwa der Gallier oder Punier geschützt. Werde der status religionis zugunsten des Christentums aufgegeben, bedeute dies das Ende Roms, worauf Ereignisse der jüngsten Geschichte – zum Beispiel die Ermordung des Kaisers Gratian (im Jahre 383) oder Missernten und Hungersnöte – auch schon hinwiesen. In den Kontext dieser Auseinandersetzung gehört Augustins großes Spätwerk „De civitate Dei“. Apologetisch tritt er hier dem Vorwurf entgegen, der Abfall von den alten Göttern und die Annahme des Christentums seien Schuld am Niedergang des römischen Reichs, namentlich an der Eroberung Roms durch den Gotenkönig Alarich. Augustins Verteidigung hatte vor allem zwei Richtungen: Zum einen versuchte er zu zeigen, dass es in der römischen Geschichte auch vor Konstantins christlicher Wende zu Katastrophen gekommen war. Zum anderen stellte er klar, dass die Geschichte der Menschen keineswegs eindimensional zu begreifen und die Hoffnung auf Vollendung oder ein Goldenes Zeitalter in dieser Welt vergeblich ist. Geschichte, Weltgeschichte, so lautet die weitreichende Erkenntnis Augustins, ist von ihrem Anfang an der Kampf zwischen zwei Reichen, zwischen der „civitas terrena“ und der „civitas Dei“. Dieser Kampf entscheidet sich nicht im Diesseits, sondern sein Ziel liegt im Jenseits, wo die „civitas Dei“ als „civitas caelestis“ ihre ideale Gestalt erlangt. Es ist daher verfehlt, nach einem immanenten Sinn der weltlichen Ereignisse zu fragen oder gar zu forschen. Augustins dualistisch-eschatologische Geschichtstheologie prägte das Geschichtsbild des ganzen Mittelalters. In den heftigen Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst um die Vorherrschaft umriss sie den Verständnishorizont. Doch wirkte sie weit über das Mittelalter hinaus bis in die neue Neuzeit hinein, vermittelt z. B. durch Luthers Lehre von den zwei Regimentern (vgl. A 11). 27 M1 Gegen Ende des 4. Jahrhunderts hatten die Kaiser endgültig mit der altrömischen Religion gebrochen und Gesetze erlassen, die den heidnischen Kult beschnitten und schließlich ganz verboten. Die Anhänger der alten Religion, die im römischen Senat und in der Intellektuellenschicht noch immer zahlreich vertreten waren, leisteten aber Widerstand gegen ihre religiöse Unterdrückung. Sie argumentierten: Wenn der status religionis aufgegeben wird, der den römischen Staat über Jahrhunderte geschützt und zum Erfolg geführt hat, wird Rom niedergehen. Die Christen hielten entgegen, dass ihre Religion nicht nur die staatstragende Rolle des Götterkults übernommen habe, sondern ihr Gott überhaupt erst in der Lage sei, das römische Reich wirklich vor Unheil zu bewahren. Der Streit um den Viktoria-Altar zeigt die Auseinandersetzung zwischen Heiden- und Christentum in der Endphase besonders prägnant. Der vorliegende Text, der dazu die Grundinformation bietet, soll nicht von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden. Er ist vielmehr die Vorlage für einen Lehrervortrag. Im Anschluss an den Lehrervortrag sind Fragen der Klasse, die gewiss zahlreich vorhanden sind, zu beantworten. M2 Hier sind die berühmte „Relatio 3 de ara Victoria“ des römischen Senators Symmachus und die Gegenschrift des Mailänder Bischofs Ambrosius auszugsweise gegenübergestellt. In Partner- oder Gruppenarbeit analysieren die Schülerinnen und Schüler, wie Symmachus für die weitere Verehrung der römischen Götter plädiert und welche Argumente Ambrosius ihm entgegenhält. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt M3 Der Text des Philosophen Kurt Flasch gibt kurze Hinweise darauf, welches historische Ereignis Augustin zur Abfassung des „Gottesstaats“ veranlasste und welche Absicht er dabei verfolgte. Arbeitsauftrag (mündlich oder schriftlich): 1. Durch welche Anstöße wurde Augustins Werk „Der Gottesstaat“ ausgelöst? 2. Welche Intentionen leiteten ihn bei seiner Schrift? 3. Wie fasste er die Weltgeschichte auf? Ergebnisse (stichwortartig) Zu 1. - Konkrete Fragen der Zeitgenossen – sowohl der Christen wie der Heiden – nach der Eroberung Roms im Jahr 410 - Heidnische Deutung des Falls Roms als Strafgericht der Götter Zu 2. - Verteidigung der Kirche gegen den Vorwurf, die Annahme des Christentums sei Schuld am Niedergang Roms - Orientierung für die durch den Zusammenbruch Roms Ratlosen 28 - Neubestimmung des Werts von Staat, Gesellschaft und Kultur Zu 3. - Zeitlich begrenzter, auf ein jenseitiges Ziel gerichteter Vorgang - Kampf der beiden „Reiche“ - Dualistische, spiritualistische und eschatologische Betrachtungsweise Um das Verständnis zu unterstützen oder zu vertiefen, kann die Lehrkraft zwei (rechtzeitig vergebene) Kurzreferate vortragen lassen: das eine zu den „Goten-Invasionen“ und zur Plünderung Roms durch Alarich (410), das andere zu den Begriffen „Dualismus, Spiritualismus und Eschatologie“. M4 Das Bild stammt aus einem Wiegendruck von Augustins „De civitate Dei“, der 1490 in der Basler Werkstatt des Johann Amerbach angefertigt wurde. Das Bild ist vertikal in zwei verschieden große Teile gegliedert. Über jedem Teil ist ein Titel eingefügt, der das Bildmotiv benennt. Der Titel am oberen Bildrand lautet: „Aurelius Augustinus“. Darunter ist der Kirchenvater in einer (mittelalterlichen) Schreibbank bei der Abfassung seines Werks „Der Gottesstaat“ zu sehen. In der zweiten Textzeile steht: „Insultat babylon. Syon urbs ut sancta exsultet.“ (Babylon verhöhnt. Auf dass die heilige Stadt Zion frohlocke.) Im zugehörigen Bildteil sind zwei Städte dargestellt, die Babylon und Zion symbolisieren, d. h. im Sinne Augustins die „civitas terrena“ und die „civitas Dei“. Jeder Stadt ist im Vordergrund ein Mann zugeordnet, rechts Kain, links Abel. Von den zwei Männern aus schlängeln sich Spruchbänder in den oberen Bildteil und verknüpfen so beide Bildteile. Auf Kains Spruchband ist zu lesen: „In sathane sedem: Cayn illam condidit urbem“. (Zum Wohnsitz Satans. Cayn hat diese Stadt gegründet.) Das Spruchband Abels enthält folgenden Text: „Urbs dicata deo: Abel fundavit sanguine iusti“. (Die Gott geweihte Stadt: Abel gründete sie mit dem Blut des Gerechten.) Die beiden Städte sind augenfällig durch ein Tal und eine im Tal verlaufende Straße voneinander getrennt. Einzelheiten kennzeichnen das Gute und das Böse: Vor der Stadt Abels – Zion – blühen zwei Blumen. Das Gelände steigt von der Straße aus sanft und gleichmäßig zur Stadtmauer hin an. Der Eingang in die Stadt ist imposant gestaltet: Rechts und links vom Stadttor erhebt sich ein Turm. Zwei Engel blicken mit abwehrender Geste über die Stadtmauer zur gegenüber liegenden Stadt. Vor der Stadt Kains – Babylon – dagegen wachsen zwei Büsche. Das Gelände zwischen Straße und Stadtmauer ist uneben – verworfen. Ein Eingang zur Stadt ist nicht zu sehen. Zwei Teufel auf Türmen lästern mit erhobenen Armen und aufgerissenem Mund – in Richtung von Zion. Ein dritter Teufel hat eine Handfeuerwaffe auf den ihm gegenüberstehenden Engel angelegt. Die Bildbetrachtung der Schüler verläuft in drei Stufen (s. Arbeitsauftrag im Arbeitsblatt). Zunächst sollen sie das Bild beschreiben. Dann sollen sie auf den Spruchbändern entziffern, wie die Männer rechts und links vorne heißen. In Lateinklassen kann diese Aufgabe so erweitert werden, dass die Schüler den ganzen Text zu lesen und zu übersetzen versuchen. Schließlich erklären sie anhand von Details den Unterschied und das Verhältnis der beiden Städte. 29 M5 Vor der Lektüre von Auszügen aus dem Primärtext (s. M 6) soll der Text von K. Flasch den Schülern eine Grundorientierung zu den Fragen vermitteln: Was ist der „Gottesstaat“, was ist der „irdische Staat“? Arbeitsauftrag (schriftlich): Beantworten Sie in Stichworten: 1. Wie dachte Augustin um 400 die beiden „Staaten“? 2. Wie sieht Augustin den Zusammenhang zwischen der civitas terrena und den führenden Staaten der Weltgeschichte? M6 Die Lektüre des Augustinischen Primärtextes führt bei den Schülern gewiss zu Verständnisschwierigkeiten. Doch ist es von der Sache her geboten, Augustins Lehre von den zwei Staaten den Schülern nicht nur durch die Sekundärliteratur nahe zu bringen. Die „Anstrengung des Begriffs“ verdeutlicht ihnen, dass Augustins Text nach unserem heutigen Maßstab nicht klar genug ist, um ihn durch eindeutige distinktive Aussagen zu erfassen. Da das ausgewählte Textkorpus einen beträchtlichen Umfang hat, liegt es auf der Hand, die Textanalyse arbeitsteilig durchzuführen. Ein Drittel (I) beschäftigt sich mit der „Zugehörigkeit zum Gottesstaat“ und der „Auseinandersetzung mit dem Imperium Romanum“, das zweite Drittel (II) mit der „Entstehung der beiden Staaten“, das dritte (III) mit der „Beziehung der beiden Staaten zum irdischen Frieden“. Die Aufteilung bedeutet nicht zwangsläufig Gruppenarbeit. Partnerarbeit dürfte bei diesen schwierigen Texten effektiver sein. Arbeitsauftrag (arbeitsteilig): Die Zugehörigkeit zum Gottesstaat/Auseinandersetzung mit dem Imperium Romanum Fragen zum Text (I, 35; IV, 3f.; V, 12) 1. Welche Unterscheidungen werden bezüglich der Zugehörigkeit zum Gottesstaat getroffen. 2. Warum erscheint es töricht, die Weite und Größe des römischen Reichs zu rühmen? 3. Von welchem Verlangen waren die Römer beseelt und wie wirkte es sich aus? 4. Wie wird die Herrschaft der Römer über die unterworfenen Völker gekennzeichnet? Zusatzaufgabe: Versuchen Sie mit eigenen Worten (in 2 Sätzen) zu sagen, wie Augustin den römischen Staat auffasst. Die Entstehung der beiden Staaten Fragen zum Text (XIV, 1.4.28; XV, 1) 1. Wie wirkte sich die Ursünde für die Menschheit aus? 2. In welcher Beziehung stehen die beiden Staaten zum Sündenfall (von Adam und Eva)? 3. Durch welche beiden Grundhaltungen sind die beiden Staaten begründet? 30 4. Welche Personen sind die ersten „Repräsentanten“ der beiden Staaten? 5. Welches Ende ist den beiden Staaten bestimmt? Der irdische und himmlische Staat und ihre Beziehung zum irdischen Frieden Fragen zum Text (XIX, 17) 1. Worin besteht Eintracht zwischen den beiden Staaten? Welches Streben ist ihnen gemeinsam? 2. a) Wie versteht der Bürger des Gottesstaats sein Leben im irdischen Staat/in dieser Welt? b) Wie gebraucht er die irdischen und zeitlichen Dinge? c) Wie steht er zu den Gesetzen des irdischen Staates? 1.1.2.4 Der Streit um die Oberhoheit im Mittelalter 1.1.2.4.1 Sakralkönigtum und Herrschaftsbegründung um 1000 n. Chr. Wenn wir nach der Herrscher- und Herrschaftsauffassung im Mittelalter fragen, haben wir für die ottonisch-frühsalische Zeit außer Quellentexten und Denkmälern auch eine Gruppe von Bildern zur Verfügung, die die damalige Königs- und Kaiseridee mit großem künstlerischem Können widerspiegeln. Es handelt sich um „die für das Mittelalter einmalige Reihe von Herrscherminiaturen in der Zeit von Otto II. bis zu Heinrich III.“ (St. Weinfurter: Sakralkönigtum und Herrschaftsbegründung um die Jahrtausendwende. In: Helmut Altrichter (Hg.), Bilder erzählen Geschichte. Freiburg i. Br. : Rombach, 1995, S. 47f.) – mit einer besonderen Dichte unter Otto III. (983–1002) und Heinrich II. (1002–1024). Angefertigt wurden sie in Klostermalschulen als Bestandteil liturgischer Bücher. Die Bilder Ottos III., auf den in diesem Arbeitsblatt das Augenmerk gerichtet ist, sind alle „von einer außerordentlichen Betonung der majestätischen Komponente gekennzeichnet“ (St. Weinfurter, a. a. O., S. 49). Das zweifellos berühmteste Kaiserbild Ottos III. enthält das „Aachener Evangeliar“. Auftraggeber des Evangeliars war Otto III. selbst, hergestellt wurde es im Inselkloster Reichenau. Das Bild zeigt eine Herrscherapotheose, die bis zum Äußersten des damals Möglichen geht: Der Kaiser wird hier schon teilweise in die himmlische Sphäre erhoben, und seine Darstellung ist ganz offenkundig der Majestas Domini nachgebildet – bis hin zu der ihn umgebenden Mandorla. Kaiser Otto III. erscheint als die Vergegenwärtigung Christi auf Erden. Was hat zu dieser Deifizierung Kaiser Ottos III. geführt? Ein Streit zwischen Kaiser und Papst um die Oberhoheit hat unmittelbar keine Rolle gespielt. Es waren vielmehr „innenpolitische Gründe“, die eine Sakralisierung des Herrschers nötig machten. Das Reich war nur locker zusammengefügt, und dass Otto III. seinem Vater als König nachfolgen sollte, war unter den führenden Leuten keineswegs unumstritten. Die sakrale Überhöhung des Herrschers schuf hier – bezüglich seiner Legitimation und Autorität – Klarheit. Auch wenn die Herrscherapotheose unter Otto III. keinen direkten Bezug zum konkurrierenden Anspruch des Papstes hatte, war es sicher so, dass von dieser Königs- und Kaiseridee in der nachfolgenden Zeit Impulse ausgingen, die im Streit um die Oberherrschaft eine Rolle spielten. Der Kaiser als auctor, stabilitor ac defensor christianitatis et christianae fidei (Mainzer Krönungsordo, 961) – das war ein gewaltiger Anspruch, der den Papst von vornherein auf den zweiten Rang verwies. 31 M1 Die Lehrperson erhält hier Grundinformationen für einen Lehrervortrag über Kaiser Otto III., die sie durch eigene Recherche noch konkretisieren und erweitern kann. Falls der Lehrervortrag als PowerPoint-Präsentation geboten wird, kann noch Bildmaterial eingesetzt werden. Denkbar ist auch, dass sich die Schülerinnen und Schüler in einer längeren Arbeitsphase den Inhalt des Textes selbst aneignen. Entsprechende Aufgaben enthält der Arbeitsauftrag auf dem Arbeitsblatt. M2 Dieses Kaiserbild Ottos III. aus dem „Aachener Evangeliar“ ist das Äußerste, was in mittelalterlichen Herrscherdarstellungen gewagt worden ist: Es ist eine Herrscherapotheose, die den Kaiser teilweise schon in die himmlische Sphäre entrückt und der Darstellung Christi als Majestas Domini nachgebildet ist. Die Bildbetrachtung und -analyse wird – da es um jedes Detail geht – im Lehrer-SchülerGespräch kleinschrittig vollzogen. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt M3 Das Bild aus dem Hitda-Codex (entstanden um 1000) ist eine Gestaltung der Majestas Domini. Sie zeigt den im Himmel thronenden Christus, der die rechte Hand zum Segensgestus erhoben hat und in der linken das Buch des Lebens hält; ein Schemel (der die Erde symbolisiert) dient ihm als Fußstütze (vgl. Jes 66,1: „Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank.“) In den vier Ecken des hochrechteckigen Bildformats sind die vier Evangelistensymbole dargestellt. Im Vergleich mit dem Kaiserbild Ottos III. (vgl. Arbeitsauftrag zu M 2, Aufgabe 6) sollten die Schülerinnen und Schüler folgende Übereinstimmungen erkennen: - die thronende Herrschergestalt, die von einer Mandorla und den Evangelistensymbolen umgeben ist - die Platzierung in himmlischer Region - die auf die „Erde“ gestützten Füße (im Aachener Evangeliar wird der mit dem Thronstuhl verbundene Fußschemel von einer symbolischen Abbildung der Erde, Frau Terra, getragen). 1.1.2.4.2 Stellvertreterschaft Christi auf Erden und Vollgewalt über alles Irdische Bei dem Streit, den im Mittelalter sacerdotium und regnum um die Oberhoheit führten, spielte bekanntlich auch eine Urkunde eine Rolle, die heute populär als „größte Fälschung aller Zeiten“ (Süddeutsche Zeitung) bzw. „der Weltgeschichte“ (Tagesspiegel) bezeichnet wird: das Constitutum Constantini – die Konstantinische Schenkung. Das Dokument wurde angeblich im Jahr 317 ausgestellt und trägt die Unterschrift Konstantins d. Gr. Der Kaiser überlässt darin dem Papst die kaiserlichen Insignien und Rechte und übergibt die Stadt Rom, 32 Italien sowie das gesamte weströmische Reich auf ewig der päpstlichen Macht und Gerichtsbarkeit. Im Gegenzug entschließt er sich, die eigene kaiserliche Reichsgewalt in die östlichen Gebiete zu verlegen und in der Provinz von Byzanz eine Stadt zu bauen und die Reichsgewalt dort zu errichten. Tatsächlich wurde das Constitutum Constantini einige Jahrhunderte später abgefasst. Über den genauen Zeitpunkt, den Urheber und die Zweckbestimmung dieser Fälschung herrscht in der Forschung aber immer noch Unklarheit. Sicher ist sich die Forschung dagegen in der Feststellung, dass die Konstantinische Schenkung – entgegen der verbreiteten Meinung – bei den mittelalterlichen Auseinandersetzungen zwischen Papsttum und Kaisertum von eher geringer Bedeutung war. Päpstlich gesinnte Staats- und Rechtsdenker beriefen sich zur Zeit von Innozenz III. nur ganz gelegentlich auf sie, seit Gregor IX. dann häufiger und nachdrücklicher. Der Hinweis auf die Konstantinische Schenkung war manchem Vertreter der Lehre von der unmittelbaren päpstlichen Macht auch in irdischen Dingen geradezu unangenehm, „weil die politische Macht des Nachfolgers Petri hier als Ausfluss kaiserlicher Gnade, als – möglicherweise sogar widerrufliche – großzügige Gabe … an die Kirche erschien“ (W. Goez: Ein Konstantin- und Silvesterzyklus in Rom. In: H. Altrichter (Hg.): Bilder erzählen Geschichte. Freiburg i. Br. : Rombach, 1995, S. 147). Der Konstantin-Silvester-Zyklus in SS. Quattro Coronati in Rom ist dagegen ein Beispiel dafür, wie die Konstantinische Schenkung gezielt von der kurialen Propaganda benutzt wurde, um im akuten Streit zwischen dem Stauferkaiser Friedrich II. und dem Papsttum die öffentliche Meinung parteiisch zugunsten des Papsttums zu bilden. M1 Das Grundwissen über den Konstantin-Silvester-Zyklus in der Silvester-Kapelle bei SS. Quattro Coronati vermittelt die Lehrperson in einem Lehrervortrag. M2 Die Szenen 7 und 8 des Freskenzyklus, die nachher betrachtet und behandelt werden (s. M 3 bis M 6), basieren nicht – wie die anderen Szenen – auf den Actus Silvestri, sondern auf der berühmten (und als Fälschung berüchtigten) Urkunde über die Konstantinische Schenkung (Constitutum Constantini). Den Inhalt erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit anhand folgender Fragen: 1. Was überlässt bzw. übergibt Konstantin Papst Silvester und den nachfolgenden Päpsten? (Gliedern Sie Ihre Aufstellung in: Gebäude – Insignien der Würde und Macht – Gebiete!) 2. Welchen Dienst erwies Konstantin Papst Silvester? Mit den stichwortartig festgehaltenen Antworten haben die Schülerinnen und Schüler die Verständnisgrundlage gewonnen, um das in den Bildern 7 und 8 dargestellte Geschehen auch in den Einzelheiten zu erkennen. M3 und M 4 Werner Goez beschreibt die Bilder 7 (M 3) und 8 (M 4) genau und mit den nötigen Erläuterungen: 33 „7. Während hinter dem Mauerrund der Stadt Rom ein Begleiter des Kaisers die Krone verwahrt, welche dieser nunmehr abgesetzt hat, nähert sich Konstantin in höfischer, geradezu huldigender Gebärde dem auf einer prachtvoll ornamentierten Sesselbank thronenden Silvester und übergibt ihm das Phrygium, jene Spitzhaube, aus der schließlich in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zum Abschluss kommenden Entwicklung die Tiara entstehen wird. Auf der siebten Fresken-Szene trägt der Papst noch die zweizipflige Mitra als kirchenrechtlich und liturgisch dem Bischof vorbehaltene Kopfbedeckung; doch Konstantin reicht ihm nun zusätzlich das kronengleiche Phrygium ad imitationem imperii nostri [zur Nachahmung unserer Herrschaft] und macht ihn damit zum Mitkaiser. Hinter Silvester steht ein Diakon mit einem Vortragekreuz. Aus dem Tor der ‚Ewigen Stadt’, welche Konstantin dem Papst als Mittelpunkt eines eigenen, überaus weitgespannten Herrschaftsbereichs überlässt, wird bereits das weiße Pferd herausgeführt, auf welchem im Mittelalter bei den unterschiedlichsten Formen der possessio, der (weltlichen wie auch der geistlichen) Besitzergreifungsprozession beim Amtsantritt, der Neuerhobene feierlich einzureiten pflegt. Gleichzeitig bringt einer aus Konstantins Gefolge jenen letztlich aus dem hellenistischen Herrscherzerimoniell stammenden Sonnenschirm oder Rundbaldachin herbei, der in dem Freskenzyklus wiederholt als zum kaiserlichen apparatus gehörig zu sehen war, nun aber dem Papst übergeben wird. Die Bilder 7 und 8 enthalten eine Veranschaulichung all dessen, was im Mittelteil des berühmten Falsifikats berichtet und im Einzelnen aufgezählt wird. Das siebte Fresko schildert den Übereignungsakt; das achte illustriert dem Betrachter die daraus erwachsenen Rechtsfolgen: 8. Unter Vortritt eines Diakons mit dem Prozessionskreuz und eines kaiserlichen Schwertträgers zieht Silvester besitzergreifend feierlich in Rom ein, symbolisiert durch Mauern, Türme, ein Tor. Die ‚urbs aeterna’ ist nunmehr seine Stadt, für alle Zeit Besitz des Papsttums, da sie ihm von Konstantin in feierlichster Form unwiderruflich und mit Zustimmung aller möglicherweise dafür Zuständigen zum Geschenk gemacht wurde: „in Übereinstimmung mit unseren sämtlichen Großen und dem ganzen Senat, dem Adel und dem römischen Volk“, wie es in dem Falsifikat wörtlich heißt. Gleich einem strator, einem Pferdeknecht im Dienste (officium) der Kurie, führt der Kaiser beim zeremoniösen, rechtsrelevanten Vollzug der possessio das päpstliche weiße Ross persönlich am Zügel, obwohl er jetzt wieder die Krone trägt. Silvester dagegen hat jetzt die Bischofsmitra abgelegt; sein Haupt schmückt das Phrygium, dessen Unterrand aus einem Kronreifen gebildet ist. (…) Man hält den zeremoniösen Sonnenschirm nun nicht mehr über den Kaiser, sondern über den Papst; in feierlichem Zug folgen Silvester die Kardinäle, allesamt hoch zu Ross, während Konstantin und sein Schwertträger zu Fuß einherschreiten.“ Aus: W. Goez: Ein Konstantin- und Silvesterzyklus in Rom. In: H. Altrichter (Hg.): Bilder erzählen Geschichte. Freiburg i. Br. : Rombach, 1995 (Rombach Wissenschaft: Reihe Historiae; Bd. 6), S. 140– 142. Die beiden Fresken werden nacheinander in vier Schritten betrachtet und analysiert. Im ersten Schritt beschreiben die Schülerinnen und Schüler das, was sie auf dem Bild sehen und erkennen. Im zweiten Schritt untersuchen sie den Bildaufbau (Vordergrund; Hintergrund; Positionierung im Bild). Im dritten Schritt versuchen sie zu erklären, welcher Vorgang im Bild dargestellt wird. Im vierten Schritt schließlich analysieren sie, wie die Beziehung der beiden Hauptpersonen – von Kaiser und Papst – gestaltet ist (Kleidung und Attribute, Körperhaltung, Anordnung [höher – tiefer], Gestik). 34 M5 Der Text erläutert mit Blick auf die machtpolitische Konstellation, warum die Kirche um 1250 höchstes Interesse an der bildhaften Darstellung päpstlicher Überlegenheit hatte. Die entsprechende Frage wird im Lehrer-Schüler-Gespräch beantwortet. M6 Im Anschluss an den vorangehenden Text werden hier die „publizistischen“ Aspekte des Konstantin-Silvester-Zyklus behandelt. Arbeitsauftrag s. Arbeitsblatt 1.1.2.5 Kirche und Staat im Kontext der Reformation 1.1.2.5.1 Martin Luther: Darum hat Gott zwei Regimente verordnet Um 1500 waren die Bauern Deutschlands in einer verzweifelten Lage: Die Feudalherren bürdeten ihnen immer mehr Abgaben und Frondienste auf, schränkten ihre überkommenen Rechte wie jagen, fischen und Holz schlagen immer stärker ein und hielten sie als Leibeigene. Als sich die Bauern gegen ihre Unterdrückung zu wehren begannen, sahen sie Martin Luther auf ihrer Seite. Sein Begriff von der „Freiheit eines Christenmenschen“ und seine Auffassung, dass die Schrift Regel und Richtschnur sei, wurden für die Bauern zu einer wesentlichen Grundlage ihrer sozialen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kirchlichen Forderungen. Folgerichtig erklärten sie sich bereit, von ihren Forderungen zu lassen, sobald man ihnen nachweise, dass sie nicht Gottes Wort entsprächen. Dass die Bauernschaft Schwabens die von ihr im März 1525 verabschiedeten „Zwölf Artikel“ an Luther mit der Bitte um Belehrung sandten, zeigt, wie sehr der Reformator für die Bauern eine anerkannte Autorität war und wie sicher sie sich seiner Zustimmung waren. In seiner Antwort bemühte sich Luther um ein ausgewogenes Urteil, indem er sowohl den Fürsten als auch den Bauern ins Gewissen redete. Den Herren hielt er vor, die Bauern auf unerträgliche Weise zu schinden, die Bauern ermahnte er, als Bürger im weltlichen Regiment ihre Rechte einzufordern, aber nicht im Namen des Evangeliums. Als dann die Bauernschaft mit Gewalt ihre Forderungen durchzusetzen begann, stellte sich Luther entschieden einseitig auf die Seite der Herren. Konkreter Anlass für seine Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ war die Weinsberger Blutttat, bei der die Bauern nach der Eroberung von Stadt und Burg Weinsberg den Obervogt mit seinen Gefolgsleuten töteten. Hinter dieser Tat und ähnlich grausamen Taten sah Luther den „Erzteufel von Mühlhausen“ Thomas Müntzer am Werk, den er jetzt auch offen mit Namen nannte. Im Unterschied zu Luther, den Müntzer seinerseits als „Erzkanzler“ des Teufels, „Doktor Lügner“ und „Vater Leisetritt“ brandmarkte, war dieser überzeugt, dass die Welt schon jetzt im Sinne der Bibel umzugestalten und dem kommenden Reich Gottes anzunähern sei. Die Fürsten seien „nicht Herren, sondern Diener des Schwerts“. Stelle sich die weltliche Obrigkeit gegen die im Evangelium geforderte soziale Gerechtigkeit, müsse ihr das Schwert genommen und dem Volk gegeben werden, das der eigentliche Souverän sei. In Luthers Verständnis aber, das er in der genannten Schrift wortgewaltig vertrat, luden die Bauern mit ihrem Aufstand eine dreifache Sünde auf sich: Sie brachen den Gehorsam, den 35 sie ihrer Obrigkeit schuldeten, mutwillig; sie richteten Aufruhr an, raubten und plünderten fremdes Eigentum und mordeten; sie deckten ihre Taten mit dem Evangelium und nannten sich „christliche Brüder“, obwohl sie in Wirklichkeit dem Teufel dienten. Luthers Verurteilung des Bauernaufstands beruhte letztlich auf seiner Lehre von den zwei Reichen, wie er sie in seiner Schrift „Von weltlicher Obrigkeit“ (1523) dargestellt hatte. Danach bedeutet die „Freiheit eines Christenmenschen“ nicht die Aufhebung der Leibeigenschaft. Sie betrifft die Seele des Menschen und gilt nur im Reich Gottes. Zum Reich Gottes gehören die, die rechtgläubig in und unter Christus sind. Leib und Gut des Menschen dagegen sind dem Reich der Welt zugehörig. Hier ist das Recht des Schwerts der Obrigkeit übergeben, die von Gott gewollt ist, damit sie der Bosheit derer, die nicht rechtgläubig sind, wehre und ein friedliches Zusammenleben gewährleiste. M1 Aus Luthers folgenreicher Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ sind hier die Kernsätze zitiert. Der erste und der zweite Satz stehen in einem paradoxen Verhältnis zueinander, der dritte Satz enthält die Lösung der Paradoxie. Die Paradoxie ist für die Schülerinnen und Schüler sofort erkennbar, dass und wie der dritte Satz die Paradoxie auflöst, dagegen nicht. Wichtig ist bei diesem Einstieg in Luthers Lehre von den zwei Regimenten, die Schülerinnen und Schüler begreifen zu lassen, dass sich die Bauern (mit ihrer Forderung nach Aufhebung des Standesunterschieds und der Frondienste) wie die Herren (mit ihrer Forderung der Unterordnung) auf Luther beriefen. Die Frage, ob sie dies – mit Blick auf den dritten Satz – zu Recht taten, soll hier nur gestellt werden; sie wird in den folgenden Unterrichtsschritten zum Thema. M2 Wenn die Bauern ihre rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Forderungen mit Luthers Begriff von der „Freiheit eines Christenmenschen“ untermauerten, stand dahinter die Überzeugung, dass ihre Bewegung nur das erreichen wolle, was im Evangelium (gemeint ist die ganze Bibel) als Wille Gottes verkündet werde. Ganz deutlich wird dies in den so genannten „Zwölf Artikeln“, die im Februar 1525 in Memmingen erschienen waren und als Manifest der Bauernbewegung von den Delegierten des Allgäuer Haufens, des Baltringer Haufens und des Bodenseehaufens im März 1525 ebendort angenommen wurden. Verfasst hatte die „Zwölf Artikel“ der Memminger Kürschnermeister und Feldschreiber des Baltringer Haufens Sebastian Lotzer, unterstützt von dem Prediger und Zwingli-Anhänger Christoph Schappeler. M 2 enthält Auszüge aus den „Zwölf Artikeln“. Die Originalversion ist – des Verständnisses wegen – dem heutigen Deutsch angenähert. Die Erarbeitung des Textes kann schriftlich (in Einzelarbeit) oder mündlich (im LSG) erfolgen. Die Fragen lauten: 1. Welche Forderungen erheben die Bauern? 2. Wie begründen die Bauern ihre Forderungen? Bei der Antwort auf die Frage 2 muss klar herauskommen, dass die Bauern dort, wo sie begründen, sich auf die Bibel, sprich auf das Wort Gottes stützen. 36 M3 Die Karikatur stammt aus der vom Franziskaner Thomas Murner verfassten antireformatorischen Propagandadichtung „Von dem großem Lutherischen Narren“, die 1522 wenige Tage nach ihrem Erscheinen vom Straßburger Rat verboten wurde. Sie ist die bildhafte Umsetzung des Abschnitts „Den Bundschuh schmieren“. Man sieht einen Mönch (Tonsur!) in Ritterrüstung, der an einem offenen heftig lodernden Feuer sitzt und einen (den) Bundschuh in den Händen hält. Der Vorgang des BundschuhSchmierens ist kaum erkennbar, aber durch die hier nicht abgebildete Überschrift der Karikatur zu belegen. Dass es sich bei der Rittergestalt um Luther handelt, erraten die Schüler vielleicht. Andernfalls muss ihnen die Lehrperson diese Information geben – mit Hinweis auf den Textbezug in Murners Propagandaschrift, der diese Identifikation absichert. Die Bedeutung tragenden Zeichen bzw. Symbole im Bild sind 1. der Bundschuh, 2. die Ritterrüstung, 3. das Feuer. 1. Der Bundschuh: Er war seit Ende des 15. Jahrhunderts das Feldzeichen der Bauern, die sich in Südwestdeutschland mit Verschwörungen und Aufständen gegen die Obrigkeit erhoben. Der Symbolwert des Bundschuhs war darin begründet, dass er einerseits der für Bauern typische Schnürschuh war und andererseits im Gegensatz stand zu den sporenklirrenden Ritterstiefeln. 2. Ritterrüstung: Sie spielt an auf den Pfälzischen Ritteraufstand 1522/23, bei dem unter Führung von Franz von Sickingen die im Erhalt ihres sozialen und wirtschaftlichen Besitzstandes bedrohten Ritter ihre Rechte mit Waffengewalt sichern wollten. Nicht zuletzt hatten die Ideen der Reformatoren die Ritter darin bestärkt, die Auflehnung gegen die fürstliche Unterdrückung mit einem biblisch verankerten Widerstandsrecht gegen ungerechte Obrigkeiten zu legitimieren. 3. Feuer: Es steht für die in Redewendungen gegenwärtige Vorstellung, dass man bei der Verbreitung von Ideen „mit dem Feuer spielt“, unter Menschen „einen Brand entfacht“ oder eine Bewegung „anheizen“ kann. Sofern die Bedeutung tragenden Bildzeichen im historischen Kontext verstanden werden, ist offenkundig: Die Karikatur will Luther als Unruhestifter und Aufwiegler (= Feuerschürer) zeigen, der sowohl die Bauernunruhen als auch die Ritterrevolte mitverursacht hat. Ohne den Bezug der Ritterrüstung auf die Ritterrevolte können die Schülerinnen und Schüler auch zu einer anderen Deutung gelangen: Luther als „Herr“ oder „Fürstendiener“ (Rüstung!) verrät die Bauern; er übergibt sie im Symbol des Bundschuhs den Flammen, d. i. der strafenden Obrigkeit (vgl. U. Ledwinka, Was ist die Freiheit des Christenmenschen? – Thomas Müntzer und Martin Luther als Ideengeber der Aufständischen. URL: http://www.studienseminarpaderborn.de/gy/downloads/ledwinka.pdf [29.03.2010]). M4 Luthers Schrift „Vermahnung zum Frieden“ (Anfang Mai 1525) war die Antwort auf die „Zwölf Artikel“, die ihm die Bauernschaft Schwabens mit der Bitte um Belehrung zugesandt hatte. Er ergriff hier nicht die Partei der Bauern, aber auch nicht die der Herren. Die Fürsten ermahnte er zur Mäßigung und Fürsorge, die Bauern dazu, die weltliche Obrigkeit nicht im Namen des Evangeliums abzulehnen. Der Arbeitsauftrag zu diesem Text wird in Verbindung mit M 5 gestellt (s. dort!). 37 M5 Für Thomas Müntzer war Luthers Trennung zwischen der Botschaft des Evangeliums und den Verhältnissen dieser Welt schon 1524 ein Ärgernis. In seiner „Hochverursachte(n) Schutzrede“ greift er Luther als „Vater Leisetritt“ und „zahmen Gesellen“ an und legt den eigenen Standpunkt zum Verhältnis von Gott und weltlicher Obrigkeit dar. Die Klasse arbeitet zu M 4 und M 5 arbeitsteilig. In Partnerarbeit befasst sich die eine Hälfte mit Luthers „Vermahnung“, die andere Hälfte mit Müntzers „Hochverursachte(r) Schutzrede“. Arbeitsauftrag zu M 4: 1. Welche Kritik übt Luther an den Fürsten/Herren einerseits und den Bauern andererseits? 2. Welche Forderungen richtet er an die beiden Seiten? Arbeitsauftrag zu M 5: 1. Worin sieht Müntzer den Ursprung aller Missstände (Wucher, Dieberei, Räuberei)? 2. Wie kennzeichnet er das von Gott gewollte Verhältnis von Fürst und Untertan? Für die Ergebnissicherung gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sammelt die Lehrperson die Antworten an der Tafel oder sie gibt in jeder Klassenhälfte zwei Schülerinnen und Schülern, von denen sie weiß, dass sie zügig arbeiten, eine OH-Folie, auf der diese ihre Resultate eintragen. Mögliches Tafel- bzw. Folienbild zu M 4 und M 5 Martin Luther, Vermahnung zum Frieden (Mai 1525) KRITIK an FORDERUNGEN an Fürsten und Herren Fürsten und Herren Toben/Wüten gegen das Evangelium Besserung mit der Zeit (sonst wird Gottes Zorn hereinbrechen) Schinden des armen Mannes Vermessene Meinung, fest im Sattel zu sitzen Bauern Bauern Aufruhr ist unentschuldbar Nur weltliche Obrigkeit darf Ungerechtigkeit Als Christen Unrecht erdulden/leiden Nur das tun, was Gott nicht wehrt Versuch einer gütlichen Einigung (weltlicher Obrigkeit) strafen Gewalt ist kein christliches Recht 38 Mögliches Tafel- bzw. Folienbild zu M 5 Thomas Müntzer, Hochverursachte Schutzrede (Herbst 1524) KRITIK an Fürsten und Herren handeln eigennützig nehmen alle Kreaturen zum Eigentum verpflichten die Armen auf Gottes Gebot „Du sollst nicht stehlen“; sich selbst dispensieren sie davon Feindschaft des Volks/Aufruhr GEGENENTWURF Ganze Gemeinde hat Gewalt des Schwerts Fürsten - keine Herren, sondern Diener des Schwerts - handeln gerecht - sprechen Recht nach Gottes Gesetz unter Beteiligung des Volks das Volk wird frei sein; Gott allein wird Herr sein M6 Als Luther wenige Wochen nach seiner „Vermahnung zum Frieden“ (vgl. M 4) die Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ verfasste, stand er unter dem Eindruck der Weinsberger Bluttat. Nach der Einnahme der Stadt und der Burg Weinsberg hatten die Bauern den Obervogt und seine Gefolgsleute auf grausame Weise getötet. Luther ergriff nun entschieden Partei gegen die Bauern. Er verurteilte ihren Aufstand als „gräuliche“ Sünde gegen Gott und Menschen und forderte die Fürsten auf, Gottes Befehl folgend mit aller Härte gegen die Bauern vorzugehen. Die Fragen des Arbeitsauftrags können mündlich besprochen oder schriftlich (in EA) bearbeitet werden. Arbeitsauftrag: 1. Welche Sünden gegen Gott und die Menschen laden die Bauern nach Luther auf sich? 2. Wie soll die weltliche Obrigkeit dagegen vorgehen? M7 Dass Luther sich nicht entschieden auf die Seite der Bauern gestellt, sondern sie im Gegenteil nach ihrem Aufstand den Fürsten preisgegeben hat, ist theologisch in seiner Lehre von den zwei Regimenten oder Reichen begründet. Diese Lehre hatte er bereits 1523 in seiner Schrift „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ dargelegt (zum Anlass der Schrift s. M 7, Einleitung). Der vorliegende Auszug aus dieser Schrift bereitet den Schülerinnen und Schülern mit Sicherheit Verständnisschwierigkeiten, auch wenn sie den Text aufgrund der früheren Beschäftigung mit Augustins „Gottesstaat“ (s. A 8) in einen Verständnishorizont einordnen können. Deshalb ist der Arbeitsauftrag kleinschrittig anzulegen. 39 Arbeitsauftrag: 1. Luther unterteilt – in Anlehnung an Augustinus – die Menschen in zwei Teile. Unterstreichen Sie die Schlüsselwörter und Kernaussagen, die das Reich Gottes betreffen, rot; die das Reich der Welt betreffen, grün. 2. Stellen Sie in einer Tabelle die Kennzeichnen des Reiches Gottes und des Reiches der Welt stichwortartig gegenüber. 3. Beschreiben Sie mit eigenen Worten, warum nach Luther a) Gott zwei Regimente verordnet hat b) die (wahren) Christen sich auch der weltlichen Obrigkeit unterstellen sollen, obwohl sie ihrer nicht bedürfen. 4. Formulieren Sie in einem Satz: Wo/wann endet für Luther der Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit? M8 Wolfgang Huber, Bischof i. R. der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und Ratsvorsitzender der EKD von 2003 bis 2009, betrachtet in seinem auszugsweise vorliegenden Vortrag das Verhältnis von Glaube und Macht nach der Auffassung Martin Luthers. Zwei Gesichtspunkte erscheinen Huber wesentlich: Zum einen ist weltliche Macht – potentia – für Luther nicht per se schlecht. Vielmehr gehört sie zu den Bedingungen der Welt, in der die Glaubenden leben. Zum anderen ist der Geltungsbereich der weltlichen Macht begrenzt; sie endet dort, wo es um den Gottesglauben geht. Nach der schriftlichen Erarbeitung von Luthers Schrift „Von weltlicher Obrigkeit“ ist es sinnvoll, den Inhalt des Textes von Wolfgang Huber im Klassengespräch zu analysieren. Fragen: 1. Wie beurteilt Huber im Anschluss an Luther die weltliche Macht? 2. Was versteht Huber unter „lutherischem Obrigkeitsgehorsam“? 3. Wie kennzeichnet Huber im Sinne Luthers die Grenzen des Obrigkeitsgehorsams? 40