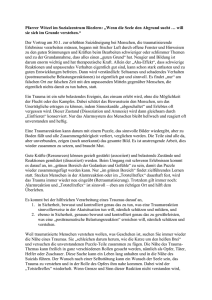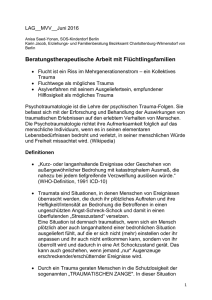Fachbericht Trauma und Sucht - Beratungszentrum Bezirk Baden
Werbung
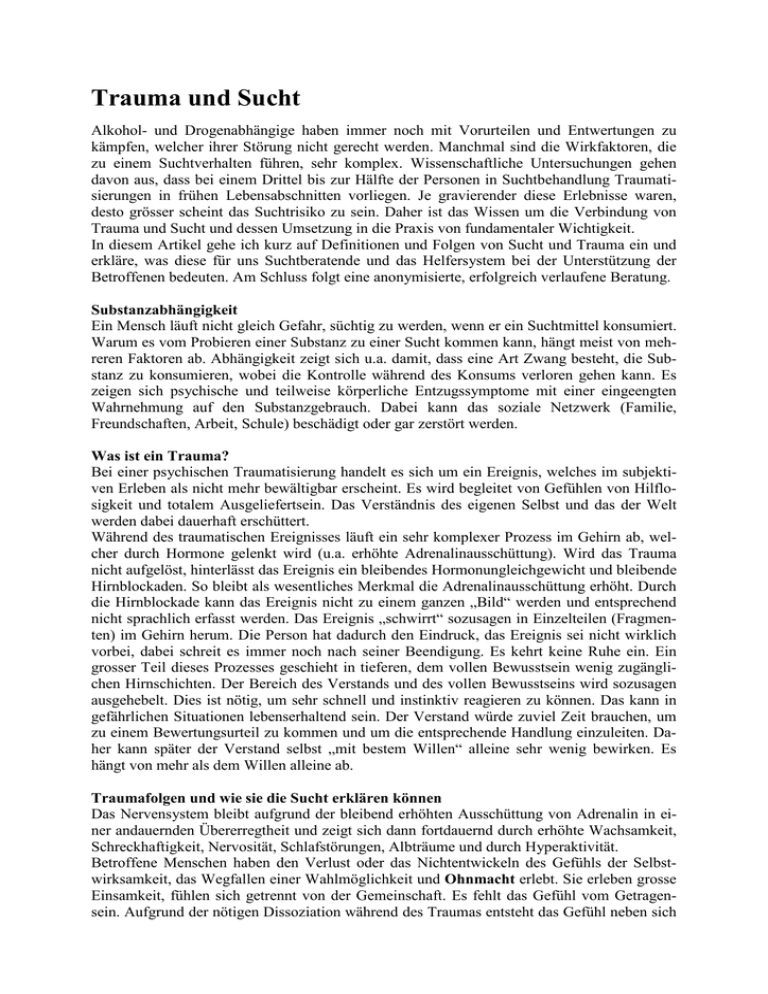
Trauma und Sucht Alkohol- und Drogenabhängige haben immer noch mit Vorurteilen und Entwertungen zu kämpfen, welcher ihrer Störung nicht gerecht werden. Manchmal sind die Wirkfaktoren, die zu einem Suchtverhalten führen, sehr komplex. Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass bei einem Drittel bis zur Hälfte der Personen in Suchtbehandlung Traumatisierungen in frühen Lebensabschnitten vorliegen. Je gravierender diese Erlebnisse waren, desto grösser scheint das Suchtrisiko zu sein. Daher ist das Wissen um die Verbindung von Trauma und Sucht und dessen Umsetzung in die Praxis von fundamentaler Wichtigkeit. In diesem Artikel gehe ich kurz auf Definitionen und Folgen von Sucht und Trauma ein und erkläre, was diese für uns Suchtberatende und das Helfersystem bei der Unterstützung der Betroffenen bedeuten. Am Schluss folgt eine anonymisierte, erfolgreich verlaufene Beratung. Substanzabhängigkeit Ein Mensch läuft nicht gleich Gefahr, süchtig zu werden, wenn er ein Suchtmittel konsumiert. Warum es vom Probieren einer Substanz zu einer Sucht kommen kann, hängt meist von mehreren Faktoren ab. Abhängigkeit zeigt sich u.a. damit, dass eine Art Zwang besteht, die Substanz zu konsumieren, wobei die Kontrolle während des Konsums verloren gehen kann. Es zeigen sich psychische und teilweise körperliche Entzugssymptome mit einer eingeengten Wahrnehmung auf den Substanzgebrauch. Dabei kann das soziale Netzwerk (Familie, Freundschaften, Arbeit, Schule) beschädigt oder gar zerstört werden. Was ist ein Trauma? Bei einer psychischen Traumatisierung handelt es sich um ein Ereignis, welches im subjektiven Erleben als nicht mehr bewältigbar erscheint. Es wird begleitet von Gefühlen von Hilflosigkeit und totalem Ausgeliefertsein. Das Verständnis des eigenen Selbst und das der Welt werden dabei dauerhaft erschüttert. Während des traumatischen Ereignisses läuft ein sehr komplexer Prozess im Gehirn ab, welcher durch Hormone gelenkt wird (u.a. erhöhte Adrenalinausschüttung). Wird das Trauma nicht aufgelöst, hinterlässt das Ereignis ein bleibendes Hormonungleichgewicht und bleibende Hirnblockaden. So bleibt als wesentliches Merkmal die Adrenalinausschüttung erhöht. Durch die Hirnblockade kann das Ereignis nicht zu einem ganzen „Bild“ werden und entsprechend nicht sprachlich erfasst werden. Das Ereignis „schwirrt“ sozusagen in Einzelteilen (Fragmenten) im Gehirn herum. Die Person hat dadurch den Eindruck, das Ereignis sei nicht wirklich vorbei, dabei schreit es immer noch nach seiner Beendigung. Es kehrt keine Ruhe ein. Ein grosser Teil dieses Prozesses geschieht in tieferen, dem vollen Bewusstsein wenig zugänglichen Hirnschichten. Der Bereich des Verstands und des vollen Bewusstseins wird sozusagen ausgehebelt. Dies ist nötig, um sehr schnell und instinktiv reagieren zu können. Das kann in gefährlichen Situationen lebenserhaltend sein. Der Verstand würde zuviel Zeit brauchen, um zu einem Bewertungsurteil zu kommen und um die entsprechende Handlung einzuleiten. Daher kann später der Verstand selbst „mit bestem Willen“ alleine sehr wenig bewirken. Es hängt von mehr als dem Willen alleine ab. Traumafolgen und wie sie die Sucht erklären können Das Nervensystem bleibt aufgrund der bleibend erhöhten Ausschüttung von Adrenalin in einer andauernden Übererregtheit und zeigt sich dann fortdauernd durch erhöhte Wachsamkeit, Schreckhaftigkeit, Nervosität, Schlafstörungen, Albträume und durch Hyperaktivität. Betroffene Menschen haben den Verlust oder das Nichtentwickeln des Gefühls der Selbstwirksamkeit, das Wegfallen einer Wahlmöglichkeit und Ohnmacht erlebt. Sie erleben grosse Einsamkeit, fühlen sich getrennt von der Gemeinschaft. Es fehlt das Gefühl vom Getragensein. Aufgrund der nötigen Dissoziation während des Traumas entsteht das Gefühl neben sich zu stehen, mehr Beobachter zu sein, der durchs Leben getrieben wird. Der Zugang zu echter Lebendigkeit, zu tiefer Freude und innerer Ruhe ist erschwert. Es fehlt die Geborgenheit und Sicherheit in sich selbst. Dies kann dann auch zu Angst- und Panikstörungen und aufgrund der Gefühle von Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Negativität zu depressivem Geschehen führen. In gewissen Situationen tauchen plötzlich emotionale oder bildliche Erinnerungen oder Symptome auf körperlicher Ebene auf. Es kann zu Dissoziationen (inneres Wegtreten) kommen oder gar dazu, dass man ohne Gefühle durchs Leben geht. Bei späteren Belastungen reagieren die betroffene Menschen aufgrund der erhöhten Adrenalinwerte meist schneller gestresst, gereizt, z. T. aggressiv und sind so auch schneller erneut traumatisiert. Sie können dabei auch andere durch ihr Verhalten traumatisieren. Trauma kann direkt und indirekt „ansteckend“ sein und kann bei ganzen Familien, erweiterten Systemen und so auch in der Gesellschaft emotionalen, physischen und finanziellen Schaden verursachen. Sucht kann hier als Kontrollversuch verstanden werden, das Leben inmitten der traumatischen Prägung und die damit verbundenen Gefühlslagen und Verhaltensweisen in den Griff zu bekommen. Der betroffene Mensch versucht regelmässig sein Körpergefühl mit Hilfsmitteln zu verändern, um als unerträglich empfundene emotionale Spannungen nicht wahrnehmen zu müssen. Dem Betroffenen fehlt der Zugang, diese Spannungen in einem bewussten Prozess selber zu steuern. Bei durch Menschen verursachten Traumata kann Sucht auch als Ausdruck für negative Beziehungs- und Bindungserfahrung stehen und ist im weitesten Sinne ein Selbstheilungsversuch, der aufgrund der problematischen Lösungsstrategie nicht wirklich gelingt. Der traumatisierte Mensch und das involvierte Helfersystem Das Helfersystem wird in der Interaktion mit den Betroffenen mit Gefühlen und Empfindungen wie Misstrauen, Widerstand, Verweigerung, Angst, Macht und Ohnmacht konfrontiert. Das kann sehr herausfordernd sein und verlangt sehr viel mehr als den „gesunden Menschenverstand“. Oft ist den Helfenden am Anfang auch gar nicht klar, welchen tiefen „Geschichten“ sie gegenüberstehen. Meist kommen traumatisierte Menschen nicht aufgrund ihrer Traumata in soziale Institutionen sondern wegen anderer sozialer Probleme. Bei Süchtigen also nur die Sucht als Symptom bearbeiten zu wollen, kann bei vorhandenen Traumata zu einem Bumerang werden. Eine Forderung nach Abstinenz an den Anfang einer Behandlung zu setzen, kann die Klienten erst recht schwächen. Denn Widerstand und Drogen können für die Betroffenen notwendige Schutzschilder sein in der Begegnung mit dem Hilfssystem. Letzteres muss sich erst als vertrauenswürdig erweisen. Es braucht keine absolute Abstinenz, um therapeutisch wirksam arbeiten zu können. Rückfalle können für den Lernfortschritt genutzt werden. Langfristig erfolgreich am Symptom arbeiten heisst, von Anfang an integriert Sucht- und Traumaberatung bei einer Person anzugehen und jeweils mit geeigneter traumaspezifischer Haltungen und Handlungen auch in allen anderen Behandlungssettings zu arbeiten. Es ist wichtig, genug Vor- und Nachbereitungszeit einzuplanen und immer wieder durch spezialisierte Supervision begleitet zu werden. Denn die Wirkung des Traumas kann auch bei der noch so bewusst arbeitenden Beratungsperson Ausblendungen und Belastungen verursachen. Daher ist eine gemeinsame Behandlungsphilosophie im gesamten Helfersystem notwendig, welches eng in Netzwerken zusammenarbeitet. Gute Erfahrungen mit zusätzlicher Integration der Polizei konnten bei Projekten in den Niederlanden gemacht werden. Stationäre Therapien sind sehr wichtig als stressfreiere Oasen, durch die manchmal erst tiefgreifende nötige Prozesse möglich werden. Doch ist die ambulante Arbeit vorher (Hinwirken auf ein Sich-einlassen-können auf einen Heilungsprozess) und ebenfalls nachher (weitere nötige Aufarbeitungen und Integration in den Alltag, Neuorientierung) essentiell wichtig und nötig. Die effektive Behandlung stationär sowie ambulant ist niederschwellig, flexibel, differenziert angelegt und richtet sich an der einzelnen Person aus. Sie orientiert sich nicht an einem starren Behandlungskonzept. Patricia - eine „einfache“ und erfolgreiche Behandlungsgeschichte Patricia, eine 24jährige junge Frau kam auf Druck ihres neuen Freundes in die Beratung. Seit einigen Jahren konsumierte sie zuerst wenig dann aber immer regelmässiger Alkohol mit zuletzt wöchentlichen Alkoholexzessen. Im Gespräch berichtet sie nebenbei von erlebter schwerer körperliche Gewalt innerhalb der Familie und von vereinzelten sexuellen Übergriffen im Bekanntenkreis. Sie erwähnte diese Facts erschreckend sachlich und emotionslos. Trotz ihren Schilderungen konnte Patricia noch keine Erkenntnis zur Verbindung zwischen ihrer Alkoholproblematik und ihren traumatischen Erfahrungen zulassen. Auch die Idee, nach Auslösern im aktuellen Geschehen zu suchen und neue Lösungen zu finden, fiel nicht auf fruchtbaren Boden. Es brauchte erst den kompletten Absturz und den Verlust der Arbeitsstelle, damit sie begriff, dass das Leben eine Veränderung von ihr erwartete, wenn sie ihr Problem loshaben wollte. Sie entschied sich dann für eine stationäre Therapie. Auch dort hatte sie im ersten Monat grosse Mühe sich einzulassen, hinzuschauen. Doch sie musste erkennen, dass ein Austritt keine gute Alternative bot. So liess sie sich auf das stationäre Angebot ein und erlebte einen positiven Durchbruch auch durch die gelungene Therapiebeziehung zu ihrem Therapeuten, welcher in Traumatherapie ausgebildet war. Mit der Aufarbeitung einiger schlimmer Ereignisse und mit Hilfe körperpsychotherapeutischer Elemente lernte sie besser ihre Körpersignale und Gefühle kennen und sie ertragen. Sie lernte, dass das Alleinsein auszuhalten ist und sich gut anfühlen kann. Sie hatte nun weniger Angst in Begegnungen mit anderen Menschen. Sie lernte Nein sagen und wurde konfliktfähiger. Sie zeigte mehr Lebensfreude und weniger Zaudern beim Anpacken neuer Sachen. Sie wurde sich ihrer eigenen Kraft und Stärke bewusst und lernte, auf diese zu vertrauen. Der Eintritt in den Alltag gelang recht gut, bekam dann aber nach und nach Risse. Einen ersten Rückfall mit Alkohol konnte sie sehr gut managen und war sich schnell bewusst, warum es dazu gekommen war. Einige Zeit später kam die Firma in eine Krise, bei der sie eine provisorische Anstellung gekriegt hatte. Sie war sehr verunsichert. Sie hatte mehrmals hintereinander Rückfälle. Obwohl sie seit dem Austritt wieder in die Beratung kam, hatte sie das Gefühl, die therapeutische Arbeit sei gemacht. Nun musste sie feststellen, dass es nicht ganz so einfach war, das Erreichte in den Alltag mit seinen Fallen und Stressmomenten zu integrieren. In der Beratung ging es dann darum, sie im meistern der Krisen zu coachen. Es zeigte sich in der Folge, dass sie gewisse Erlebnisse nochmals nachbearbeiten musste. Ein weiteres, vorhin verdrängtes Erlebnis verlangte nun auch nach Auflösung. In dieser Phase hatte sie auch schwierige Auseinandersetzungen mit ihrem Freund. Mit Hilfe von Paargesprächen und auch Einzelgesprächen des Freundes bei einem anderen Therapeuten gewann die Beziehung an Tiefe. Dies stärkte Patricia. Durch ihre gut aufgearbeiteten Geschichten wurde bei ihr Energie frei, um über eine Neuorientierung in ihrem Leben nachdenken zu können. Einen lang gehegten Wunsch setzte sie in die Tat um. Sie begann eine berufsbegleitende Weiterbildung. Das Symptom Alkohol trat mehr und mehr in den Hintergrund. Bei Belastungen lernte sie immer besser und schneller, sich selber zu steuern und andere Bewältigungsmuster zu wählen. Sie war sich aber bewusst, dass sie in Krisenzeiten immer wieder sehr achtsam mit sich selber sein muss. So wie ihre traumatischen Erlebnisse keine offenen Wunden mehr waren, sondern vernarbten, so verringerte sich das Muster, bei Stress und emotionalem Schmerz Alkohol zu konsumieren. Doch auch Narben können je nach dem schmerzen. Und so kann das Teufelchen „Erlösung durch Alkohol“ immer wieder zum Tanz winken. Rechtzeitig erblickt und auf seinen Platz verwiesen, wird es zu einem Warnsignal und kann eine erneute Alkoholkrise verhindern. Iris Luykx, Februar 2010 Literaturangaben: siehe Artikel auf unserer Homepage www.beratungszentrum-baden.ch Literatur: Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M.H. (Hrsg.)(2000): Internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10, Kaptitel V (F); klinisch-diagnostische Leitlinien / Weltgesundheitsorganisation). Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber. Fischer, G., Riedesser, P. (1998): Lehrbuch der Psychotraumatologie. München, Basel: Ernst Reinhardt. Huber M. (2009): Vortrag „Trauma und Sucht - eine häufige Verbindung“. www.michaela-huber.com. IPAS-Inst. (2003): Skript zur Ausbildung zum Gewalt-Krisen-Trauma-Coach. Wil/Schweiz. Junker, S. (2005): Trauma und Sucht - Zusammenhängen von Traumatisierung und Substanzabhängigkeit auf der Spur. Hamburg: Diplomarbeit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fachbereich Sozialpädagogik. Kraemer, H. (2003): Das Trauma der Gewalt - Wie Gewalt entsteht und sich auswirkt; Psychotraumata und ihre Behandlung. München: Kösel. Petzold, H., Schay, P., Ebert, W. (Hrsg)(2004): Integrative Suchttherapie. Theorie, Methoden, Praxis, Forschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Schäfer, I., Krausz, M. (Hrsg.)(2006): Trauma und Sucht – Konzepte, Diagnostik, Behandlung. Stuttgart: Klett-Cotta, Leben lernen. Van der Kolk, B., McFarlane, A.,Weisaeth, L. (Hrsg.)(2000): Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze. Paderborn: Junfermann. Voigtel, R. (2001): Rausch und Unglück. Die psychischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Sucht. Freiburg: Lambertus.