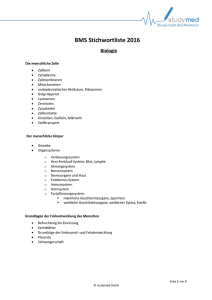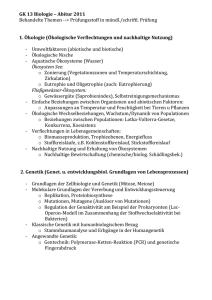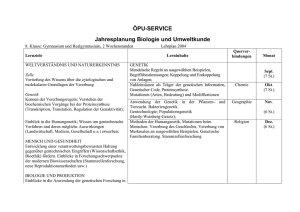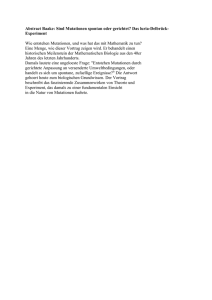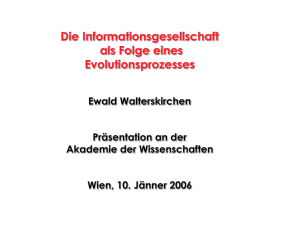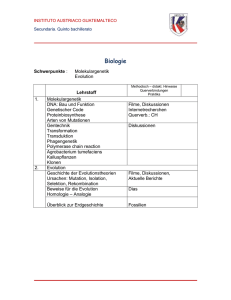Die Rolle des Zufalls in der Evolution aus Sicht einer
Werbung

Die Rolle des Zufalls in der Evolution aus Sicht einer Physikerin Barbara Drossel, TU Darmstadt (Der Originalartikel erschien im Jahrbuch „Glaube und Denken“ der Karl-Heim-Gesellschaft, Jhg. 23, im Jahr 2010, S. 105-118.) Immer wieder begegnet man im christlichen Umfeld der Auffassung, dass die Evolutionstheorie ein Feind des christlichen Glaubens sei und deshalb bekämpft werden müsse. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Die Einen sehen einen Widerspruch zwischen einem Millionen Jahre dauernden Evolutionsprozess und dem im ersten Kapitel der Bibel beschriebenen Schaffen Gottes. Die anderen sehen in wissenschaftlichen Theorien über die Entstehung des Universums und der biologischen Spezies eine Konkurrenzerklärung zur Schöpfung durch Gott. Viele sehen einen Widerspruch zwischen Gottes „es war sehr gut“ am Ende der Schöpfungsgeschichte und dem vom Kampf ums Überleben und von viel Sterben begleiteten Darwinschen Prozess. Und nicht zuletzt wird an der Rolle des Zufalls im Evolutionsprozess Anstoß genommen. Mit dem Zufall verbindet man dabei die Vorstellung, dass der Prozess willkürlich und ungeplant abgelaufen sei, viele Fehlversuche beinhaltet habe und in der stattgefundenen Form extrem unwahrscheinlich gewesen sei. Insbesondere zu den ersten beiden Einwänden gibt es viele gute Literatur, die das Verhältnis von Gottes Schöpfungshandeln zu einer naturwissenschaftlichen Beschreibung der dabei ablaufenden Prozesse klärt. Für naturwissenschaftliche Laien ist hier besonders das Buch „Creation or evolution – do we have to choose“ von Denis Alexander1 zu empfehlen. Die Frage nach der Rolle des Leids im Evolutionsprozess hängt eng mit der Theodizeefrage zusammen, und sie war das Thema einer Konferenz in der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo im Jahre 20052. Der Rolle des Zufalls ist der vorliegende Artikel gewidmet. Im Folgenden möchte ich zunächst den Stand der Evolutionstheorie diskutieren, da sie oft verzerrt und vereinfacht dargestellt wird, was unnötige Probleme aufwirft und Konflikte schürt. Dann möchte ich den zweiten Schlüsselbegriff dieses Artikels, den Zufall, aus wissenschaftlicher Sicht erklären. Im dritten Teil schließlich werden beide Themen miteinander verbunden und das Zusammenspiel von Zufall und Naturgesetz im Evolutionsprozess diskutiert. Daraus ergibt sich eine überraschende andere Sicht der Rolle des Zufalls in der Evolution. 1. Evolution 1.1. Die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Evolution“ Der Begriff „Evolution“ wird mit verschiedenen Bedeutungen verwendet, die leider oft durcheinander gebracht werden. Nach Michael Ruse3 sollte man drei Bedeutungen dieses Begriffs klar voneinander trennen. Die erste Bedeutung ist die „Tatsache Evolution“, nämlich dass alle biologischen Spezies über einen gemeinsamen Stammbaum miteinander verwandt sind. Die zweite Bedeutung ist die „Evolutionstheorie“, die postuliert, durch welche Art von 1 Erschienen im Jahr 2008 im Verlag Monarch Books. Der Tagungsband hierzu ist „Physics and Cosmology. Scientific Perspectives on the Problem of Natural Evil” (herausgegeben von Nancey Murphy, Robert John Russell, William R. Stoeger. The University of Notre Dame Press, 2007. ISBN 978-88-209-7959-1) 3 Michael Ruse, The Evolution-Creation Struggle, Harvard University Press 2005. 2 Prozessen und Mechanismen die Entwicklung der Arten vonstatten gegangen ist. Die dritte Bedeutung schließlich ist der „Evolutionismus“, also eine naturalistische Weltanschauung, die der Auffassung ist, dass die wissenschaftliche Beschreibung eine vollständige Beschreibung der Welt liefert und dass es keine darüber hinaus gehende Realität gibt. Diese Weltanschauung steht natürlich im Gegensatz zum christlichen Glauben, dass Gott die sichtbare Welt geschaffen hat. Die „Tatsache Evolution“ ist durch die Fossilien, die Biogeographie, die vergleichende Anatomie, und insbesondere durch die Molekulargenetik so vielfältig belegt, dass sie unter fachkundigen Wissenschaftlern praktisch universell akzeptiert ist. So beschreibt zum Beispiel der ehemalige Leiter des Genomprojekts, Francis Collins, in seinem Buch „Gott und die Gene“ 4 die vielfältigen Spuren, die die Entwicklungsgeschichte der Menschen in ihrem Erbgut hinterlassen hat und die ihn davon überzeugen, dass der Mensch gemeinsame Vorfahren mit dem Schimpansen und auch mit der Maus hat. Die Evolutionstheorie ist selbst einer Entwicklung unterworfen und hat seit Darwins Zeiten viele neue Forschungsergebnisse aufgenommen. Auf der Jahrestagung der „Europäischen Gesellschaft für Evolutionsbiologie (ESEB)“ in Turin im August 2009 hielt Massimo Pigliucci einen interessanten Plenarvortrag über die Geschichte und den Stand der Evolutionstheorie, dessen wesentliche Punkte wegen ihrer Bedeutung für unser Thema im Folgenden zusammengefasst werden. Das Buch zu dem Workshop, auf dem dieser Vortrag gründet 5 wird dieses Frühjahr (2010) erscheinen. 1.2. Die Entwicklung der Evolutionstheorie Die Evolutionstheorie befasst sich mit den Mechanismen, die hinter dem Evolutionsprozess stehen. Diese werden nach und nach immer besser erkannt. Massimo Pigliucci vergibt für die verschiedenen Entwicklungsstufen der Evolutionstheorie zur Veranschaulichung Versionsnummern, wie man sie Computerprogrammen gibt. Version 1.0 der Evolutionstheorie ist der Darwinismus, der die natürliche Selektion als die treibende Kraft etabliert. Version 1.1 ist der Neodarwinismus, der auf Wallace und Weissman zurückgeht und die Vererbung erworbener Eigenschaften (Lamarckismus) ablehnt, da Vererbung nur über die Keimbahn geschieht. Version 2.0 geht auf Fisher, Haldane und Wright zurück, die ab den 1920er Jahren die mendelschen Gesetze mit einer mathematisch-statistischen Formulierung von Evolutionsprozessen verbanden. Die von ihnen begonnene moderne Synthese von Genetik und Evolution fand ihre Vollendung (Version 2.1) durch die Arbeiten von Dobshanski, Huxley, Mayr, Simpson, Stebbins, u.a., die in die Theorie die Variationen natürlicher Populationen, den Prozess der Speziesbildung und die verschiedenen Paarungssysteme integrierten. Heute entwickelt sich laut Pigliucci die Evolutionstheorie zu einer Version 3.0, die als erweiterte moderne Synthese die vielen aktuellen Forschungsergebnisse zur Evolution integriert. Hier ist zunächst die Verbindung von der Evolutionsbiologie mit der Entwicklungsbiologie zu nennen („Evo-Devo“). Man ist heute der Auffassung, dass wichtige evolutionäre Änderungen durch solche Mutationen bewirkt wurden, die die Embryonalentwicklung modifiziert haben. Die Embryonalentwicklung baut aus dem „Genotyp“ (dem Erbgut) den „Phänotyp“ (den Organismus mit seinen Funktionen und seinem Verhalten). Während Mutationen den Genotyp verändern, wirkt die Selektion auf den Phänotyp. Der Zusammenhang zwischen Genotyp und Phänotyp ist extrem komplex. Man kann dies sogar schon an einer einzelnen Zelle sehen, deren faszinierendes Netzwerk 4 Francis S. Collins, Gott und die Gene: Ein Naturwissenschaftler begründet seinen Glauben. Gütersloher Verlagshaus, 2007. Das englische Original erschien unter dem Titel „The Language of God“ (Free Press, 2007). 5 Evolution-The Extended Synthesis. M. Pigliucci und G.B. Müller (Hrg), MIT Press (2010). von ineinander greifenden Signalkaskaden, Stoffwechselvorgängen und Genregulationsmechanismen von der Systembiologie bisher erst ansatzweise verstanden ist. Ein besseres Verständnis des Zusammenhangs zwischen dem Erbgut und der Entwicklung und Funktionsweise eines Organismus ist unabdingbar für ein besseres Verständnis von evolutionären Abläufen. Dieser Zusammenhang wird durch die phänotypische Plastizität noch zusätzlich verkompliziert, also dadurch, dass genetisch identische Organismen je nach Umweltbedingungen während ihrer Entwicklung einen verschiedenen Phänotyp ausbilden können und somit gleichzeitig an mehrere Umweltsituationen angepasst sein können. Ein weiterer wichtiger Baustein der Version 3.0 ist die Erkenntnis, dass Fitnesslandschaften viele neutrale Richtungen haben. Eine Fitnesslandschaft ist der quantitative Zusammenhang zwischen dem Genotyp eines Organismus und seiner Fitness, also seiner Fähigkeit zu überleben und Nachkommen zu produzieren. Wenn es neutrale Richtungen in dieser Landschaft gibt, kann ein Organismus mit hoher Fitness trotz Mutationen gut angepasst bleiben. Die Individuen einer Spezies können also genetisch immer verschiedener werden und dabei gleichermaßen an ihre Umwelt angepasst sein. Die dadurch entstehende Vielfalt bietet Raum für Anpassungsmöglichkeiten, wenn sich die Umwelt ändert. Ebenfalls wichtig in der Version 3.0 sind die verschiedenen Selektionsebenen. Lange Zeit herrschte die Auffassung, dass die Selektion im Wesentlichen auf Individuen wirkt, die besser oder schlechter an ihre Umgebung angepasst sein können. Inzwischen gibt es aber immer mehr Belege dafür, dass die Gruppe, in der sich das Individuum befindet, häufig einen mindestens genauso starken Einfluss auf das Überleben hat. Dies bedeutet, dass in vielen Fällen die Gruppe als Ganzes der Selektion unterworfen ist. Diese Überlegung lässt sich zu höheren Hierarchieebenen fortsetzen. Letztlich spielt das gesamte Ökosystem eine entscheidende Rolle für das Überleben von Organismen. Zur Version 3.0 gehören noch zwei weitere Effekte, die die auf ein Individuum wirkenden Selektionskräfte reduzieren. Der eine ist die „Nischenkonstruktion“: Ein Organismus ist nicht unbedingt darauf angewiesen, die für ihn passende Nische in der Umwelt zu finden. Er kann sich seine Nische gestalten. Ein Meister in der Nischenkonstruktion ist der Mensch, der es sich in allen Klimazonen auf der Erde wohnlich eingerichtet hat und dort ziemlich unabhängig von seiner genetischen Konstitution überleben kann. Der zweite Effekt ist die Weitergabe von nichtgenetischer Information an die nächste Generation. Hier ist zunächst die Epigenetik zu nennen, also die vielen Markierungen, die an der DNA angebracht sind, und die Art und Weise, wie die DNA zusammengepackt wird. Aber auch viele nicht genetisch fest verdrahtete Verhaltensweisen werden an die nächste Generation weitergegeben, wie z.B. Jagdstrategien oder das Verwenden von Werkzeugen. Schließlich ist noch das große Gebiet der Selbstorganisations- und Komplexitätstheorie zu nennen. Viele Muster oder Strukturen bilden sich automatisch aus, wenn gewisse Bausteine zusammenkommen, während andere Strukturen aus denselben Gründen unmöglich sind. Dies bedeutet, dass es hier nichts zu tun gibt für die Selektion, da höhere Gesetze bestimmen, was passiert. Die Schlussfolgerung aus all diesen Erkenntnissen ist, dass natürliche Selektion längst nicht so wichtig ist, wie man lange Zeit geglaubt hat, da die eben aufgezählten Effekte ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen. Die Evolutionstheorie wird dadurch komplizierter, und sie wird dadurch befreit von einigen negativen Etiketten wie „Kampf aller ums Überleben“, „beständiges Aussieben des Untauglichen“, „Recht des Stärkeren“. Leider begegnet man trotz dieser aufregenden Entwicklungen immer wieder der Auffassung, dass der Evolutionsprozess eigentlich schon vollständig verstanden sei und dass durch zufällige Mutationen und anschließende Selektion alles erklärt werden könne. 1.3. Wo der Zufall hereinspielt An welcher Stelle manifestiert sich der Zufall in der Evolution? Der Zufall ist sowohl auf der genetischen Ebene beteiligt, als auch bei den Umweltbedingungen. In diesem Beitrag werde ich nicht auf letztere, also die Auswirkungen von zufälligen, also fluktuierenden und nicht fest vorhersagbaren Umweltbedingungen eingehen. Auf genetischer Ebene gibt es mehrere Arten von zufälligen Prozessen. Dies ist zum einen die Mischung des Erbguts der beiden Eltern bei der sexuellen Fortpflanzung. Zum anderen finden zufällige Mutationen statt. Zum dritten können alle Organismen in kleinerem oder größerem Ausmaß durch horizontalen Gentransfer fremde DNA aufnehmen. Dieser Gentransport zwischen Spezies geschieht zum Beispiel durch Viren. Freilich werden nur solche genetischen Veränderungen an die nächste Generation weitergegeben, die sich in der Keimbahn ereignen. Weiter unten werden wir die verschiedenen Arten von Mutationen genauer betrachten und diskutieren, inwiefern sie zufällig sind und inwiefern daraus folgt, dass auch ihre Auswirkungen zufällig sind. Doch zunächst müssen wir uns damit befassen, was unter Zufall zu verstehen ist. 2. Zufall 2.1. Wahrscheinlichkeiten Ein Physiker spricht dann vom Zufall, wenn ein Ereignis nicht im Voraus berechnet werden kann. Solche Ereignisse sind zum Beispiel der Ausgang eines Münzwurfs, die Anordnung der Regentropfen auf der Steinfliese, der Zerfall eines radioaktiven Atoms, oder der nächste Autounfall. Dass ein Ereignis nicht vorhergesagt werden kann, bedeutet nicht, dass es völlig willkürlich und regellos stattfindet. Auch der Zufall hat seine Gesetze. Wir wollen das am Beispiel eines Würfels erläutern. Auch wenn man nicht vorhersagen kann, welche Zahl als nächstes kommt, kann man doch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die nächste Zahl eine 6 ist, 1/6 beträgt. Außerdem weiß man, dass wenn man sehr oft würfelt, der Anteil der Würfe mit dem Ergebnis 6 sich immer mehr dem Wert 1/6 nähert. Man kann andere Würfel konstruieren, die ungleiche Flächen haben und deshalb die verschiedenen möglichen Zahlen mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten ergeben. Um mit dem Zufall wissenschaftlich arbeiten zu können, benötigt man also Wahrscheinlichkeiten. Es gibt im Prinzip zwei Wege, um Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Der eine Weg geht über eine genaue Kenntnis des Prozesses. Beim Würfeln wissen wir, dass jede Zahl mit der Wahrscheinlichkeit 1/6 resultieren muss, weil keine der sechs Zahlen bevorzugt ist. Der andere Weg, Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, geht über Statistiken. Davon leben zum Beispiel die Versicherungen. Sie wissen zwar nicht, wessen Haus als nächstes brennen wird, aber sie wissen, wie häufig Brände sind. Daraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Feuers bei einem bestimmten Versicherten, und so kann man Versicherungsprämien berechnen. Wenn man weder die Abläufe genau versteht, die hinter einem Ereignis stecken, noch eine gute Statistik hat für diese Sorte Ereignis, weiß man auch keine Wahrscheinlichkeiten und kann keine quantitative Wissenschaft zu diesem Ereignis betreiben. Dies möchte ich an zwei Beispielen illustrieren: Mein erstes Beispiel ist die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Es hat sich herausgestellt, dass wenn die Werte der Naturkonstanten nur ein wenig anders wären, das Universum keine Sterne, Planeten und Leben hervorbringen könnte. Daraus folgern einige, dass es sehr unwahrscheinlich gewesen sein muss, dass unser Universum entstanden ist. Dies führt dann auf die Theorie des „Multiversums“, also von sehr vielen Universen, von denen jedes einen zufälligen Satz von Naturkonstanten hat, und auf diese Weise könne es doch passieren, dass eines auch die für eine komplexe Chemie und für Leben richtigen Konstanten hat. Die unausgesprochene Annahme, die hinter diesen Gedanken steckt, ist die, dass beim Entstehen eines Universums die Naturkonstanten aus einem breiten Bereich von Werten zufällig ausgewählt werden. Diese Annahme ist auf nichts gegründet. Wir wissen weder, durch welche Mechanismen beim Entstehen eines Universums die Werte der Naturkonstanten entstehen, noch haben wir die für eine statistische Auswertung nötigen vielen Universen, aus denen wir die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Werte der Naturkonstanten ermitteln können. Also hat die Behauptung, dass es extrem unwahrscheinlich gewesen sei, dass unser Universum genau die richtigen Werte der Naturkonstanten hat, keine wissenschaftliche Grundlage. Mein zweites Beispiel sind kreationistische Argumente gegen Evolution. Bei diesen Argumenten werden oft Wahrscheinlichkeiten dafür bestimmt, dass eine gewisse Struktur (z.B. die Geißel der Kolibakterien) „allein durch Evolution“ entstanden ist. Es stellt sich dann immer heraus, dass diese Wahrscheinlichkeit so klein ist, dass die Struktur nicht so entstanden sein kann. Es wird gefolgert, dass Gott sie gemacht hat. Wer solche Wahrscheinlichkeitsargumente macht, beginnt immer mit einer Annahme über den (angeblich von Wissenschaftlern geglaubten) Entstehungsprozess der Struktur. Oft ist es das gleichzeitige zufällige Zusammenkommen der für diese Struktur nötigen Bestandteile. Dann mag zwar die Schlussfolgerung stimmen, dass die Struktur auf die postulierte Weise nicht entstanden sein kann. Doch ein derartiges Entstehungsszenario wird von den Wissenschaftlern überhaupt nicht postuliert. Man weiß zwar für viele Prozesse die Details noch nicht gut genug, dass man fundierte Wahrscheinlichkeitsberechnungen für sie anstellen könnte. Aber man ist dabei, immer bessere Vorstellungen von realistischen Szenarien zu entwickeln. Diese sind keineswegs so horrend unwahrscheinlich wie die naiven Szenarien, die in den erwähnten Argumenten konstruiert werden. 2.2. Hintergründe des Zufalls Wenn man ein Ereignis nicht im Voraus berechnen kann, kann dies zwei Gründe haben: entweder man hat nicht genügend Wissen über die Situation, oder das Ereignis liegt tatsächlich nicht im Voraus fest. Das Erstere trifft zu bei deterministischen Abläufen. Deterministisch bedeutet, dass die Ausgangssituation in Verbindung mit den Naturgesetzen die zukünftigen Abläufe eindeutig festlegt, so wie man es von den Planetenbewegungen kennt, die den Gesetzen der Newtonschen Mechanik gehorchen. Würde man also exakt dieselbe Ausgangssituation noch einmal präparieren, würde sich auch exakt derselbe Zeitverlauf noch einmal ergeben. Im Zuge der Erfolge der klassischen Physik, die auf deterministischen Gesetzen beruht, machte sich bei vielen Wissenschaftlern die Überzeugung breit, dass diese Eigenschaft physikalischer Gesetze etwas über das Wesen des Universums an sich aussage, das daher ebenfalls deterministisch sei. Wenn wir ein Ereignis nicht im Voraus berechnen können, dann läge das also nur an unserer Unkenntnis der genauen Ausgangssituation oder unserer Unfähigkeit, die in vielen Fällen komplizierte Berechnung des Zeitverlaufs praktisch durchzuführen. Gegen diese deterministische Weltsicht lässt sich aus wissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Sicht viel einwenden. Ich beschränke mich hier auf die wissenschaftlichen Argumente. Von wissenschaftlicher Seite ist der Determinismus vor allem durch die Quantenmechanik und die Chaostheorie erschüttert worden. Nach allem, was wir wissen, gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen einem radioaktiven Atom, das zu einem Zeitpunkt zerfällt und einem gleichen Atom, das zu einem anderen Zeitpunkt zerfällt. Die Quantenmechanik liefert uns nur die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ein Atom früher oder später zerfällt. Diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich aus den Eigenschaften der Atombausteine ausrechnen. Hier hat also der Zufall explizit Einzug in physikalische Theorien erhalten. Durch die Chaostheorie haben wir gelernt, dass eine noch so gute Kenntnis der Ausgangssituation nichts daran ändern kann, dass wir den Zeitverlauf eines chaotischen Systems nur über kurze Zeit vorhersagen können. Dies liegt daran, dass eine winzig kleine Änderung der Anfangssituation sich nach kurzer Zeit spürbar auf den Zeitverlauf auswirkt. Da sowohl praktisch als auch theoretisch der Kenntnis der Ausgangssituation immer Grenzen gesetzt sind, spricht also neben der Quantenmechanik auch die Chaostheorie gegen eine deterministische Weltsicht. Es gibt also Zufall im Sinn von echter Unbestimmtheit. Die Zukunft ist durch die Gegenwart, kombiniert mit den Naturgesetzen, nicht vollständig festgelegt. 2.3. Interpretationen des Zufalls In der Alltagssprache und auch in der populärwissenschaftlichen Literatur wird der Zufall auf viele verschiedene Weisen interpretiert: von den einen er wird als blind, ziellos, sinnlos, willkürlich oder ursachenlos bezeichnet. Doch daraus, dass eine naturwissenschaftliche Beschreibung keinen Sinn und kein Ziel kennt, folgt nicht zwangsläufig, dass ein zufälliges Ereignis nicht von Gott gewollt, gewusst, oder verursacht sein kann. Es folgt nur, dass im Rahmen einer innerweltlichen, auf Naturgesetzen basierenden Beschreibung das Ereignis nicht im Voraus festliegt. Die Interpretation des Zufalls als göttliche Fügung oder des Indeterminismus als Fenster für Gottes Wirken ist genauso mit der naturwissenschaftlichen Beschreibung vereinbar wie die obige nihilistische Interpretation. Weltanschaulich weniger befrachtete Interpretationen des Zufalls betonen, dass er die Vorraussetzung für einen Freien Willen, für Kreativität und für das Entstehen von Neuem sei, also auch für einen Evolutionsprozess. 3. Evolution und Zufall 3.1. Zufall und Mutationen Mutationen sind zufällige Ereignisse, da der Zeitpunkt und Ort einer Mutation nicht vorhergesagt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Mutationen. Punktmutationen sind die Ersetzung eines Nukleotids der DNA durch ein anderes. Dies passiert als Folge von Schädigung durch chemische oder physikalische Prozesse, oder als Kopierfehler beim Duplizieren der DNA. Auf dieselbe Weise geschehen auch Löschungen und Einfügungen von Nukleotiden. Punktmutationen, die beim Duplizieren der DNA entstehen, werden durch ausgeklügelte Korrekturmechanismen so gut korrigiert, dass pro Generation nur eine Punktmutation in 50 Millionen Basenpaaren entsteht. Dies bedeutet allerdings immer noch, dass ein menschliches Kind gegenüber seinen Eltern mehr als 100 Punktmutationen hat. Durch Punktmutationen kann zum Beispiel ein Protein feinabgestimmt werden. Für größere evolutionäre Veränderungen macht man allerdings nicht Punktmutationen verantwortlich, sondern Genduplikationen und Transpositionen. Es gibt Mechanismen, durch die Gene oder größere Teile der DNA verdoppelt oder gar vervielfacht werden. Als Folge können die zusätzlichen Gene sich anders spezialisieren als die ursprünglichen Gene. Für Änderungen der Genregulation macht man u.a. Transpositionen verantwortlich. Dabei werden Abschnitte der DNA, sogenannte Transposonen, an eine andere Stelle versetzt oder kopiert. 50 Prozent unseres Erbguts bestehen aus solchen Transposonen, wobei viele von ihnen freilich schon alt sind und nicht mehr mobilisiert werden können. Transposonen gehen ursprünglich wohl auf Retroviren zurück, die sich in die DNA eingefügt haben. Die Aktivität von Transposonen wird durch die Zelle reguliert und normalerweise unterdrückt. Aber in Zeiten von Stress, wenn Anpassung an neue Umweltbedingungen erforderlich ist, werden die Transposonen freigegeben. Da sich zumindest einige Arten von Transposonen bevorzugt in die Promoterregion einfügen, also den Bereich, der die Genexpression reguliert, wird durch Transpositionen die Art und Weise modifiziert, in der Gene reguliert werden6. Auch wenn eine einzelne Mutation oder Transposition nicht vorhergesagt werden kann, folgen derartige genetische Veränderungen durchaus gewissen Gesetzen. Transposition geschehen unter verschiedenen Umweltbedingungen verschieden häufig, und Transposonen fügen sich an verschiedenen Stellen der DNA mit verschiedener Wahrscheinlichkeit ein. Dies ist so, als ob jemand zu verschiedenen Zeiten verschieden oft würfeln würde, und je nach Situation auch noch einen andersartigen Würfel nehmen würde. Der Mikrobiologe James Shapiro von der Universität Chicago interpretiert diese Beobachtungen so, dass die Zelle eine Reihe von Werkzeugen hat, mit deren Hilfe sie ihre eigene DNA als Antwort auf Herausforderungen verändern kann. Genetische Veränderungen sind seiner Aussage nach fast immer durch von der Zelle regulierte Prozesse verursacht7. Ein deutscher Text, in dem ähnliche Aussagen zu finden sind, ist das (leider mit einem polemischen Unterton geschriebene) Buch „Das kooperative Gen“ von Joachim Bauer8. Wir sehen also, dass Mutationen, auch wenn bei ihnen der Zufall beteiligt ist, mit Gesetzen einhergehen, die bestimmen, wann und wo Mutationen welcher Sorte wie häufig auftreten. Doch nicht nur die Entstehung einer Mutation ist von Gesetzmäßigkeiten umgeben, sondern auch die Auswirkung von Mutationen unterliegt Gesetzen. Wie sich die veränderte DNA auf die Prozesse in der Zelle und auf die Embryonalentwicklung auswirkt, wird durch ein komplexes Netzwerk von Regelkreisen und Wechselwirkungen in der Zelle bestimmt. Diese Überlegungen veranlassen uns dazu, im nächsten Abschnitt einige grundsätzliche Gedanken über das Zusammenspiel von Zufall und Gesetzen anzustellen. 3.2. Das Zusammenspiel von Zufall mit Gesetzen Wir können uns das Zusammenspiel von Zufall und Gesetzen am besten anhand von Würfelbrettspielen wie Mensch-ärgere-dich-nicht veranschaulichen. Durch den Würfel hat der Zufall für das Spiel eine wichtige Bedeutung. Das Gesetz liegt in Form von Spielregeln vor, die bestimmen, wer wann würfeln darf und was als Folge des Würfelergebnisses zu tun ist. Während des Spiels kann das Spielbrett viele verschiedene Konstellationen annehmen. Dabei hat das Spiel eine eindeutige Zeitrichtung: mit der Zeit erreichen immer mehr Spielsteine das Ziel. Wird solange weitergespielt, bis auch der letzte Spieler alle Steine ins Ziel gebracht hat, ist das Endergebnis des Spiels sogar völlig eindeutig. Das Zusammenspiel von Zufall und Gesetz führt bei diesem Spiel also trotz vielfältiger Zwischenergebnisse immer zu demselben Endergebnis. Natürlich kann man sich auch Spiele ausdenken, bei denen nie ein definitiver Endzustand erreicht wird, sondern alle Steine für alle Zeiten über das Spielbrett irren. Diese Überlegungen zeigen, dass allein die Tatsache, dass bei einem Prozess viel Zufall beteiligt ist, noch nicht bedeutet, dass auch das Endergebnis unvorhersagbar und bei jeder Wiederholung des Prozesses völlig anders ist. Ein Prozess, bei dem Zufall und Gesetze zusammenspielen, kann durchaus zu eindeutigen Resultaten oder zu einer stark eingegrenzten Menge von qualitativ gleichwertigen Resultaten führen. Es stellt sich daher die Frage, zu welcher Kategorie von Spielen der Evolutionsprozess gehört. Stephen J. Gould aus Harvard war der Meinung, dass der Evolutionsprozess unvorhersagbar ist und auch völlig anders hätte 6 Eine aktuelle Untersuchung darüber, wo sich Transposonen einfügen, wurde vor Kurzem an Reis durchgeführt. Die Ergebnisse von Ken Naito und seinen Koautoren wurden im Oktober 2009 in der Zeitschrift Nature (Bd. 461, S. 1130) veröffentlicht. 7 Mehrer Artikel von J. Shapiro zu diesen Überlegungen hat der Autor auf seiner Webseite http://shapiro.bsd.uchicago.edu/index3.html?content=genome.html gepostet. 8 Erschienen bei Hoffmann und Campe 2008. verlaufen können9. Simon Conway Morris aus Cambridge argumentiert im Gegensatz dazu, dass im Laufe der Evolution immer wieder ähnliche Lösungen auf ähnliche Herausforderungen gefunden wurden. Man nennt dieses Phänomen konvergente Evolution. 3.3. Konvergente Evolution In seinem Buch „Jenseits des Zufalls“ 10 bringt Simon Conway Morris viele Beispiele für konvergente Evolution. Bei den Sinnesorganen ist sie immer wieder zu finden. So haben Wirbeltiere, Tintenfische und sogar Quallen und Schnecken unabhängig voneinander ein Kameraauge bekommen, das immer nach denselben Prinzipien funktioniert, wenn es auch im Detail auf anderem Weg realisiert wurde. Auf der Ebene des Körperbaus gibt es frappierende Beispiele von konvergenter Evolution zwischen den Beuteltieren und den höheren Säugetieren. Tiere, die jeweils dieselbe Nische besetzen, sehen sich sehr ähnlich. Es gibt bzw. gab bei Beuteltieren und höheren Säugetieren jeweils eine Maus, einen Maulwurf, einen Wolf und ein Gleithörnchen. In der englischen Tageszeitung „The Guardian“ formulierte Conway Morris in einer Kolumne zu Darwins 200. Geburtstag seine Schlussfolgerungen aus diesen Beobachtungen folgendermaßen: „Es ist inzwischen legitim geworden, über eine Logik in der Biologie zu reden. Dieses Wort hört man nicht von vielen Neo-Darwinisten. Trotzdem folgt Evolution offensichtlich grundlegenden Gesetzen. Diese Gesetze sind natürlich wissenschaftlich, aber sie übersteigen den Darwinismus. Was! Der Darwinismus ist nicht die vollständige Erklärung? Warum sollte er es sein? Er ist trotz allem nur ein Mechanismus, aber wenn Evolution vorhergesagt werden kann und sogar eine Logik besitzt, dann folgt sie offensichtlich tieferliegenden Prinzipien. Denk doch, so ist es bei jeder Naturwissenschaft. Warum sollte der Darwinismus eine Ausnahme sein?“ 11 4. Schlussgedanken Mit dem letzten Absatz des vorigen Kapitels kam ein Spitzenwissenschaftler der Evolutionsbiologie zu Wort, der aufgrund seiner Beobachtungen der Überzeugung ist, dass der Evolutionsprozess tieferliegenden Gesetzen folgt. Es ist wie mit einem Fluss, der nicht überall fließen kann, sondern dem von der Landschaft mit ihren Bergen und Tälern wenige Optionen vorgegeben werden. Die naive Vorstellung, dass im Evolutionsprozess im Prinzip alles möglich, aber halt sehr unwahrscheinlich ist, muss der Erkenntnis weichen, dass nur relativ wenige Dinge möglich sind, aber dass diese wiederholt passiert sind. Diese Sichtweise passt sehr gut zusammen mit dem, was die Physiker über Prozesse wissen, bei denen Zufall mit Gesetzen zusammenspielt. Ich habe anhand der Analogie eines Spiels argumentiert, dass solche Prozesse zu Endergebnissen mit vorhersagbaren Eigenschaften führen können. Das gesamte Feld der statistischen Physik, die mein Forschungsgebiet ist, befasst sich genau mit diesem Thema. Wer freilich das Spiel nicht gut genug durchschaut, ist von den Ergebnissen überrascht. Die Biologie hat gerade erst damit begonnen, die Details der Regeln des Spiels „Evolution“ zu erarbeiten. Das extrem komplexe Wechselspiel von Genen, Stoffwechsel, Embryonalentwicklung, Organismus und Umwelt, das für den Evolutionsprozess entscheidend ist, wird auf allen Ebenen intensiv erforscht. 9 S.J.Gould, Illusion Fortschritt. Fischer (Tb.), Frankfurt; 3. Aufl.age 2004. S. Conway Morris. Jenseits des Zufalls: Wir Menschen im einsamen Universum. Berlin University Press 2008. Das englische Original erschien 2004 bei Cambridge University Press unter dem Titel „Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe.“ 11 http://www.guardian.co.uk/global/2009/feb/12/simon-conway-morris-darwin 10 Zum Schluss möchte ich zum Eingangsthema zurückkommen: wie lassen sich die Zufälligkeit des Evolutionsprozesses und der allmächtige Schöpfer zusammen denken? Die Wissenschaft entdeckt immer mehr, wie wunderbar komplex die Prozesse sind, die das Leben steuern und regulieren. Der Evolutionsprozess war nicht eine Serie von Kopierfehlern, die ab und zu ein Lebewesen besser an seine Umwelt angepasst haben. Die Mechanismen, durch die sich das Erbgut verändert, sind durch die Zelle selbst kontrolliert, so dass Mutationen nicht immer und überall mit derselben Wahrscheinlichkeit erfolgen. Mutationen ermöglichen dem oben erwähnten „Fluss“ des Lebens, die verschiedenen Richtungen abzutasten und auszuloten, in welcher Richtung der Flusslauf weitergehen kann. Die Rolle des Zufalls besteht darin, in einem sinnvoll ausgewählten Möglichkeitsraum eine jetzt gerade gute Lösung zu suchen. Dieses Verständnis des Evolutionsprozesses passt sehr gut zur Vorstellung von Gott als dem Schöpfer, der sich eine wunderbar vielfältige und komplexe Welt ausgedacht hat mit all den Mechanismen, nach denen sie funktioniert, der sie aber nicht bis in jedes Detail festlegt, sondern ihr auch die Freiheit gibt, sich in gewissen Grenzen selbst zu entfalten.