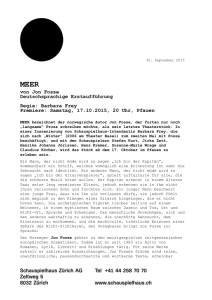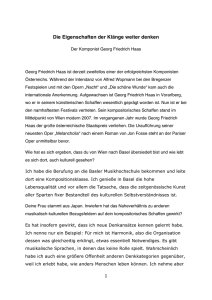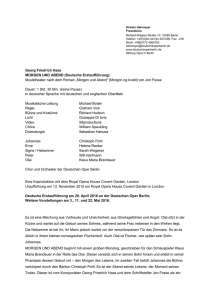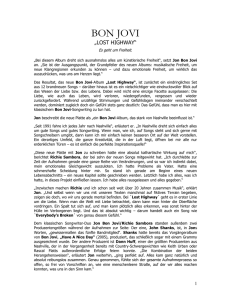Der Gitarrenmann vom Hardangerfjord
Werbung

FEUILLETON Mittwoch, 11. Juni 2014 ^ Nr. 132 45 Neuö Zürcör Zäitung RICHARD WAGNERS «HABSBURG» MORAL UND POLITIK NETZWERKE DES WISSENS FORSCHUNG UND TECHNIK Feuilleton, Seite 46 Feuilleton, Seite 47 Feuilleton, Seite 49 Seite 54 Kakanien als Mythos und Anschauung Ein Symposion der Philosophischen Gesellschaft Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts in Karlsruhe An Premieren geht er nie, und nun hat Jon Fosse auch noch beschlossen, dem Theater überhaupt den Rücken zu kehren. Die Hubble-Konstante soll präziser vermessen werden IMAGO Der Gitarrenmann vom Hardangerfjord Jon Fosses neues Stück ist möglicherweise sein letztes: Uraufführung beim Festival in Bergen – und ein Treffen mit dem Schriftsteller «Meer» heisst das Stück des Norwegers Jon Fosse, welches die Festspiele Bergen dieses Jahr am Herkunftsort des Autors zeigten. In der Landschaft seiner Kindheit verstand man es ganz unmittelbar. Barbara Villiger Heilig In Oslo soll es ein Hotel geben, das einen Saal nach Jon Fosse benannt hat. Das Dörfchen am Hardangerfjord hingegen, dessen Ortsschild weiss auf blau «Fosse» ankündigt, hiess schon immer so, aufgrund des Wasserfalls – «foss» –, welcher hinter ihm zu Tale rauscht, wenn Schnee und Gletscher schmelzen. Im Dorf namens Fosse ist der norwegische Schriftsteller aufgewachsen; dort leben seine betagten Eltern weiterhin. Von ihrem grossen weissen Holzhaus neben dem kleineren, wo die Grossmutter wohnte, bietet sich ein magischer Blick. Das Bootshäuschen, die ruhige Bucht, der Bergzug am anderen Ufer: Es könnte ein Jon-Fosse-Bühnenbild sein, dem gar nicht unähnlich, das Raimund Bauer für die Zürcher Inszenierung von «Schönes» baute. Wie in jenem Stück herrscht Sommer, mit unverschämt blauem Himmel und einer abends nicht untergehen wollenden Sonne. Schauplatz Kindheit Neben der Fosse-Bucht liegt eine zweite; zusammen formen sie den «Strandbusen», auf Norwegisch «Strandebarm»: So heisst die Gemeinde. Vor dem Gemeindehaus, einem reizenden, 1929 errichteten Gebäude aus braunrot gestrichenem Holz mit geschnitzten Säulen, grünlichem Tonnengewölbe und einer kleinen Bühne, drängt sich heute Abend das Publikum. Unter die Lokalen mischt sich eine Politikerin aus der Hauptstadt. Anlass für ihr Kommen: ein neues Jon-Fosse-Stück. «Meer» stammt zwar aus dem Jahr 2006, wurde aber erst bei den diesjährigen Festspielen in Bergen uraufgeführt, in deren Rahmen die Inszenierung auch nach Strandebarm reiste. Es hat seinen speziellen Reiz, sie am Herkunftsort des Autors zu erleben. Fosses Stücke, 33 an der Zahl, in 40 Sprachen übersetzt und weltweit 1000 Mal aufgeführt, versteht man überall. Hier aber versteht man plötzlich mehr. Das Gemeinde- oder genauer Jugendhaus von Strandebarm ist keine zufällige Wahl. Es entstammt einer nationalen Jugendkultur-Bewegung, deren Veranstaltungshäuser sich über ganz Norwe- gen verteilen. Dasjenige in Oslo wird «Meer» demnächst als Gastspiel zeigen. Ein solch volksverbundener, fast familiärer Kontext entspricht der Absicht des Regisseurs: Er bettet das metaphysisch abstrakte Kammerspiel in eine konkrete Gemeinschaft ein. Kai Johnson, befreundet mit dem Autor, inszenierte seit dessen erstem Stück vor 20 Jahren in Bergen noch mehrere andere. «Meer» dürfte seine letzte Uraufführung sein. Denn Jon Fosse hat vor, dem Theater den Rücken zu kehren. Auch deshalb berührt es sonderbar, jene Bühne zu sehen, auf der er als jugendlicher Rocker die eigene Karriere begann. Eine unscharfe Foto hängt im Entrée. Line-up mit Saxofon, Schlagzeug, E-Gitarren: Da steht er, ein Hippie mit rosa T-Shirt, hellblauen Hosen, langem Haar. Der Künstler als junger Mann. «Knocking on Heaven’s Door» habe er gespielt, erzählt eine ehemalige Schulkameradin. Die Gitarre hat Fosse unterdessen aufgegeben, das Klopfen am Tor zum Himmel nicht – erste und letzte Dinge beschäftigen ihn nach wie vor, um sie kreist sein Werk. Geburt, Leben, Tod; ausserdem: die Kunst. Letztere erscheint immer wieder verkörpert im «Gitarrenmann», wie ein Bühnenmonolog heisst. In «Schönes» verschafft ein gescheiterter Ehemann, zurückgekehrt an den Ort seiner Kindheit, zerschellten Träumen musikalischen Ausdruck – mithilfe der Gitarre. Und nun, in «Meer», steht wieder ein Gitarrenspieler vor uns, mitten im Kreis, den wir auf zwei dicht besetzten Stuhlreihen bilden. Ein Traumspiel Ihm gegenüber ein Anderer. «Ich bin der Kapitän», beginnt er; so wird er eine knappe Stunde später auch schliessen. Das Schiff, das Meer – er beschwört sie herauf wie durch ein Mantra; ausserdem Passagiere, an deren Präsenz der Dialogpartner zweifelt. Doch, doch, viele seien da, wiederholt der Kapitän. Aus dem Dunkel schälen sich die beiden Figuren heraus, spärliches Licht bricht sich prismatisch auf der matten Plexiglasscheibe zwischen ihnen. Sie dient als Projektionsfläche, im wörtlichen und im übertragenen Sinn: Zwei Paare tauchen auf, ihre Video-Porträts schimmern. Gespenster, Geister? Wie in einem langsamen Ballett suchen Gesten und Stimmen einander. Sowohl der Kapitän als auch der Gitarrenspieler vermeinen, in einem der Paare Vater und Mutter zu finden; allein: Der Wiedererkennungseffekt bleibt einseitig. Ohne Echo verklingen die Rufe. (Dass des Autors Eltern im Publikum sitzen, wirkt, einen Herzschlag lang, wie ein wohltuender Schmerz.) Gefunden, verloren. «Du bist hier / und ich vermisse dich / trotzdem», sagt einer zur «Allerliebsten»; sie – als Einzige – hört entrückt die Musik der Luftgitarre. Erinnerungen und Emotionen kreuzen sich in diesem Traumspiel, das Unbewusstes und Bewusstes zu einem Vexierbild menschlicher Beziehungskonstellationen verwebt. Es ist, als erwachten auf einmal alle Figuren aus Jon Fosses Stücken und versammelten sich für die Dauer dieser Schifffahrt durch imaginäre Leben. Körperlose Träger von Sehnsucht – einer Sehnsucht nach jener Sphäre des Unerhörten, die Fosse seit je erkundet. Der Kreis um die Spielfläche, den Quäkern nachempfunden, zu denen er einst gehörte, zwingt das Publikum zur Innenschau. Wir sehen, was in uns selbst vorgeht. Deshalb wohl wird immer wieder leise gelacht. Im Versteck Fosses Stücke, die früheren, realistischeren und die späteren, von ihm «allegorisch» genannten, widerspiegeln stets Szenarien der Seele; doch nie kam das so klar zum Ausdruck wie hier, bei diesem unaufdringlich schwebenden Heimspiel, dessen pausendurchsetzte Wortmusik das Ungesagte zur Sprache, zum Sprechen bringt. Den ganzen Fosse enthält «Meer». Wo bloss steckt der Autor in Fleisch und Blut während dieser denkwürdigen Stunde? Weit weg. Ihm würde das garantiert viel zu nahegehen. Er halte es nur kurz aus in Strandebarm, sagt er bei unserem Treffen, das in Bryggen stattfindet, der touristisch gefluteten alten Speicherstadt von Bergen. Ausländer kaufen hier Norwegerpullover, wie sie Thomas Ostermeier in seiner Inszenierung von «Der Name» verwendete, mit der er anno 2000 in Salzburg eine alsbald die deutschsprachigen Bühnen überrollende FosseWelle auslöste. Nein, in Bryggen läuft man keinem Einheimischen über den Weg. Jon Fosse ist ein scheuer Mensch. Stimmt das? Ein herzlicher vor allem. Und so offen, dass er ungeschützt wirkt. Darum vielleicht versteckt er sich an vier Wohnorten: Der Wechsel erlaube ihm «eine Art Anonymität». In Bergen, wo die engen Gässchen zum nachbarlichen Voyeurismus geradezu auffordern, leben vier von Fosses Kindern. Die einen sind erwachsen, mit den jüngeren will er nach dem Gespräch küstenaufwärts fahren zu seinem «cottage». Dann Oslo: Im Schlosspark steht ihm als Künstlerresidenz die sogenannte «Grotte» – ein normales Haus mit einer Grotte darunter – zur Verfügung, bis ans Lebensende. Und schliesslich Hainburg an der Donau, auf halbem Weg zwischen Wien und Bratislava. Fosses jetzige Frau ist Slowakin, das gemeinsame Töchterlein zweieinhalbjährig. Wenn Fosse in seinem mehr als passablen Deutsch sagt, er fühle sich dort «heimlich», aber «heimatlich» meint, so offenbart der Lapsus eine eigene Wahrheit. Und wenn er witzelt, Probleme mit den vielen Adressen gebe es höchstens für die Post, lenkt die Ironie schlecht ab vom fast beklemmend spürbaren Bedürfnis nach unbemerktem Dasein. Die Stille Jon Fosse ist ein hypersensibler Mensch. Sozialer Druck setzt ihm zu. Öffentlichen Auftritten hielt er früher nur dank Alkohol stand; als er den Alkohol nicht mehr kontrollieren konnte, sondern von ihm kontrolliert wurde, hörte er auf zu trinken – und öffentlich aufzutreten. Kein Lesungen mehr. Premieren: nie. Mit dem Theater schliesst er nun ohnehin ab. Nur Opernlibretti interessieren ihn nach wie vor: Auf «Melancholia» (2008) folgt ein neues Musiktheater-Projekt mit Georg Friedrich Haas für Covent Garden, London; und für die Oper Peking arbeitet er an einer Fortsetzung der Ibsenschen «Nora», allerdings entrümpelt vom bürgerlichen 19. Jahrhundert, als zeit- und ortlose Frauengeschichte. Apropos Ibsen: «Ein Genie», aber «die Dämonen» in seinem Werk erdrücken Fosse – er schüttelt sich. Irgendetwas muss da empfindlich weh tun, wenn auch anders als bei Neil Young, den er nicht mehr erträgt: «too touching». Musik hört Fosse kaum noch, höchstens Bach, bei dem würde er «nicht durchdrehen». Trotzdem ist ihm in der Messe – Fosse trat zum Katholizismus über – Stille am liebsten. Ja, er ist auch ein religiöser Mensch. Den Glauben braucht er, um Andersgläubige zu verstehen: «Ich habe keine Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wie tief Mohammed-Karikaturen Muslims demütigen.» Seit langem liest er Meister Eckhart, den Mystiker. Aber auch Peter Handke, der das Schweigen im Schreiben einhole, ohne zu verstummen – Fosses Ideal. Er selber hat es in den Theaterstücken mithilfe der ständigen Pausen verwirklicht. «Zu einfach», meint er jetzt; fortan will er sich dem widmen, was er «langsame Prosa» nennt, obwohl es auch Gedichte sein können. Auf jeden Fall sieht er das Schreiben als musikalische Tätigkeit. Zuerst kommt das Hören, alles entsteht aus dem Ohr. So wurde aus dem Gitarrenmann ein Dichter: Jon Fosse, der Künstler.