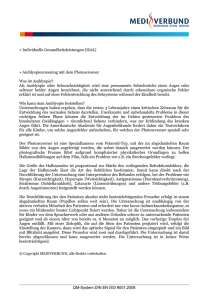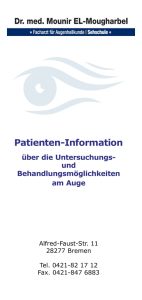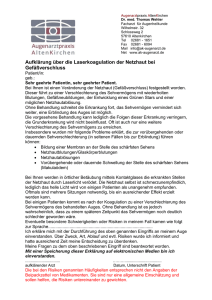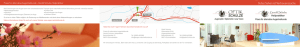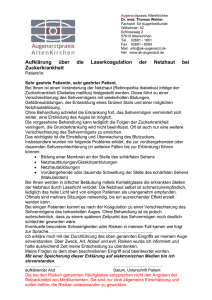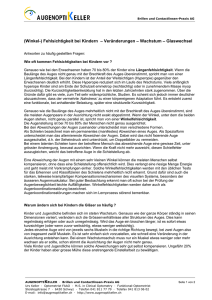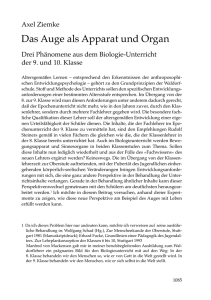Nachbilder - Diaphanes
Werbung

Nachbilder Nachbilder Das Gedächtnis des Auges in Kunst und Wissenschaft Herausgegeben von Werner Busch und Carolin Meister diaphanes Dieser Band entstand im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 626 »Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste« an der Freien Universität Berlin und wurde auf seine Veranlassung unter Verwendung der ihm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel gedruckt. 1. Auflage ISBN 978-3-03734-109-4 © diaphanes, Zürich 2011 www.diaphanes.net Alle Rechte vorbehalten Layout, Satz: 2edit, Zürich Druck: Pustet, Regensburg Umschlagabbildung: Joseph Mallord William Turner, Regulus (Detail), 1828/37, Öl auf Leinwand, London: Tate Gallery (copyright: Tate Images London) inhalt Carolin Meister Einleitung Das Gedächtnis des Auges 7 Blendung Peter Bexte Sonnenblicke und Augenlider 19 Horst Bredekamp Sonnenlicht und Augenschmerzen Von Kepler bis Lorrain 35 Ulrike Boskamp Nachbilder, nicht komplementär Augenexperimente, Sehlüste und Modelle des Farbensehens im 18. Jahrhundert 49 Schwindel Pamela M. Lee Bridget Rileys Auge/Körper-Problem 73 Matthieu Poirier »Attentate auf den Sehnerv« Nachbild und andere Wahrnehmungsstörungen in der Kunst der sechziger Jahre 95 Rebekka Ladewig Augenschwindel Nachbilder und die Experimentalisierung des Schwindels um 1800 107 Bild und Blick John Gage Fliegende Farben Goethe und der Augenschein von Gemälden 129 Annik Pietsch Augensinn und Farbenspiel Physiologische Farben und das Kolorit der Malerei Anfang des 19. Jahrhunderts 139 Georges Roque Das Universum der Empfindungen Eine Parallele zwischen der physiologischen Optik und der Malerei 155 Bild und Zeit Michael F. Zimmermann Nach-Denk-Bilder Robert Delaunays Blick auf die Sonne und die Bewegung der Wahrnehmung 173 Wilhelm Roskamm Vom Nachbild zum virtuellen Bild Überlegungen im Anschluss an Bergsons Wahrnehmungstheorie 215 Jonathan Crary Your colour memory Illuminationen des Ungesehenen 241 Postskriptum Werner Busch Stille Post Zu nichtphysiologischen Nachbildern 251 Autorenverzeichnis 269 Tafelteil 273 Verzeichnis der Farbabbildungen 303 Carolin Meister Einleitung Das Gedächtnis des Auges Nachbilder – so zumindest sagt es die Begriffsgeschichte – sind zweierlei. Es sind Bilder nach der Natur, Werke der Mimesis, und es sind physiologische Erscheinungen, Augengespenster. Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm führt unter dem Eintrag »Nachbild« so auch zwei Bedeutungen mit entsprechenden Belegstellen: »Nachbild, n. 1) nach einem ur- oder vorbilde gemachtes bild […] 2) nachwirkung einer licht- oder farbenerscheinung im auge, augen-, gesichtstäuschung«.1 Die zeitliche Signatur des Begriffs, die das Grimm’sche Wörterbuch an zweiter Stelle aufführt, ist ein relativ junges, ein modernes Phänomen. Denn die semantische Verschiebung vom »nach« der Nachahmung zum »nach« der Nachwirkung ereignet sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Sie ist der etymologische Niederschlag eines neuen Sehens, das sich in gespenstischen Wahrnehmungen verkörpert: von den Scheinbildern Goethes und den Kontrastfarben Eugène Chevreuls, über die galvanischen Lichterscheinungen Johann Wilhelm Ritters und die Druckfiguren Jan Evangelista Purkinjes bis hin zu den Blendungsbildern Joseph Plateaus. Aber auch die optischen Apparate für Forschung und Vergnügen, die – wie Walter Benjamin mit Blick auf das Phenakistiskop schrieb – das Sehen »einem Training komplexer Art«2 unterzog, gehören hierher. Während das Wort »Nachbild« zuvor für jedes Werk in den Bildergalerien galt, welche die akademische Kunstübung der Naturnachahmung hervorbrachte, zirkuliert es im 19. Jahrhundert in den Experimentierstuben der Romantiker und den Labors der Physiologen. Dort bezeichnet es allerdings keine bildende Kunst mehr, sondern spukhafte Licht- und Farbeffekte im Auge. Aus einem Begriff der Nachahmungsästhetik ist ein Name für jene Scheinbilder geworden, die als Symptome einer neuen Subjektivität des Sehens zu verstehen sind. Das »nach« verknüpft nun das Bild mit der Zeitlichkeit desjenigen Körpers, der es hervorbringt und zugleich erfährt. Kurz, das Nachbild wird zu einem Bild in der Zeit: zu einer so instabilen wie wechselhaften Wahrnehmung, die in der Physiologie der Augen gegründet ist. Es gerät auf diesem Wege zu einem im buchstäblichen Sinne verkörperten Bild: zu einer visuellen Erscheinung, die bedingt ist von den spezifischen Eigenschaften des Auges, von seinen Müdigkeitserscheinungen, seinen Gewohnheiten und seinen Störungen – zu einem Bild also, das symptomhaft mit dem Körper verbunden ist, dem es entspringt. Sein Bezug zur Außenwelt ist so brüchig geworden, dass es zu einem Gutteil mit geschlossenen Augen zu betrachten ist. Im gleichen Zuge tritt das Nachbild in einen neuen 1. Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, Band 13, Spalte 30, Leipzig 1889. 2. Walter Benjamin: »Über einige Motive bei Baudelaire«, in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. I, Frankfurt/M. 1974, S. 605–654, hier: S. 631. 7 Carolin Meister Bereich des Wissens ein, ist nicht mehr nur Konzept der Ästhetik, sondern Untersuchungsobjekt einer schließlich wissenschaftspolitisch geförderten Physiologie. Es liegt auf der Hand, dass man in dieser Wendung jenen Paradigmenwechsel wiedererkennen kann, den Jonathan Crary in seinem Buch Techniken des Betrachters dargestellt hat: nämlich die Ablösung der Camera obscura als Modell des Sehens im frühen 19. Jahrhundert und die Verortung der Wahrnehmung in der menschlichen Physiologie.3 Horst Bredekamps Beitrag Sonnenlicht und Augenschmerzen fügt dieser Diagnose eine historische Nuance hinzu. Denn eine Untersuchung der Sonnenforschung im 17. Jahrhundert macht deutlich, wie der schmerzhafte Blick in die Sonne gerade dadurch vermieden wurde, dass die Camera obscura zum Einsatz kam. Erst die Umgehung des Auges durch die Camera obscura erlaubte das Studium des Lichts und ermöglichte es, die bei diesem Forschungsgegenstand unweigerlich auftretenden Nachbildeffekte zu eliminieren – mit anderen Worten: das Bild des Himmelskörpers von den Gespenstern des Auges zu unterscheiden und somit die Anschauung der Sonne von den Scheinbildern des Gesichtssinns loszulösen. Die Camera obscura ist hier als das bewährte Gehäuse zur Trennung von Innen und Außen im Einsatz, das es gestattet, unter Vermeidung eines direkten Blicks Bilder zu projizieren. Das 19. Jahrhundert hingegen schaut ohne apparative Umwege zu dem Gestirn empor. Was es mit der Kammer aufgibt, ist nicht allein die Isolierung des Betrachters von der sichtbaren Welt, sondern zugleich die Bündelung des Lichtes zu einem Träger visueller Information. Dies führt zu einer Erfahrung der Blendung und zur Schädigung zahlreicher Augenpaare. Es geht daraus aber auch ein neuartiges Verhältnis von Bild und Blick hervor, das sich – so Peter Bexte in seinem Beitrag Sonnenblicke und Augenlider – exemplarisch in William Turners Regulus inkarniert. Nachbilder sind seit dem 19. Jahrhundert also mit zwei Dingen zugleich verknüpft: mit der physiologischen Frage nach dem Sehen, ebenso wie mit der produktionsästhetischen Frage nach dem Bild. Für eine künstlerische Praxis, die die halluzinatorischen Effekte des Auges nicht länger verdrängt, sondern gerade für sich entdeckt, entsteht ein Milieu, in dem Mimesis und Sinnesphysiologie sich kreuzen. Ist die im Nachbild paradigmatisch aufleuchtende Bildlichkeit des Sehens einmal evident, steht darum nicht nur das Verhältnis von Subjekt und Objekt zur Disposition. Den Maler stellt dies vor ein grundlegendes Problem: Wie äußert sich die Eigenaktivität der Wahrnehmung im Bild? Jene ephemeren Augengespenster, die mit den Blicken umherschweifen, die Dunkelheit bevölkern und sich selbst den geschlossenen Augen präsentieren – sie alle behaupten die Untrennbarkeit von Bild und Blick. Anders gesagt: Das Nachbild stellt das Bild, welches es im Namen trägt, in Frage. In ihm verklammert sich darum eine 3. Jonathan Crary: Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996. 8 Einleitung Geschichte des Sehens und des betrachtenden Subjekts mit einer Geschichte des Bildermachens. Der vorliegende Band möchte ganz in diesem Sinne die bildgeschichtliche Relevanz der Eigenaktivität des Auges zur Diskussion stellen: Wie werden die inneren Sensationen des Gesichtssinns zu unterschiedlichen Zeiten in Bildern veräußerlicht? Auf welchen Wegen greift das subjektive Wahrnehmungserlebnis in die Praktiken der Bildkonstruktion ein? Welche Bildkonzepte tauchen mit der Entdeckung der schöpferischen Möglichkeiten des Sehens auf? Und wie wirkt sich die individuelle Farbproduktion im Auge innerhalb einer Geschichte des Nachbilds auf die Handhabung von Pigmenten, die Gestaltung von Environments aus? Es liegt auf der Hand, dass die im 19. Jahrhundert virulente Verknüpfung von Bild und Blick Konsequenzen für Bildproduzenten, aber auch für Kunstbetrachter hat. 1810 hält Goethe in seiner Farbenlehre den Dichotomien der idealistischen Philosophie den unentwirrbaren Zusammenhang zwischen Anschauung und Phänomen, Auge und Wirklichkeit entgegen. Sein Kapitel über die »physiologischen Farben« – jene chromatischen Erscheinungen, die »dem gesunden Auge angehören«4 – soll den Naturdenker und Experimentator wider Newton zur Adresse für Maler ebenso wie für Kunstliebhaber werden lassen. Denn die Farbenlehre birgt das Versprechen, zwischen dem Kolorit der Künstler und den physiologischen Eigenheiten des Auges zu vermitteln. Wie Annik Pietsch in ihrem Beitrag Augensinn und Farbenspiel ausführt, ist es gerade das Kapitel über die »physiologischen Farben«, das die Brücke zwischen bildnerischer Praxis und der Physiologie der Wahrnehmung schlägt. Denn hier stellt Goethe seine Farbharmonie auf wissenschaftlichen Grund – und zwar indem er sie aus den Gesetzen des Sehens herleitet. Die chromatische Logik der Nachbildeffekte kann so zum Leitfaden für eine künstlerische Handhabung von Farbe werden, die den Kontrasteffekten des Sehens in der Maltechnik Rechnung trägt. Die künstlerische Produktion versucht auf diese Weise – konkret: durch eine ausgefeilte Technik der Untermalung – die Gesetze des Blicks ins Bild zu integrieren. Aber auch für den Kunstliebhaber hält Goethes Farbenlehre seinerzeit ein Versprechen bereit: nämlich die Antwort auf ein Problem zu liefern, das den Malern nicht unbekannt war. Wo Goethes Forschung die Aufmerksamkeit für die Subjektivität der Wahrnehmung geweckt hat, da kann nicht ausbleiben, dass die Wandelbarkeit der Farbe je nach Lichtsituation vermehrt das Augenmerk der gebildeten Kunstfreunde auf sich lenkt. Im Dämmerlicht betrachtet, verschieben sich die Farbwerte von Gemälden beträchtlich – ein Umstand, der dazu führt, dass die Bilder selbst einen prekären Status erhalten, wie John Gage in seinem Beitrag Fliegende Farben zeigt. Denn zumindest in ihrer chromatischen Natur entziehen sie sich jeglicher Fixierung. Dass Goethe, auf diese Effekte hin befragt, nur eine maltechnische Erklärung liefert, erstaunt gerade deshalb, da er bekannt4. Johann Wolfgang Goethe: »Zur Farbenlehre« (1808–1810), in: ders.: Werke, Band XIII, Hamburg 1966, S. 325. 9 Carolin Meister lich den »physiologischen Farben« in seiner Farbenlehre besondere Bedeutung beimaß. Konfrontiert mit der instabil gewordenen Identität der Bilder, erkennt er nicht, was später der Chemiker Michel Eugène Chevreul entdeckt: Nämlich dass die unterschiedliche Wirkung von Farben keine chemischen Ursachen, sondern physiologische Gründe hat. Die Entdeckung Chevreuls situiert sich nicht zufällig in einem gänzlich anderen Umfeld. Frankreich verweigert Goethes Farbenlehre mit gutem Grund die Rezeption. Wie Jacques Le Rider gezeigt hat, liegt das nicht nur daran, dass Goethe Position gegen Newton bezieht.5 Der ansonsten viel gelesene Weimarer Klassiker hat mit seiner Farbenlehre für die Franzosen schlicht nichts grundlegend Neues zu bieten. Denn schließlich hatte die Farbwahrnehmung bereits im französischen Empirismus und Sensualismus des 18. Jahrhunderts die Subjektivität des Sehens erschlossen – wovon die Schriften eines Comte de Buffon ebenso zeugen wie der Eintrag zum Stichwort »Farbe« in der Enzyklopädie. Es nimmt darum nicht wunder, dass gerade in Frankreich eines der bekanntesten Kapitel im kunstgeschichtlichen Zusammenspiel von Mimesis und Physiologie geschrieben wurde. Den Grundpfeiler für dieses Zusammenspiel legt im Jahr 1839 der besagte Chevreul mit einer Kontrastlehre, welche die noch von Goethe behauptete Differenz zwischen physiologischen und physikalischen Farben in Wohlgefallen auflösen sollte. In der Pariser Gobelin-Manufaktur vor das Pro­ blem gestellt, die unterschiedlichen Erscheinungsformen schwarzen Garns im Verbund mit anderen Farben zu erklären, gelangt er zu dem Schluss, dass das Problem chemisch überhaupt nicht zu lösen, sondern in der Physiologie der menschlichen Wahrnehmung begründet ist. Um seiner Entdeckung Rechnung zu tragen, versucht Chevreul in der Schrift De la loi du contraste simultané des couleurs,6 die physiologischen Effekte in der Anschauung von Farben systematisch darzulegen. So begründet er im wohl folgenreichsten Gesetz zum Komplementärkontrast die wechselseitige Steigerung der Intensität von Komplementärfarben mit der Wirksamkeit von Nachbildeffekten in der Farbwahrnehmung. Demgemäß kommt in den Komplementärkontrasten, wie Max Imdahl eindringlich resümiert, »dem Auge die Summe seiner eigenen Tätigkeit als Realität entgegen«.7 Die in der Kontrastlehre Chevreuls manifeste Einmischung subjektiver Physiologie in die Farbwahrnehmung wirft – wie Georges Roque in seinem Beitrag Das Universum der Empfindungen aufzeigt – die Frage nach dem Gegenstand künstlerischer Nachahmung auf. Folglich gilt es nicht länger zu malen, was man vor Augen hat, sondern die Aktivität des Auges bei der Farbgebung mit zu berücksichtigen. Es ist der Physiker und Physiologe Hermann von Helmholtz, der in 5. Jacques Le Rider: »La non-réception de la ›Théorie des couleurs‹ de Goethe«, in: Revue germanique internationale, n° 13, Janvier 2000, S. 169–186. 6. Michel-Eugène Chevreul: De la loi du contraste simultané des couleurs, Paris 1839; Vorwort, S. VIII (Die Farbenharmonie in ihrer Anwendung bei der Malerei, bei der Fabrication von farbigen Waaren jeder Art, Stuttgart 1840). 7. Max Imdahl: Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich, München 2003, S. 95. 10 Einleitung seinem auch in Frankreich viel gelesenen Beitrag Optisches über Malerei (1871– 1873) die Aufgabe der Kunst folgendermaßen formuliert: »Es sind nicht die Körperfarben der Objekte, sondern es ist der Gesichtseindruck, den sie gegeben haben oder geben würden, so nachzuahmen, dass eine möglichst deutliche und lebendige Anschauungsvorstellung von jenen Objekten entsteht.«8 Die Effekte des Augenlichtes werden nun in die Darstellung der Welt eingetragen. Der Reiz, dem schon Kant die Farbe zuschlug, ist zum physiologischen Reiz geworden, während die Bilder – etwa eines Seurat – sich als Imitationen nicht des Sichtbaren, sondern der retinalen Reizung verstehen. Es ist ein weiterer Schritt, der gleichwohl in der zentralen Bedeutung gründet, die den Wahrnehmungsphänomenen bei Chevreul und Helmholtz zukommt, die Unabhängigkeit der visuellen Empfindung von einem äußeren Pendant zu erkennen. Wenn einmal festgestellt ist, dass chromatische Sensationen keiner externen Farbwahrnehmung zum Anlass bedürfen und etwa durch Manipulationen der Augäpfel selbst erzeugt werden können, dann wird das Verhältnis zwischen visueller Wahrnehmung und Außenwelt als willkürliches denkbar. Für Physiologen wie Gustav Fechner oder Johannes Müller eröffnet diese Lockerung zwischen Wahrnehmungsbild und Weltbezug das Terrain zu einer experimentellen Erforschung des Sehens, die losgelöst vom Bezug auf gegebene Wahrnehmungsinhalte die Reizmuster des Auges testet. Die Möglichkeit einer Erfassung der visuellen Empfindung in Zahlen, die von Jan Evangelista Purkinje systematisch vorangetrieben wird, ist eine Ausgeburt jener bildnerischen Produktivität der Wahrnehmung, welche die äußere Wirklichkeit als fixe Referenz buchstäblich aus den Augen verloren hat. Es ist Helmholtz, der die Konsequenzen dieses gekappten Bezugs hinsichtlich der Wirkung und der Produktion von Bildern bedenkt. Wie Georges Roque zeigt, vollzieht er den entscheidenden Übergang von einem Bildkonzept, das auf den Gesichtseindruck gründet, zu jenem, das die Nachahmung von Natur durch die Übersetzung von Empfindungen ersetzt. Der Entzug der Wirklichkeit als stabiles Bild, den die unhintergehbare Einmischung der Physiologie in alles Wahrnehmbare forciert, kann auf diesem Weg zu einer Abkehr von der mimetischen Aufgabe der Kunst führen – und mithin zum Argument für ihre Ungegenständlichkeit werden. Das komplexe Feld, das sich hier zwischen äußerem Gegenstand und innerem Nachbild, zwischen dem Objekt der Außenwelt und der subjektiven Bildproduktion des Auges auftut, hat nicht allein eine Neuformulierung der künstlerischen Aufgabe provoziert. Die Aufmerksamkeit auf die Bildlichkeit der visuellen Wahrnehmung selbst führt dazu, dass sich das Sehen nach und nach von der Wirklichkeit emanzipiert und Autonomie erlangt. Im gleichen Zuge mit der physiologischen Verortung der Wahrnehmung wird man auch der Temporalität des Sehens gewahr: nämlich der Fortdauer des Nachbildes auf der Netzhaut. Mit der Disso8. Hermann von Helmholtz: »Optisches über Malerei« (1871–1873), in: Vorträge und Reden, Bd. 2, Braunschweig 41896, S. 93–135, hier S. 125. 11 Carolin Meister ziation von Bild und Welt tritt eine temporale Disjunktion zwischen Stimulus und Sinnesempfindung auf den Plan, welche die spezifische Zeitlichkeit des Nachbildes ausmacht – eines Bildes, das die Augen auch nach Verlöschen der Reizquelle noch eine gute Weile mit sich tragen. Es sind die Physiologen, die diese »Beharrlichkeit des Seheindrucks« experimentell testen, und allen voran Joseph Plateau, einer jener Forscher, die aufgrund zahlreicher Selbstexperimente schließlich den Gegenstand ihrer Recherche, das Augenlicht, verloren. Die Beschäftigung mit dem Fortwirken der visuellen Erscheinung auf der Retina ist die Voraussetzung für ganz verschiedenartige Entwicklungen. Die bekannteste von ihnen ist das Kino. Denn die Andauer des Gesichtseindrucks ist die Bedingung für die Möglichkeit optischer Bewegungsillusion, welche die kinematographische Wahrnehmung vorwegnimmt: Allein das Nachbild des Gesehenen erlaubt es, einzelne Bilder in schneller Folge zum Eindruck von Bewegung zu synthetisieren. Die Trägheit der Netzhaut liefert damit die physiologische Voraussetzung für die Zusammensetzung eines dynamischen Bildes aus einzelnen Sequenzen. Auch hier wird die Kluft zwischen dem wahrgenommenen Effekt (Bewegung) und dem tatsächlichen Ausgangsbild (einer Folge statischer Bilder) thematisch, welche das illusionäre Potenzial des Sehens unmittelbar erfahrbar macht. Wider besseren Wissens erscheint im Zoetrop ein galoppierendes Pferd und nicht die bewegungslose Sequenz seiner Einzelbilder. Dies gilt für optische Geräte zur Erzeugung bewegter Bilder, aber auch für die Beobachtung neuer Bewegungsformen wie mechanischer Räder und Ähnlichem. Als wechselseitige Durchdringung von Gegenwart und Vergangenheit kann das Nachbild aber auch zum Paradigma des Sehens an sich werden – und zwar insbesondere seiner immanenten Zeitlichkeit. Wie Wilhelm Roskamm in seinem Beitrag Vom Nachbild zum virtuellen Bild darlegt, geschieht genau dies in der Wahrnehmungstheorie Henri Bergsons, dessen vehemente Kritik an den Grundannahmen der Psychophysik bekannt ist. Nicht umsonst stellen Bergsons Überlegungen auch bei Gegenwartskünstlern wie Olafur Eliasson eine wichtige Quelle für künstlerisches Arbeiten mit Nachbildern dar. Als visuelle Erscheinung des soeben Vergangenen besteht das Nachbild auf der Netzhaut fort und kann somit beispielhaft für das Konzept einer Wahrnehmung figurieren, die sich aus der Überlagerung von aktuellen Eindrücken und Erinnerungsbildern zusammensetzt. Im Nachbild kann somit die Funktionsweise der Wahrnehmung, wie Bergson sie versteht, anschaulich werden: und zwar als Interferenz von gegenwärtigem und vergangenem, von aktuellem und virtuellem Bild. Dass man Robert Delaunays Arbeit an den formes circulaires durchaus in diesem Zusammenhang sehen kann, zeigt Michael F. Zimmermann in seinem Beitrag Nach-Denk-Bilder. In den scheibenförmigen Arbeiten der Jahre 1912–13 verdichten sich der Anblick der Sonne und ihr retinales Nachbild zu einer vibrierenden Formation. In ihr hallen nicht nur diverse Motive aus dem Werk Delaunays nach, sondern auch der Farbenkreis, jenes farbtheoretische Diagramm, das – erstmals von Newton verwandt – den Ganzheitsanspruch zahlreicher Farblehren symbolisiert. In der motivischen Korrespondenz von Sonne/ Nachbild/Farbenkreis wird der Versuch des Künstlers deutlich, die Wahrneh- 12 Einleitung mung selbst zu aktivieren. Denn der gezielte Einsatz des Simultankontrasts, wie ihn Chevreul in seiner Lehre publiziert hatte, verhindert eine endgültige Fixierung des Gesehenen. Stattdessen werden über die verschiedenen Kontrastwirkungen scheinbare Bewegungen erzeugt, bei denen die Wahrnehmung sich selbst in ihren Rhythmen und dynamischen Kräften erfährt. Die schon von den Farbenlehren des 19. Jahrhunderts favorisierte Form des Kreisdiagramms liefert dabei das Grundmuster eines Übergangs vom Kreis zum Kreisen, bei dem man nicht zuletzt an die experimentelle Konstruktion von Farbkreiseln etwa bei Goethe denken mag. Der sich hier ankündigende Statuswandel eines Bildes, das schon in Delaunays formes circulaires weniger als sichtbares Ding denn als Armatur für ein selbsttätiges Sehen in Erscheinung tritt, ist wegweisend für den Einsatz von Nachbild­ effekten in der künstlerischen Praxis des 20. Jahrhunderts. Nicht umsonst tauchen im Kontext der bildenden Künste nun – vom Farbkreis über die rotierende Scheibe bis zur farbigen oder schwarz-weißen Kontrasttafel – die verschiedenartigsten Grundmuster auf, mit denen bereits in den vergangenen Jahrhunderten die generativen Kapazitäten des Auges getestet wurden. Darum erneut ein Blick zurück. Die Produktion von Nachbildern durch eigens hergestellte Bildvorlagen ist seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Schon das zu dieser Zeit gerade aufkeimende Interesse für visuelle Phänomene, die nicht unter die Gesetze der Physik zu subsumieren sind, führt dazu, dass die unterschiedlichsten kolorierten oder unbunten Tafeln für die physiologische Erzeugung von Licht- und Farberscheinungen erdacht werden. Ulrike Boskamps Beitrag Nachbilder, nicht komplementär liefert eine Art Typologie dieser frühen Illustrationen zum Zwecke der Nachbilderzeugung, deren Autoren stets die Spannung zwischen Physik und Physiologie auszuloten haben. Dass die experimentelle Erforschung von Nachbildern jedoch nicht nur zu jener Subjektivierung der Wahrnehmung hinführt, die erst das 19. Jahrhundert vollziehen wird, zeigt Rebekka Ladewig in ihrem Beitrag Augenschwindel. Denn Versuche mit Nachbildern konnten auch im Kontext der Experimentalisierung des Schwindels Bedeutung erlangen, welche »vertiginous philosophers«9 wie William Charles Wells und Erasmus Darwin vorantrieben. Werner Buschs Postskriptum Stille Post dagegen entdeckt in den Reproduktionstechniken des 18. Jahrhunderts eine Vorgeschichte des physiologischen Nachbildes. Um 1800 tritt das Nachbild dann, wie Peter Bexte schreibt, »ins Zeitalter seiner technischen Produzierbarkeit«.10 Mit der aufkommenden Physiologie werden aus Augentäuschungen, die vormals die Erforschung der Wahrnehmung nur störten, jene Phänomene, durch die sich das Sehen vermessen bzw. normieren lässt – und mit ihm das Subjekt. Die im 19. Jahrhundert virulente Verankerung der Bilder im Auge bringt Darstellungen und Apparate hervor, die sich explizit als bloße Armaturen für eine »perzeptuelle Gymnastik« (Umberto Eco) zu erken9. Zitiert nach Rebekka Ladewig in diesem Band. 10. Siehe Peter Bexte in diesem Band. 13 Carolin Meister nen geben. Die experimentellen und unterhaltsamen Arrangements dieser Zeit führen einen Verlust vor Augen, den jedes Nachbild seinem Erzeuger evident macht: nämlich die grundlegende Ortlosigkeit der Bilder. Was einmal auf einem Träger fixiert war, löst sich jetzt von jeder materiellen Grundlage, schwebt – wie im Stereoskop – als virtuelle Erscheinung im unbezeichneten Zwischenraum zwischen zwei Bildvorlagen oder schweift mit dem unsteten Blick über die Wände.11 Bildermacher wie Künstler, Schildermaler oder Tapetenhersteller tragen dem Rechnung, indem sie versuchen, die Effekte der Physiologie in ihre Produktion zu integrieren. Es ist genau dieser Aspekt einer Bildlichkeit, die sich der Verdinglichung entzieht, der im Kontext der Kunst der 1960er Jahre das Nachbild wieder interessant macht. Verschiedene Künstler knüpfen durch den gezielten Einsatz von optischen Irritationen und Reizen, welche die physiologischen Effekte der Wahrnehmung einspielen, an zentrale Themen ihrer Zeit an: sei es die Kritik an der ­Dinghaftigkeit bzw. Warenförmigkeit des Kunstwerks, das Aufbrechen der Sub­ jekt-Objekt-Struktur durch Formen der Betrachterbeteiligung oder die Allianz von Kunst und Wissenschaft. Es sind die Op-Art und die an den Schnittstellen zwischen perzeptuellen, kinetischen und psychedelischen Ansätzen entstehenden künstlerischen Praktiken, welche die Effekte des Nachbilds für sich entdecken. Wie Pamela M. Lee in ihrem Beitrag Bridget Rileys Auge/Körper-Problem anhand der Rezeption des Werks von Riley zeigt, ist die Op-Art dabei von einer immanenten Spannung gekennzeichnet: Ihrer vorgetragenen Technizität, die mit Be­ zugnahmen insbesondere auf die Kybernetik kokettiert, steht die Adresse ihrer Wirkung gegenüber, welche die Physis des Betrachters ist. Denn in ihren Effekten erzielen die abstrakten Kompositionen der Op-Art eine Transgression des Sehens in Richtung auf das Nervensystem. Die durch optische Täuschung hervorgebrachten Phänomene scheinbarer Bewegung – Flimmern, Pulsieren etc. –, die Rileys Schwarzweißbilder aus den 1960er Jahren kennzeichnen, machen die Instabilität des Sichtbaren weniger reflexiv zugänglich, als dass sie durch retinale Reizung physische Wirkungen von möglicherweise irritierendem Ausmaß verursachen. Die Frage, was Sehen ist, wird hier im Körper des Betrachters beantwortet und hintergeht somit jede Möglichkeit der Kritik, sofern diese eine reflexive Distanz voraussetzt. Dass dieser Körper in der Rezeption nicht nur des Werks von Riley eine weibliche Genderzuschreibung erfährt, legt Lee auch mit Blick auf die so erfolgreiche Übernahme von patterns der Op-Art in Mode und Populärkultur dar. Die Erschütterung der Sinnlichkeit des Betrachters durch optische Reizmuster, die den Gesichtssinn überfordern und zu starken physischen Reaktionen führen, wird deutlicher, wenn man sich die installativen Praktiken und Environments der optisch-kinetischen und psychedelischen Kunst anschaut. Wie Matthieu Poirier in seinem Beitrag »Attentate auf den Sehnerv« zeigt, der eine breite Übersicht 11. Vgl. hierzu erneut Crary: Techniken des Betrachters, a.a.O. 14 Einleitung über derartige Ansätze in den 60er Jahren liefert, tritt das Nachbild hier nicht im Dienst, sondern als Antipode kinematographischer Illusion auf den Plan: Nicht länger Ermöglichung des Bewegungseindrucks, sondern vielmehr Überwältigung des Auges, sorgt die Multiplikation von Nachbildeffekten, wie sie etwa in flickerFilmen eingesetzt wird, für heftige körperliche Symptome wie Schwindel oder Orientierungsstörungen. Der sinnliche Zugriff auf das Sichtbare wird hier weniger mit einer Subjektästhetik beantwortet, als mit einer Entmächtigung des Subjektes, das die Grenzen seines visuellen Weltbezugs erfährt. In den 70er Jahren ist es dann James Turrell, der mit seinen Dark Pieces und Ganzfeld-Arbeiten dem Betrachter den vollständigen Zusammenbruch jeder Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung zumutet. Die Besucher, die im Jahr 1976 durch seine Installation City of Arhirit im StedelijkMuseum in Amsterdam taumeln und bedrängt von den Nachbildern ihrer Augen die Orientierung verlieren, werden Zeuge dessen, was Hans-Christian von Herrmann »ästhetische Urszene des 20. Jahrhunderts« genannt hat: »nicht der Blick durch ein Fenster, sondern das Eingetauchtsein in einen undurchdringlichen Nebel.«12 Durch die Multiplikation von Nachbildern ist das Sehen in dieser Folge von Ganzfeldern, in die Turrell das Stedelijk-Museum verwandelt hat, zu einem Prozess geworden, in dem das Subjekt sich nicht entdeckt, sondern verliert. Das Nachbild ist hier nicht das Argument für eine Subjektivierung des Sehens, das es noch bei Goethe oder Schopenhauer war; indem es seinen Betrachter und Erzeuger klarer Grenzen und jeder räumlichen Orientierung entledigt, wird es vielmehr zu einem Faktor, der das Subjekt vehement in Frage stellt. Neuerdings ist es Olafur Eliasson, der in seinen Lichtinstallationen die Augengespenster wieder freilässt, die dem 19. Jahrhundert das autonome Sehen gleichermaßen wie seine physiologische Standardisierung erschlossen haben. Jonathan Crary zieht in seinem Beitrag Your colour memory nicht nur eine Linie, die von Goethe und den Romantikern über Turner zu Eliasson verläuft. Er sieht in diesen jüngsten künstlerischen Verwendungen des Nachbildes die Möglichkeit angelegt, die körperliche Natur des Sehens zu aktivieren. Wenn Eliasson heute in seinen Lichtinstallationen die schöpferischen Potenziale des Körpers erkundet, dann stellt er auch jene Standardisierung der Farbe in Frage, die mit der Digitalisierung nur eine weitere Stufe erreicht zu haben scheint. Seine künstlerischen Versuchsanordnungen laufen dabei parallel zur Erforschung des Farbensehens in der Neurobiologie. Auch diese präsentiert Farben als je individuelle Produkte des Gehirns und weist dabei erstaunliche Ähnlichkeiten mit Goethes Farbenlehre auf. Mit Eliasson tritt das Nachbild im jüngsten Kapitel zum Gedächtnis des Auges in der Kunst erneut mit einer Emphase auf den Plan, die den Körper als Grundlage der visuellen Erfahrung adressiert: nicht, um die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung auszuloten, sondern um gerade heute ihre Potenziale freizusetzen. 12. Hans-Christian von Herrmann: »Sensing Spaces. James Turrells helle Kammern«, in: Helmar Schramm u.a. (Hg.): Bühnen des Wissens: Interferenzen zwischen Wissenschaft und Kunst, Berlin 2003, S. 339–363, hier: S. 351. 15