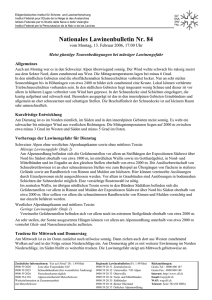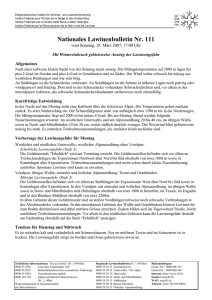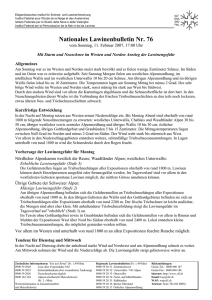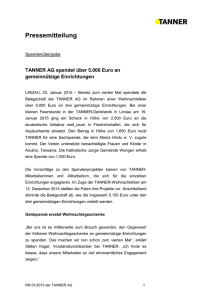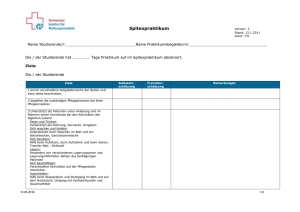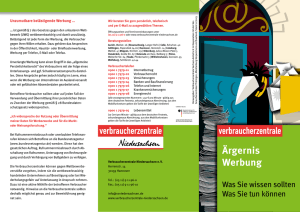Referat - Palliative Aargau
Werbung
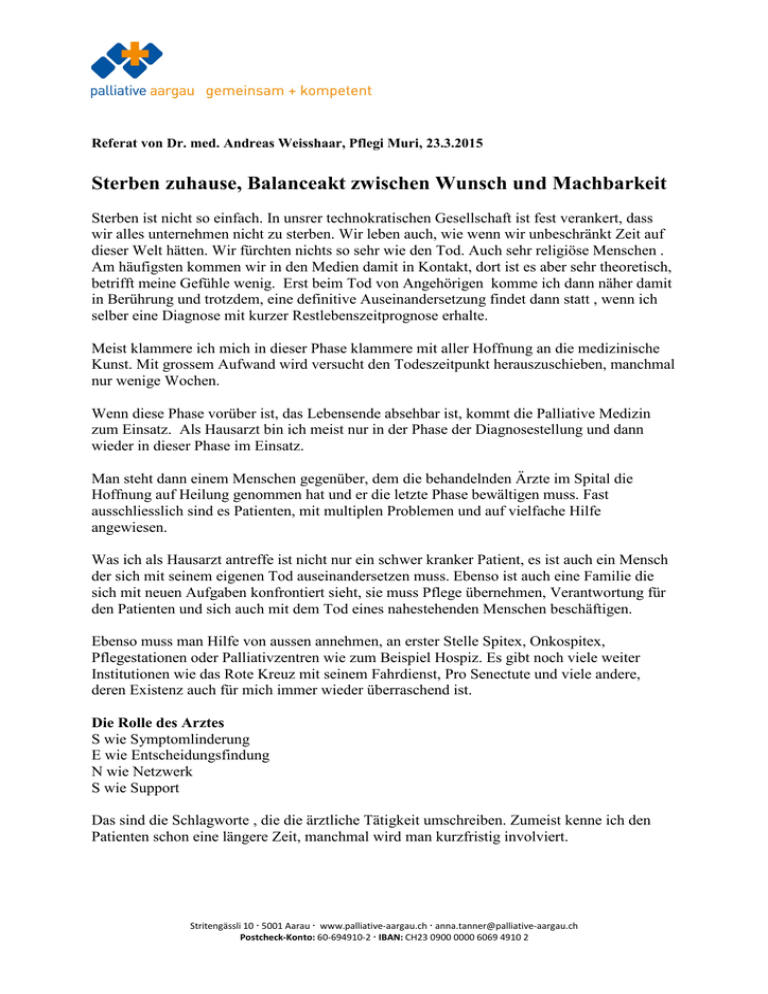
Referat von Dr. med. Andreas Weisshaar, Pflegi Muri, 23.3.2015 Sterben zuhause, Balanceakt zwischen Wunsch und Machbarkeit Sterben ist nicht so einfach. In unsrer technokratischen Gesellschaft ist fest verankert, dass wir alles unternehmen nicht zu sterben. Wir leben auch, wie wenn wir unbeschränkt Zeit auf dieser Welt hätten. Wir fürchten nichts so sehr wie den Tod. Auch sehr religiöse Menschen . Am häufigsten kommen wir in den Medien damit in Kontakt, dort ist es aber sehr theoretisch, betrifft meine Gefühle wenig. Erst beim Tod von Angehörigen komme ich dann näher damit in Berührung und trotzdem, eine definitive Auseinandersetzung findet dann statt , wenn ich selber eine Diagnose mit kurzer Restlebenszeitprognose erhalte. Meist klammere ich mich in dieser Phase klammere mit aller Hoffnung an die medizinische Kunst. Mit grossem Aufwand wird versucht den Todeszeitpunkt herauszuschieben, manchmal nur wenige Wochen. Wenn diese Phase vorüber ist, das Lebensende absehbar ist, kommt die Palliative Medizin zum Einsatz. Als Hausarzt bin ich meist nur in der Phase der Diagnosestellung und dann wieder in dieser Phase im Einsatz. Man steht dann einem Menschen gegenüber, dem die behandelnden Ärzte im Spital die Hoffnung auf Heilung genommen hat und er die letzte Phase bewältigen muss. Fast ausschliesslich sind es Patienten, mit multiplen Problemen und auf vielfache Hilfe angewiesen. Was ich als Hausarzt antreffe ist nicht nur ein schwer kranker Patient, es ist auch ein Mensch der sich mit seinem eigenen Tod auseinandersetzen muss. Ebenso ist auch eine Familie die sich mit neuen Aufgaben konfrontiert sieht, sie muss Pflege übernehmen, Verantwortung für den Patienten und sich auch mit dem Tod eines nahestehenden Menschen beschäftigen. Ebenso muss man Hilfe von aussen annehmen, an erster Stelle Spitex, Onkospitex, Pflegestationen oder Palliativzentren wie zum Beispiel Hospiz. Es gibt noch viele weiter Institutionen wie das Rote Kreuz mit seinem Fahrdienst, Pro Senectute und viele andere, deren Existenz auch für mich immer wieder überraschend ist. Die Rolle des Arztes S wie Symptomlinderung E wie Entscheidungsfindung N wie Netzwerk S wie Support Das sind die Schlagworte , die die ärztliche Tätigkeit umschreiben. Zumeist kenne ich den Patienten schon eine längere Zeit, manchmal wird man kurzfristig involviert. Stritengässli 10 5001 Aarau www.palliative-aargau.ch [email protected] Postcheck-Konto: 60-694910-2 IBAN: CH23 0900 0000 6069 4910 2 Symptomlinderung vor allem bei Schmerz, Angst, Schlechtsein und Verstopfung. Die Behandlung gehört zum medizinischen Handwerk, stellt meist kein grösseres Problem dar. Schmerzen sollten auf ein erträgliches Mass reduziert werden, wobei die Schmerzschwelle ganz verschieden sein kann. Manche tolerieren Schmerzen sehr gut, wollen lieber Schmerzen aushalten statt Medikamente einzunehmen, andere beinträchtigen auch leichte Schmerzen derart, dass sie lieber die Nebenwirkungen der Medikamente inkaufnehmen. Die bekanntesten Schmerzmittel sind Opiate diese setzt man in der Palliativsituation häufig ein, da das subjektive Empfinden höher gewertet wird als die Nebenwirkungen. Opiate haben auch den Vorteil, dass sie in verschiedenen Darreichungsformen vorliegen und sehr gut dosierbar sind. Es gibt Systeme die durch die Haut die Substanzen abgeben, daneben Tropfen, Langwirkende Tabletten und Spritzen in jeder Form. Neben der Schmerzstillenden Wirkung tritt als Nebenwirkung Beruhigung und Müdigkeit auf, manchmal werden diese Nebenwirkungen bewusst eingesetzt. Übelkeit tritt als vegetatives Zeichen auch als Tumornebenwirkung oder als medikamentöser unerwünschter Effekt auf. Neben den einfachen Mitteln, die wir auch als Gesunder bei Übelkeit oder Seekrankheit einnehmen, werden dort Neuroleptika, Medikamente aus der Schizophreniebehandlung mit gutem Erfolg eingesetzt. Schwieriger wird es beim Symptom der Atemnot, da sind die Grenzen des Machbaren auch für den Arzt oftmals erreicht. Sie ist für Patient und Umgebung am schwersten zu ertragen, Sauerstoffdauertherapie und auch wieder Opiate werden als Therapie eingesetzt. Die Entscheidungsfindung hat meist auch schon im Spital stattgefunden, das Netzwerk ist teilweise auch aufgebaut. Meine Rolle ist dann die Unterstützung zu gewährleisten. Verordnung von Medikamenten, Ausfüllen von Zeugnissen und Verordnungen. Wenn man langfristig der Hausarzt war, besteht auch in dieser Phase durch Konsultationen und später Hausbesuche ein intensiver Kontakt, die Bedürfnisse des Patienten und der Familie können gut erfasst werden. Es ist meist eine intensive Zeit, aufwändige Zeit, aber durch die Vertrautheit eine besonders wertvolle Zeit. Häufig wird man von Seiten des Patienten wie auch von Seiten der Angehörigen in die ganze Lebensgeschichte und Lebensphilosophie miteinbezogen. Schwieriger ist es wenn eine Institution dazwischen geschaltet ist, wie die Spitex zum Beispiel, die Problemstellungen übermittelt, man nicht spüren kann, sind es die Bedürfnisse des Patienten der Angehörigen oder der Spitex. Zur Entscheidungsfindung gehört vor allem auch die Wahl des Sterbeortes.75 % der Menschen in der Schweiz würden gerne zuhause sterben laut einer BAG Umfrage von 2009. Zuhause bedeutet, der Ort wo ich mich wohlfühle, wo die Menschen sind, die mir etwas bedeuten. Es ist aber auch der Ort, wo ich auf Hilfe sowohl der eigenen Familie wie auch Fremden angewiesen bin. Es kann für mich eine Belastung sein, auf meine Familie angewiesen zu sein. Ich kann auf 24Stunden Hilfe angewiesen sein aus medizinischen Gründen. Meine Symptome und die Hilflosigkeit können zur Belastung der Familie werden, insbesondere wenn die Hilfe rund um die Uhr notwendig ist. In einer Institution ist die Hilfe 24Stunden vor Ort, die Hemmungen Hilfe zu beanspruchen ist geringer. Gerade bei Patienten mit Angst eine wichtige Komponente Stritengässli 10 5001 Aarau www.palliative-aargau.ch [email protected] Postcheck-Konto: 60-694910-2 IBAN: CH23 0900 0000 6069 4910 2 Für die Familie sieht das Spannungsfeld entgegengesetzt gleich aus, ich möchte dem Kranken gerne seinen Wunsch zuhause sterben ermöglichen, muss auch fremde Hilfe annehmen können. Ich lerne meine persönlichen Grenzen kennen, kann in eine Überforderungssituation geraten. Ein ganz wichtiges Element ist auch die Wohnungssituation, hat es unüberwindbare Hindernisse wie Treppen in der Wohnung oder zur Wohnung, kleines Badezimmer etc. Die persönlichen Grenzen zeigen sich beim Menschen häufig in Form von Aggression. Man ist aggressiv auf den Patienten, weil er so viel Arbeit macht, auf den Arzt, weil er die Situation nicht im Griff hat, auf die Spitex, weil sie zu viel fordert oder es nicht genauso macht wie man es selber will. Kurze Zeit später hat man ein schlechtes Gewissen, weil es der Kranke ja nicht verdient hat. Ganz wichtig ist, dass man von Anfang an ein Netz aufbaut, das diese Situationen abfangen kann. Wenn die Palliativsituation mehrere Monate anhält, brauchen die Angehörigen zum Beispiel einen Ferienpflegeplatz, um sich selber erholen zu können. Wenn die Pflege über die gewohnte Tageszeit hinausgeht, braucht man von Familie oder Institutionen eine zeitliche Unterstützung. Man hat auch weiterhin Recht auf eigene freie Zeit. Je besser das Netz aufgestellt ist, umso länger kann man den Kranken zuhause betreuen. Auch beim stärksten Netz, der stärksten betreuenden Person, kann man die Grenze des Machbaren erreichen. Die Überweisung in ein Akutspital, Pflegeheim oder Hospiz kann notwendig sein. Es sind nicht nur die Angehörigen, die an die Grenzen kommen können, genauso kann die Spitex mit einer Situation überfordert sein. Der Übergang von Heimpflege in eine institutionelle Pflege ist psychisch oft belastend, teilweise liegen Versprechen vor, den Patienten zuhause sterben zu lassen, die nun nicht mehr erfüllt werden können. Es braucht oft die richtigen Worte, um die Emotionen zu glätten. Zum Schluss noch eine kleine Episode aus meiner Praxis zu diesem Thema. Vor Jahren wurde ich vom Uni Spital Zürich angefragt, ob ich bei einem aus-therapierten Leukämiepatient die Sterbebegleitung machen würde, da er nach Rudolfstetetten zügeln würde. Ich habe ihn dann besucht, er war in einem terminalen Zustand, hohe Dosen Opiate, trotzdem mit Schmerzen, konnte sich nur im Rollstuhl fortbewegen. Seine erste Frage nach der üblichen Begrüssung war, ob er wieder gesund werden würde. Sie können sich vorstellen, dass dies eine akute Stressreaktion bei mir hervorrief, einerseits dachte ich ja, er sei über seine Prognose informiert und andrerseits ihm an den Kopf zu werfen, dass er innert kürzester zeit sterben würde, das konnte ich auch nicht über mein Herz bringen. Jemandem die Hoffnung zu zerstören kann ich nicht, jemanden zu betrügen aber genauso wenig. Mein spontaner Ausweg war, das ich ihm erklärte, gesund sein, sei kein fest definierter Zustand, sondern das best möglich erreichbare im aktuellen Normalzustand. Ich könne ihm also nicht sagen, ob er in einem Monat noch lebe, aber wenn er mit seinen aktuellen Möglichkeiten richtig umgeht, dann kann er einen gesunden Zustand erreichen. Irgendwie scheine ich ihn erreicht zu haben, ich habe auf jeden Fall eine Woche lang nichts gehört, als ich ihn nach mehreren Versuchen erreichte und besuchte, traf ich einen völlig veränderten Patienten, immer noch im Rollstuhl, aufgestellt, und er hatte fast alle Opiate abgesetzt, da die Schmerzen massiv rückläufig seien. Er erzählte von Shopping Center Stritengässli 10 5001 Aarau www.palliative-aargau.ch [email protected] Postcheck-Konto: 60-694910-2 IBAN: CH23 0900 0000 6069 4910 2 besuchen, von Einladungen mit Freunden. Ich denke er hatte es geschafft im Rahmen seiner Möglichkeiten gesund zu werden. 2 Wochen später ist er in einer Nacht eingeschlafen und nicht mehr erwacht. ©Dr. med. Andreas Weisshar, 23.3.2015 Stritengässli 10 5001 Aarau www.palliative-aargau.ch [email protected] Postcheck-Konto: 60-694910-2 IBAN: CH23 0900 0000 6069 4910 2 Stritengässli 10 5001 Aarau www.palliative-aargau.ch [email protected] Postcheck-Konto: 60-694910-2 IBAN: CH23 0900 0000 6069 4910 2