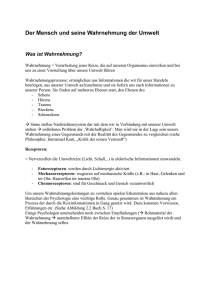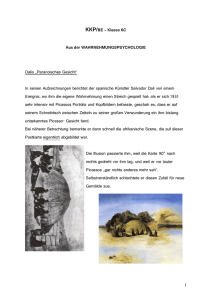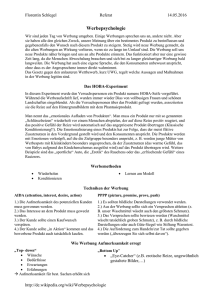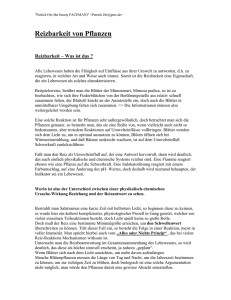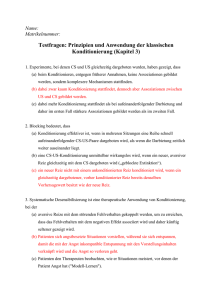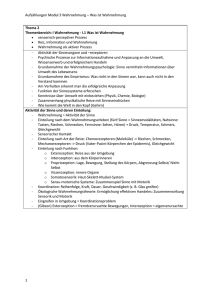Untitled - Logo IAW RWTH Aachen
Werbung

Aus ca. 80 verschiedenen Instrumenten, Anzeigen und Kontrollleuchten müssen Flugzeugpiloten alle relevanten Informationen für Stabilisierung, Führung, Navigation usw. registrieren und verarbeiten. Beim ersten Motorflug der Gebrüder Wright standen lediglich drei Instrumente zur Verfügung, nämlich ein Tachometer, ein Anemometer sowie ein Chronometer. Auch bei modernen Flugzeugen erhält der Pilot seine Informationen primär über den visuellen Kanal. Auditive Zeichen dienen bisher lediglich der Aufmerksamkeitserregung. Durch diese Vielzahl einströmender Reize kann es zu einer Reizüberflutung kommen. Es werden ggf. nicht alle Signale wahrgenommen und es besteht die Gefahr, dass der Pilot in kritischen Situationen nicht richtig reagiert. Nach Statistiken ist in ca. 70-90% der Unfälle im Zusammenhang mit technisch komplexen Transportmitteln menschliches Versagen die zentrale Ursache. Im Flugverkehr liegt die Quote bei ca. 70%, im Schiffsverkehr sogar bei über 90%. Störfälle in Kernkraftwerken sind in 1015% der Fälle auf menschliche Fehler zurück zu führen. Daher muss der ergonomischen Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle sowie der Mensch-Maschine-Umwelt-Interaktion besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden (siehe Schlick et al. 2010, 949ff). Zur zielgerichteten Informationsübertragung von einer technischen Einrichtung zum Menschen werden Anzeigen eingesetzt, die Hinweise auf die Zustände der verwendeten Maschinen, Anlagen und Apparate geben sowie die damit verbundenen Arbeitsobjekte und Prozesse darstellen. Darüber hinaus nimmt der Mensch weitere Informationen über den Systemstatus (z.B. Maschinengeräusche, -schwingungen und -gerüche) über seine Sinnesorgane unmittelbar also nicht technisch vermittelt - wahr. Die Informationsübertragung vom Menschen zur Maschine erfolgt durch sog. Eingabegeräte der Mensch-Maschine-Schnittstelle, die der Mensch durch gezielte Handlungen oder sein natürliches Verhalten, z.B. in Form von HandBewegungen, benutzt. Die Gestaltung beider Komponenten sowie ihr Zusammenwirken im Aufgabenkontext hat großen Einfluss auf die schnelle und fehlerfreie Mensch-MaschineInteraktion. Anhand des Paradigmas des Informationsumsatzes lassen sich die drei Phasen Informationsaufnahme (sog. Frühe Prozesse), Informationsverarbeitung (sog. zentrale Prozesse) sowie Informationsgenerierung durch motorische Funktionen (sog. späte Prozesse) differenzieren. Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht beziehen sich die frühen Prozesse in erster Linie auf die Entdeckung von informationstragenden optischen und akustischen Signalen im Arbeitssystem und adaptives Filtern dieser Signale vom „Hintergrundrauschen“. Die zentralen Prozesse beinhalten das Erkennen und Identifizieren der Signalbedeutung und die darauf aufbauenden Entscheidungsprozesse zur Urteilsbildung und Konsequenzbewertung. Die späten Prozesse „formen“ schließlich das manipulative und kommunikative Handeln und beinhalten u.a. die Organisation und Regelung von Bewegungen. Die Wahrnehmung ist die erste Phase des Informationsumsatzes und dient der Aufnahme von Information. Diese Aufnahme erfolgt über die Sinnesorgane. Umgangssprachlich ist von fünf Sinnen die Rede, tatsächlich sind es einige mehr. Jedes dieser Sinnesorgane ist auf eine ganz bestimmte Wahrnehmungsart – die sog. Modalität – spezialisiert, d.h. es kann bestimmte Reize in einem bestimmten Intensitätsbereich in Empfindungen umsetzen. Die Sensibilität der Sinnesorgane ist auf spezifische (physikalische) Signalarten, d.h. Reizformen, ausgerichtet, aber keinesfalls beschränkt. Z.B. weisen die Sensoren im Hörorgan zwar eine besondere Empfindlichkeit für akustische Signale auf, können aber auch durch mechanische Reize an der Ohrmuschel stimuliert werden. Die Gliederung der sensorischen Modalitäten – auch sensorische Systeme genannt – kann nach Wahrnehmungssinnen für die Umwelt (auch Exterozeptoren, von lat. exterior - äußerlich) und Wahrnehmungssinne für den eigenen Körper (Propriozeptoren, von lat. proprium - eigen) erfolgen. Eine genaue Abgrenzung bereitet Schwierigkeiten. SCHÖNPFLUG und SCHÖNPFLUG (1997) z.B. gehen von neun Modalitäten aus, die rund ein Dutzend unterschiedlicher Empfindungen hervorrufen. Jede Modalität ist bestimmten Beschränkungen unterworfen, welche die Qualität und Quantität der wahrgenommenen Eingangsinformationen und damit auch aller nachfolgenden Prozesse bestimmt. Das Wissen um diese Beschränkungen ist unerlässlich bei der Gestaltung von Arbeitssystemen. So beeinflussen z.B. die charakteristischen Eigenschaften und die Verteilung der Zapfen und Stäbchen in der Netzhaut des Auges nachhaltig den Einsatz von Farben als Informationsträger auf einem Bildschirm. Die jeweiligen Sinnessysteme erstrecken sich von den Sinnesorganen bis zur Hirnrinde (Cortex) und sind hierarchisch gegliedert. Die Rezeptoren (von lat. Recipere aufnehmen) sprechen im Wesentlichen auf Reizintensitäten an, in beschränktem Umfang auch auf Muster. Bis zum bewussten Wahrnehmungserlebnis, welches in der Hirnrinde gebildet wird, wird die Information in verschiedenen Stufen verdichtet und aggregiert. Alle Rezeptoren reagieren nur in der Modalität, für die sie vorgesehen sind. Das heißt aber nicht, dass sie nur von einer Reizart zu einer Reaktion veranlasst werden können. So führt ein Druck auf das Auge zu Farbwahrnehmungen und ein mechanischer Reiz des äußeren Ohres wird in eine entsprechende auditive Erregung gewandelt. Fast alle Rezeptoren lassen sich auch elektrisch stimulieren. Licht ist für das menschliche Auge im Wellenbereich von ca. 400 nm (Ultraviolett) bis 750 nm (Infrarot) wahrnehmbar. Weißes Licht vereint alle Frequenzen des sichtbaren Lichtes, während ein schwarzer Körper alle einfallende elektromagnetische Strahlung absorbiert. Als Schall werden mechanische Schwingungen in elastischen Medien bezeichnet (SCHAEFER 1993). Der für das menschliche Ohr wahrnehmbare Bereich liegt ungefähr zwischen den Frequenzen 20 Hz und 20 kHz (FASTL u. ZWICKER 2007) und wird als Hörschall bezeichnet. Die Hörschwelle liegt in Bezug auf den effektiven Schalldruck bei einer Frequenz von 1000 Hz bei ca. 20 μPa. Die Schmerzgrenze befindet sich ungefähr sechs Zehnerpotenzen darüber. Die taktile Empfindung wird durch die Meissner-Tastkörperchen und durch die Nervennetze um die Haarzwiebeln und Haarwurzeln vermittelt. Als Rezeptoren für Tiefensensibilität dienen die Vater-PaciniLamellenkörperchen. Sie passen sich sehr schnell an Druckunterschiede an. Vibrationsempfindung wird durch rhythmische Erregung der Sensoren für Oberflächen- und Tiefensensibilität hervorgerufen. Unter dem kinästhetischen Sinn (Propriosensibilität) werden Wahrnehmungen zusammengefasst, welche die Stellung von Körperteilen und deren Bewegungen betreffen. Dazu sind in den Gelenken, Muskeln, Sehnen sowie der Haut und im Vestibularapparat entsprechende Sensoren vorhanden. Der Tiefensinn wird weiter unterteilt in einen Stellungssinn, der die Stellung der Gelenke wahrnimmt, einen Bewegungssinn, welcher in Abhängigkeit von den Winkelgeschwindigkeiten der Gelenke deren Winkeländerung aufnimmt und einen Kraftsinn, in den die Reize der Muskelsensoren in Abhängigkeit von der Muskelkraft einfließen. Die Temperaturempfindung kann nicht funktionell einheitlich betrachtet werden, weshalb eine Unterteilung des Temperatursinns in einen Kälte- und einen Wärmesinnerfolgt. Jedem dieser beiden Sinne stehen eigene Kalt- bzw. Warmsensoren in der Haut zur Verfügung (Krause-Körperchen), wobei die örtliche Dichte der Kältepunkte auf der Handfläche 1-5/cm2 gegenüber 0,4/cm2 für Wärmepunkte beträgt. Insgesamt besitzt der Mensch etwa 30.000 Wärme- und 250.000 Kältepunkte. Die meisten Warm- und Kaltsensoren finden sich im Gesichtsbereich, wodurch sich die hohe Temperaturempfindlichkeit dieser Region erklärt. Schmerz wird meistens indirekt über sich im Gewebe anhäufende Schmerzmediatoren hervorgerufen, welche die freien Nervenenden reizen. Zu den Mediatoren zählen Kinine, Prostaglandine, Azetylcholin, Serotonin und Histamin. Eine Unterbrechung der Nervenleitung verhindert die Schmerzempfindung. Ein körpereigener Mechanismus zur Schmerzverminderung ist durch Endorphine (körpereigene morphinähnliche Stoffe) gegeben. Der Geruchssinn wird durch gasförmige Moleküle organischer Verbindungen, die erst am Rezeptor verflüssigt werden, gereizt. Die zur Wahrnehmung erforderliche Konzentration eines Stoffs in Luft ist von der Art des Stoffs abhängig; die Empfindlichkeit des menschlichen Geruchssinns kann für einige Stoffe sehr hoch sein und bei 107 Molekülen/cm3 Luft liegen. Durch die Empfindung von Gerüchen wird zum einen die Umwelt hinsichtlich des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe als auch die Nahrung kontrolliert. Der Geruchssinn ist in der Lage, mehrere Tausend Reizquellen (Gerüche) voneinander zu unterscheiden und zu klassifizieren. Der Geruch führt im hohen Maße zu einer emotionalen Bewertung einer Umgebung. Der Geschmackssinn kann durch organische und anorganische Moleküle von in der Regel nicht flüchtigen Stoffen gereizt werden. Die Konzentration eines Stoffs in einer Lösung muss mindestens 1016 Moleküle/ml betragen. Seine Hauptaufgabe besteht in der Kontrolle aufzunehmender Nahrung und der Steuerung der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung, bspw. durch Auslösen des Speichelreflexes. Dazu können die fünf Reize süß, salzig, sauer, bitter und umami differenziert werden. Umami reagiert in erster Linie auf L-Glutamate, welche vor allem in proteinreicher Nahrung wie z.B. Fleisch vorzufinden sind. Der Geschmack „umami“ wird oft als „herzhaft“ oder „intensiv“ beschrieben. Das Vestibulärsystem ermöglicht uns die Orientierung im Raum, löst u.a. die Stellreflexe zur Normalhaltung des Kopfs und der Augen aus und liefert die zur Erhaltung des Gleichgewichts notwendige Information. Der Vestibulärapparat liegt im Innenohr und ist direkt mit dem Schneckenhaus des auditiven Systems verbunden. Das Gebiet der Psychophysik beschäftigt sich mit der Messung der Beziehung zwischen dem physikalischen Reiz und der durch ihn ausgelösten Empfindung. Der Psychologe, Physiker und Natur-Philosoph Gustav Theodor Fechner prägte den Begriff „Psychophysik“. In seiner Schrift „Elemente der Psychophysik“ (Fechner 1860) definiert er die Psychophysik als die Lehre von den Beziehungen zwischen Körper und Seele, welche auf der Verbindung des physischen und psychischen Maßes beruht und sich dadurch in die Reihe exakter Lehren stellen lässt. Die Psychophysik ist für alle sensorischen Systeme anwendbar. Der Reiz wird als Erregung eines spezifischen Rezeptors definiert. Die Erregung wird an die Nervenzellen weitergegeben und über das Nervensystem zu den Sinnesorganen (Auge, Ohr) geleitet. Reize werden erst ab einer bestimmten energetischen Einwirkung oder chemischen Konzentration, der sog. Schwellenreizstärke, von Sinnesorganen verarbeitet. Unterschiedliche Reize haben dabei unterschiedliche Schwellenwerte. Die Reizspezifität beschreibt die selektive Wahrnehmung auf Ebene der Sinnesorgane. Nur rezeptoradäquate Reize lösen Empfindungen aus, z.B. erregen Schallwellen keine visuellen Rezeptoren. Absolutschwellen beschreiben, bezogen auf den menschlichen Organismus, die Minimal- bzw. Maximalwerte der Wahrnehmung von Sinnesorganen: Wie hell muss Licht sein, dass wir es noch sehen, wie hoch darf die Frequenz eines reinen Tons sein, dass wir ihn noch hören können? Beispiele für Absolutschwellen sind: Sehen: Kerzenlicht in klarer, dunkler Nacht aus 40 km Entfernung. Hören: Ticken einer Armbanduhr aus 6 m Entfernung. Schmecken: ein Teelöffel Zucker in 10 L Wasser: Riechen: ein Parfümtropfen in einer 6-Zimmer-Wohnung. Tasten: ein Sandkorn, aus 10 mm Höhe auf die Wange fallend. Das Ergebnis einer Experiments zu einer Absolutschwelle, unter kontrollierten Versuchsbedingungen, kann in einer psychometrischen Funktion statistisch zusammengefasst werden. Die Versuchsperson gibt für jeden Durchlauf einer Reizdarbietung an, ob ein Reiz entdeckt wurde oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, diesen Reiz zu entdecken (y-Achse), steigt mit der Intensität des Reizes an (x-Achse). Dieser Zusammenhang ist typischerweise S-förmig, da sehr intensive Reize mit Sicherheit entdeckt und sehr schwache Reize eher übersehen werden. Die Intensität, bei welcher die Versuchsperson den Reiz in 50% der Fälle entdeckt, wird Absolutschwelle genannt. Bei der experimentellen Ermittlung der Unterschiedsschwelle gibt die Versuchsperson an, ob ein Merkmal (z.B. Gewicht, bei konstantem Aussehen und konstanter Größe) eines Testreizes stärker oder schwächer ausgeprägt ist als das eines konstanten Vergleichsreizes (Standardreiz, auch unmittelbarer Reiz genannt). Die Fragestellung ist hierbei, wie stark sich zwei Reize unterscheiden müssen, um als verschieden erkannt zu werden. Als Punkt der subjektiven Gleichheit wird diejenige Reizintensität bezeichnet, welche die Versuchsperson in 50% der Fälle stärker als die des Standardreizes einstuft und in ebenso vielen Fällen als schwächer. Der Bereich zwischen 25% (ebenmerklich schwächer) und 75% (ebenmerklich stärker) wird als Intervall der Unsicherheit bezeichnet. Zur Berechnung der Unterschiedsschwelle wird das arithmetische Mittel aus den Reizintensitäten der beiden Intervallgrenzen gebildet, da die Abstände zur unteren und oberen Grenze nicht gleich sein müssen. Im Diagramm steht R für die Intensität des unmittelbaren Stimulus. Der Physiologe und Anatom Ernst Heinrich Weber (1795 - 1878) befasste sich am Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Genauigkeit der Gewichtsempfindung. Dazu machte er folgendes Experiment: Eine Versuchsperson musste zwei Gewichte G und G' durch Anheben mit der Hand vergleichen. Die dabei interessierende Frage war: Wie groß muss die Differenz G' - G sein, damit das größere Gewicht gerade noch mit Sicherheit erkannt werden kann? Nicht die Größe der Differenz ist entscheidend, sondern das Verhältnis G'/ G = k, das einen bestimmten Wert überschreiten muss. Je stärker der Reiz, desto größer muss der Reizunterschied sein, um diesen Unterschied zu bemerken. Ein Sinnesorgan registriert erst ab einer bestimmten Intensitätsdifferenz eine Veränderung (just noticeable difference, JND), die als Unterschied ΔR zum vorangehend dargebotenen, unmittelbaren Reiz R in einem bestimmten, gleich bleibenden Verhältnis k zu diesem steht. Der Physiker Gustav Theodor Fechner erweiterte das Weber´sche Gesetz 1860. Während Webers Gesetz die Beziehung zwischen zwei Reizen im Sinne eines eben merklichen Unterschiedes beschreibt, entwickelte Fechner eine Skala der Wahrnehmung, welche die Beziehungen zwischen Reiz- und Wahrnehmungsintensitäten darstellt. Fechner stellte fest, dass weder Wahrnehmungen noch Empfindungen direkt messbar sind, sondern nur Empfindlichkeiten. Er betrachtete alle eben merkliche Unterschiede als gleich groß und reihte diese Unterschiede von der absoluten Schwelle an aufwärts aneinander, um so die Punkte auf einer Empfindungsskala (E) zu erhalten, die mit der Skala der Reizintensität korreliert. So gelangte er an eine Formulierung, die oben auf der Folie als Fechner´sches Gesetz aufgeführt ist. Durch Integration erhält man das Weber-Fechner´sche Gesetz. Es besagt, dass bei einem linearen Anstieg der relativen Reizstärke die Empfindungsstärke nur logarithmisch anwächst. Eine Verzehnfachung des dargebotenen Schaldruckpegels z.B. bewirkt subjektiv ungefähr eine Verdopplung. Die Proportionalitätsgröße c ist von der Art des Reizes abhängig. Spätere Untersuchungen des Funktionsverhaltens von Sinnessystemen ergaben jedoch, dass die logarithmische Beziehung für visuelle, auditive oder olfaktorische Modalitäten nur in einem kleinen Intensitätsbereich gilt. Nach FECHNER wird die Empfindungsstärke indirekt über Unterschiedsschwellen (JND) bestimmt. Stevens Vorschlag war es, die Stärke von Sinnesempfindungen wirklich experimentell zu messen. Stevens hatte von seinen Versuchspersonen die ihnen angebotene Reizstärke auf Grund subjektiven Vergleichs mit einer vorher festgelegten Standardintensität beurteilen und diese erlernte Schätzung durch mehr oder weniger starken Zug an einem Dynamometer signalisieren lassen, wodurch er ein relatives Maß für die sensorische Empfindungsstärke, bezogen auf die subjektive motorische Kraftempfindung, erhielt. Diese Methode brachte eine Potenzfunktion hervor, keine logarithmische Beziehung. Der Exponent n nimmt für jede Sinnesmodalität einen anderen und charakteristischen Wert an. Der Exponent n ist mathematisch ein Maß für die Steigung und physiologisch ein Maß für den Bereich relevanter Reizintensitäten. Der wichtigste Unterschied zwischen dem Weber-Fechner´schen Gesetz und der Stevens´schen Potenzfunktion besteht in der Methodik. Bei der von Stevens formulierten Gesetzmäßigkeit wird eine direkte Skalierung zugrundegelegt: Die Versuchsperson beurteilt direkt die Stärke einer Empfindung. Im Gegensatz dazu basiert das Urteil bei der indirekten Skalierung auf der Unterscheidungsfähigkeit der Versuchsperson. Sie wird bei Fechners logarithmischem Gesetz zugrundegelegt. Das zeitliche Veränderungsgesetz sagt aus, dass Sinnesorgane bevorzugt auf Veränderungen reagieren, da bei konstanter Erregung die Nervenzellen auf den Reiz adaptieren und die Reizempfindung schwindet. Die Anpassungsbreite der Sinnesorgane von der Schwellenreizstärke bis zur Schmerzgrenze umfasst normalerweise mehrere Zehnerpotenzen physikalischer Einheiten. Die Anpassungsgeschwindigkeit schwankt von Sekunden, z.B. Helladaptation des Auges, bis zu Tagen, z.B. Kompensation einer zeitweiligen Hörschwellenverschiebung des Ohrs. Jede der sensorischen Modalitäten scheint mit einem zentralen Mechanismus gekoppelt zu sein, der nach dem physikalischen Abklingen des Stimulus die Empfindung des Reizes für kurze Zeit verlängert. Dieser Kurzzeitspeicher (short term sensory store, STSS) erlaubt es, bei Abwenden der Aufmerksamkeit in eine andere Richtung die Umgebungsinformation für kurze Zeit zu speichern und ggf. später zu verwenden (WICKENS u. HOLLANDS 1999). Die Proportionalkonstante k und der Exponent n sind rezeptorspezifisch. Der Wert von k ist abhängig von den gewählten Maßeinheiten. Die Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen relativer Reizintensität (Stimulusgröße) und Empfindungsstärke bei unterschiedlichen Reizarten in einem doppellogarithmischen Koordinatensystem. Die Einheiten der Skalen wurden willkürlich gewählt, um die Kurven in einem einzigen Diagramm in Form von Ursprungsgeraden darstellen zu können. Bei dem hier abgebildeten doppelt-logarithmischen Diagramm ist die Steigung der Geraden gleich n. Übersteigt die Reizintensität bestimmte Werte, können die Rezeptoren zerstört werden. Verletzungen und bleibende Schäden sind die Folge. Die Empfindungsstärke steigt bei der Stimulation der Haut durch Wechselstrom an den Fingern am stärksten. Die logarithmische Gleichung log E = n * log R + log k ermöglicht die linearisierte Darstellung der Stevens´schen Potenzfunktion. Die Steigung der Geraden entspricht dem Exponenten der Potenzfunktion, der das Wachstum der Empfindung bestimmt. Man befindet sich in einem Zug im Bahnhof und schaut aus dem Fenster auf einen benachbarten Zug. Bewegt sich der andere Zug, entsteht eine unklare Situation: Ist es der eigene oder der benachbarte Zug, der in Bewegung ist? Beide Interpretationen – Bewegung des eigenen oder des benachbarten Zuges – sind statistisch möglich, basierend auf der visuell dargebotenen Information. Die visuelle Information ist daher mehrdeutig. Nur das Fehlen des „Ruckeln“ des Zuges oder der Blick auf den Bahnsteig zeigt, dass es der benachbarte Zug ist, der sich bewegt. Es muss daher weitere ergänzende Information verarbeitet werden, um diese Situation klären zu können. Dies wird als Disambiguierung bezeichnet: Das „Eindeutigmachen“ mehrdeutiger Wahrnehmungen, deren explizite Auslegung erst durch zusätzliche Signale aus der Arbeitsumgebung ermöglicht wird. Bei der Beurteilung der Größe eines Objekts werden sowohl durch die visuelle als auch durch die haptische Sinnesmodalität Informationen extrahiert und bereitgestellt. Aber welches ist die wahrgenommene Größe eines Objekts, das gleichzeitig gesehen und berührt wird? Wird die Größe durch die visuelle Abschätzung bestimmt, durch die haptische oder durch beide? Die Informationen der verschiedenen Sinnesmodalitäten müssen vom zentralen Nervensystem integriert werden, so dass eine kohärente multisensorischen Wahrnehmung entstehen kann. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die multisensorische Integration von Informationen ähnliche Eigenschaften aufweist wie die sog. Maximum-Likelihood-Schätzung der klassischen Statistik (siehe z.B. Ernst und Bülthoff 2004). Das heißt, der Mensch kombiniert die multiplen Sinneseindrücke in der Form, dass der Vorhersagefehler bezüglich der redundant dargebotenen Informationen minimiert wird. Konsequenz ist dabei u.a., dass das weniger verrauschte (geringere Varianz siehe 𝜎𝑉 gegenüber 𝜎H ) Signal höher gewichtet wird als das stärker verrauschte, um den gewichteten Mittelwert zu bilden (siehe Bild rechts unten). Sichtbereiche (oben links: verschiedene Bereiche des Gesichtsfeldes – Farbabhängigkeit beachten!) und damit die Erkennbarkeit und Lesbarkeit von Instrumenten (abhängig von Sehschärfe – Visus 1 (normal): 1 Bogenminute Auflösung) sind mindestens von gleich großer Bedeutung wie die Körpermaße. So wird bei der Gestaltung von Fahrzeugen stets von einem fiktiven Augenpunkt (Design-Eye-Point, Flugzeug) oder einer Augenellipse (Auto) ausgegangen, in welchem sich das Auge des späteren Benutzers befindet. Flugzeug (unten links): Design Eye Position (Augenpunkt): ... ist ein relativ zur Flugzeugstruktur festgelegter Punkt, an dem sich die Augen des Piloten in der normalen Sitzposition befinden sollen (SAE ARP 4202); Festlegung der Position des Piloten im Cockpit; Sitzverstellbereich ist so festzulegen, dass alle Piloten Position im DEP erreichen. Line of Sight (Sichtlinie) Sichtlinie gibt die Blickrichtung bei der Landung vor; nach unten geneigt (wg. Anstellwinkel bei Landung) In der Praxis kann die Überprüfung der Sichtbedingungen auch durch Sichtlinien im CAD oder der technischen Zeichnung erfolgen. Einfacher ist dies mit Menschmodellen (rechts unten), welche die Sichtbereiche als Kegel darstellen oder direkt die Sicht des Benutzers berechnen. Außerhalb des A- und B-Bereiches sollten lediglich Anzeigen verwendet werden, die für den sicheren Betrieb und die sichere Führung von Maschinen völlig unbedenklich sind. Die Fovea Centralis ist das Zentrum des gelben Flecks und wird kurz Fovea oder Netzhautgrube genannt. Sie ist die Stelle des schärfsten Sehens im Auge mit einer Größe von ca. 0,5 mm. Die 1,6 Millionen Nervenfasern des optischen Nervs treten gebündelt durch die Netzhaut aus. Die Austrittsstelle ist nicht lichtempfindlich und wird daher als blinder Fleck bezeichnet. Sehen bei geringer Helligkeit wird als skotopisches Sehen bezeichnet. Es erfolgt komplett mit den Stäbchen. Das reine Sehen mit den Zapfen bei ausreichender Helligkeit nennt man photopisches Sehen. Scharfes Sehen ist nur bei zentraler Betrachtung eines Objekts möglich. Der Bereich des scharfen Sehens beträgt etwa 1° im Zentrum des Sehfeldes. Die Graphik stellt die Situation bei gerade ausgerichtetem Blick dar. Natürlich können durch Augenbewegungen auch Objekte außerhalb des Zentrums scharf gesehen werden. So müssen die Augen ständig auf die betrachteten Objekte ausgerichtet werden. Um dies zu vermeiden ist eine zentrale Anordnung der Anzeigen bezogen auf das Sehfeld zu bevorzugen. Die Akkommodationsbreite beschreibt die Fähigkeit des Auges, in verschiedenen Abständen scharf zu sehen. Sie ist ein Maß für die Anpassungsfähigkeit des Auges und berechnet sich als Differenz von Nahpunkt und Fernpunkt. Als Nahpunkt wird derjenige Punkt bezeichnet, der gerade noch scharf gesehen werden kann und als Fernpunkt der Punkt der quasi im unendlichen liegt. Die Distanz zwischen Nahpunkt und Fernpunkt ist normalerweise durch die Stärke der Linse vorgegeben. Falls die Linse auf das Gewebe trifft, in dem sich das Licht bricht, würde es so aussehen, als ob die Lichtstrahlen von Nahpunkt vom Fernpunkt kämen. In der Physik wird die „Stärke“ einer Sammellinse mit der Brennweite f beschrieben, sie wird in Metern angegeben. Augenärzte und Optiker geben die „Stärke“ einer Linse mit ihrem Brechwert D an. Dieser Wert wird in Dioptrien (dpt) gemessen. Stark brechende Linsen haben eine kurze Brennweite, weil sie umgekehrt einen großen Brechwert haben. Der Brechwert ist also der Kehrwert der in m angegebenen Brennweite: D=1/f. (Völcker 2007) Da ab einem Lebensalter von etwa 50 Jahren der Nahpunkt auf über 500 mm steigt, können die meisten Personen von da an keine Bildschirmarbeit ohne Sehhilfe leisten. Anzeigen sollten auf einer Ebene in etwa gleichem Abstand zum Auge platziert werden, um ständiges Akkomodieren zu vermeiden. Objekte, die das Auge sehen soll, müssen entweder selbst leuchten oder Licht aus der Umgebung reflektieren. Licht ist eine elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von ca. 400 bis 720 nm, die im Auge zu visuellen Reizen führt. Licht setzt sich aus unterschiedlichen Farben zusammen, die wiederum bestimmten Wellenlängen zuzuordnen sind. Die Farbsensibilität ändert sich mit dem Adaptionszustand, also mit der Umgebungshelligkeit. Das helladaptierte Auge besitzt seine höchste Empfindlichkeit im Farbbereich Grün bis Gelb. Es ist dann recht unempfindlich für Blau und Rot. Beim dunkeladaptierten Auge liegt die höchste Empfindlichkeit eher im Farbbereich Blau bis Grün. Sehen bei geringer Helligkeit wird als skotopisches Sehen bezeichnet. Es erfolgt komplett mit den Stäbchen, schwarz-weiße Strukturen sind daher bei Dunkelheit besser zu erkennen als farbige. Große farbige Objekte werden besser wahrgenommen als kleine farbige Objekte. Farben sind daher besser geeignet, um globale Markierungen zu erkennen, während Schwarz-Weiß besser geeignet ist, um feine Strukturen (Muster, Zeichen) zu erkennen, wie hier die Skala des Tachometers. Das Anpassen des Auges von hellen auf dunkle Szenen nimmt bei Leuchtdichteunterschieden von mehr als 10² cd/m² einige Minuten in Anspruch. Um diesen Effekt bei Fahrten in der Dunkelheit bei der Verwendung eines Navigationsgerät zu vermeiden bzw. zu verringern, werden spezielle Nachtfarben bzw. Nachtmodi angeboten. Somit ist der Helligkeitsunterschied zwischen Umgebung und Bildschirm nicht zu stark. Desweiteren ist das dunkeladaptierte Auge für blau sehr empfindlich. Bezogen auf die Vermeidung einer Blendung des Auges in der Nacht ist der Schwarz-Rot-Kontrast besser geeignet, da die dann aktiven Stäbchen für rotes Licht unempfindlich sind. Beim Blick auf die rot beleuchteten Instrumente bleibt das Auge somit dunkeladaptiert. Eine intensiv weiße Beleuchtung könnte beim Blick auf die Instrumente zu einer Hell-Adaption des Auges führen, wodurch beim Blick weg von den Instrumenten die Umstellung auf die dann dunklere Umgebung länger dauern könnte. Zwischen 8-9% der männlichen, jedoch nur 1% der weiblichen Bevölkerung können bestimmte Farben nicht wahrnehmen (Farbfehlsichtigkeit, Rot-GrünSchwäche). Davon zu unterscheiden ist die Farbenblindheit, die bewirkt, dass farbige Informationen als Graustufen wahrgenommen werden. Um die Wahrnehmbarkeit wichtiger Informationen zu gewährleisten, sollte neben der Farbinformation eine dazu redundante Information dargeboten werden, z.B. durch Formkodierung oder Anordnung von Symbolen (Bsp. Position der Lampen bei Verkehrsampeln). Unter einer analogen Anzeige versteht man eine Einrichtung mit der quantitative Größen stufenlos, d.h. kontinuierlich abgebildet werden. Normalerweise werden dazu Instrumente mit bewegtem Zeiger oder mit bewegter Skala verwendet. Analoganzeigen eignen sich für kontinuierlich ablaufende Vorgänge. Sie erlauben neben dem Messwert auch dessen Veränderung zu erfassen. Neben der qualitativen Darstellung von Messwerten eignen sich Analoganzeigen deshalb auch zum Regeln von Betriebszuständen. Der sich bewegende Zeiger erlaubt eine schnelle und sichere Orientierung, benötigt jedoch eine größere Fläche. Bei der bewegten Skala ist die Ablesegenauigkeit in der Regel besser, die Größenordnung des Ablesewerts ist mangels Orientierung jedoch schlechter zu erfassen. Ein genereller Nachteil der Analoganzeigen besteht in der Notwendigkeit, Zwischenwerte zu schätzen (Interpolation). Die Ausprägung der Skalen richtet sich nach der zu erfassenden Größe. Bei kontinuierlich ablaufenden Vorgängen (z.B. Uhrzeit) kommt eine Rundskala zur Anwendung. Bei Messwerten mit einem definierten Anfangs- und Endzustand (z.B. Fahrzeuggeschwindigkeit) bedient man sich einer Sektorskala. Langfeldskalen können für beide genannten Anzeigearten ausgelegt werden, wobei die Ausführung mit bewegter Skala äußerlich nahezu identisch mit Rundskalen ist. Langfeldskalen mit bewegtem Zeiger sind jedoch Rundskalen bei der schnellen Grobeinschätzung unterlegen, da die Information über die Winkelstellung des Zeigers fehlt (bei der Rundskala bleibt der Bezugspunkt des Zeigers fest, wohingegen der Zeiger bei der Langfeldskala zu suchen bleibt). Mit Digitalanzeigen werden diskrete (d.h. gestufte) Informationen übermittelt. Die wesentlichen Ausführungsformen sind die binäre Anzeige mit nur zwei Zuständen (z.B. über Kontrollleuchten) und alphanumerische Anzeigen mit Ziffern für Zahlen und Buchstaben. Die binäre Anzeigeform findet vielfältige Anwendung als Zustandsanzeige, z.B. als Ein-AusKontrollleuchte bei nahezu allen elektrischen Geräten. Eine solche Anzeige kann jedoch nur über eine geeignete Dekodierung richtig interpretiert werden. Hierzu kann man sich festgelegter Konventionen bedienen (Farbkodierung, z.B. bei Verkehrsampeln mit Rot = halt, Gelb = Achtung und Grün = freie Fahrt; Symbolkodierungen, z.B. an Verkehrszeichen angelehnte Begriffe oder Symbole), andernfalls ist eine dem Benutzer verständliche Erklärung anzubringen. Mit Hybridanzeigen wird versucht, die Vorteile der Analog- und der Digitalanzeige zu verbinden, indem die absolute Anzeigegröße und deren Veränderung mit zwei getrennten Elementen dargestellt werden. Im Allgemeinen wird erstere über eine Digitalanzeige und zweitere über eine Analoganzeige abgebildet. Hybridanzeigen finden vorzugsweise beim Erfassen großer Messbereiche Anwendung, deren Veränderung trotzdem schnell und einfach zu erfassen ist (Tachometer mit Kilometerzähler, Strom- und Wasserzähler). Bildschirmanzeigen erlauben die Erzeugung unterschiedlicher Anzeigearten und eignen sich deshalb für die Darstellung komplexer Sachverhalte in Form von Grafiken, Flussbildern oder Diagrammen. Ein wesentlicher Vorteil ist die große Variabilität der Informationsdarstellung, die eine zustandsabhängige Darstellung situativ relevanter Informationen mittels sog. konfigurierbarer Anzeigen ermöglicht. Enthält die Bildschirmanzeige neben den Anzeigekomponenten interaktive Elemente wie Schaltflächen (Buttons), mit denen der Benutzer Informationen auswählen oder andere Systemfunktionen auslösen kann, spricht man von einer grafischen Benutzungsschnittstelle (graphical user interface – GUI). Bei Analoganzeigen ist besonders auf eine sinnvolle Skalengestaltung (Teilstriche, Beschriftung) sowie auf eine ablesefreundliche Gestaltung des Zeigers zu achten. Dabei soll die dargestellte Information (z.B. Anzahl der Teilstriche) in einem günstigen Verhältnis stehen zur Fähigkeit des Menschen, feine Unterschiede noch erkennen zu können. Der Zeiger soll eine klar erkennbare Spitze haben, damit der Ablesende nicht gezwungen wird, den Messwert zu schätzen (wie es z.B. bei breiten Zeigern erforderlich wäre). Der Zeiger darf zudem nicht die Ziffern der Beschriftung verdecken und sollte mit seiner Spitze bis zu den Teilstrichen reichen. Der Abstand zwischen Zeiger und Skala muss zur Vermeidung von Ablesefehlern (Parallaxe) gering sein. Weitere Angaben finden sich dazu in DIN EN 894-2, DIN 43790 und DIN 43802. Die Teilung der Skale ist ein wichtiges Mittel, um die Identifikation von Skalenwerten zu verbessern, sie muss der geforderten Messgenauigkeit entsprechen und ist der Genauigkeit der Übertragung anzupassen. Es dürfen nicht mehr als drei Teilungsstufen verwendet werden (lange, mittlere und kurze Teilstriche). Es dürfen nicht mehr als vier mittlere Teilstriche (d. h. fünf Abschnitte) zwischen zwei langen Teilstrichen und nicht mehr als vier kurze Teilstriche (d. h. fünf Abschnitte) zwischen zwei mittleren Teilstrichen angeordnet werden. Die Bereiche der Messwerte zwischen zwei kurzen Teilstrichen können 1, 2 oder 5 bzw. ein dezimales Vielfaches davon betragen. Die Identifizierbarkeit ist nicht bei allen Skalenteilungen gleich gut. Interpolation von Skalenwerten zwischen zwei kleinen Teilstrichen sollte nicht notwendig sein. Falls Interpolation notwendig ist, darf die verlangte Genauigkeit nicht mehr als ein Fünftel des Intervalls betragen und die Intervalle müssen vergrößert werden. Mit Bezug auf die obige Tabelle nach DIN 33411-1 lassen sich ursachenorientierte Faktoren der Muskel- und Massenkräfte (im Körpersystem wirkend) von Funktionen hinsichtlich der erzeugten Aktionskräfte (vom Körper nach außen wirkend) unterscheiden und miteinander verknüpfen. Die Zusammenhänge sind für die Arbeitsgestaltung von Bedeutung. Beispiele hierfür sind: • Die Eigengewichte der Körperteile (Massenkräfte) werden zum Einhalten einer Körperhaltung durch statische Muskelkräfte ausgeglichen. • Aktionskräfte an Körperstützflächen können sich aus Massenkräften der Körperteile und aus Haltungskräften zusammensetzen. Dies ist z.B. bei der Dimensionierung der Rückstellkräfte eines Pedals zu beachten. • Verkürzungsmuskelkräfte sind teilweise oder ganz Ursache der Antriebskräfte (z.B. Anheben von Lasten). • Verlängerungsmuskelkräfte sind teilweise oder ganz Ursache der Bremskräfte (z.B. herab nehmen von Lasten). • Manipulationskräfte und Betätigungskräfte werden teilweise oder ganz durch das Zusammenspiel von Verkürzungs- und Verlängerungsmuskelkräften (einzelne Muskelgruppen) aufgebracht (z.B. Umsetzen von Lasten). Die dargestellten Isodynen gelten für männliche Personen mit einem durchschnittlichen Alter von 22,8 ± 2,2 Jahren, einer durchschnittlichen Körperhöhe von 176,8 ± 5,9 cm und einem durchschnittlichen Körpergewicht von 72,73 ± 12,47 kg. Charakteristisch für den Prozess des Alterns ist eine Abnahme der Muskelkraft. Bis zu einem Alter von ca. 20 Jahren steigt diese steil an, fällt dann jedoch kontinuierlich ab. Nach einer Studie von Poljakov (1991), durchgeführt an gewerblichen Mitarbeitern verschiedener Altersstufen, besitzt eine Arbeitsperson im Alter von 70 bis 79 Jahren nur noch ca. 80 Prozent der durchschnittlichen Muskelkraft eines 20- bis 29-jährigen. Bedeutsam ist auch die Entwicklung der Finger-/ Handdruckkraft. Hier zeigt sich mit zunehmendem Alter nicht nur eine Abnahme in der Stärke der Kraft, die ausgeübt werden kann, sondern mit zunehmendem Alter wird auch die Zeit kürzer, in welcher der Druck aufrechterhalten werden kann (Wandke 2000). Die Auswahl und Positionierung von Stellteilen zur Handbedienung muss unter Berücksichtigung der Beweglichkeit der Hand geschehen, um die Beanspruchung der Skelettmuskulatur zu vermindern. Die Greifart gibt die Art des Zugriffs zwischen der Hand des Operators und dem Stellteil an. Es werden drei Arten definiert: 1) Kontaktgriff: Hierbei wirkt eine Kraft in einer Richtung, die mit dem Finger, dem Daumen oder der Hand auf das Stellteil aufgebracht wird. Wie auf der Folie dargestellt, ist der Kontaktgriff besonders geeignet für schnelles Stellen und das Ertasten der Stellung. 2) Zufassungsgriff: Hierbei wird das Stellteil mit den Fingern und/oder dem Daumen gehalten, ohne dass eine Faust geballt wird. Der Zufassungsgriff ist besonders geeignet für genaues Einstellen und kontinuierliches Stellen. 3) Umfassungsgriff: Hierbei umschließen alle Finger das Stellteil. Der Umfassungsgriff ist besonders geeignet für Kraftübertragung und Halten gegen den Widerstand. Das Stellteil ist der Teil eines betätigt wird. In Bezug auf die nach der erforderlichen Stellgeschwindigkeit und der unterschieden. Stellteil-Systems, der vom Menschen direkt Aufgabenstellung werden Stellteile allgemein Genauigkeit des Positionierens, der zulässigen bzw. notwendigen Stellkräfte Die Drehknöpfe stellen von links nach rechts eine ansteigende Schwergängigkeit mit abnehmender Positioniergenauigkeit dar. Der erste Drehknopf von links verweist durch die feine Rändelung sowie durch die feinstrukturierte Skala auf eine sensible Handhabung. Beim zweiten Drehknopf ist aufgrund der gröberen Rändelung und Skaleneinteilung eine höhere Schwergängigkeit wie auch eine größere Ungenauigkeit zu erwarten. Bei den Drehknöpfen drei und vier von links findet bei der Betätigung kein Abrollen zwischen den Fingern mehr statt, sondern eher eine formschlüssige Verbindung. Ein erhöhter Kraftaufwand ist zu erwarten und von einem kontinuierlichen Regelvorgang ist nicht mehr auszugehen. Ein isotonisches Steuerelement ist ein Bedienelement in Form eines Hebels, der in der Ausgangslage senkrecht steht und der in verschiedene Richtungen ausgelenkt werden kann. Es liefert eine oder zwei kontinuierliche Stellgrößen und kehrt selbsttätig in die Ausgangslage zurück. Die Werte der Stellgrößen sind proportional zum Winkel oder zur zurückgelegten Strecke in vertikaler Lage. Die Bezeichnung isotonisch deutet darauf hin, dass die rücktreibende Kraft bei jeder Auslenkung ungefähr gleich groß ist. Ihre Vorteile sind der geringe Platzbedarf, die leicht und intuitiv erlernbare Handhabung und eine gute taktile Rückmeldung über den Zustand der Variablen. Es ist für Steuerungs- und Nachregelaufgaben geeignet. Ein isometrisches Steuerelement ist ein analoges selbstzentrierendes Bedienelement, dass die darauf angewendeten Kräfte misst. Die Bezeichnung isometrisch deutet darauf hin, dass es nur eine vernachlässigbare Auslenkung besitzt. Maximal kann man mit einem isometrischen Steuerelement sechs Variablen steuern, nämlich drei translatorische und drei durch Rotation (Baumann 1998). Die Bewegungsachse ist die Achse, entlang derer oder um die eine Stellbewegung in Bezug auf die menschliche Körperachse vorgenommen wird. Hierbei ist es notwendig, die verschiedenen Haltungen zu berücksichtigen, die der Mensch einnehmen kann, sowie die Bewegungen des Oberkörpers, wenn das Stellteil betätigt wird. Die Bewegungsrichtung ist die Richtung der Stellbewegung zur Betätigung eines Stellteils in Bezug auf die Achsen. Für translatorische und rotatorische Bewegungen werden die Richtungen mit „+“ und „−“ angegeben. Auslenkungen bzw. Bewegungen von Stellteilen nach rechts, nach oben, nach hinten und Drehungen im Uhrzeigersinn stellen für die Benutzer Funktionen wie „Ein“ oder Zustandsänderungen wie „Zunahme“ dar. Auslenkungen bzw. Bewegungen von Stellteilen nach links, nach unten, nach vorn und Drehungen entgegen den Uhrzeigersinn stellen für die Benutzer Funktionen wie „Aus“ oder Zustandsänderungen wie „Abnahme“ dar. Ausnahme: Bei Ventilen und Absperrvorrichtungen bedeutet drehen nach rechts „Drosseln“ Kompatibilität oder Sinnfälligkeit im arbeitswissenschaftlichen Sinne liegt vor, wenn bei der verknüpfenden Gestaltung von Informationseingabesystemen und Informationsausgabesystemen gewissen Erwartungen des Menschen entsprochen wird. Räumliche (statische) Kompatibilität: die Gestaltung / Anordnung der Bedienelemente in Bezug auf Anzeigen Bewegungskompatibilität (Dynamische Kompatibilität): Kompatibilität zwischen Bewegungen der Bedienelemente und Veränderungen von angezeigten Messwerten Kompatibilität zwischen Bewegungen der Bedienelemente und Bewegungen mechanisch gesteuerter Maschinenteile Modalitätsbezogene Kompatibilität: Kompatibilität zwischen Modalitäten der Informationsdarbietung (verbal, visuell), der Informationsverarbeitung (sprachlich, räumlich-analog) und der geforderten Reaktion (sprachlich, manuell) Eine Berücksichtigung kompatibilitätsförderlicher Arbeitsmittelgestaltung führt zu einer: Verhaltensstereotypien Verkürzung der Lern- und Übungsphase, Erhöhung der qualitativen und quantitativen Arbeitsleistung und verringerten Gefahr der Fehlbehandlung. bei der Gestaltung einer Bedienungsvorrichtung für die Sitzverstellung anhand der miniaturisierten Form des Sitzes. Sitzfläche und Sitzlehne lassen sich entsprechend der gegebenen Verstellmöglichkeiten bewegen. Um z.B. die Sitzvorderkante höher zu stellen, hebt man den vorderen Teil des SitzflächenHebels. Es wurden sieben rotatorische Stellteile im Hinblick auf ihre Eignung und ihren Bedienkomfort unter unterschiedlichen Einstellbedingungen untersucht. Der einstellbare Drehwiderstandsmoment kann in einem Bereich zwischen min. 0,015 Nm und der vollständigen Blockade des Stellteils stufenlos variiert und zusätzlich mit unterschiedlichen Rastcharakteristiken überlagert werden. Die Untersuchung hat gezeigt, dass der durch Variation des Durchmessers (R2 = 1,75 x R1) erzielte Effekt auf das Komfortempfinden bei der Einstellaufgabe den Effekt aus der Variation der Oberfläche (Kunststoff vs. Softlackbeschichtung) übertrifft. Grundsätzlich sind Drehwiderstandsmomente von 0,08 Nm und darunter ähnlich komfortabel beurteilt worden, während Drehmomente darüber als eher unkomfortabel eingestuft wurden. Dabei zeigen sich sowohl die signifikanten Zusammenhänge erster Ordnung wie bspw. zwischen der Schaltergestaltung und dem Komfortempfinden als auch zweiter Ordnung wie bspw. der Kombination aus Schaltergestaltung und dem Drehmoment in Abhänigkeit der Komfortbewertung. Diese Ergebnisse geben Hinweise, wie zukünftige Schalter in Abhängigkeit von der Stellkraft gestaltet werden sollten. Weitere Untersuchungen, z. B. inwiefern sich das positiv bewertete geringe Einstellmoment auf die Einstellgenauigkeit auswirkt oder ob ein Zusammenhang zwischen der zu regelnden Funktion (z. B. Klima, Radio, Navigation) und dem Komfortempfinden besteht, sind geplant. Ziel dieses Projektes war es die Benutzerakzeptanz und das Ablenkungsverhalten bei der Nutzung von Touchscreens mit taktiler Rückmeldung am Fahrerarbeitsplatz zu untersuchen. Dazu wurden im ersten Teil der Untersuchung verschiedene taktile Rückmeldungen auf ihre Eignung bezüglich der Informationsübertragung an den Fahrer untersucht. Hierbei erhielten die Probanden schriftlich die Aufgabenstellung, einzelne taktile Reize mittels Bildschirmberührung zu aktivieren, zu erproben und anschließend ohne Zeitdruck softwareseitig zu bewerten. Im zweiten Teil der Untersuchung wurden die Funktionen eines virtuellen Infotainmentsystems mit den präferierten taktilen Rückmeldungen hinterlegt und die durch die Benutzung dieses Infotainmentsystems entstehende Ablenkung von der Fahraufgabe im Vergleich zu einem System ohne taktile Rückmeldung gemessen. Hierfür mussten die Probanden drei Fahrten an einem Fahrsimulator absolvieren: Baseline ohne Nebenaufgaben Fahrt mit Nebenaufgaben an Infotainmentsystem mit taktile Rückmeldungen Fahrt mit Nebenaufgaben an Infotainmentsystem ohne taktile Rückmeldungen Aus den Ergebnissen lässt sich kein positiver Effekt der taktilen Rückmeldung für die unterschiedlichen Kennwerte beobachten Subjektiv haben die Probanden einen positiven Effekt der taktilen Rückmeldung empfunden Eine erheblich längere Übungs-/Lernphase begünstigt eventuell positivere Ergebnisse für die taktile Rückmeldung Die Bedienung des Radios via Display (taktil oder nontaktil) ist für den Großteil der älteren Probanden schwer möglich bzw. würde nicht angenommen/akzeptiert Taktile Rückmeldung als Gimmick für Selbsteinschätzungen, Zahlungsbereitschaft) die jüngeren Probanden (positive Für weitere Untersuchungen wäre eine Modifikation der Position des Displays nötig (vgl. Blickkennwerte)