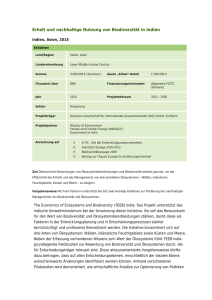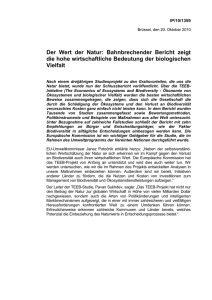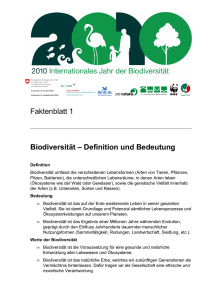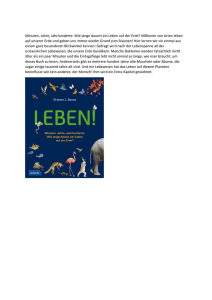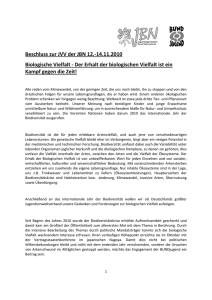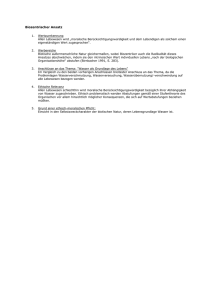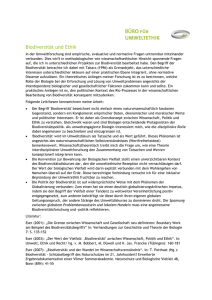Biodiversität macht Schule! Œ wissenschaftliche Hintergründe
Werbung

Published on Le site de la Fondation La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org)
Accueil > Biodiversität macht Schule! – wissenschaftliche Hintergründe
Biodiversität macht Schule! – wissenschaftliche
Hintergründe
Der Begriff der Biodiversität
Die Bezeichnung "Biodiversität" wird gewöhnlich dem berühmten amerikani-schen Biologen
Edward O. Wilson [1] zugeschrieben. Der Bericht vom ersten amerikanischen Forum zur
biologischen Vielfalt (1986) trug allerdings den Titel "Biodi-versity", während der von Wilson
favorisierte Titel "Biological Diversity" lautete. Wilson veröffentlichte die Beiträge zur
Konferenz in einem Sammel-band [2], der großen Anklang fand und zur Verbreitung des
Neologismus bei-trug. Im deutsch-sprachigen Raum fand das Wort "Biodiversität" nach dem
Erd-gipfel in Rio 1992 eine schnelle Verbreitung. Der Artikel 2 der "Biodiversitäts-Konvention"
(ausgehandelt auf dem Erdgipfel von Rio, auch als "Übereinkom-men über die biologische
Vielfalt" bekannt) definiert Biodiversität wie folgt [3]:
"Biologische Vielfalt ist die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft,
darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die
ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der
Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme."
1. Die Biosphäre: eine beachtliche Diversität
Der Begriff umfasst die unendliche Vielfalt des Lebens in Raum und Zeit: die Vielfalt der
"Biosphäre". Die Erkenntnis dieser Vielfalt ist nicht neu. Schon Aristoteles schrieb um 343 vor
unserer Zeit eine "Geschichte der Tiere". Es war einer der ersten Versuche, die Lebewesen
zu beschreiben und zu klassifizieren, wobei er allerdings die Pflanzen stiefmütterlich
behandelte und sie nur ganz pauschal beschrieb. Zu Beginn unserer Zeitrechnung ließ sich
Plinius der Ältere bei der Niederschrift der 37 Bände seiner "Naturgeschichte" weitgehend
vom Werk Aristoteles' inspirieren. Er hatte den Ehrgeiz, die ganze bekannte Welt, nicht nur
die Lebewesen, zu beschreiben. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts zählte der englische
Naturforscher John Ray in seiner Historia plantarum 6000 Pflanzenarten und schätzte die
Zahl der Insekten auf 10 000 bis 20 000.
2. Nur eine geringe Zahl der lebenden Arten ist bisher identifiziert
Heute sind 1 800 000 verschiedene Arten identifiziert und benannt, davon etwa 1 Million
Insektenarten. Jedes Jahr kommen etwa 16 000 neu hinzu. Allein in Europa werden seit dem
Anfang des 20. Jahrhunderts jedes Jahr etwa 600 neue Arten beschrieben. Wissenschaftler
vermuten, dass die tatsächliche Anzahl der lebenden Arten bei knapp 10 Millionen liegt [4], es
also 5 bis 10 Mal mehr Arten gibt als bisher bekannt. Des Weiteren ist die Anzahl aller, zu
irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte unseres Planeten vorhandenen Arten und
Ökosysteme um Größenordnungen höher, denn im Lauf der geologischen Zeitalter sind stets
neue Arten aufgetaucht, haben sich verbreitet und sind wieder verschwunden. Der Ursprung
des Lebens auf der Erde wird auf etwa 3,5 Milliarden Jahre geschätzt, Zeit genug, eine
beträchtliche Anzahl neuer Arten und Ökosysteme entstehen (und wieder vergehen) zu
lassen. Die gegenwärtige Anzahl vorhandener Arten wird auf maximal 1% der seit dem
Ursprung des Lebens jemals da gewesenen geschätzt.
Der Begriff der Art
Lamarck [5] vermerkte 1809 in seiner Philosophie zoologique: Mit voranschrei-tender
Bestandsaufnahme der Lebensformen "[...] bringt uns die Definition dessen, was eine Art ist,
in immer größere Schwierigkeiten". Man kann stun-denlang über den Artbegriff debattieren;
die Vielzahl der Definitionen in der Literatur und die zahlreichen Gegenbeispiele lassen jede
einzelne Definition unpräzise erscheinen. Und dies aus gutem Grund: Die Art entspricht einer
rein menschlichen Vorstellung, die uns "erlaubt über das zu sprechen, was wir in der Natur
beobachten", während die Natur solche klar begrenzte "Schubladen" eben nicht aufweist.
1. Die biologische Definition der Art
Im Allgemeinen verwendet man vor allem den biologischen Artbegriff, den Ernst Mayr [6] in
den 1940er Jahren vorgestellt hat. Einfach ausgedrückt bezeichnet eine Art alle Individuen,
die sich untereinander fortpflanzen können, und deren Nachkommen das auch können. Zum
Beispiel kann ein Grasfrosch (Rana tem-poraria) mit einem anderen Grasfrosch Junge haben,
eine Erdkröte (Bufo bufo) mit einer anderen Erdkröte usw. Aber ein Grasfrosch kann mit einer
Erdkröte keine Nachkommen haben. Beide Arten besitzen allerdings gemeinsame Merk-male,
so dass man sie – mit anderen Arten, die die gleichen Merkmale aufwei-sen – in einer
übergeordneten Gruppe zusammenfasst: die Ordnung der Anura oder Froschlurche. Die
Froschlurche wiederum bilden, zusammen mit anderen Ordnungen, die Unterklasse der
Lissamphibia bzw. die Klasse der Amphibien oder Lurche.
Das Leben kennt keine harten Grenzen. Zwischen den Arten, die wir nach durchaus
stichhaltig scheinenden Kriterien definieren, benennen und bear-beiten, bestehen tatsächlich
sehr oft Reproduktionsschwellen (also die Unfähigkeit, Gene zu mischen), es gibt aber auch
zahlreiche Fälle von Hybri-den. Das von den Kindern oft angeführte Beispiel sind Liger und
Tigon, halb Löwe, halb Tiger.
Es ist alles eine Frage des Maßstabs. Richtet man die Aufmerksamkeit auf zwei weit
voneinander entfernte Arten, zum Beispiel auf Löwe und Frosch, ist die Unfähigkeit Junge zu
zeugen ziemlich offensichtlich. Handelt es sich dagegen um einander nahe, oder gar sehr
nahe Arten, wird die Sache weniger klar. Die Zeugung von Hybriden ist in einigen Fällen
möglich, und manchmal sind sogar die Jungen fruchtbar.
Manchmal liegen die die Reproduktion verhindernden Barrieren zwischen zwei Arten rein im
unterschiedlichen Verhalten: Theoretisch und biologisch könnten sie sich untereinander
fortpflanzen (man kann zum Beispiel In-vitro-Befruch-tungen vornehmen), aber in der Natur
halten sie sich voneinander fern, selbst wenn sie am gleichen Ort leben.
Abb. 1: Ein Teichfrosch (Pelophylax esculentus)
Foto: Leo Bogert (Wikimedia Commons)
Zum Vergleich sei die Entfernung zwischen Löwe und Frosch etwa die zwi-schen Hamburg
und Peking. Wir befinden uns eindeutig an zwei verschiedenen Orten. Im Gegensatz dazu
sind Seefrosch (Pelophylax ridibundus) und Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) nur
einen Schritt voneinander entfernt. Befinden wir uns noch am selben Ort oder nicht? "Ja und
nein". Nein, weil es zwischen den beiden Arten ganz offensichtlich Unterschiede gibt. Ja, weil
sie Hybride erzeugen können und auch andauernd erzeugen: Frösche, die wir als
Teichfrösche (Pelophylax esculentus) bezeichnen und die sich selbst auch wieder
fortpflanzen können (und das auch mit den beiden Arten, deren Hybri-den sie sind).
2. Andere Definitionen der Art
Der morphologische Artbegriff [7], nach dem zusammengefasst wird, was sich ähnlich ist
("eine Art fasst alle Individuen zusammen, die sich sowohl unterein-ander ähneln als auch
ihren Eltern gleichen"), führt oft in die Irre. Widersprü-che stellen sich zum Beispiel bei dem
Phänomen der "konvergenten Evolution" heraus – das heißt bei Ähnlichkeiten der
Lebensweise und der Umgebung. Das Paradebeispiel für konvergente Evolution sind die weit
voneinander entfernten Arten Schmetterling und Kolibri.
Es gibt weitere Definitionen der Art: zum Beispiel diejenige, die sich auf ökolo-gische Kriterien
beruft, und seit zwanzig Jahren auch diejenige, die genetische Merkmale berücksichtigt
(damit sind allerdings noch längst nicht alle Probleme ausgeräumt!).
Man sollte in jedem Fall immer im Kopf behalten, dass die verschiedenen Art-begriffe vor
allem sprachliche Begriffe sind, selbst wenn die Taxonomen, die sich diese Begriffe
ausdenken (und immer wieder ausdenken), sich alle Mühe geben, sie so stichhaltig wie
möglich an die biologischen Gegebenheiten anzu-passen.
Und was sagt man den Schülern?
Es ist immer wieder erstaunlich, wie gezielt und intuitiv Kinder die konzeptu-ellen
Widersprüche der verschiedenen Artbegriffe erkennen. Viel besser als Erwachsene, die
gern allzu schnell als etablierte Fakten ansehen, was ihnen "sinnvoll" scheint. Je nach
Niveau der Klasse sollte man sehen, wie weit die Diskussion geführt werden kann, aber
sie ist, wenn man sich die Zeit nimmt, in jedem Fall möglich.
3. Und was ist mit dem Begriff "Rasse"?
Unter den Individuen einer Art (die miteinander Nachkommen haben können) beobachtet man
eine morphologische Vielfalt. Eine "Unterart" ist eine Gruppe von Individuen, die eine Zeit lang
vom Rest der Art (im Allgemeinen geogra-fisch) getrennt sind und eigene morphologische
Merkmale entwickeln. Wenn die Trennung lang genug andauert, so dass sich die
Unterschiede häufen, kommt es zur Artentrennung, das heißt zu einer genetischen
Verschiedenheit, die am Ende die Reproduktion zwischen ursprünglicher und veränderter Art
verhindert. Falls die Barriere wieder fallen sollte, kann sich die Unterart mit der
ursprüng-lichen Population mischen. Es kann gelegentlich auch passieren, dass sich die
Unterart mit der Zeit wieder in der ursprünglichen Art "auflöst".
Die Kinder haben keine Schwierigkeit, nach dem Kriterium "können Junge krie-gen", alle
Menschen als zu ein und derselben Art gehörig zu betrachten. Es steht dem Lehrer frei, die
Frage der "menschlichen Rassen", falls sie gestellt werden sollte, im Licht obiger
Erläuterungen zu diskutieren oder nicht. Er kann auf jeden Fall betonen, dass der Ausdruck
"Rasse" für Haustier-arten gebraucht wird und schon deshalb bei Menschen unangebracht ist.
4. Die binäre Nomenklatur
Auch wenn die Definition der Art sich im Lauf der Zeit gewandelt hat – an der Linné'schen
Nomenklatur, der sogenannten "binären Nomenklatur", wurde fest-gehalten. Ihr zufolge wird
jedes Lebewesen mit einem lateinischen Doppel-namen bezeichnet, der gewöhnlich kursiv
gedruckt erscheint: ein Name für die Gattung, groß geschrieben, gefolgt vom klein
geschriebenen Namen der Art. So lautet zum Beispiel die Bezeichnung für die Hauskatze
Felis catus, die des Gemeinen Regenwurms Lumbricus terrestris. In der Gattung werden die
nah verwandten Arten zusammengefasst, das heißt diejenigen, die vom nächsten
gemein-samen Vorfahren abstammen.
Früher beruhte der Gattungsbegriff auf Kriterien morphologischer Ähnlichkeiten. Heute weiß
man, dass ähnlich aussehende Lebewesen verschiedenen Arten angehören können, was sich
mit Hilfe der Genetik feststellen lässt. Man weiß aber auch, dass innerhalb einer Art eine
große genetische Vielfalt herrschen kann. Sinnvollerweise sollte der Begriff der Art, gleich von
der Grundschule an, mit den Kriterien Abstammung und Fruchtbarkeit der Individuen
verbunden werden und nicht mit Ähnlichkeitskriterien, die nicht stichhaltig sind
(Sexual-dimorphismus, Larven- und Erwachsenenstadium, usw.). Ein sicherer Umgang mit
dem Begriff der Art ist absolut wichtig, wenn es um Fragen der Biodiver-sität geht: geschützte
Arten identifizieren, Ernährungsweisen herausfinden, Nahrungsnetze erstellen, die Stellung
des Menschen in der Natur begreifen, den Zustand der Biodiversität evaluieren, Naturräume
schützen usw. Zumal der Begriff in den Medien gern falsch oder in verkürzender Weise
verwendet wird.
Sprachliche Verwirrungen
Die geläufigen Tiernamen bezeichnen in den seltensten Fällen eine einzige Art. Die
Namen "Frosch", "Kröte", "Schwalbe", "Regenwurm" usw. stehen jeweils für mehrere
unterschiedliche Arten. Auch das männliche oder weib-liche Geschlecht der gewöhnlichen
Tiernamen kann zu Unsinn führen, so etwa in Sätzen wie "der Frosch ist das Männchen
der Kröte", "die Eule ist das Weibchen des Kauzes". Natürlich gibt es in jeder Art von
Fröschen, von Kröten, von Eulen und von Käuzen Männchen und Weibchen.
Abb. 2: Ein Streifenkauz (Stryx varia)
Foto: Mdf (Wikimedia Commons)
Die Biosphäre besteht aus Ökosystemen
Lebewesen haben die meisten Bereiche des Planeten besiedelt, auch die un-wirtlichsten wie
Wüsten, extrem heiße oder extrem salzige Gewässer. Lebewe-sen sind abhängig von einer
Vielzahl anderer Lebewesen sowie von der unbe-lebten Umgebung – Boden, Wasser, Licht,
Klima. Der Wissenschaft, die sich mit den Beziehungen der Lebewesen zueinander und zu
ihrer Umgebung beschäf-tigt, hat der deutsche Biologe Ernst Haeckel 1866 den Namen
Ökologie gege-ben, abgeleitet von den griechischen Wörtern oikos (Haus, Habitat) und logos
(Rede).
1. Was ist ein Ökosystem?
In der Ökologie werden die Wechselwirkungen zwischen den Lebewesen und den
verschiedenen Umweltfaktoren untersucht. Dabei werden sowohl die abiotischen
(Temperatur, Wasser, Licht, Boden usw.) als auch die biotischen Umweltfaktoren untersucht,
das heißt solche, an denen Lebewesen beteiligt sind. Die Gesamtheit der Lebewesen einer
bestimmten Umgebung bildet mit ihr einen funktionalen Zusammenhang, dessen Bestandteile
– die Lebewesen und die abiotischen Faktoren – miteinander wechselwirken. Für solch eine
"Gemein-schaft" hat der englische Botaniker Arthur Tansley 1935 den Begriff Ökosystem als
ökologische Grundeinheit vorgeschlagen. Für eine Umgebung und ihre cha-rakteristischen
Bedingungen hat Tansley die Bezeichnung Biotop geprägt. Und die Gesamtheit der
Lebewesen in einem Biotop wird Biozönose genannt. Dem-gemäß kann man schreiben:
Ökosystem = Biotop + Biozönose
Es gibt eine Vielzahl von Ökosystemen, zum Beispiel Wiese, Wald, Korallenriff, Bach,
landwirtschaftliches Ökosystem (Agrarökosystem), städtisches Öko-system usw. Jedes
Ökosystem weist charakteristische, ihm eigene, abiotische Faktoren und Lebewesen auf.
2. Ökosysteme verändern sich ständig
In dem einfachen Wort Ökosystem verbergen sich komplexe und sehr unter-schiedliche
Wirklichkeiten. Zum einen sind die geografischen Grenzen eines Ökosystems manchmal
schwer festzustellen, und sie können sich auch mit der Zeit ändern. Zum anderen ist ein
gegebenes Ökosystem oft Teil eines größeren Gebietes, das aus mehreren verschiedenen
Ökosystemen besteht und als ökologischer Komplex bezeichnet wird. Außerdem können
Ökosysteme neben denen der Jahreszeiten auch noch anderen zeitlichen Veränderungen
unter-liegen (flutbedingte Wasserstände, temporäre Wasserläufe und Tümpel,
Über-schwemmungen, Dürre, Sturm usw.), die sich auf die Verteilung der Lebewe-sen
auswirken. Wenn ein Ökosystem im Lauf der Zeit zu einem Gleichgewichts-zustand – dem
Klimaxstadium – gekommen ist, kann dieser leicht wieder zer-fallen, falls das System, ganz
besonders auch durch menschliche Einwirkung, gestört wird.
Die Lebewesen unterhalten vielfältige Beziehungen zu ihrer Umgebung: Die Umwelt wirkt auf
die Lebewesen, und umgekehrt wirken diese auch auf ihre Umgebung. Zum Beispiel hat die
biologische Aktivität der Lebewesen (Fotosyn-these, Gärung, Atmung) seit dem Auftauchen
von Leben vor etwa 3,5 Milliar-den Jahren die Atmosphäre des Planeten von Grund auf
verändert (sie hat insbesondere ihren Sauerstoffgehalt fortwährend vergrößert) und zur
Bildung der Böden beigetragen. Ein Beispiel aus neuester Zeit ist die seit dem Beginn der
Industrialisierung zunehmende Treibhausgaskonzentration in der Atmos-phäre. Dieser durch
die Menschen versursachte Treibhauseffekt hat einen ent-scheidenden Einfluss auf die
Klimaentwicklung.
Abb. 3: Blätter des wilden Weins (Vitis vinifera subsp. sylvestris)
Foto: Jenny Schlüpmann
3. Die Ökosysteme hängen alle von einer Energiequelle ab: der Sonne
Charakteristisch für Ökosysteme sind vor allem ihre Nahrungsnetze. Die komp-lexe
Vernetzung der Nahrungsweisen unter den Lebewesen ist durch einen ständigen Materiefluss
gekennzeichnet: Jede Art kann der Ernährung einer oder mehrerer anderer Arten dienen. Mit
wenigen Ausnahmen – wie den hydro-thermalen Quellen der Tiefsee (Schwarze und Weiße
Raucher) – sind alle Ökosysteme von der gleichen Energiequelle abhängig: vom Sonnenlicht.
Das, was unter den Lebewesen als Nahrung "weitergegeben" wird, ist organische Materie, die
durch Fotosynthese erzeugt wird. Bei der Fotosynthese wird in den chlorophyllhaltigen
Lebewesen (Pflanzen, Algen, Phytoplankton) mit Hilfe der Energie des Sonnenlichts
Kohlenstoffdioxid und Wasser in organische Materie umgewandelt. Diese organische Materie
ist die einzige Materie- und Energiequelle der Ökosysteme.
4. Autotrophie und Heterotrophie
Da sie sich von mineralischer Materie ernähren, werden die chlorophyllhaltigen Organismen
als autotroph bezeichnet (vom griechischen autos = selbst und trophe = Nahrung). Und weil
sie der Ursprung der organischen Materieflüsse in den Ökosystemen sind, bezeichnet man
sie auch als Primärproduzenten. Alle anderen Lebewesen sind heterotroph (vom griechischen
heteros = das andere und trophe = Nahrung) und werden als Konsumenten bezeichnet. Aber
auch sie "erzeugen" organische Materie, die anderen Konsumenten als Nahrung dienen kann,
weshalb auch sie als Produzenten zu betrachten sind. Es handelt sich um
Sekundärproduzenten, wenn sie sich von Primärproduzenten ernähren, um
Tertiärproduzenten, wenn Sekundärproduzenten ihre Nahrung bilden usw. Bestimmte
Mikroorganismen können Abfälle und Kadaver in mineralische Materie umsetzen und werden
folglich als Zersetzer (auch Destruenten) bezeichnet.
Bei den zwischen verschiedenen Arten eines Ökosystems bestehenden Bezie-hungen geht
es jedoch nicht nur um die Ernährung. Es bestehen auch Bezie-hungen im Zusammenhang
mit Schutz, Transport und Fortpflanzung. So sind die meisten Blütenpflanzen auf die
Pollenübertragung durch Insekten ange-wiesen.
5. Die biogeochemischen Zyklen
Die aus der Mineralisierung organischer Materie hervorgehenden Substanzen – wie
Kohlenstoffdioxid, Nitrate oder Ammoniumverbindungen – werden wieder in den Kreislauf
aufgenommen, wenn die chlorophyllhaltigen Pflanzen, die Primär-produzenten, sie
absorbieren. Der Kohlenstoff – wie auch die anderen chemi-schen Elemente, aus denen sich
die organische Materie zusammensetzt – zirkuliert in den Ökosystemen in Form von
verschiedenen molekularen Verbin-dungen (Kohlenstoffdioxid, Zucker, Proteine usw.). In
seinen chemischen Umwandlungen wandert der Kohlenstoff von einem Reservoir ins andere:
So gelangt das Kohlenstoffdioxid aus dem Reservoir "Atmosphäre" in das Reservoir
"Biosphäre", wenn es in der Fotosynthese zur Erzeugung organischer Materie "eingesetzt"
wird. Die verschiedenen chemischen Elemente, die zwischen den Reservoirs zirkulieren,
werden immer wieder in den Kreislauf eingebracht, man spricht vom biogeochemischen
Kreislauf.
Die gesamte lebende Materie wird Biomasse genannt, aber auch die tote organische Materie
spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Die Menge an Biomasse schwankt erheblich je
nach Ökosystem, sie hängt hauptsächlich von den im Biotop herrschenden Bedingungen ab.
Man schätzt ihre Menge auf ca. 200 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar (tC/ha) in den tropischen
Regenwäl-dern, auf ca. 50 tC/ha in Wäldern der warmtemperierten Zone, ca. 5 tC/ha in
Grasland und < 1 tC/ha in der Wüste [8]. Ist ein Ökosystem im Gleichgewicht, so bleibt die
Biomasse der drei Kategorien von Lebewesen – Primärproduzen-ten, Verbraucher und
Zersetzer – ungefähr konstant.
Abb. 4: Vegetationstypen mit unterschiedlicher Biomasse (Bildnachweis)
6. Der Begriff der ökologischen Nische
In einem Ökosystem hat jede Art einen bestimmten Platz und eine bestimmte Rolle. Eine Art
findet im Ökosystem ihre Nahrungsquellen und ihr Habitat, geht in ihrem eigenen Rhythmus
ihren Tätigkeiten nach und hat unterschiedliche Beziehungen zu anderen Arten des
Ökosystems. Die einzigartige Stellung und Rolle einer gegebenen Art im Ökosystem
bezeichnet man als ihre ökologische Nische. Zwei unterschiedliche Arten können nicht die
gleiche ökologische Nische besetzen: Wenn zwei Arten um eine Nische konkurrieren,
überlebt am Ende nur eine von beiden. Deshalb sollte man es auch unbedingt vermeiden,
fremde Arten – sogenannte invasive Arten – in ein Ökosystem einzuführen: Wenn die fremde
Art mit den einheimischen Arten in einer ökologischen Nische konkurriert, laufen Letztere die
Gefahr unterzugehen. So hat in Frankreich die Einführung des Amerikanischen Flusskrebses
nahezu zum Untergang der einhei-mischen Arten geführt. Genauso kam es durch das
Aussetzen von Rotwangen-Schmuckschildkröten aus Florida zur Konkurrenz mit der
Europäischen Sumpf-schildkröte, die seither vom Aussterben bedroht ist.
Die Biodiversität als Folge der Evolution
Die Evolutionstheorie zählt zu den Grundlagen der modernen Wissenschaft. Sie ist derart
fruchtbar, dass mit ihr die meisten Eigenschaften der Welt der Lebe-wesen eine Erklärung
finden:
Sie lässt uns die Geschichte des Lebens verstehen, hauptsächlich durch die
Erschließung des Archivs, das die Fossilien darstellen, aber auch an-hand genetischer
Analysen.
Sie erklärt, warum das Leben sich einerseits – vor allem biochemisch, genetisch und
physiologisch gesehen – durch eine tiefgründige Einheit-lichkeit auszeichnet und
gleichzeitig eine außerordentliche Vielfalt auf-weist: Bis heute wurden etwas 1,8
Millionen verschiedene Arten erfasst und beschrieben.
Sie trägt zum Verständnis der geografischen Verbreitung der Lebewesen bei, sowohl in
der Gegenwart als auch in der Vergangenheit.
1. Die biologische Evolution wird untermauert von zahlreichen
überein-stimmenden Indizien
Die Wissenschaft verfügt heute über unabhängige Beweise aus Geologie, Palä-ontologie und
Biologie, dass das Leben eine etwa 3,5 Milliarden Jahre lange Geschichte hat [9], und dass
alle Lebewesen sich im Laufe geologischer Zeit-räume aus einem gemeinsamen Ursprung
entwickelt haben. Bisher wurden diese grundlegenden Vorstellungen vom gemeinsamen
Ursprung und der Evolu-tion der Lebewesen durch kein einziges wissenschaftliches Ergebnis
in Frage gestellt. Die Evolutionstheorie gilt daher in der Welt der Wissenschaft auch als
unstrittig. Was nicht heißt, dass nicht einzelne Aspekte der Evolution nach wie vor
Gegenstand von Forschung und Diskussion bleiben. Die Forschung liefert regelmäßig
genauere Einzelheiten oder berichtigt ihre Ergebnisse.
Eine der Konsequenzen der Evolution ist die, dass Arten umso enger miteinan-der verwandt
sind, je jünger ihr gemeinsamer Vorfahre ist. Daher werden die Lebewesen heute auf
Grundlage der phylogenetischen Systematik klassifiziert, das heißt: Man klassifiziert
Lebewesen nach ihrem Verwandtschaftsgrad, den man anhand der Merkmale erkennt, die sie
miteinander gemein haben. Der Evo-lutionsbegriff ist in der Biologie so zentral geworden,
dass Theodosius Dob-zhansky [10], einer der bedeutendsten Evolutionsspezialisten, 1973
schrieb: "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution" ("Nichts in der
Biologie hat einen Sinn außer im Licht der Evolution".)
2. Alle heutigen Lebewesen stammen von einem gemeinsamen Vorfahren
ab
Die Biologen sind übereingekommen, die Lebewesen in drei große Gruppen, Domänen
genannt, zusammenzufassen: Die Bakterien, die Archaeen (Urbak-terien) und die Eukaryoten
(Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern besitzen). Diese drei Gruppen stammen von einem
gemeinsamen Vorfahren ab, LUCA (Last Universal Common Ancestor = letzter universeller
gemeinsamer Vor-fahre), und bilden die drei Äste des Stammbaumes des Lebens. Alle
Lebewe-sen, die heutigen sowie längst ausgestorbene, gehören zu einem dieser drei Äste.
Unter den Eukaryoten findet man einzellige und mehrzellige Lebewesen. Zu Letzteren
gehören die Pflanzen, verschiedene Algenarten, die Tiere und die Pilze. Die Bakterien,
Archaeen und alle einzelligen Lebewesen sind mit bloßem Auge nicht zu sehen, man
bezeichnet sie daher auch als Mikroorganismen. Trotz ihrer mikroskopischen Größe spielen
sie eine sehr wichtige Rolle in den Ökosystemen, und man schätzt, dass sie etwa die Hälfte
der gesamten Bio-masse (Masse aller Lebewesen) ausmachen.
Abb. 5: Petrischale mit einer Schimmelpilzkultur (Penicillium chrysogenum)
Foto: Crulina 98 (Wikimedia Commons)
3. Der Begriff der natürlichen Selektion
Charles Darwin [11] war der Erste, der das Phänomen der natürlichen Selektion beschrieb.
Die natürliche Selektion ist einer der Mechanismen, die für die Evo-lution der Arten
verantwortlich ist. Sie erklärt, wie sich Arten im Laufe der Gene-rationen an die
Lebensumgebungen angepasst haben.
Das Prinzip der Evolution nach Ernst Mayr:
Merkmale (morphologische, physiologische oder Verhaltensmerkmale), die das Überleben
und die Fortpflanzung der Lebewesen begünstigen, häufen sich in einer Population von
einer Generation zur nächsten. Das ist nicht weiter erstaunlich, denn die Träger dieser
Merkmale haben mehr Nachkom-men (weil sie weniger schnell sterben, weil sie sich
besser ernähren kön-nen), und diese Nachkommen erben diese Merkmale ebenfalls.
Zum besseren Verständnis
Innerhalb einer Art gibt es eine große Vielfalt an Individuen mit den verschiedensten
Merkmalen. Diese haben sie von den Eltern geerbt: Sie tauchen in zufälliger
Mischung bei den Nachkommen auf. Manchmal, und wiederum ganz zufällig,
entsteht eine "Mutation", das heißt ein völlig neues Merkmal.
In einer gegebenen Umgebung führen die Individuen einer Art ihr Leben: Sie werden
geboren, ernähren sich, wachsen, pflanzen sich fort und sterben. Je mehr sie sich
fortpflanzen, umso mehr werden sie ihre spezifischen Merkmale weitergeben.
Diejenigen, die länger leben, werden sich verstärkt fortpflanzen können (sie haben
dazu mehr Zeit), das Gleiche gilt für die Stärkeren (sie setzen sich besser durch).
In dieser Umgebung sind, unter den Bedingungen des Habitats, die Träger
bestimmter Merkmale gegenüber anderen Individuen begünstigt
("Selektionsdruck"). Weiße Schmetterlinge auf weißen Bäumen werden seltener von
Vögeln gefressen als braune, sie leben länger; langhalsige Gazellen können sich in
einer Gegend mit hohen Sträuchern leichter ernähren als ihre Artgenossen mit
kurzen Hälsen und sind folglich bei besserer Gesundheit.
Derart begünstigte Individuen sterben nicht so schnell (sie werden eher ihren
Räubern entkommen, weil sie sich besser ernähren konnten) und haben daher
mehr Nachkommen. Ihre Jungen werden die günstigen Merkmale erben und
ihrerseits in dieser Umgebung begünstigt sein. Im Lauf einiger Generationen werden
die günstigen Merkmale in der Popula-tion überwiegen. Man spricht dann von
"Adaptation" (evolutionärer Anpassung) und es liegt ein Fall von natürlicher Selektion
vor.
Anmerkung
Darwin war der Begründer der Evolutionstheorie. Seither haben jedoch viele
Wissenschaftler diese Theorie fortlaufend verfeinert (Ernst Mayr, Richard Dawkins,
...). Der Name Darwin ist für die Wissenschaftsgeschichte bedeutend, man sollte
allerdings nicht von "Darwin'scher Theorie" sprechen, ebenso wenig wie bei der
Gravitation von "Newton'scher Theorie" (auch hier sind Jahrhun-derte vergangen,
in denen die Theorie durch andere Wissen-schaftler weiterentwickelt wurde, unter
anderem durch Albert Einstein).
Einige zentrale Aspekte der Evolutionstheorie und verbreitete Vorstellungen
1) Eine "Adaptation" bezieht sich immer auf eine "gegebene Umgebung". Wenn diese sich
ändert, stehen die Zeiger wieder auf null. Zum Beispiel sind die Lun-gen eine großartige
evolutionäre Anpassung an eine Luftumgebung. Dagegen sind sie im Wasser eher ein
Nachteil.
Verbreitete Vorstellung Nr. 1:
Es ist nicht sinnvoll zu sagen, eine Art sei "besser angepasst": Sie kann das erstens nur sein
in Bezug auf eine andere Art und zweitens nur in einer "gege-benen Umgebung". Der Mensch
ist im Wald besser angepasst als ein Fisch. Aber in einem Teich ist der Fisch besser
angepasst als der Mensch. Der Satz "der Mensch ist am besten angepasst" ist sinnlos.
2) Bei der natürlichen Selektion spielt der Zufall eine entscheidende Rolle. Die innerhalb einer
Art vorhandenen Merkmale entstehen (durch Mutation) und vermischen sich (im Lauf der
Generationen) zufällig. Diese Merkmale sind vor jeder Selektion vorhanden, sie existieren in
einer Population auch schon, bevor der Einfluss der Umwelt ins Spiel kommt. Die lang- und
die kurzhalsigen Gazel-len gibt es in der Art, bevor diese auf eine an Buschwerk und Bäumen
reichen aber an Gräsern armen Umgebung trifft.
Verbreitete Vorstellung Nr. 2:
Eine Art passt sich nicht an, um einer Veränderung der Umgebung zu begeg-nen. Sie besitzt
in der Reihe ihrer verfügbaren Merkmale bereits solche, die der Art auch in der veränderten
Umgebung ihre Fortdauer sichern; die Umweltver-änderung ändert nur das zahlenmäßige
Verhältnis der Individuen mit dem vorteilhaften Merkmal (das der veränderten Umgebung
besser angepasst ist).
3) Nach einigen Generationen werden die in der gegebenen Umgebung vor-teilhaften
Merkmale überwiegen. Aber auch Individuen ohne diese Merkmale wird es weiterhin geben,
sie werden nur seltener vorkommen. Wenn sich die Umgebung erneut ändert, werden sie
vielleicht eines Tages die Begünstigten sein. Bei Umweltveränderungen ist die Vielfalt der
Individuen einer Art ein wertvolles Reservoir.
Verbreitete Vorstellung Nr. 3:
Bei der natürlichen Selektion handelt es sich nicht um ein "Gesetz des Stärke-ren", das die
am wenigsten angepassten Individuen aussiebt. Es ist eher eine Frage des
"Fortpflanzungserfolges". Begünstigte zeugen mehr Nachkommen; sie haben die Merkmale,
die in der Population überwiegen werden. Aber auch weniger begünstigte Individuen sterben
nicht aus. Sie existieren auch (meis-tens) weiterhin – in kleiner Zahl – und sind eine Art
Versicherungsschutz bei eventuellen Veränderungen der Umwelt.
4) Wenn ein Ereignis (meistens geografischer Art, zum Beispiel ein Bergsturz, die
Zerstückelung eines Waldes, die Öffnung einer Schlucht, ...) die Population einer Art in zwei
Teile zerbrechen lässt, können die beiden Populationen zwei verschiedenen Umgebungen
ausgesetzt sein (zum Beispiel einem kälteren Klima auf einer Seite des Berges und einem
wärmeren auf der anderen). Die vorteil-haften Merkmale werden in beiden Populationen nicht
die gleichen sein, weil die Umgebungen verschieden sind. Im Lauf der Generationen werden
die beiden Populationen verschiedene Wege einschlagen. Auf der einen Seite des Berges
(auf der kälteren) werden die langhaarigen mehr Junge haben und dieses Merkmal wird
schließlich überwiegen. Auf der anderen Seite werden die kurzhaarigen Individuen in der
Überzahl sein.
Nach langer Zeit und durch zufällige Mutationen werden die beiden Arten sich so sehr
unterscheiden, dass zwischen den Individuen der beiden Arten keine Fortpflanzung mehr
stattfinden kann, auch wenn sie wieder in einer Umgebung vereint sind. Es liegt ein Fall von
"Speziation" (Artbildung) vor: die Entstehung von zwei unterschiedlichen Arten. Dies ist einer
der Mechanismen der Evolu-tion.
Verbreitete Vorstellung Nr. 4:
Die Evolution ist zwar zum großen Teil eine Folge von Umweltveränderungen, aber es spielen
auch andere Mechanismen eine Rolle, zum Beispiel die "sexuelle Selektion": Wenn die
Weibchen Männchen mit großen Federn bevorzugen (bei Pfauen zum Beispiel), werden
Letztere mehr Nachkommen haben und ihre Merkmale verstärkt weitergeben (auch wenn sie
keinerlei Vorzüge in Bezug auf die Umwelt bringen. Das Gegenteil ist hier übrigens der Fall:
Sie haben Mühe, sich zu bewegen, und entkommen ihren Verfolgern schlechter). Nach
einigen Generationen wird die Mehrzahl der männlichen Pfauen große Federn haben.
Verbreitete Vorstellung Nr. 5:
Die Evolution hat nichts mit "Fortschritt" zu tun. Wie wir gesehen haben, ist es allenfalls
sinnvoll von einem "Fortschreiten" in Bezug auf eine gegebene Umge-bung zu sprechen,
denn diese Umgebung hört nun einmal nicht auf, sich zu ändern. Global betrachtet sind die
Lebewesen mit der Zeit komplizierter gewor-den. Bei Werturteilen ist jedoch Vorsicht geboten:
Bei Computerprogrammen ist das Beste dasjenige, das mit den wenigsten Operationen eine
Aufgabe erfüllt (also das unkomplizierteste). Seit Entstehung des Lebens auf der Erde werden
Lebewesen geboren, sie wachsen, zeugen Nachkommen und sterben (alle erfüllen "die
gleichen Aufgaben"), dabei ist ihr mehr oder weniger kompli-zierter Aufbau irrelevant.
5) Aus den ersten vor etwa 3,5 Milliarden Jahren erschienenen einzelligen Organismen haben
sich die heute auf der Erde lebenden Arten entwickelt: Das ist das Ergebnis der natürlichen
Selektion.
Verbreitete Vorstellung Nr.6:
Alle Arten haben also eine gleich lange Evolution hinter sich: das Bakterium, die Krake, der
Farn, der Mensch, die Platane, das Protozoon, der Clownfisch. Keine Art ist "entwickelter" als
andere, da alle die gleiche Evolutionsdauer durchlaufen haben. Das Wort "entwickelt" wird oft
falsch gebraucht. "Evolu-tion" bedeutet "Transformation", mit dem Wort verbindet sich kein
Werturteil. Häufig wird "höher entwickelt" gesagt, wenn "wertvoller" gemeint ist ("wir sind doch
schließlich höher entwickelt als Nacktschnecken und Ameisen!"). Manch-mal soll mit "höher
entwickelt" auch "besser angepasst" zum Ausdruck gebracht werden. Dabei wird nicht gesagt
in Bezug auf was und in welcher Umgebung. Unsere Auffassung von der Welt und der
Biodiversität ist sprach-abhängig. Wir sollten also nicht sagen "der Mensch ist höher
entwickelt", sondern allenfalls "der Mensch ist besser an die Stadtumgebung angepasst als
die Nacktschnecke". Und da sich die Umgebung ständig ändert, sollten wir hinzufügen "im
Moment".
4. Einige wichtige Daten der Evolution
Im mittleren Silur, vor ungefähr 420 Millionen Jahren, entwickelten sich aus den Grünalgen
die ersten Landpflanzen. Die ersten Vertreter waren wahrscheinlich Fadenalgen, die bei Ebbe
bereits vorübergehend ohne Wasser überleben konn-ten. Im Laufe ihrer Evolution bildeten
ihre Vegetationskörper differenzierte Gewebe aus, aus denen Organe wie Sprossachsen,
Wurzeln und Blätter ent-standen. Algen haben keine differenzierten Gewebe, ihr
Vegetationskörper besteht aus lauter ähnlichen Zellen, die sich zu Fäden reihen oder flächige
Gebilde hervorbringen. Einen solchen Vegetationskörper (ohne Sprossachse, Wurzeln und
Blätter) nennt man Thallus oder Lager. Das Auftreten von Pflan-zen stellte eine
entscheidende Etappe in der Geschichte des Lebens dar. Sie veränderten die bis dahin rein
mineralischen Böden auf den Kontinenten radi-kal. Die Böden beherbergten von nun an eine
Mikrofauna, die dort Nahrung und Schutz vor dem Austrocknen fand.
Im Devon, vor ca. 400 Millionen Jahren – zu der Zeit tauchten die ersten Insekten auf –,
haben sich offensichtlich zwei Linien von chlorophyllhaltigen Landpflanzen getrennt: die
Moose und die Gefäßpflanzen (die Leitbündel für den Transport des Pflanzensafts besitzen).
Die ersten Wirbeltiere mit vier Extremitäten (die Tetrapoda) erschienen vor etwa 370 Millionen
Jahren. Die ersten Gefäßpflanzen, die Farne, erreichten ihr Verbreitungsmaximum vor etwa
300 Millionen Jahren, im Karbon. Dieses erdgeschichtliche Zeitalter verdankt seinen Namen
der Tatsache, dass die Baumfarne zu der Zeit riesige Wälder bildeten, deren Fossilisation zu
ausgedehnten Kohlevorkommen führte, die heute abgebaut werden. Gegen Ende dieses
Zeitalters waren einige Wirbeltiere in der Lage, sich außerhalb des Wassers fortzupflanzen,
sie begannen das Festland zu bevölkern. Das Aussterben der meisten Farne setzte bereits im
Perm ein, vor etwa 200 Millionen Jahren.
Die Spermatophyten oder Samenpflanzen spalteten sich wahrscheinlich schon im Devon, vor
etwa 400 Millionen Jahren, von den Farnen ab. Sie begannen jedoch erst viel später, vor
ungefähr 100 Millionen Jahren, die Landflora zu dominieren – ungefähr zu der Zeit, als sich
Vögel und Säugetiere voneinander abspalteten. Samenpflanzen konnten sich auch außerhalb
des Wassers fort-pflanzen (Pollentransport durch Wind und Tiere) und waren infolgedessen
besser an die Luftumgebung angepasst. Die Samenpflanzen sind heute mit etwa 260 000
beschriebenen Arten die zahlreichste Gruppe unter den Pflan-zen. Sie besetzen alle Habitate
des Planeten mit Ausnahme der extremsten.
5. Die heutige Fauna
Die Fauna verteilt sich auf etwa dreißig Stämme. Ein Zweig oder Stamm (Phylum) ist definiert
als die Gesamtheit der Lebewesen, die von einem gemeinsamen Vorfahren den gleichen
Bauplan geerbt haben. Die paläonto-logischen Archive zeigen, dass all diese Stämme (Phyla)
seit dem Kambrium vor 550 Millionen Jahren bestehen. Die Stämme mit den zahlreichsten
Tierarten sind (siehe Bildtafel 33):
die Anneliden oder Ringelwürmer (ungefähr 15 000 Arten),
die Nematoden oder Fadenwürmer (etwa 25 000 Arten),
die Vertebrata oder Wirbeltiere mit etwa 53 000 Arten (die Wirbeltiere sind ein
Unterstamm der Chordatiere),
die Mollusca oder Weichtiere mit etwa 70 000 Arten, und vor allem
die Arthropoden oder Gliederfüßer (mehr als 1,2 Millionen Arten, davon mehr als 1
Million Insekten).
Tier oder Pflanze? [12]
Pflanzen und Tiere sind entfernte Verwandte und haben einen sehr alten gemeinsamen
Vorfahren. Dieser Vorfahre war, wie auch sie selbst, ein euka-ryotisches Lebewesen.
Eukaryoten bestehen aus einer oder mehreren Zellen, deren genetisches Material durch eine
Membran geschützt ist; die Zellen besitzen einen Zellkern. Bei Prokaryoten dagegen (den
Bakterien zum Beispiel) ist das genetische Material nicht von einer Membran umschlossen.
Etwa gleichzeitig mit der Bildung der Eukaryoten, also sehr früh in der Evolutions-geschichte,
trennten sich diese in zwei Gruppen: das Tier- und das Pflanzen-reich. Tiere und Pflanzen
erwarben jeweils sehr spezielle Merkmale und ent-wickelten sich zu sehr unterschiedlichen
Lebewesen.
a) Obwohl beide Eukaryoten sind und innere Organellen (Teile des Funktions-apparates der
Zelle wie die Mitochondrien) besitzen, weisen tierische und pflanzliche Zellen große
Unterschiede auf: Tier- und Pflanzenzelle sind beide von einer Membran umgeben. Die
pflanzliche Zelle hat zusätzlich eine feste Wand aus Cellulose. Die Zelle ist formstabiler und
weniger beweglich.
In der pflanzlichen Zelle befindet sich eine mit Flüssigkeit gefüllte Kammer, die Vakuole. Die
pflanzliche Zelle enthält in ihrem Funktionsapparat etwas, das es in den tierischen Zellen nicht
gibt: das Chloroplast, das Chlorophyll enthält und bei der Fotosynthese eine zentrale Rolle
spielt (siehe weiter unten). Die grüne Farbe der Chloroplasten ist bei (fast) allen Pflanzen
auch äußerlich und mit bloßem Auge gut zu erkennen.
b) Diese (morphologischen) Unterschiede spiegeln sich in den verschiedenen
physiologischen Funktionen der Lebewesen wider. Es gibt Unterschiede bei der
Fortpflanzungsweise, der Atmung und der Ernährung. Unser Augenmerk soll sich im
Folgenden auf die Ernährung richten. Tiere und Pflanzen verfolgen bei der Ernährung
unterschiedliche Strategien.
Tiere bewegen sich (bis auf Ausnahmen) und suchen ihre Nahrung – manchmal über
Entfernungen von Tausenden von Kilometern. Fast immer besteht die Nahrung aus anderen
Lebewesen. Tiere sind heterotroph, das heißt, sie brau-chen biologische (organische)
Materie, pflanzliche oder tierische, um heran-wachsen und überleben zu können. Außerdem
wachsen Tiere nicht ihr Leben lang.
Die Pflanzen gehen anders vor. Sie bleiben an einem Ort, an dem die für die Fotosynthese
notwendigen Bedingungen gegeben sind. Ihre Ernährungsweise ist unabhängig von anderen
lebenden Organismen. Pflanzen sind autotroph, sie bauen ihre organische Materie selbst auf
und wachsen, indem sie Sonnenlicht, Wasser und mineralische Salze aus dem Boden und CO
2 aus der Luft aufneh-men. Pflanzen wachsen ihr Leben lang.
Abb. 6: Buchenwald (Rotbuchen: Fagus sylvatica)
Foto: Willow (Wikimedia Commons)
c) Wie überall im Bereich des Lebendigen gibt es auch Ausnahmen. Zum Beispiel:
Fotosynthese bei nicht pflanzlichen Lebewesen, die eine Symbiose mit pflanz-lichen
Zellen eingehen und manchmal sogar Fotosynthesegene in ihr Genom einschleusen.
Ein Beispiel ist die grüne Meeresschnecke Elysia chlorotica, die im Brackwasser der
nordamerikanischen Atlantikküste vorkommt [13].
Meeresschnecke Elysia chlorotica
Abb. 7: Die Meeresschnecke Elysia chlorotica
Foto: Patrick Krug (Encyclopedia of Life)
Autotrophie bei Tieren, zum Beispiel bei den Meerwürmern der "schwarzen Raucher",
die ihre organische Materie aus chemischen Substanzen aufbauen, die sie aus dem
Wasser der Tiefseequellen entnehmen.
Tiere, die sich nicht bewegen und dem Grundsatz folgen: "An meinem Platz habe ich
alles, was ich brauche, also bleibe ich hier und verschwende keine Energie". Zu dieser
Kategorie gehören zum Beispiel sessile Filtrierer wie Schwämme, Korallen oder
Muscheln. Sie sitzen an Felsen oder am Meeres-boden fest und ernähren sich, indem
sie schwebende Nahrungspartikel aus dem Meerwasser filtrieren.
Pflanzen, die sich bewegen, wenn auch nicht fortbewegen: die Mimose zum Beispiel [14]
(Mimosa pudica, auch Schamhafte Sinnpflanze oder "Rührmich-nichtan", die
sekundenschnell auf Umweltreize reagiert) oder die Sonnenblume, die ihren
Blütenstand nach der Sonne ausrichtet.
Pflanzen, die ihre Nahrung durch den Verzehr tierischer Organismen ergänzen
(fleischfressende Pflanzen) oder gar gänzlich heterotrophe Schmarotzerpflan-zen
(Phytoparasiten). Manchen Schmarotzerpflanzen ist sogar ihr Chlorophyll abhanden
gekommen – weil sie es nicht (mehr) brauchen. Ein Beispiel hierfür ist die Nesselseide (
Cuscuta europaea, auch Europäische oder Hopfenseide genannt), die zu den
Windengewächsen gehört und sich um ihre Wirtspflanzen – Brennnessel und Hopfen –
windet und sich von ihnen ernährt.
Abb. 8: Nesselseide (Cuscuta europaea)
Foto: Michael Becker (Wikimedia Commons)
Wie immer gibt es zwar die "großen Schubladen", in die man alles, was die Natur uns bietet,
einordnen kann, aber sie passen nicht immer. Lebewesen, die in einer gegebenen Umgebung
gut "funktionieren", werden mit großer Wahr-scheinlichkeit ihre Gene weiterverbreiten – selbst
wenn bei der neuen Pflanze die Fotosynthese oder bei dem neuen Tier die Beweglichkeit auf
der Strecke geblieben sind.
Wenn wir also unbedingt alles in Schubladen packen wollen (der menschliche
Ordnungswahn!) und dabei durcheinander kommen, sollten wir einen Blick auf die Geschichte
der beobachteten Lebewesen werfen und sie nicht vorschnell einordnen, schon gar nicht
allein aufgrund ihrer Lebensweise. Eine Koralle (deren Zellen und Physiologie definitiv die
eines Tieres sind – Korallen gehören zu den Nesseltieren) und eine Pfingstrose (eindeutig
eine Pflanze) bewegen sich beide nicht. Aber hat ihre Unbeweglichkeit die gleiche
"Geschichte"? War die Koralle schon immer unbeweglich oder handelt es sich um eine für sie
vorteilhafte "Neuerung", die eines Tages zufällig in der Reihe der evolutions-geschichtlichen
Vorfahren (die sich durchaus bewegten) auftauchte? Eine Klassifizierung ist letztendlich nur
dann sinnvoll, wenn sie auch evolutions-geschichtlich begründet ist.
6. Fossilien
Zahlreiche Lebewesen – insgesamt aber dennoch nur ein sehr kleiner Teil (der auf 0,01 bis
0,1% geschätzt wird) aller Lebewesen, die im Lauf der geolo-gischen Zeitalter die Erde
bevölkerten – haben fossile Spuren hinterlassen, in Stein aufgezeichnete Zeugnisse der
Geschichte des Lebens. Ihre Untersu-chung ergibt, dass über den ganzen Zeitraum der
Erdgeschichte Arten ver-schwunden sind und neue auftauchten. Fossilien erzählen von
ausgestorbenen Arten und zeigen, wie sich manche Arten in der Evolutionsgeschichte
verän-dert haben: Sie sind Zeugen der Evolution. Die ältesten entdeckten Spuren des Lebens
sind etwa 3,5 Milliarden Jahre alt [9]. Lebewesen tauchten also etwa eine Milliarde Jahre nach
der Entstehung unseres Planeten auf.
Die geologische Zeitskala
Eine erste Unterteilung der geologischen Zeitskala ergab sich aus der relativen
Altersbestimmung (ist dieser Boden, dieses Gestein jünger oder älter als jenes?). Historisch
im Wesentlichen auf der Anwesenheit charakteristischer (schichtspezifischer) Fossilien
beruhend, hat man die Periode der Erdge-schichte, in der die ersten Spuren des Lebens zu
sehen sind, als Phanero-zoikum bezeichnet (griech. phanerós = sichtbar und zoe = Leben).
Mit der Entdeckung der Radioaktivität wurden schließlich Messverfahren entwickelt, mit denen
das absolute Alter verschiedener Gesteine und damit die Aufein-ander-folge geologischer
Zeitalter unabhängig von Fossilien bestimmt werden konnten. Das Phanerozoikum, das sich
über etwa 550 Millionen Jahre erstreckt, wurde noch einmal unterteilt in Paläozoikum
(Erdaltertum), Mesozoikum (Erdmittelalter) und Känozoikum (Erdneuzeit). Die Periode von
der Bildung des Planeten bis zum Phanerozoikum wird Präkambrium genannt. Das Kambrium
ist die erste Periode im Phanerozoikum. Am Anfang dieses Zeitalters, vor ungefähr 540
Millionen Jahren, traten zum ersten Mal die wichtigsten Stämme der heute bekannten Tiere
auf.
Perioden mit Massenaussterben gefolgt von Perioden mit einer Diversi-fizierung der
Arten
Fossilien einer bestimmten Art finden sich meist örtlich eng begrenzt in einer kleinen Zahl
geologischer Schichten. Auch das zeigt wieder, dass Arten auf-tauchten, sich entwickelten
und wieder ausstarben, wobei ihre Lebensdauer im Mittel zwischen einer und zehn Millionen
Jahren lag. Die Anzahl fossiler Arten in den verschiedenen geologischen Schichten schwankt
sehr und lässt auf Maxima der Vielfalt und Maxima des Aussterbens rückschließen. Die
Geschichte des Lebens ist von mehreren Episoden massiven Aussterbens gekennzeichnet.
Diese fallen – im Maßstab der Erdgeschichte – mit radikalen ökologischen Krisenperioden
zusammen und haben die Biodiversität jedes Mal beträchtlich verringert. Sie sind in den
"geologischen Archiven" anhand von paläontolo-gischen und geologischen Diskontinuitäten
leicht zu identifizieren und wurden zur Unterteilung der geologischen Zeitalter in verschiedene
Perioden heran-gezogen. Die Krise am Übergang zwischen Erdmittelalter und Erdneuzeit ist
einigermaßen bekannt, weil zu jener Zeit die Dinosaurier verschwanden. Weniger bekannt
sind fünf weitere große Krisen in der Geschichte des Lebens. Die geologischen Archive
zeigen, dass jeweils eine selektive Auslöschung von Arten stattfand, und die Krisen somit den
Verlauf der Evolution beeinflussten.
Nach jeder Krise entstand jedoch im Laufe von einigen Millionen Jahren wieder eine neue
Vielfalt. Und die Biodiversität vergrößerte sich beträchtlich, sei es durch Gruppen von
Lebewesen, die schon vor der Krise da waren, sei es durch ganz neu entstandene Gruppen.
Das Ausmaß der Biodiversität der Vergangen-heit lässt sich allerdings nur sehr schwer
anhand von Fossilien abschätzen. Sicher ist nur, dass die Krisenzeiten im Quartär zu einer
starken Verminderung der Arten führten. Das liegt an der für dieses Erdzeitalter typischen
Abfolge von Eiszeiten und Warmzeiten, vor allem aber an dem Auftauchen einer neuen Art,
dem Menschen. Der Mensch beeinträchtigt viele Ökosysteme und zerstört zahlreiche lebende
Arten. Unsere heutige Natur ist ganz wesentlich durch die explosionsartige Vermehrung der
Biodiversität nach der Krise am Ende der Kreidezeit bestimmt, die insbesondere den
Durchbruch für die Blütenpflanzen und die Säugetiere bedeutete. Viele Wissenschaftler
fürchten nun, dass mit dem Klimawandel und dem rapiden Rückgang der Biodiversität eine
sechste große Krise begonnen hat.
Schutz der Biodiversität: ein weltweites Anliegen
Entgegen einer weit verbreiteten Vorstellung ist die Erosion der Biodiversität der
Wissenschaftlergemeinschaft schon länger bewusst: 1923 fand in Paris der erste
internationale Kongress zum Thema Naturschutz statt und die IUCN, die Internationale Union
für die Bewahrung der Natur (International Union for Conservation of Nature) wurde bereits
1948 gegründet. Den meisten Bürgern, Entscheidungsträgern und Regierungen wurde der
Verlust der Biodiversität erst viel später bewusst.
1. Ein altes Anliegen
1971 veröffentlicht die UNESCO unter dem Titel "Der Mensch und die Bio-sphäre" ("Man and
Biosphere") das erste Umweltprogramm zur Eindämmung des Biodiversitätsverlustes. Beim
ersten Umweltkongress der Vereinten Natio-nen 1972 in Stockholm erscheint die Biodiversität
zum ersten Mal als ein internationales Anliegen und das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP: United Nations Environment Programme) erblickt das Licht der Welt. In
Deutschland bestimmt seit 1977 das Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), was zum Schutz
der Natur und der Artenvielfalt getan und gelassen werden soll.
Bundesnaturschutzgesetz, Artikel 1 und 2 (Auszüge) [15]:
"Artikel 1: Natur und Landschaft sind [...] als Grundlage für Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-rationen [...] so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. [...]
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und
Landschaft auf Dauer gesichert sind [...].
Artikel 2: Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind ent-sprechend dem
jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere
1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließ-lich ihrer
Lebensstätten zu erhalten [...],
2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten
entgegenzuwirken,
3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geo-grafischen
Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten [...]."
In Österreich hat jedes Bundesland sein eigenes Naturschutzgesetz und in der Schweiz gibt
es das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (das in seiner ersten Fassung
bereits 1967 in Kraft trat [16].
Abb. 9: Abwasserrohr, Foto: USDA/Wikimedia Commons
1977 erkennt die UNESCO die ersten Biosphärenreservate an [17]. 1980 werden in dem von
der IUCN veröffentlichten Text zur "Welt-Naturschutz-Strategie" (World Conservation Strategy
) zum ersten Mal die Fragen der Biodiversität mit einer Form der Entwicklung in Verbindung
gebracht, die im Englischen als "sustainable" – zu deutsch: nachhaltig – bezeichnet wird.
Dieser Text enthält die starke Formulierung, dass die Menschheit als ein Teil der Natur dem
Untergang geweiht sei, wenn die Natur und die natürlichen Ressourcen nicht geschützt
werden.
2. Das Abkommen von Rio
Der Umweltfond der Vereinten Nationen (Globale Umweltfazilität = ein Fonds zur
Finanzierung vom Umweltschutzprojekten) wurde 1990 aufgelegt, um die steigenden Kosten
der Projekte des UNEP in den Entwicklungsländern zu finanzieren. Im darauffolgenden Jahr
veröffentlichten IUCN, UNEP und der WWF (World Wildlife Fond, heute World Wide Fond for
Nature) gemeinsam "Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living" (Unsere
Verant-wortung für die Erde – eine Strategie für eine nachhaltige Lebensführung), ein
vorbereitendes Dokument für die Agenda 21, die 1992 auf dem Erdgipfel von Rio (von 178
Staaten) verabschiedet wurde. Ebenfalls im Jahr 1992 trägt die Europäische Agrarpolitik
(Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union / GAP) zum ersten Mal den Umweltfragen
Rechnung. Außerdem wird durch eine europäische Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie,
kurz auch FFH- oder Habitat-Richtlinie) Natura 2000 ins Leben gerufen, ein
zusammen-hängendes Netz von Schutzgebieten [18].
3. Das Kyoto-Protokoll
1997 fordert das Kyoto-Protokoll: Wenn die Biodiversität erhalten bleiben und die Zukunft der
Menschheit gesichert werden soll, muss dem Klimawandel entgegengewirkt werden. Im Jahr
2000 ist die ökologische Nachhaltigkeit eine der acht Millenium-Entwicklungsziele (
Millennium Development Goals), die zu erreichen sich die Generalversammlung der Vereinten
Nationen vorgenommen hat. Vorgesehen war, die Ziele bis 2015 umzusetzen, doch schon
jetzt ist abzusehen, dass die Ziele nicht erreicht werden. Weiterhin haben sich 2002 die
Regierungen dazu verpflichtet, zur Eindämmung des Biodiversitätsverlustes das
gegenwärtige Tempo des Artensterbens auf weltweiter, regionaler und lokaler Ebene stark zu
verlangsamen. Die geplanten Ziele wurden auch hier nicht erreicht, so dass 2011 neue, enger
gefasste Zielvorgaben beschlossen wurden. Diese berücksichtigen auch die Ziele des
internationalen Überein-kommens über die biologische Vielfalt [19]. Seit der
Jahrtausendwende gibt es eine Initiative zur regelmäßigen Beurteilung des Zustandes der
Ökosysteme des Planeten. Über 1300 Experten veröffentlichten 2005 ihren Bericht, das
Millenium Ecosystem Assessment [20], in dem folgende Tatsachen festgestellt werden:
Die Biodiversität trägt zur Sicherheit, zur Gesundheit und zum Wohl-befinden der
menschlichen Art bei.
Die durch Menschen verursachte Verminderung der Biodiversität war in den letzten 50
Jahren größer als im gesamten Zeitraum der Menschheits-geschichte zuvor.
Der Zustand der Ökosysteme könnte sich in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts
erheblich verschlechtern und außerdem verhindern, dass die MilleniumEntwicklungsziele erreicht werden, wenn nicht Anstrengungen gemacht werden, die alle
bisherigen in den Schatten stellen.
Abb. 10: Eisschollen, Foto: Mathilde Prigent (Wikimedia Commons)
4. Ein sechstes Massenaussterben?
Das Bewusstsein, dass die Biodiversität bedroht ist, reicht offenbar nicht aus. Das UNEP
kommt in seinem letzten Bericht, dem 2012 erschienenen "Global Environment Outlook 5"
("Perspektiven der weltweiten Umweltentwicklung") [21], zu der Feststellung, dass die
Anstrengungen zum Umweltschutz kaum oder gar keinen Erfolg haben. Vielerorts sind
kritische Grenzwerte erreicht bzw. überschritten, und der Raubbau an der Umwelt gefährdet
die Ökosysteme und damit die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen.
Nach fünf großen Massenaussterben, die in geologischen Zeiträumen die Biodiversität jeweils
stark zurückgehen ließen, bahnt sich nunmehr allem Anschein nach ein sechstes an. Das
Artensterben schreitet gegenwärtig schneller voran als evolutionsgeschichtlich erklärlich: 100
bis 1000 Mal schneller als in vormenschlicher Zeit [22]. Wir erleben gerade eine rasante
Verminderung der Vielfalt der Gene, der Arten und der Habitate. Die Haupt-ursachen für die
Erosion der Biodiversität sind die Zerstückelung der Habitate, die Verschlechterung ihres
Zustandes oder gar ihr Verschwinden sowie der Klimawandel. Hinzu kommen der
internationale Handel mit bedrohten Arten und die Einführung invasiver Arten.
Tausende von Arten sind bedroht
Die von der IUCN 2012 veröffentlichte Bilanz bestätigt es: Die IUCN hat 65 518 Arten erfasst
– das entspricht ca. 4% der weltweit heute bekannten Arten und stellt laut Wissenschaftlern
eine repräsentative Stichprobe aller Arten dar. Von diesen 65 518 Arten sind 20 219 bedroht.
Sie stehen auf der "Roten Liste der gefährdeten Arten" [23].
Allein bei der Gruppe der Wirbeltiere sind laut der IUCN-Liste weltweit 20% der Arten
gefährdet: 21% der Säugetiere, 13% der Vögel und 30% der Amphibien. Für Reptilien und
Fische können keine prozentualen Angaben gemacht werden, da zu wenig Arten erfasst sind
(<90%). Bei den Säugetieren und den Vöglen sind es dagegen 100%, und bei den Amphibien
immerhin 94%. Bei den Pflanzen ist eine Aussage nur für die nacktsamigen Pflanzen sinnvoll
(96% der bekann-ten Arten sind in der IUCN-Liste erfasst): 39% sind vom Aussterben bedroht
[23].
Die Diversität der Kulturpflanzen ist bedroht
Im Lauf des letzten Jahrhunderts sind drei Viertel der Kulturpflanzenarten schlicht und einfach
verschwunden. Von ungefähr 10 000 Pflanzen, die von Menschen zu ihrer Ernährung genutzt
wurden, werden heute nur noch 150 angebaut. Lediglich ein Dutzend Arten machen 80% der
Nahrungsquellen pflanzlichen Ursprungs aus. Und nur vier Arten – Reis, Weizen, Mais und
Kartoffel – machen allein schon 60% aus. In dieser Reduzierung liegt eine Gefahr für die
Ernährung der Menschen, die durch den Klimawandel noch verstärkt wird. Gegen Dürre,
Insekten und Krankheiten widerstandsfähige Sorten werden nicht mehr angebaut.
5. Die Organisation internationaler Aktionen
Gegenwärtig ruhen die internationalen Anstrengungen zur Erhaltung der Biodi-versität auf vier
Pfeilern. Der erste ist die politische Biodiversitäts-Konvention. Der zweite ist die Erforschung
der Biodiversität: Gebündelt werden die For-schungsanstrengungen vom Netzwerk
DIVERSITAS [24], das UNESCO und Internationaler Wissenschaftsrat ICSU (International
Council for Science) auf den Weg gebracht haben, mit dem Ziel, Experten miteinander in
Kontakt zu bringen. Der dritte Pfeiler ist die Auswertung der zusammengetragenen
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse durch das Millenium Ecosystem Assessment
(Bewertung von 24 Schlüssel-Ökosystemdienstleistungen) und die IPBES [25] (
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services{C}{C}). Die erst 2010
gegründete IPBES ist für die Biodiversität das, was das IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change{C}{C}) für den Klimawandel darstellt. Den vierten Pfeiler schließlich bilden
die Messungen der Verände-rungen der Biodiversität sowie das Modellieren von Prognosen
für die Zukunft. Dafür richtet seit 2009 das Netzwerk GEO BON [26] (Group on Earth
Observa-tion Biodiversity Observation Network) auf allen Kontinenten
Beobachtungs-stationen ein, die die Veränderungen regelmäßig erfassen sollen.
Mäßige Ergebnisse
Das Bewusstsein über die Bedeutung und den Verlust der Biodiversität bahnte sich zwar erst
spät den Weg aus dem Kreis der Wissenschaftler und Natur-schützer zur Allgemeinheit,
inzwischen finden jedoch zahlreiche Aktionen statt, insbesondere auf lokaler Ebene. Ihnen ist
zum Beispiel zu verdanken, dass der Untergang einiger weniger Arten verhindert werden
konnte, darunter solche mit symbolischer Bedeutung, wie der Afrikanische Elefant, das
Przewalski-Pferd, der brasilianische Schwarzhandtamarin (ein Krallenaffe) oder auch das
Indische Panzernashorn.
Abb. 11: Przewalski-Pferde (auf der Causse Méjean, einem Hochplateau im französischen
Zentralmassiv), Foto: Ancalagon (Wikimedia Commons)
In der von den Vereinten Nationen im Mai 2010 veröffentlichten dritten Ausgabe der
"Perspektiven der weltweiten Biodiversität" (Global Biodiversity Outlook 3) wird festgestellt,
dass keines der 110 Länder, die bei den Vereinten Nationen ihren Bericht abgaben (der die
bis 2010 erreichten Fortschritte dokumentieren sollte), die vorgesehenen Ziele erreicht hat:
Die Gesamtfläche der natürlichen Habitate geht weiterhin fast überall zurück und ihr Zustand
verschlechtert sich fortlaufend [27].
Die Ökosysteme übernehmen ökologische Aufgaben
Heutzutage ist die Erosion der Biodiversität ein globales Umweltproblem gewor-den –
genauso wie der Klimawandel – und der Handlungsbedarf ist mittlerweile überall in den
Köpfen angekommen. Das hat 2010 zur Gründung der IPBES geführt (von der schon weiter
oben die Rede war), die unter Federführung der Vereinten Nationen eine Gruppe
internationaler Experten zusammenführt, die nach dem Modell des IPCC die Entwicklung der
Biodiversität verfolgen soll.
1. Die Überlebensfähigkeit der Ökosysteme
Die Untersuchung der Funktion der Ökosysteme und ihrer "Dienstleistungen" ist alles andere
als abgeschlossen. Fest steht: Je größer die Biodiversität eines Ökosystems, desto größer ist
auch seine Überlebensfähigkeit bzw. seine Resilienz, d. h. seine Fähigkeit, sich nach einer
Störung zu regenerieren. Die wirkenden Mechanismen sind jedoch noch wenig bekannt und
die Forschung auf diesem Gebiet muss intensiviert werden. Fest steht auch, dass die Arten
sich umso besser an eine gestörte Umwelt anpassen, je größer ihre genetische Vielfalt ist. Ein
in China durchgeführtes Experiment hat gezeigt, dass die genetische Vielfalt beim Reis seine
Widerstandskraft gegen die hauptsächliche Reiskrankheit, den Schimmelbefall, beträchtlich
steigert. Als die krankheits-anfälligen Reissorten zusammen mit anderen angebaut wurden,
erhöhte sich der Ertrag um 89%, und die Krankheit ging um 94% zurück. Nach zwei Jahren
des Experimentierens konnte auf Fungizide ganz verzichtet werden [28].
2. Die biologische Vielfalt der Ökosysteme
Man unterscheidet bei der biologischen Vielfalt von Ökosystemen drei Aspekte. Der
Artenreichtum eines Ökosystems ist die Anzahl der verschiedenen in ihm lebenden Arten.
Die funktionale Vielfalt umfasst die besonderen Fähigkeiten bestimmter Arten eines
Ökosystems, zum Beispiel die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu fixieren. Und drittens
zeichnen sich einige Ökosysteme dadurch aus, dass in ihnen Arten leben, die nirgends sonst
zu finden sind, sogenannte endemische Arten. Die Beurteilung der Dienstleistungen eines
Ökosystems muss allen drei Aspekten Rechnung tragen, auch wenn die funktionale Vielfalt
die wichtigste ist.
3. Die ökologischen Dienstleistungen der Ökosysteme
Die Dienstleistungen eines Ökosystems sind mit den biogeochemischen Kreis-läufen
verbunden, die in ihm ablaufen, insbesondere mit dem Kohlenstoff-kreislauf und dem
Wasserkreislauf. Sie hängen aber auch mit den vielfachen Wechselwirkungen zwischen den
Lebewesen sowie zwischen den Lebewesen und ihrer Umgebung zusammen. Die wichtigsten
Dienstleistungen der Ökosys-teme sind: die Regulierung der Treibhausgaskonzentration in
der Atmosphäre, die Wasseraufbereitung, die Wiederverwertung von Abfällen oder auch die
Befruchtung der meisten Blütenpflanzen durch Tiere. Die ökologischen Dienst-leistungen
lassen sich in drei Kategorien unterteilen: Versorgungsleistungen (Nahrungsquellen,
Arzneimittelquellen, pflanzliche Fasern, Holz usw.), Regulie-rungsleistungen (CO2-Senken, O2
-Quellen, natürliche Wasserklärung usw.) und Kulturleistungen (Tourismus, Naturerlebnis,
Erholung, spirituelle oder religiöse Stätten usw.).
Im 4. Umweltzustandsbericht (Global Environment Outlook 4) [29] wird gleich zu Beginn des
Kapitels über Biodiversität festgestellt, dass "People rely on biodiversity in their daily lives,
often without realizing it" (Die Menschen sind in ihrem Alltag auf die Biodiversität angewiesen,
meistens ist ihnen das aller-dings nicht bewusst). Zu den Ökosystemleistungen, die sich
ständig ver-schlechtern, gehören: die Süßwasserreserven, die Meeresfischbestände, die
Kapazität der Atmosphäre, Schadstoffe zu eliminieren, die Pollenübertragung, die
Parasitenresistenz der Landwirtschaftssysteme, die Anzahl und Qualität der für Freizeit und
Erholung wertvollen Stätten.
Was tun?
Die Biodiversität nimmt von den Polen zum Äquator hin zu – die tropischen Regenwälder
gelten als die artenreichsten Ökosysteme. Um den Äquator herum befinden sich auch die
meisten "Biodiversitäts-Hotspots" [30]. Weltweit wurden 34 Gegenden als BiodiversitätsHotspots eingestuft. Sie gelten in Anbetracht ihrer reichen (und zugleich bedrohten)
Biodiversität als besonders schützenswert und beherbergen sehr viele endemische Arten. Zur
Erinnerung: Eine Art heißt endemisch, wenn sie geografisch nur in einer fest abgegrenzten
Region zu finden ist. Diese Brennpunktregionen erstrecken sich allerdings nur noch über etwa
2,3% der weltweiten Landoberfläche (über 70% der ursprüng-lichen Habitate dieser Hotspots
wurden bereits zerstört). Über die Hälfte aller Pflanzen und 42% aller Landwirbeltierarten sind
in diesen 34 Biodiversitäts-Hotspots endemisch [31].
Abb. 12: Satellitenfoto der Erde, Foto: NASA, Earth Observatory
1. Biome und Ökoregion
Wissenschaftler und Naturschutzorganisationen haben auf unserer Erde – neben den
Biodiversitäts-Hotspots – noch andere Regionen ausgemacht, deren Biodiversität bedroht und
gleichzeitig besonders schützenswert ist. Zum Teil überlappen sich diese Gebiete.
Zum Beispiel hat die internationale Vogelschutzorganisation "BirdLife Inter-national" 218
"Endemic Bird Areas" (EBAs, Gebiete mit endemischen Vogel-arten) identifiziert – 105 davon
auf Inseln, 113 auf dem Festland. 77% der EBAs befinden sich in den Tropen und Subtropen.
Die EBAs beherbergen 93% der Vogelarten mit beschränkter Verbreitung, die Hälfte von
ihnen ist gefährdet bzw. gering gefährdet, und die andere Hälfte ist von einer Verkleinerung
und/oder Verschlechterung ihrer Habitate bedroht [32].
Der WWF wiederum hat die Erde in sieben große biogeografische Zonen unter-teilt [33], in
denen insgesamt 14 verschiedene Land-, 7 Süßwasser- und 5 marine Habitattypen gezählt
werden [34]. Jedes dieser großen biogeogra-fischen Gebiete – auch Biome genannt –
zeichnet sich durch ganz bestimmte ökologische Bedingungen aus: Klima, Boden,
Artenvorkommen usw. Jedes Biom umfasst eine (mehr oder weniger große) Palette von
Ökosystemen. In diesen Biomen werden 238 sogenannte Ökoregionen abgegrenzt (oft auch
als "Global 200 Ecoregions" bezeichnet).
60% der Global 200 Ecoregions und 78% der EBAs überlappen mit den Biodi-versitätsHotspots [35].
Die Unterteilung in verschiedene Naturschutzgebiete dient vor allem einem Zweck. Sie soll
helfen, eine Liste derjenigen Gebiete zu erstellen, in denen Maßnahmen zum Erhalt und zur
Wiederherstellung der Biodiversität höchste Priorität haben.
2. Die Anstrengungen zum Erhalt der Biodiversität in Europa
Auf europäischer Ebene gibt es ein EU-weites Netz von Schutzgebieten: Natura 2000 ist über
Ländergrenzen hinweg um die Erhaltung gefährdeter Arten und ihrer Habitate bemüht.
Inzwischen sind im Rahmen von Natura 2000 schon 17,5% der Landfläche Europas als
Naturschutzgebiete ausgewiesen [36].
Um das Ziel der 2011 beschlossenen Biodiversitätsstrategie ("Lebensversiche-rung und
Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020") zu erreichen, wird
anhand von regelmäßigen Bestandserhebungen und Indika-toren der Zustand der
biologischen Vielfalt evaluiert. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Ländern werden
zusammengetragen, um auf EU-Ebene eine Aussage über die Entwicklung der Biodiversität
in Europa machen zu können.
Zitat aus Biodiversitätsstrategie [37]: "Das Ziel für 2020: Aufhalten des Ver-lustes an
biologischer Vielfalt und der Verschlechterung der Ökosystemleis-tungen in der EU und deren
weitestmögliche Wiederherstellung bei gleichzei-tiger Erhöhung des Beitrags der
Europäischen Union zur Verhinderung des Verlustes an biologischer Vielfalt weltweit."
Bei der Erfassung des Zustands der Biodiversität wird immer mehr auch auf die Mitarbeit von
freiwilligen Naturbeobachtern gesetzt. Ein Beispiel ist die Ini-tiative "Vigie-Nature", die vom
Naturkundemuseum in Paris koordiniert wird. Wissenschaftler geben den Laien Formulare
und eine genaue Anleitung an die Hand, und diese beobachten das ganze Jahr über die
Natur in ihrer Umgebung (Vögel, Schmetterlinge, Fledermäuse, Amphibien, Schnecken,
Hummeln, Pflan-zen, ...) und geben ihre Ergebnisse an die Wissenschaftler weiter. Im
deutsch-sprachigen Raum betreuen science4you (Deutschland), der Österreichische
Naturschutzbund und Info Flora (Schweiz) ähnliche Projekte [38].
3. Die Gründe für den Rückgang der Biodiversität
Die Gründe für die Erosion der Biodiversität in Europa sind bekannt. Der Hauptgrund ist der
Niedergang der traditionellen Land- und Forstwirtschaft. Durch die intensive Bewirtschaftung
der Böden wurden natürliche und halbnatürliche Habitate zerstört. Weitere bedeutende
Verluste der Biodiversität gehen auf das Konto von zunehmender Urbanisierung,
Industrialisierung, Flussbettverlagerungen und Flussumleitungen, Zerstückelung der Habitate
durch Infrastrukturentwicklung und wachsendem Massentourismus.
Inzwischen sind sich die Forscher einig, dass auch der Klimawandel in starkem Maße zur
Erosion der Biodiversität beiträgt. Daher ist der Kampf gegen die globale Erwärmung eng mit
dem Kampf gegen die Erosion der Biodiversität verbunden.
Um das durch die UN-Klimarahmenkonvention festgelegte 2-Grad-Ziel zu erreichen
(Begrenzung der globalen Temperaturerhöhung auf 2°C bis zum Jahr 2100) muss die
Emission von Treibhausgasen drastisch reduziert werden. Laut IPCC müssen die Emissionen
bis 2050 gegenüber dem Wert vom Jahr 2000 um 85% reduziert werden und spätestens im
Jahr 2015 ihr Maximum erreicht haben [39]. Eine Möglichkeit, den CO2-Gehalt der
Atmosphäre zu reduzieren, liegt in dem Erhalt bzw. in der Wiederherstellung vieler
Ökosysteme unserer Erde (insbesondere tropischer Regenwälder, Moore und
Agrarlandschaften). Ökosysteme stellen bedeutende CO2-Senken dar. Außerdem wird in den
Öko-systemen unserer Erde fast dreimal so viel Kohlenstoff gebunden wie in der Atmosphäre;
der Erhalt der bestehenden Kohlenstoffreservoirs hat daher höchste Priorität, unmittelbar
gefolgt von (Wieder-)Aufforstung und Wieder-vernässung von Mooren.
Zusammenfassung
4,6 Milliarden Jahre geologischer und biologischer Evolution haben unserem Planeten eine
außerordentliche Biodiversität beschert: genetische Vielfalt, Artenvielfalt und eine Vielfalt der
Ökosysteme. Diese Biodiversität ist durch den Eingriff und die Aktivitäten der Menschen
immer mehr in Bedrohung geraten. Bereits Lamarck [5] prophezeite in seinem Spätwerk die
Selbstzer-störung der Menschheit durch Artenzerstörung infolge von Entwaldung und
Bodenerosion.
Die wachsende und sich entwickelnde Menschheit hat die Umwelt verändert und die
Biodiversität mit allen ihren verschiedenen Facetten drastisch reduziert. Verstärkt wird die
Zerstörung der Biodiversität auch noch durch den Klimawandel. Es sterben hundert bis
tausend Mal mehr Arten aus, als aus evolutionären Gründen erklärlich, und es wird
prophezeit, dass zahlreiche Arten noch vor dem Ende dieses Jahrhunderts verschwunden
sein werden. Hinzu kommt, dass die Menschen in einem Jahr so viele natürliche Ressourcen
verbrauchen, dass die Erde dafür zur Regeneration anderthalb Jahre braucht [40], die
Erneuerungskapazität des Planeten also nicht ausreicht. Auch wenn diese Schätzungen mit
ziemlich großen Unsicherheiten behaftet sind, besteht kein Zweifel daran, dass unser Planet
sich in einer schweren Krise befindet, deren Folgen noch lange Zeit zu spüren sein werden.
Dabei sind wir in vieler Hinsicht von der Biodiversität abhängig. Unter anderem schöpfen wir
aus ihr (fast) unseren gesamten Nahrungs- und Arzneimittel-bedarf. Auch die
biogeochemischen Kreisläufe hängen von ihr ab, ganz davon abgesehen, dass die Natur mit
ihrer Biodiversität ein unersetzlicher kultureller Schatz ist. Die ökologischen Leistungen, die
uns die Biodiversität kostenlos liefert, und von denen wir ganz und gar abhängig sind, können
nur sehr schwer durch Technologie ersetzt werden; und wenn überhaupt, ist dies mit enormen
Kosten verbunden. Auch wenn wir noch nicht alle Funktionsmechanismen der Ökosysteme
kennen, so können/sollten wir doch handeln.
Dafür reicht unser heutiges Wissen: Die Erhaltung der Biodiversität und ihre nachhaltige
Nutzung müssen integrierter Bestandteil der Entwicklung werden und beide müssen in die
wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen einfließen. Deshalb sollten auch
Umweltfragen und nachhaltige Entwicklung so früh wie möglich in der Schule behandelt
werden.
Bildnachweis
Abb. 4:
Regenwald
Buchenwald
Wiese
Wüste
Perojevic
Willow
Jenny Schlüpmann
Nepenthes
Public Domain
CC BY-SA 2.5
privat
CC BY-SA 3.0
Fußnoten
1: Edward O. Wilson (* 1929) ist ein US-amerikanischer Biologe und Natur-schützer. Sein
Spezialgebiet ist die Myrmekologie (Ameisenkunde).
2: Biodiversity, E. O. Wilson (Herausgeber), Frances M. Peter (Mitheraus-geberin),
National Academy Press, Washington D.C., 1988
3: Text des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity
4: C. Mora, D.P. Tittensor, S. Adl, A.G.B. Simpson, B. Worm: "How Many Species Are There
on Earth and in the Ocean?", PLoS Biology, 2011
5: Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) war ein französischer Naturforscher.
6: Ernst Mayr (1904–2005) war ein deutsch-amerikanischer Evolutionsbiologe.
7: Der französischer Paläontologe und Naturforscher Georges Cuvier (1769–1832) war einer
der Verfechter des morphologischen Artbegriffs.
8: CDIAC –Global Biomass Carbon Map for the Year 2000
9: Ein Team von Wissenschaftlern hat 2011 in Australien die vermeintlich ältesten Fossilien
gefunden. Sie stammen von Schwefelbakterien und sollen etwa 3,4 Milliarden Jahre alt sein.
Quelle: Pressemitteilung der Universität Oxford (22.8.2011)
10: Theodosius Dobzhansky (1900–1975) wurde in der Ukraine geboren und emigrierte 1927
in die USA. Er war Genetiker und Evolutionsbiologe und zusam-men mit Ernst Mayr einer der
wichtigen Vertreter der synthetischen Evolu-tionsbiologie.
11: Charles Darwin (1809–1882) war ein englischer Naturforscher und Begrün-der der
Evolutionstheorie.
12: Wir schreiben hier Pflanze, meinen aber eigentlich Chloroplastida, zu denen die
Landpflanzen und die Grünalgen gehören.
13: Weitere Informationen und Fotos zur Meeresschnecke Elysia chlorotica auf Wikipedia und
weichtiere.at
14: Kurzes Video: Eine Mimose zieht ihre Blätter ein. Hier ist übrigens nicht die meist
bekanntere "falsche Mimose" (Acacia dealbata oder Silberakazie) mit ihren kleinen gelben
kugelförmigen Blütenständen gemeint.
15: Fassung vom März 2010; gesamter Gesetzestext des Bundesnaturschutz-gesetzes
16: Naturschutzgesetze in Österreich und Natur- und Heimatschutzgesetz in der Schweiz
17: Ende 2012 gibt es weltweit 610 Biosphärenreservate in 117 Ländern (in Deutschland 15,
in Österreich 7 und in der Schweiz 2), Quelle: Liste derUNESCO-Biosphärenreservate
18: Informationen zu "Natura 2000": Bundesamt für Naturschutz, Europäische Kommission
19: Die Europäische Kommission zum Artenschutz-Aktionsplan bis 2020 (3.5.2011)
20: Millenium Ecosystem Assessment: www.maweb.org
21: GEO5: Global Environment Outlook
22: S.L. Pimm, G.J. Russell, J.L. Gittleman, T.M. Brooks: The Future of Biodiversity, Science,
New Series, vol. 269, no. 5222 (1995) 347
23: Stand 2012: Anzahl der gefährdeter Arten (Entwicklung 1996–2012) und Rote Liste
gefährdeter Arten
24: DIVERSITAS: Integrating Biodiversity Science for human well-being und DIVERSITAS
Deutschland
25: IPBES: Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services =
Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystem-dienstleistungen
26: GEO BON: Netzwerk zur weltweiten Beobachtung der Biodiversität
27: Global Biodiversity Outlook 3
28: Genetic diversity and disease control in rice, Youyong Zhu et al.,Nature 406 (2000) 718722
29: Global Environment Outlook 4
30: Definition: Ein Biodiversitäts-Hotspot ist eine Gegend, in der es mindes-tens 1500
endemische Gefäßpflanzenarten gibt, und die mindestens 70% ihrer ursprünglichen
Vegetation eingebüßt hat; Liste der Biodiversitäts-Hotspots.
Karte mit den Biodiversitäts-Hotspots: siehe Bildtafel 35
31: Conservation International: The Biodiversity Hotspots
32: BirdLife International: Endemic Bird Areas und noch mehr Informationen zuEBAs
33: WWF: Die Rolle der globalen Ökoregionen und wie sie ausgewählt werden; WWF
: Liste der globalen Ökoregionen
Ökoregionen in Deutschland: das Nordostatlantische Schelf und Bergwälder, in Österreich:
Bergwälder.
34: WWF: Die wichtigsten Habitattypen
35: Conservation International: Hotspots im Kontext
36: Natura 2000 Barometer
In Deutschland sind 15,4% der Landfläche als Naturschutzgebiete ausge-wiesen (dazu
kommen noch fast 26 000 km2 Meeresnaturschutzgebiete (das entspricht ca. 45% der
Meeresfläche von Nord- und Ostsee (Quelle: Natura 2000 – Das europäische Netz der
biologischen Vielfalt); in Österreich sind es 14,7% und in Frankreich 12,5% (Stand 2011).
37: Mitteilung der Europäischen Kommission: Lebensversicherung und Naturkapital: Eine
Biodiversitätsstrategie derEU für das Jahr 2020
38: Naturbeobachtungen an Wissenschaftler melden: science4you, naturbeobachtung.at,
Info Flora und Webfauna: Online-Erfassungsmaske des SZKF (Schweiz)
39: The natural fix? The role of ecosystems in climate mitigation, (UNEP Rapid Assessment
Report, 2009)
40: WWF: What does ecological overshoot mean? (ecological overshoot = ökologischer
Überverbrauch)
Weitere Informationen zu "world footprint" und"ecological overshoot"
Abb. 13: Kokospalme (Cocos nucifera), Foto: Jenny Schlüpmann
.Source URL: http://www.fondation-lamap.org/fr/node/20099