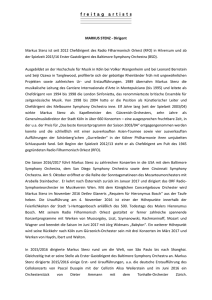Artikel als pdf
Werbung

Feine Welt Köln (Heft 2 / 2007) Supplement der Markus Stenz, Generalmusikdirektor mit pausenlosem Einsatz Begegnung mit einem Taktstockschwinger, der seinen Kampf um Qualität an vielen Fronten gleichzeitig führt. Und zwar unermüdlich Das Gürzenich-Orchester spielt Beethovens Violinkonzert, es ist die erste Probe mit dem Solisten. Da gehen plötzlich Saaltüren auf, von draußen strömen Menschen herein, tuscheln miteinander und rascheln mit ihren Einkaufstüten. Minutenlang geht das so, bis alle einigermaßen auf ihrem Platz sitzen. Markus Stenz dirigiert unbekümmert weiter. Erst viel später dreht er sich um und sagt: „Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie. Wir wollen Sie zwar nicht ignorieren, aber wir sind mitten bei der Arbeit.“ Lacher im Publikum, die Probe geht weiter. Philharmonie-Lunch heißt diese halbe Stunde donnerstags um zwölf Uhr Mittag. Jeder kann dann in die Philharmonie kommen und bei der Probe zuhören. Und auch wenn das keine Erfindung des Generalmusikdirektors Markus Stenz ist, so passt dieser KlassikLunch doch bestens in sein Konzept, zu seiner Idee, seiner Botschaft: den Menschen ohne viel Umschweife die Musik nahebringen. Gemäß seinem Leitsatz: Wer einmal im Konzertsaal war, kommt wieder. Seit 2003 ist Stenz Kapellmeister des Gürzenich-Orchesters und damit zuständig für das symphonische Programm des Orchesters, das in der Philharmonie aufgeführt wird. Seit 2004 ist er zusätzlich auch Generalmusikdirektor der Stadt Köln. In dieser Funktion ist er für die Bespielung der Oper verantwortlich. Seine Berufung hat sich bald schon als Glücksfall für die Stadt und das Musikleben herausgestellt. Das Publikum liebt ihn. Und die Fachwelt schätzt ihn. Er versteht sich darauf, populär zu sein und zugleich anspruchsvoll. Im März steht etwa Olivier Messiaens Turangalîla-Sinfonie auf dem Programm, die wegen ihrer monströsen Ausmaße höchst selten gespielt wird. Wie er überhaupt der Moderne einen hohen Stellenwert einräumt. Und dabei die Bedürfnisse des Abonnementspublikums nicht vergisst. Oft greift er in den Konzerten zum Mikrofon und gibt mit wenigen Worten kleine, aber wirkungsvolle Hörhilfen für Ungeübte. Stenz ist 42 Jahre alt. Er war schon Chefdirigent der London Sinfonietta und danach beim Melbourne Symphony Orchestra, er ist als Gastdirigent gefragt, bei den letzten Salzburger Festspielen hat er die Wiener Philharmoniker dirigiert. Doch seit vier Jahren lebt er mit seiner Familie wieder in der Stadt, in der seine Karriere begonnen hat, in Köln. Er war in den 80er-Jahren Student in der Kapellmeisterklasse der Musikhochschule. Dort leitete er eine Aufführung von Hans Werner Henzes Zweiter Sinfonie. Henze hörte zu und war so begeistert, dass er den unbekannten 25-Jährigen nach Berlin empfahl, wo er die Uraufführung einer Henze-Oper dirigierte. Noch vor ein paar Jahren hatte es in Interviews den Anschein, als spreche Stenz nicht besonders gern über seine frühere Kölner Zeit. Und auch nicht über die Tatsache, dass er ja sogar ganz in der Nähe, in Ahrweiler, geboren und aufgewachsen ist. Es schien, als wolle er dieses kumpelhafte „Einer-von-uns“-Gerede vermeiden; als befürchte der weltgereiste Dirigent, dass sein internationaler Wert unter dem Label Kölner Eigengewächs wieder geschmälert würde. „Mag sein, dass ich da in der Anfangszeit etwas empfindlich war“, sagt er. Vielleicht ist er aber auch einfach kein Typ des Zurückblickens. Aufbruchsgeist hat ihn von Anfang an getrieben, der Wille zur Lebensveränderung. Von Ahrweiler nach Köln, von Köln nach Berlin, von Berlin nach London, von London nach Australien. „Immer wieder weg, weg, weg“, sagt er und wedelt dazu mit der Hand. Immerzu neue Erfahrungen sammeln. „Das ist doch wichtig für die Entwicklung.“ Erst heute kann er wieder sagen: „Es ist auch schön in Ahrweiler.“ Dass auch Köln schön ist - diesen Satz wird man von ihm aber nicht hören können. „Köln ist so was von hässlich“, sagt er ohne Umschweife, schiebt aber sogleich eine Liebeserklärung an die Kölner hinterher. Der jetzige Kölner Stenz sieht die Stadt freilich mit anderen Augen als der frühere Kölner Musikstudent. Dem fielen die städtebaulichen Unzulänglichkeiten überhaupt nicht auf. Es ist fast, als lebe er heute in einer anderen Stadt als damals, sagt Stenz, so unterschiedlich nehme er die Stadt wahr: Im Stadtwald war er als Student vielleicht ein oder zwei Mal. „Jetzt sind wir dauernd da“, sagt er. Den Tanzbrunnen kannte er früher noch nicht einmal dem Namen nach, jetzt tritt er dort zum Abschluss der Spielzeit mit dem Gürzenich-Orchester auf. Manches, was er eigentlich wiedererkennen müsste, hat sich völlig verändert. Neulich war er mit seinen Kindern im Agrippabad und merkte erst, als er schon eine Weile drin war, dass er da früher schon geschwommen ist. Nur die Musikhochschule ist für ihn die alte geblieben, „es ist immer noch dieselbe Stimmung wie damals.“ Und wie wichtig ist es, die Tradition und die Mentalität einer Stadt zu kennen, wenn man in ihr wirken und etwas verändern will? Stenz denkt lange nach. Möglicherweise habe ihm bei der ein oder anderen Verhandlung geholfen, Köln und seine Eigenheiten zu kennen, sagt er. „Aber noch viel wichtiger ist doch, dass man das Ziel kennt, das man anstrebt.“ Es gibt eine Geschichte aus Stenz' Studentenzeit Mitte der 80er-Jahre, die seine Einstellung verdeutlicht. Er wohnte damals auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring, Nummer 36, er weiß es noch genau. Wenn er aus dem Fenster blickte, sah er Tag und Nacht Menschen in den Bäumen sitzen, die gegen die Umgestaltung der Ringe protestierten. Er hat sie nicht verstanden. „Ich war eher empfänglich für die Bilder auf den Schildern, die zeigten, wie es später einmal aussehen soll“, sagt Stenz. „Nichts muss so bleiben, wie es ist.“ Das ist einer seiner Grundsätze. Er hat ein Faible für Visionen - und ein geschicktes Händchen für deren praktische Umsetzung. So hat er mit der größten Selbstverständlichkeit einige Neuerungen ins Kölner Konzertleben eingeführt. Den sogenannten Dritten Akt etwa, eine Art musikalisches Überraschungsbonbon, das dem Publikum nach dem Ende des offiziellen Programms dargeboten wird. Dafür wurde das Orchester gleich 2004 mit dem Musikverlegerpreis für das beste Programm ausgezeichnet. Oder das sogenannte GO-Live-Projekt: LiveMitschnitte der Gürzenich-Konzerte werden direkt auf CD gebrannt und können unmittelbar nach dem Konzert gekauft werden. Zwar saßen wegen dieser Novitäten keine protestierenden Menschen in den Bäumen wie damals zu seiner Studentenzeit. Aber skeptische Kommentare von Musikkritikern gab es zuhauf. Das Publikum allerdings hat den Nachhör-Service rasch angenommen. Wäre doch alles so einfach wie in der Philharmonie. Denn am Kölner Opernhaus, dem anderen Arbeitsplatz von Stenz, herrscht seit Jahren Unruhe und Verunsicherung. Da sind die Unklarheiten um den künftigen lntendanten. Und dann die Querelen um das sanierungsbedürftige Haus. „Wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich mir einen Neubau wünschen“, sagt Stenz. Ohnehin versteht er nicht, was an dem klotzigen Bau denkmalschutzwürdig sein soll. Das sagt er draußen auf dem Offenbachplatz. als er auf die Fassade blickt. Aber Stenz ist Realist. Also sagt er auch, dass er voll und ganz einverstanden wäre mit einer Sanierung „von Grund auf“. Aber was er nun mal überhaupt nicht leiden kann, ist, „wenn so gar nichts passiert“. So wie jetzt, „eine verfahrene Situation“, sagt er. Eine Sanierung war beschlossen, dann stellte sich heraus, dass Fehler bei der Kalkulation gemacht wurden, jetzt geht alles wieder von vorn los. Stillstand ist für einen Macher wie ihn kaum auszuhalten. Stenz' Vertrag als Generalmusikdirektor läuft bis August 2009. Derzeit verhandelt er mit der Stadt über eine Verlängerung. Die Stadt würde ihn gern behalten. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die ungeklärten Fragen um das Opernhaus ein Bestandteil dieser Verhandlungen sind. Drinnen in der Oper stiefelt Stenz unwirsch durch die Flure und zählt die Schäden auf wie ein Hausmeister, der dem Hausbesitzer das Geld für Reparaturen aus den Rippen leiern muss: „0,8 Wasserrohrbrüche am Tag, du meine Güte und einige davon im Dirigentenzimmer“, ruft er mit bitterer Häme. Der' sonst so heiter Gestimmte hat schlechte Laune bekommen. Sein Weg führt nun durch dunkle Flure und über viele Treppen, er reißt schwere Stahltüren auf und lässt sie hinter sich ins Schloss krachen. Es ist der verwinkelte Weg, den er geht, wenn er eine Opernvorstellung dirigiert. Eine letzte Tür noch, und dann steht er im Operngraben. Er stellt sich mit dem Rücken zur Bühne auf das Dirigentenpodest - und blickt eine Weile in die leeren Stuhlreihen und zu den Logen hinauf. Gerade war er noch so aufgebracht, jetzt wirkt er wieder friedlich. Er sagt: „Den Innenraum mag ich wirklich gern, auch die Akustik ist gut.“ Da merkt man wieder, wie sehr ihm diese Oper doch am Herzen liegt. „Es ist mein größter Wunsch, dass diese Oper in der Stadt strahlt wie ein Juwel.“ von Andreas Fasel