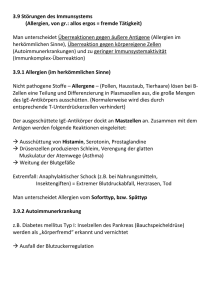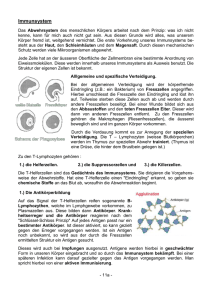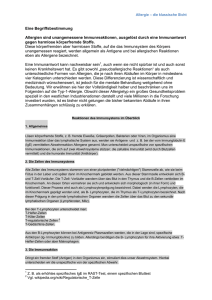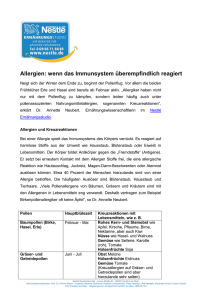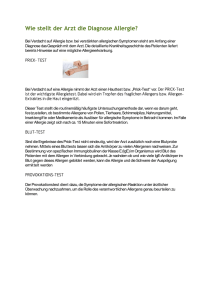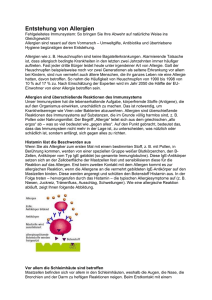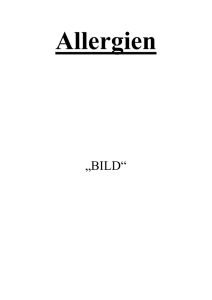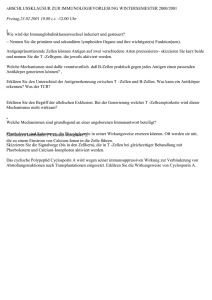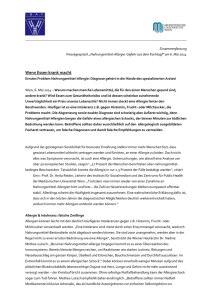Nahrungsmittel-Allergie – was nun?
Werbung
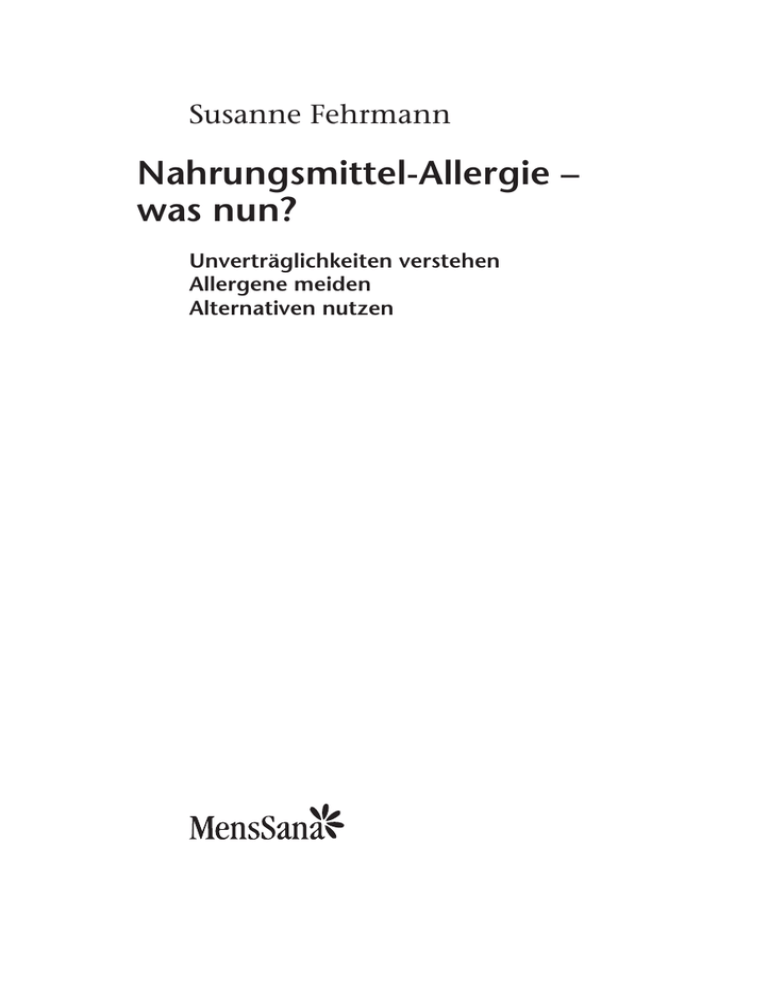
Susanne Fehrmann Nahrungsmittel-Allergie – was nun? Unverträglichkeiten verstehen Allergene meiden Alternativen nutzen Die in diesem Buch erwähnten Ratschläge und Therapiemethoden sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie ersetzen jedoch nicht die Beratung und Behandlung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Autorin und Verlag übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der angeführten Empfehlungen, die Verantwortung liegt allein beim Leser. Besuchen Sie uns im Internet: www.knaur.de Alle Titel aus dem Bereich MensSana finden Sie im Internet unter: www.mens-sana.de Vollständige Taschenbuchausgabe September 2011 © 2011 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München © 2007 Foitzick Verlag GmbH, Augsburg Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden. Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Umschlagabbildung: XXXXXXXX Satz: Adobe InDesign im Verlag Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck Printed in Germany ISBN 978-3-426-87444-8 5 4 3 2 1 Inhaltsverzeichnis Geleitwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Allergien – ein modernes Phänomen? . . . . . . . . . . . . 15 Die Allergie – ein Irrtum des Immunsystems . . . . . 17 Unsere Immunabwehr – ein lebenswichtiger Schutz . . . Angeborene Abwehrmechanismen – Schutz ab dem ersten Lebenstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erworbene Abwehr – individueller Schutz . . . . . . . . . . . . . Immunglobuline – Spezialisten des Abwehrsystems . . . . Eine Allergie entsteht – der Freund wird zum Feind . . . Das Immunsystem wird sensibel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die allergische Reaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergietypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ-I-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ-II-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ-III-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typ-VI-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warum gerade ich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die Allergie – ein schweres Erbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umweltbelastungen als Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . Hygiene – zu viel des Guten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergie und Psyche – ein Wechselspiel . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wenn Essen krank macht – Nahrungsmittel-Allergien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome – nicht nur Jucken und Kratzen . . . . . . . . . . . Macht die Dosis das Gift? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnose – auf der Suche nach dem Allergen . . . . . . . . . Die Anamnese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 18 21 25 29 29 31 34 34 35 35 36 37 37 39 40 41 43 43 48 51 52 Hauttests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluttests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provokationstests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suchdiät – Eliminationsdiät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wenn Pollen auf den Apfel treffen – Kreuz-Allergien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie essen bei Birkenpollen-Allergie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie essen bei Beifußpollen-Allergie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie essen bei Gräserpollenund Getreidepollen-Allergie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie essen bei Naturlatex-Allergie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie essen bei Hausstaub-Allergie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie essen bei anderen Kreuz-Allergien? . . . . . . . . . . . . . . . Die häufigsten Nahrungsmittel-Allergien ........ 58 59 59 60 65 67 69 71 72 73 73 75 Milcheiweiß-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Gesund ernährt trotz Milcheiweiß-Allergie . . . . . . . . . . . . 79 Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Milchfreie Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Säuglinge mit einer Kuhmilch-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Hühnerei-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Gesund ernährt trotz Hühnerei-Allergie . . . . . . . . . . . . . . 92 Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Eifreie Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Getreide-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6 Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesund ernährt trotz Getreide-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weizenfreie Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fisch- und Schalentier-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesund ernährt trotz Fisch- und Schalentier-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergie gegen Nüsse, Erdnüsse und Samen . . . . . . . . . . . . Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesund ernährt trotz Nuss-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nussfreie Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soja-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesund ernährt trotz Soja-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sojafreie Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergie gegen Senf und Senferzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . Allergieauslöser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 107 102 103 163 108 111 112 113 114 114 115 116 117 118 119 119 120 120 123 123 126 127 128 129 129 129 131 132 135 136 137 7 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Gesund ernährt trotz Senf-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Pseudo-Allergien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Auslöser einer Pseudo-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Gesund ernährt trotz Pseudo-Allergie . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Lebensmittel-Intoleranzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Laktose-Intoleranz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesund ernährt trotz Laktose-Intoleranz . . . . . . . . . . . . . . Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laktosearme Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histamin-Intoleranz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verlauf und Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesund ernährt trotz Histamin-Intoleranz . . . . . . . . . . . . . Mangelerscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beim Einkaufen und unterwegs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histaminarme Rezeptideen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergene auf dem Etikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allergiefreie Zukunft 145 146 146 149 149 150 152 152 152 153 156 156 157 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Moderne Technologien versprechen Hilfe . . . . . . . . . . . . . Neues Allergiesiegel hilft beim Einkauf . . . . . . . . . . . . . . . Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 144 164 164 167 167 168 170 170 173 Legende Y Der Blitz signalisiert Ihnen »Vorsicht!« Hier geht es um riskante Nahrungsmittel: Lebensmittel, die erfahrungsgemäß das jeweilige Allergen enthalten, oder Produkte, in denen das Allergen versteckt sein kann. V Die Sonne zeigt, was Sie erfahrungsgemäß ohne Bedenken essen können. Aufgelistet sind Nahrungsmittel, die die jeweiligen Allergene in der Regel nicht enthalten. Sie finden verträgliche Lebensmittel und mögliche Alternativen für Ihren persönlichen Speiseplan. Information Nützliche Tipps und Antworten auf häufige Fragen zum Thema bieten Ihnen die Infokästen. Rezepte Am Ende der Kapitel finden Sie einfache Rezepte für den Alltag und für Genuss trotz Allergie. 9 Geleitwort Statistiken zufolge sind 1 bis 8 % der gesamten Bevölkerung in Deutschland Lebensmittel-Allergiker, wobei der Anteil der betroffenen Kinder besonders hoch ist. Etwa 1 bis 2 % der Erwachsenen leiden unter dieser Form der Allergie, Kinder hingegen bis zu 8 %. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung ist also in seiner täglichen Nahrungsaufnahme beeinträchtigt und kann Essen nicht einfach unbeschwert genießen. Wissenschaft und Forschung suchen verstärkt nach Lösungen für dieses Problem. Um die Lebensqualität von Betroffenen bei der Ernährung zu sichern, werden die Allergene in Lebensmitteln, also die Stoffe, die Allergien auslösen, intensiv erforscht. Die weitergehende Forschung beschäftigt sich damit, Technologien zur Verarbeitung von Lebensmitteln zu entwickeln. Ziel dieser Forschung ist es, Lebensmittel in ihrem Charakter zu erhalten, ihr allergenes Potenzial aber erheblich herabzusetzen, oder, wenn möglich, ganz zu beseitigen. REDALL (Reduced Allergenicity of Processed Foods) ist ein von der Europäischen Union unterstütztes Forschungsprojekt, an dem dreizehn Institutionen und Forschungsgruppen aus sechs Ländern Europas beteiligt sind. Lebensmittelchemiker, Lebensmitteltechnologen, Mediziner vier verschiedener Allergiezentren Europas und Sozialwissenschaftler arbeiten in diesem Projekt zusammen, um allergikerfreundliche Lebensmittel für die Zukunft zu entwickeln. Auch der Autorin Susanne Fehrmann geht es im vorliegenden Buch um Lösungen für Menschen mit Lebensmittel-Allergien. »Allergien vom Tisch« erklärt verständlich und einfach, was eine Allergie ist und worauf Betroffene achten sollten, um ohne Minderung ihrer Lebensqualität Essen in seiner Vielfalt genießen zu können. Das Buch ist eine große Hilfe im Alltag: 11 beim Einkauf, beim Zubereiten von Lebensmitteln und letztlich ihrem genussvollen Verzehr. Dr. Angelika Paschke Lebensmittelchemikerin und Koordinatorin des REDALL-Projekts Dank Dieses Buch konnte nicht ohne Hilfe entstehen. Ganz besonders bedanke ich mich bei Frau Dr. Inge Ziegler für ihr großes persönliches Engagement. Dankeschön an Frau Elisabeth Yu für die professionelle Übernahme des Lektorats und das offene Ohr bei allen Problemen. Außerdem bedanke ich mich bei Dr. Philipp Yu für das Korrekturlesen im Bereich der Immunologie. Danke Walter, mit dir schaffe ich jede Hürde. 12 Vorwort »Das vertrage ich nicht.« – gehört auch für Sie dieser Satz zum Alltag? Tatsächlich bekommt uns nicht alles, was »vom Tisch« kommt. Ein Kribbeln auf der Zunge nach der leckeren Nusstorte, ein Hautausschlag wegen der Milch im Kaffee oder Durchfall im Anschluss an die Grillparty - viele Menschen reagieren sensibel auf ihre Nahrung. Essen macht sie krank. Angst und Unsicherheit sind die Folge, denn meist dauert es Monate oder Jahre, bis endlich die Diagnose »Nahrungsmittel-Allergie« gestellt wird. Doch auch dann fühlen sich viele Betroffene nicht ernst genommen. Familie und Freundeskreis akzeptieren die Erkrankung nicht wirklich oder spielen die Symptome herunter. Dazu kommt, dass gerade Lebensmittel-Allergiker häufig schlecht aufgeklärt sind und in der Folge viel von ihrer Leistungsfähigkeit und Lebensfreude einbüßen. »Allergien vom Tisch« will genau hier Abhilfe schaffen. Wie entsteht eine Nahrungsmittel-Allergie, und was passiert dabei im Körper? Ist jede Unverträglichkeit auch eine Allergie? Und was ist eine Pseudo-Allergie oder eine Intoleranz? Im ersten Teil des Buches möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, über Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten ganz allgemein aufklären. In verständlichen Worten erfahren Sie, was bei einer allergischen Reaktion passiert, warum Allergien in unserer modernen Gesellschaft scheinbar zunehmen und wie Allergien nachgewiesen werden können. Im zweiten Teil sind die häufigsten Nahrungsmittel-Allergien, Pseudo-Allergien und Intoleranzen ausführlich dargestellt. Hier finden Sie alles Wissenswerte über Ihre Erkrankung, um Ihnen den Alltag zu erleichtern. Sie erfahren, welche Allergene für Ihre Beschwerden verantwortlich sind, mit welchen Symptomen sich Ihre Allergie bemerkbar machen kann und ob Ihnen Mangelerscheinungen drohen, wenn Sie bestimmte Lebensmittel meiden müssen. Darüber hinaus gibt es zu jeder einzelnen Unverträglichkeit viele nützliche Tipps, die Ihnen den Alltag erleichtern wer13 den. Sie können nachlesen, welche Lebensmittel für Sie riskant sind und wo Sie auch außer Haus bedenkenlos zugreifen dürfen. Hinter welcher Zutat sich ein Allergen verbergen könnte, erfahren Sie im Abschnitt »Die Zutatenliste im Blick«. Genuss trotz Allergie bieten Ihnen die einfachen Rezepte am Ende der Kapitel. Dass die Zukunft für Lebensmittel-Allergiker durchaus rosig sein könnte, beweist der Blick auf die aktuelle Forschung und das neue Allergiesiegel der EU, das ich am Ende des Buches vorstelle. Im Anhang finden Sie ein kurzes Glossar, in dem Sie die wichtigsten Fachbegriffe nachlesen können, und hilfreiche Adressen zum Thema. Natürlich kann und will ich mit dem Buch »Allergien vom Tisch« den Besuch beim Arzt und Ernährungsberater nicht ersetzen. Vielmehr möchte ich Ihnen einen Begleiter für den Alltag mit Lebensmittel-Unverträglichkeiten an die Hand geben, der Ihnen zu mehr Essgenuss trotz Allergie verhilft. Ihre Susanne Fehrmann Regensburg – im März 2007 14 Allergien – ein modernes Phänomen? Sie oder einer Ihrer Familienangehörigen leidet unter einer Allergie? Da stehen Sie nicht alleine. Allergie – das ist längst kein Fremdwort mehr. In den modernen Industriestaaten nehmen Allergien unablässig zu und kaum ein Bundesbürger, der nicht schon einmal auf die ein oder andere Weise mit Allergien zu tun hatte. Allergologen schätzen, dass jeder Dritte von uns in irgendeiner Form an einer Allergie leidet. Ist die Allergie also eine Art moderner »Heimsuchung«? Aus antiken Quellen wissen wir, schon die alten Ägypter kannten die Symptome einer Allergie. Durchforstet man medizinische Schriften, findet man auch unter historischen Persönlichkeiten einige »Allergiker«. Der älteste beschriebene Fall einer allergischen Reaktion ist wahrscheinlich der Tod von Pharao Menes. Er starb 2640 v. Chr. an einem Wespenstich. Kaiser Augustus litt bereits vor zweitausend Jahren, wie andere aus seiner Familie, an allergischem Asthma und Hautekzemen. Nahrungsmittel-Allergien waren bereits Hippokrates bekannt. 400 v. Chr. beschrieb er Migräneanfälle nach Käsegenuss, und auch Ei-Unverträglichkeiten kannte er. Allergien sind also keine reinen Erscheinungen der letzten hundert Jahre. Doch während Allergien früher nur vereinzelt auftraten, sind sie heute ein Massenleiden. Jeder scheint gegen irgendetwas allergisch zu sein. Alles nur Hysterie? Nein, sagt die WHO und belegt mit Zahlen, dass Allergien in den westlichen Industrienationen eindeutig auf dem Vormarsch sind. So litten beispielsweise 1926, 1,4 % der Züricher an Heuschnupfen, 1986 waren es bereits über 10 % und heute geht die Pharmaindustrie davon aus, dass bis zu 20 % der in der Schweiz lebenden Menschen unter pollenbedingten allergischen Symptomen leidet. Allergien scheinen eine Krux unserer modernen Zivilisationsgesellschaft und sind weltweit auf dem Vormarsch. Längst zählen sie zu den großen gesundheitlichen Problemen unserer Zeit. 15 Besonders Heuschnupfen oder Bronchialasthma rangieren ganz oben auf der Liste allergischer Erkrankungen. Doch immer noch werden Allergien von den Betroffenen nicht als wirkliche Krankheit akzeptiert. Wahrscheinlich wissen drei Viertel aller Allergiker nichts von ihrer Krankheit oder bagatellisieren sie. Doch wer seine Allergie nicht ernst nimmt, muss mit schlimmen Folgen rechnen. Grundsätzlich zeigen Allergien nämlich die Tendenz, sich auszuweiten. Ein unbehandelter Heuschnupfen kann über die Jahre zu lebensbedrohlichem Asthma werden, oder es können zur Pollen-Allergie weitere Allergien hinzukommen. Blütenpollen, Hausstaub und Metall sind verbreitete Allergieauslöser. Immer öfter macht aber auch das Essen Menschen krank. Besonders die Kleinen sind betroffen. Studien belegen, Nahrungsmittel-Allergien treten besonders häufig in den ersten Lebensjahren auf. Erschreckend hoch sind die Zahlen vor allem bei Kindern mit Hauterkrankungen wie etwa Neurodermitis. 30 bis 50 % dieser Kinder reagieren allergisch auf Milch, Ei oder andere Grundnahrungsmittel. Prinzipiell kann eine Lebensmittel-Allergie jedoch in jedem Alter entstehen, und auch ältere Menschen sind nicht vor ihr gefeit. Aber wie kommt es überhaupt zu einer Allergie, welche Ursachen hat eine Allergie, wie entsteht sie, und was sind ihre Auslöser? Um mit einer Allergie gut leben zu können, ist es wichtig, die eigene Allergie zu verstehen. 16 Die Allergie – ein Irrtum des Immunsystems Der moderne Allergiebegriff wurde 1906 von dem österreichischen Kinderarzt Clemens von Pirquet geprägt. Mit den beiden griechischen Begriffen »allos« (anders) und »ergon« (Tätigkeit, Wirkung) beschreibt er eine unerklärliche »andersartige Reaktion« des Körpers. Heute verstehen wir unter einer Allergie eine unangemessen heftige Reaktion unseres Immunsystems auf eine an sich harmlose Substanz. Das Immunsystem übernimmt dabei die Schlüsselrolle. Unsere Immunabwehr – ein lebenswichtiger Schutz Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute unseres Lebens kommt unser Körper mit ihm fremden Stoffen in Berührung. Viren, Bakterien, Parasiten und Umweltgifte zählen ebenso zu körperfremden Stoffen wie Kleidung, Seife oder Lebensmittel. Wir sind mit einer Umwelt konfrontiert, die uns eigentlich permanent krank machen könnte. Damit wir überleben, muss unser Organismus laufend in der Lage sein, Schädliches zu erkennen und von unserem Körper abzuwehren und Notwendiges zu akzeptieren. Immer wieder aufs Neue müssen wir zwischen Freund und Feind unterscheiden. Dieser Drahtseilakt gelingt nur, weil unser Körper über ein einzigartiges Abwehrsystem verfügt. Um das Überleben zu sichern, verlässt sich unser Organismus nicht auf ein einzelnes Organ; ein komplexes System aus unterschiedlichen Organen, Geweben, Zellen und physikalischen sowie chemischen Mechanismen schützt unseren Körper gegen 17 unsere Umwelt. Jeder Beteiligte übernimmt in diesem System spezifische Aufgaben, die alle miteinander verzahnt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Gesamtheit all dieser Funktionen und Maßnahmen bilden das sogenannte Immunsystem. Erstaunlicherweise merken wir von dieser extrem wichtigen Aufgabe in der Regel nichts. Im Gegensatz zu anderen Körperfunktionen, wie etwa dem Herzschlag, der Atmung oder der Darmtätigkeit, arbeitet unser Immunsystem im Normalfall vollkommen unbemerkt. Erst wenn die Abwehr mehr als gewöhnlich arbeitet und stärkere Geschütze auffahren muss, nehmen wir unser Immunsystem wahr. Wir bekommen etwa Fieber oder leiden an einer Entzündung. Doch glücklicherweise ist unser Organismus meistens in der Lage, schon im Vorfeld krank machende Eindringlinge abzuwehren bzw. harmlose Substanzen zu akzeptieren. Unser Immunsystem ist so vielschichtig und umfassend, dass es nicht ersetzt werden kann, auch nicht durch Medikamente oder andere Hilfsmittel. Um das Immunsystem in seiner Komplexität besser zu verstehen, wird in der Regel zwischen dem angeborenen und dem erworbenen Abwehrsystem unterschieden. Beide Systeme können jedoch nur gemeinsam funktionieren und sind über viele Mechanismen untrennbar miteinander verbunden. Angeborene Abwehrmechanismen – Schutz ab dem ersten Lebenstag Die angeborene Abwehr wird auch Resistenz genannt und ist als erste Verteidigung des Körpers gegen Krankheitserreger allen anderen Abwehrmechanismen vorgeschaltet. Angeborene physikalische und chemische Barrieren und Abwehrmechanismen schützen den Organismus unspezifisch gegen jede Art von krank machenden Mikroorganismen: Unsere Haut erschwert durch ihre Hornschicht und einen leicht sauren pH-Wert das Eindringen von Keimen. Enzyme in der Tränenflüssigkeit (Lysozym), im Speichel und im Verdauungstrakt töten Bakterien ab. 18 Abb. 1 Angeborene Abwehrmechanismen des Körpers Chemische und physikalische Barrieren schützen den Körper unspezifisch gegen Krankheitserreger. 19 Abb. 2 Organe des Immunsystems Das erworbene Immunsystem entwickelt sich ein Leben lang fort. Erst der Kontakt mit einem Erreger aktiviert diesen Abwehrmechanismus. 20 Flimmerhärchen und das Sekret der Schleimhäute in den Ohren, der Nase und den Bronchien spülen krank machende Partikel aus unserem Körper. Niesen oder Hustenreflex befördert Fremdkörper wieder nach außen. Die Magensäure eliminiert viele Krankheitserreger, bevor sie Schaden im Körper anrichten können, und im Urogenitaltrakt spült Urin Krankheitserreger aus dem Organismus. Das saure Scheidenmilieu verhindert viele Infektionen. Eine gesunde Darmflora entwickelt sich bereits im Säuglingsalter. Sie beherbergt eine Vielzahl symbiontischer Bakterien, die krank machende Keime am Wachsen hindern. Gelangt trotz dieser zahlreichen Abwehrmechanismen Fremdmaterial in unseren Organismus, so wird eine unspezifische Abwehr aktiv. Sogenannte Fresszellen (Phagozyten) fressen fremde Eindringlinge regelrecht auf. Sie erkennen mit Hilfe von Rezeptoren den körperfremden Stoff, umfließen ihn und schließen ihn in ihrem Inneren ein. Dort wird der fremde Mikroorganismus in Bruchstücke zerlegt und verdaut. Mit Hilfe von Immunbotenstoffen locken sie außerdem weitere Fresszellen zur Verstärkung an. Diese Fresszellen sind in unserem ganzen Organismus vorhanden. Beispielsweise zirkulieren neutrophile Granulozyten (kleine Fresszellen) ständig im Blut. Sie können bei einer »lokalen Invasion« von Mikroorganismen schnell an Ort und Stelle sein und den Eindringling vernichten. Monozyten und Makrophagen (große Fresszellen) bilden eine zweite Gruppe von Fresszellen, die ebenfalls unspezifisch gegen alle Mikroorganismen gerichtet ist. Makrophagen kommen praktisch in allen Geweben vor. Vor allem aber arbeiten sie in den Filterorganen, wie Leber, Milz, Lunge, Niere und den Lymphknoten. Erworbene Abwehr – individueller Schutz Um diese angeborenen Schutzmaßnahmen zu perfektionieren und noch wirksamer gegen Krankheitserreger vorgehen zu können, verfügt unser Organismus außerdem über das adaptive bzw. erworbene Immunsystem. Erst der Kontakt mit einem 21 Krankheitserreger aktiviert diesen Abwehrmechanismus. Dieses Abwehrsystem entwickelt sich ein Leben lang fort. So entsteht eine Abwehr, die genau auf unsere Umwelt abgestimmt ist. Jeder hat das bereits am eigenen Leib erfahren: Erkrankt man als Kind beispielsweise an Röteln, so entwickelt das Immunsystem einen lebenslangen Schutz vor Röteln. Man wird sich nicht mehr anstecken, da das Immunsystem gelernt, hat sich gegen Rötelnerreger zu wehren. Diese Abwehr ist nicht angeboren, sondern wir erwerben sie, indem wir mit dem Krankheitserreger in Kontakt kommen. Die Grundlage der erworbenen Abwehr bilden die weißen Blutzellen (Lymphozyten). Bei einer gesunden Immunabwehr verfügt ein Erwachsener über etwa zweimal 1012 Lymphozyten. Das heißt, dass nur ein Tropfen Blut bereits mehr als 20 Millionen Lymphozyten enthält. Ausgelöst wird die spezifische Abwehr von Substanzen, die Antigene genannt werden. Antigene befinden sich auf der Oberfläche von körperfremden Stoffen, z. B. von Viren, Bakterien, Parasiten oder auch von Blütenpollen. Chemisch können Proteine, aber auch Lipide, Nukleinsäuren und andere organische und anorganische Verbindungen als Antigenmoleküle fungieren. Dringt ein Fremdstoff mit Antigenen an seiner Oberfläche in unseren Körper ein, so ruft das in unserem Immunsystem eine Immunantwort hervor. Je nach Art des Antigens werden unterschiedliche Lymphozyten aktiviert, die gezielt gegen den Eindringling vorgehen. Lymphozyten entstehen aus den Stammzellen unseres Knochenmarks. Es gibt verschiedene Arten von Lymphozyten, die alle eine spezifische Aufgabe erfüllen. Sie werden in Lymphozytenfamilien unterteilt. T-Lymphozyten Ein Teil der im Knochenmark gebildeten Lymphozyten gelangt über die Blutzirkulation in den Thymus (Drüse unterhalb des Brustbeins). In einem Reifungsprozess lernen sie hier zwischen »eigen« und »fremd« zu unterscheiden und feindliche Antigene zu erkennen. Nach dieser »Erziehung« verlassen sie als spezi22 Abwehr von Krankheiten Das angeborene Immunsystem Das erworbene Immunsystem wirkt unspezifisch wirkt spezifisch hat kein Gedächtnis hat ein Gedächtnis besteht aus Makrophagen, Granulozyten und dendritischen Zellen besteht aus B-Lymphozyten und T-Lymphozyten Abb. 3 Eigenschaften des angeborenen und des erworbenen Immunsystems fische antigenreaktive Zellen den Thymus und übernehmen unterschiedliche Aufgaben in der Immunabwehr: • Als T-Helferzellen erkennen sie ihr spezifisches Antigen, wenn es von anderen Zellen präsentiert wird, und zerstören es. Dafür wird das feindliche Antigen zunächst von bestimmten Zellen (vor allem dendritischen Zellen, Makrophagen, B-Zellen) gebunden und den T-Lymphozyten als Feind »präsentiert«. Ein Beispiel: Treffen Makrophagen auf eine körperfremde Substanz, umschließen sie den Eindringling und zerlegen ihn. Seine Bruchstücke werden anschließend als Antigen an der Zelloberfläche der großen Fresszellen »präsentiert«. Die T-Helferzellen erkennen die so präsentierten Antigene und die Beschaffenheit des Eindringlings und sind nun in der Lage, einen Eindringling als »Freund«, also harmlosen Stoff, oder als »Feind«, sprich gefährliche Substanz, zu identifizieren und nötigenfalls zu zerstören. • Als T-Killerzellen (zytotoxische Zellen) spielen T-Lymphozyten vor allem in der Erkennung und Beseitigung von Virusinfektionen eine große Rolle. • Als T-Suppressorzellen oder als T-Regulatorzellen (genaue Mechanismen sind noch nicht bekannt) verhindern sie, dass Immunreaktionen immer weiter laufen. Sie vermitteln unter 23 Umständen eine gewisse Toleranz gegenüber bestimmten Antigenen. • Als langlebige T-Gedächtniszellen speichern T-Lymphozyten Informationen über den Eindringling und können bei einer erneuten Infektion schnell spezifische Abwehrreaktionen auslösen. B-Lymphozyten Auch diese Lymphozyten bekämpfen Antigene. Allerdings zerstören sie den Eindringling nicht direkt, sondern leiten die sogenannte humorale Abwehr ein, indem sie spezifische Antikörper (Immunglobuline) gegen das feindliche Antigen produzieren. Stark vereinfacht dargestellt, geschieht dies folgendermaßen: B-Lymphozyten werden im Knochenmark auf ihr spezifisches Antigen trainiert. Über die Lymphbahn gelangen sie vor allem in Milz und Lymphknoten. Treffen sie dort auf »ihr« Antigen, binden sie das Antigen und entwickeln sich so zu Plasmazellen weiter. Diese Plasmazellen produzieren nun Antikörper gegen genau dieses Antigen. Verbinden sich Antigen und Antikörper, entsteht ein Antigen-Antikörper-Komplex. So ist der Eindringling markiert und kann im weiteren Verlauf von unserem Immunsystem gezielt ausgeschaltet werden. Bei Bedarf kann das Immunsystem unendlich viele verschiedene Antikörper bilden, die sich gegen unterschiedliche Antigene richten können. Sind alle Fremdkörper vernichtet, so sterben die meisten antikörper-produzierenden B-Lymphozyten ab. Einige wenige B-Lymphozyten jedoch werden zu sehr langlebigen Zellen, den B-Gedächtniszellen. Zusammen mit den oben erwähnten langlebigen T-Zellen bilden sie unser »immunologisches Gedächtnis«. Dringt das gleiche Antigen erneut in unseren Organismus ein, so »erinnert« sich unser Abwehrsystem mit Hilfe dieser Zellen und der Krankheitserreger kann schnell und gezielt ausgeschaltet werden. 24 Immunglobuline – Spezialisten des Abwehrsystems Antikörper sind ein zentraler Bestandteil unseres Immunsystems. Stark vereinfacht, könnte man sie als die »Waffen« unserer Immunabwehr bezeichnen. Da sie auch bei der Entstehung von Allergien eine entscheidende Rolle spielen, ist es sinnvoll, sie etwas detaillierter zu erläutern. Antikörper sind keine Zellen, sondern Eiweiße des menschlichen Körpers, die meist in der Gewebsflüssigkeit, im Blut und in den Körpersekreten gelöst sind. Da diese Eiweiße zur Gruppe der Globuline gehören, werden sie auch als Immunglobuline (Ig) bezeichnet. Trotz ihrer enormen Vielfalt besitzen alle Immunglobuline eine ähnliche Struktur. Jeder Antikörper ist aus vier Eiweißketten aufgebaut. Zwei identisch schwere Ketten (H) und zwei identisch leichte Ketten (L) sind zu einer Y-förmigen Struktur zusammengefügt. Die beiden kurzen Arme des Y sind spezifisch aufgebaut. Sie sind die Erkennungs- und Bindungsstelle des Antikörpers. Dabei identifiziert der Antikörper nicht das ganze Antigen, sondern nur einen Teil, das sogenannte Epitop. Das Antigen an der Oberfläche eines Bakteriums kann beispielsweise unterschiedliche charakteristische Epitope besitzen. Antigen-präsentierende Zellen präsentieren genau diese Epitope an ihrer Zelloberfläche. Gegen jedes Epitop bildet unser Immunsystem spezifische Antikörper. Sind Antigen und Antikörper am Epitop verbunden, so spricht man von einem Immunkomplex oder Antigen-Antikörper-Komplex. Dieser Komplex aktiviert nun die gezielte Vernichtung des Antigens. Indem er das Antigen neutralisiert, Fresszellen anlockt, Killerzellen aktiviert oder indem er eine ganze Reaktionskette des Immunsystems auslöst, wird der körperfremde Eindringling zerstört. Der Y-Stamm des Antikörpers ist – im Gegensatz zu den Armen – wenig variabel. Einige wenige strukturelle Unterschiede in diesem Teil des Y erlauben eine Einteilung der Antikörper in einzelne Klassen unabhängig davon, gegen welches Antigen der Antikörper spezifisch reagieren kann. In der Humanmedizin werden fünf verschiedene Antikörperbzw. Immunglobulinklassen unterschieden und mit den Buch25 staben G, A, M, D, E benannt. Man spricht daher auch von der GAMDE-Einteilung. Jede einzelne Klasse erfüllt eine andere Aufgabe und ist im Labor nachweisbar. Immunglobulin G (IgG) Mit einem Anteil von 80 % an allen Immunglobulinen bildet IgG die größte Klasse unter den Antikörpern. IgG ist hauptverantwortlich für die Abwehr von Viren und Bakterien. Es wird erst ca. drei Wochen nach einer Erstinfektion gebildet und ist sozusagen eine verspätete Immunantwort auf eine Infektion. IgG schützt uns vor einer zweiten Erkrankung durch den gleichen Erreger. Kommt unser Organismus erneut mit dem Fremdstoff in Kontakt, so kann dank der Gedächtniszellen sofort eine große Menge IgG gebildet werden. Sie schlagen im Abwehrsystem Alarm, indem sie sich an den Eindringling heften, weitere Abwehrmaßnahmen in Gang setzen und so eine erneute Erkrankung verhindern. Außerdem ist IgG als einziges der bekannten Immunglobuline plazentagängig. Während einer Schwangerschaft und bis zu drei Monate nach der Geburt schützt das mütterliche IgG das Kind vor Infektionen, die die Mutter bereits durchlebt hat. Immunglobulin A (IgA) Immunglobulin A stellt mit ca. 15 % die zweitgrößte Gruppe der Antikörper unseres Immunsystems dar. An der Oberfläche der Schleimhäute schützt es unter anderem im Mund, in der Nase, der Tränenflüssigkeit oder im Magen-Darm-Trakt vor Infektionen. Erst wenn ein Eindringling die IgA-Barriere überwunden hat und tiefer eindringt, kommt es zu Anzeichen einer Entzündung. IgA wird auch von den Drüsen rund um die Brustwarzen abgesondert und ist daher in der Muttermilch nachweisbar. Gestillte Säuglinge erhalten so einen zusätzlichen Infektionsschutz. 26 Abb. 4 Die Wirkungsweise von IgG-Antikörpern (Immunglobuline G) Immunglobuline G bilden die größte Klasse unter den Antikörpern und dienen hauptsächlich der Abwehr von Viren und Bakterien. 27 Immunglobulin M (IgM) Immunglobulin M ist die erste (primäre) Antwort des Immunsystems auf eine Infektion mit einem neuen Erreger. IgM wird daher auch als »Frühantikörper« bezeichnet. Im Blut verbinden sich die IgM mit den Eindringlingen und markieren sie damit für die Fresszellen. Im Lauf der Infektion nimmt der Wert an IgM wieder ab. Gleichzeitig werden dafür mehr IgG gebildet. Ist nur eine geringe Menge IgM im Organismus nachweisbar, so handelt es sich entweder um eine Zweitinfektion oder die akute Erkrankung klingt bereits ab. Immunglobulin D (IgD) Immunglobulin D ist ein noch relativ unerforschter Antikörper. Es ist nur in winzigen Mengen in unserem Blut gelöst und in der Lymphe nachweisbar. IgD findet sich vor allem auf der Oberfläche von B-Lymphozyten, an deren Aktivierung es wohl beteiligt ist. Immunglobulin E (IgE) Immunglobuline E wehren Parasiten, wie etwa Würmer, ab. IgE wird in den Plasmazellen der Schleimhaut des Darms und der Atemwege gebildet und ans Blut abgegeben. Dort heften sie sich an die Oberfläche der sogenannten Mastzellen und basophilen Granulozyten. Trifft nun das passende Antigen des Eindringlings auf ein solches IgE, so schütten die Zellen Histamin und andere Botenstoffe aus, die zu weiteren Abwehrmaßnahmen führen. So kommt es etwa zur Gefäßerweiterung, um weitere Immunzellen leichter anzulocken, und zu Muskelkontraktion, so dass der Erreger leichter über Darm und Lunge ausgeschieden werden kann. Obwohl nur 0,001 % aller Immunglobuline zur IgE-Klasse gehören, spielen sie bei über 90 % aller allergischen Prozesse eine wichtige Rolle. 28