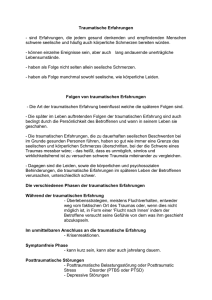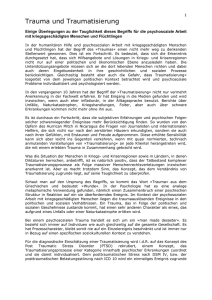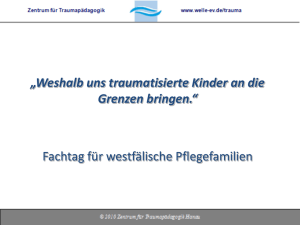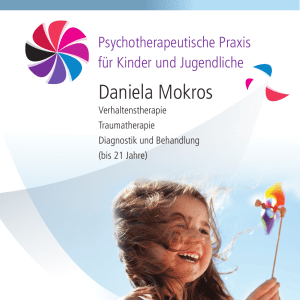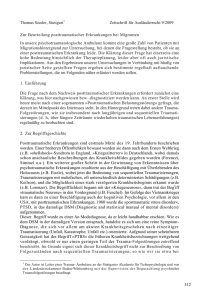Der Körper als Ausdrucksfeld traumatischer Erfahrungen
Werbung

Der Körper als Ausdrucksfeld traumatischer Erfahrungen Inselspital Bern 22.9.2011 PD Dr. phil. Rosmarie Barwinski Schweizer Institut für Psychotraumatologie (SIPT) www.psychotraumatologie-sipt.ch Welche seelischen Folgen, die sich auch körperlich ausdrücken können, hinterlassen Ereignisse wie Unfall und Krankheit bei den Betroffenen? Aufbau 1. Psychische Folgen von Traumatisierung durch Unfall und Krankheit 2. Psychosomatische Folgen von Traumatisierung - Krankheit als Traumafolge 3. Indikation: Welches Vorgehen ist bei welchen Patienten indiziert? Ätiologischer Ansatz - Ätiologie - Symptomatologie - Pathogenese Ätiologie In ihrer Verallgemeinerung über verschiedene Krankheitsbilder hinweg wird die Lehre von den Krankheitsursachen als „Ätiologie“ bezeichnet. Symptomatologie Den Ausdruck „Symptom“, der aus dem Altgriechischen stammt, können wir übersetzen mit „Zeichen“ oder „Anzeichen“. Gemeint ist ein Anzeichen, das auf die Krankheit verweist. Aus den Krankheitszeichen sucht der Praktiker den pathologischen Prozess zu erschliessen, der als Ursache der Symptome verstanden wird. Pathogenese Pathogenese ist die Lehre von den Vorgängen intraorganismischer bzw. intrapsychischer Fehlregulation und den Mechanismen der Aufrechterhaltung einer Störung bzw. Erkrankung. Pathogenetische Mechanismen lassen sich als Dysfunktion oder -regulation gesundheitserhaltender Kräfte und Faktoren beschreiben. A) psychotraumatisch D) B) Untersozialisation Übersozialisation C) psychobiologisch 1. Definition: Trauma Fischer & Riedesser (1998) definieren Trauma als "ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen der Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbstund Weltverständnis bewirkt." Trauma ist eine Verlaufskrankheit: Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung Die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen durchläuft unterschiedliche Phasen: - traumatische Situation - traumatische Reaktion - traumatischer Prozess Traumatische Situation Der Begriff der traumatischen Situation umfasst sowohl die äußeren, objektiv erfassbaren Situationsmerkmale als auch die persönlichkeitstypische Reaktionsbereitschaft. Objektiver Zugang Unfall: - der Unfallhergang (äussere Umstände) Krankheit: - Diagnosemitteilung Subjektiver Zugang Erleben in der traumatischen Situation: - Hilflosigkeit - Angst, Todesangst - Panik - Schock - Schmerz, Schmerzunempfindlichkeit - fehlende Handlungskontrolle - Verwirrung, Wahrnehmungsschwierigkeiten - heftige affektive und körperliche Reaktionen - dissoziative Phänomene dissoziative Phänomene Beispiel Unfall: - Betroffene sah sich während des Unfalls „von oben“ aus der Beobachterperspektive im Auto sitzen (wusste nicht, wie sie nach dem Unfall nach Hause gekommen war) Beispiel Diagnosemitteilung: - realisierte nicht, was die Mitteilung des Arztes bedeutet; erlebte sich wie „im Film“ Traumatische Reaktion - Wechsel zwischen Verleugnung und Reizüberflutung Verleugnung zeigt sich in Apathie oder Teilnahmslosigkeit. Reizüberflutung zeigt sich z.B. darin, dass Betroffene von Bildern des Unfalls verfolgt werden (z.B. ständig den Moment des Aufpralls „sehen“) oder sie ständig die Situation der Diagnosemitteilung innerlich wiederholen. Diese Notfallmassnahmen sind notwendig zur Integration der traumatischen Erfahrung. D.h. der Wechsel von Überflutung und apathischen Pausen macht es langsam möglich das Schreckliche denken zu können und als Teil der eigenen Geschichte zurückzulassen. Die traumatische Reaktion ist in diesem Sinne eine normale Antwort auf eine aussergewöhnliche Situation. Unfall natürlicher Verarbeitungsprozess ist blockiert: - von Bildern und Gefühlen „überschwemmt“ werden - „so tun, als wäre nichts passiert“ oder Vermeidung von „triggern“ hält an Erkrankung natürlicher Verarbeitungsprozess ist blockiert: - Verleugnung der Krankheit (Diagnosemitteilung führt zu keiner Reaktion oder Veränderung in der Lebensführung) - Überflutung von Ängsten Langzeitfolge: Ich-Spaltung Ein Teil der Persönlichkeit weiss um das traumatisch Geschehen, der andere lebt weiter als sei nichts geschehen. Vorteil: Teil der Persönlichkeit bleibt weiterfunktionsfähig Nachteil: keine weitere psychische Bearbeitung der als traumatisierend erlebten Realität, so dass das Traumatisierende permanente, aber nicht psychisch repräsentierte Aktualität besitzt Auch wenn Aktivitäten, Situationen oder Personen vermieden werden, die an die traumatische Situation erinnern könnten, schaffen sich die Erinnerungen, auch wenn sie nicht bewusst sind, via Inszenierungen, Albträumen und Gefühlen, die mit dem Trauma verknüpft sind, noch Jahrzehnte nach deren Geschehen Zugang zur Aktualität. Auslöser - erhöhter Stress - "trigger" (Eindrücke visueller, olfaktorischer oder auditiver Art, die an traumatische Situationen erinnern) - aktuelle Traumata Traumatischer Prozess Der traumatische Prozess stellt den lebensgeschichtlichen Bewältigungsversuch der traumatisierten Persönlichkeit dar, der zu verschiedenen klinischen Bildern führen kann (wie z.B. Depressionen, Phobien, Suchterkrankungen, aber auch psychosomatische Beschwerden oder PTSD). psychotraumatisches Belastungssyndrom (PTBS) Halten die Folgen des Traumas länger als einen Monat an, so tritt häufig ein Zustand ein, der durch folgendes Erscheinungsbild gekennzeichnet ist: - unfreiwilligen Erinnerungsbildern an das traumatische Ereignis (meist in Form von flash-backs oder sich wiederholenden Albträumen), - Vermeidung von Situationen, die an die traumatische Situation erinnern könnten und - Erregung (Die Erregung und Angst kann sich auch körperlich äussern z.B. in Magen- oder Kopfschmerzen). Unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis finden sich diese und andere Beschwerden, wie schwere Depressionen und Selbstzweifel oder überwältigende Wut bei den meisten Betroffenen. Hier sprechen wir noch nicht von einem PTBS. Bleibt die Erholung jedoch dauerhaft aus, so besteht ein erhöhtes Risiko für negative Langzeitfolgen. Unfall bildhafte, sensomotorische Form der Erinnerung bleibt erhalten - Flashbacks (Bilder des traumatischen Geschehens) - Albträume - mit dem Trauma verknüpfte heftige Gefühlszustände oder - Vermeidungsverhalten weitet sich aus Krankheit - körperliche Grenzen werden verleugnet - körperliche Grenzen werden nicht ausgetestet - der Körper als „Fremdkörper“ (Spaltung) Verständniszugang zu Langzeitfolgen: Dynamik psychotraumatischer Störungen - Traumaschema vs. - Traumakompensatorisches Schema Traumakompensatorisches Schema - Wie hat es zu dem erschütternden Ereignis kommen können? - Wie lässt sich eine Wiederholung in Zukunft vermeiden? - Was kann das Trauma, die seelische Verletzung bzw. Erschütterung, wieder heilen bzw. ungeschehen machen? Beispiel Frau M. ist eine 64jährige Frau, die eine langwierige lebensbedrohliche Krankheit in ihrer Kindheit überlebte. Vor sechs Monaten erlitt sie einen Herzanfall. Obwohl sie sich erholte, berichtete Frau M. seit dieser Zeit von folgenden Symptomen: Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, intrusive Erinnerungen an ihre Kindheit und depressiven Verstimmungen. Frau M. schreibt ihrem Herzanfall ihrer eigenen Unwürdigkeit zu. Frau M. sagt: „Mir passieren immer schlimme Dinge, weil ich es nicht anders verdiene. Ich bin oft neidisch und engstirnig, und ich bin niemals dankbar für das, was ich habe. Menschen wie ich verdienen es zu leiden. Man sollte meinen, dass mich meine Krankheit in meiner Kindheit zu einem besseren Menschen gemacht hätte. Aber ich war so dumm, das ich das vergessen habe, bis der Herzanfall mich wieder an meine selbstsüchtige Natur erinnert hat. Ich verdiene einfach die guten Dinge des Lebens nicht.“ Beispiel Herr W. ist ein 62jähriger Mann, der an einer Netzhautdegeneration leidet. Der Patient wurde vom Hausarzt zu einer Einschätzung durch einen Psychotherapeuten überwiesen. Herr W. berichtete über die folgenden Symptome: Schlaflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Interesselosigkeit. Zusätzlich berichtete er die Gesichter von Kameraden des 2. Weltkrieges zu sehen, die im Gefecht starben. Und die Geräusche von Schreien und Geschützfeuer zu hören. Er berichtet, dass er früher ein unerschütterlicher Leser war. „Gewöhnlich las ich zwei bis drei Romane in der Woche. Ich habe nichts, um meinen Geist zu beschäftigen. Seit ich solche Schwierigkeiten beim Lesen habe, fange ich an, über meine Kameraden nachzudenken, die im Krieg starben. Ich sehe ihre Gesichter, höre ihre Schreie. Ich wünschte, ich hätte etwas, um meinen Geist zu beschäftigen, aber ich kann nicht einfach ein Buch nehmen und anfangen zu lesen, wie ich es früher tat.“ Vorangehende Traumata bestimmen die Verarbeitung aktueller Traumatisierungen. Wenn durch aktuelle Traumata das TKS in Frage gestellt wird, kommt es zur Dekompensation. Beispiel Die Patientin erlitt im Januar 2010 in der Nacht einen Selbstunfall mit dem Auto. Sie rutschte mit dem Auto ca. 80 Meter eine Böschung hinunter. Sie sei während dem Sturz des Autos voll bei Bewusstsein gewesen. Dabei verspürte sie starke Rückenschmerzen sowie Todesangst, unermessliche Hilfs- und die Ausweglosigkeit. Nach dem Sturz konnte sie nicht aus dem Auto klettern. Als sie ihr Natel nicht fand, dachte sie, sie wird erfrieren. Nachdem es ihr gelungen war aus dem zerquetschten Auto durch das Fenster zu klettern, hörte sie ein Auto auf der Strasse vorbei fahren. Sie rief nach Hilfe, aber wurde nicht gehört. Sie dachte: “Ich sterbe hier und es wird mich niemand hören und mir helfen“. Sie versuchte den Abhang hinauf zu klettern, rutschte mehrfach hinunter. Auf der Strasse wurde sie von einem Fahrer aufgefunden und ins Spital gebracht. Es wurden mehrere Quetschungen und Schürfungen ohne Frakturen festgestellt. Seit dem Selbstunfall mit dem Auto hat sie sich verändert, erträgt keine Konfrontationen, bricht schnell in Zorn aus, hat starke Schuldgefühle insbesondere gegenüber ihrem Freund. Sie leidet an Antriebs-, Freud-, Kraft- und Energielosigkeit. Im weiteren Verlauf litt sie an erhöhter Schreckhaftigkeit, innerer Unruhe, Nachhallerinnerungen (Flash-backs), Alpträume, Ein- und Durchschlafstörungen, Schweissausbrüchen, Konzentrations-, Merkfähigkeit und Gedächtnisstörungen, Hypervigilanz und erhöhte Reizbarkeit mit häufigen Wutausbrüchen. Ihr Leben sah sie sinnlos, sie bedauerte überlebt zu haben, fürchtete sich vor ihrer Zukunft. Die Patientin ist seit dem Unfall krank geschrieben und wurde vom Hausarzt in eine ambulante Therapie überwiesen. Im Gespräch mit der Therapeutin berichtet sie von sexuellen Übergriffen, die im Alter von 12 Jahren von einem Onkel verübt wurden. Sie schäme sich darüber zu reden und habe bis heute niemanden etwas davon erzählt. Ihr Vater hätte einen „Schock bekommen und die Enttäuschung nicht verkraften können“. Er hätte seinen Bruder umgebracht und damit die Familie unglücklich gemacht. Aus diesem Grund wollte sie ihre Eltern nicht damit belasten. Sie habe gelernt, allein mit Problemen auszukommen. Im traumakompensatorischen Schema ist eindeutig, dass die Patientin gelernt hat, dass ihr keiner hilft und sie selber Probleme lösen muss. Sie kann keine Hilfe und Unterstützung zulassen, weil sie damit auch ihre Hilflosigkeit spüren würde. Unter Autonomie versteht sie keine Hilfe zu benötigen. Sie erlebt Hilflosigkeit als Bedrohung eigener Autonomie. Der Verlust des Autos hat ihre Autonomie eingeschränkt. Sie hat keine Arbeitsstelle, die Unfallversicherung übt Druck aus und bald wird sie kein Einkommen haben. Sie will ihrem Verlobten nicht zur Last fallen. Da sie wegen Kleinigkeiten in Zorn ausbricht und dabei verbal verletzend wird, hat sie Angst um ihre Beziehung und ihre Zukunft. Einflussfaktoren auf Langzeitfolgen traumatischer Erfahrungen Traumatische Situation Objektive Situationsfaktoren: - Dauer und Alter, wann das Trauma sich ereignete - körperliche Verletzungen u.a. Subjektives Erleben Lebensgeschichte - Vortraumatisierungen, Probleme im Beziehungsleben Zusätzliche Schutzfaktoren - Soziale Unterstützung (z.B. Familie) 2. Psychosomatische Folgen von Traumatisierung - Krankheit als Traumafolge Zu Beginn der Traumabearbeitung können der Körper und unterschiedliche Körpersymptome folgende Funktionen erfüllen: - Körpersymptome als Ausdruck der unterbrochenen Handlung in der traumatischen Situation - Körpersymptome als Affektäquivalente - Körpersymptome können als Ausdrucksverhalten verstanden werden, die Symbolgehalt haben und körpersprachlich zu entschlüsseln sind - Körpersymptome können Ausdruck psychischer Abwehrmechanismen sein Körpersymptome können als Ausdruck der unterbrochenen Handlung in der traumatischen Situation gedeutet werden, die keine Bewältigung ermöglichten. Ist die Erinnerung an traumatischer Situationen verloren oder fragmentiert, so repräsentieren traumatische Reaktionen die traumatische Erfahrung in der impliziten Erinnerung, auf der Ebene des Körpergedächtnisses. Auf die vitale Bedrohung antwortet der Organismus mit maximaler Handlungsbereitstellung und – anstrengung, die jedoch in sich zurückgeworfen wird. Wird nun die Sequenz Kampf-Flucht-„freeze“ (Erstarren, Sich Tot-stellen) vollständig durchlaufen, so stellt sich die intrasomatische Teilstrecke der unterbrochenen Handlung als „eingefrorenes Handlungsfragment“ dar, wobei die maximale Aktivität – angesichts der bedrohlichen Ausgangslage – in starker Anspannung mit dauerhaft überhöhtem Muskeltonus fortwirkt. Dies kann langfristig zu Spasmen und Kontrakturen in der betroffenen Muskulatur führen. Beispiel Ein Lastwagenfahrer versuchte einen Aufprall auf einen PKW zu verhindern, indem er verzweifelt mit dem Fuss auf das Bremspedal trat und sich gegen den Boden stempte. Seit dem Unfall kann er sein Knie nicht mehr biegen – sein Bein scheint in der Haltung „eingefroren“, die es während des Unfallhergangs hatte. Differentialdiagnostisch handelt es sich hier häufig um Fälle, die ein doppeltes Vorgehen verlangen. Wurde die motorische Reaktion über einen bestimmten Grenzwert hinaus gleichsam biologisch „eingefrässt“, ist zusätzlich zu einer ansonsten erfolgreichen Psychotherapie auch ein manuelles Therapieverfahren indiziert, welches die tiefe Skelettmuskulatur erreicht und gezielt auf die Reorganisation neuromuskulärer Regelkreise hinwirkt. Körpersymptome können als Affektäquivalente verstanden werden, die den Zugang zu Gefühlen ermöglichen, die in der traumatischen Situation erlebt, aber abgespalten wurden. Beispiel: Eine Patientin meldete sich in der Praxis wegen Burnout. Sie klagte über Körpersymptome wie „wacklige Beine“, Druck auf der Brust, Atemprobleme und Schwindel. Die Beschwerden führte sie auf Stress am Arbeitsplatz zurück. Sie fühlte sich überfordert, von ihrer Vorgesetzten im Stich gelassen und hatte das Gefühl, dass ihre Klagen nicht gehört würden. Sie war nicht mehr arbeitsfähig und seit ca. drei Monaten krank geschrieben. Im Verlauf des Gesprächs wird deutlich, dass ihre körperlichen Beschwerden als Symptome von Angst verstanden werden müssen, die sie jedoch nicht spürte. Das Erkennen der körperliche Symptome als Angstäquivalente ermöglichte ihr in der Folge sich an Situationen zu erinnern, denen sie im Alter von 12 Jahre ausgesetzt war. Ihre Mutter war schwer erkrankt und musste notfallmässig für einige Monate ins Krankenhaus. Sie musste während dieser Zeit in der Nacht alleine auf ihren jüngeren Bruder aufpassen, der damals eineinhalb Jahre alt war. Ihr Vater sei in dieser Zeit nicht ansprechbar gewesen. Er ging zwar regelmässig zur Arbeit, sei aber durch die Krankheit der Mutter in seiner Alltagsbewältigung überfordert gewesen. Sie habe in diesen Situationen, in denen sie sich eigentlich hätte überfordert fühlten müssen, ihre Angst nicht gespürt. „Es war doch niemand da, der mir helfen konnte. Ich musste funktionieren. Ich musste mich doch um den Kleinen kümmern“, führte sie aus. Sie entwickelt in der Folge eine Art NotAutonomie, die ihr jedoch den Zugang zu Gefühlen wie Angst und Überforderung verwehrte. Als die Patientin 18 Jahre alt war, starb ihre Mutter. Wieder war sie in einer schwierigen Lebensphase auf sich gestellt. Auch in dieser Zeit konnte ihr Vater ihr nicht die altersadäquate Unterstützung geben. Am Arbeitsplatz habe sie Gefühle der Überforderung nicht gespürt, wie „damals, als ich nachts mit dem kleinen Bruder alleine war“. Angst hatte bei dieser Patientin ihren Signalcharakter verloren. Sie konnte Grenzen nicht wahrnehmen und überforderte sich ständig. Aufgrund der Überlastung am Arbeitsplatz und der damit einhergehenden Reaktivierung traumatischer Erfahrungen, wurden Affekte wieder resomatisiert. Körpersymptome können als Ausdrucksverhalten verstanden werden, die Symbolgehalt haben und körpersprachlich zu entschlüsseln sind. Beispiel Wie der Körper als Mittel zum Ausdruck seelischer Verletzung gebraucht werden kann, kann am Beispiel der Behandlung einer Patientin mit einer über Jahre hinweg nicht heilenden Wunde illustriert werden. Im Verlauf der Behandlung konnte sich die Patientin an ein traumatisches Ereignis erinnern, das in ihrer Lebensgeschichte vorgefallen war. Zuvor hatte sie mit niemandem darüber gesprochen. In der Behandlung sah die Therapeutin eine zeitlang beim Wechsel der Wundverbände zu, ohne dabei selbst Hand anzulegen. Dies genügte, um die Wunde allmählich heilen zu lassen. Als Hintergrund dieser erstaunlichen Heilung kann man vermuten, dass die traumatische Erfahrung durch die Wunde zum Ausdruck gebracht worden war, so lange die Patientin nicht darüber reden konnte. Infolgedessen konnte sie nicht heilen. Sie war von der nicht verfügbaren symbolischen auf die Körperebene „verschoben“ worden. Körpersymptome als Ausdruck psychischer Abwehrmechanismen Beispiel Eine Patientin berichtete von Herzschmerzen und Druck auf der Brust. Sie hatte Angst, dass sie an einem Herzanfall sterben könnte. Im Verlauf des Gesprächs berichtete sie, das ihr Vater an einem Herzanfall gestorben sei. Sie hatte als Kind grosse Angst vor ihrem Vater gehabt, den sie als jähzornig und unberechenbar beschrieb. Als ihr bewusst wurde, dass sie mit ihrem Vorgesetzten in Konfliktsituationen ähnlich reagiere wie gegenüber dem Vater, konnte sie selbst den Zusammenhang zwischen ihren Herzschmerzen und ihrer Angst vor ihrem Vorgesetzten erkennen. Um Angst vor Aggression und Ohnmacht abzuwehren, zeigte sie eine partielle Identifikation mit dem Vater. Sie bekam Herzschmerzen wie der Vater. 3. Indikation: Welches Vorgehen ist bei welchen Patienten indiziert? Frage nach der Wahl eines Therapieverfahrens bei einer bestimmten Störung Unmittelbar nach einer katastrophalen Erfahrung weisen die meisten Personen Symptome eines psychotraumatischen Belastungssyndroms auf bzw. die Symptomatik einer akuten Belastungsreaktion oder Anpassungsstörung. Bei den meisten Personen bilden sich die Symptome zurück, bei einer Minderzahl von zwischen 10 bis zu 30 %, je nach Ereignis, bleiben sie bestehen oder verschärfen sich noch mit der Zeit. Als Selbstheiler werden Personen bezeichnet, die ohne klinische Folgen über traumatische Erfahrungen hinwegkommen. Wechselgruppe: Diese sind in ihrem postexpositorischen Erholungsprozess sehr stark auf stützende und beschützende soziale Bedingungen angewiesen. Sind diese vorhanden, werden sie zu „Selbstheilern“. Treffen sie jedoch auf ungünstige Bedingungen, wie eine kritische, zweifelnde soziale Umgebung oder langwierige bürokratische Prozeduren, so wandern sie zur Risikogruppe ab. Für die Wechselgruppe ist „psychotraumatologische Fachberatung“ indiziert. Viele Betroffene benötigen ausserdem aktive Unterstützung und Betreuung. Bei der Hochrisikogruppe ist eine möglichst zeitnahe Variante einer Akuttherapie angezeigt. Liegt die traumatische Erfahrung länger als ein dreiviertel Jahr zurück, so hat sich bereits ein traumatischer Prozess gebildet und oft auch schon neurobiologisch konsolidiert. In diesen Fällen ist eine Therapie vom Typ „mittelfristiger traumatischer Prozess“ indiziert mit zwischen 30 und etwa 50 Sitzungen. Bei langfristig bestehenden, stark chronifizierten Prozessen kommt nur eine Langzeittherapie in Frage mit zwischen 80 und ca. 300 Sitzungen bei schweren Fällen. Kriterien für die Indikation 1. zeitlicher Abstand zum traumatischen Ereignis z.B. akut oder chronisch 2. Art der traumatischen Situation, z.B. natural vs. men-madeDesaster, Schocktraumata, Belastungstraumata, Entwicklungstraumata u.a.), 3. soziales Umfeld, z.B. soziale Ressourcen 4. Tiefe der Störung (psychisches Struktur des Patienten) Generell gilt: Je unmittelbarer die Hilfe, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Störungen und Erkrankungen. Interventionsmöglichkeiten - Akuttherapie - Beratung - Betreuung - mittelfristiger Prozess - langfristiger Prozess Physiotherapie Wie erwähnt, kann Physiotherapie bei bestimmten Patienten indiziert sein. Wurde die motorische Reaktion über einen bestimmten Grenzwert hinaus gleichsam biologisch eingeprägt, ist zusätzlich zu einer ansonsten erfolgreichen Psychotherapie auch ein manuelles Therapieverfahren indiziert. Physiotherapeuten berichten, dass ihre Patienten während einer Massagebehandlung plötzlich Zugang zu Erinnerungen an traumatische Geschehnisse finden. In Physiotherapien mit traumatisierten Menschen muss diesem Sachverhalt besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um scheinbar unverständliche Reaktionen der Patienten einordnen zu können und Retraumatisierung zu verhindern. Empfehlungen zum Erstkontakt: - Kontrast zur traumatischen Situation (z.B. nach Möglichkeit freistellen, ob eine männliche oder weibliche Person die Bearbeitung bzw. Beratung übernimmt u.a.) - die Betroffenen sollten zunächst Gelegenheit haben, ihr Anliegen ausführlich vorzutragen - Aufbau eines Vertrauensverhältnisses: dazu gehört - Anerkennung der Opferwerdung: die Opfer ernst nehmen und ihnen glauben sollte im Vordergrund stehen - Behandlung der Traumafolgen als normale Reaktion (ev. Opfer aufklären über Folgen von Traumata) - Durchschaubarkeit der Verfahrensabläufe (eine verständliche, unbürokratische Sprache benutzen) - Einwirkungsmöglichkeiten und Kontrolle ermöglichen - Vermeidung zusätzlicher Belastungen Zusammenfassung Psychische Folgen von Krankheit und Unfall sind vielfältig und unspezifisch. Auch körperliche Erkrankungen können Traumafolgestörungen sein. Eine Differenzierung entsprechend der Ätiologie der Störung wird möglich, wenn sowohl psychische als auch körperliche Symptome als möglicher Ausdruck traumatischer Erfahrungen verstanden werden. In diesem Sinne plädiere ich für ein ätiologie-orientiertes Vorgehen und eine Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen. Fachgerechte Schulung Eine fachgerechte Schulung der verschiedenen Berufsgruppen - im Erkennen von psychischer Traumatisierung - im Umgang mit Akuttraumata - in der Indikationsstellung (d.h. im Wissen, wann die Betroffenen an Fachpersonen verwiesen werden sollten) trägt wesentlich dazu bei, dass Traumafolgeschäden ursächlich behandelt oder vermieden werden können.