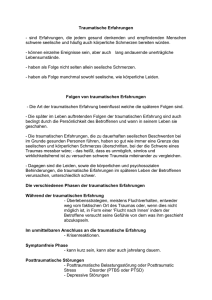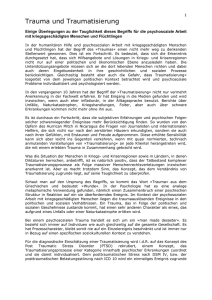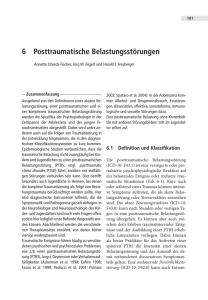Zur Beurteilung posttraumatischer Erkrankungen bei
Werbung
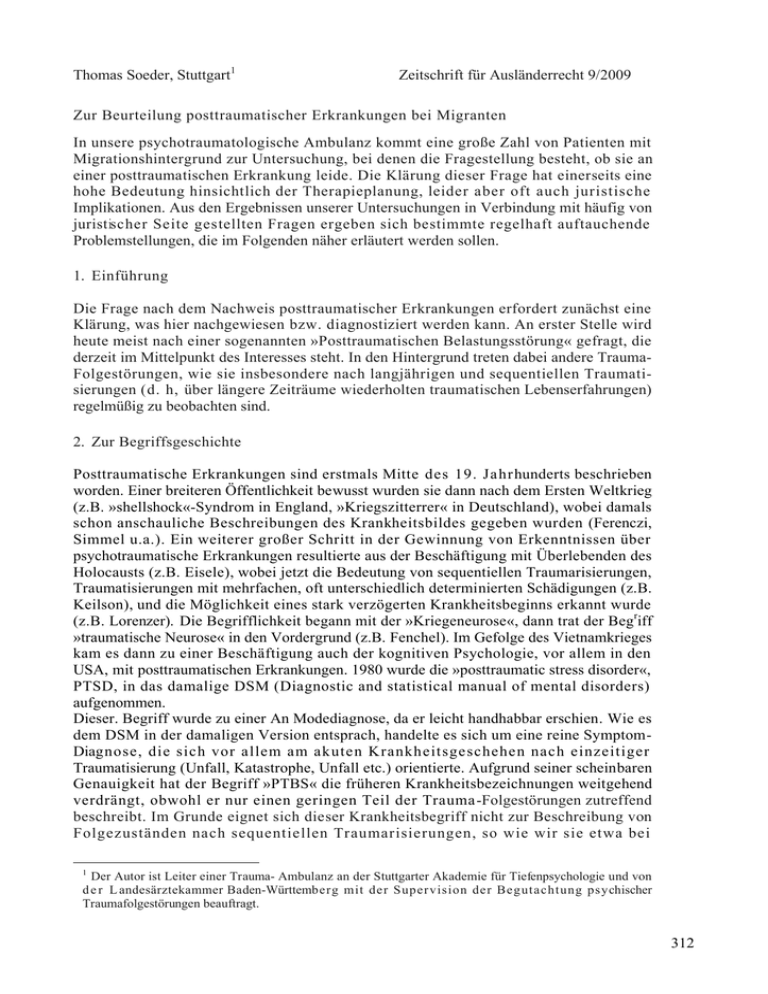
Thomas Soeder, Stuttgart1 Zeitschrift für Ausländerrecht 9/2009 Zur Beurteilung posttraumatischer Erkrankungen bei Migranten In unsere psychotraumatologische Ambulanz kommt eine große Zahl von Patienten mit Migrationshintergrund zur Untersuchung, bei denen die Fragestellung besteht, ob sie an einer posttraumatischen Erkrankung leide. Die Klärung dieser Frage hat einerseits eine hohe Bedeutung hinsichtlich der Therapieplanung, leider aber oft auch juristische Implikationen. Aus den Ergebnissen unserer Untersuchungen in Verbindung mit häufig von juristischer Seite gestellten Fragen ergeben sich bestimmte regelhaft auftauchende Problemstellungen, die im Folgenden näher erläutert werden sollen. 1. Einführung Die Frage nach dem Nachweis posttraumatischer Erkrankungen erfordert zunächst eine Klärung, was hier nachgewiesen bzw. diagnostiziert werden kann. An erster Stelle wird heute meist nach einer sogenannten »Posttraumatischen Belastungsstörung« gefragt, die derzeit im Mittelpunkt des Interesses steht. In den Hintergrund treten dabei andere TraumaFolgestörungen, wie sie insbesondere nach langjährigen und sequentiellen Traumatisierungen (d. h, über längere Zeiträume wiederholten traumatischen Lebenserfahrungen) regelmüßig zu beobachten sind. 2. Zur Begriffsgeschichte Posttraumatische Erkrankungen sind erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben worden. Einer breiteren Öffentlichkeit bewusst wurden sie dann nach dem Ersten Weltkrieg (z.B. »shellshock«-Syndrom in England, »Kriegszitterrer« in Deutschland), wobei damals schon anschauliche Beschreibungen des Krankheitsbildes gegeben wurden (Ferenczi, Simmel u.a.). Ein weiterer großer Schritt in der Gewinnung von Erkenntnissen über psychotraumatische Erkrankungen resultierte aus der Beschäftigung mit Überlebenden des Holocausts (z.B. Eisele), wobei jetzt die Bedeutung von sequentiellen Traumarisierungen, Traumatisierungen mit mehrfachen, oft unterschiedlich determinierten Schädigungen (z.B. Keilson), und die Möglichkeit eines stark verzögerten Krankheitsbeginns erkannt wurde (z.B. Lorenzer). Die Begrifflichkeit begann mit der »Kriegeneurose«, dann trat der Begriff »traumatische Neurose« in den Vordergrund (z.B. Fenchel). Im Gefolge des Vietnamkrieges kam es dann zu einer Beschäftigung auch der kognitiven Psychologie, vor allem in den USA, mit posttraumatischen Erkrankungen. 1980 wurde die »posttraumatic stress disorder«, PTSD, in das damalige DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) aufgenommen. Dieser. Begriff wurde zu einer An Modediagnose, da er leicht handhabbar erschien. Wie es dem DSM in der damaligen Version entsprach, handelte es sich um eine reine SymptomDiagnose, die sich vor allem am akuten Krankheitsgeschehen nach einzeitiger Traumatisierung (Unfall, Katastrophe, Unfall etc.) orientierte. Aufgrund seiner scheinbaren Genauigkeit hat der Begriff »PTBS« die früheren Krankheitsbezeichnungen weitgehend verdrängt, obwohl er nur einen geringen Teil der Trauma-Folgestörungen zutreffend beschreibt. Im Grunde eignet sich dieser Krankheitsbegriff nicht zur Beschreibung von Folgezuständen nach sequentiellen Traumarisierungen, so wie wir sie etwa bei 1 Der Autor ist Leiter einer Trauma- Ambulanz an der Stuttgarter Akademie für Tiefenpsychologie und von d e r L andesärztekammer Baden-Württemberg mit der Supervision der Begutachtung psychischer Traumafolgestörungen beauftragt. 312 misshandelten oder missbrauchten Kindern und Jugendlichen und auch der großen Überzahl der erkrankten Flüchtlinge zu sehen bekommen. Es wurde versucht, für diese Erkrankungsgruppe den Begriff »DESNOS« (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Classified) einzuführen, dies hat sich jedoch bisher nicht durchgesetzt. Einen anderen Ansatz bietet die Kategorie der »Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung«, die ebenfalls eine erheblich größere Variabilität gegenüber der Definition der PTBS aufweist und Parallelen bietet zur Diagnose der Persönlichkeitsstörungen. Es ergibt sich jedenfalls zwingend, dass die Frage nach einer posttraumatischen Erkrankung nicht mit der Entscheidung »PTBS ja oder nein« zu beantworten sein kann. Das typische Bild einer PTBS findet sich vor allem nach einzeitigen schwerwiegenden traumatischen Erfahrungen, mit einer der Schwere des Traumas korrelierenden Häufigkeit und Ausprägung. In einer Untersuchung der Universitär Konstanz (Neuner 2005) wurde eine Prävalenz der PTBS bei Asylsuchenden von 40% festgestellt. 3. Zur Diagnostik posttraumatischer Erkrankungen Zur Erkennung einer posttraumatischen Erkrankung, insbesondere bei chronifizierten Erkrankungen (z.B. jahrelange familiäre Misshandlung) bedarf es vor allem entsprechender Erfahrungen, ansonsten bleibt es bei Verlegenheitsdiagnosen wie »Depression«. Es ist bei vielen damit befassten Ärzten, auch Psychiatern und Psychologen noch nicht ausreichend bekannt, dass das Vermeidungsverhalten bezüglich aller trauma-assoziierten Erinnerungen einen Grundzug der »normalen« Trauma-Verarbeitung darstellt. Hiermit sind wir bei einem ersten grundlegenden Problem: Ärzte (und Juristen) erwarten üblicherweise, dass man ihnen offen über die bestehenden Schwierigkeiten berichtet (andernfalls ist es ein Hinweis auf »Schuld«) Es gehört daher zu der ersten Aufgabe des Diagnostikers, wahrzunehmen, wenn eine Scham- (und nicht Schuld-!) Problematik die Untersuchungssituation beherrscht. Dies ist in der Regel der erste klare Hinweis auf die Vorgeschichte Es wird über etwas nicht geredet, Fragen werden nicht sinngemäß beantwortet, gegen jedes »vernünftige« eigene. Interesse wird der schmerzhaften und schambesetzten Thematik ausgewichen. Das zweite grundlegende Problem ist, dass Menschen allgemein erwarten, und das gilt natürlich auch für Ärzte und Richter, dass man sich korrekt erinnern kann, wenn man nur will. Es sei dahingestellt, inwieweit das für die sogenannte Normalbevölkerung stimmen mag, für schwer und sequentiell traumatisierte Menschen stimmt es mit Sicherheit nicht («dissoziative Amnesie«, »mnestisches Blockade-Syndrom« (z. B. Markowitsch etc). Unseren Untersuchungen zu Folge leiden 2/3 aller schwer Traumatisierten an erheblichen Erinnerungsstörungen, die nicht nur das unmittelbar traumatische Geschehen, sondern zumeist auch viele andere bedeutungsvolle Lebensereignisse betreffen. Es gehört zu den selbstverständlichen psychotherapeutischen Erfahrungen, dass solche Ereignisse dann in einer vertrauensvollen, tragfähigen therapeutischen Beziehung teilweise wiedererinnert werden können. Insofern gehört das Phänomen der »Steigerung« des Erinnerungsvermögens zu den Hinweisen auf ein konflikthaftes, nur in einem geschützten Rahmen erinnerbares Lebensereignis. Auf der Symptomebene treten im Lauf der Jahre bei chronifizierten Traumafolgestörungen zwei Akutsymptome der PTBS zumeist in den Hintergrund, nämlich die sogenannten »intrusiven Erinnerungen« und die generalisierte Übererregbarkeit. Als Rest bleiben zumeist Schlafstörungen und Alpträume. In den Vordergrund treten die Anzeichen einer strukturellen Störung, unter anderem die Störung der Affekt-Integration, der Selbst- u nd Fremdwahrnehmung, der Erinnerungsfähigkei t i m K u r z - und Langzeitbereich, d e r Konzentrationsfälligkeit und auch die Störung früher vorhandener kognitiver Kompetenzen (z.B. Rechenfähigkeit), sodass nicht selten das Bild einer Demenz entsteht. Hinzu kommt, je nach individueller Krankheitsbewältigung, ei n e überwiegend depressive oder mehr angstbetonte Symptomatik, s o w i e h ä u f i g paranoide Verfolgungsvorstellungen und 313 akkustische (Pseudo-) Halluzinationen. All dies kann von einem erfahrenen Untersucher leicht erkannt und beschrieben werden, wobei allerdings eine mehrzeitige Untersuchung notwendig bzw. wünschenswert ist. Ein zweiter Weg führt über standardisierte Untersuchungsinstrumente, z.B. CAPS (Clinical Administered PTSD Scale), PDS D1 (diagnostische Scala für die posttraumatische Belastungsstörung), IES-R (Impact of Event Scale) u.a.. Hinzu kommen noch andere Instrumente, etwa um Hinweise auf Simulation zu erfassen. (s. Morgan 2007). Der Nachteil dieser Instrumente ist, dass sie zumeist nicht in validierten Übersetzungen vorliegen, für Analphabeten ohnehin ungeeignet sind, und nur sehr schematisierte Störungsmuster erfassen, so z.B. bei der PTBS die Bereiche Intrusion, Vermeidung, Übererregbarkeit und emotionale Abstumpfung. Ein sorgfältig und ausreichend lange geführtes klinisches Interview, verbunden mit einer psychopathologischen Befunderhebung, wird in aller Regel aussagekräftiger und zuverlässiger sein als eine auf Symptom-Abfrage und Selbsteinschätzung gestützte Untersuchung. Dabei sollte die Exploration die gesamte Biographie des Betroffenen mit einschließen, und nicht nur etwaige als auslösend vermutete traumatisierende Situationen. Nur bei einer umfassenden Würdigung eines Menschen kann das Verhältnis zwischen Persönlichkeit, traumatischem Ereignis und den die traumatische Erfahrung verarbeitenden Mechanismen zu erfassen sein. Die differenzialdiagnostischen Überlegungen sind bei ausgeprägten Krankheitsbildern verhä1tnismäßig übersehbar. Zu erwägen sind in der Regel, vor allem bei ausgeprägter depressiver Symptomatik, primär affektive Erkrankungen sowie (insbesondere bei Verfolgungsvorstellungen, Wahrnehmungsstörungen und auffälligen Denkstörungen) psychotische Störungen. Bei überwiegender Angstsymptomatik sind Panikstörungen und generalisierte Angststörungen zu erwägen sowie, vor allem bei ausgeprägter dementieller Symptomatik, hirnorganische Störungen. Eine Untersuchung mit der funktionellen Magnetresonanztomographie wäre aus wissenschaftlichen Gründen oft wünschenswert, da hier charakteristische Aktivitätsverteilungen n a c h g e w i e s e n w e r d e n k ö n n t e n . A l s Routinevcrfahren scheidet dies aber zum einen aus Kostengründen aus, zum anderen ist diese Untersuchung für traumatisierte Patienten ausgesprochen belastend (schon für gesunde Menschen ist sie oft ziemlich beängstigend). Die häufigste Differentialdiagnose bei chronifizierten Traumafolgestörungen sind Persönlichkeitsstörungen, die ihrerseits ja in der Mehrzahl der Fälle in traumatischen Einflüssen auf die frühe Entwicklung wurzeln. Wie leicht vorstellbar, gibt es hier unter Umständen fließende Übergänge. Im Unterschied zur für den Erfahrenen relativ unproblematischen klinischen Diagnostik birgt der von manchen Autoren geforderte »objektive« Traumanachweis schier unüberwindbare Schwierigkeiten. So hat ein Artikel von Ehlert und Kindl (2004) dazu geführt, dass sich bei vielen Menschen, auch bei Psychiatern, die Vorstellung gebildet hat, posttraumatische psychische Erkrankungen dürften nur dann diagnostiziert werden, wenn das traumatische Ereignis nachweisbar sei. Dies ist zum einen deshalb irrig, weil eine ausgeprägte psychische posttraumatische Erkrankung sich in der Regel deutlich von anderen schweren psychischen Erkrankungen unterscheidet (eine absolute Sicherheit gibt es selbstverständlich bei keiner Diagnose). Zum anderen ist es meines Erachtens aus ethischen Granden nicht vertretbar, Gewaltopfern die Anerkennung ihrer Lebensgeschichte zu v erweigern, wenn si e keine objektivcn Beweise bringen können. Dies bedeutet regelmäßig eine schwere, zumeist kaum wider gutzumachende Krankung Selbstverständlich betrifft das nicht nur Flüchtlinge. Insbesondere betrifft es die Opfer aus der Nachbarschaft, die Opfer von Kindesmisshandlung oder sexuellem Messbrauch, von Erpressung in der Schule oder von Arbeits-Sklaverei in einer versteckten Firma. All diese Menschen wird, wenn sie es denn schaffen, jemanden zu finden, der ihnen zuhört, zunächst Unglaubhaftigkeit unterstellt: so, wie es ein 314 Vermeidungsverhalten des Individuums bezüglich traumatischer Erinnerungen gibt, gibt es auch ein Vermeidungsverhalten der sozialen Gruppen, sich mit dem, was eigentlich nicht sein darf, auseinanderzusetzen. Selbstverständlich gibt es gelegentlich auch das Problem der „false memory“, bei der, sei es durch Fremdsuggestion, sei es aufgrund eigener Phantasietätigkeit Ereignisse erinnert werden, die so nicht statt gefunden haben. Naturgemäß gibt es über die Häufigkeit solcher Erscheinungen keine zuverlässigen Zahlen. Wenn man jedoch die von Volbert (2004) nach Derivera (1997) zitierte Zahl von 5% falscher Anschuldigungen bezüglich kindlichen Missbrauchs als Orientierungsgröße nimmt, käme man schon rein statistisch auf ein Verhältnis von 20 richtigen auf eine falsche Trauma-Erinnerung, was ja bereits eine recht hohe Wahrscheinlichkeit darstellt. ( S i c h e r l i c h m u s s b e züglich möglicher Täter selbstverständlich die Unschuldsvermutung einen hohen Stellenwert haben, auch wenn es sich um den so häufigen familiären Missbrauch handelt. Bei traumatisierten Flüchtlingen kommt es jedoch fast nie vor, dass die Schutzinteressen putativer Täter mit dem Wirklichkeitsanspruch der Opfer kollidieren.) Hinzu kommt, dass eine angemessene Behandlung natürlich nur bei einer zutreffenden Diagnose möglich ist; insofern müssen sich alle Anstrengungen darauf richten, eine korrekte Diagnose auch dann zu stellen, wenn keine objektiven Nachweise einer traumatischen Situation zu erhalten sind. Hierfür gibt es auch zumindest auf einzelnen Gebieten recht klare Kriterien (z. B. Soeder 2009). 4. Zur Frage der Retraumatisierung Obwohl der Begriff »Retraumatisierung« inzwischen in vielfältigen Zusammenhängen auftaucht, fehlt nach wie vor eine klare definitorische Abgrenzung. Von manchen Autoren wird er im reinen Wortsinn verwendet (re = wieder), was impliziert, dass es sich um das Einwirken eines Reizes handelt, der dem ursprünglich traumatisierenden Reiz in hohem Maße entspricht (ein geprügeltes Kind wird erneut geprügelt; ein einmal Verhörter wird erneut verhört, einer missbrauchten Frau wird dies erneut angedroht etc). Dabei geht es nicht darum, dass exakt das Gleiche wieder passiert, aber darum, dass der Kontext die gleiche Gefahr impliziert (wenn in einem Verhör gefoltert wurde, muss an nächsten Verhör nicht konkret gefoltert werden, um eine Retraumatisierung zu erreichen). Eine weitere Auslegung des Retraumatisierungsbegriffes schließt alles ein, was als »Trigger« für die traumatische Erinnerung dient (so kann z.B. ein bestimmter Geruch, der Anblick einer Uniform, ein Knall zum quälenden Wiedererleben einer bestimmten traumatischen Erinnerung führen). Eine weitere Begriffsausweitung bestellt dann, jede, wie auch immer geartete, spätere Traumatisierung als Retraumatisierung zu bezeichnen. Damit wird dann z.B. ein ungeeignetes therapeutisches Vorgehen bei einem traumatisierten M e n s c h e n z u e i n e r R e t r a u ma t i s i e r u n g , e b e n s o k ö n n t e m a n d a n n b ei einer Zwangseinweisung in eine geschlossene psychiatrische Station von einer Retraumatisierung sprechen. Ich denke, dass die Tendenz in der fachlichen Diskussion dahin geht, den Begriff »Retraumatisierung« eher eng auszulegen (vgl. Wenk-Ansohn 2008). Dies darf aber nicht dazu fuhren, den kumulativen Effekt an sich unzusammenhängender traumatischer Ereignisse zu übersehen (ein Beispiel für eine solche sequentielle Traumatisierung, wäre eine Frau, die in ihrem Heimatland gegen ihren Willen als 15-jährige verheiratet wurde (der Begriff der Zwangsheirat entspräche in unserem Verständnis im Grunde j a e i n e r Vergewaltigung), die dann von der Schwiegerfamilie missachtet u n d zu unerwünschten Arbeiten gezwungen wurde, anschließend aufgrund der politischen Aktivitäten ihres Ehemannes von der Polizei geschlagen und sexuell. bedroht wurde, und schließlich, nach ihrer Flucht, in einem von ihr als sicher betrachteten anderen Staat damit konfrontiert wurde, dass ihre Leidensgeschichte als Lüge aufgenommen wurde). 315 5. Erinnerungsstörungen und Glaubhaftigkeit Oft wurde beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und auch in vielen Gerichtsurteilen davon ausgegangen, es spreche für die Glaubhaftigkeit einer Aussage, wenn sie vollständig, detailreich, chronologisch geordnet, und widerspruchsfrei wäre, und sich im weiteren Verlauf keine sogenannten »Steigerungen« ergäben. Diese Vorstellung widerspricht den Ergebnissen der modernen Gedächtnisforschung. Ihre Vorannahmen beruhen vermutlich a u f der Vorstellung eines »photographischen Gedächtnisses«, die aber bereits seit langem widerlegt ist. Erinnern und Rekonstruieren ist e i n Prozess, h e i d e m eben nicht gespeicherte, abgelegte »Gedächtnisakten« wieder hervorgezogen werden, sondern bei dem, zumeist in Zusammenhang mit verknüpften Affekten und Handlungserinnerungen, die Umstände jeweils neu zusammengesetzt werden. Wenn man mit einem gut motivierten, »offenen und ehrlichen« Menschen in zeitlichem Abstand mehrmals über die gleichen Ereignisse spricht, wird man unterschiedliche Varianten zu hören bekommen. Innerhalb dieser Varianten stellt sich dann aber ein Kerngeschehen heraus, von dem man, nach Ablauf angemessener Zeit, sicher sein kann, dass es der subjektiven Erfahrung des Betroffenen entspricht. Damit muss es aber noch nicht einer objektiven, dokumentierbaren Ereignisfolge entsprechen, da das menschliche Erinnerungsvermögen immer nur bestimmte Teile der jeweiligen Realität aufnimmt. Wenn man vier Leute über den gleichen Streit oder Unfall befragt, erhält man, je nach Perspektive, vier verschiedene Schilderungen. Dabei ist weiter zu beachten, dass die optimale Erinnerungsfähigkeit in einem Zustand mittlerer affektiver Erregung möglich ist. Das Erinnerungsvermögen nimmt ab bei völligem Desinteresse, aber auch hei Übererregung, wie sie bei traumatischen Ereignissen in der Regel der Fall ist. Das, was jemand drei Jahre nach einem schwer traumatischen Ereignis zu erzählen in der Lage ist, ist immer eine Rekonstruktion, nie eine quasi dokumentarische Darstellung. Dies hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Betreffende eine falsche Darstellung geben möchte; er kann einfach nur, anhand der für ihn auffindbaren Erinnerungsspuren, ein Gesamtereignis rekonstruieren, Dieser Prozess ist grundsätzlich unbewusst. Mit geeigneten explorativen Techniken kann jedoch ein Teil dieses Rekonstruktionsprozesses bewusst gemacht werden, was dann zur Folge hat, das der Betroffene sich genauer darüber klar wird, was er nun wirklich weiß, und was er nicht mehr weiß, Dieser Prozess ist aber ebenfalls nur im Rahmen eines mittleren Erregungsniveaus möglich; in einem Zustand der Angst. der Wut oder Scham kann er nicht ablaufen; d.h., in Zuständen heftiger affektiver Erregung ist es dem jeweiligen Menschen nicht möglich, genau zu unterscheiden zwischen dem, was er tatsächlich erinnert und was nicht. Für das traumatische Ereignis selbst gelten die Regeln der Fragmentierung von Erinnerung, d.h., es sind Bruchstücke vorhanden, teilweise äußerst konkret, die dann in intrusiven Erinnerungen wie ein Film ablaufen können, Dabei handelt es sieh aber dennoch um Bruchstücke, die oft nicht in richtiger Reihenfolge zusammengesetzt werden können. Hier wäre erst die bereits erwähnte rekonstruktive Erinnerungsarbeit notwendig. Diese Erinnerungsarbeit kann aber erst geleistet wurden, wenn die hohe affektive Besetzung der traumatischen Erinnerungsbruchstücke sozusagen »abgekühlt« ist. (Die Gedächtnisforschung unterscheidet hier zwischen »heißen« und »kalten« Gedächtnisinhalten.) 6. Häufige Schwierigkeiten und Fragen Die häufigste Komplikation besteht in der Vorstellung, man dürfe eine posttraumatische Störung nur bei nachgewiesenem Trauma diagnostizieren. Dies ist unter therapeutischen 316 Gesichtspunkten m, E. nicht vertretbar. Ich stütze diese Auffassung unter anderem auf Krankheitsverläufe von sexuell missbrauchten Kindern, bei denen oft jahrelang an ihrem eigentlichen Problem vorbei therapiert wurde, weil ihnen niemand glauben konnte. Ich bestreite nicht, dass es auch unzutreffende Vorwürfe, z. B. aus anders motivierter Rache, gibt. Wie bereits oben erwähnt, ist das jedoch wohl eher selten, und zum anderen hält es n a c h m e i n e r Erfahrung einer längeren, quasi therapeutischen Exploration bzw. Probebehandlung nicht stand. Ein weiterer Zweifel äußert sich oft in der Argumentation, die Symptome von Traumafolgestörungen (genannt wird meistens wieder die PTBS) kämen auch bei anderen psychischen Erkrankungen vor. Dies ist zweifelsfrei richtig, basiert aber auf der reduktionistischen Grundannahme, komplexe psychische Erkrankungen ließen sich anhand einer Symptomenliste diagnostizieren o d e r a u s s c h l i e ß e n . F a s t a l l e p s y c h i s c h e n Symptombildungen kommen bei verschiedenen Erkrankungen vor. E i n d r i t t e r E i n w a n d l a u t e t , e s g e b e k e i n e f ü r P T B S c h a r a k t e r i s t i schen Erinnerungsstörungen. Auch das ist richtig, zumal die individuelle Reaktion auf traumatische Ereignisse stark variiert Typisch ist allerdings der über die Jahre progrediente Erinnerungsverlust bei chronischen posttraumatischen Erkrankungen, wobei hier natürlich euch wieder der jeweilige soziale und individuelle Ausgangspunkt eine Rolle spielt. 7. Zusammenfassung Die Untersuchung von in Folge psychischer Traumatisierung erkrankter Menschen ist ebenso vielschichtig und komplex wie die Beurteilung anderer schwerer psychischer Erkrankungen. Sie lässt sich nicht ausreichend in manualisierten Items erfassen, auch wenn diese bis zum gewissen Grade hilfreich sein können. Aus den neueren Forschungsergebnissen folgert, dass Traumatisierungen zum einen häufiger sind, als dies bisher wahrgenommen wurde- Zum zweiten haben sie gravierendere Auswirkungen auf die weitere Lebensführung der Betroffenen, als dies bislang anerkannt war. Zum dritten zeigt sich, dass ihre Interpretation unter Alltagsbedingungen ausgesprochen schwierig ist. Festzuhalten ist: 1. Aufgrund deutlicher Kriterien in einer zeitlich ausreichend langen Beobachtung ist die Diagnose einer posttraumatischen Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch b ei, fehlendem objektiven Trauma-Nachweis möglich. 2. Die traditionell angenommenen Voraussetzungen für die Erinnerungsfähigkeit und damit für die Glaubhaftigkeit einer Darstellung stehen im Widerspruch zu den neueren Erkenntnissen der neurowissenschaftlichen Gedächtnisforschung. Literatur: Dreißing, H. u n d Foerster, K . (2009): Psychiatrische Begutachtung hei asyl- u n d ausländerrechtlichen Verfahren- In: Diese., Hrsg. Psychiatrische Begutachtung, Urban und Fischer 2009. Eissler, K.R. (1963): Die Ermordung von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen können, um eine normale Konstitution zu haben? Psyche 17, S. 241291. Keilson, H. (1979): Sequentielle Traumatisierung bei Kindern, Psychosozial-Verlag 2005. 317 Lorenzer, A. (1966): Zum Begriff der traumatischen Neurose, Psyche 20, 5.481-492. Mor g a n S . : Welche Anforderungen sind an die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung zu stellen? Kurzvortrag für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2007. Neuner, F. et. al.: Prävalenz der posttraumatischen Belastungsstörung und Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. Z. f. Klin Psychologie u. Psychotherapie 2005. Soeder, T. (2009) : Sexuelle Gewalt gegen Männer. In: Über die (Un)möglichkeit zu trauern, Hrsg; F. Wellendorf und Th. Wesle, Klett-Cotta 2009. Volbert R. (2004)1 Beurteilung von Aussagen über Traumata. Hans Huber Verlag, 318