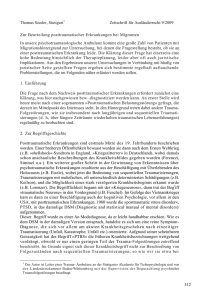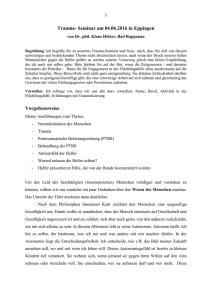Musterseiten 101-104
Werbung

101 6 Posttraumatische Belastungsstörungen Annette Streeck-Fischer, Jörg M. Fegert und Harald J. Freyberger Zusammenfassung Ausgehend von den Definitionen einer akuten Belastungsstörung, einer posttraumatischen und einer komplexen traumatischen Belastungsstörung werden die Spezifika der Psychopathologie in der Zeitspanne der Adoleszenz und des jungen Erwachsenenalters dargestellt. Dabei wird unter anderem auch auf die Folgen von Traumatisierung in der Entwicklung hingewiesen, die in den diagnostischen Klassifikationssystemen zu kurz kommen. Epidemiologische Studien verdeutlichen, dass die traumatische Belastung nicht zwangläufig bei Kindern und Jugendlichen zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS; engl. posttraumatic stress disorder, PTSD) führt, sondern mit vielfältigen Störungen verbunden sein kann. Dies betrifft besonders auch Jugendliche in Heimen, bei denen die komplexe Traumatisierung als Folge von Beziehungstraumata berücksichtigt werden sollte. Hier sind diagnostische Instrumente hilfreich, die die Symptomatik und Pathogenese gezielt abfragen. In der Neurobiologie und Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters sind noch viele Fragen offen, sodass hier lediglich erste Befunde dargestellt werden können. Abschließend werden die verschiedenen Therapieansätze erwähnt, von denen bisher wenige evidenzbasiert sind. Traumatische Ereignisse führen häufig zu verschiedenen psychischen und psychosozialen Problemen, wie z. B. einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), Angst, Depression oder Verhaltensauffälligkeiten (Ackerman et al. 1998; Cohen 1998; Essau et al. 1999; Paolucci et al. 2001; Putnam 2003; Spataro et al. 2004). In der Adoleszenz kommen Alkohol- und Drogenmissbrauch, Essstörungen, dissoziative, affektive, somatoforme, immunologische und sexuelle Störungen dazu. Eine posttraumatische Belastung ohne Komorbidität mit anderen Störungsbildern tritt im Jugendalter selten auf. 6.1 Definition und Klassifikation Die posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F43.1) ist eine verzögerte oder protrahierte psychophysiologische Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder mehrere traumatische Situationen (Tab. 6-1). Kurz nach oder während eines Traumas können intensive Symptome auftreten, die als akute Belastungsstörung oder Stressreaktion anzusehen sind. Die akute Belastungsreaktion (ICD-10: F43.0) kann nach Stunden oder wenigen Tagen in eine posttraumatische Belastungsstörung übergehen. Es können aber auch zwischen dem Erleben traumatisierender Ereignisse und der Ausbildung einer PTBS erhebliche Latenzzeiten vorliegen. Dabei können als bester Prädiktor für das Auftreten einer späteren PTBS die Intensität einer akuten Belastungsstörung und das Ausmaß des damit verbundenen dissoziativen Symptomanteils gelten. Eine andauernde Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F62.0) kann nach Extrem- 102 6 Tab. 6-1 Traumatisierungen, die in der Kindheit und Adoleszenz eine besondere Rolle spielen 1 Vernachlässigung sexueller Missbrauch familiäre Gewalt, Misshandlung Gewalt in Schule, Umfeld, subkulturellem Milieu komplexe Traumatisierung1 Trennung, schwerwiegende Verlusterlebnisse Traumatisierung durch medizinische Eingriffe, schwere Erkrankungen mit Schmerzerfahrungen Naturkatastrophen, Unfälle Kriegsfolgen, Migration, Flucht Damit ist die Typ-II-Traumatisierung nach Terr (1991) gemeint. Es handelt sich um komplexe und chronische Traumatisierungen in den frühen Beziehungsangeboten wie Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch. Die Symptomatik geht mit Störungen in der Entwicklung und den Beziehungen einher, die sich heutzutage allenfalls in verschiedenen Diagnosen fassen lassen. belastung eintreten. Es handelt sich um eine mögliche chronische Verlaufsform einer PTBS (vgl. disorder of extreme stress not otherwise specified, DESNOS). Bei Traumatisierungen in der Kindheit und Jugend kommt es in der Regel nicht nur zu traumaspezifischen Symptomen und Bewältigungen, sondern auch zu Veränderungen in der Persönlichkeitsentwicklung und zu kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen, sodass in der Regel von einer komplexeren Problematik ausgegangen werden muss. Bei chronischen Belastungen ist mit einer andauernden Persönlichkeitsveränderung zu rechnen (vgl. Gordon u. Wraith 1993: »aus states werden traits«). Es ist sinnvoll, zwischen der traumatischen Situation (dem Zusammenspiel von Innenund Außenperspektive, von traumatischen Umweltbedingungen und subjektiver Bedeutungszuschreibung), der traumatischen Reaktion und dem traumatischen Prozess zu unterscheiden (Fischer u. Riedesser 1998). Ein psy- Posttraumatische Belastungsstörungen chisches Trauma ist ein Ereignis, das die Fähigkeit der Person, für ein minimales Gefühl von Sicherheit und integrativer Vollständigkeit zu sorgen, abrupt überwältigt. Das Trauma geht mit existenzieller Angst und Hilflosigkeit einher. Aus der traumatischen Überwältigung können bei entsprechenden Risikofaktoren (z. B. Alter, Geschlecht, konstitutionelle Resilienzfaktoren, prämorbide Persönlichkeitsentwicklung) und einem ungünstigen sozialen Umfeld charakteristische Symptome entstehen, wie z. B. Wiedererleben traumatischer Ereignisse, Vermeidung, Übererregung und Betäubung. Traumatische Ereignisse werden durchlebt, aber nicht unbedingt als solche erkannt. Dies hat in der Adoleszenz eine besondere Bedeutung. Bei den im Jugendalter auftretenden traumatischen Belastungserfahrungen handelt es sich nicht selten um eine Wiederherstellung bzw. die Reinszenierung (reenactment) einer Traumatisierung, die in der Kindheit erfahren wurde, die per blindem Handeln wiederhergestellt wird und ggf. erst dann zum Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung führt. Es gibt keine lineare Verbindung zwischen traumatischer Belastung und PTBS bei Traumatisierungen in der Entwicklung. Häufiger liegen komplexere Störungen vor, die komorbid aus verschiedenen anderen Störungsbildern zusammengesetzt sind: »Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zeigen komorbide Symptome im Bereich der internalisierenden und externalisierenden Störungen.« (McCloskey u. Walker 2000) Wichtig ist aus jugendpsychiatrischer Sicht auch, dass traumatische Belastungen zu einer Exazerbation zuvor bestehender Entwicklungsprobleme oder Symptomatiken führen können. So können oppositionell-aggressives Verhalten oder andere Störungen des Sozialverhaltens auch direkter Ausdruck eines erhöhten Levels an Irritabilität sein (Resch et al. 2004). Wird im Jugendalter die Diagnose einer PTBS gestellt, so besteht ein erhebliches Risi- 6.3 ko, im weiteren Lebenslauf eine depressive Störung, eine Angststörung oder insbesondere auch eine Suchtproblematik zu entwickeln (Giaconia et al. 1995; Lipschitz et al. 1999). Auch ein Drittel jugendlicher und junger erwachsener Patienten mit Borderline-Störungen erfüllen Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung (Gunderson u. Sabo 1993). Dennoch sind Resch et al. (1999) der Auffassung, dass sexuelle oder körperliche Traumata alleine nicht als Ätiologiefaktoren für die Genese einer Borderline-Störung hinreichend seien. Infolge der Schwierigkeit, die Komplexität der posttraumatischen Folgeerscheinungen in Kindheit und Jugend zu erfassen, gibt es Bestrebungen, die Diagnose einer traumatischen Entwicklungsstörung einzuführen (developmental trauma disorder, DTD) (StreeckFischer u. van der Kolk 2002; van der Kolk et al. 2005). 6.2 103 Epidemiologie Kurzer geschichtlicher Überblick Sowohl die Psychiatrie als auch die Psychoanalyse haben die Bedeutung traumarelevanter Ereignisse über eine lange Zeit hinweg verleugnet bzw. nicht zur Kenntnis genommen. Eher nur punktuell wurde in den Nachkriegsjahren den Überlebenden des Holocaust zuerkannt, dass ihre multiplen Störungen als eine Folge der massiven Traumatisierungen durch Konzentrationslagerhaft, Verfolgung und Flucht anzusehen sind. Im Vergleich zu anderen Staaten wurden in den deutschsprachigen Ländern die Auswirkungen von Traumatisierung erheblich später wahrgenommen. So sind auch die Folgen von kindlicher Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung aus wissenschaftlicher Perspektive nur zögernd aufgegriffen worden. In den 1980er Jahren fanden Misshandlungen verstärkte Aufmerksamkeit, in den 1990er Jahren zunehmend auch sexuel- ler Missbrauch. Gewalt an Schulen, Mobbing, Videoaufnahmen von Folterszenen werden selbst heute noch eher selten unter dem Aspekt traumatischer Belastungen wahrgenommen. Auch verbreitet sich erst allmählich die Erkenntnis, dass überwältigende Schmerzerfahrungen, z. B. durch operative Eingriffe oder anhaltende Erkrankungen, zu PTBS führen können. In der psychoanalytischen Literatur wurde auf die Folgen von kumulativen Traumatisierungen bei Kindern hingewiesen (Khan 1963). Keilson (1979) untersuchte sequenzielle Traumatisierungen im Zusammenhang mit Flucht, Fremdunterbringung und Migration bei Kindern und Jugendlichen. Terr (1991) hat Zusammenhänge zwischen traumatischen Ereignissen erstmals systematischer an Kindern und Jugendlichen untersucht und zwischen Traumatisierungen vom Typ I (akutes Trauma) und Typ II (chronisches und komplexes Trauma) unterschieden. 6.3 Epidemiologie Bevölkerungsrepräsentative epidemiologische Studien in den USA haben zeigen können, dass deutlich mehr als 50 % aller Menschen in ihrem Leben zumindest einmal mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert werden (Kessler et al. 1995), in Großstädten wahrscheinlich sogar deutlich mehr (Breslau et al. 1991). Die Lebenszeitprävalenz in der Allgemeinbevölkerung liegt bei etwa 1–9 %, wobei Frauen offensichtlich doppelt so häufig wie Männer betroffen sind (Davidson u. Fairbank 1993; Kessler et al. 1995), d. h. ein doppelt so hohes Risiko tragen, im Anschluss an ein Trauma an einer PTBS zu erkranken. Zudem weisen Frauen mit PTBS offensichtlich längere Krankheitsverläufe auf. In Hochrisikogruppen für PTBS werden zum Teil erheblich höhere Prävalenzraten 104 gefunden. Bei Kriminalitätsopfern liegen sie zwischen 15 und 71 %, bei Vietnamkriegsveteranen zwischen 22 und 26 %, wobei weitere 22 % der Vietnamkriegsveteranen subsyndromale Störungsbilder entwickelten. Bei Folteropfern werden Lebenszeitprävalenzen von 33–50 % angegeben, wobei der Status als Flüchtling oder Asylbewerber offensichtlich prädiktiv wirkt (Basoglu et al. 1994; van Velsen et al. 1996). Vergewaltigungsopfer zeigen im Langzeitverlauf etwa 30 % chronifizierter die Symptomatik einer PTBS (Resnick et al. 1993). Bei Unfallopfern fand sich in einer in Deutschland durchgeführten Längsschnittstudie nach sechs Monaten eine Prävalenzrate von 8,2 % und für subsyndromale PTBS von 10,2 % (Frommberger et al. 2004). Generell wird heute die Traumaschwere als Risikofaktor für die Entwicklung einer PTBS angesehen, wobei mit der Traumaschwere etwa bei Unfall- und Vergewaltigungsopfern die Häufigkeit einer PTBS anzusteigen scheint (March u. Amaya-Jackson 1993). Wie die größeren epidemiologischen Studien zeigen, sind die Folgen von Realtraumatisierung nicht allein mit dem Auftreten posttraumatischer Belastungsstörungen assoziiert, sondern Realtraumatisierungen gehören auch zu den kardinalen Risikofaktoren für andere schwere psychische Störungen. Alle großen epidemiologischen Studien (zusammenfassend s. Breslau et al. 1997) haben zeigen können, dass Personen mit einer PTBS zumindest an einer weiteren psychischen Störung in ihrem Leben erkrankt sind. Dabei wurden die hohen Komorbiditätsraten mit anderen Angststörungen zum Teil mit der Überlappung diagnostischer Kriterien erklärt, die mit Suchterkrankungen über die Selbstmedikationshypothese. Nach Traumatisierungen erhöht sich das Risiko für das Auftreten z. B. folgender behandlungsbedürftiger psychischer Störungen: 6 Posttraumatische Belastungsstörungen Bei Angststörungen (insbesondere Panikstörungen und Agoraphobien) wurden in verschiedenen Stichproben Häufigkeitsraten zwischen 16 und 50 % vorangegangener Traumatisierungen gefunden (zusammenfassend s. Joraschky u. Pöhlmann 2005). In mehreren Allgemeinbevölkerungsstudien wurden Traumatisierungen als ein Risikofaktor identifiziert, der das Auftreten späterer episodenhafter oder anhaltend depressiver Symptomatik um etwa den Faktor 2 erhöht (zusammenfassend s. Joraschky u. Pöhlmann 2005). Für Substanzmissbrauch und -abhängigkeit zeigen sowohl klinische als auch Allgemeinbevölkerungsstudien, dass vorangehende Traumatisierung das Risiko späteren kritischen Substanzkonsums um das 2,5- bis 3,5-fache erhöht (zusammenfassend s. Krausz et. al. 2005). In einer Untersuchung, die ausschließlich Frauen einschloss, konnten Breslau et al. (1997) zeigen, dass das Risiko, eine weitere psychische Störung zur PTBS auszubilden, um den Faktor 4,36 erhöht ist, wobei die Risiken für die generalisierte Angststörung (Odds-Ratio [OR] 6,46), die Agoraphobie (OR 6,40) und die Major Depression (OR 4,95) am höchsten liegen. In einem Prädiktionsmodell sagte eine vorbestehende PTBS das nachfolgende erstmalige Auftreten einer Major Depression und Alkoholmissbrauch voraus, während die Traumaexposition allein keine Risikovorhersage erlaubte. Umgekehrt sind danach eine vorbestehende Major Depression, eine Angststörung sowie Missbrauch von Alkohol und illegalen Drogen mit einem erhöhten Risiko einer Traumaexposition verbunden, während lediglich eine vorbestehende Major Depression das Risiko für eine spätere PTBS erhöht. Auch die neuseeländische Langzeitkohorte von Fergusson et al. (1996a, b) zeigt klar, dass