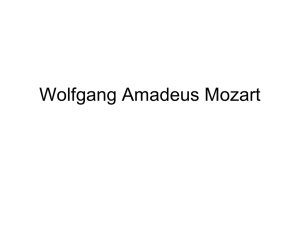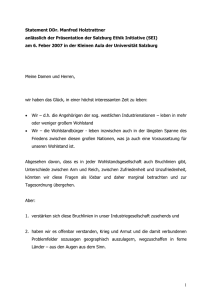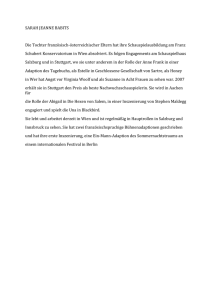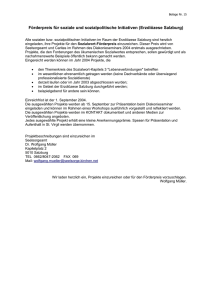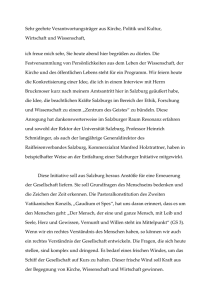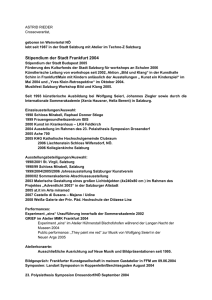1 Salzburg: War lange Zeit nichts als eine fixe Idee. Immer wieder
Werbung

Salzburg: War lange Zeit nichts als eine fixe Idee. Immer wieder erhielt ich Einladungen nach Salzburg, vom Literaturhaus, einer Bibliothek, doch nie hat es zeitlich geklappt. Die Autorenkollegin Kathrin Röggla stammt aus Salzburg, erzählte von ihrer Heimatstadt, Bilder verdichteten sich im Kopf. Langsam wurde Salzburg zu einer fixen Idee, einem mystischen Ort. Wie könnte es dort sein? Salzburg - Schon der Name der Stadt ist irritierend, hat etwas von einem Paradoxon: Mit Salz verbinde ich etwas Feines, etwas, das sich auflöst, und - irgendwie – etwas Trauriges. Salz ist für mich fast so etwas wie die sich materialisiert habende seelische Befindlichkeit eines Melancholikers. Und dann „Burg“: Das ist so gar nicht ein Seelenort, das hat wenig Intimes - ist und bleibt ein militärisch konnotierter Ort. Außerdem habe ich als Kind so viele Burgen besichtigen müssen, das meine Ohren bei „Burg“ auf taub gestellt sind. Ich reagiere auf „Burg“ wie der Salzburger auf die Silbe „Mo“. Nicht aber auf „Hohensalzburg“, das darf meine Ohren passieren. Das ist ein großartiges Wort, ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, es in den Mund zu nehmen, diese hohe Burg – immer wieder rekurrierte ich darauf. Es gibt eine Lust daran, bestimmte Worte auszusprechen und ihnen gleichzeitig nachzuschmecken, die nur von bestimmten Törtchen übertroffen werden kann. Und so kommt zum Salz das Süße: Törtchen & Kugeln: Für Bildende Künstler, die zur Internationalen Sommerakademie kommen, aber auch für andere, muss Salzburg ein sehr inspirierender Ort sein: Neben den eigenartigen Festspielbesuchern, die man im Sommer überall in der Stadt beobachten kann und die eine Spezies für sich zu sein scheinen, kann man unendlich viele verschiedene Törtchen – und Pralinenkreationen in Augenschein nehmen. Auch für Architekten müssen sie eine großartige Inspiration darstellen. Was gibt es da nicht alles in Salzburg zu sehen: Sie sind mehrstöckig, haben verschieden gestaltete Fassaden, Brüstungen und Terrassen, ja, einige Törtchen sind terrassiert, andere sind mit 1 schwindelerregenden Dachgeschossen und Obstgärten auf dem höchsten Stockwerk ausgestattet, mit Swimmingpools aus Himbeer- oder Schokoladensauce, manche tragen kronenartige Gebilde auf den Dächern, andere sehen wie dreidimensionale kalligraphische Zeichen aus, wiederum andere wie Hüte aus dem 19. Jahrhundert und nochmals andere schlicht und modern wie Objekte von Donald Judd. Auf dem großen Platz vor dem Dom ist dann doch tatsächlich in Salzburg eine zur Skulptur gewordene Praline zu sehen: Stefan Balkenhols großartige Mozartkugel, auf dem ein kleines Männeken obenauf sitzt. Der Mensch sitzt zwar auf der Kugel, dennoch sind die Größenverhältnisse so, dass er eher wie eine Fliege auf einer Kuh wirkt, die Mozartkugel als Erdkugel, als existentielles Alles-oder-Nichts. Dieses Mozartkugelgold ist für mich gleichsam die Farbe Salzburgs. Es ist das Gold der christlichen Ikonenmalerei, der matte goldene Hintergrund, der hier hinter allem aufscheint. Auch in der Massenware. Mozart: Mein Interesse an Salzburg hat, was nicht sehr originell, aber wahr ist, unter anderem mit meinem Mozartinteresse zu tun. Und das wiederum hat mit der Geschichte meiner Entdeckung von „Don Giovanni“ zu tun: Als ich vor einigen Jahren die Auflösung der Wohnung meiner Großeltern gemeinsam mit dem Rest der Familie in Angriff nahm, stießen mein Bruder und ich auf einen Riesenbatzen alter Langspielplatten. „Don Giovanni“ fiel mir auf, weil die vier Platten in einem sehr schönen schwarzen Kasten steckten - und weil dieser Kasten tatsächlich noch eingeschweißt war. Und verdammt verstaubt. Ich fragte mich, wie lange diese nie gehörte Oper wohl bei meinen Großeltern gestanden hatte? Die Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau war aus dem Jahr 1967. Natürlich konnten meine Großeltern sie später gekauft haben - der Kasten stand allerdings weit hinten, wo die Reihen immer eingestaubter wurden. Ich wusste, meine Großeltern mochten Bach. Bach und Mozart - das ist ein bisschen - nun ja - wie die Beatles oder die Stones, selten mag man beides. Es passte jedenfalls zu meinen Großeltern, dass sie sich für eine Oper wie „Don Giovanni“, die den Rausch und das 2 Anarchische feiert, nicht wirklich erwärmen konnten. Vielleicht war sie mal ein Geschenk gewesen. Ich nahm den eingeschweißten Kasten und einige andere LPs mit nach Berlin. Monate vergingen, irgendwann erinnerte ich mich an den verstaubten Plattenstapel. Sehr genau weiß ich noch, wie mich Erregung befiel, als ich die knisternde Plastikfolie aufriss und diese „jungfräulichen“, noch nie gehörten Platten auflegte. Ich kannte - wer nicht? - ein paar Mozart-Opern, „Die Entführung aus dem Serail“, „Così fan tutte“ und natürlich „Die Zauberflöte“. Aber diese Musik war anders, drohend, dunkel, langsam in Gang kommend, in sich selbst verstrickt. Nicht gerade das, was man sich unter „Mozarts Leichtigkeit“ vorstellt. Ich war perplex und betört, saß vor den Boxen wie das Kaninchen vor der Schlange. „Don Giovanni“: eine dämonisch-düstere Oper, die der damals strengen Kategorisierung von „Tragödie“ oder „Komödie“ in ihrer unauflösbaren Ambivalenz zuwiderlief. Voller Ironie, voller Witz und Boshaftigkeit - aber auch nicht ohne den Eros und den Rausch wirklich zu feiern - wird in ihr der Untergang eines alternden Frauenhelden dargestellt. Schon die gut siebenminütige Ouvertüre, die Mozart beim Kegeln (!) wenige Tage vor der Uraufführung in Prag nebenbei herunter geschrieben hat, nimmt das „böse Ende“ vorweg. In den nächsten Wochen hörte ich die Oper in einem Fort und erwartete, dass ich sie mir eines Tages „überhören“ würde. Darauf warte ich heute - neun Jahre später immer noch. In Folge meiner Begeisterung für „Don Giovanni“ hörte ich auch viele Opern anderer Komponisten, auch aus dem Bereich der Neuen Musik, aber der Entdeckung von „Don Giovanni“ - dieser für mich aus einem unendlich langen Dornröschenschlaf wachgeküssten Musik - kam nichts gleich. Lange Zeit reichte es mir, mich wirklich „nur“ mit Mozarts Kosmos zu beschäftigen. Ich fühlte mich dort mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und in den verschiedensten Lebenslagen gut aufgehoben, völlig saturiert - keine Seelenlage, kein Schattengesicht, die oder das man in der unglaublichen Diversität von Mozarts Werk nicht finden kann. Auch aus Sicht der Schriftstellerin fasziniert mich diese Oper: Don Giovannis erotische „Schandtaten“ sind wirklich mitreißend „erzählt“ - dabei ist Mozart so schlau, Don Giovanni nicht nur sich selbst darstellen zu lassen, sondern ihn vor allem durch die Augen seiner Mitmenschen zu charakterisieren. Eine der 3 erotischsten Arien in „Don Giovanni“ wird gerade nicht von Don Giovanni selbst gesungen, sondern von seinem Diener Leporello, der in einer unnachahmlichen Mischung aus Bewunderung für seinen Herrn und Entrüstung über ihn seine „Schandtaten“ (oder Heldentaten, je nachdem) aufzählt. Die Präzision, mit der Don Giovannis Diener Leporello exakte Zahlenangaben über den „Frauenverschleiß“ von seinem Herrn macht (dies natürlich im Libretto von Lorenzo Da Ponte) steht in einem großartigen Gegensatz zum vokalistischen Bombast und der Erregung, mit der der empörte Diener sein „Register“ vorträgt. Hier spielen unterschwellige Momente von männlicher Konkurrenz und einem sängerischen Wettbewerb mit; es wird deutlich, dass Don Giovanni eingangs eine gleichermaßen Frauen und Männer verzaubernde und erotisierende, die gesellschaftlichen Regeln ungestüm durchbrechende, pansexuelle, äußerst autonome Gestalt ist. Jedes Heldentum wird bei Mozart ironisiert, der Lächerlichkeit preisgegeben, jeder Aufstieg lässt schon von Beginn an die Fallhöhe sichtbar werden, die Frauen - denen von den Librettisten meist „brave“ Rollen zugedichtet wurden, z.B. als hilflos Verführte von Don Giovanni - verleiht Mozart Imposanz, sie bekommen dramatische und dämonische Züge, sind würdevoll und mächtig - . Janis Joplin, Tina Turner, Nina Hagen, Annie Lennox - in meinen Augen nicht wilder als Mozarts’ beste Frauenrollen. In einem „Nebensatz“ kritisiert Mozart dabei die bürgerlichen Sitten und Tugenden, deren Vertreter - in Da Pontes Libretto eigentlich als starke Figuren vorgesehen - bei ihm eher blasse Langweiler abgeben. Auch sie sind - trotz gegenteiliger Beteuerungen und Handlungen - von der Person Don Giovannis fasziniert. So inszeniert Mozart sie zumindest. Das alles könnte den Eindruck erwecken, als sei meine Beschäftigung mit Mozarts Opernwerk vor allem eine solitäre, gar in erster Linie eine akademische. Aber dem ist nicht so. Zum Beispiel gehörte ich einem Freundeskreis an, der eine Weile lang eine sehr nette illegale Bar in Berlin betrieb, in der im kleinen Kreis immer phantastisch gefeiert wurde - bis das Haus saniert wurde - eine übliche „Berliner“ Geschichte. Einige aus diesem losen Kreis waren Sänger und sangen am Liebsten Mozart-Arien besonders gerne Arien aus „Don Giovanni“, was natürlich bei mir auf offene Ohren stieß. So kam es, dass wir oft - in einem ganz und gar „unklassischen Rahmen“ - wild bis in den Morgen zu Mozart tanzten und feierten. 4 Dementsprechend abgerockt sind die Platten, die bei meinen Großeltern einen so unendlich langen Winterschlaf gehalten hatten: 213 Jahre nach ihrer Entstehung (1787, Uraufführung von „Don Giovanni“ in Prag) hatte ich diese Musik für mich entdeckt - und vermutlich um die 30 Jahre hatte sie bei meinen Großeltern, ohne je angehört zu werden, überdauert. Meine Großeltern hatten die Oper vielleicht um meine Geburt herum gekauft oder geschenkt bekommen. Ich hingegen habe die vier Don Giovanni-LPs innerhalb von wenigen Jahren vollkommen verschlissen. Plötzlich bin ich da, in Salzburg. Ich dachte, im Mozartland. Aber hier verdrehen alle Einheimischen die Augen, wenn ein Wort nur mit der Silbe „Mo“ anfängt. Mozarts Wohnhaus In Mozarts Wohnhaus ist es so trubelig, dass sich irgendeine Art von Nachdenken nicht einstellen mag. Nur retrospektiver Sozialneid kommt mir zu Ohren: SO ein großes schönes Arbeitszimmer wie Wolfgang Amadeus hätte ich auch gern. Naja, immerhin hat das Zimmer hier ja auch zu etwas geführt. Wer weiß, was der dicke Familienvater neben mir im Jeansanzug mit Schirmmütze da zustande gebracht hätte. Einen Moment überlegte ich, in welcher Weise Räume die Kunstproduktion beeinflussen, was Mozart wohl manchmal gedacht hat, hier, in diesem schönen großen, hellen, sehr städtischen Musikzimmer. Ob er die Stimmen von draußen gehört hat. Kutschen, Glocken, all das. Oder ob er nichts davon gehört hat, wenn er im Arbeitsrausch war. Immer heißt es: die Evolution hätte den Menschen keineswegs optimal ausgestattet, zum Beispiel seine Ohren könne der Mensch nicht schließen, anders als die Augen. Aber das stimmt nicht, die Ohren horchen auf die Gedanken. Und dann hört man keine Stimmen mehr, sondern Musik. Für Deutsche hat Österreich die Reputation, ein merkwürdiges Land zu sein, ein Land mit seltsamen Bewohnern und Sitten. So verwunderte es mich nicht, mal in Wien auf eine Art Sekte gestoßen zu sein, die sich „Die Mauer“ nennt und sich, sie besteht seit Mozarts Tod, mit verschiedenen Theorien zu seinem Tod beschäftigt. 5 „Die Mauer“ ist eigentlich die Abkürzung für „Die Mauer des Schweigens“. Dass Mozart Opfer eines Mords wurde, ist für die Mitglieder glasklar. Aber wenn man, wie ich, aus Berlin kommt, denkt man nicht zuerst an „Die Mauer des Schweigens“, sondern an die Mauer. Manchmal habe ich, hier in Salzburg, das Gefühl, aus einem fernen Land zu stammen. Open Air Wenn man durch Salzburg läuft hört man – im Vergleich zu Berlin – sehr viel Musik. Auch in Berlin gibt es natürlich viel zu hören: Aus heruntergekurbelten Autoschreiben dröhnt Drum `n Bass oder Metal, aus der Wohnung des Nachbarn monoton der immer gleiche Elektro-Pop, vom Italiener neben an scheppernder ItaloPop, aus der Peepshow eine Straße weiter jeden Tag die gleiche Säusel-PlinkerBimbim-Kaufhaus-Mucke, aus der Würstchenbude um die Ecke – sehr laut – Heino. Und zwar das schlimme Lied „Das Polenmädchen“. So in etwa in Berlin. Wie anders die akustische Kulisse in Salzburg: Die Studenten im Mozarteum üben, Straßenmusiker (erstaunlich gute) treten auf, überall, hinter Türen und Treppen, Giebeln und Dächern, dringt Musik. Meist klassische – es hat etwas Rückwärtsgewandes, sicher, und doch scheint die Stadt von einem Vorhang aus Musik von der Außenwelt abgeschirmt – das hat etwas befremdlich liebliches, und ist doch auch betörend. Die Kunst-Burg: Zu Burgen habe ich ein spezielles Verhältnis. Manche würden sagen ein traumatisches, andere ein enges. Ich habe das übliche Schicksal von Kindern mit bildungsbürgerlichen Eltern erlitten – ich musste als Kind hunderte von Burgen, Kirchen, Domen, Kathedralen, Grüften, Friedhöfen und so weiter besuchen. Eltern überschätzen dabei oft das Interesse von Kindern an alten musealen Gebäuden oder Plätzen – Vergangenheit hat für diejenigen, die selber kaum eine besitzen, eben noch 6 keinen großen Wert „an sich“. Auch überschätzen Eltern gern die Lust von Kindern, ins Detail zu gehen. Als Kind waren Burgen für mich Burgen und Punkt. Ein paar Unterschiede machte ich schon: Es gab Ruinenburgen und „heile“ Burgen, es gab „doofe“, das waren welche mit besonders vielen Treppen, deren Besuch wir im Hochsommer absolvierten, und „ganz schöne“, das waren die, deren Besuchszeit überschaubar war und ihn denen ich weder fror noch schwitzte. Alle Burgen hatten etwas gemeinsam: es waren unbedingt Erwachsenenorte, Orte, an denen man gnadenlos belehrt wurde, manchmal auch in Sprachen, die man gerade erst in der Schule erlernen sollte – jedenfalls niemals Orte, die etwas wohnliches ausstrahlten, an denen man „spielen“ konnte. Das sollte ich jetzt doch noch mal nachholen können: Denn die Sommerakademie findet – was eine sehr, sehr gute Wahl ist - nicht in üblichen universitären, bemüht neutralen Langweilerräumen statt, sondern an so malerischen besonderen Orten wie der Hohensalzburg und der Alten Saline. Plötzlich werden solche erhabenen Orte auf menschliches Maß reduziert, werden wirklich begeh- und bewohn- bzw. „bespiel“-bar, werden Orte, an denen Experimente – Gegenwart – stattfinden kann. Vor langer Zeit hatte eine der Bands, in der mein Bruder spielt, in Berlin in einer Kirche gespielt – da schon dachte ich, dass man es mit der Traditionswahrung nicht übertreiben, sondern diese schönen Orte, wenn die Zahl der Kirchenbesucher dramatisch nachlässt, eben anderen Zwecken übergeben sollte. Gefeiert wird eben zu verschiedenen Zeiten und von unterschiedlichen Generationen auf jeweils andere Weise. So gefiel es mir sehr gut, dass man die Hohensalzburg nicht nur nutzt, um Schwertersammlungen, Kerker, Folterwerkzeug und Alte Stiche zu zeigen, sondern als einen Ort, der jetzt, in der Gegenwart, lebendig wird – eben nicht auf museale, sondern auf kreative Art. Die Alte Saline ist einer der schönsten Orte, die ich in den letzten Jahren besucht habe. So sehr die Burg im touristischen Zentrum liegt, so fern von all dem fühlt man sich in Hallein, 7 die kleine Stadt, in der das Alte Saline liegt. Hier kann man meinen, wieder ins 19. Jahrhundert abgestiegen zu sein. Als ich zum ersten Mal die Alte Saline betrete, ist es mittags, und ich bin überrascht, wie kühl es hier ist. Gleichzeitig bin ich vom intensiven Salzgeruch überwältigt. Wie die Hochensalzburg ist auch dies ein besonderer Ort, der einerseits einen sehr starken Eigencharakter besitzt, selbst Kunstwerk ist, gleichzeitig aber eine erstaunliche Ruhe in seinem Inneren offenbart, die dem Arbeitenden doch nicht den Blick auf das eigene verstellt, sondern vielmehr öffnet. Es gibt ja auch Orte, deren Präsenz einen erdrückt. Als ich die Alte Saline betrete, denke ich: Hier einmal arbeiten zu können! Ich gönne es den Malern, hier wochenlang arbeiten zu können und bin doch ein bisschen neidisch... hier einmal schreiben... und wenn es nur ein paar Stunden sind. Die Gedanken werden lang, strecken sich aus wie Abend-Schatten, reichen weit über das Alltägliche hinaus mit dem Blick auf die Berge von Salz, auf die Kostbarkeit des Salzes, seine Stummheit, seine merkwürdige Reinheit, es strahlt etwas Unberührtes, Unberührbares, fast klösterliches aus, dabei ist es als Handelsprodukt auch ganz weltlich, doch in der Alten Saline herrscht für mich die gleiche Erhabenheit wie in Tropfsteinhöhlen, dieses Gefühl, plötzlich mit der Ewigkeit auf einer zeitlichräumlichen Horizontale zu sein, ein Stück mehr als nur immer ich selbst zu sein, vielleicht kann man hier, an diesem Ort, stärker Diener der (eigenen) Kunst sein als an anderen Orten, die das Ego weniger transzendieren. Ein paar Salzgedichte: Salt I (Mermaids singing in the evening, leaving the coastline) "I’m parting but he is still with me in my tears within my tears he’s the salty taste in my memory of sweatwater-times he’s the reason to cry 8 and the sense of crying and the essence of it as well: crystallizing on my cheeks he is the salt - he IS my tears and when I cry underwater I lose him but not in a painful but in a relieving way for he ocean is all.“ Salt II (Love Poem) Here we collect here we keep here we rinse here we scatter here we mix our salt our sadness together Salt III (big blur / urban mermaid) She writes her diary puts photos in of him she cries distorts pictures blurs letters her life her face all smeared 9 crying she rewrites her life with nothing but salt Salt IV (Immigrants / European Saltwater-Border) "We swim on and on out into nowhere we swim from ocean to ocean calling our names loudly under the black sky hide our future behind our front teeth we swim under the black sky and die of thirst" Salt V (Little boy, narcisstical phase) „I'm outside-inside my skin costume in a kind of yellow submarine I play with water I urinate masturbate watch my blood circulation examine my liquids I am fascinated by my sweetwater paradise 10 SALT and DANGER are unknown to me.“ Last Salt (Salt VI) When the Beatles sung: She’s leaving home bye bye a father at an Edward-Hopper restaurant thought about his daughter who left home without a word (and him without being able to shed tears): I wish I could swallop her like whiskey For the moment no more Salt. Künstlerhaus Salzburg Das Künstlerhaus ist im Moment okkupiert von Dan Perjovschis wunderbaren, sarkastischen, melancholischen, philosophischen, provokanten comic-artigen Zeichnungen – Statements zur Lage der Welt, zum Verhältnis von Kapitalismus und Kommunismus, von Individuum und Kollektiv in einer Gesellschaft, von Urbanität und Provinzialität, von gescheiterten und manchmal auch in Erfüllung gegangenen Träumen, von Kunst und Geld/Markt, vom Verhältnis der USA zu Europa und umgekehrt – ich staune, wie Perjovschi immer wieder verschiedenste Orte, banale und sakrale, in das Netz seiner eigenen Bildsprache verwebt, verstrickt, sich aneignet. Toll. Hohensalzburgtrubel (Schreibworkshop) An einem Samstag gebe ich einen Schreibworkshop. Es ist einer wenigen sonnigen Tage, den ich in Salzburg erleben soll. Dementsprechend groß ist der Andrang auf 11 der Burg. Touristen. Ich flüchte schnell vor meinesgleichen durch das schwere Tor ins Treppenhaus, in die Burg, eile die Stufen hoch. Die Kursteilnehmer finden sich langsam ein. So viele Menschen, wie sich draußen drängeln, schieben und schubsen, so wenige sind es hier im dunklen, kühlen Innenraum – der wie ein Antiraum zum Außenraum zu wirken scheint, alle Gesetzmäßigkeiten, die draußen gelten, scheinen hier innen verkehrt. Es herrscht eine gerade zu andächtige Stille, ich befinde mich an einem Ort der Ruhe. So wie der Einzelner draußen Teil der Masse wird, wird er hier, als Einzelner, hervorgehoben, steht für sich. Jeder stellt sich vor, die Kursteilnehmer sind im Alter von Anfang Zwanzig bis Anfang Siebzig, jeder ganz anders. Wir beginnen. Ich stelle Schreibaufgaben wie zum Beispiel die Übung: Beschreiben Sie die Wohnung einer alten Dame, der man ansieht – der Wohnung, nicht der Dame, das ist das Entscheidende - , dass die Dame sich noch einmal auf ihre alten Tage verliebt hat. Es geht mir darum, zu üben, wie Beschreibungen nicht um ihrer selbst willen in einem Text untergebracht werden, sondern ihrerseits die Handlung vorantreiben. Und wie man die Psychologie einer Figur nicht plump „ausspricht“, sondern indirekt dem Leser nahe bringt. Und schon wird losgekritzelt. Bis auf ein Student, der seinen Lap Top mitgebracht hat, schreiben alle per Hand. Plötzlich ist nichts mehr zu hören, außer diesem beharrlichen Knirschen, wenn sich Stifte in Papier festbeißen, wenn Stifte Papier bezwingen, wenn Gedanken Wirklichkeit werden, wenn Papier anfängt zu leben. Die Burgmauern sind so dick, dass man hier das Tohuwabohu draußen nur durch die kleinen Fenster sieht, aber kaum hört – ein Stummfilm scheint vor mir abzulaufen. Ich bewege mich kaum, will mit keinem Knirschen meines Stuhls meine Studenten aus ihren Gedanken reißen. Mein Blick gleitet nur immer wieder zu den Himmelsquadraten vor mir. Einen Moment lang vergesse ich, wer ich bin, wie ich heiße, wie alt ich bin, in welcher Zeit ich lebe. Es ist einer dieser besonderen Momente, die manche vielleicht als religiös empfinden, ich nenne sie anthropologische individualisierten Überbau Momente, vergisst und in denen wie mit man einem seinen gesamten Aufzug einige Seelenstockwerke tiefer fährt: da bin ich in der Burg, es gibt keine Computer und keine Bahn zur Burg, es gibt nur die Mauern der Burg, den Himmel, Sonne und die Jahreszeiten. Und Burgbewohner. Und, ja, was es schon gibt es so etwas wie eine 12 Sommerakademie, eine Akademie für Maler. Und Gelehrte (Schriftsteller sagte man damals noch nicht). Ich höre sie hinter mir kritzeln. Und kritzeln. Die Burg hat mich verschluckt. Meine Studenten und ich arbeiten 6 ½ Stunden in völliger Ruhe – sie schreiben alle – aus dem Stand, aus der Burg heraus – wirklich gute Texte, die sie sich nach jeder Aufgabenrunde gegenseitig vorlesen. Ich schlage eine Mittagspause vor, doch meine Studenten meinen, nö, nur höchstens eine Viertelstunde. Eine Studentin hat am nächsten Morgen Schmerzen in der rechten Hand vom vielen Schreiben. Ich fühle mich etwas schuldig. Doch sie, die Burg, ist schuld. Finissage Die Finissage der Kurse im ersten Teil der Sommerakademie gibt mir Gelegenheit, zu sehen, was in diesen Wochen erarbeitet wurde. Die Finissage ist ein wunderbares Fest, das ich nicht vergessen werde. Ich laufe durch die Gänge und Flure der Burg, die mir eigentümlich vertraut geworden ist, noch nie bin ich durch eine Burg wie durch ein Berliner Wohnlabyrinth gewieselt. Besonders begeistert bin ich von den Drucken. Die Arbeiten der Studierenden der Sommerakademie sind so gut, so wunderbar, dass ich andächtig vor ihnen verharre, eigentlich gar nicht mehr aufnahmefähig bin. Doch dann denke ich nachher das Gleiche über die Arbeiten der Comic-Klasse von Dan und Lia Perjovschi – und danach über die – sehr guten – abstrakten Bilder der Klasse von Rebecca Morris. Das Niveau der Arbeiten ist insgesamt sehr hoch, man kommt nicht umhin zu vermuten, dass sowohl die Alte Saline als auch die Hohensalzburg Orte sind, an denen eine besondere Konzentration möglich ist. Vielleicht, weil beide Orte mit Salz zu tun haben, also mit Verdichtung, mit Kristallisationsprozessen, mit Reduktion auf das Wesentliche. Selten so viel gute Kunst auf so begrenztem Raum gesehen. 13 Café Bazar Gott sei Dank habe ich keine Scheu, touristische Orte aufzusuchen, im Gegenteil, Touristenorte sind ja nicht per se doof, was würde einem entgehen, wenn man sie aus reiner Misanthropie meiden würde! Also bin ich schnurstracks in das wunderschöne, nostalgische Café Bazar gegangen, um mich mit meinen Salzburger Kollegen und Bekannten (die, wenn sie nicht ins Café Wernbacher gehen auch keine Scheu vorm Cafe Bazar haben) zu treffen und um viel Geld für allerdings gute heiße Schokolade und guten Kuchen auszugeben. Solche Ausgaben rechtfertige ich vor mir selber stets damit, dass ich als Schriftstellerin ja schließlich auch Recherchen auf dem Gebiet der Schokolade unternehmen müsse – für den großen Schokoladenroman in ferner Zukunft. Und so weiter. Im Café Bazar gibt es Mo – jetzt verzieht der Salzburger schon sein Gesicht ZARTschnitte zu essen, also Kuchen mit einer Pistaziencremeschicht. Wenn man so etwas isst, kann man nicht mehr gut denken – je besser die Süßspeisenqualität in einem Café, um so träger, teilnahmsloser, saturierter sein Publikum. Für das Café Bazar trifft diese Gleichung unbedingt zu. Bahn zur Hohensalzburg (nightmare) Zur Hohensalzburg muss man mit einer Bahn hochfahren. Vor dieser Bahn habe ich höchsten Respekt. Sie fährt den Berg beinahe senkrecht hoch, und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn einmal die Schwerkraft die Elektrizität besiegt. Manchmal habe ich Sorge, über merkwürdige geistige Energien zu verfügen: Unlängst stand ich in Berlin in einer elektrischen Drehtür – und zwar in der Akademie der Künste am Pariser Platz, wenige Meter neben dem Brandenburger Tor, sicher ein Ort, der seine Ein- und Ausgänge gut wartet - und dachte: Jetzt bleibt sie stehen und ich kann hier nicht raus. Noch nie in meinem Leben ist mir so etwas passiert, doch in genau diesem Moment blieb sie stehen. In Salzburg habe ich jedes Mal, wenn ich zur Festung hochfuhr, gedacht: Wenn die Bahn bloß nicht stehen bleibt... oder herunterstürzt ... Mein Misstrauen in die 14 Verlässlichkeit des Bahn-Unternehmens wurde noch dadurch genährt, dass ich jedes Mal einen anderen Preis für die gleiche Strecke zahlen musste. Meine Ausgaben schwankten zwischen 14 Euro und keinem Euro. Für die gleiche Leistung. Mein Vertrauen in den Bahnbetreiber hielt sich also in Grenzen. Und tatsächlich: Am letzten Tag auf der Burg, bei der öffentlichen Finissage, bleibt die Bahn stecken! Allerdings bin ich – Gott sei Dank – nicht in einem der Waggons selbst, sondern stehe noch oben an der Plattform der Hohensalzburg. Aber ich blicke die ganze Zeit auf die schief auf dem Abhang stehende hell erleuchtete Bahn mit den aufgeregt winkenden, gestikulierenden, verzweifelt wirkenden Menschen. Da ich sehr emphatisch bin, fühlte es sich für mich fast so an, als sei ich selber eingeschlossen. Es ist 22.00 Uhr und stockfinster draußen. Sehr angenehm finde ich die Vorstellung nicht, den Berg vielleicht zu Fuß heruntergehen zu müssen. Immer wieder renne ich zum Bahnwärterhäuschen, klopfe an die Scheibe, frage, was da los ist (man hält mich wahrscheinlich schon für die Heilige Penetrantia). Die Antworten sind nicht beruhigend „Das wissen wir auch nicht.“ „Geduld, Madame.“ Eine geschlagene Viertelstunde passiert nichts. Im Bahnwärterhäuschen wird in einem Fort hektisch telefoniert. Irgendwann, plötzlich, setzt sich die Bahn zuckelnd wieder in Bewegung. Jetzt tritt der Bahnwärter aus seinem Häuschen und sagt zu uns Wartenden, wir sind langsam eine richtig große Gruppe: „Eigentlich müsste jetzt nichts mehr schief gehen, das war nur ein Computerproblem, wissen Sie. Die beiden Züge sind computergesteuert“. Ein Mann fragt, ob man wenigstens weiß, um was für ein Computerproblem es sich handelte. Nicht, dass es wieder auftritt! Doch der Bahnwärter zuckt die Schultern „jetzt fährt sie wieder.“ Man kann genauso gut an Gott wie an Computer glauben. Krönungsmesse: Im Dom habe ich die „Krönungsmesse“ von Mozart gehört. Hier wurde die Messe vor über 230 Jahren zum ersten Mal aufgeführt. Ein erhabener Gedanke. Doch berührt es einen wirklich zu denken: HIER war es? Oder ist es nicht nur eine fixe 15 Idee, im Grunde unwichtig, weil nicht mehr nachvollziehbar? Die Räume, nur die Räume sind geblieben, Gerippe der Zeit, menschenleer, mit wechselndem Personal. Was sind die Räume dann, Kleiderständer? Jeder in Berlin war ergriffen als ich erzählte, ich habe die „Krönungsmesse“ am Ort ihrer Uraufführung gehört, doch ich fragte mich mehr und mehr, warum und was mich genau daran berührt hatte, ob ich nicht nur der Idee anheim gefallen war. Ich habe keine Vorstellung, welche Menschen wie gekleidet, welche Gespräche führend, damals hier gesessen haben. Aber die Musik, sie ist die Gleiche, die Unveränderliche. Vielleicht eben weil sie ortlos ist. Können nur Orte altern, nicht aber Ideen? Constanze-Kugeln: Es gibt in Salzburg nicht nur Mozartkugeln, sondern auch Constanze-Kugeln. Sie sind noch süßer. Das Papier ist azurblau. Zwei, drei von ihnen und man verzichtet sofort auf ein ganzes Mittagessen, man streckt die Waffen. Ich möchte feuerrote Don-Giovanni-Kugeln. Schoko mit einer Prise Pfeffer. Mit Pfeffer und Rosengeschmack, eine echte Kavalierspraline. Und groß, vielleicht ein Luft-Ei, mit Hohlkammern, sollte sie auch sein, Don Giovanni war schließlich ein Prahlhans sondergleichen. Regenloch: Dass Salzburg ein derartiges Regenloch ist, wusste ich nicht bei der Ankunft. Ich hätte es mir jedoch denken können: eine Stadt, so nahe vor den Bergen gelegen... Der Regen wird zum Teil der Stadt wie die Festungsbahn oder die ewigen Mozartkugeln. Der Regen ist ein skulpturaler Teppich von oben, verkehrt herum aufgehängt an der Himmelsplane – der Regen und Salzburg, so gehen ineinander über, sie zerfließen, sie vermengen sich mit dem Grund der Salzach und der vielen Seen, ein großes schokoladiges Einerlei. Bis auf die Burg. Sie bleibt für sich. 16 Die Burgmauern: Oben auf der Burg spürt man, wie dick die Mauern sind, die die Festung umgeben. Ich denke, nur wegen der dicken Mauern (auch wegen der guten Studenten und Lehrkräfte) war es möglich, trotz touristischen Highlights, so konzentriert auf der Burg zu arbeiten. Die Außenwände sind teilweise meterdick. Wenn die Burg einen verschluckt hat, lebt es sich gut in ihr. Auch wenn man in sicherem Abstand zu ihr steht, zum Beispiel mit Blick von der Salzach aus, ist der Anblick erfreulich. Aber direkt vor oder nach hier, ist sie ein zu mächtiges Gegenüber, man wünscht sich mehr und nicht weniger Freiheit. Doch Martin Amanshauser, der Schriftsteller und Journalist, ein geschätzter Kollege, ist „im Schatten der Burg“ aufgewachsen - . Wie sich das angefühlt haben muss. Ist es so wie bei Riesen, dass in ihrer größten Nähe eine Art blinder Fleck, eine Nische herrscht, eine Art Freiheit im Schatten der Krone? Oder ist der Himmel einfach immer nur dunkler von diesem Schatten? Oder sieht man die Burg gar nicht mehr? Wie muss es sich leben, als Kind, am Hang der Burg? Ich werde die Frage nicht los, ich, gross geworden in der brandenburgischen Steppe – im Schatten auch, einer anderen Mauer. Wolken: In der Alten Saline findet ein Malkurs statt. Die Studenten malen Himmelsausschnitte, Wolkenbänke vom gleichen Motiv. Zwanzig mal an den Wänden der Alten Saline. Und so entfaltet sich vor mir eine Himmelslandschaft, keine gleicht der anderen, jeder setzt andere Nuancen, der eine dramatisiert den Himmel, der andere lässt ihn nüchtern erscheinen, der nächste haucht ihm Sommer ein, der übernächste Kälte – ein großartiges Himmelsmosaik, zusammengesetzt aus den vielen einzelnen Himmelsquadraten. Ein Stockwerk tiefer ruht das Salz. 17 Zauberflötenspielplatz Einen solchen kann es nur in Salzburg geben. Er ist wirklich wunderbar – es gibt eine Art begehbare Metallfläche, die an verschiedenen Stellen unterschiedlich hohe oder tiefe Töne produziert, man kann eine kleine Melodie „erstampfen“ – jeden Tag, ob bei Regen oder Hagel, springen mindestens so viele Erwachsene wie Kinder auf diesem Klangbogen herum, ich turne schamlos mit. Kulturschock einen solche erlitt ich kurz nach meiner Ankunft in der Metropole Salzburg. Ich machte einen ersten Erkundigungsspaziergang in der mir bislang unbekannten Stadt – eh ich mich versah, stand ich im Schlosspark vor einer Trachtenmusikgruppe. Ich dachte, so etwas gäbe es nur in den entlegensten Dörfern Österreichs und Deutschlands, aber doch nicht in einer Stadt wie Salzburg! Tatsächlich schienen keineswegs nur Touristen zuzuhören, sondern, im Gegenteil, ich hörte, wie sich Einheimische in ihrer merkwürdigen Sprache darüber unterhielten, dass sie jeden Sonntag hierherkämen, nur um diese Musikanten und andere Trachtengruppen zu hören. Noch überraschter war ich, als ich mir die Musiker näher anschaute. In meiner Vorstellung waren Trachtenkapellen etwas für dicke, grauhaarige Männer mit struppigen Koteletten. Doch hier saßen und standen vornehmlich junge Leute! Und sie spielten solch eine rückwärtsgewandte Heimatfolklorenmusik – voller Begeisterung. Neben mir stand ein Pärchen und wippte mit, die Frau trug eine Handtasche in Form eines, ja, trübten mich schon meine Augen? - eines kleinen Bierfässchens. Es ist wahr, ich habe es mit dem Handy fotografiert – eine kleines Holzbierfässchen als DesignHandtasche, mit Plastikblumengirlande on top. Da tupfte ich mir die Stirn ab und ging erstmal zurück zu unserem Quartier, um eine Pause von den Erkundungen einzulegen. 18 Oskar Kokoschka habe ich im Kunstgeschichts-Studium eine Weile lang verehrt, nicht nur wegen seiner Gemälde wie „Das rote Ei“ oder „Anschluss – Alice in Wonderland“ oder wegen seiner blau-grauen apokalyptischen Niemandslandschaften. Ich denke an Details aus seinem mutigen Leben, seiner Flucht über viele Länder vor den Nazis, seine Brandmarkung als entarteter Künstler, seine Hochzeit mit Olda Palkoská in einem Luftschutzkeller im Londoner Exil. Ich denke an jenes geheimnisvolle multiethnische Mittelosteuropa, dem er angehörte, das er repräsentierte – und das untergegangen ist. 1953 gründete Kokoschka zusammen mit Friedrich Wels die Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg als „Schule des Sehens“ auf der Festung Hohensalzburg. Übrigens, die österreichische Staatsbürgerschaft hat er erst 1975 wieder angenommen, fünf Jahre vor seinem Tod. Die Terrasse vom Hotel Stein hätten wir ohne Martin und Eva nie gefunden. Wir sitzen in diesem nostalgischen Ambiente und blicken auf die Burg, die Berge, die Salzach. Wir könnten uns wie Könige fühlen, träge wie wir Kuchen speisend aus altem Leder auf die alte Welt schauen, nur ein Flugzeug stört das Bild – und der Tiger und der Husky neben uns. Der anderthalbjährige Husky und der einjährige Tiger verhindern jedes Abgleiten in andere Zeiten. Sie heißen eigentlich Jim und Emil, aber ihre Welt ist so viel magischer, so viel phantastischer als meine Zeitreisen, das sie dagegen den Charakter von Touri-Kutschfahrten in totsanierten Altstadtvierteln annehmen. Nie wieder werde ich so reisen können wie ein Einjähriger, nie wieder werde ich ein Tiger oder ein Husky sein können. Aber auf der Terrasse vom Hotel Stein fallen ein paar Himmelssplitter immerhin genau in die Kaffeetassen. 19 Café Wernbacher von unserem Quartier um die Ecke gelegen in der Franz-Josef-Straße wirbt mit „Das sind noch Zeiten ... Ankommen, Wohlfühlen, Zeit genießen, Loslassen. Freunde treffen, Gespräche führen. Bücher, Zeitungen, Magazin lesen. Kaffeeduft liegt in der Luft. Wernbacher“ und genauso ist die Stimmung dort. Man fühlt sich ein wenig in die Siebziger zurückversetzt, keine hektischen Business-Gespräche auf dem Handy, dafür gepflegter Müßiggang bei gutem Essen ohne zeitgeistigen Firlefanz und viel raschelnden Zeitungen. Herrlich. Hier unterhalte ich mich mit Susanne Tiefenbacher über Ausstellungen, Indienreisen und über österreichische Innenpolitik. Das Publikum um uns herum ist eine angenehme Mischung aus Jung und Alt, kein Szenevolk. Das Café sieht mit seinen dunklen Holzmöbeln auch noch aus wie ein Café und nicht wie eine Wellnessoase oder ein Designfachgeschäft. Es ist so warm, dass man noch auf der Straße sitzen kann. Für mich die Jahreszeit, in der ich von Heißer Schokolade auf Eisschokolade umsteige. Wenn Susanne mal in Berlin ist, steht eine Gegeneinladung in eines der – meist etwas hektischeren – Berliner Kaffeehäuser an. Rebecca Morris ist eine großartige abstrakte Malerin, deren Werke ich durch eine Freundin in Berlin kennen gelernt habe. Ich bin sehr neugierig auf die Künstlerin hinter den großformatigen Gemälden, mit bunten stein- oder kristallartigen Gebilden vor silbernen Wandschichten, diese Bilder, denen man doch, wie früher denen von Clyfford Still, die Wüstenerfahrung ansieht. Und den Funken Las Vegas in all der Kargheit. Dann lerne ich sie kennen. Rebecca Morris ist sehr klein und zierlich, ganz ernst, auf eine Weise fast ein wenig humorlos, die ich nicht als unangenehm, sondern als verschlossen empfinden würde – ernst, korrekt, humorlos nach außen. Je länger wir miteinander sprechen, desto entgegenkommender wird sie. Sie ist ganz erstaunt, dass man in Berlin ihre Werke so gut kennt, was ich über sie weiß. Am Ende lachen wir. 20 Destiny Deacon und Virginia Fraser: widersprechen jeder These, dass Paare, deren Beziehung von langer Dauer ist, sich visuell – oder habituell - einander angleichen. Doch in ihrer Zusammenarbeit verschmelzen sie miteinander, ein seltenes Beispiel einer fruchtbaren, auf Dauer angelegten Künstlerbeziehung. Festspiele „Das ist ja toll, dass ihr während der Festspiele in Salzburg seid!“, hörten wir schon oft in Berlin. In Salzburg werden aus den „Festspielen“ die „Feschschschtspiele“, daran hat sich das Ohr bald gewöhnt. Überall hängen die Plakate, die ganze Stadt wartet auf die Festspiele. Mir gefällt so etwas, wenn für kurze Zeit einmal ein kulturelles Großereignis eine ganze Stadt zu beherrschen scheint, so viel weltliche Macht erlangt. Auch wenn diese Macht ohne den ökonomischen Gewinn für die Stadt sicher nicht denken wäre. In Salzburg muss ich dann feststellen, dass meine Vorstellungen von der Preishöhe der Tickets unrealistisch bzw. fahrlässig an Berliner Niveau angelehnt war. Die günstigste Karte, die ich noch erwerben kann, kostet 150 Euro. Ich überlege – und passe. Und so wird mir unversehens ein besonderer Platz, ein kostenloser! – zuteil, nämlich auf den Stufen zum Festspielhaus in den schönen Stunden der Abenddämmerung. Da betreten sie die große Freilichtbühne – die Stadt Salzburg – einer nach dem anderen, und ich studiere die Besucher, ein ergreifenderes, aufwühlenderes, nachdenklich stimmenderes Bühnenereignis hätte ich indoors niemals erleben können. Lieblingsbesucher: Die Dame mit dem grünen Samthut, so groß fast wie ein Regenschirm, dazu ein Hündchen mit passendem Hütchen, ebenfalls aus grünem Samt Der Herr im Dreiteiler – mit Monokol. Das Frauenpärchen in rosa Tüll. 21 Der Mann in dem weißen eleganten Sommeranzug, unter dem er ein Che Guevara-TShirt trägt. Das Paar, das sich streitend das Festspielhaus betritt – und eine halbe Stunde später, streitend, die Aufführung verlässt. Die Menschen, die unter einem eleganten Jackett ein eher billig aussehendes Hemd tragen. Die Menschen, die unter einem billig aussehendem Jackett ein teures Hemd tragen. Die vielen Menschen, die unter dem teurem Jackett ein teures Hemd tragen. Der eine Mensch, der unter einem Kapuzensweatshirt ein zerrissenes T-Shirt trägt. Die vielen Stöckelschuhe erzeugen eine Sinfonie besonderer Art, ein erwartungsfrohes Geklapper dringt durch die Gassen und Straßen und verdichtet sich zu einem hektischen, trommelnden Staccato dicht vor dem Festspielhaus. Vladimir Vertlib ist ein österreichischer Schriftstellerkollege mit russisch-jüdischer Herkunft. Er lebt in Salzburg und in Wien und hat Romane wie „Abschiebung“, „Zwischenstationen“ über seine lange Emigrationsgeschichte, „Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur“, „Am Morgen des Zwölften Tages“ oder die Erzählungen „Mein erster Mörder – Lebensgeschichten“ geschrieben. Wenn man ihm zuhört, könnte man denken, er sei viel älter als er ist – er ist 1966 geboren. Er gehört zu jenen Männern, die immer gleich alt aussehen. Ich frage mich, wie man so gemütlich sein kann, sich so viel Zeit beim Sprechen, beim Kaffee trinken lassen kann, und gleichzeitig so unheimlich produktiv sein kann. Vladimir sitzt mir im vollen Café Bazar gegenüber, lauter Eindrücke strömen auf ihn ein, oder – vielleicht eben auch nicht. Das ist eine besondere Gabe: In der Welt und doch völlig bei sich sein, sich scheinbar nur dann anrühren, tangieren, stören zu lassen, wenn es einem gerade passt. 22 Mondsee Nicht vom Land aus den See gesehen, sondern vom See aus – auf dem Schiff – das Land. Kegelige Berge, wie Vulkane, doch es ist nur der Schafsberg im Wolfskostüm, sattes Grün wie man es in Berlin kaum sieht, ich fühle mich wie in den Tropen. An den Ufern hektarweise Seerosen, wo sind wir nur, an was für einen verwunschenen Ort? Irrsee Auf dem Weg zum Irrsee haben wir uns verirrt. Vermutlich sind wir dreimal um den Irrsee gefahren, ohne es zu merken, im Glauben, es handele sich dabei um einen anderen See. Wenn man aus der brandenburgischen Steppe kommt, wie wir, verwirren einen so viele Seen mit verwirrend romantischen Namen. Hier, in Berlin, heißen die Seen „Müggelsee“, „Lietzensee“ oder „Krumme Lanke“. Am Ende unserer Suche nach dem Irrsee dämmert es schon, doch dann sehen wir den zartblauen See unter einem hartblauen Himmel, unser Blick verirrt sich an der feinen, flimmernden Linie zwischen Wasser und Luft – und genau so etwas habe ich gesucht, für diese Sekunden, bevor die Blaues in einander versinken, bevor wir unser Auto kaum mehr in der Dunkelheit finden, hat sich der lange Ausflug zum Irrsee gelohnt. Akustischer Goldstaub: Vielleicht komme ich auf solche kitschigen Bilder, weil ich, wie ich erst vor wenigen Jahren erfahren habe, Synästhetikerin bin. Der Begriff bezeichnet Menschen, bei denen verschiedene Sinneswahrnehmung miteinander gekoppelt sind oder auch Abstrakta mit Sinneswahrnehmungen. Anders als Psychotiker, die auch oft Wahrnehmungsverschmelzungen erleben, sind Synästhetiker eigentlich ganz 23 normal, sie stören sich nur manchmal an Dingen wie rotem Essen an einem Dienstag oder einem grünen Kleid an einem Montag (würde ich nie anziehen). Als Kind wunderte ich mich schon immer, warum für andere Kinder die 8 nicht rot sei oder die drei gelb, warum das A nicht grün und ein Mädchen und das N nicht braun und ein Junge sei. Bei mir haben alle Buchstaben und Zahlen, Wochentage und Monate Farben und Geschlechter – und Musik sehe ich auch sehr oft in Farben. Wenn ich Fieber habe, wird es richtig verrückt, dann geht es richtig ab – ich habe nie Drogen genommen, nie Interesse an Drogen gehabt (abgesehen mal von meiner Vorliebe für Schokolade), hab ich nie vermisst. Das Wort Schokolade ist überhaupt nicht braun bei mir, weshalb mir die Mozartschnitte aus dem Café Bazar eigentlich am Besten gefällt. Vor allem mit Musik im Hintergrund. © Tanja Dückers, Juli-November, Salzburg-Berlin 2010 24