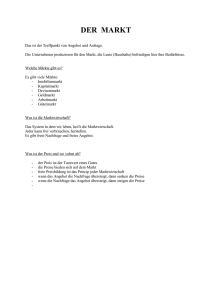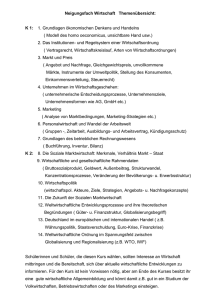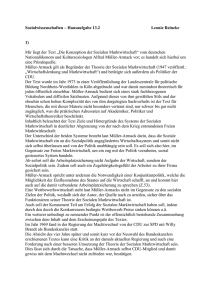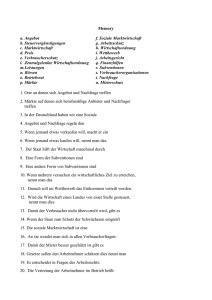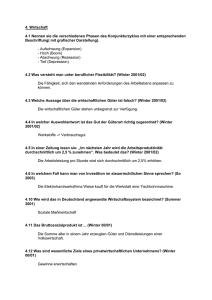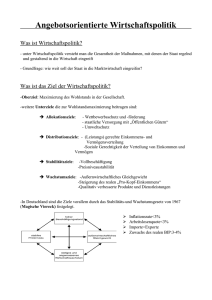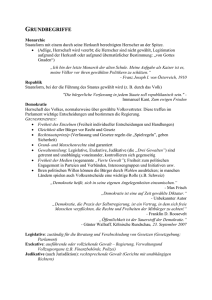Marx, Engels, Erhard: Auf dem Weg zu einer neuen Ikonographie
Werbung
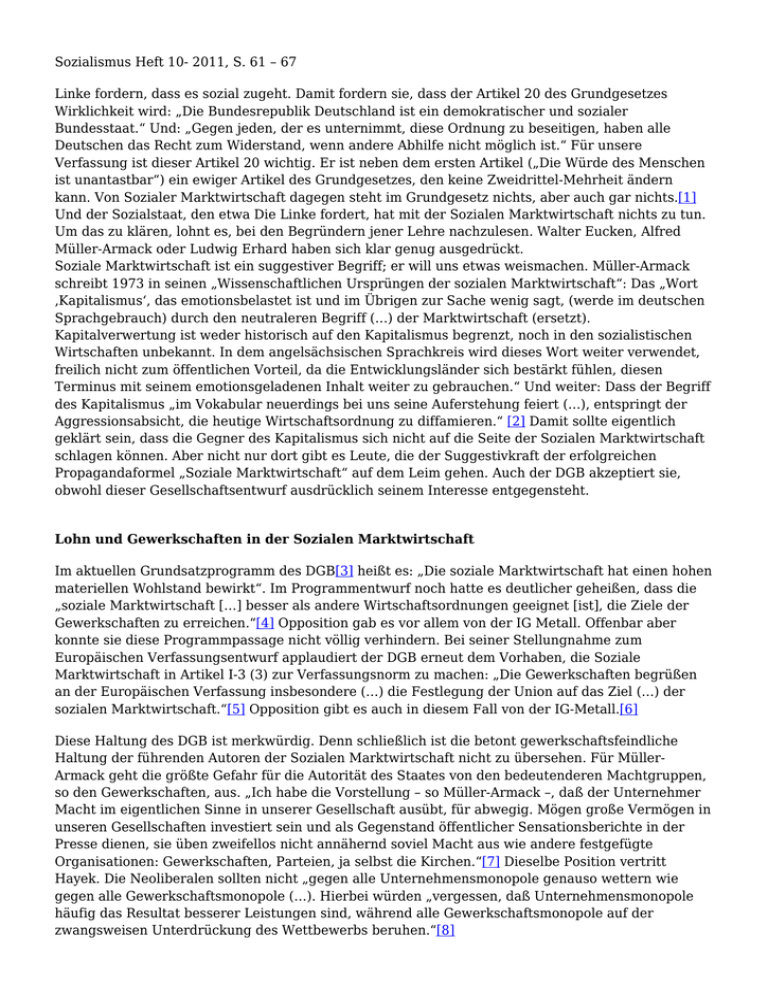
Sozialismus Heft 10- 2011, S. 61 – 67 Linke fordern, dass es sozial zugeht. Damit fordern sie, dass der Artikel 20 des Grundgesetzes Wirklichkeit wird: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Und: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Für unsere Verfassung ist dieser Artikel 20 wichtig. Er ist neben dem ersten Artikel („Die Würde des Menschen ist unantastbar“) ein ewiger Artikel des Grundgesetzes, den keine Zweidrittel-Mehrheit ändern kann. Von Sozialer Marktwirtschaft dagegen steht im Grundgesetz nichts, aber auch gar nichts.[1] Und der Sozialstaat, den etwa Die Linke fordert, hat mit der Sozialen Marktwirtschaft nichts zu tun. Um das zu klären, lohnt es, bei den Begründern jener Lehre nachzulesen. Walter Eucken, Alfred Müller-Armack oder Ludwig Erhard haben sich klar genug ausgedrückt. Soziale Marktwirtschaft ist ein suggestiver Begriff; er will uns etwas weismachen. Müller-Armack schreibt 1973 in seinen „Wissenschaftlichen Ursprüngen der sozialen Marktwirtschaft“: Das „Wort ‚Kapitalismus‘, das emotionsbelastet ist und im Übrigen zur Sache wenig sagt, (werde im deutschen Sprachgebrauch) durch den neutraleren Begriff (…) der Marktwirtschaft (ersetzt). Kapitalverwertung ist weder historisch auf den Kapitalismus begrenzt, noch in den sozialistischen Wirtschaften unbekannt. In dem angelsächsischen Sprachkreis wird dieses Wort weiter verwendet, freilich nicht zum öffentlichen Vorteil, da die Entwicklungsländer sich bestärkt fühlen, diesen Terminus mit seinem emotionsgeladenen Inhalt weiter zu gebrauchen.“ Und weiter: Dass der Begriff des Kapitalismus „im Vokabular neuerdings bei uns seine Auferstehung feiert (…), entspringt der Aggressionsabsicht, die heutige Wirtschaftsordnung zu diffamieren.“ [2] Damit sollte eigentlich geklärt sein, dass die Gegner des Kapitalismus sich nicht auf die Seite der Sozialen Marktwirtschaft schlagen können. Aber nicht nur dort gibt es Leute, die der Suggestivkraft der erfolgreichen Propagandaformel „Soziale Marktwirtschaft“ auf dem Leim gehen. Auch der DGB akzeptiert sie, obwohl dieser Gesellschaftsentwurf ausdrücklich seinem Interesse entgegensteht. Lohn und Gewerkschaften in der Sozialen Marktwirtschaft Im aktuellen Grundsatzprogramm des DGB[3] heißt es: „Die soziale Marktwirtschaft hat einen hohen materiellen Wohlstand bewirkt“. Im Programmentwurf noch hatte es deutlicher geheißen, dass die „soziale Marktwirtschaft […] besser als andere Wirtschaftsordnungen geeignet [ist], die Ziele der Gewerkschaften zu erreichen.“[4] Opposition gab es vor allem von der IG Metall. Offenbar aber konnte sie diese Programmpassage nicht völlig verhindern. Bei seiner Stellungnahme zum Europäischen Verfassungsentwurf applaudiert der DGB erneut dem Vorhaben, die Soziale Marktwirtschaft in Artikel I-3 (3) zur Verfassungsnorm zu machen: „Die Gewerkschaften begrüßen an der Europäischen Verfassung insbesondere (…) die Festlegung der Union auf das Ziel (…) der sozialen Marktwirtschaft.“[5] Opposition gibt es auch in diesem Fall von der IG-Metall.[6] Diese Haltung des DGB ist merkwürdig. Denn schließlich ist die betont gewerkschaftsfeindliche Haltung der führenden Autoren der Sozialen Marktwirtschaft nicht zu übersehen. Für MüllerArmack geht die größte Gefahr für die Autorität des Staates von den bedeutenderen Machtgruppen, so den Gewerkschaften, aus. „Ich habe die Vorstellung – so Müller-Armack –, daß der Unternehmer Macht im eigentlichen Sinne in unserer Gesellschaft ausübt, für abwegig. Mögen große Vermögen in unseren Gesellschaften investiert sein und als Gegenstand öffentlicher Sensationsberichte in der Presse dienen, sie üben zweifellos nicht annähernd soviel Macht aus wie andere festgefügte Organisationen: Gewerkschaften, Parteien, ja selbst die Kirchen.“[7] Dieselbe Position vertritt Hayek. Die Neoliberalen sollten nicht „gegen alle Unternehmensmonopole genauso wettern wie gegen alle Gewerkschaftsmonopole (…). Hierbei würden „vergessen, daß Unternehmensmonopole häufig das Resultat besserer Leistungen sind, während alle Gewerkschaftsmonopole auf der zwangsweisen Unterdrückung des Wettbewerbs beruhen.“[8] Ziel der Sozialen Marktwirtschaft ist der deregulierte Arbeitsmarkt mit individuellen Arbeitsverträgen. „Während der Staat auf die Aufsicht und eventuelle Gestaltung der Formen beschränkt werden soll, in denen der Wirtschaftsprozeß abläuft, muß im Rahmen der Märkte, auch des Arbeitsmarktes, Freiheit bestehen. Das ist das Ziel.“[9] Und weiter: Es werde nicht bemerkt, was sich vor unseren Augen abspiele: „wie die Arbeiter und Angestellten … durch Beseitigung des freien Arbeitsvertrages (…) in ihrer sozialen Position geschwächt werden und die Menschen in eine Apparatur und in die Hand von Funktionären geraten, die sie beherrschen.“[10] Sicherlich betont Müller-Armack, daß „freie Gewerkschaften, freie(r) Tourismus (sic!)“ als Wert von der überlegenen Sozialen Marktwirtschaft verwirklicht worden wären,[11] aber: „Das Anwachsen der zentralen Lenkung führt in (den) Gewerkschaften zum Anwachsen eines bürokratischen Apparates (…), der sich verselbständigt. Es beginnt die Herrschaft der Funktionäre (…)“.[12] Machen wir uns im Sinne von Walter Eucken klar, was Sache ist auf dem Arbeitsmarkt: Herausgebildet haben sich zunächst die Gewerkschaften, dann die Arbeitgeberverbände. Entstanden sei so (Eucken) ein sehr labiles bilaterales Monopol auf dem Arbeitsmarkt, wobei das fehlende stabile Gleichgewicht Staatsintervention auf diesem Markt auslöse.[13] Überwiege ein NachfrageTeilmonopol (der Unternehmen nach Arbeit), dann komme den Gewerkschaften die positive Aufgabe zu, einen zu niedrigen Lohn dem Gleichgewichtslohn, d.h. der Lohnhöhe bei Vollbeschäftigung im Sinne eines neoklassischen Arbeitsmarktmodells anzupassen. Dann „tragen sie zur Realisierung der Wettbewerbsordnung bei.“[14] Steigt der Lohn dagegen über den Wettbewerbslohn, so führt dies zu Arbeitslosigkeit.[15] Ein Mindestlohn, der bei anomalem Verhalten des Arbeitsangebotes erforderlich werden könnte, ist gesetzlich zu regeln, ebenso wie etwa die Begrenzung der Arbeitszeit.[16] Die Soziale Markwirtschaft versteht demnach den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und Beschäftigung neoklassisch. Diese Theorie, sie ist die wirtschaftstheoretische Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft, behauptet, dass bei gegebener Arbeitsproduktivität und damit gegebener Grenzproduktkurve der Arbeit die Beschäftigung mit fallendem Lohn steigt. (Hoher Lohn macht arbeitslos – so die politische Parole.) Ist der Lohn zu niedrig, herrscht Überbeschäftigung: Das Angebot an Arbeit ist dann geringer als die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeit. Hier tragen die Gewerkschaften zur Realisierung der Wettbewerbsordnung bei, wenn sie Lohnerhöhungen durchsetzen (oder wenn es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt). Dann wird die Nachfrage nach Arbeit dem begrenzten Arbeitsangebot angepasst. Gehen sie aber über diesen Punkt hinaus, entsteht Arbeitslosigkeit. Bei Arbeitslosigkeit also sind im Sinne Euckens die Löhne zu hoch. Sicherlich steht das einem gesetzlichen Mindestlohn nicht entgegen. Aber es muss der Gleichgewichtslohn sein, der Vollbeschäftigung ermöglicht. Bei Arbeitslosigkeit muss das ein niedriger Lohn sein. So ist Müller-Armack zu verstehen. Den „sozialpolitischen Eingriffen (soll) eine Form“ gegeben werden, „durch die sie sinnvoll in den marktwirtschaftlichen Prozess eingegliedert werden“. Nicht mit einem solchen sozialpolitischen Vorgehen verträglich ist „die Form einer Lohnsicherung, die über eine allgemeine Preisfixierung und durch eine bewußt von der Grenzproduktivität der Arbeit abweichende Festlegung des Lohnsatzes dessen Höhe entgegen den Markttendenzen zu behaupten sucht. Der Übergang zu einer marktwirtschaftlichen Lohnpolitik bedeutet keineswegs, daß auf alle lohnpolitischen Bindungen verzichtet werden müßte. Es ist marktwirtschaftlich durchaus unproblematisch, als sogenannte Ordnungstaxe eine staatliche Mindestlohnhöhe zu normieren, die sich im wesentlichen in der Höhe des Gleichgewichtslohnes hält.“ [17] Also: Der Mindestlohn oder der Lohn, den die Gewerkschaften durchsetzten, soll der Gleichgewichtslohn bei Vollbeschäftigung sein. Sicherlich lässt das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt bei Vollbeschäftigung Lohnerhöhungen zu: Das ist ohne Beschäftigungseinbußen dann möglich, wenn das Grenzprodukt der Arbeit steigt – etwa als Folge von technischem Fortschritt. Aber Achtung: Das bedeutet nicht, dass die realen Löhne mit derselben Rate steigen könnten wie die Arbeitsproduktivität. Denn entscheidend ist hier die Reaktion des Grenzproduktes der Arbeit auf den technischen Fortschritt. Und klar ist auch für diese theoretische Richtung: Solange es Arbeitslosigkeit gibt, ist der Lohn zu hoch. Bei konstantem (zu hohem Lohn) tragen dann eine steigende Arbeitsproduktivität und damit ein steigendes Grenzprodukt der Arbeit dazu bei, die Arbeitslosigkeit zu verringern.[18] Soziale Marktwirtschaft und Mitbestimmung Zum Stichwort Mitbestimmung wird eine soziale Betriebsordnung mit sozialem Mitgestaltungsrecht angestrebt, „ohne dabei die betriebliche Initiative und Verantwortung des Unternehmens einzuengen.“[19] Im Einzelnen meint Müller-Armack: „Daß der Arbeitsvorgang in einem Betriebe (…) in einem humanen, friedlichen und geordneten Verbande erfolgen muß, ist ein Ziel, daß jeder (…) akzeptieren muß.“[20] Eine „Mitentscheidung in wirtschaftlichen Fragen“ wird dagegen abgelehnt. „Dieses schwere Geschäft des Spitzenunternehmers einer Mitbestimmung zu unterwerfen, (…) erscheint mir (…) wenig sinnvoll.“ Aber in den bedeutenden „Wachstumsindustrien ist die unternehmerische Funktion so heikel, risikogeladen und setzt so seltene Fähigkeiten voraus, daß es nur wenig sinnvoll erscheint, die eigentliche Entscheidung durch das Gewicht mitbestimmender Funktionäre zu belasten, die nach ihrer Herkunft verständlicherweise nur in seltenen Fällen eine unternehmerische Begabung aufweisen.“[21] Bedenken ergeben sich auch, weil „gegen die Fernsteuerung der Mitbestimmung seitens der Gewerkschaften“ vieles einzuwenden ist.[22] Deswegen wollte „Erhard die Gewerkschaften unter das Kartellgesetz stellen. Er hielt die Mitbestimmung für unvereinbar mit dem freien Markt. Folglich kämpfte er gegen das MontanMitbestimmungsgesetz von 1951. Letzteres wurde erst nach gewerkschaftlichen Streikdrohungen durchgesetzt.“[23] Wenn nun Belegschaftseigentum gefordert wird und damit die (Mit)bestimmung der Belegschaft bei der Unternehmenspolitik, oder wenn die Gewerkschaften Mitbestimmung bei der Unternehmenspolitik fordern, wenn sie den individuellen Arbeitsvertrag ablehnen, dann lässt sich dies nicht aus dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft begründen: Das muss gegen die Soziale Marktwirtschaft durchgesetzt werden. Soziale Gerechtigkeit und Einkommensverteilung Ebenfalls ist es – folgt man der Sozialen Marktwirtschaft – nicht Sache der Gewerkschaften oder der Parlamente, soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Denn grundsätzlich ergibt sich gerechte Einkommensverteilung durch vollständige Konkurrenz – auf den Gütermärkten und auf dem Arbeitsmarkt. „In der vollständigen Konkurrenz teilt ein anonymer Wirtschaftsprozeß den Menschen ihre Einkommen zu. (…) Und so wird die Verteilung nicht nach ethischen Gesichtspunkten vollzogen, sondern sie ist einem ethisch-gleichgültigen Automatismus überlassen.“[24] Allerdings ist dieses „ethisch-gleichgültige Grundprinzip der Wettbewerbswirtschaft“ eine Bedingung für die „Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit“,[25] denn es teilt das Einkommen entsprechend der für den Konsumenten erbrachten Leistung zu. Leistungsgerechtes Einkommen ist also gerechtes Einkommen. Und damit ist auch vollständige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gerecht. Denn „die Preismechanik der vollständigen Konkurrenz (ist) – trotz vieler Mängel – immer noch besser ist als die Verteilung aufgrund willkürlicher Entscheidungen privater oder öffentlicher Machtkörper.“ [26] Machtkörper, daran ist zu erinnern, sind die Parteien und die Gewerkschaften. Sehr aktuell sind auch Müller-Armacks Forderungen zur Sozialpolitik. 1960 schreibt er: „Mit fortschreitender Expansion wachsen mehr und mehr Schichten in eine Lage hinein, in der ihnen ein höheres Maß an Selbsthilfe zugemutet werden kann.“ Gefordert wird „Konzentration auf die echten Fälle der Hilfsbedürftigkeit“ und eine „Aufgliederung der sozialen Hilfe in eine vom Staate gesicherte Grundversorgung und eine zusätzliche Schicht einer der eigenen Initiative überlassenen Eigensicherung (…).“[27] Die Riester-Rente kann demnach ohne Einschränkung durchgehen als Errungenschaft der Sozialen Marktwirtschaft. Gewisse Korrekturen der marktbestimmten Einkommensverteilung sind im Konzept der sozialen Marktwirtschaft zulässig. Dies aber einzig, um – im Rahmen der irenischen (der friedensstiftenden) Formel – den sozialen Frieden zu erhalten, nicht dagegen, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu erhöhen. Zwar dürfe, so Eucken, die Steuerpolitik genutzt werden, um bestimmte nachträgliche Korrekturen der Verteilung vorzunehmen, er betont aber, dass die Einkommenspolitik nicht dem Zweck der Vollbeschäftigung dienen könne. Der Einkommenspolitik Englands oder der USA in der Nachkriegszeit lehnt er ab. Die Vollbeschäftigungspolitik dort arbeite zwar ebenfalls mit dem Instrument der Steuerpolitik, „aber die Vollbeschäftigungspolitiker verfolgen hiermit einen ganz anderen Zweck. Sie wollen zu starkes Sparen verhindern. Deshalb sehen sie in hohen Einkommen, von denen erfahrungsgemäß eine großer Teil gespart wird, eine Gefahr.“[28] Eucken sieht die Gefahr an anderer Stelle: Er betont, dass Verteilungspolitik, die sich an der Möglichkeit des Übersparens (bzw. an der Unterkonsumtion) orientiert, die Investitionen behindert.[29] Das macht deutlich: Wer – keynesianisch – von einer Verteilung zugunsten der niedrigen Einkommen mehr Beschäftigung erwartet, der kann sich dabei nicht auf die Soziale Marktwirtschaft berufen. Zu beachten ist aber bei einer Einkommenskorrektur, die sich am sozialen Frieden orientiert: Es wird korrigiert, damit die Leute die Klappe halten. Das aber ist keine rationale Orientierung. Vielmehr muss die Einkommensverteilung das folgende Ziel anstreben: Sie trägt, neben anderen politischen Maßnahmen, dazu bei, Vollbeschäftigung zu erreichen. In dieser Lage wird das Vollbeschäftigungsprodukt restlos nachgefragt in Form von Investitionsgütern (Unternehmen und Staat) und in Form von Konsumgütern (öffentlicher und privater Konsum). Ist der Investitionsgüterbedarf niedrig, dann muss ausgleichend die Konsumgüternachfrage steigen – oder, wenn das Konsumniveau als hinreichend eingeschätzt wird, die Arbeitszeit bei unverändertem Konsum sinken, so dass die nicht benötigten Waren nicht hergestellt werden. Dies ist die leitende Idee einer rationalen Verteilungspolitik, d.h. die Aufgabe der Gewerkschaften und der Parlamente. Großunternehmen und wirtschaftliche Macht Auf Anhieb könnte man sich vorstellen, dass eine vollständige Konkurrenz diese Demokratie befreit vom Einfluss der Wirtschaftslobby. Denn wenn es nur noch viele kleine Unternehmen gibt – dadurch zeichnet sich die vollständige Konkurrenz aus – dann ist der Staat befreit von privaten Machtgruppen[30], dann lässt sich die Sphäre des Staates und der privaten Wirtschaft klar voneinander trennen. „Privateigentum bei vollständiger Konkurrenz bedeutet (…) Ohnmacht, die Verfügungsmacht und Freiheit der anderen Eigentümer zu Lasten der Gesamtheit einzuschränken.“ [31] Aber diese vollständige Konkurrenz als Ensemble vieler kleiner hemmt den technischen Fortschritt. Darum ging es in der Hoppmann-Kantzenbach-Kontroverse.[32] Der Kern des Vorwurfes gegenüber der Sozialen Marktwirtschaft war, dass ihre vollständige Konkurrenz nichts weiter sei als Schlafmützenkonkurrenz. Revolutionärer technischer Fortschritt, etwa wie ihn Schumpeter mit dem Begriff der schöpferischen Zerstörung beschreibt, könne dieser Wettbewerb mit seinen vielen kleinen Wirtschaftseinheiten nicht zustande bringen. Die Lösung sollte eine arbeitsfähige Konkurrenz unter Oligopolen sein. (Kantzenbach greift bei seiner Kritik die britische Diskussion der 30er Jahre auf. Hier wurde der Begriff der workable competition entwickelt.) Die Sozialdemokratie fordert in ihrem Godesberger Programm von 1959 (hier hat sie ihren Frieden geschlossen mit dem Kapitalismus) nicht vollständige Konkurrenz, um zu verhindern, dass wirtschaftliche Macht zu politischer Macht wird und die Demokratie Schritt für Schritt beseitigt. Im Godesberger Programm heißt es: „Mit ihrer durch Kartelle und Verbände noch gesteigerten Macht gewinnen die führenden Männer der Großwirtschaft einen Einfluss auf Staat und Politik, der mit demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar ist. Sie usurpieren Staatsgewalt. Wirtschaftliche Macht wird zu politischer Macht.“ Daher: „Wo mit anderen Mitteln eine gesunde Ordnung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse nicht gewährleistet werden kann, ist Gemeineigentum zweckmäßig und notwendig.“ Die Großunternehmen bleiben bestehen, aber sie werden Gemeineigentum. Nun hat der demokratische Staat hat den Vorrang. Er ist der Souverän, der – befreit von der Wirtschaftslobby – die Wirtschaft ordnet. Es entsteht ein gemischtwirtschaftliches System mit einem großen öffentlichen Produktionssektor. Damit gewährleistet der Großbetrieb technischen Fortschritt, das Gemeineigentum am Großbetrieb verhindert den Übergriff der Wirtschaft auf die Politik. „Dezentral“ war also bei der damaligen SPD nicht die Lösung. (Gegenwärtig allerdings scheint „dezentral“ im progressiven Milieu da und dort eine religiöse Anrufung zu sein, eine mythische Formel, die viele Fragen lösen soll.) Sicherlich findet sich auch in der Sozialen Marktwirtschaft die Idee des öffentlichen Unternehmens. Sein Zweck ist aber nicht, den Übergriff der Wirtschaft auf die Politik zu verhindern, sondern dort Wettbewerb zu inszenieren, wo dies die Privatwirtschaft nicht zuwege bringt. Ein weiteres Argument war das natürliche Monopol. Immer dann, wenn die Großproduktion zu Kostenvorteilen führe, so bei den Versorgungsbetrieben, sei das öffentliche Unternehmen statthaft. Das war aber wirklich als Ausnahme gedacht. Grundsätzlich wurde unterstellt, dass kleine Unternehmen mit ebenso geringen Kosten produzieren könnten wie Großunternehmen. Die Demokratiefrage: vom reinen Staatsinteresse zu Erhards formierter Gesellschaft Auf den Märkten, auch auf dem Arbeitsmarkt, muss Freiheit herrschen, so Müller-Armack. Vollständige Konkurrenz ist das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. Der Zweck dieser vollständigen Konkurrenz ist die Befreiung des Staates von mächtigen, organisierten Interessen, die Zuteilung des Einkommens nach der Leistung, die optimale Steuerung der Produktion. Was es mit der Befreiung des Staates auf sich hat, macht Eucken 1932 in einem Aufsatz über „Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus“[33] klar. Der Weimarer Republik (und vergleichbaren Demokratien) hält er folgendes vor: Die enge Verflechtung mit der Wirtschaft unterhöhlt die Selbständigkeit der Willensbildung des Staates, auf der seine Existenz beruhe. Der „Druck der Interessenten“ hat einen „Zersetzungsprozeß“ ausgelöst, so daß der Staat „das reine Staatsinteresse zur Geltung zu bringen, (…) nur selten imstande“ ist.[34] Die „staatlichgesellschaftliche Entwicklung“ habe zur „Entartung“ des Kapitalismus geführt. Den Grund hierfür sieht Eucken in Folgendem: „Letzten Endes waren und sind es die Massen, unter deren wachsendem Druck … die überkommene staatliche Struktur maßgeblicher altkapitalistischer Länder zerstört, der Wirtschaftsstaat geschaffen, sowie ohne Ersatz das alte Staatssystem aufgelöst wird (…); damit verfällt die staatlich-gesellschaftliche Organisation, in deren Rahmen der Kapitalismus entstanden ist, und ohne die er weder seine starken Kräfte entfalten noch überhaupt funktionieren kann.“[35] Diese Passage ist besonders deswegen informativ, weil Eucken zunächst von zwei Gruppen ausgeht, die den Staat zum Eingriff in die Wirtschaft veranlassen, nämlich die Unternehmer und die Arbeiter,[36] um aber dann zu resümieren, dass letzten Endes der wachsende Druck der Massen die Veränderung von Kapitalismus und Staat, also die „Krisis des Kapitalismus“ herbeigeführt hätten.[37] Wichtig zu notieren ist, dass das reine Staatsinteresse gegen den „Einfluss der Massen“ verwirklicht werden muss. Mit wem, mit welcher gesellschaftlichen Kraft aber sollen Euckens Vorstellungen verwirklicht werden? Die „Massen“ sind nicht gefragt. Wer dann? Kann dieser Staat – diese Frage ist rhetorisch – ein demokratischer Staat sein? Jedenfalls war eine partizipative Massendemokratie (ein Ziel der Linken) nicht sein Anliegen. In seinen „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ spricht Eucken Parlamentarismus und Demokratie nicht an. „Parlament“ taucht im Sachregister nicht auf, „Demokratie“ ist dort zweimal zu finden, aber beide Male als wörtliche Belegstellen, die Eucken nicht zustimmend zitiert. (Es ist einmal der Economist von 1942 und weiter eine Stelle aus Keynes‘ „Ende des Laissez-Faire“) Reichlich Eintragungen finden sich dagegen unter ‚Staat‘ und ‚Rechtsstaat‘. Beides wird aber nie mit der Demokratie in Verbindung gebracht wird. Dies ist beachtenswert. Denn bei Grundsätzen der Wirtschaftspolitik ist doch zu klären, wer die Entscheidungen trifft und wie sie legitimiert sind. Auch Müller-Armack kann nicht als Symbolfigur für Demokratie durchgehen. Seine Schrift „Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neuen Reich“ vom Sommer 1933 – das Hakenkreuz auf dem Umschlag der Broschüre ist nicht zu übersehen – verherrlicht vorbehaltlos den deutschen Faschismus. Allenfalls lassen sich einige Bedenken zur Wirtschaftsplanung der neuen Regierung herauslesen. Dennoch war Müller-Armack nicht zwingend ein überzeugter Faschist, auch wenn er 1933 der NSDAP beigetreten ist. Man wird ihm wohl eher gerecht, wenn man ihn als Opportunisten versteht. Diese Schrift und seine Mitgliedschaft in der Partei allerdings mögen mit dazu beigetragen haben, dass er 1934 vom Privatdozenten an der Universität Köln zum außerordentlichen Professor aufrückte und 1940 ordentlicher Professor für Nationalökonomie und Kultursoziologie an der Universität Münster wurde. Nach 1945 „gab er sich“, wie die Biographen bemerken, „religionssoziologischen Studien hin“. In seiner Schrift „Das Jahrhundert ohne Gott. Zur Kultursoziologie unserer Zeit“ (Münster 1948) unternimmt er eine religionssoziologische Deutung des Nationalsozialismus. Dieser sei eine Ersatzreligion in einer Zeit des Glaubensabfalls. 1952 wurde Müller-Armack dann Leiter der Grundsatzabteilung im Wirtschaftsministerium unter Erhard. Auch Erhard hat etwas eigentümliche Vorstellungen zur Organisation der Gesellschaft. Die zweite Phase der Sozialen Marktwirtschaft sollte die „formierte Gesellschaft“ sein. Dies war seine Reaktion auf die Entwicklung in den 60er Jahren: Die autoritäre Nachkriegsrestauration des AdenauerStaates wurde zunehmend in Frage gestellt. Mehr Demokratie wagen! – das war die Parole von Willy Brandts SPD. Im Wahlkampf 1965 engagierten sich eine Reihe von Schriftstellern für die SPD, so Schallück, Rühmkorf, Hey, Lenz, Jens, Richter, Eggebrecht, Wellershoff, Hochhuth, Weiss, Grass. Erhard war entrüstet: „Ich muß diese Dichter nennen, was sie sind: Banausen und Nichtskönner, die über Dinge urteilen, von denen sie einfach nichts verstehen (…). Es gibt einen gewissen Intellektualismus, der in Idiotie umschlägt (…). Alles, was sie sagen, ist dummes Zeug.“ „Da hört bei mir der Dichter auf, und es fängt der ganz kleine Pinscher an, der in dümmster Weise kläfft.“[38] Ernst Bloch hat das so kommentiert: „Die Sprache des Bundeskanzlers hat sich bis zur Kenntlichkeit verändert.“ (In der Tat: Adenauer soll gesagt haben, dass für ihn eine Diskussion mit Erhard ebenso schwierig sei, wie einen Pudding an die Wand zu nageln.) Müller-Armack und Erhard haben die Herausbildung dieser Opposition als Auflösung der Gesellschaft begriffen. Die Ursache für den Verlust von Stabilität sieht Müller-Armack in einer „beispiellosen industriellen Expansion,“ einer „durcheinandergeschüttelten demokratischen Gesellschaft,“ im „Abbau der traditionellen Bindungen an die heimatliche Scholle.“[39] Die neue Integrationsformel sollte offenbar in einer „zweiten Phase der Sozialen Marktwirtschaft“ die „formierte Gesellschaft“ werden. Erhard hat diesen Begriff 1965 lanciert. Einige Zitate können skizzieren, was Erhards Anliegen war. „Die Gesellschaft ist nicht hinreichend befriedet und integriert, d.h. formiert.“[40] Der bestehende „antagonistische Gruppenegoismus“ ist durch „strukturierten, organischen Pluralismus“ zu überwinden. Ziel ist „Ordnungspluralismus“, die „Wirtschaftsverfassung“ ist „sozial temperierter Kapitalismus.“[41] „Die deutsche Gesellschaft von heute ist keine Klassengesellschaft mehr.“ Damit ist das Trennende beseitigt. Aber es bleibt Unbehagen, das „im Positiven (…) den Wunsch (ausdrückt) nach einer Stabilisierung der Lebensordnung und zugleich einer sinnvoll gegliederten Gesellschaft (…), die dem Einzelnen und der Gemeinschaft ein Gefühl der Geborgenheit geben (…)“[42] Die Voraussetzungen für eine „neue kulturelle und zivilisatorische Höhe unseres Staates und unseres Volkes“ sind zu bereiten. „Wir müssen vielmehr wieder dazu kommen, mehr auf das Ganze zu schauen(…), nicht nur auf das individuelle Sein, sondern auf das Volk, auf die Nation, auf die umfassenden Formen der Gemeinschaft und der Gesellung im Leben(…)“[43] „Die großen Organisationen (…) haben sich bewußt unter die Autorität des Staates gestellt. Die Gruppen des Volkes haben sich in der Gemeinschaft des Volkes formiert.“[44] Nachdem Erhard wiederholt feststellt, dass der „Streik bei uns unpopulär“ [45] ist, schließt er folgerichtig: „Die gewerkschaftliche Lohnpolitik und das Verhalten der Unternehmer verdienen die Aufmerksamkeit des ganzen Volkes. Dessen gesundes Urteil und seine Meinung werden immer mehr zu einem nützlichen Regulativ und tragen dazu bei, die Durchsetzung einseitiger Interessen einfach nicht mehr zuzulassen.“[46] Nun, die formierte Gesellschaft ist nicht mehr „von sozialen Kämpfen geschüttelt und von kulturellen Konflikten zerrissen (…), ihrem wahren Wesen nach ist sie vielmehr kooperativ; das Ergebnis ist ein vitales Verhältnis zwischen sozialer Stabilität und wirtschaftlicher Dynamik.“[47] Diese Gesellschaft bedarf „eines höheren Bewußtseins ihrer Einheit und ihres Leistungswillens“.[48] Was genau ist unter diesen vielen, bombastischen, dahingeworfenen Begriffen, unter dieser Politikasterlyrik genau zu verstehen? All das wiederholt sich in der ein oder anderen Weise, in den Regierungserklärungen Merkels[49] in den Erweckungsrufen der Kampagne „Du bist Deutschland.“[50] Wenn sich die Linke auch auf die Soziale Marktwirtschaft beruft, wird es schwer, sie von den anderen Parteien zu unterscheiden – auch wenn sie die echte und wahre Soziale Marktwirtschaft vertreten will. [1] Hierzu eingehender: Deutscher Bundestag und Bundesarchiv (Hrsg.), Der Parlamentarische Rat 1948-1949. Akten und Protokolle. [2] Alfred Müller-Armack, Die wissenschaftlichen Ursprünge der Sozialen Marktwirtschaft (1973). In: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern und Stuttgart 1981, S.181 f. [3] Die Zukunft gestalten. Grundsatzprogramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes Beschlossen auf dem 5. Außerordentlichen Bundeskongreß am 13.-16. November 1996 in Dresden, Abschnitt II.5 [4] 5. Außerordentlicher Bundeskongress des DGB in Dresden, 13.-16.11.1996, Protokoll, S. 381. [5] Michael Sommer, Neue Verfassung, großer Schritt für Europa, Pressemitteilung des DGB vom 29.10.2004 [6] Erklärung des Vorstandes der IG Metall zum „Vertrag über eine Verfassung für Europa“. Frankfurt, 13.12.2004 [7] Alfred Müller-Armack, Der Moralist und der Ökonom. Zur Frage der Humanisierung der Wirtschaft (1969), in: derselbe, Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern und Stuttgart 1981, S. 134 [8] Friedrich August von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Band 3, Landsberg am Lech 1981, S. 117f. Müller-Armack bezieht sich - übrigens häufiger als Eucken - auf Hayek, wobei beide stets volle Übereinstimmung mit Hayek ausdrücken. Soziale Marktwirtschaft ist eben nichts anderes als eine politische Kampfparole des Neoliberalismus [9] Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1975, S. 189f [10] ebenda, S. 192 [11] Müller-Armack, Unser Jahrhundert der Ordnungsexperimente, März 1972, in: Genealogie , a.a.O., S. 144 [12] Müller-Armack, Abhängigkeit und Selbständigkeit in den Wirtschaftsordnungen (1951), in: derselbe, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, Bern und Stuttgart 1976 ... a.a.O., S. 224 [13] Grundsätze …, a.a.O., S. 214 [14] ebenda, S. 323 [15] ebenda [16] ebenda, S. 304. [17] Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, in derselbe, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, Bern und Stuttgart 1976, S. 131f. (Hervorhebung von mir, H.S.) Wagenknecht versteht diesen Satz so, dass, wer Mindestlöhne bekämpfe, „sich dabei nicht mit den Meriten eines sozialen Markwirtschaftlers schmücken“ könne. (Wagenknecht, Freiheit statt Kapitalismus, Frankfurt 2011, S. 19) Wichtig ist zu beachten, dass MüllerArmack an vielen Stellen dieser Schrift ganz im Sinne der Neoklassik den Lohnsatz zum Grenzprodukt der Arbeit in Beziehung setzt. [18] Ludwig Erhard schreibt dazu: „Der Tatbestand der Sozialen Marktwirtschaft ist vielmehr nur dann als voll erfüllt anzusehen, wenn entsprechend der wachsenden Produktivität (…) echte Reallohnsteigerungen möglich werden.“ Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, Köln 2009 (Erstauflage 1957), S. 243. Zu beachten ist unverändert: Erhard befürwortet nicht eine kostenniveauneutrale Lohnpolitik, bei der der Reallohn mit derselben Rate steigt wie die Arbeitsproduktivität und der Lohnanteil am Volkseinkommen sich nicht ändert. Entscheidend ist vielmehr das Grenzprodukt der Arbeit. Und überdies ist zu bedenken: Veröffentlichungen von Politikern fehlt zumeist Stringenz und analytische Klarheit. Oft findet man auf viele Seiten zusamnmengequasselte Plattitüden, wo jeder für sein Interesse etwas finden kann. Das ist auch bei Erhard-Zitaten zu beachten. (Vgl. Wagenknecht, Freiheit statt…, a.a.O. S. 19.) [19] Müller-Armack, Vorschläge zur Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft (1948), in: derselbe, Genealogie, a.a.O., S. 100f [20] derselbe, Der Moralist, a.a.O., S. 133 [21] ebenda, S. 135 [22] derselbe, Die zukünftige Verfassung der Sozialen Marktwirtschaft, in derselbe, Genealogie … a.a.O. S. 192 [23] Claus Matecki, Warum wir vom Kapitalismus reden. Freitag 22.5.2009 [24] Eucken, Grundsätze..., a.a.O. S. 300. [25] ebenda, S. 315 [26] Eucken, Grundsätze..., a.a.O. S. 300. [27] Müller-Armack, Die Zweite Phase der Sozialen Marktwirtschaft. Ihre Ergänzung durch das Leitbild der neuen Gesellschaftspolitik (1960), in: derselbe, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, Bern und Stuttgart 1976, S. 284 [28] Eucken, Grundsätze..., a.a.O. S. 301. [29] ebenda [30] ebenda, S. 293 [31] ebenda, S. 274, ähnlich S.334, vgl. ebenfalls Walter Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie, New York, Heidelberg, Berlin 1989, S. 201 [32] Erhard Kantzenbach: „Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs“, Göttingen 1966, Erich Hoppmann, Wettbewerb als Norm der Wettbewerbspolitik, in: ORDOJahrbuch für Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 18, Stuttgart, New York 1967 [33] Eucken, Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 36, (1932), S. 297-321. [34] ebenda, S. 307. [35] ebenda, S. 314, Hervorhebung im Original [36] ebenda, S. 303 ff. [37] Doch nicht nur, was die Staatsintervention im Bereich von Wirtschaft und Sozialem angeht, ist Eucken der Demokratie gegenüber zutiefst skeptisch: Auch eine rationale Außenpolitik werde wegen der „Demokratisierung der Welt und (der) damit vollzogene(n) Entfesselung dämonischer Gewalten in den Völkern unmöglich." ebenda, S. 319. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan lässt sich so wohl eher nicht deuten. Die Meinungsumfragen zeigen, dass die deutschen „Massen“ den Einsatz mit großer Mehrheit ablehnen. Zum Staatsverständnis vgl. auch Carl Schmitt, Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland, in Carl Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939, 2. Aufl. Berlin 1988, S. 187 (1. Aufl. Hamburg 1940). Schmitt schreibt: „Der heutige Staat [die Weimarer Republik, H. S.] ist total aus Schwäche und Widerstandslosigkeit, aus der Unfähigkeit heraus, dem Ansturm der Parteien und der organisierten Interessen standzuhalten.“ Carl Schmitt, Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland, in Carl Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit WeimarGenf-Versailles 1923-1939, 2. Aufl. Berlin 1988, S. 187 (1. Aufl. Hamburg 1940). Schmitts und Euckens Verständnis vom totalen Staat im Sinne eines schwachen Interventionsstaates nimmt die Theorie der neuen ökonomischen Rechten vom modernen Staat als Gefangenen bzw. als Beute mächtiger Interessengruppen vorweg (die sog. Regulatory–Capture–Theorie der Chicagoer Schule). [38] Ludwig Erhard am 9. Juli 1965. Zitiert nach DER SPIEGEL 30/1965, 21.07.1965 [39] Müller-Armack, Die zweite Phase ..., S. 271 [40] Erhard, Parteitag CDU 1965 [41] Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Die Formierte Gesellschaft, Ludwig Erhards Gedanken zur politischen Ordnung Deutschlands. Reden und Interviews des Bundeskanzlers und bemerkenswerte Stellungnahmen, o.J., S. 4 ff [42] Rede Erhards auf dem 13. Bundesparteitag der CDU am 31.3.1965 in Düsseldorf, Presse- und Informationsamt, S. 11 [43] Erhard, Rede vor der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft am 11.5.1965 in Bad Godesberg, Presse- und Informationsamt, S. 21 [44] Erhard zum Thema „Formierte Gesellschaft“ in der August-Ausgabe 1965 der Zeitschrift EPOCA, Presse- und Informationsamt, S. 30 [45] ebenda, S. 30, desgl. Rede vor dem Aktionstag Soziale Marktwirtschaft, S. 23 [46] Erhard, Rede vor dem 14. CDU-Bundesparteitag am 22.3. 1966 in Bonn, Presse- und Informationsamt, S. 39 [47] Interview mit Erhard am 6.4.1965 mit Klaus Emmerich, WDR, Presse- und Informationsamt, S. 15 [48] Erhard in EPOCA, a.a.O., Presseamt, S. 28 [49] Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 30. 11. 2005, Protokollarische Mitschrift des Deutschen Bundestages. [50] Die Kampagne "Du bist Deutschland" (September 2005 bis Januar 2006) war eine gemeinsame Aktion deutscher Medienunternehmen im Rahmen der Initiative "Partner für Innovation".