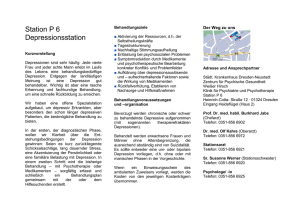Schokolade bei Depression?
Werbung

TITELTHEMA Schokolade bei Depression? Dr. med. Peyman Satrapi RRby_Grace Winter_pixelio Schon seit langer Zeit hören und lesen wir immer wieder, dass der Konsum von Süßigkeiten oder Schokolade gegen Liebeskummer helfen soll. Nicht nur, dass in Filmen und Serien diese Erkenntnis propagiert wird, darauf baut sogar die Werbestrategie eines ganzen Industriezweigs auf. Durch einige Publikationen in den letzten Jahren fühlte man sich in seiner Erwartung bestätigt. Süßigkeiten, insbesondere Schokolade, soll gegen Verstimmungen oder sogar Depression wirksam sein. Diese Evidenz machte in den letzten Jahren in den Print- und Digitalmedien die Runde. Wir wollen nun der Frage nachgehen, was wir tatsächlich aus diesen Studien lernen können und ob und wie Schokolade gegen Depression hilft. Um diese Frage beantworten zu können, sollten wir uns zunächst um den Begriff Depression kümmern. Was verstehen wir Psychiater unter „Depression“? Wie entsteht sie und welche Symptome müssten vorliegen, damit wir diese Diagnose stellen, und wie können wir am besten die Depression behandeln? Depression Unter Depression verstehen wir eine Kombination aus diversen Symptomen mit dem Leitsymptom einer niedergedrückten Stimmung, deutlicher Antriebsminderung, formalen Denkstörungen und vegetativen Beschwerden. Die Patienten klagen über schlechte Stimmung, Lustlosigkeit, ein Empfinden von Gefühllosigkeit, aber auch Ängstlichkeit, übertriebene Sorge um Zukunft und Schuldgefühle. Meistens berichten sie zusätzlich über Gedankenkreisen und Grübeln und können im Kontaktverhalten unkonzentriert und abwesend wirken. Weiterhin klagen fast alle Patienten über diffuse somatische Beschwerden. Einige leiden unter Ein- und Durchschlafstörungen, andere haben einen gesteigerten oder aber auch einen verminderten Appetit. Kopfschmerzen, eine ständige Müdigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden können die Lebensqualität der Patienten deutlich einschränken. Die Depression hat selten ein einheitliches Bild, so dass unterschiedliche Symptomkombinationen die Diagnosestellung erschweren. Wie bei allen psychiatrischen Erkrankungen muss eine organische Ursache zunächst ausgeschlossen werden. Wenn danach immer noch die oben genannten Symptome durchgehend mindestens über zwei Wochen bestehen sollten, kann die Verdachtsdiagnose einer Depression gestellt werden. Die Depression kann in allen Altersstufen auftreten, wobei die Diagnose zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr am häufigsten auftritt. Ein zweiter Erkrankungsgipfel befindet sich bei Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Frauen sind fast doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Erkrankung verläuft meist in Phasen und in der Regel ohne Residualzustände*. Als Ursache für die Entstehung der Depression wird von einer multifaktoriellen Genese ausgegangen. Auf einer Seite stehen die neurobiologischen und auf der anderen Seite die psychosozialen Ursachen. Es gibt ausreichende Hinweise, dass eine genetische Disposition eine Rolle bei der Entstehung der Erkrankung spielt. In diesem Zusammenhang wird ein Mangel an den Botenstoffen Serotonin sowie Noradrenalin diskutiert. Weiterhin könnten Übertragungsstörungen der Botenstoffe, eine gestörte Schlaf- und Wachregulation sowie Einfluss der Stresshormone als mögliche Faktoren benannt werden. 131 І 2012 VFEDaktuell 9 TITELTHEMA Andere Mechanismen, die ebenfalls ihre Rolle bei der Regulation des Affektes und damit der Entstehung einer Depression haben können, sind noch nicht ausreichend erforscht. In diesem Zusammenhang könnte die Rolle der endogenen Cannabinoidrezeptoren genannt werden. Vor einigen Jahren wurde in den USA ein Cannabinoidrezeptorblocker als Medikament zur Gewichtsreduktion zugelassen. Dieses Medikament musste nach wenigen Jahren aufgrund von Nebenwirkungen wie Angstzuständen sowie depressiven Reaktionen und Suizidversuchen vom Markt genommen werden. Somit liegt es nahe, dass neben den oben genannten Botenstoffen auch andere Mechanismen für die Affektregulation wichtig sind und eine Störung dieser Systeme eine depressive Erkrankung begünstigt. Neben den biologischen Ursachen spielen psychosoziale Belastungssituationen wie Verlust des Arbeitsplatzes, die Trauer um nahestehende Personen oder chronische Überlastung eine wesentliche Rolle bei der Entstehung einer Depression. Schwere, chronische somatische Erkrankungen wie Diabetes mellitus führen häufig zur Entstehung einer Depression. Durch viel Aufklärungsarbeit und gezielte Anti-Stigma-Kampagnen konnten Ärzte und Gesellschaft für dieses Thema sensibilisiert werden. So können depressive Patienten besser und schneller erkannt und versorgt werden. Die Erkrankung Depression hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen gesundheitsökonomischen Größe entwickelt. Bereits heute stehen psychische Erkrankungen – allen voran die Depression – an vierter Stelle der Gründe für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Eine jüngst publizierte Kombination von publizierten epidemiologischen Studien durch den European Brain Council (EBC) und das European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) zur Relevanz von psychischen und neurologischen Störungen in Europa (Wittchen et al. 2011, Gustavsson et al. 2011) zeigte, dass die Belastungen durch psychische und neurologische Erkrankungen bisher massiv unterschätzt wurden. Im Berichtsjahr waren demnach 38 Prozent aller Einwohner der EU (plus Schweiz, Norwegen, Island) an einer klinisch bedeutsamen psychischen Störung erkrankt. 10 VFEDaktuell 131 І 2012 RRQuelle: Rheinisches Ärzteblatt 9/2009 Nach Angststörungen mit 14 Prozent stehen die unipolaren Depressionen mit sieben Prozent an zweiter Stelle der in der EU am weitesten verbreiteten psychischen Erkrankungen. Ein wichtiger Aspekt der Depression ist die Möglichkeit, dass bei einer Nichtoder unzureichenden Behandlung die Erkrankung im Rahmen eines Suizides tödlich enden kann. Allein in NRW haben sich 2010 insgesamt 1816 Menschen (466 Frauen, 1350 Männer) selbst getötet. Die Suizidrate – das ist der Anteil der Bevölkerung, der durch Selbsttötung stirbt – lag im Jahr 2010 bei durchschnittlich 10,2 Suizidopfern pro 100 000 Einwohner. Die Suizidrate bei Männern liegt dreimal so hoch wie bei Frauen. Therapie Trotz Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung und möglichem tragischen Ende einer depressiven Erkrankung lautet die gute Nachricht, dass die Depression sich gut behandeln lässt. Es stehen diverse Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Patienten erfolgreich therapieren zu können. Unter Berücksichtigung des Schweregrads der Erkrankung und der Leitsymptomatik, kann aus einer großen Auswahl auf das optimale Antidepressivum zugegriffen werden. Fast niemand nimmt gerne Medikamente ein, daher muss die Verordnung der Medikation immer unter Berücksichtigung einer Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. Es gibt wohl kein Medikament, das keine Nebenwirkungen aufweist, somit sollten Antidepressiva dann eingesetzt werden, wenn der Nutzen der Einnahme deutlich das Nebenwirkungsprofil übersteigt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass bei Einnahme von Antidepressiva keine Abhängigkeit entsteht und keine Toleranzentwicklung zu verzeichnen ist. Als zweite wichtige Säule der Behandlung ist die Psychotherapie zu erwähnen. Im Hinblick auf die psychosozialen Ursachen bei der Entstehung von Depressionen sollte immer eine begleitende, unterstützende und aufklärende Psychotherapie stattfinden. Weiterhin kommen Interventionen wie Schlafentzugstherapie, Lichttherapie und Elektrokonvulsionstherapie erfolgreich zum Einsatz. Schokolade Auch die Ernährung spielt bei Depression eine Rolle. Zum einen kann eine Appetitminderung oder auch eine Appetitsteigerung ein Symptom einer depressiven Erkrankung sein. Weiterhin können wenige Antidepressiva als Nebenwirkung zu Heißhungerattacken führen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ernährung und Stimmung. Folgend drei Schlussfolgerungen, die gezogen werden können (Benton et al. 1992): Die Aufnahme von Kohlenhydraten führt zu einer Stimmungsaufhellung. Schlechte Stimmung führt zu vermehrtem Konsum von „Comfort Food“. Ein Mangel an Spurenelementen sowie Vitaminen führt zu einer Stimmungsverschlechterung. Die Schlussfolgerung, dass Kohlenhydrate zu einer Stimmungsaufhellung führen, TITELTHEMA basiert auf der Wurtman-Hypothese. Sie besagt, dass eine vermehrte Kohlehydrataufnahme zu erhöhter Insulinausschüttung führt. Insulin würde wiederum eine vermehrte Aufnahme von Tryptophan (eine Vorstufe von Serotonin) in die Nervenzellen veranlassen. Damit wären die Nervenzellen in der Lage mehr Serotonin produzieren zu können. Die zweite Schlussfolgerung stammt aus der Essverhaltensforschung. Bei der Klärung der Frage, wie beziehungsweise welches neurologische Korrelat das Essverhalten regulieren würde, gab es deutliche Hinweise, dass die körpereigenen Endorphine für genau diese Regulation zuständig sein sollten. Verhaltensbeobachtungen und Befragungen zeigten, dass Menschen, die unter einer schlechten Stimmung oder zunehmendem Stress litten, mehr „Comfort food“ aufnahmen als andere. Unter diesem Begriff verstehen wir hochkalorische, aber auch leicht zugängliche Nahrungsmittel. Schlussendlich zeigten Menschen mit isoliertem Thiamin- beziehungsweise Eisenmangel ebenfalls depressive Symptomatik, so dass ein Einfluss dieser Substanzen auf die Stimmung nicht zu ignorieren ist. Das kalifornische Forscherteam um Natalie Rose untersuchte im Rahmen einer Patientenbefragung den direkten Zusammenhang zwischen Stimmung und Schokoladenkonsum. Dabei wurden 1018 Erwachsene (694 Männer und 324 Frauen) aus San Diego, Kalifornien, die nicht an Diabetes mellitus oder einer Herzerkrankung litten, untersucht. 931 der Probanden nahmen zum Zeitpunkt der Befragung keine Antidepressiva ein. Neben der Auskunft über ihren Schokoladenkonsum mussten diese Teilnehmer einen Standardtest für Depressionssymptome absolvieren (CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale). Das Ergebnis zeigte, dass die Probanden, die am meisten Schokolade aßen (11,8 Tafeln pro Monat), auch die höchste Punktzahl auf der Depressionsskala aufwiesen (CES-D score > 22). Eine geringe Depressionsneigung (CES-D score >16) korrespondierte mit mittlerem Schokokonsum (8,4 Tafeln monatlich). Am wenigsten Schokolade (5,4 Tafeln pro Monat) verspeisten die Versuchsteilnehmer ohne Depressionsmerkmale. Weiterhin konnte kein signifikanter Unterschied beim Schokoladenkonsum zwischen Frauen und Männern festgestellt werden. Diese veröffentlichten Daten sorgten weltweit für Aufsehen, da sie die landläufige Vermutung, dass Menschen dann zu Schokolade griffen, wenn sie sich „deprimiert“ fühlten, nun bestätigte. Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse sehr plausibel. Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, dass die Probanden, die bei der Befragung auf der Depressionsskala keine Depression aufwiesen, bereits viel Schokolade zu konsumieren scheinen. Weiterhin wird nicht ersichtlich, ob der Schokoladenkonsum zeitlich mit der Depression in Zusammenhang steht. Nun könnte man sogar spekulieren, ob der Konsum der Schokolade nicht eine Depression hervorrufen kann. * Ein Residualzustand ist eine nachhaltige Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Leistungsfähigkeit nach einer Krankheit, z.B. Aufmerksamkeitsstörungen nach Abklingen einer schizophrenen Episode (Psychose, Schizophrenie). Take home message Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn solche Erkrankungen wie Depression sich durch richtiges beziehungsweise gesundes Essen vermeiden oder therapieren ließen. Depression ist eine ernsthafte Erkrankung und kann unterschiedliche Ursachen haben. Sie führt meist zu Niedergeschlagenheit, Antriebsminderung und diversen somatischen Beschwerden. Ohne eine adäquate Behandlung kann Depression sogar zum Suizid führen. Das frühzeitige Erkennen und Behandeln der Depression verringert das Risiko einer Chronifizierung. Die moderne Medizin bietet den Menschen, die an einer Depression leiden, gute Therapieoptionen. Durch medikamentöse und psychotherapeutische Behandlungsformen kann die Depression effektiv behandelt werden. Schokolade scheint über unser Belohnungssystem Einfluss auf unsere Emotionen zu haben. Der Wirkmechanismus ist jedoch nicht endgültig geklärt. Unklar bleibt aber auch, welchen Einfluss die Schokolade auf die Krankheit hat. Fest steht jedoch, dass ein ausgewogenes Essen die Lebensfreude, die Gesundheit und damit die Lebensqualität fördert. Benton D. et al.: The effects of nutrients on mood. Public Health Nutrition, 1999 Sep; 2(3A): 403-9 Rose et al.: Mood food: chocolate and depressive symptoms in a cross-sectional analysis. Archives of internal medicine, 2010 Apr 26; 170(8): 699-703 Schneider: Facharztwissen, Psychiatrie und Psychotherapie, Springer Verlang Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology 2011; 21: 655–79 131 І 2012 VFEDaktuell 11