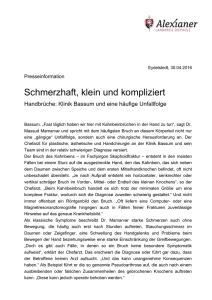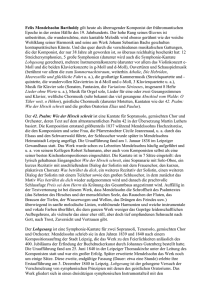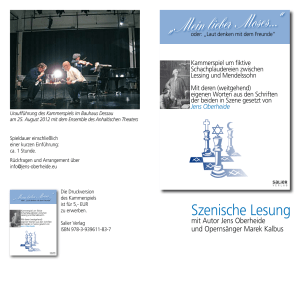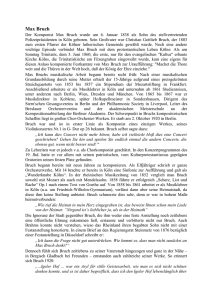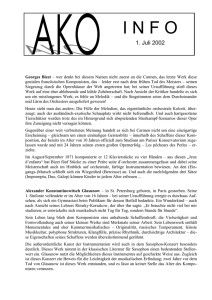„Moses“ von Max Bruch… - beim Bodensee
Werbung
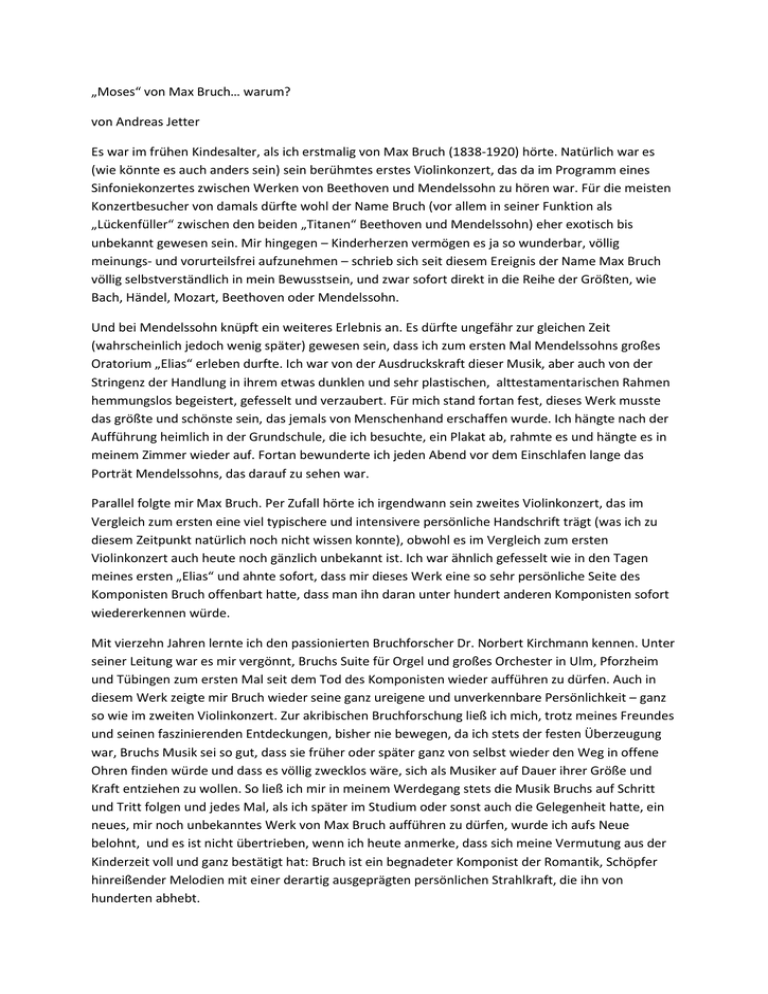
„Moses“ von Max Bruch… warum? von Andreas Jetter Es war im frühen Kindesalter, als ich erstmalig von Max Bruch (1838-1920) hörte. Natürlich war es (wie könnte es auch anders sein) sein berühmtes erstes Violinkonzert, das da im Programm eines Sinfoniekonzertes zwischen Werken von Beethoven und Mendelssohn zu hören war. Für die meisten Konzertbesucher von damals dürfte wohl der Name Bruch (vor allem in seiner Funktion als „Lückenfüller“ zwischen den beiden „Titanen“ Beethoven und Mendelssohn) eher exotisch bis unbekannt gewesen sein. Mir hingegen – Kinderherzen vermögen es ja so wunderbar, völlig meinungs- und vorurteilsfrei aufzunehmen – schrieb sich seit diesem Ereignis der Name Max Bruch völlig selbstverständlich in mein Bewusstsein, und zwar sofort direkt in die Reihe der Größten, wie Bach, Händel, Mozart, Beethoven oder Mendelssohn. Und bei Mendelssohn knüpft ein weiteres Erlebnis an. Es dürfte ungefähr zur gleichen Zeit (wahrscheinlich jedoch wenig später) gewesen sein, dass ich zum ersten Mal Mendelssohns großes Oratorium „Elias“ erleben durfte. Ich war von der Ausdruckskraft dieser Musik, aber auch von der Stringenz der Handlung in ihrem etwas dunklen und sehr plastischen, alttestamentarischen Rahmen hemmungslos begeistert, gefesselt und verzaubert. Für mich stand fortan fest, dieses Werk musste das größte und schönste sein, das jemals von Menschenhand erschaffen wurde. Ich hängte nach der Aufführung heimlich in der Grundschule, die ich besuchte, ein Plakat ab, rahmte es und hängte es in meinem Zimmer wieder auf. Fortan bewunderte ich jeden Abend vor dem Einschlafen lange das Porträt Mendelssohns, das darauf zu sehen war. Parallel folgte mir Max Bruch. Per Zufall hörte ich irgendwann sein zweites Violinkonzert, das im Vergleich zum ersten eine viel typischere und intensivere persönliche Handschrift trägt (was ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen konnte), obwohl es im Vergleich zum ersten Violinkonzert auch heute noch gänzlich unbekannt ist. Ich war ähnlich gefesselt wie in den Tagen meines ersten „Elias“ und ahnte sofort, dass mir dieses Werk eine so sehr persönliche Seite des Komponisten Bruch offenbart hatte, dass man ihn daran unter hundert anderen Komponisten sofort wiedererkennen würde. Mit vierzehn Jahren lernte ich den passionierten Bruchforscher Dr. Norbert Kirchmann kennen. Unter seiner Leitung war es mir vergönnt, Bruchs Suite für Orgel und großes Orchester in Ulm, Pforzheim und Tübingen zum ersten Mal seit dem Tod des Komponisten wieder aufführen zu dürfen. Auch in diesem Werk zeigte mir Bruch wieder seine ganz ureigene und unverkennbare Persönlichkeit – ganz so wie im zweiten Violinkonzert. Zur akribischen Bruchforschung ließ ich mich, trotz meines Freundes und seinen faszinierenden Entdeckungen, bisher nie bewegen, da ich stets der festen Überzeugung war, Bruchs Musik sei so gut, dass sie früher oder später ganz von selbst wieder den Weg in offene Ohren finden würde und dass es völlig zwecklos wäre, sich als Musiker auf Dauer ihrer Größe und Kraft entziehen zu wollen. So ließ ich mir in meinem Werdegang stets die Musik Bruchs auf Schritt und Tritt folgen und jedes Mal, als ich später im Studium oder sonst auch die Gelegenheit hatte, ein neues, mir noch unbekanntes Werk von Max Bruch aufführen zu dürfen, wurde ich aufs Neue belohnt, und es ist nicht übertrieben, wenn ich heute anmerke, dass sich meine Vermutung aus der Kinderzeit voll und ganz bestätigt hat: Bruch ist ein begnadeter Komponist der Romantik, Schöpfer hinreißender Melodien mit einer derartig ausgeprägten persönlichen Strahlkraft, die ihn von hunderten abhebt. Im Studium fiel mir in einer Bibliothek erstmalig Bruchs „Moses“ in die Hand. Beim Durchsehen fand ich die typischen Themen in Kombination mit dem unverwechselbaren Personalstil des Komponisten sozusagen in komprimierter Form vor und ich ahnte, dass es sich bei diesem Oratorium um eines der Schlüsselwerke Bruchs handeln müsse. Schlagartig kam mir wieder Mendelssohns „Elias“ (und seine umwerfende Wirkung aus meinen Kindertagen) in den Sinn. Und natürlich die damals noch recht verbreitete musikwissenschaftliche These, es hätte aufgrund der Entwicklung der neudeutschen Schule nach Mendelssohns „Elias“ kein weiteres romantisches Kirchenoratorium gegeben, das in Perfektion, Stringenz der Handlung und Schlüssigkeit der Komposition an Mendelssohn anzuknüpfen vermocht hätte. Seit ich Bruchs „Moses“ das erste Mal in der Hand hielt, bin ich der Überzeugung – doch, es gibt dieses Werk. Und der Wunsch erwachte, es aufzuführen und es der Vergessenheit zu entreißen. Seit dem Erwachen dieses Wunsches ist nun wieder viel Zeit vergangen, und ich habe seine Verwirklichung niemals mit Kraft vorangetrieben. Bruchs „Moses“ wurde vor allem in den letzten zehn Jahren immer wieder aufgeführt und vermochte es – wo auch immer – spielend, Zuhörer und Rezensenten in seinen Bann zu ziehen. Und wie bereits von mir in Jugendjahren erwartet: diese Musik findet tatsächlich wie von selbst ihren Weg zurück in die Reihe der ganz Großen, zurück in die Konzerthallen der Welt. Dass „Moses“ immer noch im Vergleich zum „Elias“ oder anderen romantischen Oratorien eher selten aufgeführt wird, dürfte wahrscheinlich an den immensen Anforderungen an alle Mitwirkenden sowie in der außergewöhnlich großen Besetzung liegen – das Werk ist wirklich schwer. Für die Hörer ist es jedoch ein wahres Feuerwerk feinster, exquisitester Musik, wie sie hinreißender nicht sein könnte. Dass nun, sozusagen als Einstandskonzert zu meiner neuen Position als Dirigent des BodenseeMadrigalchores, die Aufführung von Max Bruchs „Moses“ auch für mich persönlich Wirklichkeit zu werden scheint, erfüllt mich mit einer tiefen, inneren Freude.