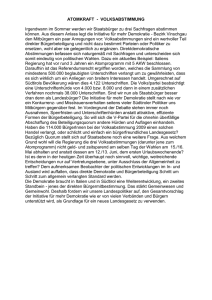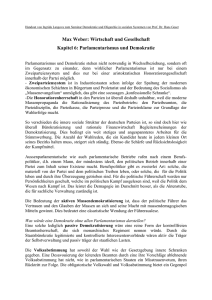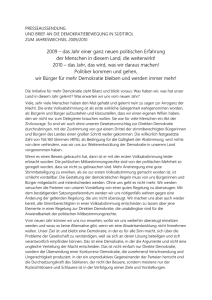PRO DIREKTE DEMOKRATIE CONTRA DIREKTE DEMOKRATIE
Werbung

ZUSAMMEN-LEBEN ZUSAMMEN-LEBEN 03/2012 bruno PRO DIREKTE DEMOKRATIE D ie Debatte um mehr direkte Demokratie gleicht dem berühmten „Steh-auf-Manderl“. Diskutieren, fallen lassen und zu gegebener Zeit wieder aufnehmen. Dann tauschen GegnerInnen und BefürworterInnen ihre Standpunkte aus. Teils mit haarsträubender Sachkenntnis der Faktenlagen und flachen Argumenten. Und das Ergebnis? Bis dato hat sich nichts verändert. D abei hätte mehr direkte Demokratie einen entscheidenden Vorteil: Gesetze können mitgestaltet werden. Derzeit werden die WählerInnen in der Regel alle fünf Jahre aufgefordert, über die Zusammensetzung des Nationalrates, des Landtages oder des Gemeinderates zu befinden. Man entscheidet sich für eine Partei bzw. für deren Wahlprogramm. Diese Festlegung hat dann mehrere Jahre Gültigkeit. Damit endet aber auch die Entscheidung über die politischen Weichenstellungen der nahen Zukunft. Bin ich mit meiner Partei unzufrieden, stehe ich spätestens beim nächsten Wahltermin vor einem Dilemma: Soll mein Kreuzerl zur Konkurrenz wandern? Soll ich tatsächlich mein Vertrauen einer anderen Partei schenken, obwohl ich vielleicht nur mit einzelnen Punkten unzufrieden war? Das ist das Dilemma der repräsentativen Demokratie: Sie verlangt eine Kosten-Nutzen-Analyse. Wie viele 18 konträre Standpunkte darf eine Partei einnehmen und/oder umsetzen, bevor der/die bisherige Wähler/in einen Wechsel vornimmt? Welche Themen sind mir wichtig, welche sehr wichtig? Hier kann die direkte Demokratie Abhilfe schaffen. Sie ermöglicht es, auch während der Legislaturperiode seine Meinung mittels Abstimmung deutlich zu artikulieren. Die WählerInnen haben die Möglichkeit, Entscheidungen der Volksvertretung zu korrigieren oder über einen neuen Gesetzesvorschlag direkt abzustimmen. D as österreichische System direkter Demokratie (Volksbegehren, Volksabstimmung) leidet an einem schweren Geburtsfehler: Ob eine verbindliche Volksabstimmung angesetzt wird, liegt in der Hand der Volksvertretung. Sie entscheidet darüber mit einfacher Mehrheit. Nachdem in der Regel die Parlamentsmehrheit gleichgerichtet mit der Regierung ist, liegt auch der oben erwähnte Geburtsfehler auf der Hand: Die Regierungsparteien werden sich tunlichst davor hüten, strittige Themen direkt einer Volksabstimmung zu unterziehen. Ähnlich verkorkst ist die Lage bei den Volksbegehren. Zwar können 100.000 Wahlberechtigte das Parlament zwingen, einen vorformulierten Gesetzestext gleichwertig wie eine Regierungsvorlage zu behandeln, CONTRA DIREKTE DEMOKRATIE damit endet die direkte Demokratie aber bereits wieder. Es obliegt wiederum der Parlamentsmehrheit, den Vorschlag der BürgerInnen in ein Gesetz zu gießen oder eine Volksabstimmung anzusetzen. E in Vorschlag für den Ausbau direkter Demokratie könnte wie folgt aussehen. Erstens: Eine Volksabstimmung muss verpflichtend durchgeführt werden, wenn mindestens 10 % der Wahlberechtigten eine entsprechende Petition unterstützen. Auf Basis der letzten Nationalratswahlen wären das gut 630.000 UnterstützerInnen. Zweitens: Das Ergebnis der Abstimmung ist bindend, wenn die Wahlbeteiligung mehr als 40 % beträgt. Mit dieser Klausel ließe sich auch das Argument der GegnerInnen entkräften, dass eine kleine Minderheit der Bevölkerung den Gesetzgebungsprozess beeinflussen könnte. Aber das Parlament verliert das alleinige Recht, nach Gutdünken per Mehrheit eine Volksabstimmung über Themen oder Gesetzesvorlagen anzusetzen. Somit wird verhindert, dass die Regierungsmehrheit willkürlich auswählen kann, über was abgestimmt werden soll. Denn direkte Demokratie soll von den BürgerInnen ausgehen, und nicht vom Parlament. In diesem Sinne: Mehr Demokratie wagen. D irekte Demokratie ist in aller Munde; sie scheint zum Allheilmittel gegen politische Blockaden geworden zu sein. Doch so schön ein Mehr an demokratischer Mitbestimmung mittels Volksabstimmungen auch sein mag, geht es doch völlig am Ziel vorbei, damit die Politik(er)verdrossenheit in der österreichischen Bevölkerung bekämpfen zu wollen. In einer repräsentativen Demokratie werden MandatarInnen auf Zeit gewählt, um Entscheidungen zu treffen und gegebenenfalls auch für unpopuläre Maßnahmen einzustehen. Gewiss, für grundsatzpolitische Entscheidungen wie EU-Beitritt, Atomkraft oder die Wehrpflicht gab bzw. gibt es auch in Österreich Volksabstimmungen – unsere Verfassung sieht ja mit Volksbegehren, Volksbefragung und Volksabstimmung explizit drei derartige Instrumentarien vor. Bezeichnend dabei, dass die Abstimmung über die Wehrpflicht im Jänner 2013 die erste „Volksbefragung“ 20 Jahre nach ihrer gesetzlichen Einführung ist. I n seltener Einigkeit diskutierten in den vergangenen Wochen die fünf Parlamentsparteien über einen Automatismus, bei dem Volksbegehren (ab Erreichen einer bestimmten Unterschriftengrenze) automatisch ein entsprechendes bindendes Plebiszit nach sich ziehen. Dass damit das Parlament bei der Gesetzgebung völlig umgangen werden kann, wurde meist unter den Teppich gekehrt. Abgesehen davon, dass ein derartiger Automatismus eine Gesamtänderung der österreichischen Bundesverfassung darstellen würde, der seinerseits zuerst mit einer verpflichtenden Volksabstimmung wie beim EU-Beitritt Österreichs legitimiert werden müsste, ist dieser Vorschlag grundsätzlich abzulehnen. Komplexe politische Herausforderungen können in den seltensten Fällen einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden; mit Emotionen kann nicht über ernste Themen abgestimmt werden. Versachlichung ist gerade in Österreich mit seinen rechtspopulistischen Parteien FPÖ und BZÖ mehr als schwierig. Hätten wir dieses Instrumentarium bereits in der Vergangenheit gehabt, Demagogen wie Jörg Haider hätten mit Hilfe des Boulevards wohl das eine oder andere Abstimmungsergebnis mit massiven Nachteilen für unser Land erreicht: Ein per Plebiszit erreichter „Zuwanderungsstopp“ wäre wider jede ökonomische Vernunft wohl ebenso wahrscheinlich gewesen wie ein Nein zu Eurozone oder Schengener Abkommen, ein Veto gegen den EU-Beitritt Tschechiens (Temelín) oder ein noch schärferes Asylund Fremdenrecht. Abstimmungsergebnisse, die gerade für Minderheiten ohne Wahlrecht massive Nachteile mit sich brächten. M ehr Demokratie wagen“ im Brandt‘schen Sinn ja, aber das bedeutet nicht automatisch mehr direkte Demokratie. Es sollte vielmehr eine Aufwertung des Parlamentarismus und der gewählten MandatarInnen bedeuten. In Deutschland beispielsweise vergibt jede/r Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl zwei Stimmen: mit einer wird ein/e Mandatar/in aus dem jeweiligen Wahlkreis, mit der anderen wird – wie bei uns – eine der kandidierenden Listen (Parteien) gewählt. Eine Aufwertung der Direktmandate im Nationalrat würde auch in Österreich den Parlamentarismus stärken und gleichzeitig die Abhängigkeiten einzelner MandatarInnen von ihrer Partei reduzieren. Auch über einen „dreistufigen Volksentscheid“, wie er in einigen deutschen Bundesländern bereits praktiziert wird, sollte ernsthaft nachgedacht werden. Ein Modell, das auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer favorisiert. Eine der wenigen übrigens, die die derzeit diskutierten Vorschlägen auch öffentlich kritisch hinterfragt. Zu Recht. 19