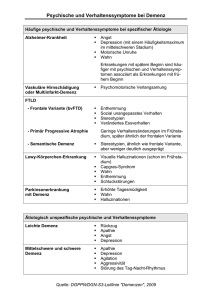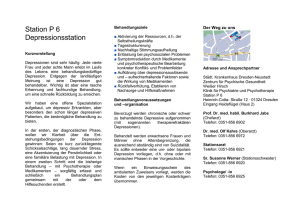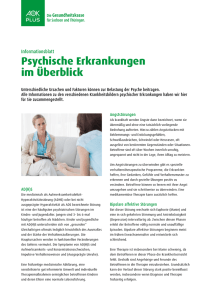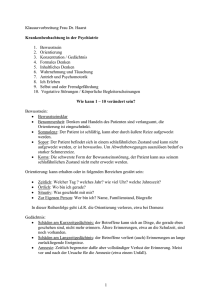Band 23 Ausgabe 1 / 2009
Werbung

Titelmotiv_Heft 23_1.qxd:Umschlag_1-2007_5.0.qxd 02.03.2009 21:43 Uhr Seite 1 Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt – B 20695 F – Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle – Bajuwarenring 4 – D-82041 Deisenhofen – Oberhaching Wissenschaftliches Organ der pro mente austria, ÖAG, ÖGBE, ÖGKJP, ÖSG This journal is indexed in Current Contents / Science Citation Index / MEDLINE / Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Stationäre Rehabilitation Demenz & Musik Dopaminagonisten & Depression Angehörigenrunde Postpartale Dysphorie Online-Diskussionforum Pupillometrie & Demenz Rivastigmin Pflaster Psychose & Philosophie ISSN 0948-6259 23/1 Band 23 Nummer 1 – 2009 Editorial Volume 23 Number 1 – 2009 1 Stationäre Rehabilitation versus gemeindenahe psychiatrische Rehabilitation – Überlegungen zur Indikationsfrage E. M. Haberfellner Übersicht Editorial Indication for inpatients vs ­ outpatient rehabilitation – considera­tions E. M. Haberfellner 4 Demenz und Musik M. Kerer, J. Marksteiner, H. Hinterhuber, G. Mazzola, R. Steinberg, E. M. Weiss Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Review Dementia and music M. Kerer, J. Marksteiner, H. Hinterhuber, G. Mazzola, R. Steinberg, E. M. Weiss Zeitungsgründer Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression N. Clausius, Ch. Born, H. Grunze 15 The relevance of dopamine agonists in the treatment of depression N. Clausius, Ch. Born, H. Grunze 1 09 Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Originalarbeit 26 Nutzung der Angehörigenrunde I. Sibitz, B. Schrank, M. Amering Original Utilisation of a group for relatives I. Sibitz, B. Schrank, M. Amering Die Bedingungsvariablen der postpartalen Dysphorie M. Complojer, H. Schweigkofler, J. Schwitzer, A. Scherer, G. O. Schwitzer, W. Schiefenhövel 35 The preconditions of postpartum Dysphoria M. Complojer, H. Schweigkofler, J. Schwitzer, A. Scherer, G. O. Schwitzer, W. Schiefenhövel Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige – eine Untersuchung zu Motiven und Auswirkungen der Teilnahme A. Blume, R. Mergl, N. Niedermeier, J. Kunz, T. Pfeiffer-Gerschel, S. Karch, I. Havers, U. Hegerl 42 Evaluation of an online discussion forum for depressive patients and their relatives – an examination focus­sing motives and effects of participation A. Blume, R. Mergl, N. Niedermeier, J. Kunz, T. Pfeiffer-Gerschel, S. Karch, I. Havers, U. Hegerl Der Rezeptortest bei der Pupillometrie als Methode zur Differenzierung des dementiellen Syndroms J. Grünberger, W. Prause, P. Frottier, H. Stöhr, B. Saletu, M. Haushofer, M. Rainer 52 The pupillary response test as a method to differentiate various types of dementia J. Grünberger, W. Prause, P. Frottier, H. Stöhr, B. Saletu, M. Haushofer, M. Rainer Ullrich Meise, Innsbruck Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Dustri-Verlag Dr. Karl Karl Feistle Feistle http://www.durstri.de http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 0948-6259 ISSN I Bericht 58 Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich: eine naturalistische Studie an 103 PatientInnen mit Alzheimer Demenz R. Schmidt, C. Alf, Ch. Bancher, Th. Benke, K. Berek, P. Dal-Bianco, G. Führwürth, D. Imarhiagbe, Ch. Jagsch, A. Lechner, M. Rainer, F. Reisecker, J. Rotaru, M. Uranüs, A. Walter, A. Winkler, A. Wuschitz Kritisches Essay Psychose im Diskurs der zeitgenössischen Philosophie Th. Stompe, K. Ritter Report Transdermal Rivastigmine Patch in Outpatient Services in Austria: a Naturalistic Study in 103 Patients with Alzheimer Dementia R. Schmidt, C. Alf, Ch. Bancher, Th. Benke, K. Berek, P. Dal-Bianco, G. Führwürth, D. Imarhiagbe, Ch. Jagsch, A. Lechner, M. Rainer, F. Reisecker, J. Rotaru, M. Uranüs, A. Walter, A. Winkler, A. Wuschitz 64 Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Critical Essay The discourse of psychosis in contemporary philosophy Th. Stompe, K. Ritter Zeitungsgründer 1 09 Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Dustri-Verlag Dr. Karl Karl Feistle Feistle http://www.durstri.de http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 0948-6259 ISSN II Zeitungsgründer Franz Gerstenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Herausgeber Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck (geschäftsführend) Johannes Wancata, Wien Wissenschaftlicher Beirat Hans Förstl, München Andreas Heinz, Berlin Wulf Rössler, Zürich Christian Bancher, Horn Ernst Berger, Wien Karl Dantendorfer, Wien Max Friedrich, Wien Armand Hausmann, Innsbruck Hans Rittmannsberger, Linz Christian Simhandl, Neunkirchen Reinhold Schmidt, Graz Werner Schöny, Linz Erweiterter wissenschaftlicher Beirat Josef Aldenhoff, Kiel Michaela Amering, Wien Jules Angst, Zürich Wilfried Biebl, Innsbruck Peter Falkai, Göttingen Wolfgang Gaebel, Düsseldorf Verena Günther, Innsbruck Reinhard Haller, Frastanz Ulrich Hegerl, Leipzig Isabella Heuser, Berlin Florian Holsboer, München Christian Humpel, Innsbruck Kurt Jellinger, Wien Hans Peter Kapfhammer, Graz Siegfried Kasper, Wien Heinz Katschnig, Wien Ilse Kryspin-Exner, Wien Wolfgang Maier, Bonn Karl Mann, Mannheim Josef Marksteiner, Klagenfurt Hans-Jürgen Möller, München Heidi Möller, Kassel Franz Müller-Spahn, Basel Thomas Penzel, Berlin Walter Pieringer, Graz Anita Riecher-Rössler, Basel Peter Riederer, Würzburg Wolfgang Rutz, Uppsala Hans-Joachim Salize, Mannheim Alois Saria, Innsbruck Norman Sartorius, Genf Heinrich Sauer, Jena Gerhard Schüssler, Innsbruck Gernot Sonneck, Wien Marianne Springer-Kremser, Wien Thomas Stompe, Wien Gabriela Stoppe, Basel Hubert Sulzenbacher, Innsbruck Hans Georg Zapotoczky, Graz Redaktionsadresse Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-236 16, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected] Produktion in Lizenz durch VIP-Verlag Integrative Psychiatrie Innsbruck Anton-Rauch-Straße 8 c, A-6020 Innsbruck, Email: [email protected] www.vip-verlag.com – Tel. +43 (0) 664 / 38 19 488 Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Postfach 1351, © 2008 Jörg Feistle. D-82032 München-Deisenhofen, Verlag: Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle. Tel. +49 (0) 89 61 38 61-0, Telefax +49 (0) 89 6 13 54 12 ISSN 0948-6259 Email: [email protected] Regulary indexed in Current Contents/Science Citation Index/MEDLINE/Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medical Abstract Journals and PSYNDEX Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht das Ver­lagsrecht für alle Sprachen und Länder einschließlich des Rechts der photomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfäl­ tigung an den Verlag über. benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen wird vom Verlag keine Gewähr übernommen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Die Neuro­ psychiatrie erscheint vierteljährlich. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß sol­che Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu be­trachten wären und daher von jedermann Bezugspreis jährlich € 84,–. Preis des Einzelheftes € 23,– zusätzlich € 6,– Versandgebühr, inkl. Mehrwertsteuer. Einbanddecken sind lieferbar. Bezug durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis 4 Wochen vor Jahresende erfolgt. Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 IIII Hinweise für AutorInnen: Sämtliche Manuskripte unterliegen der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtung durch Schriftleitung und Reviewer. Allgemeines: Bitte die Texte unformatiert im Flattersatz (Ausnahme: Überschrift und Zwischenüberschriften, Hervorhebungen) und keine Trennungen verwenden! Manuskripte – verfasst im Word – sind am besten per Email an die Redaktion (Adresse ­siehe ­unten) zu übermitteln. Sie können auch elektronisch auf CD oder Diskette an die Redaktions­adresse ­gesandt werden. Die Zahl der Abbildungen und Tabellen sollte sich auf maximal 5 beschränken. Manuskriptgestaltung: • Länge der Arbeiten: - Übersichtsarbeiten: bis ca. 50.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Originalarbeiten: bis ca. 35.000 Zeichen inkl. Leerzeichen - Kasuistiken, Berichte, Editorials: bis ca. 12.000 Zeichen inkl. Leerzeichen • Titelseite: (erste Manuskriptseite) - Titel der Arbeit: - Namen der Autoren (vollständiger Vorname vorangestellt) - Klinik(en) oder Institution(en), an denen die Autoren tätig sind - Anschrift des federführenden Autors (inkl. Email-Adresse) • Zusammenfassung: (zweite Manuskriptseite) - Sollte 15 Schreibmaschinenzeilen nicht übersteigen - Gliederung nach: Anliegen; Methode; Ergebnisse; Schlussfolgerungen; - Schlüsselwörter (mindestens 3) gesondert angeben • Titel und Abstract in englischer Sprache (3. Manuskriptseite) - Kann ausführlicher als die deutsche Zusammenfassung sein - Gliederung nach: Objective; Methods; Results; Conclusions - Keywords: (mindestens 3) gesondert angeben • Text: (ab 4. Manuskriptseite) Für wissenschaftliche Texte Gliederung wenn möglich in Einleitung, Material und Methode, Ergebnisse, Diskussion, evtl. Schlussfolgerungen, evtl. Danksagung, evtl. Interessenskonflikt • Literaturverzeichnis: (mit eigener Manuskriptseite beginnen) - Literaturangaben sollen auf etwas 20 grundlegende Werke und Übersichtsarbeiten beschränkt werden. Das Literaturverzeichnis soll nach Autoren alphabetisch geordnet werden und fortlaufend mit arabischen Zahlen, die in [eckige Klammern] gestellt sind, nummeriert sein. - Im Text die Verweiszahlen in [eckiger Klammer] an der entsprechenden Stelle einfügen. Beispiele: Arbeiten, die in Zeitschriften erschienen sind: [1] Rittmannsberger H., Sonnleitner W., Kölbl J., Schöny W.: Plan und Wirklichkeit in der ­psychiatrischen Versorgung. Ergebnisse der Linzer Wohnplatzerhebung. Neuropsychiatr 15, 5-9 (2001). (Abkürzung Neuropsychiatr) Bücher: [2] Hinterhuber H., Fleischhacker W.: Lehrbuch der Psychiatrie. Thieme, Stuttgart 1997. Beiträge in Büchern: [3] Albers M.: Kosten und Nutzen der tagesklinischen Behandlung. In: Eikelmann B., Reker T., Albers M.: Die psychiatrische Tagesklinik. Thieme, Stuttgart 1999. • Abbildungen und Tabellen: (jeweils auf eigener Manuskriptseite - Jede Abbildung und jede Tabelle sollte mit einer kurzen Legende versehen sein. - Verwendete Abkürzungen und Zeichen sollten erklärt werden. - Die Platzierung von Abbildungen und Tabellen sollte im Text durch eine Anmerkung markiert werden („etwa hier Abbildung 1 einfügen“). - Abbildungen und Grafiken sollten als separate Dateien gespeichert werden und nicht in den Text eingebunden werden! - Folgende Dateiformate können verwendet werden: Für Farb-/Graustufenabbildungen: .tiff, .jpg, (Auflösung: 300 dpi); für Grafiken/Strichabbildungen (Auflösung: 800 dpi) Psychiatrie, Psychotherapie, Public Mental Health und Sozialpsychiatrie Zeitungsgründer Franz Gestenbrand, Innsbruck Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Kornelius Kryspin-Exner † Redaktion Hartmann Hinterhuber, Innsbruck Ullrich Meise, Innsbruck Wissenschaftliches Organ • pro mente austria Dachverband der Sozialpsy chiatrischen Gesellschaften • Österreichische Alzheimer Gesellschaft • Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen • Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugend psychiatrie • Österreichische Schizophrenie­gesellschaft Ethische Aspekte: Vergewissern Sie sich bitte, dass bei allen Untersuchungen, in die Patienten involviert sind, die Grundsätze der zuständigen Ethikkommissionen oder der Deklarationen von Helsinki 1975 (1983) beachtet worden sind. Besteht ein Interessenskonflikt gemäß den Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors, muss dieser gesondert am Ende des Artikels ausgewiesen werden. Korrekturabzüge: Nach Anfertigung des Satzes erhält der verantwortliche Autor einen Fahnenabzug des Artikels elektronisch als pdf-Datei übermittelt. Die auf Druckfehler und sachliche Fehler durchgesehenen Korrekturfahnen sollten auf dem Postweg an die Verlagsadresse zurückgesandt werden. Manuskript-Einreichung: Redaktion: Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Innsbruck, Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck, Telefon: +43-512-504-236 68, Fax: +43-512-504-23628, Email: [email protected] Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http//:www.dustri.de ISSN 0948-6259 IV Editorial Editorial Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 1–3 Stationäre Rehabilitation versus gemeindenahe psychiatrische Rehabilitation – Überlegungen zur Indikationsfrage Egon Michael Haberfellner Rehabilitationszentrum für psychische Gesundheit „Sonnenpark“, Bad Hall, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg Indication for inpatients vs outpatient rehabilitation – considera­ tions Zusätzlich zu den schon seit langem verfügbaren sozialpsychiatrischen Rehabilitationsmöglichkeiten wurde in den letzten Jahren in Österreich die psychiatrische Rehabilitationslandschaft um Einrichtungen zur „medizinischen Rehabilitation“ erweitert. Durch diese Entwicklung stellt sich verstärkt die Frage nach den Indikationen und den Zielgruppen für die unterschiedlichen Interventionen der psychiatrischen Rehabilitation. Es besteht das Risiko, dass die Auswahl der Rehabilitationsmaßnahmen nicht durch die Bedürfnisse der Patienten bestimmt wird, sondern durch die Zugangswege. Ärzte der Pensionsversicherung können z.B. direkt zur medizinischen Rehabilitation zuweisen, haben aber keine Möglichkeit, direkt die Behandlung oder Betreuung in sozialpsychiatrischen Einrichtungen zu veranlassen – auch wenn das indiziert wäre. © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Zur geschichtlichen Entwicklung Die vielfältigen sozialpsychiatrischen Rehabilitationsangebote haben sich in Zusammenhang mit der Enthospitalisierung psychiatrischer Langzeitpatienten entwickelt [4, 5, 8]. Patienten, die in psychiatrischen Großkrankenhäusern zentralisiert untergebracht waren, sollten in ihren Heimatgemeinden reintegriert werden. Durch ambulante Behandlungs- und Betreuungsangebote sollten regressive Entwicklungen und Entwurzelung, die mit der Langzeitunterbringung in Großinstitutionen verbunden waren, verhindert werden. Sozialpsychiatrische Rehabilitation wird daher überwiegend gemeindenah angeboten und hat das Ziel, Menschen mit schwerwiegenden, chronisch verlaufenden psychischen Erkrankungen („severe mental illness“) [9] auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Auch wenn sozialpsychiatrische Rehabilitation darauf abzielt, Patienten trotz schwer wiegender Einschränkungen zu einer selbständigen Lebensweise zurück zu führen, sind diese Unterstützungsmaßnahmen grundsätzlich langfristig angelegt und haben auch „prothetische“ Funktion. Medizinische Rehabilitation bei psychiatrischen Erkrankungen ist hingegen in der Tradition der „Rehabilitationsmedizin“ groß geworden. Medizinische Rehabilitation hat sich in den letzten Jahrzehnten parallel zur Akutmedizin entwickelt und wird traditionell als stationäre Rehabilitation in Rehabilitationszentren angeboten. Diese Tradition ist durchaus verständlich, wenn man an neurologische Anschlussheilverfahren nach Schlaganfall oder an orthopädische Anschlussheilverfahren nach Gelenksersatz denkt. In diesen Indikationen ist der Pflegebedarf hoch und die Mobilität der Patienten ist meistens eingeschränkt. Das Argument der eingeschränkten Mobilität ist in psychiatrischen Indikationen nur selten relevant. Lang anhaltende Inaktivität und eingeschränkte Mobilität psychiatrischer Patienten sind oft nicht Ausdruck der Erkrankung an sich sondern dysfunktionaler Bewältigungsstrategien. Soziales Rückzugsverhalten oder phobisches Vermeidungsverhalten können nicht positiv beeinflusst werden, indem die Aktivitäten des täglichen Lebens vom Pflegepersonal übernommen werden, sondern durch Aktivierung. Da Pflege und Betreuung rund um die Uhr nicht erforderlich sind, kann Medizinische Rehabilitation in psychiatrischen Indikationen grundsätzlich auch ambulant angeboten werden. Andererseits stoßen ambulante medizinische Rehabilitationsangebote an Grenzen, weil komplexe Therapieangebote mit mehreren Therapieeinheiten pro Tag durch verschiedene Professionen bei dezentraler Organisation schwierig organisierbar sind. Die Entwicklung Haberfellner in Richtung ambulanter medizinischer Rehabilitation im Sinn tagesklinischer Angebote wurde in Österreich bisher erst in einigen Indikationen (z.B. kardiologische Rehabilitation) begonnen. In psychiatrischen Indikationen befindet sich die ambulante medizinische Rehabilitation im Projektstadium. Zur Situation in Deutschland In Deutschland entwickelte sich die medizinische Rehabilitation in psychiatrischen Indikationen unter dem Begriff „psychosomatische Rehabilitation“. Ausgehend von einer sehr weit gefassten Definition der Psychosomatik werden alle psychiatrischen Erkrankungen außer Psychosen zum Indikationsspektrum gezählt. Die „psychosomatische Rehabilitation“ definiert sich weniger über bestimmte Diagnosegruppen, sondern durch die Art des Behandlungsangebots, bei dem psychotherapeutischen Angeboten ein besonderer Stellenwert zukommt [1]. Die beiden Hauptrichtungen psychiatrischer Rehabilitation – nämlich die sozialpsychiatrische und die psychosomatische Rehabilitation sind in Deutschland ideologisch, inhaltlich und konzeptionell weit auseinandergedriftet. Zur Indikationsfrage: Ambulant oder stationär Unter dem Eindruck der Enthospitalisierungsprogramme der letzten Jahrzehnte und des gemeindepsychiatrischen Grundsatzes „ambulant vor stationär“ werden von manchen Fachleuten stationäre Rehabilitationsangebote grundsätzlich abgelehnt. Das Argument, dass stationäre Rehabilitation regelmäßig zu Regression führt, trifft für Rehabilitationsprogramme, die mit einigen Wochen zeitlich klar limitiert sind, nicht zu. Strukturierte, dichte Therapieange- bote wirken der Regression entgegen. Auch der Kontakt zur Familie und zu Freunden geht in 4 bis 8 Wochen nicht verloren. Die Diskussion „ambulant oder stationär“ wird dadurch kompliziert, dass die Rehabilitationszentren, in denen medizinische Rehabilitation angeboten wird, zum Teil den sanitätsrechtlichen Status einer Sonderkrankenanstalt haben, zum Teil den eines „Ambulatoriums mit angeschlossenem Hotelbetrieb“. Diese Ambulatorien sind nicht als „echte Ambulanzen“ zu sehen und entsprechen nicht dem Grundsatz der gemeindenahen Psychiatrie „ambulant vor stationär“, weil die Patienten die Nächtigungsmöglichkeit in Anspruch nehmen müssen und nicht die Möglichkeit haben, zuhause zu übernachten. Diese Ambulatorien haben Vorteile gegenüber einer Sonderkrankenanstalt, weil die sanitätsrechtlichen Vorschriften nur auf den Therapiebetrieb angewandt werden müssen. Das kommt den Zielen psychiatrischer Rehabilitation – Förderung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung – entgegen. Die Indikationen für sozialpsychiatrische Rehabilitation einerseits und medizinische Rehabilitation andererseits ergeben sich nicht aus der diagnostischen Einordnung in eine diagnostische Kategorie des ICD-10, sondern aus den funktionellen Einschränkun- gen, der Rehabilitationsprognose und dem sich daraus ergebenden Behandlungs- bzw. Betreuungsbedarf. Von Hesse wurde die IREPRO-Indikatorenliste entwickelt [3], eine strukturierte Hilfe, die die Einschätzung der Rehabilitationsprognose und die Entscheidung begutachtender Ärzte erleichtert. Manchmal entsteht der Eindruck, dass die Indikationen für stationäre Rehabilitation zu wenig bekannt sind (Tabelle 1) [2, 10]. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ hat im Indikationskatalog durchaus einen hohen Stellenwert, wird aber in der Praxis nicht immer realisiert. Nicht selten nehmen Patienten vor Beginn einer stationären Rehabilitationsmaßnahme keine adäquate psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung in Anspruch. Patienten mit schweren und chronisch verlaufenden psychischen Störungen sind primär die Zielgruppe für gemeindenahe sozialpsychiatrische Rehabilitation. Klar ist, dass Patienten mit „severe mental illness“ nur zum Teil von zeitlich befristeten Rehabilitationsangeboten wie der medizinischen Rehabilitation profitieren können und in einem dichten therapeutischen Programm auch durch Überforderung gefährdet sind. Wenn es sich um chronische Krankheitsverläufe handelt, sollte jede Rehabilitationsmaßnahme in einen langfristigen Berufs- und Erwerbsfähigkeit ist gefährdet Mit ambulanten Therapiemöglichkeiten wurde der gewünschte Erfolg nicht erreicht Ein intensives, multimodales Therapieprogramm ist indiziert Vorübergehende Distanzierung vom häuslichen oder beruflichen Umfeld ist therapeutisch sinnvoll Ambulante Therapiemöglichkeiten sind im Lebensumfeld des Patienten nicht verfügbar Eine ambulante Therapie ist wegen chronischen Funktionseinschränkungen (z.B. somatischen Comorbiditäten, phobisches Vermeidungsverhalten) nicht realisierbar Tabelle 1:Indikationen für stationäre Rehabilitation [6, 10] Stationäre Rehabilitation versus gemeindenahe psychiatrische Rehabilitation – Überlegungen zur Indikationsfrage Literatur wohnortferne Rehabilitation wohnortnahe Rehabilitation Distanz von häuslichen Problemen Fortbestehende Beziehung zum eigenen Lebensumfeld Neuorientierung in neuer Umgebung Neuorientierung in vertrauter Umgebung Ungestörtes therapeutisches Milieu Einbeziehung von Familie oder Arbeitgeber bzw. Kollegen in die Therapie Städte und Landschaften mit Erholungswert Entdecken von Ressourcen im eigenen Lebensumfeld Erleichterung der Herstellung einer Patientenkooperation bei passiven Behandlungserwartungen von Rehabilitanden Nutzung einer primär hohen Therapiemotivation Fokussierung des Patienten auf sein eigenes Erleben Aufmerksamkeitslenkung des Patienten auf Veränderungen in seinem täglichen Leben Tabelle 2:Vorteile wohnortferner und wohnortnaher Rehabilitation [7] Rehabilitationsplan eingebettet sein. Umgekehrt können durch sozialpsychiatrische Angebote nicht die Bedürfnisse aller Patienten abgedeckt werden. In vielen Fällen kann eine zeitlich begrenzte Rehabilitationsmaßnahme mit einem intensiven Therapieprogramm ausreichen, einen Patienten soweit zu stabilisieren, dass er wieder sein selbständiges Leben in Angriff nehmen kann. Die Grundfrage ist, ob den Bedürfnissen des Patienten langfristige Unterstützung und Betreuung in der Gemeinde eher entspricht, oder ein komplexes und intensives Rehabilitationsprogramm. Diese Frage ist aber nicht immer mit entweder / oder zu beantworten. In bestimmten Krankheitsphasen kann das Eine sinnvoll sein, in anderen Phasen das Andere. Zum Beispiel kann medizinische Rehabilitation eine Maßnahme der beruflichen Rehabilitation vorbereiten. Medizinische Rehabilitation und sozialpsychiatrische Rehabilitation sollten nicht als Gegensätze gesehen werden. Wichtig wäre es daher, in Österreich das Auseinanderdriften der verschiedenen Rehabilitationsmöglichkeiten zu verhindern und vorurteilsfrei die Vor- und Nachteile ambulanter und stationärer Rehabilitationsangebote abzuwägen (Tabelle 2) [7, 10]. [1] Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Hrsg.): Rahmenempfehlungen zur ambulanten Rehabilitation bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. http://www.bar-frankfurt. de/upload/Rahmenempfehlung_psychische_Erkrankungen_145.pdf 2004 [2] Haberfellner E.M., Schöny W., Platz T., Meise U.: Evaluationsergebnisse Medizinischer Rehabilitation für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen - ein neues Modell im komplexen psychiatrischen Leistungsangebot. Neuropsychiatr 20:215-218 (2006) [3] Hesse B., Gebauer E., Heuft E.: Die IREPRO-Indikatorenliste – eine Arbeitshilfe zur systematischen Beurteilung von Rehabilitationsbedürftigkeit und Rehabilitationsprognose in der psychiatrischen Rentenbegutachtung. Rehabilitation 46, 24-32 (2007) [4] Hinterhuber H., Rutz W., Meise U.: Psychische Gesundheit und Gesellschaft. „… Politik ist nichts anderes als Medicin im Großen.“ Neuropsychiatr 21,180-186 (2007) [5] Hinterhuber H., Meise U.: Keine moderne Psychiatrie ohne Sozialpsychiatrie. Neuropsychiatr 22, 148-152 (2008) [6] Janssen P.L., Franz M., Herzog T., Heuft G., Paar G., Schneider W. (Hrsg.): Psychotherapeutische Medizin. Standortbestimmung zur Differenzierung der Versorgung psychisch und psychosomatisch Kranker. Schattauer, Stuttgart 1999 [7] Linden M., Lind A., Fuhrmann B., Irle H.: Wohnortnahe Rehabilitation. Rehabilitation 44, 82-89 (2005) [8] Meise U., Wancata J., Hinterhuber H.: Psychiatrische Versorgung in Österreich: Rückblick – Entwicklungen – Ausblick.. Neuropsychiatr 22, 243-251 (2008) [9] Ruggieri M., Thornicroft G., Bisoffi G., Tansella M.: Definition and prevalence of severe and persistent mental illness. Br J Psychiatry 177, 149-155 (2000) [10] Schmeling-Kludas C.: Fachliche und rechtliche Aspekte zur Abgrenzung einer Krankenhausbehandlung im Gebiet “Psychotherapeutische Medizin” von der psychosomatischen Rehabilitation. Psychother Psychosom med Psychol 49, 312-315 (1999) Priv.-Doz. Prim. Dr. Egon Michael Haberfellner Rehabilitationszentrum für psychosoziale Gesundheit „Sonnenpark“ Pro Mente Oberösterreich [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 4–14 Demenz und Musik Manuela Kerer1, Josef Marksteiner1, 2, Hartmann Hinterhuber1, Guerino Mazzola3, Reinhard Steinberg4 und Elisabeth M. Weiss1 Medizinische Universität Innsbruck, Abteilung für Allgemeine Psychiatrie Landeskrankenhaus Klagenfurt, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 3 CLA University of Minnesota 4 Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie, Universität Mainz 1 2 Schlüsselwörter Musik – Demenz – Gehirn – Gedächtnis für Musik – Musik im Alter – Musikwahrnehmung – Musiktherapie Key words Music – dementia – brain – memory for music – music in old age – cognition for music – music-therapy Demenz und Musik Menschen, die an einer Demenzerkrankung leiden und einen großen Teil ihres Gedächtnisses verloren haben, sind vielfach nichts desto trotz noch in der Lage, außergewöhnliche musikalische Leistungen zu erbringen. Sie können beispielsweise Musik aus den frühen Jahren ihres Lebens wieder erkennen oder Text und Melodie vierstrophiger Lieder singen. Dabei beobachten Musiktherapeuten und Altenpfleger die große Zufriedenheit demenzerkrankter Menschen, wenn sie in der Musik ein Stück ihrer Vergangenheit oder Identität wieder finden. Mit der Hilfe von musikalischen Parametern können sie ihre soziale Isolation verlassen und psychomotorische Unruhe, Weinen, aber auch aggressives Verhalten verringern. Dabei aktiviert Musik unser © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Gehirn auf unterschiedlichste Weise, regt das Gedächtnis an und ist der Sprache durchaus ähnlich. Doch auf die Frage, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Musik-Erlebnisse sich so sehr einprägen können, kann bis heute nicht bis ins letzte geantwortet werden. Zwar gehen einige Fallstudien darauf ein, doch befindet sich die experimentelle Erforschung der Auswirkung einer Demenzerkrankung auf musikalische Fähigkeiten oder das musikalische Gedächtnis noch in ihrem Anfangsstadium. Dementia and music Patients suffering from dementia are nevertheless still able to render exceptional musical performances. For example, they can recognize music from childhood and reproduce lyrics and melodies of songs with four verses. Furthermore, behavioural symptoms such as psycho- motor agitation and crying, but also aggressive behaviour can be positively influenced by music and motivation and positive emotions can be increased. A variety of physiological and psychological changes occur when patients are listening to music. Previous research could show that music activated different parts of the brain especially in the temporal cortex, but also motoric areas in the frontal cortex, thalamus and cerebellum were essential for rhythm, melody and harmony perception and processing. Music therapy is an interpersonal process in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals with various psychiatric or medical conditions. However, until now only little research has been directed towards non-pharmacological treatments like music therapy in dementia patients. Further research is warranted to investigate the long term influence of music therapy on patients suffering from dementia. Musik im Gehirn Lokalisation Musizieren oder Musik hören ist eine hoch differenzierte Tätigkeit und umso spannender erweist sich der Versuch einer Annäherung an die Frage, wie Musik unser Gehirn aktiviert. Olof Dahlin, königlicher Bibliothekar in Stockholm, berichtete schon 1745 von einem Mann, der an einer Lähmung der gesamten rechten Körperseite und einem daraus resultierenden kompletten Verlust der Sprache litt. Obwohl dieser Mann unfähig war, auch nur ein Wort außer „ja“ zu Demenz und Musik sagen, konnte er so manche Hymne, die er vor seiner Erkrankung gelernt hatte, klar und deutlich singen [50]. Dieser Fallbericht weist auf eine besondere Beteiligung der rechten Hemisphäre für Musik hin, weshalb Forscher lange davon ausgingen, dass es ein Musikzentrum in der rechten Hemisphäre geben müsse. Unterstützt wurde diese Annahme zunächst durch die Untersuchung der Lateralisierung musikbezogener Fähigkeiten mittels WADA- Test. Dabei deutlich zeigte sich sehr deutlich, dass bei Ausschaltung der linken Hemisphäre die Patienten noch Melodien singen konnten, jedoch ihre Sprache verloren hatten. Das Umgekehrte trat bei Ausschaltung der rechten Hemisphäre auf, die Patienten konnten noch Dinge benennen, waren aber nicht mehr fähig, einfache Melodien zu singen [7]. Ergebnisse der neueren Hirnforschung belegen aber, dass Musik die Leistungen beider Hemisphären erfordert. Dabei ergänzen sich Ergebnisse von Läsionsstudien und Studien an gesunden Testpersonen, deren Gehirnaktivität mit bildgebenden Verfahren dargestellt wurde. Wenn der Mensch Musik hört oder ausübt, sind verschiedene Gehirnareale aktiv, auch solche, die sich normalerweise mit anderen kognitiven Aufgaben befassen. Vereinfacht dargestellt könnte man die Aussage treffen, Melodien und Harmonien würden rechtshemisphärisch, Rhythmus und Metrum hingegen linkshemisphärisch verarbeitet. Die Vorstellung von einer diesbezüglich in beiden Hemisphären getrennten Verarbeitung ist sicher reizvoll, aber wäre zu einfach dargestellt. Musizieren beansprucht unterschiedlichste Bereiche im gesamten Gehirn [8]. Nachgewiesen werden konnte eine besonders ausgeprägte Beteiligung temporaler Regionen beider Gehirnhälften an der Verarbeitung von Musik. Diese gehören zu den empfindlichsten Regionen im Hinblick auf vaskuläre Beeinträchtigungen [39]. Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre Artikulation ++++ + Klangfarben ++ +++ Dynamik ++ +++ Tonhöhe ++ +++ Intervalle +++ ++ Konturen ++ +++ Perioden Abhängig von Ausbildung Abhängig von Ausbildung Rhythmen +++ ++ Metren ++ +++ [Musik-] Gedächtnis +? ++++? Emotionen Positiv Negativ Tabelle 1 [nach 4]: Übersicht über die relative Hemisphärenlateralisation unterschiedlicher musi­ kalischer Leistungen Die Kreuze beziehen sich auf die Eindeutigkeit der Zuordnung einer be­stimmten Teil­ leistung zu einer bestimmten Hemisphäre + = geringe Lateralisation; ++ = teilweise Lateralisation; +++ = große Lateralisation; ++++ = sehr große Lateralisation. ? = noch nicht sicher feststehende Hemisphärenlateralisation Abbildung 1 [nach 48]: Das Gehirn beim Musizieren. Dargestellt sind diejenigen Bereiche, die bei bestimmten Tätigkeiten des Musizierens aktiviert werden. Das Gehirn verarbeitet Musik sowohl hierarchisch als auch einzelne Komponenten parallel. In der primären Hörrinde erfolgen die ersten Schritte der Musikerkennung, anschließend werden sekundäre Hörrindenfelder erfasst und andere assoziierte Gebiete, die wahrscheinlich für komplexere Muster von Musik, wie Harmonie, Melodie und Rhythmus zuständig sind, wobei eine der Schaltstellen auf dem Weg zur Hörrinde der Thalamus ist. Beim Musizieren werden unter anderem aber auch das Kleinhirn und die motorische Hirnrinde angeregt. Dabei kann man zwischen der Lokalisation bestimmter musikalischer Parameter durchaus unterscheiden. Kerer, Marksteiner, Hinterhuber, Mazzola, Steinberg, Weiss Melodie- und Zeitintervalle scheinen beispielsweise relativ unabhängig voneinander verarbeitet zu werden, da sich in Läsionsstudien isolierte Defizite für Tonhöhendiskrimination und die Unterscheidung von Zeitintervallen zeigten [41]. Es wird angenommen, dass die Analyse der Kontur einer Melodie (die Teil der Formierung auditorischer Gestalten ist) insbesondere den rechten Gyrus temporalis superior involviert, und dass detailliertere Intervall-Analysen sowohl den posterioren als auch den anterioren Anteil des Gyrus temporalis superior bilateral involvieren [41, 38]. Das Planum temporale wird mit der Verarbeitung von TonhöhenIntervallen sowie von Tonsequenzen in Verbindung gebracht [38]. Gemäß der Theorie des “Mozart-Effekts” steigert das Hören von klassischer Musik, insbesondere von Werken von W. A. Mozart, kognitive Leistungen, wie beispielsweise das räumliche Vorstellungsvermögen. Musikunterricht und aktive Beschäftigung mit Musik stärken kognitive Fähigkeiten in noch höherem Maße und steigern die Intelligenz [44]. Nach den initialen Verarbeitungsstufen wird beim Hören musikalischer Sequenzen eine syntaktische Struktur gebildet. Perzeptuell diskrete Elemente (wie Töne, Intervalle und Akkorde) werden entsprechend syntaktischer Regularitäten zu Sequenzen arrangiert [26, 27]. Bei der Analyse musikalischer Struktur ist das Herstellen von Relationen zwischen strukturellen Elementen komplexer auditorischer Sequenzen nötig, z. B. das Herstellen der Relation einer Akkordfunktion zu einem vorhergegangenen harmonischen Kontext. Ähnliche Operationen existieren wahrscheinlich für die Verarbeitung von Rhythmus und Metrum. Der Verarbeitung musikalischer Syntax scheinen stark automatisierte neuronale Prozesse zugrunde zu liegen, wobei elektrophysiologische Effekte musik-syntaktischer Verarbeitung beobachtet wurden, wenn Versuchsper- sonen ein Buch lasen oder ein VideoSpiel spielten. [26]. Zahlreiche Studien wiesen nach, dass auch Nichtmusiker (Personen ohne formales musikalisches Training) ein sehr genaues implizites Wissen musikalischer Syntax haben [26, 27]. Alltägliche Hörerfahrungen machen dies wahrscheinlich möglich. Plastizität Schon wenig musikalisches Training, musikalische Erfahrung und Betätigung beeinflussen Gehirnbereiche aktiv. In Anbetracht der geringen Zahl an Hörzellen ist dies relativ erstaunlich, denn kein anderes Sinnesorgan benutzt so wenige Sinneszellen wie das Ohr. Während im Auge rund 100 Millionen Lichtrezeptoren sitzen, gibt es nur rund 3500 Haarzellen im Innenohr. Sie genügen aber, damit das Gehirn schon nach kurzen Musikübungen in Zukunft mit musikalischen Eindrücken anders umgeht. Dies zeugt von der Plastizität des auditiven Systems und des gesamten Gehirns beim Rezepieren und Produzieren von Musik. Ein Musiker, der sich tagtäglich mehrere Stunden mit Musik beschäftigt, „verändert“ sein Gehirn [48]. Dies kann so weit gehen, dass der Grad der musikalischen Ausbildung die Hirnlateralisation beim Musikhören beeinflusst. Berufsmusiker zeigen dementsprechend bei analytischen Musikaufgaben eine stärkere linkshemisphärische, Laien eine stärkere rechtshemisphärische Aktivierung. Musikalische Laien verarbeiten Tonhöhen und Melodien in bilateralen, rechtshemisphärisch überwiegend frontotemporal gelegenen Netzwerken. Bei Berufsmusikern sind allerdings linkshemisphärische Netzwerke in stärkerem Ausmaß an Tonhöhenunterscheidung und Akkordwahrnehmung beteiligt [39]. Intensives musikalisches Training führt zu einer Vergrößerung rezeptiver Felder in primären und sekundären auditiven Regionen. Diese Veränderungen sind abhängig vom gespielten Instrument und den jeweiligen musikalischen Erfordernissen [4]. So besitzen Trompeter vergrößerte rezeptive Felder für Trompetenklänge, nicht aber für Klavierklänge. Geiger sind aufgrund der freien Tonhöhenwahl auf der Geige auf eine sehr präzise Tonhöhenwahrnehmung angewiesen. Insgesamt haben beide Gruppen von Musikern mehr Platz für Instrumententöne im Vergleich zu reinen Sinustönen [35]. Eine Untersuchung von professionellen Gitarren- und Geigenspielern ergab des weiteren, dass diese Instrumentalisten eine Vergrößerung des kortikalen somatosensorischen Areals für die Finger der linken Hand aufweisen, da sie Tastempfindungen der linken „Griffhand“ sehr genau verarbeiten müssen. Dieser Effekt war besonders stark ausgeprägt, wenn die Gitarristen, bzw. Geiger vor dem 12. Lebensjahr mit dem Erlernen des Instruments begonnen hatten [48]. Musikalisches Lernen bedeutet Erwerb zusätzlicher mentaler Repräsentationen von Musik. Ungeübte Hörer beispielsweise erleben eine Orchestermusik in der Regel ausschließlich ganzheitlich auditiv. Geschulte Hörer hingegen erkennen Instrumentierung, Strukturen und Stilmerkmale eines Stückes, weil sie über multiple Repräsentationen verfügen. Daneben können sie Musik aber wie ungeübte Hörer ganzheitlich wahrnehmen. Diese verschiedenen mentalen Repräsentationen von Musik werden in unterschiedlichen neuronalen Netzwerken abgelegt [25]. Die Struktur und die Lokalisation der beteiligten neuronalen Netzwerke werden auch von der Art und Weise, wie musikalisches Wissen erworben wurde, beeinflusst. Überwiegend prozedurales musikalisches Handlungslernen durch Musizieren ohne verbale Intervention scheint eher auf rechts frontotemporalen Netzwerken zu beruhen. Dagegen geht der Erwerb von explizitem Faktenwissen über Musik wohl eher auf links frontotemporale Strukturen zurück [4]. Demenz und Musik Musiker, die bei ihrer ersten Unterrichtsstunde jünger als sieben Jahre alt waren, verfügen offenbar auch über einen besseren Informationsaustausch zwischen den Hemisphären. Der Balken ist bei ihnen größer als bei Musikern, die ihr Instrument später erlernt haben. Voraussetzung dafür ist aber das andauernde Üben über Jahre hinweg [8]. Amusie Die Unfähigkeit, trotz intakter Sinnesorgane Tonfolgen zu erkennen und diese vokal oder instrumental wiederzugeben wird mit dem Begriff der Amusie umschrieben. Diese Beeinträchtigung musikalischer Fähigkeiten und des musikalischen Auffassungsvermögens kann als Folge von Hirnläsionen auftreten. [4]. Dabei können die Fähigkeiten, Melodien aufzufassen, zu singen, zu spielen oder Noten zu verstehen beeinträchtigt sein. Im ersten Falle spricht man von einer sensorischen Amusie, im zweiten von einer motorischen Amusie, im letzten von musikalischer Alexie, bzw. „Notenblindheit“. Diese Veränderung musikalischer Fähigkeiten ist oft mit einer sensorischen oder einer motorischen Aphasie kombiniert. Die Amusie ist aber im Gegensatz zu anderen neurologischen Störungsbildern unscharf abgegrenzt. So bezieht sie sich auf jede Beeinträchtigung der Wahrnehmung, des Verstehens, des Erinnerns, des Reproduzierens, des Lesens oder des Spielens von Musik. Amusie ist folglich keine ortsspezifische Ausfallserscheinung [24]. Der wohl bekannteste Fall von Amusie in der Musikgeschichte ist der Komponist Maurice Ravel (18751937). Mit 58 Jahren zerstörte eine Läsion seine linke Großhirnrinde an der Stelle, an der Temporallappen und Parietallappen zusammentreffen [48]. Auch Sigmund Freud litt an Amusie, wobei es sich bei ihm um eine angeborene Musik- Schwäche handelte. Etwa 4 % der Bevölkerung leiden an dieser „Congenital amusia“, die es trotz normaler Intelligenz und Sprachfähigkeit unmöglich macht, ein Instrument zu erlernen, Melodien oder starke Schwankungen der Tonhöhe zu erkennen. Keine Probleme haben die Betroffene dagegen beim Erkennen von alltäglichen Geräuschen, Liedtexten oder menschlichen Stimmen. Vieles deutet darauf hin, dass die Musikschwäche ebenso wie die Legasthenie auf einer Entwicklungsstörung des Gehirns beruht. Defizite können durch maßgeschneiderte Trainingsprogramme und intensive Betreuung verringert werden, mit besten Ergebnissen vor dem siebten Lebensjahr. Ab dem 12. Lebensjahr besteht kaum noch Hoffnung auf Verbesserung [37, 40]. Musik und Sprache “Musik ist sprachähnlich. […] Aber Musik ist nicht Sprache“. Mit diesem Satz sprach der deutsche Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker und Komponist Theodor W. Adorno (1903-1969) [1] einen nach wie vor hoch interessanten Wissenschaftsbereich an. Musik ist der Sprache verwandt im Sinne einer zeitlichen Abfolge artikulierter Laute. Die traditionelle musikalische Formenlehre bezeichnet in Analogie zur Sprache bestimmte musikalische Parameter mit „Satz“, „Halbsatz“, „Periode“, „Interpunktion“, und wohl nicht zufällig verlangt Beethoven den Vortrag einer Bagatelle aus op. 33 „mit einem gewissen sprechenden Ausdruck“. Sprache und Musik artikulieren im rhythmischen Spektrum der Gehirnwellen und nutzen Tonbereiche zur Gestaltung von Vorstellungen und Gefühlen, beide können in eine Schriftform komprimiert werden. Gewisse musikalische Fähigkeiten des Menschen sind eine Voraussetzung für Spracherwerb und Sprachverarbeitung. Säuglinge und Kleinkinder eignen sich beträchtliche Information über Wort- und Phrasengrenzen durch unterschiedliche prosodische Informationen an, d.h. über die musikalischen Aspekte der Sprache wie Sprechmelodie, -metrum, -rhythmus, und -timbre [23]. Die genaue Wahrnehmung von Tonhöhenrelationen ist dabei wichtig für das Verständnis und das Produzieren von Tonsprachen, wobei natürlich auch andere Sprachen eine akkurate prosodische Analyse erfordern, um die Struktur und Bedeutung gesprochener Sprache zu verstehen. Befunde stark überlappender, teilweise identischer neuronaler Ressourcen für die Verarbeitung von Sprache und Musik stärken die Annahme einer engen Verbindung zwischen Sprache und Musik. Für die Syntax ist beispielsweise in beiden Fällen derselbe Bereich der Stirnhirnrinde zuständig [36]. Dabei werden musikalischer und sprachlicher Sinngehalt gleichermaßen ähnlich aber auch verschieden repräsentiert: Beide lösen einen N400 Effekt Abbildung 2 [nach 26]: Ereigniskorrelierte elektrische Hirnpotentiale, die durch semantisch passende (durchgezogene Linie) und unpassende (gepunktete Linie) Wörter evoziert wurden, nach der Darbietung von Sätzen (links) und Musik (rechts). Sowohl in der Sprach-Bedingung, als auch in der Musik-Bedingung, evozierten Wörter, die semantisch nicht zum vorhergehenden Satz oder Musikstück passten, eine sog. N400 Komponente (im Vergleich zu Wörtern, die semantisch zum vorhergehenden Prime-Stimulus passten, Pfeil). Dies zeigt, dass nicht nur sprachliche, sondern auch musikalische Informationen einen systematischen Einfluss auf die semantische Verarbeitung von Wörtern haben können. Kerer, Marksteiner, Hinterhuber, Mazzola, Steinberg, Weiss aus, aktivieren aber verschiedene Teile des rechten Temporallappens [49]. Aussage und einer Frage haben, da sie die finale Tonsteigerung bzw. den finalen Tonfall nicht erkennen [37]. Sprache als spezielle Art von Musik? Man kann davon ausgehen, dass menschliche musikalische Fähigkeiten eine phylogenetische Schlüsselrolle für die Evolution von Sprache spielten. Gemeinschaftliches Musizieren beinhaltet wichtige evolutionäre Funktionen wie Kommunikation, Kooperation, Gruppenkoordination und soziale Kohäsion [54]. Im Hinblick auf die Ontogenese erwerben Kleinkinder Sprache auf Basis prosodischer Information [23]. Musikalische Kommunikation früher Kindheit in Form von beispielsweise Spiel-, Wiegen-, Schlafliedern oder Abzählreimen spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung emotionaler, kognitiver und sozialer Fertigkeiten von Kindern. Deshalb kann angenommen werden, dass eine phylogenetisch betrachtet höchst entwickelte Musikalität eine natürliche und allgemeine Fähigkeit des menschlichen Gehirns ist [27]. Dies legt den Schluss nahe, dass das menschliche Gehirn, zumindest im Kindesalter, Musik und Sprache nicht als separate Domänen versteht, sondern eher Sprache als eine spezielle Art von Musik. Wirkung von Musik auf Sprache Während man im Bereich des „Mozart- Effektes“ positive Auswirkungen des Musikhörens auf verschiedenste kognitive Leistungen nachweisen konnte, weiß man noch verhältnismäßig wenig über die positiven Nebeneffekte des formalen Musiktrainings auf die Sprache oder andere kognitive Effekte. [44]. Läsionsstudien ergaben in diesem Bereich, dass etwa 30% der Amusiker aus britischen und französischkanadischen Bevölkerungen Schwierigkeiten in der Unterscheidung einer Musik und Gedächtnis Im Volksmund spricht man davon, dass „das Ohr das beste Gedächtnis habe“. In der Tat kann eine bestimmte Melodie oder ein Rhythmus in Sekundenschnelle Erinnerungen wach rufen, denn Musik beeinflusst das autobiographische Gedächtnis positiv [2]. So genannte „Ohrwürmer“ können jemanden über Tage hindurch begleiten und wir können oft gar nicht anders, als gewisse Melodien im Kopf weiterzuhören, wobei der gen in der Musik als zusammenhängend wahr, so liegt das nicht daran, dass die gesamte Passage in unserem auditorischen Cortex repräsentiert ist, sondern daran, dass wir Tiefenstrukturen in der Musik entdeckt haben, an die sich unser Gehirn erinnern kann. Es nützt gewissermaßen sein Wissen über musikalische Stile, um gedankliche Töne vorwegzunehmen. Viele Teile des Gehirns sind beteiligt, wenn die neuronalen Schaltkreise aus den Kategorisierungen Erinnerungen und neue Ideen erzeugen. Bestimmte Aspekte sind dabei nach den jeweiligen Sinnesmodalitäten kategorisiert, so spielt der auditorische Cortex bei der Erinnerung an Klänge eine wichtige Rolle [24]. Abbildung 3 [nach 29]: Beim „Rosaroten Panter“ - ein reines Instrumentalstück – wurden weite Bereiche des auditorischen Cortex aktiviert, um das Lied im Kopf weiterzuhören (Bild rechts). Verlängerten die Probanden eine Melodie mit Text gedanklich, mussten sie nur auf die rein assoziativ arbeitenden, „oberflächlichen“ Teile des Gehörzentrums zurückgreifen (Bild links). auditorische Cortex aktiviert bleibt. Allerdings werden verschieden große Areale für das musikalische Gedächtnis aktiviert, je nachdem ob es sich um eine Melodie mit oder ohne Text handelt [29]. Kategorienbildung Das Gehirn „erinnert“ sich, indem es Kategorien bildet und so ist alles Wissen über musikalische Elemente, Techniken, Stile und ganze Musikstücke in einer Hierarchie zusammengefasst. Nehmen wir längere Passa- Thematische musikalische Entwicklungen können nur verfolgt werden, wenn man sowohl ein Gespür für Harmonien als auch ein gutes musikalisches Gedächtnis hat. Andernfalls können Motive nicht über mehrere Takte hinweg verfolgt oder melodische Beziehungen wahrgenommen werden. Auch die Fähigkeit zur Antizipation spielt in diesem Bereich eine wichtige Rolle, denn das Gehirn formuliert Wahrnehmungshypothesen, die es je nachdem bestätigt oder nicht [24]. Demenz und Musik Durch wiederholte Abläufe von Wahrnehmungen werden figurale Repräsentationen als „Bilder“ zeitlicher Abläufe gebildet. Dadurch findet eine Kategorisierung statt, die nicht mehr einzelne Elemente speichert, sondern Bedingungen bereitstellt, um Prozesse in Gang zu setzen. Dies wird durch eine Rekonstruktion früherer Erfahrungen möglich. Gedächtnisinhalte wie „Dur“ oder „Moll“ ergeben sich folglich nicht aus der Speicherung aller Einzelbewegungen oder –töne, die den verschiedenen Musik- Skalen zugeordnet sind, sondern konkretisieren sich in einer allgemeinen Klangvorstellung, die eine Kategorisierung der Einzelphänomene auf einer höheren Repräsentationsstufe darstellt. Es findet dementsprechend keine Eins- zu- eins- Relation zwischen musikalischen Phänomenen und mentalen Repräsentationen statt, sondern es handelt sich um „globale Abbildungen“ mentaler Prozesse, die sich in neuronalen Verschaltungen zwischen Großhirnrinde und anderen Hirnarealen wie z.B. Cerebellum, Hippokampus, Amygdala und Basalganglien selektiv ausgebildet haben [19]. Was für die Entwicklung einer primitiven Tonalität die harmonisch reinsten Intervalle (Oktave, Quint, Quart) vor anderen Distanzen auszeichnet, ist hauptsächlich der Umstand, dass sie sich, einmal „erkannt“, aus der Fülle der ihnen benachbarten Tondistanzen durch ihre größere „Klarheit“ für das musikalische Gedächtnis auffällig herausheben. Wie es im allgemeinen leichter ist, wirkliche als erlogene Erlebnisse und wahre als verworrene Gedanken korrekt im Gedächtnis zu behalten, so gilt das Entsprechende im allgemeinen in der Tat ziemlich weitgehend auch für rational „richtige“ und „falsche“ Intervalle. Tiefen- EEG- Studien ergaben, dass bei Vorgabe eines dissonanten („auflösungsbedürftigen“) Klanges, der auf mehrere Konsonanzen („wohl klingend“) folgt, der linke Hippocampus aktiviert wird. Musik kann den Hippocampus anregen und so helfen, schwer zugängliche Gedächtnisinhalte leichter abzurufen [32, 33, 52]. Beim Üben und Memorieren dieser musikalischen Zusammenhänge können dabei nur Muster motorischer Abläufe eingeübt werden. Es werden aber nicht einzelne Muskelinnervationen gespeichert, die zur Hervorbringung einer musikalischen Passage nötig sind, sondern es findet eine Integration der vielen Einzelabläufe in eine globale Struktur statt. Sie wird als Kategorisierung gemäß rhythmischen, metrischen, melodischen, harmonischen und agogischen Merkmalen gespeichert. Diese globalen motorischen Programme, die noch nicht mit musikalischem Verstehen gleichzusetzen sind, sondern nur die technische Seite musikalischer Reproduktion betreffen, können auch bei pathologischen Veränderungen im Bereich kognitiver Leistungen erhalten bleiben [19]. Das Gedächtnis für Musik kann als Funktion eines heterogenen Systems angesehen werden, dessen Teile sich darin unterscheiden, wie lange sie Informationen halten können. Beispielsweise muss das System für die in Beziehung- Setzung von Tönen Informationen sehr lange aufrechterhalten, während das für das absolute Gehör nicht gilt. Analog dazu muss das System, das für zeitliche Muster zuständig ist, Informationen länger speichern als Systeme, die absolute Werte der zeitlichen Dauer verwalten. Die Verwaltung musikalische Gedächtnisinhalte erfolgt hierarchisch [13]. Verschiedene Formen des Gedächtnisses für Musik Das prozedurale Gedächtnis für Musik kommt zum Einsatz, wenn jemand beispielsweise ein Musikstück auswendig spielt, es ihn an einer Stelle „hinauswirft“ und er dann bei einer früheren Stelle ansetzt und weiterspielt. Der Musiker kann seinem inneren Ohr folgen, d.h. der klanglichen Erinnerung an den Ablauf der melodischen Grundlinie des Stückes. Es kann aber auch eine visuelle Vorstellung des Notentextes geben oder die Finger folgen dem motorischen Gedächtnis, wenn der immer wieder geübte Bewegungsablauf so automatisiert ist, dass die Finger gewissermaßen wissen, was sie zu spielen haben [19]. Um eine Form kategorialen Erinnerns handelt es sich, wenn jemand ein Musikstück oft gehört hat und ihm eine bestimmte Melodie nicht aus dem Kopf geht. Ganz offensichtlich werden bei dieser Form des musikalischen Gedächtnisses nicht bestimmte Zellen im primären auditorischen Cortex aktiviert, sondern die Melodie wird durch neuronale Vorgänge in den synaptischen Schaltkreisen generiert, die auch beim ersten Hören aktiv waren. In diesem Fall ist die Erinnerung also eine Rekonstruktion des Höreindrucks [19]. Eine besondere Form des musikalischen Gedächtnisses stellt das „absolute Gehör“ dar. Dabei geht es um die Fähigkeit, Tonhöhen ohne äußere Referenz benennen und spontan erkennen oder hervorbringen zu können [3]. Das prozedurale Wissen bezieht sich auf motorische Fähigkeiten und einfache musikalische Wahrnehmungsleistungen, im deklarativen Gedächtnis wird das Wissen über diese Sachverhalte als bewusster Inhalt sprachlich gespeichert. Bei musikalischem Lernen unterscheidet man daher begriffliches Wissen über Musik von einem eher prozedural kodierten Wissen und Können von Musik [19]. Genauso wie die Vorstellung einer eindeutigen Lokalisierbarkeit von Gedächtnisinhalten innerhalb des Gehirns oder die Vorstellung eines „Sitzes“ des Gedächtnisses heute als unhaltbar angesehen wird, so kann auch keine eindeutige Zuordnung von musikalischen Gedächtnisfunktionen zu bestimmten Hirnarealen festgestellt werden [25]. Kerer, Marksteiner, Hinterhuber, Mazzola, Steinberg, Weiss Forschungsrichtungen Allgemein können verschiedene Richtungen der musikalischen Gedächtnisforschung beobachtet werden. Es gibt zum einen starkes Interesse daran, die allgemeine Erinnerungsfähigkeit für Musik, v.a. bei musikalischen Laien zu erforschen. Andererseits ist der Bereich des Musiklernens, des Übens und des Musikgedächtnisses ein viel beachteter Zweig. Aber auch das kulturelle Musikgedächtnis im Sinne einer Wahrnehmung von Stilen, Werken etc., der Einfluss von Musik auf Gedächtnis für andere Inhalte und die Entwicklung musikalischer Gedächtnisfähigkeiten stoßen auf vermehrtes Interesse. Kurzzeitgedächtnis für Musik: Normalerweise können etwa sieben Wörter auf einmal gehandhabt und im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden. Um sich längere Abschnitte zu merken, muss man sich eher an die Bedeutung einer kurzen Phrase als an den Klang einzelner Wörter erinnern. Es muss eine ähnliche Beschränkung für unsere Wahrnehmung musikalischer Objekte geben. Fehlt dem Gehirn die nötige Erfahrung, wahrgenommene Töne zu ungefähr sieben Teilen zu reduzieren, kann es das Gehörte nicht mehr zusammenfügen. Das musikalische „Jetzt“ bricht zusammen, es hinterlässt nur Bruchstücke an Verständnis und hauptsächlich Chaos [24]. Beim Kurzzeitgedächtnis ist der auditorische Cortex aktiv, der akustische Wahrnehmungen speichert. Ohne diese Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses wäre man nicht in der Lage, die Teile eines sich entwickelnden musikalischen Satzes zusammenzufügen [24]. Akkorde werden im Gegensatz zu Wörtern, Bildern oder Umweltgeräuschen nicht besser erkannt, wenn sie wiederholt präsentiert werden, da musikalisches Priming eher auf dem Erkennen der Funktion im musikali- schen Kontext als auf einfacher Wiederholung beruht [6]. Es ist noch nicht endgültig geklärt, inwiefern bei musikalischer Verarbeitung auch verbale oder visuell-räumliche Komponenten des Gedächtnisses beteiligt sind oder ob es ein eigenes musikalisches Subsystem dafür gibt. Allerdings scheint die Verarbeitung musikalischer Gedächtnisaufgaben im verbalen Subsystem fraglich. Die Beteiligung visuell- räumlicher Prozesse oder Strukturen kann aber nicht ausgeschlossen werden. Die Störanfälligkeit für Rhythmus- und Melodieaufgaben ist hinsichtlich verbaler oder visuell-räumlicher Sekundäraufgaben gleich stark. Dies spricht nicht für eine getrennte Verarbeitung von Melodie und Rhythmus im Rahmen der zwei Subsysteme verbal-auditiv und visuell-räumlich des Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley (1986). Die Annahme musikalischer Subsysteme wäre hingegen damit 10 kompatibel. [30]. Das Erkennen von Tonhöhen ist hingegen stark beeinträchtigt, wenn zwischen den Stimuli andere Töne eingespielt werden, da das Gedächtnis für Tonhöhen extrem störanfällig und von hoher Spezifität geprägt ist. [11,12]. Probanden, denen vier gesungene Silben vorgespielt wurden, wurden angewiesen, sich entweder die Töne oder die Silben zu merken. Beide Kurzgedächtnisleistungen aktivierten in gleichem Maße ein Netzwerk bestehend aus ventrolateralem prämotorischem Cortex (in das Broca Areal reichend), dorsalem prämotorischem Cortex, Planum Temporale, inferiorem Parietallappen, anteriorer Insula, subcorticaler Strukturen (Basalganglien und Thalamus), sowie Cerebellum. [28]. Abbildung 4: Musikalische Strukturen sind grundsätzlich eng miteinander verflochten. A.: Melodie: Folge von Tönen verschiedener Höhe bzw. Folge von Intervallen, die als Einheit aufgefasst wird. B.: Rhythmus: Ordnung, Gliederung und Gestaltung des zeitlichen Verlaufs von Klangereignissen C.: Harmonik: räumliches Miteinander von Zusammenklängen und Ordnung von Akkordstrukturen im Gegensatz zur linear sich entfaltenden Einzelstimme Demenz und Musik Langzeitgedächtnis für Musik Damit Musik aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden kann, ist wie besprochen wichtig, explizites oder implizites Wissen musikalischer Parameter gespeichert zu haben. Es gestaltet sich aber als äußerst schwierig, die Dominanz eines dieser Parameter bestimmen zu können. Melodie und Rhythmus eines Musikstückes können beispielsweise nur schwer getrennt voneinander untersucht werden. Grundsätzlich ist eine rhythmische Struktur alleine zwar weniger effektiv als melodische Linien, um bekannte Musik aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen, dennoch ist der optimale Zugang zum Widererkennen von Musik eine Kombination aus Melodie und Rhythmus. [22]. Musikalische Auszüge, die als positiv und somit angenehm bewertet werden, werden dabei leichter abgespeichert als unangenehme. Die Bewertung eines Musikstücks scheint ein wichtiger Regulator für das episodische Langzeit- Gedächtnis zu sein. Eine stärkere emotionale Bewertung erleichtert in diesem Zusammenhang sowohl die Speicherung im Gedächtnis als auch den anschließenden Abruf. [14]. Musik im Alter Ein regelmäßiges Training von Kleinund Großhirn, wie es das Musizieren und die Beschäftigung mit Musik darstellen, kann das Gedächtnis langfristig fördern. Es handelt sich wohl um keinen Zufall, dass Pianisten wie Artur Rubinstein oder Vladimir Horowitz in geistiger Frische weit über 80 Jahre alt geworden sind. Folglich kann Musik als „heilende Kunstform“ für ältere Menschen bezeichnet werden, denn sie bringt sowohl mentale als auch physische Stimulation mit sich [47]. 11 Musiktherapie mit menz-Patienten De- Die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (DMG) definiert Musiktherapie u.a. in den „Kasseler Thesen“ als den gezielten Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit. Die Musiktherapie ist eine praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin und steht in enger Wechselwirkung zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen, insbesondere der Medizin, den Gesellschaftswissenschaften, der Psychologie, der Musikwissenschaft und der Pädagogik. Es wird davon ausgegangen, dass Musik eine Artikulation menschlichen Erlebens ist und somit subjektive Bedeutung hat, die sich wiederum in einem Spannungsverhältnis zum gesellschaftlich- kulturellen Kontext befindet. Musik kann in aktiver, aber auch in passiver Form eingesetzt werden. Musik als Mittel zur Kommunikation Besonders für Patienten, deren verbale Kommunikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, erscheinen kreative Verfahren als Therapieformen sinnvoll. Wo Sprache nicht mehr zur Kommunikation genutzt werden kann, hat Musik immer noch eine hohe Bedeutung für den Zugang zum Kranken. Der Musik werden ordnende, strukturierende Eigenschaften zugeschrieben, sie ist Kreativitäts- und Bewegungs- fördernd, emotionalisierend, Erinnerungs- auslösend und fördert Gemeinschaftserleben und Interaktionen. Zahlreiche Studien dokumentieren die Erfolge der Musiktherapie an älteren Menschen, speziell an Demenzerkrankten. Demnach bewirkt sie eine Reduktion von agitiertem, Zunahme von sozialem, Verbesserung von kognitivem Verhalten und Verbesserung des Nachtschlafes. Musiktherapie verbessert oder stabi- lisiert zumindest die nichtkognitive dementielle Symptomatik, daneben kann sie psychomotorische Unruhe, Weinen, aber auch aggressives Verhalten verringern, soziales Verhalten fördern und die Realitätsorientierung verbessern [46]. Außerdem kann Musiktherapie verhaltensauffällige und psychiatrische Symptome, die bei Demenzerkrankungen auftreten können, verringern [43]. Musik ist ein gemeinschaftsbildendes Phänomen und insbesondere das Singen bietet neben der Möglichkeit zur Kommunikation bei bestimmten Melodien einen Anknüpfungspunkt an das Langzeitgedächtnis und anhand der verschiedenen Liederstimmungen eine Möglichkeit zur emotionalen Auseinandersetzung. Zum Stand der musiktherapeutischen Forschung Dennoch gibt es im deutschsprachigen Raum bisher wenige wissenschaftliche Untersuchungen, die Musiktherapie bei Demenzerkrankungen evaluieren [20, 34], experimentelle Studien zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Demenzerkrankungen wurden bis dato keine durchgeführt. Im angloamerikanischen Sprachraum hingegen stellt die musiktherapeutische Behandlung alter Menschen schon seit den achtziger Jahren einen Forschungsschwerpunkt dar. Musik kann demnach problematische Verhaltensweisen und negative Emotionen verringern, eingeschlossen der Aggression, Gereiztheit oder Rastlosigkeit. Zeitweise kann sie eine Leistungssteigerung im Bereich des Gedächtnisses bewirken und wirkt sich positiv auf zwischenmenschliche Interaktionen aus [45]. Musik als Prävention Das Hören von Musik erleichtert die Neurogenese, die Regeneration und die Wiederherstellung zerebraler Nerven, indem es die Sekretion stero- Kerer, Marksteiner, Hinterhuber, Mazzola, Steinberg, Weiss ider Hormone wie Cortisol, Testosteron und Östrogen ausgleicht. Deshalb können musiktherapeutische Ansätze effektive Erfolge in der Prävention von Alzheimer Erkrankung und Demenz erzielen [16]. In einer Pilotstudie waren Alzheimer Patienten sogar in der Lage, aktiv an Singgruppen teilzunehmen, ein neues Lied zu lernen und drei- und vierstimmig zu singen, wobei ihre Betreuer einen langfristigen Gewinn für die Patienten erkannten [5]. Schon allein der Gesang des Betreuers oder bloße Hintergrundmusik können die Kommunikation zwischen Betreuer und schwer dementen Patienten antreiben und die Fähigkeit des Patienten positive Emotionen auszudrücken und seine Vitalität verbessern [18]. Musik beeinflusst das autobiographische Gedächtnis positiv und Alzheimer Patienten können bis in die Spätstadien der Krankheit hinein an strukturierten Musikaktivitäten teilnehmen. Instrumentales Spiel und Tanz/ Bewegung scheinen dabei bevorzugte Live Musik- Aktivitäten zu sein. Einzelsitzungen und Kleingruppen mit 3-5 Teilnehmern eignen sich am besten für die Musiktherapie mit Alzheimer Patienten. Grundsätzlich haben sich musikalische Interventionen als wirkungsvolle Therapieformen erwiesen und können gemeinsam mit einer medikamentösen Behandlung eine Heimeinweisung von Alzheimer Patienten mit Verhaltensstörungen hinauszögern. Es versteht sich von selbst, dass ein gewisser Hang und Freude zur Musik Voraussetzung für erfolgreiche musiktherapeutische Behandlungen sind [2]. Demenz und Musik Bisher gibt es keine experimentellen Untersuchungen in Bezug auf die Auswirkung einer Demenzerkrankung auf musikalische Fähigkeiten oder das musikalische Gedächtnis. Tatsächlich zeigen aber Studien, die die Wirkung von Musiktherapie an Demenzerkrankten erprobten, dass Musik besonders auf diese Patientengruppe enorme positive Wirkungen erzielt. Dabei könnte die Erkenntnis, wie Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben, mit Musik und der Erinnerung an sie umgehen, Aufschluss über die Funktion von Musik, Gedächtnis und biographischem Erinnern geben. Gründe für die geringe Zahl an Studien in diesem Bereich könnte die diffuse Lokalisation der Pathologie sein, die es schwierig macht, Vorhersagen über genaue daraus folgende musikalische Defizite zu machen. Nicht zuletzt sind die vorhandenen Tests zur Überprüfung musikalischer Fähigkeiten nicht für demenzerkrankte Patienten konzipiert. [10]. Es besteht eine große Bedeutung des Zusammenspiels von Hippocampus mit medialen temporalen Cortexarealen für Gedächtnisleistungen, welche sich bei Alzheimer- Patienten, die sich früher musikalisch betätigten, nachweisen lässt. Bei diesen Patienten bleibt das prozedurale Gedächtnis noch lange Zeit intakt, sie können also noch singen oder ihr Instrument spielen, auch wenn sie sonst starke kognitive Beeinträchtigungen aufweisen. So konnten sich Personen, die an der Alzheimer- Erkrankung litten und ein früher gelerntes Stück noch aus dem Gedächtnis spielen konnten, nicht mehr an den Titel des Stücks oder dessen Komponisten erinnern [Crystal, Grober, Masur, 1989, nach 19]. Es kann auch vorkommen, dass Alzheimer Patienten mit erheblichen Wortfindungsstörungen und Sprachstörungen noch in der Lage sind, einen Liedtext korrekt zu singen. Hier erkennt man, dass motorische Abläufe des impliziten Lernens aufgrund ihrer starken Verankerung in corticalen und limbischen Arealen besonders stabil sind [19]. Das implizite Wissen musikalischer Strukturen kann intakt und zugänglich bleiben, auch wenn explizites Erkennen und Entscheiden nicht mehr möglich sind [51]. 12 Fallanalysen Worauf wir bis dato zurückgreifen können, sind einige Fallstudien, die die Erforschung dieses Bereichs verfolgen. So konnte an einer 84- jährigen Demenzpatientin mit MMSE (MiniMental- State Examination) von 8/30 nachgewiesen werden, dass musikalische Fähigkeiten wie beispielsweise das musikalische Gedächtnis, bei Demenzerkrankungen trotz des starken kognitiven Abbaus erhalten geblieben ist. Obwohl die Probandin Probleme mit Testinstruktionen und geschriebenen Testmaterialien hatte, reagierte sie auf die Testvorgaben und es kam zu einer enormen Diskrepanz zwischen ihren musikalische Erkennungs- Leistungen und den Ergebnissen des MMSE. Musikalische Fertigkeiten und musikalisches Gedächtnis wurden mit existierenden Tests für gesunde Probanden überprüft, wobei als Methode die Verhaltensbeobachtung mit zwei unabhängigen Beobachtern angewandt wurde. Die Patientin reagierte beispielsweise, indem sie bei bekannten Liedern spontan mitsang oder die Melodien sogar fortsetzte, nachdem sie gestoppt worden waren. Bei unbekannten Melodien regierte sie nie, bei verzerrten Melodien reagierte sie mit Veränderungen in der Mimik (z.B. Überraschung). Der Grund dafür könnte darin liegen, dass Musik generell die Aktivierung erhöht und motorische Aktivität und das Gedächtnis anregt, während sie zusätzlich auch noch positive Emotionen hervorruft. [10]. Eine ehemalige Profipianistin war mit einem MMSE von 10/30 nicht mehr in der Lage, verbales Material (geschrieben oder auditorisch präsentiert) nach einer einwöchigen Trainingsphase wiederzugeben. Musikalisch notiertes Material konnte sie ebenfalls nicht mehr wiedergeben, doch sie war in der Lage, auditorisch präsentiertes musikalisches Material zu lernen und konnte es abrufen, wiedergeben und die Abrufleistung bis zu Tag sieben steigern. Dabei wurden Demenz und Musik keine Verbesserungen im Bereich anderer kognitiver Leistungen beobachtet, doch erreichte die Probandin in diese Trainingsphase ein Absinken der Werte der GDS (Geriatric depression scale) von 6/15 auf 1/15 [15]. Ein Violinist mit leichter Demenz erlernte das Spiel eines neuen Stücks, das erst nach dem Beginn der Krankheit öffentlich erschienen war, und das er somit nicht vor der Erkrankung gekannt haben konnte. Er konnte das Stück im Anschluss 10 Minuten lang im Gedächtnis behalten, obwohl er in anderen anterograden Gedächtnistests stark beeinträchtigt war [9]. Alzheimer Patienten entwickelten im Gegensatz zu depressiven Patienten eine positive Neigung zu Melodien, die sie vorher gehört hatten [42]. Bei kurzen, unbekannten Melodien zeigten ältere Probanden weniger explizite Gedächtnisleistung als jüngere, aber es kam ein „Mere-ExposureEffekt“ zum Tragen (positive Bewertung nach mehrfacher Darbietung). Bei Alzheimer Patienten konnte allerdings dieser Effekt nicht gefunden werden [21]. Das autobiografische Gedächtnis wird durch Musik stark stimuliert und dadurch verbessert, wobei bloßer Klang (leise Geräusche oder Hintergund- Geräusche) nicht ausreicht um zu einer Veränderung des autobiographischen Gedächtnisses beizutragen [31]. Zwei Patienten veränderten ihren Musikgeschmack nach frontotemporaler Demenzerkrankung radikal. Beide zeigten Gefallen an Pop- Musik, obwohl einer der Patienten diesen Musikstil total abgelehnt hatte und die andere Patientin nie Zugang zu irgendwelcher Musik gefunden hatte. Die radikale Änderung könnte an einer generell veränderten Einstellung zu Neuem oder an einer Veränderung der zuständigen Gehirnareale liegen, die musikalische Parameter verarbeiten [17]. Ein generationenübergreifendes Forschungsprojekt zu musikalischen Biographien erfasst derzeit musikalische Biographien von Menschen ab 13 60 Jahren in ganz Europa. Eines der Ziele ist die Schaffung einer speziellen Sammlung von Musiktiteln, die den Alltag von Demenz Patienten positiv beeinflussen kann [53]. Literatur die Erkenntnis, wie Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben, mit Musik und der Erinnerung an sie umgehen, könnte Aufschluss über die Funktion von Musik, Gedächtnis und biographischem Erinnern geben. Schlussfolgerung Musik ist für viele Menschen ein überaus wichtiger Bestandteil ihres Lebens und oft fällt gar nicht mehr auf, dass wir nahezu ständig von ihr umgeben sind. Dabei ist Musizieren oder Musik hören eine hoch differenzierte Tätigkeit, die verschiedene Gehirnareale aktiviert, auch solche, die sich normalerweise mit anderen kognitiven Aufgaben befassen. So sind musikalische und sprachliche Fähigkeiten durchaus miteinander verwandt und auch im musikalischen Bereich kann man verschiedene Formen des Gedächtnisses unterscheiden. Generell fördern Musizieren und die Beschäftigung mit Musik das Gedächtnis langfristig und musiktherapeutische Ansätze können nichtkognitive dementielle Symptomatiken und psychomotorische Unruhe stabilisieren, aggressives Verhalten verringern, soziale Kommunikation und die Realitätsorientierung fördern. Dabei konnten musiktherapeutische Ansätze besonders im gerontologischen Bereich große Erfolge verbuchen. Dennoch gibt es bisher keine experimentellen Untersuchungen in Bezug auf die Auswirkung einer Demenzerkrankung auf musikalische Fähigkeiten oder das musikalische Gedächtnis. Zu der Tatsache, dass die vorhandenen Tests zur Überprüfung musikalischer Fähigkeiten nicht für demenzerkrankte Patienten konzipiert sind tritt erschwerend hinzu, dass man von keiner durchschnittlichen Musik- Ausbildung ausgehen kann und es allgemein schwierig ist, Vorhersagen über genaue musikalische Leistungen zu machen. Aber [1]Adorno T.W.: Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren. In: Musikalische Schriften I- III. Suhrkamp, Frankfurt 2003. [2] Aldridge D.: Musiktherapie in der Behandlung von Demenz. Geriatrie Journal 4, 24-27 (2004). [3] Altenmüller E.: Gehör. In: MGG, Sachteil Bd. 3, 1093-1104, Bärenreiter, Kassel (1995). [4] Altenmüller E.: Musikwahrnehmung und Amusien. In Karnath H.- O., Thier, P:. Neuropsychologie. Springer, Berlin:2003. [5] Bannan N, Montgomery-Smith C.: “Singing for the brain”: reflections on the human capacity for music arising from a pilot study of group singing with Alzheimer's patients. J R Soc Health, 128(2):73-8 (2008). [6] Bigand E., Tillmann B., Pulin-Charronnat B., Manderlier D.: Repetition priming: Is music special? Q J Exp Psychol A., 58(8):1347-75 (2005). [7] Bogen J.E., Gordon H.W.: Musical tests for functional lateralization with intracarotid amobarbital. Nature, 230, 524-525 (1971). [8] Broschart J., Tentrup I.: Der Klang der Sinne. Geo11/2003, 54-88 (2003). [9] Cowles A., Beatty W.W., Nixon S.J., Lutz L.J., Paulk J., Paulk K., Ross E.D.: Musical skill in dementia: a violinist presumed to have Alzheimer's disease learns to play a new song. Neurocase. 9(6), 493-503 (2003). [10] Cuddy L.L., Duffin J.: Music, memory and Alzheimer`s disease: is music recognition spared in dementia, and how can it be assessed? Medical Hypotheses 64, 229-235 (2005). [11] Deutsch D.: Delayed pitch comparisons and the principle of proximity. Perception & Psychophysics, 23, 227-230 (1978). [12] Deutsch D. The organization of shortterm memory for a single acoustic attribute. In D. Deutsch & J. A. Deutsch (Eds.), Short-term memory. New York: Academic Press, 1975. Kerer, Marksteiner, Hinterhuber, Mazzola, Steinberg, Weiss [13] Deutsch D.: The processing of pitch combinations. In D. Deutsch (Ed.): The Psychology of Music. 2nd. Edition, Academic Press, San Diego 1999. [14] Eschrich S., Münte T.F., Altenmüller E.O.: Unforgettable film music: the role of emotion in episodic long-term memory for music. BMC Neurosci., 9, 48 (2008). [15] Fornazzari L, Castle T, Nadkarni S, Ambrose M, Miranda D, Apanasiewicz N, Phillips F.: Preservation of episodic musical memory in a pianist with Alzheimer disease. Neurology, 66(4):610-1 (2006). [16] Fukui H., Toyoshima K.: Music facilitate the neurogenesis, regeneration and repair of neurons. Medical Hypotheses 71, 5, 765-769 (2008). [17] Geroldi C, Metitieri T, Binetti G, Zanetti O, Trabucchi M, Frisoni GB.: Pop music and frontotemporal dementia, Neurology, 55(12), 1935-6 (2000). [18] Götell E, Brown S, Ekman SL.: The influence of caregiver singing and background music on vocally expressed emotions and moods in dementia care: A qualitative analysis. Int J Nurs Stud, doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.11.001 (2008). [19] Gruhn W.: Der Musikverstand. Georg Ohms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 1998. [20] Grümme R.: Situation und Perspektive der Musiktherapie mit dementiell Erkrankten. Deutsches Zentrum für Altersfrage e. V. –Transfer Verlag, Regensburg 1998. [21] Halpern A.R., O’Connor M.G.: Implicit memory for music in Alzheimer's disease. Neuropsychology 14(3), 391-7 (2000). [22] Hébert S., Peretz I.: Recognition of music in long-term memory: are melodic and temporal patterns equal partners? Em Cognit., 25(4):518-33 (1997). [23] Jusczyk P.W.: How infants begin to extract words from speech. Trends in Cognitive Sciences 3, 323-328 (1999). [24] Jourdain R.: Das wohltemperierte Gehirn. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, Berlin 1998. [25] Kerer M.: Die Beeinträchtigung musikalischer Fähigkeiten nach zerebrovaskulärer Erkrankung und daraus resulierende emotionale Folgen für den Patienten. Diplomarbeit Universität Innsbruck, 2005. [26] Koelsch S.: Ein neurokognitives Modell der Musikperzeption. Musiktherapeutische Umschau 26, 365-381 (2005). [27] Koelsch S.; Friederici, A.D.: Towards the neural basis of processing structure in music: Comparative results of different neurophysiological investigation methods. Annals of the New York Academy of Sciences 999, 15-27 (2003). [28] Koelsch S., Schulze K., Sammler D., Fritz T., Müller K., Gruber O. Functional architecture of verbal and tonal working memory: An FMRI study. Hum Brain Mapp., in print (2008). [29] Kraemer D.J.M., Macrae C.N., Green A.E., Kelley W. M.: Musical imagery: Sound of silence activates auditory cortex. Nature 434, 158 (2005). [30] Lange E. B.: Die Verarbeitung musikalischer Stimuli im Arbeitsgedächtnis. In: Behne K.E., Kleinen G., de la Motte-Haber H.: Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie 16. Hogrefe, Göttingen (2001). [31] Larkin M.: Music tunes up memory in dementia patients. Lancet, 357(9249):47 (2001). [32] Mazzola G.: The Topos of Music. Birkhäuser, Basel 2002. [33] Mazzola G., Wieser H.G., Brunner F., Muzzulini D.: A Symmetry-Oriented Mathematical Model of Counterpoint and Related Neurophysiological Investigations by Depth-EEG. In Hargittai I. (Ed.): Symmetry: Unifying Human Understanding, II, CAMWA/ Pergamon Press, New York 1989. [34] Nickel A. K.; Hillecke T., Bolay V.: SENEX. Pilotstudie zur Entwicklung und Überprüfung eines musiktherapeutischen Behandlungskonzepts für gerontopsychiatrisch erkrankte Altenpflegeheimbewohner. Zeitschrift für Musik-, Tanz- und Kunsttherapie,13 (1), 1-6 (2002). [35] Pantev C., Roberts L.E., Schulz M. Engelien A., Ross B.: Timbre- specific enhancement of auditory cortical representations in musicians. Neuro Report, 12, 169-174 (2001). [36] Patel A.: Language, music, syntax and the brain. Nature Neuroscience 6, 674681 (2003). [37] Patel A., Wong M., Foxton J., Lochy A., Peretz I.: Speech intonation perception deficits in musical tone deafness (congenital amusia). Music Perception, 25, 357-368 (2008). [38] Patterson R.D., Upperkamp S., Johnsrude I.S., Griffiths T.D.: The processing of temporal pitch and melody information in auditory cortex. Neuron 36, 767776 (2002). [39] Peretz I.: Music Perception and Recognition. In Rapp, B.: The Handbook of Cognitive Neuropsychology. Taylor & Francis, Philadelphia 2001. [40] Peretz I., Cummings S., Dubé M.P.: The genetics of congenital amusia (tonedeafness): A family-aggregation study. The American Journal of Human Genetics, 81, 582-588 (2007). [41] Peretz I.; Zatorre R.J.: Brain organization for music processing. Annual Review of Psychology 56, 89-114 (2005). 14 [42] Quoniam N., Ergis A.M., Fossati P., Peretz I., Samson S., Sarazin M., Allilaire J.F.: Implicit and explicit emotional memory for melodies in Alzheimer’s disease and depression. Annals: of the New York Academy of Sciences, 999, 381-384 (2003). [43] Raglio A, Bellelli G, Traficante D, Gianotti M, Ubezio MC, Villani D, Trabucchi M.: Efficacy of music therapy in the treatment of behavioral and psychiatric symptoms of dementia. Alzheimer Dis Assoc Disord., 22(2), 158-62 (2008). [44] Schellenberg E.G., Peretz I.: Music, language, and cognition: Unresolved issues. Trends in Cognitive Sciences, 12, 45-46 (2008). [45] Sherratt K, Thornton A, Hatton C.: Music interventions for people with dementia: A review of the literature. Aging and Mental Health, January, 3-12 (2004). [46] Smeijsters H.: Musiktherapie bei Alzheimerpatienten - Eine Meta-Analyse von Forschungsergebnissen. Musiktherapeutische Umschau18, 268-283 (1997). [47] Sorrell JA, Sorrell JM.: Music as a healing art for older adults. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv., 46(3):21-4 (2008). [48] Spitzer M.. Musik im Kopf. Schattauer, Stuttgart, New York 2003. [49] Steinbeis N., Koelsch S.: Comparing the processing of music and language meaning using EEG and FMRI provides evidence for similar and distinct neural representations. 3(5), 2226 (2008). [50] Swedenborg E.: De fibra, de tunica arachnoidea et de morbis fibrarum. In: Oeconomia Regni Animalis, Bd.3. Wilkinson, London 1847. [51] Tillmann B., Peretz I., Bigand E., Gosselin N.: Harmonic priming in an amusic patient: The power of implicit tasks. Cognitive Neuropsychology, 24, 603622 (2007). [52] Wieser H.G., Mazzola G.: Musical consonances and dissonances: are they distinguished independently by the right and left hippocampi? Neuropsychologia,;24 (6), 805-12 (1986). [53] www.mytopen.de [54] Zatorre R.J.: The Biological Foundations of Music. In: Zatorre R.J., Peretz I. (Eds): Annals of the New York Academy of Sciences. New York Academy of Sciences. 930, New York 2001. Manuela Kerer Abteilung für Allgemeine Psychiatrie Medizinische Universität Innsbruck [email protected] Übersicht Review Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 15–25 Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression Nicola Clausius1, Christoph Born1 und Heinz Grunze1, 2 Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychologie 2 Institute of Neuroscience, Dept. of Psychiatry, University of Newcastle 1 Schlüsselwörter: Depression – Pathophysiologie – Dopaminagonisten – Bupropion Keywords: Depression – Pathophysiology – Dopaminagonists –Bupropion Die Bedeutung von Dopamina­ gonisten in der Behandlung der Depression In der Pathophysiologie der Depression kommt dem Noradrenalin- und Serotoninsystem eine entscheidende Rolle zu. Ergebnisse verschiedener Studien sprechen jedoch auch für eine Beteiligung des dopaminergen Systems: Insbesondere psychomotorisch gehemmte depressive Patienten weisen erniedrigte Spiegel von Homovanillinsäure (Metabolit des Dopamins) auf. Während die stimmungsaufhellende Wirkung von Methylphenidat, D-Amphetamin und Kokain für eine Beteilung des dopaminergen Systems an der Modulation der Stimmung sprechen, vermindert Reserpin Dopamin und kann, wie auch Dopaminrezeptorblocker, ein depressives Syndrom induzieren. Dopaminabhängige motorische Störungen und begleitende Stimmungsschwankungen bei der Parkinsonerkrankung weisen ebenfalls auf pathophysiologische Gemeinsamkeiten von Depression und Parkinson hin. © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Die psychomotorische Hemmung, reduzierte Mimik und verminderte Sprachproduktion bei Depressionen ist mit einem hypodopaminergen Zustand motorischer Areale vereinbar. Die Ergotalkaloide Bromocriptin und Pergolid zeigen in offenen Studien antidepressive Effekte. Für die selektiven Dopamin D2- / D3-Agonisten Pramipexol und Ropinirol liegen kontrollierte Studien vor. Bupropion, ein selektiver Dopamin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (DNRI) hat ebenso seine antidepressive Wirksamkeit nachgewiesen und ist bereits zur Behandlung der Depression zugelassen. The relevance of dopamine agonists in the treatment of depression The pathophysiology of depression has been assigned to the noradrenalin and serotonin system. Results of different studies also support a role of the dopaminergic system in depression: In particular, psychomotor retarded depressive patients exhibited lower levels of homovanillic acid (metabolite of dopamine). While the moodimproving effect of methylphenidat, D-amphetamin and cocaine is also supportive for an involvement of the dopaminergic system, reserpine leads to diminished dopamine levels and may induce a depressive syndrome as well as dopamine receptor-blockers. Dopamine-mediated motor disturbances and accompanying changes in mood in Parkinson’s disease likewise support pathophysiological similari- ties of depression and Parkinson’s disease. Psychomotor inhibition, reduced facial expression and decreased speech production in depression are in line with a hypodopaminergic state of the respective motor areas. There is evidence from open studies for the ergotalkaloids bromocriptine and pergolide to have anti-depressive effects. Controlled studies for the selective dopamine D2/D3-agonists pramipexole and ropinirole are existing. Bupropion, a selective dopamine and noradrenaline reuptake inhibitor (DNRI), has proven antidepressant efficacy in controlled studies and has been licensed for the treatment of depression. Einleitung Neben Umweltfaktoren, die zur multifaktoriellen Genese der Depression beitragen, wurden, beginnend mit der Katecholaminhypothese von Schildkraut in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts [75], neurochemische Veränderungen bei Patienten mit affektiven Störungen in zahlreichen Studien nachgewiesen. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses standen dabei die Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin, Histamin und Dopamin. Dieser isolierte Fokus auf einzelne Transmittersysteme wich in den letzten Jahrzehnten einer komplexeren Betrachtung neuronaler Netzwerke und neuroregulatorischer Mechanismen. Heutzutage wird bei den pathophysiologischen Hypothe- Clausius, Born, Grunze sen der Depression nicht mehr von einem isolierten Mangel, sondern von einer Dysbalance verschiedener Neurotransmitter ausgegangen, welche die Genexpression und damit die Proteinsynthese beeinflusst. Obwohl unverändert dem Noradrenalin- und Serotoninsystem in der Pathophysiologie der Depression eine entscheidende Rolle zukommt, die sich insbesondere auch in der Effektivität der dort ansetzenden Antidepressiva zeigt, weisen Ergebnisse mehrerer experimenteller und klinischer Studien aus unterschiedlichen Forschungsperspektiven auch auf eine erhebliche Beeinträchtigung des dopaminergen Systems in der Depression hin [45]. Eine Dopaminhypothese der affektiven Störungen wurde bereits 1975 formuliert [65]. Indizien sind biochemische Veränderungen, die sich bei depressiven Patienten zeigen, die Wirkung von Medikamenten, die am dopaminergen System ansetzen, die Ergebnisse funktioneller Diagnostik sowie Parallelen der Symptomatik von Patienten mit Schizophrenie, Parkinsonerkrankung und Depressionen, wobei bei den ersteren beiden eine nachhaltige Beteiligung des dopaminergen Systems als gesichert gelten kann. Neuere tierexperimentelle Studien zeigen, dass nicht mehr von einer ausschließlichen Beteiligung des Hippocampus und des Frontalen Kortex an der depressiven Symptomatik ausgegangen werden kann, sondern dass auch Veränderungen im mesolimbischen Dopaminsystem [57] eine wichtige Rolle spielen. Im Folgenden soll das dopaminerge System als Ansatzpunkt medikamentöser Depressionsbehandlung näher betrachtet werden. Das dopaminerge System Die Kerngebiete des dopaminergen Systems im ZNS sind die Substantia nigra, die Area tegmentalis ventralis, hypothalamische Neurone sowie 16 Neurone im Bulbus olfactorii. Für das Verständnis psychiatrischer Erkrankungen haben sich dabei nigrostriatale, mesolimbisch-mesocorticale und tuberoinfundibuläre dopaminerge Bahnen als besonders wichtig erwiesen. Das nigrostriatale Dopaminsystem hat seinen Ausgangspunkt in den Zellkörpern der Substantia nigra und projiziert zum dorsalen Teil des Corpus striatum. Diese Neurone enthalten etwa 70% des Gesamt-Dopamins des ZNS, und sind entscheidend für die Regulation der Motorik. Sie sind Bestandteil des extrapyramidalen Nervensystems. Ein Verlust dopaminerger Neurone dieses Systems, vor allem in der Substantia nigra, führt zur Parkinsonerkrankung mit den Hauptsymptomen Bradykinese, Hypokinese, Rigidität und Tremor. Eine Blockierung der D2-Rezeptoren an den dopaminergen Synapsen durch Antipsychotika führt zu Parkinsonsymptomen, Akathisie und Dystonie als unerwünschte Medikamentennebenwirkungen. Es erscheint wahrscheinlich, dass die oft bestehende motorische Hemmung bei der Depression zum Teil ebenfalls über das nigrostriatale Dopaminsystem vermittelt wird. Bedeutend für die Feinmodulation des nigrostriatalen Systems ist der Nucleus caudatus. Bei Herabregulierung oder Verlust von D2-Rezeptoren nimmt die motorische Aktivität drastisch ab. Eine hohe Dopaminaktivität hebt andererseits die Kontrolle der Motorik durch den Nucleus caudatus auf, sodass es zu unwillkürlichen Bewegungen wie Tics, Dyskinesien und choreatischen Bewegungsstörungen kommt. Eine chronische Blockade von D2-Rezeptoren mit daraus resultierenden erhöhten Sensitivität von Dopaminrezeptoren im nigrostriatalen Dopaminsystem ist eine der Haupthypothesen für die Entstehung antipsychotikainduzierte Spätdyskinesien [8]. Die mesolimbischen Dopaminbahnen gehen von der Area tegmentalis ventralis aus und ziehen zum Nucleus accumbens. Der Nucleus accumbens ist Bestandteil des limbischen Systems. Mesolimbischen Bahnen wird eine Rolle bei angenehmen Emotionen, bei drogeninduzierter Euphorie sowie der Befriedigung bei Nahrungsaufnahme oder Sexualität zugeschrieben (reward-system). Diese Hypothese ist aber letztendlich noch nicht gänzlich abgesichert [3;72]. Hyperaktive mesolimbische Dopaminbahnen vermitteln vermutlich auch die Positivsymptome einer Psychose. Insbesondere Wahn, Denkstörungen und akustische Halluzinationen, und zwar unabhängig von der Grunderkrankung, werden mit einer Überaktivität des mesolimbischen Systems in Verbindung gebracht. Schizophrenien, amphetamin- oder kokaininduzierte Psychosen sowie psychotische Begleitsymptome einer Manie, Depression oder Demenz scheinen gleichfalls mit einer Hyperaktivität dieser Dopaminbahnen in Zusammenhang zu stehen [6;25]. Das mesokortikale Dopaminsystem hat seinen Ausgangspunkt in der Area tegmentalis ventralis. Seine Bahnen ziehen zu den meisten Arealen des zerebralen Kortex, insbesondere auch zum limbischen Kortex. Diese Dopaminbahnen spielen eine Rolle für Verhalten und Kognition [9]. Ein relatives Dopamindefizit der mesokortikalen Projektisbahnen spielt bei der Entwicklung von Negativsymptomen und kognitiven Beeinträchtigungen bei den Schizophrenien eine Rolle [71]. Die Hypothese einer Beteiligung dieser Bahnen an Symptomen wie Antriebsminderung oder kognitiven Beeinträchtigungen bei anderen Erkrankungen, z.B. der Depression, liegt somit nahe. Die tuberoinfundibulären Bahnen haben ihren Ursprung im Nucleus arcuatus und der Area periventricularis des Hypothalamus und projizieren zum Infundibulum und zur anterioren Hypophyse. Dopamin hemmt hier die Freisetzung von Prolaktin. Dies erklärt den Anstieg des Prolaktins bei Patienten, die mit Dopaminrezeptorantagonisten behandelt werden, da durch die Blockade des Dopamin- Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression rezeptors der hemmende Effekt des Dopamins auf Prolaktin aufgehoben wird. Hohe Prolaktinspiegel führen nicht nur zu Galaktorrhoe und Amenorrhoe, sondern stehen vermutlich auch mit sexueller Dysfunktion in Verbindung [8]. Dopamin ist, wie Adrenalin und Noradrenalin- ein Katecholamin und wird primär aus der Aminosäure Tyrosin synthetisiert [71]. Durch Katalyse mittels Tyrosinhydroxylase entsteht als erstes Zwischenprodukt L-DOPA (L-3,4-Dihydroxyphenylalanin), welches bei der Parkinsonerkrankung zur Steigerung der Syntheserate von Dopamin eingesetzt wird. Anschließend entsteht durch Decarboxylierung mittels Dopa-Decarboxylase Dopamin. Dopamin ist aufgrund der fehlenden Carboxyl-Gruppe im Unterschied zu den Vorstufen nicht mehr liquorgängig. Nach der Biosynthese wird Dopamin zum terminalen Axon transportiert und in Vesikeln gespeichert. Bei einer Depolarisation erfolgt die Ausschüttung des Dopamins in den synaptischen Spalt. Anschließend wird das Dopamin entweder über einen Wiederaufnahmemechanismus (Reuptake) wieder in das präsynaptische Axon aufgenommen oder metabolisiert. Der Abbau erfolgt über die Monoaminoxidase (MAO) oder über die Catechol-O-Methyltransferase (COMT). MAO ist hauptsächlich an der präsynaptischen Membran lokalisiert, COMT befindet sich in der postsynaptischen Zelle, in geringem Maße aber auch extrazellulär. Der Hauptmetabolit von Dopamin ist die Homovanillinsäure (HVA). HVA lässt sich im Liquor cerebrospinalis, im Urin und im Serum nachweisen [71]. Einige Studien untersuchten die Konzentration von HVA als Maß der Dopaminaktivität im zentralen Nervensystem [32;40;49;61;63;65;78]. Die Wirkung von Dopamin auf das postsynaptische Neuron ist abhängig vom Rezeptortyp an der postsynaptischen Membran. Die fünf bekannten Subtypen von Dopaminrezeptoren lassen sich in zwei Gruppen auftei- len: D1-artige Rezeptoren (D1 und D5) und D2-artige Rezeptoren (D2, D3 und D4). D1-artige Rezeptoren wirken exzitatorisch. [71]. Sie sind vor allem an der postsynaptischen Membran lokalisiert. Bei Bindung des Dopamins an den D1-artigen Rezeptor wird über ein G-Protein das Enzym Adenylatcyclase aktiviert, das ATP in cAMP umwandelt. cAMP-abhängige Proteinkinasen phosphorylieren die Ionenkanäle, was zu deren Aktivierung führt. Der D5-Rezeptor besitzt dabei eine höhere Affinität zu Dopamin als der D1-Rezeptor [71]. Die D2-artigen Rezeptoren bewirken hingegen über die Aktivierung eines inhibitorischen G-Proteins eine Abnahme der cAMPBildung. Sie befinden sich sowohl in der präsynaptischen als auch in der postsynaptischen Membran. Die Verteilung der D2-artigen Rezeptoren ist unterschiedlich: D2-Rezeptoren finden sich vor allem im Striatum (Nucleus caudatus und Putamen). D3-Rezeptoren sind besonders im Nucleus accumbens konzentriert. D4Rezeptoren finden sich vornehmlich im frontalen Kortex. D2-Rezeptoren sind Ziel verschiedener Therapieansätze. Sie werden in der Therapie der Parkinsonerkrankung von Dopaminagonisten stimuliert oder in der Therapie der Schizophrenie durch antipsychotisch wirkende Dopaminantagonisten geblockt [71]. Dopaminerges und Depression System Verschiedene präklinische und klinische Studien sprechen, neben der Beteiligung des serotonergen und noradrenergen Systems, für eine Beteiligung des dopaminergen Systems an der Depression. So konnte gezeigt werden, dass der Spiegel des Metaboliten HVA im Liquor cerebrospinalis von Patienten mit Major Depression niedriger war als in Kontrollgruppen [35;78]. Die erniedrigten HVA-Spiegel bei depressiv Erkrankten könn- 17 ten für eine Rolle des Dopamins bei Depressionen sprechen. Besonders die Subgruppe von psychomotorisch gehemmten depressiven Patienten wies niedrigere Spiegel von HVA auf [32;40;49;61;63;65]. Im Serum, Liquor und Urin suizidaler Patienten sind ebenfalls erniedrigte Spiegel von Dopamin bzw. Dopaminmetaboliten nachgewiesen worden [58]. Allerdings wurde dieses Ergebnis in weiteren Studien nicht bestätigt, bzw. es wurde sogar ein höherer HVASpiegel gefunden [78;86]. Auch bei psychotisch-depressiven Patienten wurden im Vergleich zu depressiven Patienten ohne psychotische Symptome erhöhte Plasma-Dopaminspiegel und erhöhte HVA-Spiegel gefunden [21;74;81]. Insgesamt lassen sich diese Befunde am ehesten so interpretieren, dass die Subgruppe der psychomotorisch gehemmten depressiven Patienten eine verminderte, die Gruppe psychotisch depressiver Patienten hingegen eher eine erhöhte Dopaminaktivität aufweist. Die Funktion dopaminerger Nervenzellen und Bahnen kann durch verschiedene Medikamente und Drogen verändert werden. Eine antidepres­ sive Wirkung läßt dann Rückschlüsse auf den Beitrag des dopaminergen Systems, evtl. auch in Hinblick auf eine mögliche Beteiligung an der Pathophysiologie der Depression, zu. Einige medikamentöse Wirkungen auf das dopaminerge System werden im Folgenden besprochen. Methylphenidat und D-Amphetamin wirken kurzfristig antidepressiv, wobei Methylphenidat und D-Amphetamin dabei vor allem eine präsynaptische Dopaminfreisetzung hervorrufen. Es entsteht dabei aber eine schnelle Toleranz- und Suchtentwicklung. Diese Medikamente stellen damit trotz der Stimmungsaufhellung, die sie induzieren können, keine sinnvolle Therapie der Depression dar, geben aber einen Hinweis für die Beteilung des dopaminergen Systems an der Modulation der Stimmung [65;92]. Kokain hingegen blockiert die Wiederaufnahme von Dopamin und hebt Clausius, Born, Grunze dadurch ebenfalls den Dopaminspiegel im synaptischen Spalt. Kokain hat eine stimmungsaufhellende Wirkung, wirkt aber suchterzeugend über das mesolimbische Belohnungssystem. Reserpin, ein Alkaloid aus Rauwolfia serpentina, wurde früher neben der Hpertoniebehandlung auch als Antipsychotikum eingesetzt. Reserpin bewirkt zentral eine Katecholaminausschüttung und führt damit langfristig zu einer Entleerung der Dopaminspeicher. Unter Reserpin können als unerwünschte Nebenwirkung schwere Depressionen sowie psychomotorische Verlangsamung und Parkinsonsymptome auftreten. Ein weiteres pharmakologisches Indiz auf eine Beteiligung des dopaminergen Systems bei der Depression ist die Wirkung von klassischen Antipsychotika. Sie blockieren Dopaminrezeptoren und können als unerwünschte Nebenwirkung neben dem bekannten Parkinsonsyndrom auch Dysphorie oder Depressionen induzieren [20;52;65;92]. Differentialdiagnostisch lässt sich dies oft nur schwer von einer postpsychotischen depressiven Episode abgrenzen, die bei ca. einem Drittel der Patienten nach einer akuten schizophrenen Psychose auftritt [91], und ebenfalls mit einem relativen Dopaminmangel in Verbindung gebracht wird. Eine Abgrenzung zur Negativsymptomatik der mit Antipsychotika behandelten Patienten kann ebenfalls schwierig sein. In diesem Zusammenhang ist interessant, das atypische, gemischt serotonerg-dopaminerge Antipsychotika in der Behandlung der Negativsymptomatik mit deutlich mehr Erfolg eingesetzt werden als die klassischen D2-Blocker. Eine Sonderstellung als atypisches Antidepressivum nimmt der Wirkstoff Bupropionhydrochlorid ein. Es handelt sich um einen selektiven Dopamin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (DNRI), der selber nur eine relativ schwache Wirkung auf beide Rezeptoren aufweist, wobei die Wiederaufnahmehemmung von Dopamin etwas stärker ist als die des 18 Noradrenalins. Bupropion hat jedoch drei aktive Metaboliten (Hydroxybupropion, Threohydrobupropion, Erythrohydro-bupropion), die sich im zentralen Nervensystem anreichern und dort als stärker wirksame Dopamin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer wirken [80]. Mit anderen gebräuchlichen Antidepressiva hat Bupropion keine chemische Ähnlichkeit. Die antidepressive Wirksamkeit ist in kontrollierten klinischen Studien gut belegt [10;12;13;15;18; 23;24;29;37;38;48;59;60;70;83;83;8 4;87;89] Sowohl Wirkmechanismus als auch Wirksamkeit von Bupropion legen ebenfalls eine Beteiligung des dopaminergen Systems bei der Depression nahe. Funktionelle Diagnostik und Dopamin Nuklearmedizinisch kann eine funktionelle Diagnostik des dopaminergen Systems bei Patienten mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder single photon emission computed tomography (SPECT) erfolgen. Der Dopamintransporter (DAT, dopamine active transporter) ist ein Membranprotein, das Dopamin aus dem synaptischen Spalt transportiert und so die synaptische Wirkung beendet. DAT wird als präsynaptischer Marker von Dopaminneuronen angesehen. Die Dichte von DAT vermindert sich in den Basalganglien bei chronischer Dopamindepletion [39;54;55]. Mit dem radioaktiven Indikator DATSCAN (selektiver DAT radioligand I-FP-CIT, [123 I]N-fluoropropyl-carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl) tropan) konnte in der SPECT-Bildgebung in einer kleinen Studie an 11 depressiven Patienten mit ausgeprägter Anhedonie eine signifikant geringere DAT-Bindung als in der gesunden Vergleichsgruppe (n= 9) nachgewiesen werden. Die geringere DAT-Bindung wurde getrennt in Caudatus und Putamen sowie bilateral im gesamten Striatum nachgewiesen. Dies ist vereinbar mit der Hypothese, dass zwischen Anhedonie und einer Dysfunktion im dopaminergen System der Basalganglien eine Beziehung besteht [73] . In einer PET-Studie mit dem Radioliganden [ 11C]RTI-32, der hochselektiv für DAT ist, konnte ein ähnlicher Effekt bei neun schwer depressiven Patienten mit rezidivierender depressiver Störung im Vergleich zu 23 gesunden Probanden gezeigt werden. Die DAT-Bindung im Caudatus und Putamen war bilateral in der Gruppe der depressiven Patienten signifikant reduziert. Dabei war die DAT-Bindung um 14% geringer als in der Gruppe der Gesunden. Die Autoren sahen die Ergebnisse als weitere Evidenz dafür an, dass während einer schweren depressiven Episode ein relativer Dopaminmangel besteht [55]. Jedoch ist die Datenlage nicht eindeutig. Eine andere Gruppe fand eine höhere DAT-Dichte in den Basalganglien depressiver Patienten in einer SPECT-Studie an 15 nicht medikamentös behandelten depressiven ambulanten Patienten versus 18 gesunden Kontrollpersonen. Diese Studie wurde mit dem Radioliganden [123 I]β-CIT (2 β-carbomethoxy-3β-(4iodophenyl)-tropane), der eine hohe Affinität zu DAT aufweist, durchgeführt. Diese Ergebnisse standen im Widerspruch zu der primären Hypothese der Autoren, dass die DATDichte bei depressiven Patienten geringer sei als die in gesunden Kontrollprobanden. Neben der generell angenommenen sekundären Herabregulierung der DAT-Dichte in Folge einer Reduktion der Dopaminfreisetzung bei der Depression diskutierten die Autoren daher auch eine primäre Stimulierung des Dopamintransporter, welche zu einer verminderten intrasynaptischen Dopaminkonzentration führt und somit die Dopamintransmission vermindert [41]. Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression Parkinsion Syndrom und Depression Morbus Parkinson ist gekennzeichnet durch einen Verlust dopaminerger Neurone in der Substantia nigra, im limbischen System sowie in anderen Arealen. Etwa 50% der Patienten, die an Parkinson erkrankt sind, leiden an einer schweren Depression. Diese zeigt sich dabei häufig schon als Erstsymptom des Parkinsonsyndroms, oft bereits Jahre vor dem Auftreten motorischer Symptome [19;42;44;51;79]. Die Inzidenz depressiver Erkrankungen ist damit deutlich höher als bei anderen vergleichbaren chronischen Erkrankungen. Eine Entwicklung der Depression als Reaktion auf die Beeinträchtigungen durch die Erkrankung erscheint somit nicht alleine ausschlaggebend. Die Abhängigkeit motorischer Phänomene und begleitender Stimmungsschwankungen von der Dopamintransmission weisen vielmehr auf eine komplexe Vernetzung von Depression und Parkinson hin. Es konnte nachgewiesen werden, dass depressive Syndrome bei Patienten mit On-Off-Phänomenen in der hypokinetischen, dopamindefizitären Off-Phase ausgeprägter waren als in der mobileren dyskinetischen OnPhase [44]. Eine Beteiligung dopaminerger Projektionen vom ventralen Tegmentum zum präfrontalen Kortex konnte bei depressiven Patienten mit Parkinsonsyndrom gefunden werden. Lemke schlägt das folgende pathogenetische Modell vor, um die Depression bei Patienten mit Morbus Parkinson zu erklären [44]: Die degenerativen Veränderungen in den Kernen des Hirnstammes beeinflussen monaminerge Mechanismen im Kortex und in den Basalganglien. Dies führt zu funktionellen Störungen im dopaminerg vermittelten Belohnungssystem und in der Folge zu einer inadäquaten Stressantwort, welche sich in psychopathologischen Symptomen wie Anhedonie, Motivations- und Antriebsreduktion, reduzierter Reaktion auf emotionale Reize, Hoffnungslo- sigkeit, Hilflosigkeit und Dysphorie äußert. Depression und motorische Hemmung Neben kognitiven und affektiven Symptomen sind auch bei depressiven Störungen motorische Symptome wie Agitation oder Hemmung bekannt und gut untersucht. Motorische Funktionen beinhalten Motilität, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Sprachfluss und, als feinmotorische Störung, Tremor. Diese Funktionen werden durch Emotionen moduliert, sodass psychische und somatische Komponenten des motorischen Ausdrucks nur schwer getrennt werden können. Mittels Aktigraphie (Messung des motorischen Aktivitätsniveaus durch piezoelektronischen Sensor) ließ sich eine motorische Hemmung bei Patienten mit Depressionen in verschiedenen Studien objektivieren (Übersicht bei Lemke [42]). Untersuchungen zum Gangbild von depressiven Patienten ergaben eine verkürzte Schrittlänge und Kadenz (Trittfrequenz) sowie eine verlängerte Standphase [46;93]. Störungen in der Geschwindigkeitsmodulation des Ganges depressiver Patienten werden im Zusammenhang mit einer Dysfunktion der Basalganglien gesehen [47]. Hinsichtlich der Gestik zeigen Untersuchungen eine ähnliche psychomotorische Hemmung der oberen Gliedmaßen bei depressiven Patienten wie bei Patienten mit Parkinsonsyndrom [30]. So zeigt sich unter anderem eine signifikante Verlangsamung beim Schreiben [53]. Auch eine reduzierte Mimik bei der Depression läßt sich objektivieren [85]. Ein hypodopaminerger Zustand kortikaler und subkortikaler motorischer Areale könnte an der motorischen Hemmung bei der Depression beteiligt sein. Dieser Hypothese folgend, zeigte eine klinisch definierte Subgruppe von Patienten mit einer gehemmten Depression eine deutliche Besserung unter Therapie mit 19 dem selektiven Dopamin-Wiederaufnahmehemmer Amineptine [64]. Die untersuchte Patientengruppe litt neben Anhedonie auch an weiteren defizitären Symptomen wie z.B. psychomotorischer Hemmung, reduzierter Mimik und verminderter Sprachproduktion. Bei älteren depressiver Patienten mit psychomotorisch Verlangsamung und Apathie, sowie Einschränkungen in exekutiven Funktionen wie Planen, Konzeptbildung, zeitlicher Sequenzierung und Abstraktion, wird ebenfalls eine Dysfunktion dopaminerger striatofrontaler Bahnen angenommen. Bei einem schlechten Ansprechen auf handelsübliche Antidepressiva könnten Dopamin-Agonisten hier eine Behandlungsalternative darstellen [1]. Dopaminagonisten in der Therapie der Depression Dopamin-Agonisten kommen überwiegend in der Behandlung des Parkinson- Syndroms zum Einsatz. Dabei werden Ergotalkaloide (Bromocriptin, Cabergolin, Dihydroergocriptin, Lisurid, Pergolid) von Nicht-Ergot-Alkaloiden (Pramipexol, Ropinirol) unterschieden. Beide Substanzklassen unterscheiden sich hinsichtlich ihres peripheren Nebenwirkungsprofils. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werde, dass direkte Dopaminrezeptor-Agonisten antidepressiv wirken können, die Dopamin- Vorläufersubstanz L-DOPA (L-3,4-Dihydroxyphenylalanin) selbst hingegen keine spezifisch antidepressive Wirkung aufzuweisen scheint [77]. Bromocriptin, ein D2- und D3- Rezeptoragonist mit schwacher antagonistischer Wirkung am D1-Rezeptor, wurde in älteren klinischen Studien auf seine antidepressive Wirkung hin untersucht. Im direkten Vergleich zu Amitryptilin und Imipramin wurde ein ähnlich stark ausgeprägter antidepressiver Effekt für Bromocriptin gezeigt [5;90;92]. Clausius, Born, Grunze Pergolid, ein potenter Agonist an D1 und D2-Rezeptoren, wurde ebenfalls hinsichtlich seines antidepressiven Effektes bei therapierefraktärer Depression untersucht. Eine kleinere offene Studie an zwanzig unipolar (n=16) oder bipolar (n=4) depressiv erkrankten Patienten konnte eine Verbesserung der Stimmung bei 11 Patienten, gemessen mit der Clinical Global Impression (CGI) Skala, innerhalb von einer Behandlungswoche zeigen. Auf Trizyklika oder Monaminooxidase-Hemmer hatten die Patienten vorher nicht angesprochen. Die Patienten erhielten 0,25 bis 2 mg Pergolid zusätzlich zur Vorbehandlung. Unerwünschte Nebenwirkungen waren vor allem Übelkeit und Erbrechen [4]. Der Versuch der Replikation dieses Befundes in einer kleinen doppelblinden Studie gelang jedoch nicht: Eine doppelblinde placebokontrollierte Studie, die Pergolid als Augmentationstherapie bei therapierefraktären Patienten untersuchte, musste mangels Wirksamkeit nach 8 Patienten abgebrochen werden [50]. Eine neuere offene Studie an therapierefraktären unipolaren Patienten (n=20) kam allerdings wiederum zu dem Schluss, dass Pergolid als Adjuvans zu trizyklischen und ande­ ren heterozyklischen Antidepressiva sinn­­voll sein könnte. In dieser Studie hatte sich der CGI bei 40% der Pa­ tienten mit Pergolid als Adjuvans in 4 Wochen deutlich sowie bei 20% der Patienten minimal verbessert [34]. Pramipexol ist ein Dopamin-Agonist, der selektiv an Dopamin D2 und D3Rezeptoren bindet, und als gut verträglich angesehen wird. Neben seiner Wirkung auf motorische Symptome konnte ein antidepressiver Effekt bei Patienten mit Parkinsonsyndrom und schwerer Depression sowohl in offenen Studien, als auch in einer Vergleichsstudie gegen Sertralin gezeigt werden [Übersicht in [43], [2;26;66;67]]: In einer doppelblinden placebokontrollierten Studie an Patienten mit einer depressiven Episode bei Bipolar-II-Störung wurde Pramipexol über sechs Wochen als Adju- 20 vans zu Valproat oder Lithium verabreicht (N=21). 60 % der Patienten mit Pramipexol zeigten eine >50%ige Verbesserung in der Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) gegenüber 9% in der Placebogruppe (p=0.02). Zwei Patienten in der Placebogruppe entwickelten hypomane Symptome, hingegen nur ein Patient in der Pramipexolgruppe [94]. Eine weitere, allerdings ebenfalls nur kleine randomisierte placebokontrollierte Studie (n=22), konnte einen antidepressiven Effekt von Pramipexol bei Patienten mit einer bipolaren Depression ebenfalls nachweisen. Die Patienten in dieser Studie erhielten Pramipexol in einer durchschnittlichen Dosis von 1,7 mg pro Tag über sechs Wochen als Adjuvans zu einem Stimmungsstabilisierer. Ein Patient der Placebogruppe beendete die Studie vorzeitig wegen eines Switches in die Hypomanie. Keiner der Patienten beendete die Studie vorzeitig wegen unerwünschter Nebenwirkungen. Die als primäres Zielkriterium definierte mindestens 50%ige Verbesserung in der Hamilton-Depressions-Skala (HAM-D) gegenüber dem Ausgangswert wurde von 83% der Patienten mit Pramipexol, aber nur von 20% der Placebogruppe erreicht [31]. In einer größeren randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierte Vergleichsstudie (n=174) erwies sich Pramipexol (Enddosis bis zu 5mg pro Tag) in seiner antidepressiven Wirkung bei typischer Depression (Major depressive disorder, MDD) ohne psychotische Symptome Fluoxetin (20mg pro Tag) ebenbürtig und gegenüber Placebo signifikant überlegen. Die Verbesserung der depressiven Symptome wurde mit der HAM-D, der MADRS sowie der CGI erhoben. Patienten, die eine höhere Dosis Pramipexol tolerierten (5mg/ Tag), zeigten eine besonders ausgeprägte Besserung ihrer Symptomatik, aber schon eine Dosierung von 1 mg Pramipexol pro Tag zeigte Wirksamkeit [16] . Ropinirol, ein D2-D3 Rezeptor-Agonist, der wie Pramipexol in der Be- handlung der Parkinsonerkrankung und des Restless-Leg-Syndroms (RLS) eingesetzt wird, wurde in klinischen Studien auf seine antidepressive Wirkung hin untersucht, nachdem sich im Tiermodell mehrfach ein anxiolytischer sowie ein als antidepressiv interpretierbarer Effekt gezeigt hatte [68]. Neben dem im Vordergrund stehenden D2/D3 Rezeptor-Agonismus zeigte Ropinirol im Tiermodell auch Wirkung auf Sigma 1- Rezeptoren [22], ein zusätzlicher Wirkmechanismus, der auch bei anderen neueren Antidepressiva, u.a. Venlafaxin, diskutiert wird. 18 Bipolar-II-Patienten mit einer schweren depressiven Episode, die nach mindestens acht Wochen konventioneller antidepressiver Therapie sowie einer Behandlung mit Stimmungsstabilisierern keine Besserung zeigten, erhielten zusätzlich Pramipexol oder Ropinorol. Die retrospektive Krankenblattauswertung ergab bei acht Patienten (vier unter Pramipexol und vier unter Ropinorol) eine Verbesserung des CGI-Wertes [62]. Eine weitere Pilotstudie zur therapieresistenten Depression untersuchte Ropinirol als Adjuvans zu trizyklischen Antidepressiva oder selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) bei zehn Patienten. Sieben der Patienten litten an unipolarer Depression, drei an bipolarer. MADRS und der CGI zeigten bei 40% der Patienten ein Ansprechen auf die Therapie. Zwei Patienten beendeten die Studie vorzeitig wegen Schwindels [9]. Schließlich konnte eine große offene Phase IV-Studie (n=327) über 14 Wochen konnte eine Verbesserung von Depressions- und Angst- Symptomen durch eine Behandlung mit Ropinirol bei 48% der Patienten mit Parkinsonerkrankung zeigen [7]. Bupropion, ein selektiven Dopaminund Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (DNRI), war im Jahre 2005 eines der am häufigsten verschriebenen Antidepressiva in den USA [83]. Bezogen auf alle drei Darreichungsformen (Bupropion-IR, BupropionSR, Bupropion-XL) wurden bis 2006 Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression etwa 15 Millionen Patienten mit einer depressiven Störung mit Bupropion behandelt [11]. 1989 wurde es in den USA als Bupropion – IR zur Behandlung der MDD wieder zugelassen, nachdem es ursprünglich bereits 1984 erhältlich war. Wegen Krampfanfällen, z.T. mit Todesfolge, ruhte die Zulassung in den USA zunächst. Eine neuere Beobachtungsstudie an 9329 Patienten, die Bupropion zur Nikotinentwöhung einnahmen, zeigte eine Assoziation mit einem gering erhöhten Risiko für Krampanfälle, aber kein erhöhtes Mortalitätsrisiko [33]. Bupropion (Wellbutrin®) ist in retardierter Form („XR“) auch in Österreich zur Behandlung von schweren Depressionen (MDD) zugelassen, nachdem es bereits zuvor zur Nikotinentwöhnung erhältlich war (Zyban®). Retardierte („XR“) Formulierungen ( „XR“, sowie „XL“ und „SR“ in anderen Ländern)) sind dabei deutlich verträglicher als die ursprüngliche IR („immediate release“) Formulierung; insbesondere ist das Risiko eines Krampfanfalles in therapeutischer Dosis nicht höher als bei anderen modernen Antidepressiva, wie z.B. SSRIs [56;76]. Bei nachgewiesener Bioäquivalenz von Bupropion XR zu Bupropion-IR ist die Plasma-Peak-Konzentration (Cmax) geringer und damit auch die subjektive Verträglichkeit am besten. In den USA gibt es Bupropion-XR seit 2003, die zugelassene Maximaldosis ist 450mg pro Tag. Die zugelassene Maximaldosis von Bupropion zur Behandlung der Depression für Österreich ist 300 mg/Tag. Als Dopamin- und NoradrenalinWiederaufnahme-Hemmer (DNRI) hat Bupropion keine signifikante Wirkung auf Serotonin. Die Plasmakonzentration der aktiven Metaboliten, und letztlich die Anreicherung im ZNS ist, wie oben beschrieben, zum Teil höher als die von Bupropion selbst. Seit Beginn der 80er Jahre wurden zahlreiche doppelblinde, placebokontrollierte Studien durchgeführt, welche die antidepressive Wirksamkeit von Bupropion belegen konnten (u.a. [23;48]). In einer europäischen placebokontrollierten Studie zur Wirksamkeit von Bupropion (150-300mg/Tag) über zehn Wochen bei älteren, schwer depressiven Patienten (n=418, Durchschnittsalter etwa 71 Jahre) zeigte Bupropion ebenfalls eine deutliche antidepressive Wirkung [10]. In einer placebokontrollierten Langzeitstudie (n=123) mit einer Therapiedauer bis zu 44 Wochen war Buproprion in einer Dosierung von 300g/Tag zur Behandlung rezidivierender schwerer Depressionen Placebo ab der 12. Woche überlegen (p<0,05). Zusätzlich konnte eine signifikante Minderung des Rückfallrisikos gezeigt werden [87]. Auch Vergleichsstudien zur Wirksamkeit bei Patienten mit Major Depression von Bupropion gegenüber Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) liegen zahlreich vor [12-14; 17;24;28;36;38;59;60;70;83;84;87;8 8], auf die im Folgenden noch näher eingegangen wird. Die Datensätze von sieben randomisierten doppelblinden kontrollierte Studien, welche die Wirksamkeit von Bupropion-IR [27] und -SR [14;17;37;88] (n=732) gegenüber Fluoxetin (n=339), Sertralin (n=343) und Paroxetin (n=49) bei ambulanten Patienten mit schwerer depressiver Störung (MDD) untersuchten, wurden von Thase in einer Metaanalyse zusammengefasst [84]. Vier der Studien untersuchten zusätzlich eine Placebogruppe (n=512). Bupropion und SSRIs waren gleich wirksam, dabei beide besser als Placebo, und wurden jeweils gut toleriert.. Der Unterschied zwischen den Behandlungen lag in der Art der unerwünschten Nebenwirkungen. Insbesondere sexuelle Nebenwirkungen traten unter SSRI gehäuft, unter Bupropion hingegen nicht auf. Weiteren Aufschluss über der unterschiedliche Nebenwirkungsprofil ergibt sich aus einer sechswöchigen randomisierten, doppelblinden Multicenter-Vergleichsstudie mit Bupropion-SR (100-300mg/d) versus Paroxetin (10-40mg/d) bei älteren 21 Patienten (60-88 Jahre) mit schwerer Depression. Beide Therapien erwiesen sich als sicher und effektiv. An unerwünschten Wirkungen wurden in dieser Studie in beiden Gruppen bei über 10% der Patienten Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, trockener Mund, Agitation, Schwindel und Übelkeit beobachtet. Somnolenz, Diarrhoe, Obstipation und Anorexie trat zusätzlich in über 10% der Patienten der Paroxetin-Gruppe auf [88]. Eine aktuelle Metaanalyse untersuchte die Wirkung von Bupropion auf Angstsymptome bei schweren depressiven Störungen. Es wurden Primärdaten (HDRS-AS, HAM-A) aus zehn doppelblinden, randomisierten klinischen Studien (n=2890) hinsichtlich der anxiolytischen Wirksamkeit von Bupropion und SSRIs untersucht. Bupropion und SSRIs unterschieden sich nicht signifikant in ihrer Wirksamkeit [60]. In einer ebenfalls neueren doppelblinden Multicenterstudien (N= 348) [13;82] wurde Bupropion-XL mit dem selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Venlafaxin-XR verglichen. Ziel der 12-wöchigen Studie an ambulanten Patienten war es, die Effektivität der Therapie sowie deren Verträglichkeit, nicht zuletzt in Hinblick auf die sexuelle Funktion, zu vergleichen. Es konnte eine signifikante Wirksamkeit von BupropionXL und Venlafaxin-XR bei Patienten mit schwerer Depression, gemessen an der Veränderung des CGI und der HAMD-17, gezeigt werden. Die Remissionsraten waren dabei in der Bupropiongruppe höher (46%) als in der Venlafaxingruppe (33%). Hinsichtlich der zu Beginn der Behandlung im „Changes in Sexual Functioning Questionaire“ (CSFQ) normalen sexuellen Funktion der Patienten zeigte sich im Verlauf der Behandlung eine Verschlechterung ab der zweiten Woche in der Venlafaxingruppe. In der Bupropriongruppe blieb die sexuelle Funktionsfähigkeit unverändert. Zwei weitere Studien (n=830) mit einem identischen, randomisierten, Clausius, Born, Grunze doppelblinden Studiendesign über acht Wochen verglichen die Wirksamkeit von Bupropion-XL (300450mg/d) mit der von Escitalopram (10-20 mg/d) gegenüber Placebo bei schweren Depressionen. Die Remissionsraten der Bupropiongruppe entsprachen dabei denen der Escitalopramgruppe (HAM-D-17-Gesamtscore), Bupropion-XL wurde aber hinsichtlich der sexuellen Funktion, was das primäre Outcome-Kriterium war, signifikant besser toleriert als Escitalopram [12]. Eine randomisierte doppelblinde Studie (n=141), welche die Wirkung von Bupropion-SR (150-300mg pro Tag) mit der von Paroxetin (20-40mg pro Tag) hinsichtlich der Auswirkungen auf die sexuelle Funktion von Männern (n=73) und Frauen (n=68) mit schwerer depressiver Störung verglich, kam zu dem Ergebnis, dass ein signifikanter Unterschied in der ­Häufigkeit Antidepressiva-induzierten sexuel­len Funktionsstörung bei Männern bestehe. Paroxetin verschlechterte die sexuelle Funktionsfähigkeit bei Männern im Gegensatz zu Bupropion. Dieser Effekt wurde in dieser Studie bei Frauen nicht gefunden [38]. Hinsichtlich des Symptomkomplexes Müdigkeit und Erschöpfung bei depressiver Störung (MDD) erscheint das amphetaminähnliche pharmakologische Profil von Bupropion verheißungsvoll. Hierzu liegt eine Analyse aus sechs randomisierten placebo-kontrollierten klinischen Studien vor, die Bupropion (n=662) mit SSRIs (n=655) verglich. Bei Auswertung der entsprechenden Items der Hamilton Depressionsskala der Primärstudien kam die Studie zu dem Ergebnis, dass die Therapie mit Bupropion signifikant stärker zu einem Rückgang der Symptome Müdigkeit und Erschöpfung führte als die Behandlung mit SSRIs [59]. Die Behandlung von Patienten, die auf das Antidepressivum der ersten Wahl nicht oder nur teilweise ansprechen, stellt eine oft schwierige Anforderung da. Die Chance, eine wirkungsvolle Therapie zu finden, 22 verschlechtert sich deutlich mit jedem vorausgegangenen, erfolglosen Therapieversuch [69]. Bupropion-SR (bis 400mg/d) war in einer Studie zur Behandlung der schweren therapieresistenten Depression ohne psychotische Symptome - nach einer erfolglosen oder nicht vertragenen Behandlung mit Citalopram – im Vergleich etwa genauso wirksam wie Sertralin (bis 200mg/d) oder Venlafaxin-XR (bis 375 mg): In dieser randomisierten Vergleichsstudie (n=727) über vier Wochen remittierten etwa ein Viertel der ambulanten Patienten unter den jeweiligen Folgetherapien (Bupropion, Sertralin, Venlafaxin) [70]. Eine andere kleinere offene Studie (n=29) fand bei Gabe von Bupropion – nach nicht erfolgreicher Behandlung mit Fluoxetin – 30,8 % Responder, 34,6% Teilresponder und 23,1 % remittierte Patientn [24]. Die Folgerung aus beiden Studien war, daß Bupropion eine Option bei SSRI-therapieresistenter schwerer Depression darstellt. Schlussfolgerungen Die Ergebnisse der dargestellten experimentellen und klinischen Studien legen einen relativen Dopaminmangel bei Depression nahe. Insbesondere die depressive Symptomatik einer Subgruppe von Patienten, die dopaminvermittelte motorische Störungen – im Sinne von psychomotorischer Hemmung – aufweisen, könnte mit einer Dysfunktion im dopaminergen System der Basalganglien in Beziehung stehen. Zur Behandlung der Depression mit Dopaminagonisten lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Datenlage für eine Behandlung mit dem Ergotalkaloid Pergolid widersprüchlich erscheint. Möglicherweise kann Pergolid als Adjuvans zu anderen Antidepressiva bei therapierefraktärer Depression eine sinnvolle Behandlungsstrategie darstellen. Der antidepressive Effekt von Pergolid sollte - vor einer therapeutischen Empfeh- lung - jedoch in größeren dopppelblinden Studien bestätigt werden. Pramipexol, ein selektiver D2- / D3Agonist und Nicht-Ergotalkaloid, zeigte, neben Ergebnissen aus offenen Studien, in kleineren placebokontrollierten Studien gute Ergebnisse als Adjuvans zu Stimmungsstabilisierern bei der bipolaren Depression. Ergebnisse einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie zur Therapie der unipolaren Depression legen eine mit Fluoxetin vergleichbare antidepressive Wirkung nahe. Weitere klinische Studien zur Bestätigung dieses Effektes erscheinen sinnvoll. Ropinirol, ein weiterer selektiver D2- / D3-Agonist und ein Nicht-Ergotalkaloid, zeigte in offenen Studien Wirksamkeit in der Behandlung unipolarer und bipolarer Depressionen. Auch für Ropinirol sollten doppelblinde Studien an größeren Patientenkollektiven vorliegen, ehe klare therapeutische Empfehlungen gegeben werden können. Der DNRI Bupropion hingegen erweitert schon heute die Therapieoptionen bei schweren depressiven Störungen. Bupropion ist ein eher aktivierendes Antidepressivum. Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung sprechen gut auf eine Therapie mit Bupropion an. Hinsichtlich der anxiolytischen Wirksamkeit scheint Bupropion mit Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) vergleichbar zu sein. Es erscheint besonders geeignet für Patienten, die serotonerg vermittelte unerwünschte Nebenwirkungen, wie z.B. sexuelle Funktionsstörungen, nicht tolerieren oder deren depressive Symptomatik nicht auf eine selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmung anspricht. In der Behandlung der schweren therapieresistenten Depression stellt Bupropion eine Option dar, die nach erfolgloser Behandlung mit SSRI noch bei nicht wenigen Patienten eine Remission erreichen kann. „Essential sentence": Ergebnisse ver­schiedener experimenteller und Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression klinischer Studien sprechen für eine Beteiligung des dopaminergen Systems an der Depression. Dopa­ minagonisten zeigen z. T. ausreichend antidepressive Effekte, um sie bei der depressiven Störung zumindest als augmentativen Behandlungsversuch einzusetzen. Neben seiner allgemein guten antidepressiven Wirksamkeit eignet sich Bupropion als DNRI insbesondere auch zur Behandlung depressiver Patienten, bei denen SSRI zu Verträglichkeitsproblemen führen oder die auf SSRI keine Besserung erfahren. Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Alexopoulos G.S.: "The depression-executive dysfunction syndrome of late life": a specific target for D3 agonists? Am J Geriatr Psychiatry 9(1), 22-29 (2001). Barone P., Scarzella L., Marconi R., Antonini A., Morgante L., Bracco F., Zappia M., Musch B.: Pramipexole versus sertraline in the treatment of depression in Parkinson's disease: a national multicenter parallel-group randomized study. J Neurol 253(5), 601-607 (2006). Berridge K.C.: The debate over dopamine's role in reward: the case for incentive salience. Psychopharmacology (Berl) 191(3), 391-431 (2007). Bouckoms A., Mangini L.: Pergolide: an antidepressant adjuvant for mood disorders? Psychopharmacol Bull 29(2), 207211 (1993). Bouras N., Bridges P.K.: Bromocriptine in depression. Curr Med Res Opin 8(3), 150-153 (1982). Bradberry C.W.: Cocaine sensitization and dopamine mediation of cue effects in rodents, monkeys, and humans: areas of agreement, disagreement, and implications for addiction. Psychopharmacology (Berl) 191(3), 705-717 (2007). Buchwald B., Angersbach D., Jost W.H.: [Improvements in motor and non-motor symptoms in parkinson patients under ropinirole therapy]. Fortschr Neurol Psychiatr 75(4), 236-241 (2007). Casey D.E.: Pathophysiology of antipsychotic drug-induced movement disorders. J Clin Psychiatry 65 Suppl 9:25-8., 25-28 (2004). Cassano P., Lattanzi L., Fava M., Navari S., Battistini G., Abelli M., Cassano G.B.: Ropinirole in treatment-resistant depression: a 16-week pilot study. Can J Psychiatry 50(6), 357-360 (2005). [10] Chrzanowski W., Rousseau R., Hewett K., Gee M.D., Wightman D.S., Richard N., Modell J.G., Goodale E.P.: Efficacy and safety of bupropion extended release in elderly patients with major depressive disorder. Eur Neuropsychopharmacol 16 Suppl 4, 315-316 (2006). [11] Clayton A.H.: Extended-release bupropion: an antidepressant with a broad spectrum of therapeutic activity? Expert Opin Pharmacother 8(4), 457-466 (2007). [12] Clayton A.H., Croft H.A., Horrigan J.P., Wightman D.S., Krishen A., Richard N.E., Modell J.G.: Bupropion extended release compared with escitalopram: effects on sexual functioning and antidepressant efficacy in 2 randomized, double-blind, placebo-controlled studies. J Clin Psychiatry 67(5), 736-746 (2006). [13] Clayton A.H., Thase M.E., Haight B.R., Harriett A.E., Richard N., Goodale E.P.: Comparision of bupropion extended release for the treatment of depression : a double-blind, multicentre trial. Eur Neuropsychopharmacol 16 Suppl 4, 316 (2006). [14] Coleman C.C., King B.R., BoldenWatson C., Book M.J., Segraves R.T., Richard N., Ascher J., Batey S., Jamerson B., Metz A.: A placebo-controlled comparison of the effects on sexual functioning of bupropion sustained release and fluoxetine. Clin Ther 23(7), 1040-1058 (2001). [15] Coleman C.C., King B.R., BoldenWatson C., Book M.J., Segraves R.T., Richard N., Ascher J., Batey S., Jamerson B., Metz A.: A placebo-controlled comparison of the effects on sexual functioning of bupropion sustained release and fluoxetine. Clin Ther 23(7), 1040-1058 (2001). [16] Corrigan M.H., Denahan A.Q., Wright C.E., Ragual R.J., Evans D.L.: Comparison of pramipexole, fluoxetine, and placebo in patients with major depression. Depress Anxiety 11(2), 58-65 (2000). [17] Croft H., Settle E Jr, Houser T., Batey S.R., Donahue R.M., Ascher J.A.: A placebo-controlled comparison of the antidepressant efficacy and effects on sexual functioning of sustained-release bupropion and sertraline. Clin Ther 21(4), 643-658 (1999). [18] Croft H., Settle E Jr, Houser T., Batey S.R., Donahue R.M., Ascher J.A.: A placebo-controlled comparison of the antidepressant efficacy and effects on sexual functioning of sustained-release bupropion and sertraline. Clin Ther 21(4), 643-658 (1999). [19] Cummings J.L.: Psychosomatic aspects of movement disorders. Adv Psychosom Med 13:111-32., 111-132 (1985). [20] D'Aquila P.S., Collu M., Gessa G.L., Serra G.: The role of dopamine in the mechanism of action of antidepressant 23 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] drugs. EUR J PHARMACOL 405(1-3), 365-373 (2000). Devanand D.P., Bowers M.B., Jr., Hoffman F.J., Jr., Nelson J.C.: Elevated plasma homovanillic acid in depressed females with melancholia and psychosis. Psychiatry Res 15(1), 1-4 (1985). Dhir A., Kulkarni S.K.: Involvement of dopamine (DA)/serotonin (5-HT)/ sigma (sigma) receptor modulation in mediating the antidepressant action of ropinirole hydrochloride, a D2/D3 dopamine receptor agonist. Brain Res Bull 74(1-3), 58-65 (2007). Fabre L.F., Brodie H.K., Garver D., Zung W.W.: A multicenter evaluation of bupropion versus placebo in hospitalized depressed patients. J Clin Psychiatry 44(5 Pt 2), 88-94 (1983). Fava M., Papakostas G.I., Petersen T., Mahal Y., Quitkin F., Stewart J., McGrath P.: Switching to bupropion in fluoxetineresistant major depressive disorder. Ann Clin Psychiatry 15(1), 17-22 (2003). Featherstone R.E., Kapur S., Fletcher P.J.: The amphetamine-induced sensitized state as a model of schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 31(8), 1556-1571 (2007). Fedorova N.V., Chigir' I.P.: Use of the dopamine receptor agonist Mirapex in the treatment of Parkinson's disease. Neurosci Behav Physiol 37(6), 539-546 (2007). Feighner J.P., Gardner E.A., Johnston J.A., Batey S.R., Khayrallah M.A., Ascher J.A., Lineberry C.G.: Doubleblind comparison of bupropion and fluoxetine in depressed outpatients. J Clin Psychiatry 52(8), 329-335 (1991). Feighner J.P., Gardner E.A., Johnston J.A., Batey S.R., Khayrallah M.A., Ascher J.A., Lineberry C.G.: Doubleblind comparison of bupropion and fluoxetine in depressed outpatients. J Clin Psychiatry 52(8), 329-335 (1991). Feighner J.P., Gardner E.A., Johnston J.A., Batey S.R., Khayrallah M.A., Ascher J.A., Lineberry C.G.: Doubleblind comparison of bupropion and fluoxetine in depressed outpatients. J Clin Psychiatry 52(8), 329-335 (1991). Fleminger S.: Control of simultaneous movements distinguishes depressive motor retardation from Parkinson's disease and neuroleptic parkinsonism. Brain 115(Pt 5), 1459-1480 (1992). Goldberg J.F., Burdick K.E., Endick C.J.: Preliminary randomized, doubleblind, placebo-controlled trial of pramipexole added to mood stabilizers for treatment-resistant bipolar depression 4807. Am J Psychiatry 161(3), 564-566 (2004). Goodwin F.K., Post R.M., Dunner D.L., Gordon E.K.: Cerebrospinal fluid amine metabolites in affective illness: the probenecid technique. Am J Psychiatry 130(1), 73-79 (1973). Clausius, Born, Grunze [33] Hubbard R.C., Lewis S., West J.C., Smith C., Godfrey C., Smeeth L., Farrington P., Britton J.: Bupropion and the risk of sudden death: a self-controlled case-series analysis using The Health Improvement Network. Thorax 60, 848-850 (2005). [34] Izumi T., Inoue T., Kitagawa N., Nishi N., Shimanaka S., Takahashi Y., Kusumi I., Odagaki Y., Denda K., Ohmori T., Koyama T.: Open pergolide treatment of tricyclic and heterocyclic antidepressant-resistant depression. J Affect Disord 61(1-2), 127-132 (2000). [35] Kapur S., Mann J.J.: Role of the dopaminergic system in depression. Biol Psychiatry 32(1), 1-17 (1992). [36] Kavoussi R.J., Segraves R.T., Hughes A.R., Ascher J.A., Johnston J.A.: Double-blind comparison of bupropion sustained release and sertraline in depressed outpatients. J Clin Psychiatry 58(12), 532-537 (1997). [37] Kavoussi R.J., Segraves R.T., Hughes A.R., Ascher J.A., Johnston J.A.: Double-blind comparison of bupropion sustained release and sertraline in depressed outpatients. J Clin Psychiatry 58(12), 532-537 (1997). [38] Kennedy S.H., Fulton K.A., Bagby R.M., Greene A.L., Cohen N.L., RafiTari S.: Sexual function during bupropion or paroxetine treatment of major depressive disorder. Can J Psychiatry 51(4), 234-242 (2006). [39] Kilbourn M.R., Sherman P.S., Pisani T.: Repeated reserpine administration reduces in vivo [18F]GBR 13119 binding to the dopamine uptake site. Eur J Pharmacol 216(1), 109-112 (1992). [40] Korf J., van Praag H.M.: Retarded depression and the dopamine metabolism. Psychopharmacologia 19(2), 199-203 (1971). [41] Laasonen-Balk T., Kuikka J., Viinamaki H., Husso-Saastamoinen M., Lehtonen J., Tiihonen J.: Striatal dopamine transporter density in major depression. Psychopharmacology (Berl) 144(3), 282-285 (1999). [42] Lemke M.R.: Motorische Phänomene der Depression. Nervenarzt 70(7), 600612 (1999). [43] Lemke MR. Dopaminagonisten. In: Bauer M, Berghoefer A, Adli M, editors. Akute und therapieresistente Depressionen, Pharmakotherapie - Psychotherapie - Innovationen. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2005: 321-328. [44] Lemke MR. Motion und Emotion. Morbus Parkinson und Depression. In: Förstl H, editor. Frontalhirn,Funktionen und Erkrankungen. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2005: 178-191. [45] Lemke M.R.: Dopaminagonisten als Antidepressiva : Experimentelle und klinische Befunde. Nervenarzt 78(1), 31-38 (2007). [46] Lemke M.R., Puhl P., Koethe N., Winkler T.: Psychomotor retardation and anhedo- 24 [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] nia in depression. Acta Psychiatr Scand 99(4), 252-256 (1999). Lemke M.R., Wendorff T., Mieth B., Buhl K., Linnemann M.: Spatiotemporal gait patterns during over ground locomotion in major depression compared with healthy controls. J Psychiatr Res 34(4-5), 277-283 (2000). Lineberry C.G., Johnston J.A., Raymond R.N., Samara B., Feighner J.P., Harto N.E., Granacher R.P., Jr., Weisler R.H., Carman J.S., Boyer W.F.: A fixed-dose (300 mg) efficacy study of bupropion and placebo in depressed outpatients. J Clin Psychiatry 51(5), 194-199 (1990). Markianos M., Alevizos B., Hatzimanolis J., Stefanis C.: Effects of monoamine oxidase A inhibition on plasma biogenic amine metabolites in depressed patients. Psychiatry Res 52(3), 259-264 (1994). Mattes J.A.: Pergolide to augment the effectiveness of antidepressants: clinical experience and a small double-blind study. Ann Clin Psychiatry 9(2), 87-88 (1997). Mayeux R.: Depression in the patient with Parkinson's disease. J Clin Psychiatry 51 Suppl:20-3; discussion 24-5., 20-23 (1990). McKinney W.T., Jr., Kane F.J., Jr.: Depression with the use of alpha-methyldopa. Am J Psychiatry 124(1), 80-81 (1967). Mergl R., Juckel G., Rihl J., Henkel V., Karner M., Tigges P., Schroter A., Hegerl U.: Kinematical analysis of handwriting movements in depressed patients. Acta Psychiatr Scand 109(5), 383-391 (2004). Meyer J.H., Goulding V.S., Wilson A.A., Hussey D., Christensen B.K., Houle S.: Bupropion occupancy of the dopamine transporter is low during clinical treatment. Psychopharmacology (Berl) 163(1), 102-105 (2002). Meyer J.H., Kruger S., Wilson A.A., Christensen B.K., Goulding V.S., Schaffer A., Minifie C., Houle S., Hussey D., Kennedy S.H.: Lower dopamine transporter binding potential in striatum during depression. Neuroreport 12(18), 4121-4125 (2001). Montgomery S.A.: Antidepressants and seizures: emphasis on newer agents and clinical implications. Int J Clin Pract 59(12), 1435-1440 (2005). Nestler E.J., Carlezon W.A., Jr.: The mesolimbic dopamine reward circuit in depression. Biol Psychiatry 59(12), 1151-1159 (2006). Papakostas G.I.: Dopaminergic-based pharmacotherapies for depression. Eur Neuropsychopharmacol 16(6), 391-402 (2006). Papakostas G.I., Nutt D.J., Hallett L.A., Tucker V.L., Krishen A., Fava M.: Resolution of sleepiness and fatigue in major depressive disorder: A comparison of bupropion and the selective serot- [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] onin reuptake inhibitors. Biol Psychiatry 60(12), 1350-1355 (2006). Papakostas G.I., Trivedi M.H., Alpert J.E., Seifert C.A., Krishen A., Goodale E.P., Tucker V.L.: Efficacy of bupropion and the selective serotonin reuptake inhibitors in the treatment of anxiety symptoms in major depressive disorder: A meta-analysis of individual patient data from 10 double-blind, randomized clinical trials. J Psychiatr Res . (2007). Papeschi R., McClure D.J.: Homovanillic and 5-hydroxyindoleacetic acid in cerebrospinal fluid of depressed patients. Arch Gen Psychiatry 25(4), 354-358 (1971). Perugi G., Toni C., Ruffolo G., Frare F., Akiskal H.: Adjunctive dopamine agonists in treatment-resistant bipolar II depression: an open case series. Pharmacopsychiatry 34(4), 137-141 (2001). Praag H.M., Korf J., Lakke J.P.W.F., Schut T.: Dopamine metabolism in depressions, psychoses, and Parkinson's disease: the problem of the specificity of biological variables in behaviour disorders. Psychol Med 5(2), 138-146 (1975). Rampello L., Nicoletti G., Raffaele R.: Dopaminergic hypothesis for retarded depression: a symptom profile for predicting therapeutical responses. Acta Psychiatr Scand 84(6), 552-554 (1991). Randrup A, Munncvad I, Fog R, Gerlach J, Molander L, Kjellberg B et al. Mania, depression, and brain dopamine. In: Essman WB, Valzelli L, editors. Current developments in psychopharmacology. New York: Spectrum Publications, 1975: 207-229. Reichmann H., Brecht H.M., Kraus P.H., Lemke M.R.: Pramipexol bei der Parkinson-Krankheit.Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung. Nervenarzt 73(8), 745-750 (2002). Rektorova I., Rektor I., Bares M., Dostal V., Ehler E., Fanfrdlova Z., Fiedler J., Klajblova H., Kulist'ak P., Ressner P., Svatova J., Urbanek K., Veliskova J.: Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease: a national multicentre prospective randomized study. Eur J Neurol 10(4), 399-406 (2003). Rogers D.C., Costall B., Domeney A.M., Gerrard P.A., Greener M., Kelly M.E., Hagan J.J., Hunter A.J.: Anxiolytic profile of ropinirole in the rat, mouse and common marmoset. Psychopharmacology (Berl) 151(1), 91-97 (2000). Rush A.J., Trivedi M.H., Wisniewski S.R., Nierenberg A.A., Stewart J.W., Warden D., Niederehe G., Thase M.E., Lavori P.W., Lebowitz B.D., McGrath P.J., Rosenbaum J.F., Sackeim H.A., Kupfer D.J., Luther J., Fava M.: Acute and Longer-Term Outcomes in Depressed Outpatients Requiring One or Several Die Bedeutung von Dopaminagonisten in der Behandlung der Depression [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] Treatment Steps: A STAR*D Report. Am J Psychiatry 163(11), 1905-1917 (2006). Rush A.J., Trivedi M.H., Wisniewski S.R., Stewart J.W., Nierenberg A.A., Thase M.E., Ritz L., Biggs M.M., Warden D., Luther J.F., Shores-Wilson K., Niederehe G., Fava M.: BupropionSR, sertraline, or venlafaxine-XR after failure of SSRIs for depression. N Engl J Med 354(12), 1231-1242 (2006). Sadock BJ, Saddock VA. The Brain and Behavior, Neurophysiology and Neurochemistry. In: Sadock BJ, Saddock VA, editors. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry, Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilk, 2007: 94110. Salamone J.D.: Functions of mesolimbic dopamine: changing concepts and shifting paradigms. Psychopharmacology (Berl) 191(3), 389 (2007). Sarchiapone M., Carli V., Camardese G., Cuomo C., Di G.D., Calcagni M.L., Focacci C., De R.S.: Dopamine transporter binding in depressed patients with anhedonia. Psychiatry Res 147(2-3), 243-248 (2006). Schatzberg A.F., Rothschild A.J., Langlais P.J., Bird E.D., Cole J.O.: A corticosteroid/dopamine hypothesis for psychotic depression and related states. J Psychiatr Res 19(1), 57-64 (1985). Schildkraut J.J.: The catecholamine hypothesis of affective disorders: a review of supporting evidence. Am J Psychiatry 122(5), 509-522 (1965). Settle E.C.: Bupropion sustained release: side effect profile. J Clin Psychiatry 59 Suppl 4, 32-36 (1998). Shaw K.M., Lees A.J., Stern G.M.: The impact of treatment with levodopa on Parkinson's disease. Q J Med 49(195), 283-293 (1980). Sher L, Mann JJ. Psychiatric Pathophysiology: Mood Disorders. In: Tasman A, Kay J, Lieberman JA, editors. Psychiatry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2003: 300-315. Shiba M., Bower J.H., Maraganore D.M., McDonnell S.K., Peterson B.J., Ahlskog J.E., Schaid D.J., Rocca W.A.: Anxiety disorders and depressive dis- [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] orders preceding Parkinson's disease: a case-control study. Mov Disord 15(4), 669-677 (2000). Stahl SM. Essential Psycho­pharma­ cology: Neuroscientific basis and practical applications. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Sweeney D., Nelson C., Bowers M., Maas J., Heninger G.: Delusional versus nondelusional depression: Neurochemical differences. Lancet 2(8080), 100-101 (1978). Thase M.E., Clayton A.H., Haight B.R., Thompson A.H., Modell J.G., Johnston J.A.: A double-blind comparison between bupropion XL and venlafaxine XR: sexual functioning, antidepressant efficacy, and tolerability. J Clin Psychopharmacol 26(5), 482-488 (2006). Thase M.E., Clayton A.H., Haight B.R., Thompson A.H., Modell J.G., Johnston J.A.: A double-blind comparison between bupropion XL and venlafaxine XR: sexual functioning, antidepressant efficacy, and tolerability. J Clin Psychopharmacol 26(5), 482-488 (2006). Thase M.E., Haight B.R., Richard N., Rockett C.B., Mitton M., Modell J.G., VanMeter S., Harriett A.E., Wang Y.: Remission rates following antidepressant therapy with bupropion or selective serotonin reuptake inhibitors: a meta-analysis of original data from 7 randomized controlled trials. J Clin Psychiatry 66(8), 974-981 (2005). Ulrich G., Harms K.: A video analysis of the non-verbal behaviour of depressed patients before and after treatment. J Affect Disord 9(1), 63-67 (1985). Vestergaard P., Sorensen T., Hoppe E., Rafaelsen O.J., Yates C.M., Nicolaou N.: Biogenic amine metabolites in cerebrospinal fluid of patients with affective disorders. Acta Psychiatr Scand 58(1), 88-96 (1978). Weihs K.L., Houser T.L., Batey S.R., Ascher J.A., Bolden-Watson C., Donahue R.M., Metz A.: Continuation phase treatment with bupropion SR effectively decreases the risk for relapse of depression. Biol Psychiatry 51(9), 753761 (2002). 25 [88] Weihs K.L., Settle E.C., Jr., Batey S.R., Houser T.L., Donahue R.M., Ascher J.A.: Bupropion sustained release versus paroxetine for the treatment of depression in the elderly. J Clin Psychiatry 61(3), 196-202 (2000). [89] Weihs K.L., Settle E.C., Jr., Batey S.R., Houser T.L., Donahue R.M., Ascher J.A.: Bupropion sustained release versus paroxetine for the treatment of depression in the elderly. J Clin Psychiatry 61(3), 196-202 (2000). [90] Wells B.G., Marken P.A.: Bromocriptine in treatment of depression. DICP 23(78), 600-602 (1989). [91] Whitehead C., Moss S., Cardno A., Lewis G.: Antidepressants for people with both schizophrenia and depression. Cochrane Database Syst Rev(2), CD002305 (2002). [92] Willner P.: Dopamine and depression: a review of recent evidence. III. The effects of antidepressant treatments. Brain Res 287(3), 237-246 (1983). [93] Winkler T., Buhl K., Linnemann M., Mieth B., Stolze H., Lemke M.R.: Alterations of gait parameters in depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 248 Suppl, 126 (1998). [94] Zarate C.A., Jr., Payne J.L., Singh J., Quiroz J.A., Luckenbaugh D.A., Denicoff K.D., Charney D.S., Manji H.K.: Pramipexole for bipolar II depression: a placebo-controlled proof of concept study 4806. Biol Psychiatry 56(1), 54-60 (2004). Prof. Dr. Heinz Grunze Institute of Neuroscience, Dept. of Psychiatry Newcastle University, United Kingdom [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 26–34 Nutzung der Angehörigenrunde Ingrid Sibitz1, 2, Beate Schrank1, 2 und Michaela Amering1 1 2 Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie Ludwig-Boltzmann-Institut für Sozialpsychiatrie, Wien Schlüsselwörter: Schizophrenie – Belastung – Angehörige – Psychoedukation Keywords: schizophrenia – burden – relatives - pschoeducation Nutzung der Angehörigenrunde Anliegen: Die vorliegende Studie untersucht die Nutzung einer expertengeleiteten Angehörigengruppe sowie Gründe für die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme. Methode: 147 Angehörige von PatientInnen mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis wurden mit einem Fragebogen zur Nutzung von Hilfe-Angeboten, zu Problemen in der Familie (FPQ), zum gesundheitlichen Wohlbefinden (GHQ) und zur Lebensqualität (WHOQOL-BREF) erfasst. Ergebnisse: 60 Angehörige nahmen das Angebot der Angehörigengruppe wahr. Vor allem Angehörige mit hoher wöchentlicher Kontaktzeit zum/ zur PatientIn, solche mit niedrigerer Lebensqualität, höherer objektiver Belastung und weniger positiver Einstellung dem/der PatientIn gegenüber nutzten die Angehörigenrunde. Wichtige Gründe nicht zu kommen waren Scheu, Angst, Scham, Resignation und ein Nicht-Wahrhaben-Wollen der Erkrankung. Schlussfolgerungen: © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Trotz hoher Belastung gibt es Berührungsängste mit Angeboten der Angehörigenarbeit und eine hohe empfundene Stigmatisierung von Angehörigen psychisch Kranker. Die erfolgreiche Integration von Angehörigen in die Therapie erfordert daher Einfühlsamkeit und besonderes Engagement. servations about professional support intended for them and they feel highly stigmatised. Successful integration of relatives into psychiatric care requires empathy and strong commitment. Utilisation of a group for relatives Objective: Relatives of patients suffering from schizophrenia are a highly burdened group. While benefits of integrating them into routine care are internationally recognised only a fraction receive adequate interventions. The present study investigates the utilisation of an open group for relatives, variables potentially associated with it and relatives’ reasons for and against its utilisation. Methods: 147 relatives of in-patients and patients attending a day hospital where assessed using the General Health Questionnaire (GHQ), the Family Problem Questionnaire (FPQ), the WHO Quality of Life-BREF (WHOQOLBREF) and a questionnaire inquiring about the utilisation of an open group for relatives. Results: Overall, 60 relatives attended the group routinely offered at the hospital. Especially those with higher weekly contact time with patients, lower quality of life, higher subjective burden and a less positive attitude towards the patient were attenders. Important reasons to decline the offer were feelings of timidity, fear and shame, resignation and disavowal. Conclusions: Despite their high burden, relatives have re- Es ist heute durch zahlreiche Studien belegt, dass Angehörige von PatientInnen mit schizophrenen Psychosen unter vielfältigen Belastungen leiden [3, 13, 15, 25, 26, 27] was sie zu einer Hochrisikogruppe bezüglich ihrer psychischen Gesundheit macht [2]. Auch konnte wiederholt gezeigt werden, dass verschiedene Interventionen zur Unterstützung und Entlastung der Angehörigen wirksam sind [3, 19], dass der hohe Bedarf an Interventionen für Angehörige jedoch häufig nicht oder nur unzureichend gedeckt ist [3, 5, 26]. Zu den Belastungen der Angehörigen zählen der Betreuungsaufwand, Schwierigkeiten im Umgang mit dem/ der Erkrankten, berufliche Nachteile, eigene gesundheitliche Beeinträchtigungen, die Erfahrung von Diskriminierung und Ablehnung und negative Auswirkungen auf ihre Beziehungen zu anderen [27]. Auch ein bestehendes Informationsdefizit bezüglich der Erkrankung, das Gefühl nicht ernst genommen zu werden, der Mangel an institutioneller Unterstützung, sowie wohnortferne stationäre Behandlung bedeuten Belastungen [22]. Angehörige benötigen von Beginn der Erkrankung an Informationen und Hilfe Einleitung Nutzung der Angehörigenrunde in diversen Bereichen. Dazu gehören Informationen über Krankheit und Medikamente ebenso wie rechtliche und finanzielle Beratung. Die benötigte Hilfe umfasst verschiedenste Dimensionen des praktischen Lebens, wie etwa das Lernen eines offenen Umgangs mit der Krankheit, oder das Wiedergewinnen von sozialen Funktionen, Struktur und Routine. Eine Entlastung der Angehörigen, besonders durch psychoedukative Interventionen, führt einerseits auf Seiten der Angehörigen zu einem verbesserten Wohlbefinden und einer verringerten Anfälligkeit für psychische und somatische Beschwerden [2, 28] und andererseits kann der verbesserte Umgang mit den PatientInnen deren Rückfallsrate und Hospitalisierungszeiten drastisch senken [17, 18, 20] sowie ihre Compliance, Lebensqualität und soziale Funktion nachhaltig steigern [7, 8, 15, 20] was auch zu einer Kostenreduktion für das Gesundheitssystem beiträgt. Auch für die Gesundheit und die Zufriedenheit der Angehörigen ist neben einer guten Behandlung der PatientInnen und genügend Information, vor allem das Eingehen auf ihre eigenen Probleme und das Miteinbezogenwerden in die Therapie wichtig [28]. Angehörigengruppen, wie die professionell geleitete „Angehörigenrunde“ zielen darauf ab, die Kompetenz und Autonomie sowie den Selbstwert der Angehörigen zu erhöhen. Sie bieten die Möglichkeit zum Austausch der eigenen Probleme und Erfahrungen und können so zur Entlastung der Angehörigen und zur Verbesserung der Selbsteffizienz und Familienfunktion beitragen [6, 8]. Obwohl international empfohlen wird, Angehörigenarbeit in die Routinebetreuung zu integrieren [5, 10] erhält in der Praxis nur ein Bruchteil der Angehörigen entsprechende Interventionen [3, 21]. Andererseits zeigt die klinische Erfahrung, dass Angehörigenrunden oftmals nur spärlich besucht werden. In unserer Angehörigenbefragung zu „Wege zur Angehörigenrunde“ zeigte sich, 27 dass vor allem Geschwister von PatientInnen mit Schizophrenie in der Angehörigen-Arbeit eine vernachlässigte wenngleich subjektiv stark belastete Gruppe darstellen [24]. Ziel der hier vorliegenden explorativen Analyse war zu erfassen, wie und welche Angehörige das Angebot der Angehörigenrunde erhalten bzw. nutzen und welche Gründe aus Sicht der Angehörigen für bzw. gegen eine Teilnahme an der Angehörigenrunde sprechen. Material und Methode Angehörige von schizophren Erkrankten wurden mittels einem per post zugesendeten Fragebogen zu Wege und Hindernisse bei der Nutzung des Angebotes der Angehörigenrunde sowie zu ihrer Belastung, ihrem gesundheitlichen Befinden und ihrer Lebensqualität befragt. Zusätzlich wurden die behandelnden ÄrztInnen gefragt, wie, welche und warum Angehörige zur Angehörigenrunde eingeladen bzw. nicht eingeladen wurden. In die Untersuchung eingeschlossen wurden alle Angehörigen von PatientInnen mit der klinischen Diagnose einer Schizophrenie oder schizoaffektiven Psychose (ICD-10: F20.0-9, F25.0-9), die in einem Zeitraum von 17 Monaten stationär bzw. tagesklinisch an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Wien aufgenommen waren. Die PatientInnen wurden über die Untersuchung informiert und um ihr schriftliches Einverständnis zur Befragung ihrer Angehörigen gebeten. Die von den PatientInnen vorgeschlagenen Angehörigen wurden erst rund um den Entlassungszeitpunkt telefonisch kontaktiert, um ihnen zuvor genügend Zeit für eine Teilnahme an der Angehörigenrunde zu geben. Bei telefonischem Einverständnis erhielten sie umgehend einen Fragebogen inklusive eines adressierten und frankierten Rücksendekuverts zugesendet. Angehörige, die den Frage- bogen innerhalb von 3 Wochen nicht zurückgesendet hatten, wurden zur Erinnerung erneut telefonisch kontaktiert. Weitere Erinnerungsanrufe erfolgten in der sechsten bis siebenten bzw. neunten bis elften Woche nach Zusendung des Fragebogens. ÄrztInnen-Befragung Dieses kurze strukturierte Erhebungsgespräch umfasste die Frage nach allen den ÄrztInnen bekannten Angehörigen der PatientInnen, ob diese zur Angehörigengruppe eingeladen worden waren, nach der Art und dem Stil der Einladung sowie nach den Gründen jemanden nicht einzuladen. Bei der Art der Einladung wurde erfasst, ob diese persönlich, über die PatientInnen oder über andere Familienmitglieder erfolgte. Außerdem bestand eine offene Kategorie für davon abweichende Angaben. Beim Einladungs-Stil wurde zunächst „allgemein-offen“, individuell-offen“, “allgemein-direktiv“ und „individuell-direktiv“ unterschieden. Diese Kategorien sind als Stufen zunehmenden Nachdrucks im Einladungsstil zu verstehen. In der Analyse wurden sie zu den zwei Kategorien „offen“ und „direktiv“ zusammengefasst. Angehörigen-Fragebögen Die an der Untersuchung teilnehmenden Angehörigen erhielten je einen aus vier Teilen bestehenden Fragebogen zum selbständigen Ausfüllen. Der aus 39 Items bestehende Fragebogen zur Nutzung von Hilfe-Angeboten ist angelehnt an den „Wiener Angehörigenfragebogen“ [12]. Er erfasst den Krankheitsverlauf des/der PatientIn aus der Sicht der Angehörigen und das daraus entstehende Bedürfnis nach Information und Hilfe sowie die Inanspruchnahme verschiedener Hilfe-Angebote. Ein Teil des Fragebogens befasst sich mit der Angehörigengruppe, einer routinemäßig Sibitz, Schrank, Amering stattfindenden expertengeleiteten offenen Gruppe für Angehörige. Der 34 Items umfassende Fragebogen zu Problemen der Familie (FPQ) [14] ist in die folgenden Dimensionen gruppiert: (a) objektive Belastung; (b) subjektive Belastung; (c) Unterstützung der Angehörigen durch professionelle HelferInnen und Mitglieder des sozialen Netzwerkes; (d) positive Einstellung der Angehörigen dem/der PatientIn gegenüber; (e) Kritik der Angehörigen am Verhalten des/der PatientIn. Jedes Item wird anhand einer vierstufigen Skala bewertet, von 1 „nie“ bis 4 „immer“. Der WHOQOL-BREF [1] ist ein Fragebogen zur reliablen und validen Erfassung der subjektiven Lebensqualität. Die aus 26 Items bestehende Kurzversion des WHOQOL-100 erfasst die Domänen physisches Wohlbefinden, psychisches Wohlbefinden, soziale Beziehungen, Umwelt und globales Wohlbefinden. Die Items werden anhand einer fünfstufigen Likert Skala bewertet. Die Domänenwerte werden aus Gründen der Vergleichbarkeit in einen 0-100 Wertebereich transformiert. Der Fragebogen zum gesundheitlichen Wohlbefinden (GHQ-12) [11, 23] ist ein kurzer Screening-Fragebogen, der Hinweise auf psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen und Angststörungen, erfasst. In insgesamt 12 Items, die sich auf unterschiedliche Lebensbereiche beziehen, erhebt dieser Fragebogen, wie sich die betreffende Person für gewöhnlich fühlt, wobei ein höherer Score für das Vorliegen von mehr Beschwerden spricht. In der vorliegenden Auswertung wurde die bimodale Skalierung (0-0-1-1) mit einem Grenzwert von 3 für das Vorliegen von psychischen Beschwerden verwendet. 28 Statistische Auswertung Ermittelt wurden absolute Häufigkeiten im Bezug auf die Einladung und Nutzung des Angebots der Angehörigengruppe sowie die mittleren Werte der subjektiv angegebenen Belastung auf einer Skala von 1 bis 10. Die Variable der wöchentlichen Kontaktzeit wurde zu 3 Kategorien zusammengefasst: unter 10 Stunden, 10-40 Stunden und über 40 Stunden. Es wurde untersucht, ob sich Hinweise auf Unterschiede zwischen den an der Angehörigengruppe teilnehmenden und nicht teilnehmenden Angehörigen ergaben. Dabei erfolgten Gruppenvergleiche der normal verteilten intervallskalierten Variablen mittels t-Test, die von dichotomen Variablen mittels χ2-Tests bzw. mittels Fisher-Yates-Test (exakter Test nach Fischer), wenn zwei unabhängige Stichproben bezüglich eines zweifach gestuften Merkmals verglichen wurden [4]. P-Werte < 0,05 wurden als statistisch signifikant angesehen. Alle p-Werte wurden 2-seitig berechnet. Alle Analysen wurden mittels SPSS Version 15.0 durchgeführt. Durch unvollständig ausgefüllte Fragebögen schwankte die Stichprobengröße für die einzelnen Vergleiche. Ergebnisse Die Rekrutierung der TeilnehmerInnen erfolgte über die PatientInnen der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Wien und ist bei Schrank et al [24] detailliert dargestellt. Hier eine kurze Zusammenfassung: von 137 in Frage kommenden PatientInnen stimmten 109 einer Kontaktierung ihrer Angehörigen zu. Von den insgesamt 333 genannten Angehörigen und nahen Bezugspersonen konnten 239 erfolgreich kontaktiert werden, wobei 217 der Teilnahme an der Untersuchung zustimmten und einen Fragebogen zugesendet bekamen. Zurückgesendet wurden 147 von 217 ausgesendeten Fragebögen, was ei- Abbildung 1: Einladung und Nutzung der Angehörigenrunde 147 Angehörige - 63 Mütter, 38 Väter - 13 Schwestern, 16 Brüder - 6 PartnerInnen - 11 sonstige Verwandte + FreundInnen 103 eingeladen - 52 Mütter, 31 Väter - 4 Schwestern, 8 Brüder - 5 PartnerInnen - 3 sonstige Verwandte + FreundInnen 44 nicht eingeladen - 11 Mütter, 7 Väter - 9 Schwestern, 8 Brüder - 1 PartnerIn - 8 sonstige Verwandte + FreundInnen 44 nicht teilgenommen 60 teilgenommen - 33 Mütter, 20 Väter - 1 Schwester, 1 Bruder - 2 PartnerInnen - 3 sonstige Verwandte + FreundInnen 43 nicht teilgenommen - 30 Mütter, 18 Väter - 12 Schwestern, 15 Brüder - 4 PartnerInnen - 8 sonstige Verwandte + FreundInnen Abbildung 1: Einladung und Nutzung der Angehörigenrunde Nutzung der Angehörigenrunde ner Rücklaufrate von 68% entspricht. Die Fragebögen wurden von 87 weiblichen und 60 männlichen Angehörigen von insgesamt 82 PatientInnen (29 Frauen, 53 Männer) komplettiert. Die überwiegende Mehrzahl der Fragebögen stammte von Eltern, gefolgt von Geschwistern. Einige wenige Fragebögen kamen von PartnerInnen, FreundInnen oder sonstigen Verwandten. (Abbildung 1) 29 Einladung Zur Angehörigenrunde eingeladen fühlten sich 103 (70,1%) der 147 Angehörigen, während 44 (29,9%) sich nicht eingeladen fühlten. Welche Angehörige sich zur Angehörigenrunde eingeladen fühlten und welche nicht ist in Abbildung 1 dargestellt. Vor allem die Eltern und PartnerInnen der PatientInnen fühlten sich meist eingeladen, die Geschwister und sonstige Verwandte oder FreundInnen jedoch deutlich seltener. Die Einladung erfolgte laut Angabe der Angehörigen direkt durch die behandelnden ÄrztInnen (N=46), durch andere Familienmitglieder (N=32), über den Aushang an der Klinik (N=28), über die PatientInnen (N=6) und über andere Quellen wie das Pflegepersonal oder Familienmitglieder anderer PatientInnen (N=18), wobei eine Reihe von Angehörigen mehrere Einladungsvarianten angaben. Einige merkten an, dass sie sich durch die Information über die Angehörigenrunde durch ein anderes Familienmit- TeilnehmerInnen Nicht-TeilnehmerInnen N (%) N (%) Geschlecht der Angehörigen Weiblich 37 (61,7%) 50 (57,5%) Männlich 23 (38,3%) 37 (42,5%) Ja 29 (48,3%) 34 (39,1%) Nein 31 (51,7%) 53 (60,9%) < 10 Std/Woche 8 (13,3%) 37 (42,5%)* 10 – 40 Std/Woche 32 (53,3%) 28 (32,2%) > 40 Std/Woche 19 (31,7%) 17 (19,5%) Mütter 33 (55,0%) 30 (34,5%) Väter 20 (33,3%) 18 (20,7%) PartnerInnen 2 (3,3%) 4 (4,6%) Geschwister 2 (3,3%) 27 (31,0%) Sonstige (inkl. FreundInnen) 3 (5,0%) 8 (9,2%) Station 21 (35,0%) 44 (50,6%) Tagesklinik 39 (65,0%) 43 (49,4%) Offen 37 (61,7%) 23 (26,4%) Direktiv 21 (35,0%) 6 (6,9%) Nie teilgenommen (obwohl eingeladen) 5 (8,3%) 16 (18,4%) Früher teilgenommen 26 (43,3%) 2 (2,3%)* Erstmals eingeladen 26 (43,3%) 17 (19,5%)* Positiv 20 (33,3%) 1 (1,1%) Negativ 6 (10,0%) 1 (1,1%) Leben im gleichen Haushalt Kontakt zu PatientIn Art der Angehörigkeit Behandlungseinheit Einladungsstil Frühere Einladung zu / Teilnahme an Angehörigengruppen Frühere Erfahrungen mit Angehörigenrunden Tabelle 1:Charakteristika der TeilnehmerInnen (N=60) und Nicht-TeilnehmerInnen (N=87) * Statistisch signifikanter Unterschied (p<0,05) FPQ GHQ WHOQOL-BREF Sibitz, Schrank, Amering 30 TeilnehmerInnen Nicht-TeilnehmerInnen MW (SD) MW (SD) Physisches Wohlbefinden 70,3 (19,3) 80,1 (15,9)* Psychisches Wohlbefinden 63,8 (15,9) 70,7 (17,1)* Soziale Beziehungen 65,1 (19,0) 68,4 (18,3) Umwelt 71,2 (16,6) 73,6 (16,9) Globales Wohlbefinden 56,3 (18,3) 66,8 (20,7)* Gesundheitliches Wohlbefinden 3,4 (3,5) 2,7 (3,3)* Objektive Belastung 13,7 (4,5) 11,6 (4,6)* Subjektive Belastung 20,0 (3,6) 19,3 (3,8) Unterstützung in Notsituationen 11,8 (3,7) 11,0 (3,9) Positive Einstellung 11,1 (2,1) 12,2 (2,3)* Kritik 6,0 (1,3) 6,1 (1,7) Tabelle 2:Lebensqualität, gesundheitliches Wohlbefinden und familiäre Probleme von TeilnehmerInnen und Nicht-TeilnehmerInnen. *Statistisch signifikanter Unterschied (p<0,05) glied oder den Aushang an der Klinik nicht eingeladen fühlten. Laut Befragung der ÄrztInnen wurden 91 (61,9%) Angehörige zur Angehörigenrunde eingeladen und 56 (38,1 %) nicht. Die Übereinstimmung zwischen Angehörigen und ÄrztInnen darüber ob eine Einladung erfolgte oder nicht betrug insgesamt 67,1% (98 von 146). 30 Angehörige, die laut der behandelnden ÄrztInnen nicht eingeladen worden waren, gaben an, eine Einladung erhalten zu haben. Umgekehrt meinten 18 Angehörige, die laut ÄrztInnen eingeladen worden waren, keine Einladung erhalten zu haben. Teilnahme Im Zeitraum der Untersuchung haben 60 der befragten Personen (40,8%) an der Angehörigenrunde teilgenom- men. Unter den 87 (59.2%) Personen, die nicht teilgenommen hatten, befanden sich alle 44 Personen, die sich nicht eingeladen gefühlt hatten. Die Charakteristika der TeilnehmerInnen und Nicht-TeilnehmerInnen sind in Tabelle 1 dargestellt. Signifikante Unterschiede zeigten sich bei der wöchentlichen Kontaktzeit zu den PatientInnen und bezüglich früherer Einladung und Teilnahme an Angehörigenrunden: Angehörige, deren wöchentliche Kontaktzeit mit den PatientInnen über 10 Stunden lag, nahmen häufiger teil als Angehörige mit weniger Kontakt zu den PatientInnen. Angehörige, die erstmals eingeladen wurden bzw. schon früher einmal an einer Angehörigenrunde teilnahmen, nahmen das Angebot in höherem Ausmaß wiederum wahr als solche, die bereits vor dem Untersuchungszeitpunkt trotz Einladung das Angebot nicht nutzten. Weiters zeigte sich, dass Angehörige von PatientInnen der Tagesklinik tendenziell häufiger teilnahmen als jene der Station (p=0,06). In den weiteren Bereichen unterschieden sich die beiden Gruppen nicht: sowohl bei den TeilnehmerInnen als auch bei den Nicht-TeilnehmerInnen gab es etwas mehr Frauen, die meisten Angehörigen waren Mütter, knapp weniger als die Hälfte lebte mit den PatientInnen zusammen, der Stil der Einladung zur Angehörigenrunde war häufiger offen als direktiv und auch bezüglich früherer Erfahrung mit Angehörigenrunden gab es keine signifikanten Unterschiede. Unterschiede zwischen TeilnehmerInnen und Nicht-TeilnehmerInnen in der Lebensqualität, im gesundheitlichen Wohlbefinden und bei Problemen in der Familie sind Nutzung der Angehörigenrunde 31 Eigene Gründe zu kommen Vermutete Gründe anderer Angehöriger zu kommen Aufklärung und Information über die Erkrankung (N=53) Informationen vom ÄrztInnen (N=103) Aussprache und Austausch mit Gleichgesinnten (N=44) Sich aussprechen können (N=80) Hilfe bei der Überwindung des eigenen Schocks durch die Erkrankung eines Familienmitgliedes, Unterstützung (N=15) Praktische Tipps von anderen Angehörigen (N=72) Hilfe im Umgang mit den PatientInnen (N=10) Informationen von anderen Angehörigen (N=69) Um den PatientInnen zu helfen, Wunsch der PatientInnen (N=8) Sich verstanden fühlen (N=49) Hilfe in sozialrechtlichen Angelegenheiten (N=3) Sozialer Kontakt, neue Bekannte (N=33) Schlechtes Gewissen beruhigen (N=16) Tabelle 3:Gründe für eine Teilnahme an der Angehörigenrunde (in der Reihenfolge der Häufigkeit; Mehrfachnennungen) in Tabelle 2 dargestellt. Die Angaben von 144 Angehörigen konnten in die Auswertung der Lebensqualität einbezogen werden. Beim Vergleich ergaben sich in drei Bereichen statistisch signifikante Unterschiede zwischen TeilnehmerInnen und NichtTeilnehmerInnen. Erstere zeigten niedrigeres physisches, psychisches und globales Wohlbefinden als die Nicht-TeilnehmerInnen. In die Auswertung des Fragebogens zu Problemen in der Familie (FPQ) konnten die Angaben von 97 Angehörigen einbezogen werden, die Restlichen mussten aufgrund zu vieler fehlender Angaben ausgeschlossen werden. Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen teilnehmenden und nicht teilnehmenden Angehörigen ergab sich in zwei der fünf Bereiche. Die teilnehmenden Angehörigen zeigten höhere Werte bei objektiver Belastung und niedrigere bei positiver Einstellung dem/der PatientIn gegenüber. Was das gesundheitliche Wohlbefinden betrifft, so zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen TeilnehmerInnen und Nicht-TeilnehmerInnen. Gründe für eine Teilnahme Gründe gegen eine Teilnahme Die Angehörigen wurden offen nach ihren drei wichtigsten Gründen dafür, an der Angehörigenrunde teilzunehmen, gefragt. Angaben dazu wurden von 60 Angehörigen gemacht, wobei mehrere Angaben pro Person die Regel waren. Weiterhin wurden die Angehörigen gebeten anhand einer vorgegebenen Liste einzuschätzen, was Gründe anderer Angehöriger sind, zur Angehörigenrunde zu kommen. 121 Angehörige machten Angaben zu diesem Punkt. Die Gründe für eine Teilnahme an der Angehörigenrunde sind in Tabelle 3 dargestellt. Am wichtigsten waren hier der Erhalt von Informationen, aber auch die Möglichkeit sich auszutauschen und auszusprechen, und praktische Tipps von Menschen in einer ähnlichen Situation zu erhalten. Sich verstanden fühlen, Wunsch nach sozialen Kontakten und neuen Bekannten, Hilfe bei der Überwindung des eigenen Schocks durch die Erkrankung eines Familienmitgliedes und Hilfe im Umgang mit den PatientInnen waren weitere wichtige Gründe für den Besuch einer Angehörigenrunde. 78 Personen gaben ein bis drei Gründe an, die gegen eine Teilnahme an der Angehörigenrunde sprachen. Zur Frage nach den Gründen anderer, nicht an der Angehörigenrunde teilzunehmen, nahmen 77 Angehörige Stellung. Gründe gegen eine Teilnahme in der Angehörigenrunde sind in Tabelle 4 dargestellt. Am wichtigsten waren hierbei emotionale Gründe wie Scheu, Angst, Scham, Resignation, ein nicht Akzeptieren wollen der Krankheit und die Befürchtung einer zusätzlichen Belastung. Weitere wichtige Gründe, die gegen eine Teilname sprachen, waren Zeitmangel, zu weite Entfernung der Angehörigenrunde, kein Hilfebedarf sowie die Tatsache, nicht eingeladen worden zu sein. Diskussion Insgesamt nahmen über 40% der befragten Angehörigen an der Angehörigenrunde teil. Dies übertrifft bei weitem die durchschnittliche Teilnahme an Angehörigenangeboten von 2% in Österreich, Deutschland Sibitz, Schrank, Amering 32 Eigene Gründe nicht zu kommen Vermutete Gründe anderer Angehöriger nicht zu kommen Zeitmangel (N=32) Scheu, Angst, Scham, die Krankheit nicht wahrhaben wollen, zusätzliche Belastung, deprimiert über andere Fälle,, Desinteresse, Resignation (N=76) Scheu, Angst, die Krankheit nicht wahrhaben wollen, zusätzliche Belastung, deprimiert über andere Fälle, Müdigkeit (N=19) Zeitmangel (N=23) Kein Informations- oder Hilfebedarf (N=16) Angehörigenrunde zu weit entfernt (N=5) Angehörigenrunde zu weit entfernt (N=16) Keine Einladung erhalten (N=5) Keine Einladung erhalten (N=15) Kein Informations- oder Hilfebedarf (N=3) Unzufrieden mit Angebot (N=7) Unzufrieden mit Angebot (N=1) PatientIn wünscht das nicht bzw. beibt nicht allein zu hause (N=4) Tabelle 4:Gründe, nicht zur Angehörigenrunde zu kommen (in der Reihenfolge der Häufigkeit; Mehrfachnennungen) und der Schweiz [21]. Diese hohe Teilnahme ist einerseits dadurch zu erklären, dass durch die Thematisierung der Angehörigenrunde bei der regelmäßigen Befragung der betreuenden ÄrztInnen über den 17monatigen Zeitraum dieser Studie diese in der Folge vermutlich häufiger als sonst in der klinischen Routine üblich Angehörige zur Angehörigenrunde eingeladen hatten. Andererseits ist anzumerken, dass 40,8% der befragten Angehörigen (60 von 147) das Angebot nutzten und nicht 40,8% aller von den PatientInnen genannten nahen Angehörigen und Bezugspersonen (N=333). Wie viele der Nicht-StudienteilnehmerInnen die Angehörigenrunde besuchten ist unbekannt, doch selbst wenn niemand dieser Personen die Angehörigengruppe besucht hätte so würden 60 TeilnehmerInnen von insgesamt 333 Angehörigen noch immer einer Rate von 18% entsprechen. Trotz dieser außergewöhnlich hohen Teilnahme zeigen die hier vorliegenden Ergebnisse deutlich mögliche Hindernisse für Angehörige am Weg zu für sie bestimmten Angeboten ebenso wie Möglichkeiten für Verbesserungen. Das erste in diesem Sinne bedeutende Ergebnis war die eher geringe Übereinstimmung von 67,1% zwischen ÄrztInnen und Angehörigen bei der grundlegenden Frage ob überhaupt eine Einladung zur Angehörigenrunde erfolgt war. Einige Angehörige, die laut ÄrztInnen nicht eingeladen worden waren, gaben an, eine Einladung erhalten zu haben. Diese Tatsache ist dadurch erklärbar, dass die Einladung in einem multiprofessionellen Team auch von anderer Seite als nur durch die behandelnden ÄrztInnen ausgesprochen werden kann und dass die Angehörigen auch über den Aushang an der Klinik oder durch ein anderes Familienmitglied von der Angehörigenrunde erfahren können. Auf der anderen Seite gab es auch Angehörige, die sich nicht eingeladen fühlten, jedoch laut behandelnder ÄrztInnen eingeladen worden waren. Diese Diskrepanz ist am ehesten dadurch zu erklären, dass die Einladung durch die ÄrztInnen oft über die PatientInnen mittels Informationsblatt erfolgte, das möglicherweise nicht an die Angehörigen weitergegeben wurde, oder dass sie sich durch eine nicht persönliche Einladung nicht angesprochen fühl- ten. Dieses Ergebnis zeigt, dass der Weg auf dem eine Einladung erfolgt von grundlegender Bedeutung ist und dass persönlicher Kontakt und eine persönliche Einladung eine wichtige Motivation zur Teilnahme darstellen. Auch fanden sich in unserer Untersuchung Hinweise darauf, dass Angehörige von PatientInnen der Tages­klinik im Vergleich zu Angehörigen von stationären PatientInnen das Angebot der Angehörigenrunde etwas häufiger wenngleich nicht statistisch signifikant häufiger nutzten. Eine größere Stichprobe würde hier vermutlich signifikante Ergebnisse liefern. Möglicherweise kann daher eine integrative Betreuung, wo die Angehörigenarbeit zur Routine gehört, wie dies bei uns stärker in der Tagesklinik als auf der Station der Fall ist, die Nutzung der Angehörigenangebote fördern. Yamaguchi et al [28] zeigten, dass besonders Angehörige mit hohen “Expressed Emotions” und solche mit hoher Belastung von Angehörigenangeboten profitieren. Die vorliegende Untersuchung zeigte, dass dies auch die Personen sind, die solche Angebote bevorzugt wahrnehmen. So zeigte sich etwa, dass die Teil- Nutzung der Angehörigenrunde nehmerInnen der Angehörigenrunde signifikant niedrigere Werte von psychischem, physischem und globalem Wohlbefinden hatten als die NichtTeilnehmerInnen. Außerdem zeigten sie eine höhere Kontaktzeit zu den PatientInnen, eine höhere objektive Belastung und weniger positive Einstellung dem/der PatientIn gegenüber. Die an der Angehörigenrunde teilnehmenden Personen waren meist die Eltern der PatientInnen. Personen, die schon früher an Angehörigenangeboten teilgenommen hatten, nahmen besonders häufig wieder teil. Dabei spielten frühere Erfahrungen mit solchen Angeboten offensichtlich keine Rolle, denn sowohl Personen mit positiven als auch mit negativen Vorerfahrungen nahmen das Angebot bevorzugt wieder wahr. Auch Angehörige, die zuvor noch nie ein entsprechendes Angebot erhalten hatten, konnten zu einem großen Prozentsatz für eine Teilnahme motiviert werden während Angehörige, die bereits früher trotz Einladung an Angehörigenrunden nicht teilnahmen vermehrt wieder nicht teilnahmen. Besonders wichtig erscheinen diesbezüglich Ergebnisse der Befragung der Angehörigen nach den Gründen für bzw. gegen eine Teilnahme an der Angehörigenrunde. Bei den Gründen für eine Teilnahme stand der Wunsch nach Aufklärung und Information an oberster Stelle. Aber auch die Möglichkeit sich auszutauschen und mit Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation zu sprechen waren eine wichtige Motivation, ebenso wie der Erhalt von Hilfe und praktischen Tipps von anderen Angehörigen. Bei den Gründen nicht zur Angehörigenrunde zu kommen standen Gefühle wie Scheu, Angst, Scham, Resignation oder das nicht akzeptieren wollen der Krankheit sowie Belastung durch negative Gefühle anderer GruppenteilnehmerInnen ganz oben. Dieses Ergebnis steht in Übereinklang mit einer aktuellen qualitativen Untersuchung die ebenfalls die Betonung intensiver negativer Gefühle als Hin- 33 dernis für eine Teilnahme fand [9]. Kein Informations- oder Hilfebedarf wurde nur selten als Grund für die Nicht-Teilnahme genannt. Diese explorative Fragebogenuntersuchung hat einige methodische Schwächen. Eine Einschränkung besteht durch unvollständig ausgefüllte Fragebögen. Vor allem im Fragebogen zur Nutzung von Hilfe-Angeboten und im Fragebogen zu Problemen der Familie (FPQ) wurden einige Fragen nicht beantwortet, was darauf hinweist, dass diese Fragebögen verbesserungswürdig sind. Eine größere Stichprobe und größere Fallzahlen durch vollständig aufgefüllte Fragebögen würden zuverlässigere statistische Ergebnisse liefern. Auch bleibt unklar, wie die Meinung und Situation derer ist, die nicht geantwortet haben, jedoch ist die insgesamte Fragebogenrücklaufrate von 68% sehr hoch für eine solche Arte der Untersuchung. Die in der vorliegenden Untersuchung gefundenen Merkmale von TeilnehmerInnen und Nicht-TeilnehmerInnen sowie die genannten Gründe gegen die Inanspruchnahme der Angehörigenrunde weisen auf eine hohe Belastung bei gleichzeitig bestehenden Berührungsängsten mit Angeboten der Angehörigenarbeit und eine hohe Stigmatisierung von Angehörigen psychisch Kranker hin. Die erfolgreiche Integration von Angehörigen in die Therapie erfordert daher von professionellen HelferInnen Einfühlsamkeit und besonderes Engagement. Literatur Danksagung [11] Wir danken allen PatientInnen, Angehörigen und ÄrztInnen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an unserer Studie. Dem „Medizinisch-wissenschaftlichen Fonds des Bürgermeisters Wien“ danken wir für die finanzielle Unterstützung. Herzlichen Dank auch an Dr. Thomas Zidek für die statistische Beratung. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12] [13] Angermeyer M.C., Kilian R., Matschinger H.: WHOQOL-100 und WHOQOLBREF (WHO-QOL) Handbuch für die deutschsprachigen Versionen der WHO Instrumente zur internationalen Erfassung von Lebensqualität. Hogrefe, 2000. Angermeyer M.C.: Befindlichkeitsstörungen der Eltern von Patienten mit schizophrenen und affektiven Störungen. Psychother Psychosom Med Psychol 51, 255-260 (2001). Awad A.G., Voruganti L.N.: The burden of schizophrenia on caregivers: a review. Pharmacoeconomics 26, 149-62 (2008). Bortz J., Liener GA.: Kurzgefasste Statistik für die klinische Forschung. Ein praktischer Leitfaden für die Analyse kleiner Stichproben. Springer, Berlin Heidelberg New York 1998. Brent B.K., Giuliano A.J.: Psychoticspectrum illness and family-based treatments: a case-based illustration of the underuse of family interventions. Harv Rev Psychiatry 15, 161-8 (2007). Cheng L.Y., Chan S.: Psychoeducation program for chinese family carers of members with schizophrenia. West J Nurs Res 27, 583-599 (2005). Chien W.T., Chan S.W.C.: One-year follow-up of a multiple-family-group intervention for Chinese families of patients with schizophrenia. Psychiatr Serv 55, 1276-1284 (2004). Chien W.T., Chan S.W., Thompson D.R.: Effects of a mutual support group for families of Chinese people with schizophrenia: 18-month follow-up. Br J Psychiatry 189, 41-49 (2006). Chien W.T., Norman I., Thompson D.R.: Perceived benefits and difficulties experienced in a mutual support group for family carers of people with schizophrenia. Qual Health Res 16, 962-981 (2006). Cohen A.N., Glynn S.M., MurraySwank A.B., Barrio C., Fischer E.P., McCutcheonS.J., Perlick D.A., Rotondi A.J., Sayers S.L., Sherman M.D., Dixon, L.B..: The family forum: directions for the implementation of family psychoeducation for severe mental illness. Psychiatr Serv 59, 40-8 (2008). Goldberg D., Williams P.: A User's Guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson 1988. Kramer B., Simon M., Katschnig H.: Wiener Angehörigenfragebogen (Wang) Ludwig Bolzmann Institut für Sozialpsychiatrie, Wien 1993. Krautgartner M., Unger A., Gössler R., Rittmannsberger H., Simhandl C., Grill W., Stelzig-Schöler R., Doby D., Wancata J.: Minderjährige Angehörige von Schizophrenie-Kranken: Belastungen Sibitz, Schrank, Amering [14] [15] [16] [17] [18] [19] und Unterstützungsbedarf. Neuropsychiatr 21, 267-74 (2007). Magliano L., Fiorillo A., De Rosa C., Malangone C., Maj M.: Family burden in long-term diseases: a comparative study in schizophrenia vs. physical disorders. Soc Sci Med 61, 313-22 (2005). Magliano L., Fiorillo A., Marangone C., De Rosa C., Maj M.: Patient functioning and family burden in a controlled, realworld trial of family psychoeducation for schizophrenia. Psychiatr Serv 57, 1784-1791 (2006). Mino Y., Shimodera S., Inoue S., Fujita H., Fukuzawa K.: Medical cost analysis of family psychoeducation for schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci 61, 20-24 (2007). Pekkala E., Merinder L.: Psychoeducation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev CD002831 (2002). Pharoah F., Mari J., Rathbone J., Wong W.: Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev CD000088 (2006). Pilling S., Bebbington P., Kuipers E., Garety P., Geddes J., Orbach C., Morgan C.: Psychological treatments in schizophrenia: 1. Meta-analysis of family interventions and cognitive behavioural therapy. Psychol Med 32, 763-782 (2002). 34 [20] Pitschel-Walz G., Bäuml J., Bender W., Engel R.R., Wagner M., Kissling W.: Psychoeducation and Compliance in the Treatment of Schizophrenia: Results of the Munich Psychosis Information Project Study. J Clin Psychiatry 67, 443-452 (2006). [21] Rummel-Kluge C., Pitschel-Walz G., Bäuml J., Kissling W.: Psychoeducation in schizophrenia – results of a survey of all psychiatric institutions in Germany, Austria and Switzerland. Schizophr Bull 32, 765-775 (2006). [22] Schmid R., Spiessl H., Vukovich A., Cording C.: Belastungen von Angehörigen und ihre Erwartungen an psychiatrische Institutionen. Fortschr Neurol Psychiat 71, 118-128 (2003). [23] Schmitz N., Kruse J., Tress W.: Psychometric properties of the General Health Questionnaire (GHQ-12) in a German primary care sample. Acta Psychiatr Scand 100, 462-8 (1999). [24] Schrank B., Sibitz I., Schaffer M., Amering M.: Zu unrecht vernachlässigt: Geschwister von Menschen mit schizophrenen Psychosen. Neuropsychiatr 21, 216-225 (2007). [25] Schützwohl M., Glöckner M., Matthes C., Eichler T., Kallert T.: Die Belastung von Bezugspersonen voll- und teilstationär behandelter psychisch Erkrankter. Ergebnis einer randomisierten kontrollierten Untersuchung. Psychiatr Prax 32, 281-8 (2005). [26] Unger A., Krautgartner M., Freidl M., Stelzig-Schöler R., Rittmannsberger H., Simhandl C., Grill W., Doby D., Wancata J.: Der Bedarf der Angehörigen Schizophrenie-Kranker. Neuropsychiatr 19, 141-147 (2005). [27] Wancata J.: Angehörige psychisch Kranker: Belastungen, Bedürfnisse und Bedarf. Neuropsychiatr 19, 131-133 (2005). [28] Yamaguchi H., Takahashi A., Takano A., Kojima T.: Direct effects of short-term psychoeducational intervention for relatives of patients with schizophrenia in Japan. Psychiatry Clin Neurosci 60, 590597 (2006) Dr. Ingrid Sibitz Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 35–41 Die Bedingungsvariablen der postpartalen Dysphorie Mirjam Complojer1, Hansjörg Schweigkofler1, Josef Schwitzer1, Arthur Scherer2, Georg Oliver Schwitzer3 und Wulf Schiefenhövel4 Psychiatrischer Dienst des Sanitätsbezirkes Brixen Gynäkologische und Geburtshilfliche Abteilung des Sanitätsbezirkes Brixen 3 Univ.-Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Sozialpsychiatrie, MUI, Innsbruck 4 Max-Planck-Institut Gruppe Humanethologie, Andechs 1 2 Schlüsselwörter: Postpartale Dysphorie – Baby Blues – Wochenbettstörungen – unsicheres soziales Netzwerk – Heultage Key words: postpartum dysphoria – Baby Blues dass vor allem Frauen, welche ein unsicheres soziales Netzwerk nach der Krankenhausentlassung vorfanden, Symptome einer Dysphorie auf­wiesen. Somit scheint die postpartale Dysphorie ein hilfesuchendes Signal der Mutter an ihre Umgebung zu sein. – ­ puerperal-disease – unsecure social ­environment Die Bedingungsvariablen der postpartalen Dysphorie Die postpartale Dysphorie (Baby Blues) ist eine Wochenbettstörung, deren Prävalenz in den westlichen Industrieländern mit 26 bis 85% angegeben wird. Diese milde Verstimmung tritt zwischen dem dritten und zehnten Tag postpartum auf, dauert einige Tage und verschwindet ohne therapeutische Behandlung wieder. Gerade weil diese Störung von alleine wieder abklingt, sind deren Ursachen noch wenig erforscht. Die vorliegende Untersuchung zur Ursachenforschung wurde im Rahmen des internationalen Münchner Postpartum-Projektes mittels eines Fragebogens durchgeführt. Die Studie in Brixen (Italien) ergab, © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 The preconditions of postpartum dysphoria Postpartum dysphoria (Baby Blues) is a puerperal-disease of mothers who have recently given birth; its prevalence in western industrialized countries ranges from 26 to 85% The baby-blues may begin during the first week after birth, lasts a few days and disappears without any medical treatment. Therefore there is still little research dealing with this phenomeon. The present study was carried out in Brixen, Italy, in the framework of the international Munich-PostpartumProject and was done by means of a questionnaire. It showed that these women who had to face an unsecure social environment after hospital discharge, had symptoms of a dysphoria. For that reason the Blues seems to be a phenomenon of socially distressed women. Hintergrund und Fragestellung Begriffsbestimmung In der Regel wird eine Dreiteilung der Wochenbettstörungen vorgenommen: postpartale Dysphorie, Wochenbettdepression und Wochenbettpsychose. Die postpartale Dysphorie (BabyBlues, Heultage) ist dabei die häufigste und mildeste Verstimmung. Sie tritt meist zwischen dem dritten und zehnten Tag postpartum auf [1], dauert einige Tage und verschwindet ohne Behandlung wieder. Folgende Symptome werden als für die Dysphorie typisch erachtet: Weinerlichkeit, Empfindsamkeit, leichte Irritierbarkeit, ängstliche Besorgtheit, subjektiv verspürte Beeinträchtigung der Konzentration, diskrete Gefühle persönlicher Entfremdung, körperliches Unwohlsein, Appetit- und Schlafstörungen und gelegentlich euphorische Stimmungslage [2]. Die Prävalenz wird mit 26 bis 85% angegeben [2], wobei auch andere Werte in der Literatur zu finden sind (15% bis 80% nach [3]; [4, 5], 41,88% [6]). Weder im ICD- 10, noch im DSM IV wird die postpartale Dysphorie eigens klassifiziert. Im ICD-10 werden unter F53 „Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, nicht andernorts klassifizierbar“ genannt. Man wählt Complojer, Schweigkofler, Schwitzer, Scherer, Schwitzer, Schiefenhövel meist zwei Kodierungen: 1. F30-F39 (verschiedene Schweregrade einer Depression) und 2. O99.3 (Psychische Krankheiten und Erkrankungen des Nervensystems, die zu Komplikationen im Wochenbett führen). Man unterscheidet F53.0 (leichte-), F53.1 (schwere-), F53.8 (sonstige-) und F53.9 (nicht näher bezeichnete psychische Störung im Wochenbett). Eine schwere postpartale Dysphorie könnte als eine dieser Störungen klassifiziert werden [7,8]. Das DSM-IV erlaubt bei den verschiedenen depressiven Erkrankungen (aktuelle oder letzte depressive, manische oder gemischte Episode bei Major Depression, Bipolar I oder II, kurze psychotische Störung) die Zusatzcodierung „Mit postpartalem Beginn“. Diese kann dann verwendet werden, wenn die Episode innerhalb von vier Wochen nach der Entbindung ihren Beginn hat [9]. Ursachen Man kann die Ursachenforschung auf dem Gebiet der Postpartalen Dysphorie in drei Bereiche einteilen, wie folgend beschrieben (Einteilung nach [6]). Hormonell-biologische Ursache: hor­ mo­nelle Dysregulation als Folge der physiologischen Hormonum­stellung nach dem Partus Mitte der 50-er Jahre des 20. Jahr­ hunderts wurde die Endo­krinologie vermehrt untersucht und besonderes Interesse galt dem Einfluss der Hormone auf die Psyche. Die „Entdeckung“ des Baby-Blues fällt zeitlich mit dem Aufkommen dieser Forschungsorientierung zusammen. Man erwartete förmlich eine Veränderung der Befindlichkeit wäh­rend des Wochenbettes aufgrund der neuen Erkenntnisse der Endokrinologie über die hormonellen Veränderungen nach einer Geburt. Ab 1970 sind dazu viele Untersuchungen gemacht worden. Man wollte die endokrinologischen Veränderungen ausfindig machen, die für die Wochen­bettstörungen verantwortlich sind [10, 11, 12]. Man kam jedoch zu keinem einheitlichen Ergebnis, da unterschiedliche Hormone als Auslöser benannt wurden. Es ist noch nicht gelungen, die Beziehung zwischen Hormonen und spezifischen Stimmungsveränderungen eindeutig zu klären. Für den Blues wurden unter anderem folgende als Auslöser genannt: Östrogene [7], Tryptophan [13, 14], Tryptophan, Kynurenin und Neopterin [15], Thyroxin [16, 17, 18] und eine Unausgewogenheit zwischen Östrogenen und Progesteron [1, 19, 20]. Vertreter der endokrinologischen Hypothese gehen häufig von der An­nahme aus, dass die Wochen­ bettstörungen direkt mit dem Geburts­ ereignis zusammenhängen. Allgemein herrscht bei der hormonalen Ursachenforschung keine Einigkeit über die affektiven Bedingungen der postpartalen Dysphorie. Schiefenhövel und Dammann [21] gehen davon aus, dass die postpartale Dysphorie nicht primär von endokrinologischen Faktoren bedingt wird, da diese auf der ganzen Welt gleich vorherrschen müssten, aber unterschiedliche Prävalenzen der postpartalen Dysphorie festzustellen sind. Vielmehr gehen sie von einer anthropologischen Ursache aus (siehe unten). Umweltbedingt-psychologische Ur­ sache: transitorische reaktive Stö­ rung als Folge der Belastung durch die Geburt und die damit verbundenen Lebensumstände Die Emotionstheorie von Schachter und Singer [22] betont auch die hormonelle Komponente bei der Entstehung des Baby- Blues. Man geht hier von einer hormonell bedingten, aber eher unspezifischen Veränderung der emotionalen Aktivierung aus. Die eigene- und Fremdbewertung des Kindes ist hierbei von Bedeutung und wird durch die Erwartungen der Mutter, sowie durch das Temperament des Kindes bedingt. Als wichtige 36 Einflussfaktoren werden die Atmosphäre während der Geburt und des Wochenbettes und der Oxytozinspiegel gesehen. Ist dieser hoch, so steigt die Lernbereitschaft. Ihm wird auch eine wesentliche Rolle bei der Geburt und dem Stillen eingeräumt [23]. Condon und Watson formulierten 1987 eine Hypothese, die zwei Komponenten vorsieht: 1. Hormonell bedingte emotionale Labilität, die zu einem inten­ siveren emotionalen E r l e b e n führt, 2. Diskrepanz zwischen dem erwarteten Phantasie-Baby und dem realen Neugeborenen. Der Baby-Blues ist somit als Trauerreaktion auf den Verlust des Phantasie- Babys zu verstehen und erleichtert die Zuwendung zum realen Baby. Diese Hypothese konnte bisher nicht bestätigt werden. Bei diesen Erklärungsversuchen tritt die Pathologie der postpartalen Dysphorie in den Hintergrund [6]. Unter anderem wurde von Schiefenhövel eine dritte Theorie zur Entstehung entwickelt: Anthropologische Ursache: Kulturgebundenes Syndrom der industriellen Gesellschaft Dieses anthropologische Erklärungsmodell geht von einem kulturgebundenen Syndrom aus. Verbunden damit ist die evolutionsbiologisch inspirierte Annahme, daß sich die meisten menschlichen Verhaltensäusserungen evolutionär entwickelt haben. Sie sind adaptiv. Doch welche Funktion sollten ein Baby Blues oder eine postpartale Depression erfüllen? Schiefenhövel [24] hält die hohe Rate an postpartaler Dysphorie in Industrieländern für dysfunktional. Er hat humanethologische Forschungen in der traditionalen Kultur der Eipo im Hochland von West-Neuguinea und bei den Trobriandern in Papua-Neuguinea durchgeführt und festgestellt, dass die postpartale Dysphorie und Die Bedingungsvariablen der postpartalen Dysphorie die Wochenbettdepression dort nahezu unbekannt sind. Beide oben genannten Modelle können diese Unterschiede nicht erklären. Die Hauptursachen dafür sieht Schiefenhövel [24] in folgenden Punkten: 1. Körperkontakt: In traditionalen Kulturen findet der Körperkontakt meist bald nach der Geburt statt, und auch danach haben Mutter und Kind sehr intensiven Körperkontakt (bei einjährigen Kindern liegt der Wert tagsüber bei 60%, nachts noch höher). 2. Stillen: Es gibt meist ein frühzeitiges und problemloses Ansetzen und Stillen des Kindes. 3. Schutz vor Störung: Der Mutter wird ein Raum zugewiesen, in dem sie Schutz und Betreuung findet und den sie allerdings auch nicht verlassen darf. 4. Unterstützung: Die Mutter erhält Unterstützung und Beratung durch eine erfahrene Frau. 5. Würde in der Gemeinschaft: Die Mütter, besonders die Erstgebärenden, werden oft beschenkt oder sozial besonders herausgehoben. Das gibt ihnen eine Würde in der Gemeinschaft. 6. Natürliche Geburt: In traditionalen Kulturen findet die Geburt weitgehend natürlich statt. Das Gebärverhalten (z.B. Gebärstellung) kann frei gewählt werden. Es gibt keine medizinischen Eingriffe wie Dammschnitte oder anästhesiologische Maßnahmen. 7. Sexualtabu: Mutter und Ehemann dürfen postpartal über mehrere Monate keinen Sex haben. Obwohl die Frauen in den westlichen Ländern von der beruflichen Arbeit befreit sind, erwarten sie neue Aufgaben, die sie zusätzlich zu den bisherigen Alltagsbelastungen erledigen müssen. Zudem haben die meisten Frauen kaum Erfahrung im Umgang mit Kindern. Von allen Seiten wird aber die Wichtigkeit eines adäquaten Umgangs mit dem Säugling propagiert (siehe Boom an Ratgebern über die richtige Pflege, Musik und Ernährung), während kaum auf den mütterlichen Instinkt geachtet wird. Die Geburt ist eine wichtige Anpassungsphase, während der sich Mutter und Kind allmählich aneinander gewöhnen können [25]. In einigen Kulturen wird deshalb kein oder wenig Besuch zugelassen. Wenn Mutter und Kind sich ganz aufeinander beziehen, so brauchen sie Hilfe bei den alltäglichen Arbeiten. In einigen Kulturen nehmen vor allem die Erstgebärenden eine Sonderstellung in der Gesellschaft ein [26]. Die Geburt und die Phase nach der Geburt haben sich viele Kulturen so geformt, dass sie ihren biologischen und sozialen Zweck erfüllen. Die Riten und Gewohnheiten haben sich allmählich herausgebildet und stellen in etlichen Fällen einen evolutionären, angepassten Prozess dar [27]. Je mehr sich eine Kultur von den traditionellen Gewohnheiten entfernt, die sich durch die biologische- und kulturelle Evolution gefestigt haben, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, eine Störung auszubilden [28]. Nach Schiefenhövel [29] kann unter anderem die Trennung von Mutter und Neugeborenem durch medizinische und klinische Routinemaßnahmen zu einer Trauerreaktion und so zu einer Bindungsstörung führen. Die Mutter hat das Gefühl, ihren „biologischen Auftrag“, das Kind zu versorgen und es an ihrem Körper zu haben, nicht erfüllen zu können [22]. Schiefenhövel [24] sieht Geburt und Wochenbett als vulnerable Übergangsphase an, die, je nachdem wie sie gestützt und abgefangen wird, symptomlos bleibt oder zum Blues führt. Es liegt daher die Annahme nahe, dass es sich bei der postpartalen Dysphorie um ein multifaktoriell beeinflusstes Krankheitsbild handelt, dessen Auftreten durch bestimmte Unterschiede in der Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett der Mütter ausgelöst wird. So z. B. durch die Trennung von Mutter und Kind, 37 Störung der Mutter-Kind-Dyade oder die Überforderung. Fragestellung Zurzeit gibt es noch keine einheitliche Definition der postpartalen Dysphorie. Durch eine ausführliche Befragung sollte eine Formulierung dieser Störung und ein Beitrag zur Klärung ihrer Pathogenese möglich werden. Die Bedingungsvariablen für die Gefühle und Empfindungen der Frauen im Wochenbett sollten erhoben werden, ebenso wie der Einfluss der Hormone Östradiol, Prolaktin und Progesteron auf die Befindlichkeit. Es sollte geklärt werden, ob es sich beim Blues um eine vorübergehende Anpassungsstörung handelt und ob – im Einklang mit evolutionsbiologischen Hypothesen – eine Störung des frühen Wochenbetts und damit des Bondings zwischen Mutter und Kind, sowie eine von der Wöchnerin subjektiv wahrgenommene suboptimale Situation für ihr Kind und sie selbst einem Baby-Blues zugrunde liegen kann. Als Messinstrumente kamen standardisierte Fragebögen zur psychischen Befindlichkeit zum Einsatz. Im Vergleich mit anderen Studien sollte geprüft werden, welche Prävalenz der postpartalen Dysphorie und welche spezifischen Bedingungen im Setting der Brixner Klinik auftraten und ob sich aus den Untersuchungsergebnissen Vorschläge für Verbesserungen in der Wochenbettphase ableiten lassen. Empirische Untersuchung Die Untersuchung wurde in Brixen, Südtirol, im Rahmen des „Münchner Postpartum- Projekts“, durchgeführt. Das Auftreten verschiedener Symptome im Wochenbett wurde in den verschiedenen Subgruppen, auch im außereuropäischen Ausland verglichen. Einflussfaktoren wie der Geburtsverlauf, die Medikalisierung der Complojer, Schweigkofler, Schwitzer, Scherer, Schwitzer, Schiefenhövel Geburt, d.h. das Ausmaß medizinischer Interventionen, der Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, die soziale Unterstützung und die Persönlichkeitsstruktur wurden bezüglich des Auftretens von Symptomen untersucht [30, 21]. Im Rahmen dieses Projektes wurde zunächst eine retrospektive schriftliche Befragung von 585 Müttern, die 3-6 Monate zuvor an zwei Münchner Frauenkliniken geboren hatten, durchgeführt [6]. Basierend auf den Ergebnissen dieser Vorstudie wurde eine Untersuchung zur Befindlichkeit im Wochenbett geplant. Ein halbstrukturiertes Interview zur Durchführung im frühen Wochenbett und ein schriftlicher Fragebogen zur Durchführung im späten Wochenbett wurden entwickelt. Neben der Integration vorhandener standardisierter Instrumente in den Fragebogen erschien eine ausführliche Symptomerfassung unerlässlich, auch, da im Rahmen der Studie der Vergleich interkultureller Subgruppen geplant war [30]. Dies ergab einen ausführlichen Fragenkatalog zu verschiedenen Themenbereichen. Dieser Fragebogen wurde bereits für mehrere Untersuchungen in verschiedenen Ländern verwendet [vgl.31]. Das Untersuchungsdesign Die Studie wurde am Krankenhaus Brixen/Südtirol (Italien) an 51 deutsch­sprachigen Frauen durchgeführt. Kaiserschnittgeburten wurden von der Untersuchung ausgeschlossen. Methodik Die Hypothesen gingen davon aus, dass insbesondere solche Wöchnerin­ nen an einem Blues leiden, deren Möglichkeiten der Interaktion mit dem Neugeborenen nicht an dem stammesgeschichtlich evoluierten Prima­ten-Muster ausgerichtet sind und die (bewusst oder unbewusst) die postpartale Situation für das Kind und sich selbst als nicht befriedigend oder bedrohlich bewerten. Der Fragebogen wurde in den oben erwähnten Studien als vorstrukturiertes Interview verwendet. Depressive Symptome wurden aktuell sowohl in den im Fragebogen enthaltenen standardisierten Tests erfragt, als auch durch zusätzliche Items (z.B. Fühlen Sie sich traurig? Fühlen Sie sich einsam und alleingelassen?). Außerdem wurde die Mutter nach einer psychischen Erkrankung in der Familie gefragt mit der genauen Angabe der Diagnose und des Verwandtschaftsgrades. Die meisten Fragen wurden dichotom- oder anhand von Likert- Skalen beantwortet. Einige Fragen konnten von den Frauen ergänzt werden. Es wurden auch standardisierte Fragebögen hinzugenommen. Hierzu wurden alle seinerzeit in der Literatur vorhandenen Blues-Instrumente ausgewertet und in den Fragebogen integriert. Der Fragebogen von Kennerly und Gath [32] wurde von der Arbeitsgruppe als der wichtigste angesehen, da er am ausführlichsten war. Im Fragebogen enthalten sind folgende vier standardisierten Fragebögen: • Maternity Blues Questionnaire von Kennerly and Gath [32], • Scale for Measuring the Maternity Blues von Stein [33], • Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) von Cox et al [34], • Problemliste (PL) von Hahlweg [35]. Es wurden von den Wöchnerinnen anhand gewöhnlicher Blutproben auch Hormone untersucht. Das Östradiol, das Prolaktin und das Progesteron wurden im krankenhauseigenen Labor bestimmt. Zur statistischen Auswertung der Daten wurde das Statistikprogramm SPSS (Version 13.0) verwendet. Wenn eine Normalverteilung vorlag, wurde ein T- Test und die Korrelation nach Pearson gemacht. Wenn hingegen nicht normalverteilte Daten 38 vorlagen, so wurden ein U-Test nach Mann und Whitney und die Korrelation nach Spearman angewendet. Die Normalverteilung wurde anhand des Kolmogorov-Smirnov-Tests untersucht. Zwei binominale Variablen wurden anhand von Kreuztabellen ver­ glichen. Ein Zusammenhang p<0,05 wurde als signifikant- jener p<0,01 als hoch signifikant gewertet. Beim Maternity Blues Questionnaire von Kennerly and Gath wird der CutOff-Wert mit 8 angegeben, bei der Scale for Measuring the Maternity Blues von Stein ebenfalls mit 8 und bei der Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) von Cox et al. spricht man ab einem Wert von 9,5 von einer postpartalen Dysphorie. Anhand dieser Werte konnte die Gruppe der Untersuchten in Frauen mit einer postpartalen Verstimmung- und ohne eine solche eingeteilt werden. Dieselben Kriterien wurden auch für die anderen erwähnten Studien angewandt, um einen Vergleich ermög­ lichen zu können. Ergebnisse Soziodemografische Daten Die 51 befragten Mütter waren im Mittel 31,06 Jahre alt. Die jüngste war 19, die älteste 46 (Tabelle 1). Aus Abbildung 1 ist die Altersverteilung der Mütter ersichtlich. Zwei waren unter 20 Jahre alt. Zwischen 21 und 30 Jahre waren 25 Mütter und zwischen 31 und 40 Jahre waren 20 Mütter zum Zeitpunkt der Geburt. Vier Wöchnerinnen waren älter als 40. Für 20 Frauen war dies die erste Schwangerschaft (39,2%), während 17 Frauen (33,3%) von der zweiten berichteten und 12 (23,5%) von ihrer dritten Schwangerschaft. Nur jeweils eine Wöchnerin (je 2%) erlebte die vierte oder fünfte Schwangerschaft. Die Bedingungsvariablen der postpartalen Dysphorie Alter der Mütter 39 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 51 19 46 31,06 6,288 Tabelle 1: Alter der Mütter Von den 31 Mehrgebärenden gaben 11 (21,6%) an, dass es ihnen nach der früheren Schwangerschaft nicht gut gegangen war. Sie gaben vor allem körperliche Probleme und Schwäche an. Zwei nannten eine leichte postpartale Depression (subjektive volkstümliche Diagnostik, nicht medizinisch abgeklärt). 18 Frauen (35,3%) war es nach der Geburt gut gegangen. Die fehlenden drei machten keine Angabe dazu. Kennerlycut (Cut-Off-Wert=8) EPDS-Cut Cut-Off-Wert=9,5 Kein Blues Baby Blues Total Kein Blues 28 9 37 Baby Blues 4 10 14 32 19 51 Total Tabelle 2: Häufigkeiten nach Kennerly und EPDS, n = 51 Häufigkeit der postpartalen Dysphorie Nach dem Maternity Blues Questionnaire von Kennerly und Gath litten 19 (37,3%) von den 51 befragten Müttern an einem Baby Blues. Nach der Scale for Measuring the Maternity Blues von Stein hatten 11 Frauen (21,6%) einen Baby Blues. Alle Frauen, bis auf eine, die nach Stein einen Blues hatten, hatten ihn auch nach Kennerly und Gath. Nach der Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) von Cox et al. kann man 14 (27,5%) der Frauen dieser Stichprobe als postpartal dysphorisch bezeichnen. Von den 14 Frauen, die nach dem EPDS einen Blues hatten, hatten 10 auch beim Maternity Blues Questionnaire einen Blues- Wert (nach den Cut-Off-Werten). Im Vergleich mit dem Fragebogen von Stein wiesen sieben Frauen einen Wert auf, der auf einen Baby Blues hinweisen kann und sieben einen Wert, der auf keinen Baby Blues hinweist. Die statistische Auswertung ergab viele signifikante Ergebnisse. Die Untersuchung des Hormonstatus ergab bei den Frauen mit einer postpartalen Dysphorie einen signifikant niedrige- EPDS-Cut (Cut-Off-Wert=9,5) Östradiolwert Kein Blues Baby Blues Total 1 (<75) 4 5 9 2 (76-150) 13 6 19 3 (151-225) 8 3 11 4 (226-300) 5 0 5 5 (301-375) 2 0 2 6 (376-450) 2 0 2 7 (>451) 2 0 2 36 14 50 Total Tabelle 3: Östradiol, T = -3,529; p = 0,001 (T- Test für unabhängige Stich­ proben), n = 50 ren Östradiolwert als bei Frauen ohne Symptome einer Dysphorie (siehe Tabelle). Ein Ergebnis, das den vorhergehenden Studien zum Einfluss der Hormone nach der Geburt widerspricht. Somit könnte es sein, dass in dieser Stichprobe die Hauptursache für die postpartale Dysphorie nicht in den untersuchten Hormonen liegt. erstgebärende Frauen ein höheres Risiko haben, an einer Dysphorie zu leiden. Bei Frauen mit einer Dysphorie konnte eine höhere Rate an Problemen mit dem Stillen festgestellt werden und jene Frauen gaben an, durch diese Probleme besonders belastet zu sein. Frauen, die gleich nach der Geburt Körperkontakt zum Kind hatten, zeigten signifikant öfter Symptome einer Dysphorie. Weiters kann davon ausgegangen werden, dass vor allem ältere und Bezüglich der Symptome des Baby Blues konnten folgende festgestellt Complojer, Schweigkofler, Schwitzer, Scherer, Schwitzer, Schiefenhövel werden: eine besonders ausgeprägte Traurigkeit, welche von den Müttern verschieden erklärt wurde (v.a. Veränderung der Lebenssituation und Hormonumstellung), die erlebte Unsicherheit im Umgang mit dem Neugeborenen, leichtes Erschrecken. Im Allgemeinen waren die Frauen mit Blues-Symptomatik zufriedener mit der Klinik, möglicherweise da diese als schützender, helfender Ort wahrgenommen und geschätzt wird. Eine weitere statistische Signifikanz zwischen der postpartalen Dysphorie und besonderen Belastungen während der Schwangerschaft konnte festgestellt werden. So gaben die betroffenen Frauen öfter an, während der Schwangerschaft andere Personen betreut zu haben und besondere Ereignisse und berufliche Belastungen erlebt zu haben. Sie klagten öfter über eine schlechte Stimmung während der Schwangerschaft. Eine depressive Störung wurde jedoch bei keiner von den Frauen effektiv diagnostiziert. Die meisten signifikanten Ergebnisse konnten im Bereich der sozialen Unsicherheiten und Ängste ausgemacht werden. Auffällig war die Erwartung einer mangelhaften Unterstützung vonseiten der Umwelt nach der Entlassung aus der Klinik. Es ergab sich eine signifikant schlechtere Befindlichkeit der Frauen mit einer Dysphorie beim Gedanken an zuhause. Frauen mit einer Blues- Symptomatik wiesen eine stärkere Angst vor der Einsamkeit nach der Entlassung und eine Angst vor der Überforderung auf. Sie hatten einen niedrigeren Wunsch nach beruflicher Tätigkeit nach der Geburt des Kindes. Die Zufriedenheit mit der Partnerschaft wies eindeutig niedrigere Werte auf, ebenso konnte ein mangelder Kontakt zu den eigenen Eltern festgestellt werden. Dieses Ergebnis knüpft an das Ergebnis an, dass Frauen mit Blues auch weniger Hilfe vonseiten ihrer Ursprungsfamilie erwarten können. Mehr Frauen mit einer Dysphorie waren in städtischen Gebieten aufgewachsen, was sich damit erklären lässt, dass in den ländlichen Gebieten mehr Kontakt zu anderen und auch Sorge füreinander gepflegt wird. Jene Frauen hatten auch öfter existenzielle Nöte: finanzielle Sorgen und eine schlechte Wohnsituation. Vor allem Frauen, die in einer unsicheren sozialen Umgebung leben, können eine postpartale Dysphorie entwickeln. Das ist gut vereinbar mit einer Interpretation des Blues als evoluiertes Signalverhalten, über das zusätzliche soziale und psychologische Unterstützung ausgelöst wird. Darin liegt sehr wahrscheinlich der evolutionäre Sinn der Dysphorie als Signalsystem mit Appellfunktion. Die wahrgenommene mangelnde soziale Unterstützung könnte auch als verzerrte Wahrnehmung interpretiert werden, nach der depressive Frauen eine negative Sicht der Situation aufweisen (Zukunftsängste). Zusammenfassung In dieser Studie konnte festgestellt werden, dass vor allem jene Frauen an einer postpartalen Dysphorie leiden, die mit einer unsicheren sozialen Situation nach der Entlassung aus der Klinik konfrontiert werden. Sie beschreiben signifikant öfter Angst vor dem Alleinsein und sie erwarten sich wenig Unterstützung. Hinzu kommt oftmals eine ungünstige familiäre und finanzielle Situation und Unsicherheit im Umgang mit dem Kind. Positiv bewerteten die Frauen mit Dysphorie-Symptomatik den Aufenthalt in der Klinik. Genau diese Ergebnisse sollten Kliniken dazu veranlassen, Frauen je nach deren Befinden und Bedürftigkeit die Aufenthaltsdauer an der Klinik selbst bestimmen zu lassen. Aufgrund des deutlichen Leidensdruckes der Wöchnerinnen soll eine 40 Neuklassifikation dieser psychischen Störung vorgenommen werden. Denn nur durch klare diagnostische Kriterien und standardisierte Erhebungsmethoden kann garantiert werden, dass die postpartale Dysphorie als klinisch bedeutsame nosologische Einheit erkannt wird und Wege gefunden werden, in prophylaktischer und (psycho)therapeutischer Weise Hilfe anzubieten. Danksagung Besonderer Dank gilt: - den Probandinnen, - dem Personal der Gynäkologischen und Geburtshilflichen Abteilung des Krankenhauses Brixen, - dem Krankenhaus Brixen für die Kostenübernahme der Hormonproben. Literatur [1] Lanczik M H (1994) Entstehungsbedingungen und Verlauf postpartal auftretender psychischer Erkrankungen und Störungen. Habilitationsschrift Bayrische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg [2] Kapfhammer H P (1993) Psychische Störungen im Zusammenhang von Geburt und Wochenbett. In: Münchener Medizinische Wochenschrift 135 Nr 4. MMV Medizin Verlag GmbH, München [3] Pitt B (1973) Maternity Blues. British Journal of Psychiatry 122: 431-433 [4] Stein G S (1980) The Pattern of Mental Change and Body Weight Change in the First Post- Partum Week. Journal of Psychosomatic Research 24: 498-508 [5] Stein G S (1982) The Maternity Blues. In: Brockington I F & Kumar R (Eds) Motherhood and Mental Illness. Academic Press, London [6] Strobl Ch W (2002) Postpartale Dysphorie (Baby-Blues) und Wochenbettdepression- Eine katamnestische Untersuchung an 585 Müttern aus Kliniken in München und Starnberg. Dissertationsschrift. Technische Universität, München [7] Dilling H, Mombour W, Schmidt M H (Hrsg) (2000) Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD- 10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Die Bedingungsvariablen der postpartalen Dysphorie [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Leitlinien. Weltgesundheitsorganisation 4., korrigierte und ergänzte Auflage. Verlag Hans Huber, Göttingen Saß H, Wittchen H-U, Zaudig M , Houben I (2003) Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen-Textrevision. DSM-IV-TR. Hogrefe Verlag, Göttingen Riecher-Rössler A, Kuhl H , Bitzer J (2006) Psychische Störungen in Zeiten hormonaler Umstellung bei Frauen – Eine selektive Übersicht. Neuropsychiatrie Band 20: 155-165 Dalton K (1971) Prospective Study Into Puerperal Depression. British Journal of Psychiatry 118: 689-692 Ballinger C B, Buckley D E, Naylor G J, Stansfield D A (1979) Emotional Disturbance following childbirth- Clinical findings and urinary excretion of cyclic AMP. Psychological Medicine 9: 293300 Hamilton J A , Harberger P N (Hrsg) (1992) Postpartum Psychiatric Illness. A Picture Puzzle. University of Pennsylvania Press, Philadelphia Gard P R, Handley S L, Parson A D, Waldron G A (1986) Multivariate Investigation of Postpartum Mood Disturbance. British Journal of Psychiatry 148: 567-575 Baïlara K M, Henry C, Lestage J, Launay J M, Parrot F, Swendsen J, Sutter A L, Roux D, Dallay D, Demotes-Mainard J (2006) Decreased brain tryptophan availability as a partial determinant of post-partum blues. Psychoneuroendocrinology. Apr 31(3):407-13. Epub 2005 Nov 21 Kohl C, Walch T, Huber R, Kemmler G, Neurauter G, Fuchs D, Sölder E, Schröcksnadel H, Sperner-Unterweger B (2005) Measurement of tryptophan, kynurenine and neopterin in women with and without postpartum blues. Journal of Affect Disorder. 86 (2-3):135-42 Pop V J, De Rooy H A, Vader H L. Van der Heide D , Van Son M, Komproe I H, Essed G G, De Geus C A (1991) Postpartum Thyroid Dysfunction and Depression in an Unselected Population. New England Journal of Medicine 325: 371 Pedersen C A, Johnson J L, Silva S, Bunevicius R, Meltzer-Brody S, Hamer R M, Leserman J (2007) Antenatal thyroid correlates of postpartum depression. Psychoneuroendocrinology. Apr 32(3): 235-45. Epub 2007 Mar 7 Ijuin T, Douchi T, Yamamoto S, Ijuin Y, Nagata Y (1998) The relationship between maternity blues and thyroid dysfunction. Journal of Obstetrics and Gynaecolicy Research. Feb 24(1): 49-55 Klier CM, Muzik M, Dervic K, Mossaheb N, Benesch T, Ulm B, Zeller M (2007) The role of estrogen and progesterone in depression after birth. Journal [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] of Psychiatric research. Apr-Jun 41(3-4): 273-9. Epub 2006 Oct 17 Abou-Saleh MT, Ghubash R, Karim L, Krymski M, Bhai I (1998) Hormonal aspects of postpartum depression. Psychoneuroendocrinology. 23(5):465-75 Dammann G, Schiefenhövel W (o.J.) Study- Design: Identification of Relevant Factors for The Development of non-psychotic Postpartum Depression and Mood- Changes, so-called ‚BabyBlues‘, in different groups of women in Germany and Indonesia. unveröffentlicht Schachter S, Singer J E (1962) Cognitive, Social and Physiological Determinants of Emotional State. Psychol Rev 69: 379 Hartung A C, Hartung Ch (1997) Postpartum Blues: psychosomatische Aspekte des frühen Wochenbettes. Dissertationsschrift Humboldt-Universität, Berlin Schiefenhövel W (1994) Transkulturelle und evolutionsbiologische Aspekte von Schwangerschaft und Geburt. Sexuologie 1: 27-37 Schiefenhövel W (1991) Ethnomedizinische und verhaltensbiologische Beiträge zur pädiatrischen Versorgung. Curare 14,4: 195-204 Schiefenhövel W (1988) Geburtsverhalten und reproduktive Strategien der Eipo-Ergebnisse humanethologischer und ethnomedizinischer Untersuchungen im zentralen Bergland von Irian Jaya (West-Neuguinea), Indonesien. Reimer, Berlin Dammann G, Schiefenhövel W (2001) Wochenbettdepression und Heultage in anthropologisch-transkultureller Forschungsperspektive. In: Schultz M, Atzwanger K, Bräuer G, Christiansen K, Forster J, Greil H, Henke W, Jaeger U, Niemitz C, Scheffler C, Schiefenhövel W, Schöder I & Wiechmann I (Hrsg) Homo-unsere Herkunft und Zukunft. Proceedings 4. Kongress der Gesellschaft für Anthropologie (GfA) Potsdam 25.-28. September 2000. Cuvillier, Göttingen Dammann G, Schiefenhövel W & Strobl C (1998) Post Partum Blues and Depression - Culture Bound Syndromes in Industrialized Countries. Homo 49 Supplement: 17 (Abstract) Schiefenhövel W (1993) Puerperal Depression: Biological or Iatrogenic Disease. In: XXIII International Ethnological Conference. Torremolinos, Spanien Dammann G, Schiefenhövel W (2000) Die Münchner Postpartum Studie: Evolutionspsychologische Hypothesen und Design der Untersuchungen. In: Schultz M, Christiansen K, Greil H, Henke W, Kemkes-Grottenthaler A, Niemitz C, Rothe H, Schiefenhövel W, Schmift H D, Schröder I, Schutkowski H, Tesch- 41 [31] [32] [33] [34] [35] ler-Nicola M & Wittwer-Backofen U (Hrsg). Schnittstelle Mensch-Umwelt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Proceedings 3. Kongress der Gesellschaft für Anthropologie (GfA) Göttingen 1.-3.Oktober 1998. Cuvillier, Göttingen Schiefenhövel W (2007) "Bedding-in" als Prophylaxe gegen Baby-Blues? Evolutionsmedizinische und kulturenvergleichende Aspekte. In: Brisch K H & Hellbrügge Th (Hrsg) Die Anfänge der Eltern-Kind-Bindung. Schwangerschaft, Geburt und Psychotherapie. Klett-Cotta, Stuttgart: 100-114 Kennerly H, Gath D (1989) Maternity Blues Questionnaire. British Journal of Psychiatry 155: 356- 362 Stein G S (1980) Scale for Measuring the Maternity Blues. Journal of Psychosomatic Res. 24: 165- 171 Cox J L, Holden J, Sagowski R (1987) Development of the 10-Item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150: 782-786 Hahlweg K (1996) Problemliste (PL) zur Partnerschaftsdiagnostik. Hogrefe, Göttingen Dr. Mirjam Complojer Psychiatrischer Dienst des Krankenhauses Brixen- Psychosomatische Ambulanz [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 42–51 Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige – eine Untersuchung zu Motiven und Auswirkungen der Teilnahme Anne Blume1, Roland Mergl1, Nico Niedermeier2, Jörg Kunz3, Tim Pfeiffer-Gerschel4, Susanne Karch3, Inga Havers1 und Ulrich Hegerl1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universität Leipzig Praxis für psychosomatische Medizin, München 3 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, LMU München 4 IFT Institut für Therapieforschung, München 1 2 Schlüsselwörter: Depression – Online – Internet – Diskussionsforum – Selbsthilfe Keywords: Depression – Online – Internet – Discussion forum – Self-help Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Er­krankte und Angehörige – eine Untersuchung zu Motiven und Aus­wirkungen der Teilnahme Anliegen: Es wird untersucht, welche psychiatrischen Diagnosen bei den Schreibern eines Online-Diskussionsforums vorherrschend sind und ob das Forum als Alternative oder Ergänzung zu professioneller Behandlung genutzt wird. Des Weiteren wird dargestellt, wie sich die Teilnahme im Forum auf den individuellen Umgang mit der Krankheit Depression auswirkt. Methode: 55 aktive Nutzer wurden mit Hilfe der computerunterstützten Fassung eines vollstrukturierten psychiatrischen Interviews (DIA-X) telefonisch be© 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 fragt. Der Behandlungsstatus und die Motive zur Nutzung des Forums wurden online erhoben. Ergebnisse: 52 Studienteilnehmer (94,5%) erhielten die Lebenszeitdiagnose Depression. 90,2% sind schon einmal wegen Depressionen ambulant psychiatrisch behandelt worden, 64,7% waren stationär aufgenommen. Die Befragten gaben an, dass durch ihre Teilnahme am Forum das Vertrauen in die medizinische Behandlung gestiegen ist (63,3%) und sie dazu ermutigt worden sind, sich in ärztliche bzw. therapeutische Behandlung zu begeben (61,2%). 32,7% der befragten Forumsteilnehmer schätzten ihre Einstellung gegenüber einer Behandlung mit Medikamenten positiver ein als noch vor der Kontaktaufnahme mit dem Forum. Schlussfolgerungen: Das Forum erreicht seine Zielgruppe und wird nicht als Alternative, sondern als Ergänzung zu professioneller ärztlicher und psychologischer Betreuung genutzt. Aspekte der Selbsthilfe, insbesondere eine Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und die Akzeptanz und Bewältigung der eigenen krankheitsbedingten Situation können durch die Teilnahme am OnlineDiskussionsforum erreicht werden. Internetforen können eine sinnvolle Rolle im Gesamtbehandlungskonzept spielen. Evaluation of an online discussion forum for depressive patients and their relatives – an examination focus­sing motives and effects of participation Objective: The profile of psychiatric patients, who write within the online discussion forum of the German Research Network on Depression and Suicidality, is described. The question of which diagnoses are predominant among the forum members and the question of their treatment status shall be answered. Furthermore, the effects of participation in the forum on individual handling of the illness are examined. Methods: 55 active users were interviewed by telephone using a computer-assisted version of a fully structured psychiatric interview (DIA-X) and online with the Beck Depression Inventory (BDI). Moreover, their treatment status and their motivation to use the online forum were asked for. Results: 52 study participants (94,5 %) received the diagnosis depression. Currently, 36,5 % of the respondents suffer from a depressive episode. Frequent comorbid disorders are phobic disorders and somatoform disorders. 90,2 % received outpatient treatment before, 64,7 % inpatient treatment. In the year before this study started, 78,2 % of participants were treated by a psychiatrist / Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige neurologist and 63,6 % by a psychological psychotherapist. By participating in the online discussion forum, the respondents expect to receive information about the disorder, support in coping with depressive symptoms as well as an exchange with other affected persons and their relatives. The respondents stated that their ­ trust in medical treatment was raised (63,3 %) and that they were encouraged to seek professional help (61,2 %). Furthermore, 32,7 % of the interviewed participants rated their attitudes towards the treatment with medication more positive than before being a member in the discussion forum. Conclusions: The forum reaches its targets and the users do not see it as an alternative, but rather as a supplement to professional and psychological care. By participating in the forum, aspects of self-help, especially a strengthened sense of community and acceptance of and coping with the own illness-related situation can be accomplished. Einleitung Risiken und Chancen der Internetnutzung durch psychiatrische Patienten Immer häufiger suchen Patienten und deren Angehörige im Internet nach Informationen zu krankheitsspezifischen Themen und Austausch mit anderen Betroffenen [25, 30]. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Seiten mit medizinischen Inhalten unterschiedlichster Anbieter, wie etwa Krankenkassen, Pharmafirmen, Kliniken, Vereine, aber auch Privatpersonen. Aus psychiatrischer Sicht birgt die Nutzung des Internets für Patienten neben zahlreichen nützlichen Anwendungsmöglichkeiten einige Risiken [6]. Durch die Internetnutzung bedingt können Rückzugstendenzen und Isolation bei vulnerablen Menschen gefördert werden. Es besteht die Gefahr, dass persönliche Kontakte immer mehr durch virtuelle ersetzt werden. Möglicherweise kann intensive Internetnutzung auch negativen Einfluss auf das Hilfesuchverhalten haben. Diese Form des sozialen Rückzugs birgt die Gefahr der Polarisierung in sich. Häufig kommt es zu Fehleinschätzungen der eigenen Situation, was für labile und psychisch kranke Menschen besonders schwer zu erkennen und aufzufangen ist. Vielfach wird die Möglichkeit eines Internetabhängigkeitssyndroms diskutiert. Es kann vermutet werden, dass es sich bei pathologischer Internetnutzung häufig um eine Begleiterscheinung psychiatrischer Er­­kran­­kungen handelt [7, 11, 29]. Die Tatsache, dass man sein Gegenüber nicht sieht und nur ein eingeschränktes Feedback auf die eigenen Äußerungen erhält, nimmt entscheidenden Einfluss auf die Art und Weise des Austauschs. Es werden Kommunikationsstile und -inhalte gefördert, die im Vergleich zur „faceto-face“-Verständigung offener, aber auch enthemmter und aggressiver sein können. Sogenannte „Suizidforen“ können über Enttabuisierung, Gruppendruck und Verbreitung von Informationen zu Suizidmethoden die Selbstgefährdung erhöhen. Gleichzeitig wird der Zugang zu professioneller Hilfe erschwert, da die Schulmedizin in diesen Foren als Feindbild fungiert [21]. Demgegenüber stehen die zahlreichen Chancen, die das Internet gerade für Menschen mit depressiven Erkrankungen bereit hält. Wegen der dauerhaften Erreichbarkeit und der Anonymität, die das Internet bietet, scheint es für psychisch erkrankte Patienten - und hier vor allem auch für depressive Menschen und deren Angehörige - von großem Interesse zu sein. Das Internet bietet die Möglichkeit; sich auf niederschwelligem Weg zu informieren und sich anderen Betroffenen oder Helfern mitzuteilen. Viele Betroffene informieren sich bereits vor dem Gang zum Arzt über die Erkrankung. Durch die Aufnahme von umfangreichen 43 Informationen wird die Position des Patienten als „Experte in eigener Sache“ gestärkt [18]. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Online-Selbsthilfegruppen konsti­tuiert, deren Mitglieder mittels Diskussionsforen miteinander kommunizieren. Die meisten deutschsprachigen Foren sind für Patienten mit unterschiedlichen psychischen Störungen offen. Meist gibt es gesonderte Unterforen z.B. für bipolare Erkrankungen, Essstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen und andere Persönlichkeitsstörun­ gen. Einige Selbsthilfegruppen betreiben zusätzlich zu ihrem sonstigen Angebot Internet-Foren für spezielle depressive Störungen, beispielsweise zum Thema postpartale Depression. Diese Plattformen ermöglichen es, neue Kontakte zu knüpfen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Nutzer können zu einem umgrenzten Themenbereich Textbeiträge (auch Nachrichten, Artikel oder Postings genannt) austauschen. Diese Beiträge werden von anderen Interessenten gelesen und beantwortet. Mehrere Beiträge zum selben Thema bezeichnet man zusammenfassend als Thread (Faden) oder Thema (Topic). Mit dem Eröffnen eines neuen Threads kann ein neues Thema zur Diskussion gestellt werden. Einzigartig für Online-Selbsthilfe­ gruppen ist der Umstand, dass Leser als stille Beobachter im Verborgenen bleiben können und so von den Diskussionen profitieren, ohne sich selbst aktiv beteiligen zu müssen [31]. Face-to-Face-Selbsthilfegruppen machen hingegen ein gewisses Maß an Reziprozität erforderlich. Depressive Patienten bevorzugen es meist, unerkannt zu bleiben, bis sie die Abläufe in der Gruppe verstanden haben, und melden sich eventuell dann zu Wort. Derartige Foren fungieren häufig auch als Archiv von Informationen: über eine Schlagwortsuche können gezielt ältere Diskussionen aufgerufen werden. Patienten können in krankheitsbezogenen Foren Verständnis für ihre Blume, Mergl, Niedermeier, Kunz, Pfeiffer-Gerschel, Karch, Havers, Hegerl Situation und Gefühle empfangen, was im Rahmen ihres vertrauten sozialen Umfeldes oft nicht in vergleichbarer Art und Weise geleistet werden kann [30]. Dabei profitieren die Nutzer von der Sachkompetenz, die sich andere im Verlauf ihrer eige­ nen Erkrankung angeeignet haben. Auf diesen Plattformen entstehen mehr oder weniger feste Ge­ mein­­den, in denen sich die Be­ trof­fenen über emotionale und andere Belange zur Entstehung, Behandlung oder Aufrechterhaltung der Erkrankung austauschen. Teil­nehmer können ohne feste Terminvereinbarung miteinander kom­munizieren und haben gleichfalls die Möglichkeit, die Worte der Gegenüber länger zu reflektieren sowie eigene Texte zu bearbeiten und auch wieder zu verwerfen [17]. Sie können steuern, wie viel Information sie zu welchem Zeitpunkt von sich preisgeben möchten. Die Kommunikation in OnlineForen ist in erster Linie von bereitwilligem Informationsaustausch und unterstützenden Beiträgen geprägt. Postings mit positiven Äußerungen wie emotionaler Unterstützung, Akzeptanz und Zustimmung überwiegen [2, 9, 14, 27]. Im Vergleich zur Kommunikation in traditionellen Face-to-Face-Selbsthilfegruppen ist der Anteil an ausgedrückter emo­tionaler Unterstützung und Selbstoffenbarung höher, hingegen finden sich weniger formale Strukturen und Gruppenprozesse [27]. Online-Foren fördern lose Bindungen. Diese Beziehungen sind im Vergleich zu familiären Strukturen zunächst weniger verbindlich und konzentrieren sich auf einige wenige gemeinsame Interessen und Ziele. Weitere Vorteile von virtueller Selbsthilfe im Internet sind vor allem die räumliche und zeitliche Unabhängigkeit sowie die mögliche Anonymität. Die Gewissheit, dass beinahe zu jeder Tageszeit ein Teilnehmer in diesen Foren erreichbar ist, der als Ansprechpartner dienen kann, wird von den Betroffenen als massive Erleichterung erlebt. Somit kann die Nutzung von OnlineSelbsthilfegruppen für Betroffene eine sinnvolle Ergänzung zur realen Selbsthilfe sein [3]. Die Unterhaltung und Moderation der Plattformen erfolgt häufig ehrenamtlich durch nicht-medizinische Privatpersonen, aber je nach Initiator der Foren (z.B. angehängt an Pharmafirmen) auch über Ärzte oder Psychologen. Auf den Internetseiten sind die von den Forenbetreibern festgelegten Nutzungsbedingungen ersichtlich. So gelten neben allgemeinen Gesetzen zum Schutz der Persönlichkeit und vor Straftaten forenspezifische Vorschriften hinsichtlich der erlaubten Inhalte. Einige Moderatoren erlauben so genannte „triggernde Inhalte“, die sich beispielsweise mit selbstverletzendem Verhalten beschäftigen, wenn diese im Betreff kenntlich gemacht werden. In anderen Foren sind diese Themen verboten und werden gegebenenfalls durch die Moderation gelöscht. Das Online-Diskussionsforum des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität Das Online-Diskussionsforum ist ein Bestandteil des Internetauftrittes des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität (www.kompetenznetzdepression.de) sowie des hieraus entstandenen Deutschen Bündnisses gegen Depression e.V. (www.buend­ nis-depression.de) [22]. Finanziert wird es über das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Kompetenznetz Depression, Suizidalität und einen festen Zuschuss im Rahmen der Selbsthilfe-Fördergemeinschaft des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen e.V. / Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V. (VdAK/AEV). Seit der Gründung des Forums im Sommer 2001 wurden von inzwischen über 7.000 registrierten Nutzern über 200.000 Beiträge, soge- 44 nannte Postings, verfasst. Täglich gibt es etwa 150 neue Beiträge. Die Zahl der passiven Leser liegt etwa um ein Zehnfaches höher als die der aktiven Teilnehmer. Das Diskussionsforum des Kompe­ tenz­netzes ist ein Selbsthilfeforum. Folglich diskutieren in erster Linie Betroffene untereinander oder Be­ troffene mit Angehörigen respektive Angehörige mit Angehörigen. In acht thematischen Unterforen werden unter den Überschriften „Umgang mit der Krankheit“, „Pharmakotherapie“, „Psychotherapie“, „Angehörige“ und „Depression, Arbeit, Ämter und Renten“ Beiträge an einer Art „Schwarzem Brett“ im Inter­ net ver­fasst. Das Spektrum der einzel­nen Beiträge reicht von un­ ter­­­stützendem Austausch bis hin zu spezifischen Fragen zur me­­ di­­ka­­mentösen Behandlung, aber auch zu Angelegenheiten be­züg­­­­­ lich des Arbeitgebers oder Ren­ten­ versicherungs­trägers. Wäh­rend die geschriebenen Beiträge für jeden Internetnutzer sichtbar sind, ist für das Verfassen von eigenen Postings eine Registrierung erforderlich. Nach Anerkennung der Nutzungsbedingungen erhält jeder Nutzer ein Zugangspasswort und kann sich ein persönliches Profil, in dem persönliche Kontaktdaten vermerkt sind, einrichten. Somit gibt es die Möglichkeit, anderen Nutzern, die ihr Profil allgemein zugänglich machen, außerhalb des Forums eine e-Mail zu schreiben oder über einen Instant-Messaging-Dienst, wie etwa ICQ, eine private Nachricht zu senden. Das Forum wird durch einen Facharzt für Psychotherapeutische Medizin und eine Diplom-Soziologin moderiert. Ein- bis zweimal täglich werden alle neuen Beiträge gegengelesen. Ziel der Moderation ist es, für die sachliche Richtigkeit der Beiträge und gleichzeitig für ein freundliches und respektvolles Diskussionsklima zu sorgen. Das Forum selbst versteht sich als Ort des Meinungs- und Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige Informationsaustauschs und bietet explizit keine Krisenintervention. Die Moderatoren können einzelne Beiträge editieren, löschen und Zugänge gegebenenfalls sperren. Dies geschieht, um zu verhindern, dass Teilnehmer durch „appellative Postings“ anderer Betroffener zusätzlich zu belastet oder verunsichert werden. Zudem soll verhindert werden, dass andere Nutzer beleidigt oder Diskussionen absichtlich gestört oder unterbrochen werden, was in unmoderierten Foren häufig an der Tagesordnung ist. Folglich werden Postings dieser Art von der Moderation gelöscht. In sehr kritischen Situationen, wie etwa bei Suizidankündigungen, greift die Moderation ebenfalls aktiv ein. Anhand der IP-Adresse kann ein Verfasser durch die Polizei identifiziert und an lokale Krisendienste, Kliniken oder behandelnde Ärzte und Therapeuten verwiesen werden. Seit Bestehen des Forums musste von den genannten Instrumenten nur in sehr wenigen Fällen Gebrauch gemacht werden. Die in Einzelfällen angekündigten Suizide konnten verhindert werden [23]. Aus dem Diskussionsforum sind seit 2001 zahlreiche „Stammtische“ und Forentreffen entstanden. In regelmäßigen Abständen finden in verschiedenen deutschen Städten von den Teilnehmern selbst organisierte Treffen statt. Diese Veranstaltungen bieten über das Forum hinaus Gelegenheit zum Austausch zwischen den Nutzern. Stand der Forschung Studien konnten belegen, dass krankheitsspezifische Internetforen soziale Unterstützung und Informationen vermitteln und helfen, die Isolation zu überwinden und die Erkrankung besser zu bewältigen [8, 10, 12, 13, 24]. Bisher gibt es nur einige wenige Untersuchungen, die sich mit dem Gesundheitsstatus und anderen charakteristischen Merkmalen der Nutzer von internetbasierten Foren für an Depression Erkrankte beschäftigt haben [26]. Houston et al. [8] gaben für eine Stichprobe eines US-amerikanischen Online-Diskussionsforums (N=103) an, dass aktuell 86,4% der Teilnehmer erkrankt waren. 65% der Befragten waren zum Befragungszeitpunkt in medizinischer Behandlung. In der Follow-up-Befragung (N=61) nach einem Jahr gaben 62,3% der Befragten an, dass ihre Erfahrungen im Internetforum sie dazu veranlasst hatten, sich mit ihrem Behandler über ihre Therapie zu unterhalten und Fragen zu stellen [8]. Powell et al. berichten in ihrer Querschnittsuntersuchung eines in sechs europäischen Ländern angebotenen Internetforums für an Depression Erkrankte über Punktprävalenzraten für Depression von 40% bis 64%, in Abhängigkeit von dem Land, aus dem die Forenteilnehmer kamen. 48% der Befragten, die die Kriterien für eine Depression erfüllten, waren nicht in Behandlung. 35% hatten im letzten Jahr keinen Kontakt mit Behandlern. Von denjenigen Befragten, die im vorangegangenen Jahr Kontakt mit einem Arzt oder Therapeuten hatten, gaben 36% an, dass das Internetforum bei ihrer Entscheidung, professionelle Hilfe zu suchen, eine wichtige Rolle gespielt hat [26]. Um den Forschungsstand zur Wirkung von Selbsthilfeangeboten im Internet für depressive Patienten zu erweitern, sollen Erkenntnisse über die vorhandenen Diagnosen, die Motive zur Nutzung von derartigen Foren sowie den wahrgenommenen Einfluss auf den Umgang mit der Erkrankung gewonnen werden. Im Einzelnen wurden folgende Ziele verfolgt: • Mit Hilfe von strukturierten diagnostischen Interviews werden psychiatrische Diagnosen der ausgewählten Teilnehmer des Online-Diskussionsforums des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität gestellt. Hiermit soll die Frage beantwortet werden, ob das Diskussionsforum • • 45 seine Zielgruppe, Patienten mit depressiven Erkrankungen, erreicht. Untersuchungen der Qualität und Intensität der Nutzung des Diskussionsforums; Untersuchung der Frage, ob das Diskussionsforum als Alternative oder Ergänzung zur professionellen Behandlung genutzt wird. Hierzu werden u.a. der gegenwärtige Behandlungsstatus und Angaben zum subjektiven Nutzen aus der Teilnahme am Forum erfasst. Weiter werden Teilnehmer dahingehend befragt, ob sich bei Ihnen durch die Teilnahme Einstellungen gegenüber bzw. der Umgang mit der Erkrankung verändert haben. Methode Stichprobe Die Auswahl der Studienteilnehmer erfolgte direkt über das Online-Diskussionsforum. Zu Beginn wurde das Projekt von der Moderation im Forum angekündigt. Mit Hilfe eines computergestützten Verfahrens wurden nach dem Zufallsprinzip 141 Teilnehmer, welche innerhalb der letzten 6 Monate mindestens 3 Beiträge verfasst hatten, ausgewählt. Die ausgewählten Personen erhielten per e-Mail Informationen zum Forschungsvorhaben und wurden um ihre Teilnahme an der Studie gebeten. Nach Unterzeichnung einer Einverständniserklärung erhielten sie eine Zugangsnummer und ein Passwort. Damit konnten Sie anonym den online dargebotenen Fragebogen bearbeiten. Die Daten wurden über eine sichere Verbindung übermittelt und in einer Datenbank abgespeichert. Gleichzeitig wurde ein Termin für eine telefonische Befragung vereinbart. Von 49 Personen liegen sowohl die Online-Befragung als auch eine Diagnose vor. Dies entspricht einer Blume, Mergl, Niedermeier, Kunz, Pfeiffer-Gerschel, Karch, Havers, Hegerl Rücklaufquote von 34,8% (49/141). Zusätzlich konnten die Daten von 6 Probanden einer anderen Untersuchung zum gleichen Thema, welche im Längsschnittdesign konzipiert war, in die Berechnung einfließen. 55 Personen wurden somit schließlich in die Studie aufgenommen. Erhebungsinstrument/Auswertung Die inhaltlichen Schwerpunkte des Fragebogens wurden aus den in der Literatur zu krankheitsspezifischen Online-Gruppen dargestellten Relevanzbereichen abgeleitet [1, 26]. Der erste Teil untersuchte die Nutzungsparameter des Forums (Häufigkeit und Dauer der Nutzung, Motive und erwarteter Nutzen). Des Weiteren wurden Angaben zur individuellen Krankengeschichte erhoben (Art der Behandlung, Therapieerfahrung, Behandlungsstatus). Der dritte Teil enthielt Fragen zum wahrgenommenen Einfluss der Teilnahme am Forum auf den Umgang mit der Krankheit. Dabei waren Aussagen zur Wirkung des Forums auf den Krankheitsverlauf zu bewerten. Außerdem wurde die Einstellungsänderung gegenüber einer Behandlung der Depression mit Medikamenten bzw. Psychotherapie untersucht. Dieser Teil enthielt neben geschlossenen Fragen auch zwei offene Fragen, deren Auswertung inhaltsanalytisch mit kategorialer Einordnung und Deutung erfolgte [15]. Das Kategoriensystem wurde induktiv nach Sichtung des Materials erstellt. Anschließend wurden die Aussagen von zwei Ratern bewertet. Die Rater hatten die Möglichkeit, mehrere Kategorien pro Aussage zu vergeben. Die CodiererReliabilität CR beträgt 0,85 [5]. Die ICD-10-Diagnose wurde mit Hilfe des „Diagnostischen Expertensystems für psychische Störungen“ (DIAX) in der Lebenszeit-Version er- 1 stellt [32]. Dieses Instrument beruht auf der Version 1.1 des „Composite International Diagnostic Interview“ (CIDI). Es kann davon ausgegangen werden, dass der im direkten Kontakt mit Patienten durchgeführte CIDI und seine computerisierte Fassung äquivalent sind (vgl. [20]). Bei diesem standardisierten Verfahren werden durch die Beantwortung von diagnostisch relevanten Fragen sämtliche zutreffenden ICD-10- sowie DSM-IVDiagnosen ausgegeben. Gleichfalls werden Angaben zu Beginn, Dauer und Verlauf der Syndrome sowie des klinischen und psychosozialen Schweregrades und resultierender Komplikationen ausgegeben. Geschulte Interviewer führten die Befragung telefonisch durch. Die Auswertung erfolgt computerisiert mit dem Standard-DIA-X-Programm und kann als objektiv gewertet werden. Ergebnisse Diagnose Mit Hilfe des DIA-X wurde bei 52 der 55 Befragten die Lebenszeitdiagnose Depression gestellt. 46 dieser 52 Untersuchungsteilnehmer (46/521 – 88,5%) litten bzw. leiden an einer schweren Depression. Von den 52 Befragten mit Lebenszeitdiagnose Depression leiden aktuell 19 Befragte (19/52 - 36,5%) an einer depressiven Episode. Hinzu kommen 14 Personen, die im letzten halben Jahr erkrankt waren (14/52 - 26,9%) und zusätzlich 7 in den letzten 7 bis 12 Monaten (7/52 - 13,5%). Bei weiteren 12 Patienten (12/52 - 23,1%) lag die depressive Episode länger als ein Jahr zurück. Bei 36 Befragten (65,5%) konnte eine phobische Störung und für 32 Befragte (58,2%) eine somatoforme 46 Störung diagnostiziert werden. Weiterhin fanden sich die Diagnosen generalisierte Angststörung (30,9%), posttraumatische Belastungsstörung (23,6%) und Essstörung (10,9%). Häufig wiesen die Befragten mehrere Störungsbilder gleichzeitig auf. In der vorliegenden Untersuchung trat die Diagnose Depression am häufigsten in Verbindung mit einer phobischen Störung (34/52 - 65,4%), somatoformen Störungen (30/52 - 57,7%) oder generalisierten Angsterkrankungen (16/52 - 30,8%) auf. 23,1% (12/52) der Befragten hatten zusätzlich zur Diagnose Depression eine Posttraumatische Belastungsstörung. 17 Befragte (17/52 - 32,7%) mit der Diagnose einer depressiven Störung litten an einer phobischen und einer somatoformen Störung. Behandlungsstatus 46 Studienteilnehmer (46/51 - 90,2%) gaben an, schon einmal wegen Depressionen in ambulanter Behandlung gewesen zu sein. 33 waren aufgrund dieser Diagnose in stationärer Behandlung (33/51 - 64,7%). Die Abbildung 1 zeigt, welche Behandlungsmöglichkeiten der Depression die Befragten bereits eigenen Angaben zufolge in Anspruch genommen hatten. 42 Befragte (42/47 - 89,4%) hatten schon einmal Antidepressiva eingenommen und lediglich 13 Studienteilnehmer (13/51 - 25,5%) sind noch nie wegen ihrer Depression medikamentös behandelt worden. Eine Verhaltenstherapie erhalten haben 28 der Befragten (28/46 60,9%). 34 gaben an, an einer Gesprächspsychotherapie teilgenommen zu haben (34/46 – 73,9%). Wenn man davon ausgeht, dass eine Gesprächspsychotherapie bei Depressionen keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen ist, erscheint diese Anzahl Zu einigen Sektionen des Erhebungsinstruments liegen nicht von allen Befragten vollständige Angaben vor. Zum besseren Verständnis der Untersuchungsergebnisse gibt der Nenner jeweils die Anzahl der tatsächlich erhaltenen Antworten an. Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige Item 47 Häufigkeiten Alter (für 1 Person war keine Angabe erhältlich) 26 – 67 Jahre MW 41,39; SD 9,41 Geschlecht Männlich 10/55 (18,18 %) Weiblich 45/55 (81,82 %) Lebenszeitdiagnose Depression Ja 52/55 (94,5 %) Nein 3/55 (5,5 %) Lebenszeitdiagnosen nach ICD-10 mittelgradig depressive Episode F 32.1 3/52 (5,8 %) schwere depressive Episode F 32.2 / F 32.3 20/52 (38,5 %) rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradig F 33.1 rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwer F 33.2 / F 33.3 Dysthymia F 34.1 1/52 (1,9 %) 26/52 (50,0 %) 2/52 (3,8 %) seit wann im Forum (für 6 Personen waren keine Angaben erhältlich) 1 Monat bis 1 Jahr 11/49 (22,4 %) länger als 1 Jahr 38/49 (77,6 %) Nutzungsdauer pro Woche (für 5 Personen waren keine Angaben erhältlich) 1 Stunde 19/50 (38,0 %) 2 bis 4 Stunden 20/50 (40,0 %) Länger 11/50 (22,0 %) Tabelle 1: Charakteristik der 55 Studienteilnehmer hoch. Möglicherweise haben einige Befragte lediglich angenommen, an einer Gesprächspsychotherapie teilgenommen zu haben, und hatten eigentlich eine andere Therapieform, beispielsweise eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, verordnet bekommen. Es ist wahrscheinlich, dass Patienten eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie als Gesprächstherapie bezeichnen, weil es sich letztendlich um eine Therapie im Gespräch handelt. die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist wie die Verhaltenstherapie auch ein von den Krankenkassen anerkanntes und bezahltes, sehr häufig angewandtes Verfahren. Mit einer Kombination aus Antidepressiva und Verhaltenstherapie wurden 26 Befragte (26/46 - 56,5%) behandelt, 30 nahmen Antidepressiva ein und bekamen eine Gesprächspsychotherapie verordnet (30/46 – 65,2%). Betrachtet man den Behandlungsstatus der Studienteilnehmer im Jahr vor der Untersuchung, ergibt sich folgendes Bild: 43 der 55 Befragten (78,2%) befanden sich in der Behandlung eines Psychiaters/Nervenarztes. 35 (35/55 - 63,6%) wurden von einem psychologischen Psychotherapeuten betreut. Der zuständige Hausarzt behandelte 23 der Studienteilnehmer (23/55 - 41,8%) im Jahr vor unserer Untersuchung. 8 Befragte (8/55 - 14,5%) suchten Unterstützung bei einem Heilpraktiker. Von einem Pfarrer bzw. Priester oder einer seelsorgerischen Einrichtung wurden 6 der Befragten betreut (6/55 - 10,9%). Blume, Mergl, Niedermeier, Kunz, Pfeiffer-Gerschel, Karch, Havers, Hegerl Abbildung 1: Behandlungsmöglichkeiten der Depression, die von den Befragten schon einmal in Anspruch genommen worden sind Einstellungsänderung gegenüber Therapie und Erkrankung durch die Teilnahme am Diskussions­ forum Erwartungshaltung gegenüber dem Diskussionsforum Die Befragten erwarten sich von der Teilnahme am Forum Informationen über die Erkrankung (49/51 – 96,1%), Unterstützung bei der Bewältigung der depressiven Symptome (33/51 – 64,7%) und Austausch mit anderen Betroffenen bzw. Angehörigen (49/51 – 96,1%). Veränderte Einstellung gegenüber Therapie 30 Befragte (30/49 – 61,2%) gaben an, durch das Forum dazu ermutigt worden zu sein, sich in ärztliche bzw. therapeutische Behandlung zu begeben. Bei 31 Personen (31/49 – 63,3%) ist das Vertrauen in die medizinische Behandlung nach eigenen Angaben durch die Teilnahme am Forum gestiegen. 24 der Betroffenen (24/49 – 48,98%) konnten sich beim Behandler auf Informationen aus dem Forum berufen. 16 Befragte (16/49 – 32,7%) schätzen ihre Einstellung gegenüber einer Behandlung mit Medikamenten in Form von Antidepressiva oder Johanniskraut durch die Teilnahme am Forum als positiver ein. Veränderte Einstellung gegenüber der eigenen Erkrankung Für 33 der Befragten (33/49 – 67,3%) hat sich durch ihre Teilnahme am Forum die Einstellung zur eigenen Erkrankung verändert. Die Antwor- Kategorie I II III IV V VI VII 48 ten auf die Frage, was sich durch die Forenteilnahme verändert hat, konnten sieben Kategorien zugeordnet werden. Die Abbildung 2 zeigt die gefundenen Kategorien und die Häufigkeit, mit der sie von den Ratern vergeben wurden. Insgesamt wurden 39 Statements durch diese Kategorien abgebildet. „Akzeptanz“ und „Gemeinschaft“ wurde am häufigsten für die Beschreibung der eingetretenen Veränderungen vergeben. Die Forumsmitglieder nennen dabei die veränderte Sicht auf die Erkrankung und die Akzeptanz der Diagnose als ursächlich für ein verbessertes Wohlbefinden. Im Forum finden sie andere Menschen, die ebenfalls an Depressionen leiden, und stoßen hier erstmals auf Verständnis ihrer Situation. Eine Antwort lautete: „Ich fühle mich nicht mehr so beschämt, da ich nun weiß, dass ich nichts für die Krankheit kann. Ich Beschreibung Ressourcenmobilisierung: Der Betroffene setzt sich aktiv mit seiner Krankheit auseinander. Gemeinschaft: Der Betroffene hat seine gefühlte Einsamkeit überwunden. Akzeptanz: Veränderte Sicht auf die Krankheit. Stigmareduzierung: Verringerung der sozialen Distanz gegenüber Menschen, die an Depressionen erkrankt sind. Behandlung: Der Betroffene hat eine Behandlung aufgenommen. Wissen: Der Betroffene hat sich im Forum Wissen über die Erkrankung ange­ eignet. Einstellungsänderung gegenüber Behandlern: Die subjektive Einschätzung/Be­ wertung der Ärzte und Therapeuten hat sich geändert. Abbildung 2: Was hat sich für die Betroffenen durch die Teilnahme am Forum verändert? Anzahl der Zuordnungen der gebildeten Kategorien durch die Rater Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige Kategorie I II III IV V VI VII VIII Beschreibung Krankheit: Symptome und Prognosen der Diagnose Depression Behandlung: Therapiemöglichkeiten Medikamente: Ratschläge zu Einnahme und Wirkung Behandlungsaufnahme: Ermutigung zur Aufnahme einer Therapie/Arztbesuch Umgang mit der Krankheit: Vorschläge zu positiven Aktivitäten, Annahme der Krankheit Berufliches Umfeld: Ratschläge zum Umgang mit Arbeitsgeber und Behörden Soziales Umfeld: Ratschläge zum Umgang mit Freunden und Angehörigen Andere: Nennung weiterer Informationsquellen Abbildung 3: Welche Ratschläge haben Sie im Forum erhalten? Anzahl der Zuordnungen zu den gefundenen Kategorien habe durch die Erfahrung der anderen Hoffnung bekommen, dass sich die Depression auch wieder bessert. Ich bin nicht mehr so sehr verzweifelt, wenn ich in eine erneute depressive Krise abrutsche. Ich fühle mich nicht mehr so alleine gelassen mit der Krankheit. Und habe auch immer wieder längere „gute“ Phasen, da mir die anderen Teilnehmer immer wieder vermitteln, dass ich immer noch ein ‚liebenswerter, vollwertiger’ Mensch bin. Ich habe wieder schneller und mehr Selbstvertrauen gefasst.“ 32% der Studienteilnehmer hatten schon einmal eine Empfehlung aus dem Forum befolgt, 66% richteten sich teilweise nach diesen Ratschlägen. Die Tipps wurden acht verschiedenen Kategorien zugeordnet (vgl. Abb. 3). Hier konnten 43 Statements abgebildet werden. Zum Umgang mit der Krankheit bekamen die Befragten die meisten Ratschläge im Forum. Diskussion Immer wird die Frage gestellt, ob man über das Internet auch die Grup- pe von Betroffenen erreichen kann, die man eigentlich zu erreichen sucht. Die vorliegende Untersuchung legt nahe, dass das Online-Diskussionsforum hauptsächlich von Patienten mit depressiven Störungen genutzt wird. Eine hohe Anzahl der Untersuchungsteilnehmer leidet an schweren depressiven Störungen. Verglichen mit den Ergebnissen vorangegangener Studien [8, 26] erscheint der Anteil der Nutzer mit Lebenszeitdiagnose Depression in unserer Untersuchung, relativ zur Stichprobengröße betrachtet, höher. Zudem waren mehr Forenteilnehmer in ärztlicher bzw. therapeutischer Behandlung. Unsere Untersuchungsergebnisse zum subjektiven Nutzen des Forums für die Betroffenen lassen den Schluss zu, dass das Diskussionsforum eine gern genutzte Möglichkeit der Selbsthilfe ist. Insbesondere das Gemeinschaftsgefühl und die Akzeptanz der eigenen Erkrankung werden stark gefördert. Durch die Teilnahme am Forum kann es gelingen, die eigene krankheitsspezifische Einsamkeit zu überwinden. 84% der Befragten können im Forum über Dinge sprechen, 49 die sie sonst nicht diskutieren können. Sie fühlen sich, bedingt durch die Teilnahme, weniger einsam. Eine hohe Bedeutung kommt den weiterführenden Kontakten über das Forum hinaus zu, weil durch diese zusätzlich und nachhaltig die Einsamkeit überwunden werden kann. Dies steht im Einklang mit Befunden anderer Studien, welche derartige Foren untersucht haben [17, 19]. Auch für den Behandlungsfortschritt wichtige Aspekte wie die Verbesserung des Wissens über die eigene Erkrankung und die Aktivierung eigener Ressourcen scheinen durch das Forum angeregt zu werden. Wissen über die eigene Erkrankung kann Ängste und ungerechtfertigte Sorgen verringern, das Hilfesuchverhalten günstig beeinflussen und die Compliance verbessern [7]. Nutzer von Online-Foren suchen nach Informationen, Unterstützung und Verständnis bezogen auf ihr spezifisches Krankheitsbild [16, 28]. Die vorliegende Untersuchung konnte zeigen, dass die Mitglieder des Forums des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität eben diese Motive haben und im Forum bedienen können. Für den Befund, dass in Internetforen eine große Anzahl von unbehandelten Nutzern mit der Diagnose einer depressiven Störung zu finden [26] sind bzw. derartige Foren von den Betroffenen als Ersatz für Arztbesuch und Therapie betrachtet werden, gibt es in unserer Studie keinen Beleg. Keiner der Befragten fühlt sich durch das Forum davon abgehalten, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nur 14% der Befragten meinen, sie wären durch das Forum weniger auf ärztliche Hilfe angewiesen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein: Betroffene fühlen sich durch das Forum gerade erst ermutigt, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen (61,2% Prozent der Befragten). Ein bedeutsames Ergebnis dieser Untersuchung ist dies gerade deshalb, weil in Gesprächen mit Behandlern immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Internetforen Blume, Mergl, Niedermeier, Kunz, Pfeiffer-Gerschel, Karch, Havers, Hegerl skeptisch gegenüber stehen, weil sie annehmen, dass dort negativ über Ärzte, Psychologen und deren Behandlung gesprochen wird [18]. Dies hält die Betroffenen aber anscheinend nicht davon ab, sich die Annahme von professioneller Hilfe gegenseitig zu empfehlen. Das Forum wird demnach eher zusätzlich zur medizinischen und therapeutischen Behandlung im Sinne der Selbsthilfe genutzt. Für die Patienten kann es ebenfalls vor Beginn einer Therapie („Warteposition“) oder nach Verlassen der Klinik eine hilfreiche Unterstützung sein [4, 8]. Die Betroffenen nehmen häufig erst im Anschluss an professionelle Hilfe durch Ärzte und Therapeuten Möglichkeiten der Selbsthilfe wahr. Doch bereits vor einer ersten Begegnung mit Behandlern, die häufig ängstlich vermieden wird, treten Fragen auf. Das Diskussionsforum kann hier eine Lücke schließen, indem es eine Plattform für derartige Anliegen bietet, und damit den Weg in professionelle Hilfe anbahnen. Einschränkungen Die vorliegende Studie liefert Erkenntnisse über das diagnostische Profil von Nutzern eines Online-Diskussionsforums für an Depression erkrankte Menschen. Es wurden für die Befragung aktive Teilnehmer ausgewählt, Betroffene, die im Forum lesen und auch selbst Beiträge verfassen. Die anhand der Zugriffszahlen ermittelte Anzahl passiver Nutzer, also Menschen, die im Forum lesen, ohne selbst Beiträge zu verfassen, liegt um etwa ein Zehnfaches über der Zahl der aktiven Nutzer. Die Unterschiede zwischen den Fallzahlen hinsichtlich der Diagnose Depression und dem Behandlungsstatus der Patienten, die sich im Vergleich zwischen dieser Untersuchung und anderen Studien zeigen, könnten auf den Einsatz verschiedener Erhe- bungsinstrumente, aber auch einen unterschiedlichen Grad der Versorgung psychischer Erkrankungen in den Herkunftsländern der Studienteilnehmer zurückzuführen sein [26]. Anzumerken ist, dass bisher in keiner uns bekannten vergleichbaren Studie in Foren für Depressive eine ausführliche Diagnostik mit einem klinischen Interview durchgeführt worden ist. Befragungen im Internet sind zwangsläufig mit methodischen Mängeln behaftet. Die Grundgesamtheit ist unbekannt und somit ist die Repräsentativität der Stichprobe fragwürdig. Aufgrund der Selbstselektion ist mit einer Verzerrung der Stichprobe zu rechnen. In der Ergebnispräsentation wurde jeweils der Quotient aus der Häufigkeit der Antwort und der tatsächlichen Fallzahl dargestellt. Hierbei wird deutlich, dass einige Fragebögen nicht vollständig vorliegen. Eine Tatsache, die zum Teil der Durchführung als Onlinebefragung geschuldet sein könnte. Um die Anzahl der fehlenden Werte zu verringern, ist zu überlegen, Instrumente bei Onlinebefragungen so zu konzipieren, dass eine Antwort gegeben werden muss, bevor die Befragung fortgesetzt werden kann. Dadurch könnte ausgeschlossen werden, dass Teilnehmer Antwortfelder übersehen. Über die Auswirkungen der Forenteilnahme von passiven Nutzern auf die Einstellung gegenüber ihrer Erkrankung können wir auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Angaben machen. Ausblick Das Online-Diskussionsforum des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität kann ein sinnvoller Baustein im Rahmen eines Gesamtbetreuungskonzeptes sein, auf den die Patienten durch den behandelnden Arzt hingeführt werden. Eine hohe Akzeptanz und Frequentierung des Diskussionsforums verweist auf den Wunsch der 50 Betroffenen nach solchen Angeboten und unterstreicht die Notwendigkeit, derartige Angebote auf einem hohen Qualitätsniveau auszubauen. Diese Arbeit entstand im Rahmen des Kompetenznetzes Depression, Suizidalität, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt wird. Literatur [1]Baker L., Wagner T.H., Singer S., Bundorf M.K. Use of the Internet and e-mail for health care information - Results from a national survey. Journal of the American Medical Association 289, 2400-2406 (2003). [2]Finfgeld D.L. Therapeutic groups online: the Good, the Bad, and the Unknown. Issues in Mental Health Nursing 21, 241255 (2000). [3]Finn J. Computer-based self-help groups: A new resource to supplement support groups. Social Work with Groups 18, 109-117 (1995). [4]Finn J. An exploration of helping processes in an online self-help group focusing on issues of disability. Health & Social Work 24, 220-231 (1999). [5]Früh W. Inhaltsanalyse: UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz, 2004. [6]Hegerl U. Kann man psychische Störungen "wegklicken"? MMW-Fortschritte der Medizin 148, 21-22 (2006). [7]Hegerl U., Bussfeld P. Psychiatrie und Internet: Möglichkeiten, Risiken, Perspektiven. Nervenarzt 73, 90-95 (2002). [8]Houston T.K., Cooper L.A., Ford D.E. Internet support groups for depression: a 1-year prospective cohort study. American Journal of Psychiatry 159, 2062-8 (2002). [9]Klemm P., Bunnell D., Cullen M., Soneji R., Gibbons P., Holecek A. Online cancer support groups - A review of the research literature. Computers Informatics Nursing 21, 136-142 (2003). [10]Klemm P., Hardie T. Depression in Internet and Face-to-Face Cancer Support Groups: A Pilot Study. Oncology Nursery Forum 29, E45-E51 (2002). [11]Kratzer S., Hegerl U. [Is "Internet Addiction" a Disorder of its Own?]. Psychiatrische Praxis 35, 80-83 (2008). [12]Kummervold P.E., Gammon D., Bergvik S., Johnsen J.A.K., Hasvold T., Rosenvinge J.H. Social support in a wired world - Use of online mental health forums in Norway. Nordic Journal of Psychiatry 56, 59-65 (2002). Evaluation eines Online-Diskussionsforums für an Depression Erkrankte und Angehörige [13]Loader B.D., Muncer S., Burrows R., Pleace N., Nettleton S. Medicine on the line? Computer-mediated social support and advice for people with diabetes. International Journal of Social Welfare 11, 53-65 (2002). [14]Madara E.J. The mutual aid self-help online revolution. Social Policy 27, 20-26 (1997). [15]Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken: Deutscher Studien Verlag, Weinheim, 2000. [16]Mickelson K.D. Seeking Social Support: Parents in Electronic Support Groups. In: S.Kiesler: Culture of the Internet.2007 [17]Muncer S., Burrows R., Pleace N., Loader B., Nettleton S. Births, deaths, sex and marriage ... but very few presents? A case study of social support in cyberspace. Critical Public Health 10, 1-18, (2000). [18]Niedermeier N., Pfeiffer-Gerschel T., Hegerl U. Learning from our patients - a field report after five years running an online discussion forum in the framework of the German Research Network on Depression and Suicidality. Nervenheilkunde 25, 361-367 (2006). [19]Parks M.R., Floyd K. Making Friends in Cyberspace. Journal of Communication 46, 80-97 (1996). [20]Peters L., Clark D., Carroll F. Are computerized interviews equivalent to human interviewers? CIDI-Auto versus CIDI in anxiety and depressive disorders. Psychological Medicine 28, 893901 (1998). [21]Pfeiffer-Gerschel T., Hegerl U., Seidscheck I. Suizidforen. Chancen und Risiken von Internet-Foren. CliniCum psy 34-38 (2004). [22]Pfeiffer-Gerschel T., Niedermeier N., Hegerl U. Moderiertes Diskussionsforum zum Thema "Depression". MMWFortschritte der Medizin 148, 22-27 (2006). [23]Pfeiffer-Gerschel T., Seidscheck I., Niedermeier N., Hegerl U. Suicide and Internet. Verhaltenstherapie 15, 20-26 (2005). [24]Pleace N., Burrows R., Loader B., Muncer S., Nettleton S. On-line with the friends of Bill W: Social support and the Net. Sociological Research Online 5 (2000). [25]Podoll K., Morth D., Sass H., Rudolf H. Self-help via the internet - chances and risks of communication in electronic networks. Nervenarzt 73, 85-89 (2002). [26]Powell J., McCarthy N., Eysenbach G. Cross-sectional survey of users of Internet depression communities. BMC Psychiatry 3, 19 (2003). [27]Salem D.A., Bogat G.A., Reid C. Mutual help goes on-line. Journal of Community Psychology 25, 189-207 (1997). [28]Scheerhorn D., Warisse J., McNeilis K.S. Computer-Based Telecommunication Among an Illness-Related Community: Design, Delivery, Early Use, and the Functions of HIGHnet. Health Communication 7, 301-325 (1995). [29]Seemann O., Stefanek J., Quadflieg N., Grebener N., Kratzer S., Möller-Leim- 51 kühler A.M., Ziegler W., Engel R.R., Hegerl U. Wissenschaftliche OnlineUmfrage zur Internet-Abhängigkeit. MMW-Fortschritte der Medizin 118, 109-113 (2000). [30]Turner J.W., Grube J.A., Meyers J. Developing an optimal match within online communities: An exploration of CMC support communities and traditional support. Journal of Communication 51, 231-251 (2001). [31]White M., Dorman S.M. Receiving social support online: implications for health education. Health Education Research 16, 693-707 (2001). [32]Wittchen H.-U., Weigel A., Pfister H. DIA-X - Diagnostisches Expertensystem: Swets Test Services, Frankfurt am Main, 1996. Dipl. Soz. Anne Blume, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie der Universität Leipzig [email protected] Original Original Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 52–57 Der Rezeptortest bei der Pupillometrie als Methode zur Differenzierung des dementiellen Syndroms Josef Grünberger1, Wolfgang Prause2, Patrick Frottier3, Hans Stöhr4, Bernd Saletu2, Manfred Haushofer5 und Michael Rainer5 Abt. für klinische Psychodiagnostik, Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien 2 Bereich für Schlafforschung und Pharmakopsychiatrie, Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien 3 Therapeutischer Bereich, Justizanstalt Wien-Mittersteig 4 Institut für Biomedizinische Forschung, Medizinische Universität Wien 5 Memory Klinik, Psychiatrische Abt. des Sozialmedizinischen Zentrums Ost Wien 1 Schlüsselwörter: Pupillometrie – Rezeptortest – Tropicamid – Differentialdiagnose – Demenz Key words: pupillometry – receptor test – tropicamide – differential diagnosis – dementia Der Rezeptortest bei der Pupil­ lo­­metrie als Methode zur Dif­ feren­zierung des dementiellen Syndroms Anliegen: Die Pupillometrie ist eine nicht-invasive Untersuchungstechnik, deren Grundlage die Reagibilität der Pupille durch spezifische sensorische, mentale und emotionale Variablen ist. Nach topischer Applikation eines Anticholinergikums (Tropicamid) kann pupillometrisch eine überschießende Pupillendilatation bei Morbus Alzheimer-Patienten beobachtet werden („Rezeptortest“). Das Ziel unserer Studie ist, nachzuweisen, ob mittels des 0,01%igen Tropicamidtests eine Differenzierung verschiedener De© 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 menzformen gelingt. Methode: 425 Patienten (159 Männer, 266 Frauen, mittleres Alter 75 Jahre) der Memory Klinik des SMZ Ost Wien wurden in die Studie eingeschlossen. 195 Patienten litten an einer senilen Demenz vom Alzheimertyp (ICD-10: F00.1), 42 an einer präsenilen Demenz vom Alzheimertyp (F00.0), 71 an einer vaskulären Demenz (F01), 34 an einer Lewy-Body Demenz (F03) und 83 an einer Mixed Dementia (F00.2). Alle Patienten wurden mittels eines computerunterstützten TV-Pupillo­ meters untersucht. Der Pupillendurch­ messer des linken Auges wurde 4 x vermessen. Die Messzeitpunkte wa­ ren 0 (baseline), nach 20, 40 und 60 Minuten. In der 4. Minute nach der Baseline-Untersuchung erhielten die Patienten einen Tropfen einer 0,01%igen Tropicamidlösung in das linke Auge geträufelt. Ergebnisse: Bei der Baseline-Untersuchung war der Pupillendurchmesser bei der Lewy-Body Demenz am größten, bei der vaskulären Demenz am geringsten. Bei den Ausgangswerten („Baseline“) unterschied sich sowohl die vaskuläre Demenz von der präsenilen Demenz als auch die Lewy-Body Demenz von allen anderen Demenzformen außer der präsenilen Demenz. Mittels des Tropicamidtests konnte die präsenile Demenz sowohl von der vaskulären Demenz als auch von der Mixed Dementia abgegrenzt werden. Schlussfolgerungen: In unserer Studie konnten wir zeigen, dass die pupillometrische Untersuchung beim 0,01%igen Tropicamid-Rezeptortest eine Unterscheidung zwischen der präsenilen Demenz und der vaskulären Demenz bzw. der Mixed Dementia ermöglicht. The pupillary response test as a method to differentiate various types of dementia Aim: Pupillometry is a non-invasive measurement technique based on the pupillary response to specific sensoric, mental and emotional variables. After topical application of a cholinergic antagonist (tropicamide) an increased pupillary dilatation response in Alzheimers´s disease patients was described (“receptor test”). The aim of the present study was to evaluate the usefulness of the 0.01% tropicamide receptor test in differentiating types of dementia. Method: 425 patients (159 men, 266 women, mean age 75 years) of the Memory Clinic of the SMZ Ost Vienna, Austria were included in the study. 195 patients Der Rezeptortest bei der Pupillometrie als Methode zur Differenzierung des dementiellen Syndroms suffered from a dementia in Alzheimer's disease with late onset (ICD-10: F00.1), 42 from dementia in Alzheimer's disease with early onset (F00.0), 71 from vascular dementia (F01), 34 from Lewy-Body dementia (F03) and 83 from mixed dementia (F00.2). All patients were investigated by means of a computer-assisted pupillometer. The pupillary diameter of the left eye was measured 4 times (baseline = 0 minutes, after 20, 40 and 60 minutes). 4 minutes after baseline one drop of 0.01% tropicamide solution was installed onto the left eye of the patients. Results: At baseline the pupillary diameter was largest in LewyBody dementia, smallest in vascular dementia. Significant differences were observed between vascular dementia and early-onset dementia in Alzheimer's disease as well as between Lewy-Body dementia and all other dementia syndromes (except dementia in Alzheimer's disease with early onset). The 0.01% tropicamide receptor test made it possible to differentiale early-onset dementia in Alzheimer's disease from vascular and mixed dementia. Conclusion: Utilizing pupillometry in combination with the 0.01% tropicamide receptor test allows to discriminate between different dementia types of, as demonstrated in our study. Einleitung Dementielle Erkrankungen (ICD10: F00-F03) sind meist progredient und chronisch verlaufende Krankheiten des Gehirns, wobei zahlreiche höhere kortikale Funktionen wie das Gedächtnis, die Auffassung, die Lernfähigkeit oder das Urteilsvermögen und in Folge auch das Sozialverhalten beeinträchtigt sind. Die Demenz vom Alzheimertyp stellt die häufigste Demenzform (60%-80%) dar, gefolgt von der vaskulären Demenz (10%-25%) und der Lewy-Körperchen Demenz (7-25%). Andere Demenzformen sind selten, während Mischformen häufig auftreten. Derzeit leiden weltweit mehr als 24,3 Millionen Menschen an einer Demenz. Da Inzidenz und Prävalenz von Demenzerkrankungen mit dem Alter ansteigen und der Anteil alter Menschen wächst, kommen jedes Jahr 4,6 Millionen neue Krankheitsfälle hinzu [1]. Im Jahr 2000 litten in Österreich etwa 90500 Personen an einer dementiellen Erkrankung. Die jährlichen Neuerkrankungen werden von 23600 im Jahr 2000 auf 59500 im Jahr 2050 ansteigen, sodass im Jahr 2050 mit circa 233.800 Erkrankten in Österreich gerechnet werden muss [26]. Es gibt keine technische Untersuchung, die das eindeutige Vorliegen einer dementiellen Erkrankung beweist. Hilfreich zur Diagnosestellung sind neben der Krankengeschichte zunächst einfache psychometrische Testverfahren, wie der Mini-Mental State Test [2] und der Uhrentest [24]. Dann muss eine genaue somatische, psychiatrische und neurologische Untersuchung erfolgen, wobei unter anderem standardisierte technische Untersuchungsverfahren, wie die cra­niale Computertomographie und Kernspintomographie eingesetzt werden. Um keine behandelbare Ursache zu übersehen, sollten zumindest auch Laborparameter, wie ein komplettes Blutbild, Vitamin B12-Spiegel, Blutzucker, Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte und Schilddrüsenhormone bestimmt werden. Andere Verfahren, wie Magnetresonanzspektroskopie, evozierte Potentiale, quantitatives EEG, Bestimmung spezifischer Proteine aus Urin und Serum aber auch die Pupillometrie, sind nicht validiert und ihre diagnostische Aussagekraft ist daher noch offen [15]. Die Pupillometrie ist eine nicht-invasive Untersuchungstechnik, deren Grundlage die Reagibilität der Pupille durch spezifische sensorische, mentale und emotionale Variablen ist [6]. Anatomische Basis der Pupillenreaktion ist das Wechselspiel zwischen dem vom parasympathischen 53 Nucleus Edinger-Westphal innervierten M. sphincter pupillae und dem sympathisch innervierten M. dilatator pupillae. Nach topischer Applikation eines cholinergen Antagonisten (0,01%ige Tropicamidlösung) konnten Scinto et al. [20] pupillometrisch eine unterschiedlich große Pupillendilatation bei Patienten mit einer Demenz vom Alzheimertyp im Vergleich zu gesunden Kontrollen messen („Rezeptortest“). Durch den Nachweis eines gesteigerten miotischen Effekts nach topischer Gabe eines Anticholinergikums bei bestehendem Acetylcholinmangel sollte damit der Beweis eines zentralen cholinergen Defizits, wie beim Morbus Alzheimer beschrieben, gelingen. Obwohl das Studienergebnis in einigen Folgestudien reproduziert werden konnte [5, 11, 17, 21], wird der Rezeptortest heutzutage wegen zu geringer Spezifität und Sensitivität als Diagnostikum für eine senile Demenz vom Alzheimertyp abgelehnt [14]. Iijima et al. [12] sehen daher die Zukunft des Tropicamidtests nicht primär als „Alzheimertest“, sonders als Hilfsmittel bei der Differentialdiagnostik des dementiellen Syndroms. Die Fragestellung unserer Studie ist nun, ob mittels des 0,01%igen Tropicamidtests pupillometrisch eine Differenzierung der wichtigsten Demenzformen gelingt. Methodik Patienten In die Studie wurden Patienten beiderlei Geschlechts, die entweder an einer senilen Demenz vom Alzheimertyp (ICD-10: F00.1), an einer präsenilen Demenz vom Alzheimertyp (ICD-10: F00.0), an einer vaskulären Demenz (ICD-10: F01), an einer Lewy-Body Demenz (ICD-10: F03) oder an einer Mixed Dementia (vaskuläre Demenz plus Alzheimer-Demenz, ICD-10: F00.2) litten, eingeschlossen. Alle Patienten waren an der Memory Klinik der psychiatrischen Abteilung des Grünberger et al. Donauspital SMZ-Ost Wien in Betreuung und wurden von erfahrenen Fachärzten mittels einer standardisierten somatischen, neurologischen und psychiatrischen Untersuchung [15] nach ICD-10 [13] diagnostiziert. 425 Patienten (159 Männer, 266 Frauen, mittleres Alter 75 Jahre), die an einer obig genannten dementiellen Erkrankung litten, wurden im Zeitraum 1996 – 2005 konsekutiv in die Studie eingeschlossen. 195 Patienten (76 Männer, 119 Frauen) litten an einer senilen Demenz vom Alzheimertyp, 42 (6 Männer, 36 Frauen) an einer präsenilen Demenz vom Alzheimertyp, 71 (26 Männer, 45 Frauen) an einer vaskulären Demenz, 34 (17 Männer, 17 Frauen) an einer LewyBody Demenz und 83 (34 Männer, 49 Frauen) an einer Mixed Dementia. Methodik der Pupillometrie Alle Patienten wurden mittels eines computerunterstützten TV-Pupillometers 1050 der Whittaker Coporation untersucht [4]. Die Patienten hatten sich 3 Minuten lang an die Beleuchtung (160 Lux) eines geräuschgedämmten Raumes (3x4 m) zu adaptieren. Dann mussten sie ihren Kopf auf der Kinn- und Stirnstütze des Pupillometers möglichst angenehm positionieren und einen schwarzen Punkt – 1,6 m vom Auge entfernt – fixieren, um eine Akkommodation zu vermeiden. Diese Distanz wurde verwendet, da ein näherer Fixationspunkt einen kleineren Pupillendurchmesser verursacht. Nach der Akkommodation und Adjustierung des Pupillometers erfolgte die 25,6 Sekunden dauernde computerunterstützte Messung der Pupille des linken Auges und Berechnung des Pupillendurchmessers und der Standardabweichung. In der 4. Minute nach der 1. Untersuchung erhielten die Patienten einen Tropfen 0,01%ige Tropicamidlösung mittels topischer Applikation in das linke Auge installiert. Die zweite Messung erfolgte 20 Minuten nach der ersten, die 3. und 4. Messung folgten jeweils 54 in 20-minütigem Abstand. Die Messzeitpunkte waren daher 0 (baseline), nach 20, 40 und 60 Minuten. Der Wert jedes Messzeitpunktes ist der Mittelwert von 40 Einzelmessungen/Sekunde. Die Pupillenmessungen wurden am Vormittag an der psychiatrischen Abteilung des Sozialmedizinischen Zentrums Ost/Wien durchgeführt. Die Patienten nahmen zum Zeitpunkt der pupillometrischen Untersuchung keine Acetylcholinesterasehemmer oder sympatomimetischen Medikamente ein. Statistik Der Mittelwert und die Standardabweichung sowie die Spannweite wurden für alle erhobenen Variablen berechnet. Für Gruppenvergleiche wurde der Mann-Whitney-U-Test verwendet. Vor der Testung wurde mit Hilfe des Levene-Tests auf Varianzgleichheit geprüft. Ergebnisse Bei der Baseline-Untersuchung (ohne Tropicamid) war der absolute Pupillendurchmesser bei der Lewy-Body Demenz am größten, gefolgt von der präsenilen Demenz vom Alzheimertyp. Den kleinsten Durchmesser wiesen Patienten mit einer vaskulären Demenz auf. Bei den Ausgangswerten unterschied sich die LewyBody Demenz signifikant von allen anderen untersuchten Demenzformen außer der präsenilen Demenz vom Alzheimertyp. Nach der Gabe von 0,01% Tropicamid kam es bei der Gruppe der senilen Demenz vom Alzheimertyp in der 40. Minute zur relativ größten Zunahme des Pupillendurchmessers, die prozentuell geringste Zunahme trat insgesamt bei der Mixed Dementia gefolgt von der vaskulären Demenz auf. Generell war ein progredienter mydriatischer Effekt bei allen Demenzformen zu beobachten, der zum Messzeitpunkt „40 Minuten“ sein Maximum erreichte. Danach kam es wegen der nachlassenden Wirkung von Tropicamid insgesamt wiederum zu einer Abnahme des Pupillendurchmessers (Abbildung 1). Zum Zeitpunkt „20 Minuten“ konnte ein signifikanter Unterschied des Pupillendurchmessers zwischen der präsenilen Demenz vom Alzheimertyp und der Mixed Dementia festgestellt werden. In der 40. und 60. Minute konnte die präsenile Demenz vom Alzheimertyp sowohl von der Mixed Abbildung 1: Darstellung des Pupillendurchmessers in mm bei Patienten mit einer präsenilen und senilen Demenz vom Alzheimer Typ, mit einer Mixed Dementia, mit einer vaskulären Demenz und einer Lewy-Body Demenz vor und nach der Applikation von 0,01% Tropicamid. Der Rezeptortest bei der Pupillometrie als Methode zur Differenzierung des dementiellen Syndroms 55 mentia an 3 Zeitpunkten (20, 40, 60 Minuten) unterschieden werden (Abbildung 3). Diskussion Abbildung 2: Darstellung signifikanter Unterschiede in der Pupillenreaktion beim 0,01% Tropicamidtest zum Zeitpunkt „0“ (baseline) und nach 20, 40 und 60 Minuten bei der präsenilen und senilen Demenz vom Alzheimer Typ, der Mixed Dementia, der vaskulären Demenz und der Lewy-Body Demenz. Abbildung 3: Darstellung der Differenzierungsmöglichkeit des dementiellen Syndroms mittels des 0,01% Tropicamidtests zum Zeitpunkt „20“ (20 Minuten), „40“ (40 Minuten) und „60“ (60 Minuten). Die Pfeile bezeichnen die möglichen Differenzierungen zwischen den einzelnen Demenzformen. Dementia als auch von der vaskulären Demenz abgegrenzt werden. Die Lewy-Body Demenz unterschied sich in der 40. Minute von der vaskulären Demenz und in der 60. Minute von der Mixed Dementia (Abbildung 2). Generell konnte daher die präsenile Demenz vom Alzheimertyp pupillometrisch mittels des 0,01%igen Tropicamidtests von der vaskulären Demenz an 2 Messzeitpunkten (40, 60 Minuten) und von der Mixed De- Zum Messzeitpunkt 0 (=baseline) unterschied sich die Pupillengröße der Patienten mit Lewy-Body Demenz signifikant von allen anderen Demenzformen, mit Ausnahme der präsenilen Demenz vom Alzheimertyp. Eine sichere Unterscheidung der vaskulären Demenz und der senilen Demenz vom Alzheimertyp anhand des Pupillendurchmessers gelang zum Zeitpunkt „0“ nicht. Mittels des Tropicamidtests konnte die präsenile Demenz vom Alzheimertyp sowohl von der vaskulären Demenz als auch von der Mixed Dementia eindeutig differenziert werden. Zwischen der senilen Demenz vom Alzheimertyp und den anderen Demenzformen konnten keine signifikanten Unterschiede in der Pupillenreaktion gemessen werden. Dies ist in guter Übereinstimmung mit der Literatur. Higuchi et al. [7] und Treloar et al. [25] konnten eine senile Demenz vom Alzheimertyp von einer vaskulären bzw. einer Multi-Infarkt Demenz mittels des 0,01%igen Tropicamidtests nicht unterscheiden. Auch Iijima et al [12] gelang es nicht, in einer Re-evaluierung des 0.01%igen Tropicamidtests pupillometrisch eine Unterscheidung zwischen der senilen Demenz vom Alzheimertyp und der vaskulären Demenz zu treffen. Weiters ließ sich die senile Demenz vom Alzheimertyp weder von einer frontotemporalen Demenz [18], noch von einer progressiven supranukleären Paralyse [16] noch von Morbus Parkinson [3] mittels des Rezeptortests differenzieren. Dass in unserer Studie eine deutliche Unterscheidung zwischen der vaskulären Demenz und der präsenilen Demenz vom Alzheimertyp gelang, ist bemerkenswert. Scinto et al [22] beschrieben, dass der Edinger-West- Grünberger et al. phal (EW) Kern im Mittelhirn ein selektives Ziel der Alzheimer Pathologie sei und schon in frühen Stadien der Erkrankung degeneriere. Auch der beobachtete Zusammenhang zwischen dem Apolipoprotein E ε4 Allel (ApoE-ε4) und einer damit verbundenen gesteigerten mydriatischen Reaktion im Tropicamidtest [6, 8] ist in diesem Zusammenhang zu sehen. ApoEε4 gilt generell als Risikofaktor für die Entwicklung einer präsenilen und senilen Demenz vom Alzheimertyp [10, 19]. Das ApoE-ε4 Genprodukt wird mit einer gesteigerten Phosphorylierung des Tau-Proteins und einer dadurch beeinträchtigten Stabilisierungsfunktion der Mikrotubuli und verstärkten Bündelbildung („Alzheimer-Fibrillen“) in Zusammenhang gebracht. Dieser Mechanismus, der auch für die frühe Alzheimerpathologie im EW Kern (mit)verantwortlich ist und mit einem signifikanten Zellverlust einhergeht, führt somit letztendlich zu einer Überempfindlichkeit im Tropicamidtest [23]. Hou et al. [9] nahmen als eine weitere Ursache einer bei einer Demenz vom Alzheimertyp gesteigerten pupillären Empfindlichkeit auf Tropicamid eine verminderte noradrenerge Aktivität bedingt durch einen Zellverlust im Locus Coeruleus (LC) an. Man könnte den Tropicamidtest daher auch als Test für das Ausmaß der neuronalen Degeneration im cholinergen EW Kern (und eventuell auch im noradrenergen LC) sehen. Bei unserem Patientenkollektiv würde dies bedeuten, dass die pathologischen Veränderungen im EW-Kern bei der präsenilen Demenz vom Alzheimertyp weiter fortgeschritten sind als bei der senilen Demenz vom Alzheimertyp und der Mixed Dementia. Daher zeichnen Patienten mit präseniler Demenz vom Alzheimertyp im 0,01%igen Tropicamid-Rezeptortest im Vergleich zur vaskulären Demenz deutlicher als im Vergleich zur senilen Demenz vom Alzheimertyp. Iijima et al. [12] gelang es, auch zwischen der senilen Demenz vom Alzheimertyp und der vaskulären 56 Demenz mit einer stärker verdünnten Lösung von Tropicamid (0,005%) einen signifikanten Unterschied in der Pupillenreaktion nachzuweisen. Die Autoren folgerten, dass 0,01%iges Tropicamid vielleicht zu konzentriert sei, da auch gesunde Menschen oft noch mit einer überschießenden Pupillenreaktion reagieren. Wir stimmen daher der Forderung von Iijima et al. [12] zu, dass es wichtig wäre, eine Konzentration von Tropicamid zu finden, die kaum einen Effekt bei gesunden Menschen zeigt, aber noch eine umfassendere Differenzierung zwischen den Demenzformen erlaubt. Danksagung [6] [7] [8] [9] [10] Die Autoren möchten Frau Mag. Elisabeth Grätzhofer für ihre wertvolle Unterstützung danken. [11] Literatur [1] Ferri CP., Prince M., Brayne C., Brodaty H., Fratiglioni L., Ganguli M., Hall K., Hasegawa K., Hendrie H., Huang Y., Jorm A., Mathers C., Menezes P.R., Rimmer E., Scazufca M.: Alzheimer's Disease International. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 366, 2112-7 (2005). [2] Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R.: "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 12, 189-198 (1975). [3] Granholm E., Morris S., Galasko D., Shults C., Rogers E., Vukov B.: Tropicamide effects on pupil size and pupillary light reflexes in Alzheimer's and Parkinson's disease. Int J Psychophysiol 47, 95-115 (2003). [4] Grünberger J., Linzmayer L., Grünberger M., Saletu B.: Pupillometry in clinical psychophysiological diagnostics: methodology and proposals for application in psychiatry. Isr J Psychiatry Relat Sci 29, 100-13 (1992). [5] Grünberger J., Linzmayer L., Walter H., Rainer M., Masching A., Pezawas L., Saletu-Zyhlarz G.M., Stöhr H., Grünberger M.: Receptor test (pupillary dilatation after application of 0.01% tropicamide solution) and determination [12] [13] [14] [15] [16] of central nervous activation (Fourier analysis of pupillary oscillations) in patients with Alzheimer's disease. Neuropsychobiology 40, 40-6 (1999). Grünberger J.: Pupillometrie in der klinisch-psychophysiologischen Diagnostik. Springer, Wien, New York (2003). Higuchi S., Matsushita S., Hasegawa Y., Muramatsu T., Arai H.: Pupillary response to tropicamide in Japanese patients with alcoholic dementia, Alzheimer's disease, and vascular dementia. Exp Neurol 144, 199-201 (1997). Higuchi S., Matsushita S., Hasegawa Y., Muramatsu T., Arai H., Hayashida M.: Apolipoprotein E epsilon 4 allele and pupillary response to tropicamide. Am J Psychiatry 154, 694-6 (1997). Hou R.H., Samuels E.R., Raisi M., Langley R.W., Szabadi E., Bradshaw C.M.: Why patients with Alzheimer's disease may show increased sensitivity to tropicamide eye drops: role of locus coeruleus. Psychopharmacology (Berl) 184, 95-106 (2006). Houlden H., Crook R., Backhovens H., Prihar G., Baker M., Hutton M., Rossor M., Martin J.J., Van Broeckhoven C., Hardy J.: ApoE genotype is a risk factor in nonpresenilin early-onset Alzheimer's disease families. Am J Med Genet 81, 117-21 (1998). Idiaquez J., Alvarez G., Villagra R., San Martin R.A.: Cholinergic supersensitivity of the iris in Alzheimer's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 57, 1544-5 (1994). Iijima A., Haida M., Ishikawa N., Ueno A., Minamitani H., Shinohara Y.: Reevaluation of tropicamide in the pupillary response test for Alzheimer's disease. Neurobiol Aging 24, 789-96 (2003). Dilling H. (Hrsg): Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10, Kapitel V (F); klinisch-diagnostische Leitlinien. 5. Aufl. Huber, Bern 2005. Kardon R.H.: Drop the Alzheimer's drop test. Neurology 50, 588-91 (1998). Alf C., Bancher C., Benke T., Berek K., Bertha G., Bodner T., Croy A., Dal-Bianco P., Fazekas F., Fischer P., Fruhwürth G., Gatterer G., Hinterhuber H., Imarhiagbe D., Krautgartner M., Jaksch A., Jellinger K., Kalousek M., Ladurner G., Leblhuber F., Lechner A., Lingg A., Marksteiner J., Nakajima T., Psota G., Rainer M., Ransmayr G., Reisecker F., Rumpl E., Schmidt R., Walch T., Walter A., Wancata J.: Konsensusstatement „Demenz“ der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft und Österreichischen Alzheimer Liga zur Demenz. Neuropsychiatrie, 18, 39-46 (2004). Litvan I., FitzGibbon E.J.: Can tropicamide eye drop response differentiate patients with progressive supranuclear palsy and Alzheimer's disease from healthy Der Rezeptortest bei der Pupillometrie als Methode zur Differenzierung des dementiellen Syndroms [17] [18] [19] [20] control subjects? Neurology 47, 1324-6 (1996). Prettyman,R., Bitsios P., Szabadi E.: Altered pupillary size and darkness and light reflexes in Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg Psych 62, 665-8 (1997). Robles A., Tourino R., Gude F., Noya M.: The tropicamide test in patients with dementia of Alzheimer type and frontotemporal dementia. Funct Neurol 14, 203-7 (1999). Saunders A.M., Schmader K., Breitner J.C., Benson M.D., Brown W.T., Goldfarb L., Goldgaber D., Manwaring M.G., Szymanski M.H., McCown N., et al.: Apolipoprotein E epsilon 4 allele distributions in late-onset Alzheimer's disease and in other amyloid-forming diseases. Lancet 342, 710-1 (1993). Scinto L.F., Daffner K.R., Dressler D., Ransil B.I., Rentz D., Weintraub S., [21] [22] [23] [24] Mesulam M., Potter H.: A potential noninvasive neurobiological test for Alzheimer's disease. Science 266, 1051-4 (1994). Scinto L.F., Rentz D.M., Potter H., Daffner K.R.: Pupil assay and Alzheimer's disease: a critical analysis. Neurology 52, 673-4 (1999). Scinto L.F., Wu C.K., Firla K.M., Daffner K.R., Saroff D., Geula C.: Focal pathology in the Edinger-Westphal nucleus explains pupillary hypersensitivity in Alzheimer's disease. Acta Neuropathol (Berl) 97, 557-64 (1999). Scinto L.F.: ApoE allelic variability influences pupil response to cholinergic challenge and cognitive impairment. Genes Brain Behav (Epup) Jun 8 (2006). Shulman K., Shedletsky R., Silver I.: The challenge of time. Clock drawing and cognitive function in the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 1, 135-40 (1986). 57 [25] Treloar A.J., Assin M., Macdonald A.J.: Pupillary response to topical tropicamide as a marker for Alzheimer's disease. Br J Clin Pharmacol 41, 256-7 (1996). [26] Wancata J., Kaup B., Krautgartner M.: Projections in the incidence of dementia in Austria for the years 1951 to 2050. Wien Klin Wochenschr 113, 172-80 (2001). Univ. Prof. Dr. Josef Grünberger Abteilung für klinische Psychodiagnostik, Universitätsklinik für Psychiatrie, Medizinische Universität Wien. [email protected] Bericht Report Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 58–63 Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich: eine naturalistische Studie an 103 PatientInnen mit Alzheimer Demenz Reinhold Schmidt1, Claude Alf2, Christian Bancher3, Thomas Benke4, Klaus Berek5, Peter Dal-Bianco6, Gerhard Führwürth7, Douglas Imarhiagbe8, Christian Jagsch9, Anita Lechner1, Michael Rainer10, Franz Reisecker11, Juliana Rotaru12, Margarete Uranüs13, Andreas Walter14, Andreas Winkler15 und Albert Wuschitz16 Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Graz Neurologisches Zentrum Rosenhügel,1.Neurologische Abteilung, Wien 3 Landesklinikum Waldviertel Horn, Abteilung für Neurologie 4 Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck 5 Bezirkskrankenhaus Kufstein, Neurologische Abteilung 6 Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Wien 7 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, Sozialpsychiatrische Abteilung 8 Psychiatrisches Krankenhaus Hall 9 Psychiatrische Klinik Wels 10 SMZ-Ost Donauspital, Psychiatrische Abteilung, Wien 11 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz 12 Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg, Neurologische Abteilung, Linz 13 Landesnervenklinik-Sigmund-Freud Graz, Abteilung für Gerontopsychiatrie 14 Geriatriezentrum Wienerwald 15 Haus der Barmherzigkeit, Wien 16 Wallensteinplatz, Wien 1 2 Dieses Projekt wurde von Novartis Austria initiiert, die Untersucher erhielten finanzielle Unterstützung für die Abwicklung des Projektes. Schlüsselwörter: Alzheimer Demenz – Klinische Routine – Rivastigmin – Behandlung Key Words: Alzheimer´s disease – clinical routine – ­rivastigmine – therapy © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich: eine naturalistische Studie an 103 PatientInnen mit Alzheimer Demenz Wir führten eine offene 6-Monats Studie zur Anwendung des Rivastigminpflasters in der klinischen Routine bei 103 PatientInnen mit Alzheimer Demenz in 25 ambulanten Zentren in Österreich durch. Nach der initialen Visite wurden alle StudienteilnehmerInnen nach 4, 12 und 24 Wochen bezüglich Sicherheit und Tolerabilität des 10cm2 - Rivistigminpflasters untersucht, zu Beginn, nach 12 und 24 Wochen wurde eine Mini Mental State Examination durchgeführt. Die Klebeeigenschaften des Pflasters waren bei 85% aller Patien- tInnen sehr gut oder gut. Nur 2.9% der PatientInnen hatten gastrointestinale unerwünschte Ereignisse, lokale Hautreaktionen wurden bei etwa 23% festgestellt. Die Hautveränderungen waren meist gering und führten nur bei 6.8% der TeilnehmerInnen zu Therapieabbruch. Sie wurden frühestens nach 3-monatiger Therapiedauer beobachtet. Die kognitiven Funktionen verbesserten sich vergleichbar zur kontrollierten Zulassungsstudie. In der täglichen Routine ist das Sicherheitsprofil des Rivastigminpflasters und die Therapieantwort günstig. Lokale, meist geringgradige Hautreaktionen treten bei etwa jeder/ em fünften PatientIn, und relativ spät im Behandlungsverlauf, auf. PatientInnen und ihre BetreuerInnen sollten Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich detailliert darüber informiert werden um unnotwendige Therapieabbrüche zu vermeiden. Transdermal Rivastigmine Patch in Outpatient Services in Austria: a Naturalistic Study in 103 Patients with Alzheimer Dementia We performed a 6-month open-label study on the use of the trandermal rivastigmine patch in clinical routine in 103 patients with Alzheimer´s disease from 25 outpatient services in Austria. After baseline, safety and tolerability of the 10 cm2 – rivastigmine patch was assessed at week 4,12 and 24 in all patients. A Mini Mental State Examination was done at baseline and at week 12 and 24. Skin adherence of the patch was very good or good in 85% of study participants. Only 2.9% of patients had gastrointestinal adverse events. Local skin reactions occurred in 23 % of individuals. Skin alteration were mostly mild in severity. In only 6.8% of subjects did they result in termination of treatment. At the earliest skin reactions were observed after 3 months of treatment. Cognitive functioning of patients improved comparable to the controlled trial which led to approval of the rivastigmine patch. In daily routine the safety profile of the rivastigmine patch is favourable, as is the response to treatment. Local, mostly mild skin reactions affect approximately every fifth patient, and they occur relatively late in the course of therapy. Patients and their caregivers should receive detailed information about skin reactions to omit unnecessary drop outs to treatment. Einleitung Rivastigmin inhibiert Acetylcholinesterase und Butyrylcholinesterase und ist für die Behandlung von milder bis moderater Alzheimer- ­ emenz und Parkinson-Demenz zuD gelassen (1). Rivastigmin und andere Cholinesterasehemmer werden bei PatientInnen mit Alzheimer-Demenz ausschließlich in Form von Tabletten oder Kapseln verabreicht (2). Spe­ zifische Richtlinien für die Anwendung in Österreich wurden publiziert (3-6). Ein transdermales RivastigminPflaster (Exelon®, Novartis) wurde kürzlich entwickelt. Die lipophilen und hydrophilen Eigenschaften von Rivastigmin erlauben eine transdermale Applikation (7). In der IDEALStudie wurden 1.195 Alzheimer-PatientInnen in 21 Ländern im Rahmen einer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten Studie mit Rivastigmin 10cm2 (9.5mg/24Stunden) - oder 20cm2 (17.4mg/24Stunden)Pflaster oder 6mg Kapseln zweimal täglich behandelt (8). Die Studie belegte, dass das 10cm2-Pflaster ähnliche Wirksamkeit wie 2 mal 6mg Rivastigmin in Form von Kapseln aufwies. Die Häufigkeit von Nebenwirkungen war beim 10cm2-Pflaster nahezu ident zur Placebogruppe und signifikant niedriger als bei jenen PatientInnen, die Kapseln erhielten. Das 20cm2-Pflaster brachte keine Vorteile gegenüber der oralen Medikation in Hinblick auf Nebenwirkungen bei vergleichbarer Wirksamkeit. Die Hautverträglichkeit des Pflasters war im Allgemeinen gut, ausgeprägte Erytheme traten bei 8% und Pruritus bei 7% auf. Die Zahl von PatientInnen, welche die Behandlung aufgrund von Hautirritationen abbrachen, lag beim 10cm2-Pflaster bei 2%. Aufgrund dieser Daten wurde das 10cm2-Rivastigmin-Pflaster im September 2007 zugelassen und wird vom Hauptverband der Versicherungsträger seit Juli 2008 in Österreich erstattet. Randomisierte, kontrollierte Studien sind geeignet, die Wirksamkeit von therapeutischen Interventionen abzuklären und sind Standard, um evidenzbasierte Medizin zu etablieren. Kontrollierte Studien erfolgen 59 jedoch in klinischen Idealsituationen und reflektieren die tägliche Praxis nur begrenzt. Ergänzende Beobachtungsstudien, welche die Anwendung von Substanzen und ihren Applikationsformen in der täglichen Routine untersuchen, sind im Anschluss an kontrollierte Studien notwendig (9). Wir führten daher in Österreich eine der ersten naturalistischen Untersuchungen zur Anwendung des Rivastigmin-Pflasters in der Behandlung der Alzheimer-Demenz durch und beschreiben die Sicherheit und Verträglichkeit dieser Applikationsform bei 103 PatientInnen, die in 25 Zentren behandelt wurden. Eine offene Studie ist nicht geeignet, die Wirksamkeit einer Behandlung nachzuweisen, trotzdem ist die Dokumentation der Therapieantwort in deskriptiver Form wertvoll. PatientInnen und Methodik Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie, die nicht randomisiert und in offener Form bei PatientInnen mit milder bis schwerer AlzheimerErkrankung durchgeführt wurde. Ziel der Untersuchung war es, Sicherheit und Verträglichkeit des 10cm2-Pflasters und die Behandlungseffekte in der täglichen Praxis zu erheben. Alle PatientInnen erfüllten die NINCDS-ADRDA-Kriterien (10) und erreichten Mini Mental State Examination (MMSE; 11) Scores zwischen 7 und 26. PatientInnen erhielten das Rivastigmin-Pflaster über einen Zeitraum von 24 Wochen. Nach einer Startdosis mittels 5cm2-Pflaster (4,6mg Rivastigmin/24 Stunden) wurde nach 4 Wochen eine Dosiserhöhung auf das10cm2-Pflaster (9.5mg Rivastigmin/24Stunden) durchgeführt. Im Anschluss an die Initialvisite wurden die PatientInnen entsprechend Studienplan nach 4, 12, und 24 Wochen kontrolliert. Bei der Erstuntersuchung erhoben wir demographische Faktoren der StudienteilnehmerInnen einschließlich Größe Schmidt et al. und Gewicht, sowie Dauer der Alzheimer-Erkrankung und sozialen Versorgungsstatus, aber auch Begleiterkrankungen und Begleitmedikation. Eine MMSE war obligatorisch. Bei den Kontrolluntersuchungen folgten neben einem physikalischen Status die Erhebung von unerwünschten Ereignissen, Aufzeichnung der Klebeeigenschaften des Pflasters, Dokumentation von Hautirritationen, und eine MMSE. Alle unerwünschten Ereignisse unabhängig davon, ob von den PatientInnen selbst oder ihren Betreuungspersonen beobachtet, wurden aufgezeichnet und bezüglich ihres Schweregrades und ihrer Dauer sowie bezüglich eines möglichen kausalen Zusammenhanges mit dem Rivastigmin-Pflaster beurteilt. Jene unerwünschten Ereignisse, welche zum Tode führten oder lebensbedrohlich waren oder eine stationäre Behandlung in einer Krankenanstalt erforderten oder zu einer Verlängerung eines stationären Aufenthaltes führten oder eine maligne Erkrankung verursachten, zu Missbildungen oder sonstigen andauernden oder schweren Schädigungen der Gesundheit führten, wurden als schwer eingestuft. Alle Analysen zur Sicherheit und Verträglichkeit sowie zur Therapieantwort beziehen sich auf die intention-to-treat-Population. Diese beinhaltete alle PatientInnen, welche die Aufnahmekriterien erfüllten und bei denen zumindest eine Pflasterapplikation erfolgte. Da bei dieser Beobachtungsstudie ein offenes Studiendesign vorliegt, wurden keine formalen statistischen Vergleiche für die Wirksamkeitsvariable durchgeführt. 60 68 (66%) waren Frauen. Die mittlere Dauer der Alzheimer-Erkrankung seit Erstdiagnose betrug 2,4 Jahre; 66 Teilnehmer (64,1%) lebten im familiären Umfeld; 19 (18,4%) hatten professionelle Hilfe; 10 (9,7%) lebten alleine mit zeitlich begrenzter Betreuung; und 7 (6,8%) lebten alleine ganz ohne Fremdhilfe. Die Ergebnisse der MMSE betrugen im Mittel 19,8±4,0 (Range 7-26) Punkte. Die häufigsten Begleiterkrankungen waren kardiovaskuläre Erkrankungen (45,6%), gefolgt von neurologischen (21,4%), metabolischen (17,4%), und psychiatrischen (15,5%) Erkrankungen; 26 StudienteilnehmerInnen (25,2%) hatten zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses Begleitmedikationen. Bei 79 (76,7%) PatientInnen konnte die Abschlussuntersuchung nach 24 Wochen durchgeführt werden. Abbildung 1 beschreibt den Studienverlauf und informiert über die Zahl, die Ursachen, und die Zeitpunkte von Therapieabbrüchen. Wie aus dieser Abbildung ersichtlich, erfolgte die höchste Abbruchsrate zwischen den Wochen 12 und 24. Die Ursache für einen Medikationsabbruch blieb bei 10 PatientInnen unbekannt, 2 TeilnehmerInnen verstarben zwischen den Wochen 4 und 12; der häufigste Grund für einen Therapieabbruch waren Hautreaktionen. Insgesamt veranlassten Hautveränderungen 7 PatientInnen und ihre behandelnden ÄrztInnen dazu, zwischen den Wochen 12 und 24 die Behandlung mit dem Rivastigminpflaster zu beenden. Die Klebeeigenschaften des Pflasters wurden über den gesamten Studienverlauf von 85,4% der PatientInnen und ihren Betreuungspersonen und ÄrztInnen als sehr gut oder gut beurteilt. Bei 39 Personen (37,9%) traten unerwünschte Ereignisse auf. Eine detaillierte Darstellung dieser Ereignisse gibt Tabelle 1. Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, betrafen 23 (59%) unerwünschte Ereignisse Haut und Anhangsgebilde, und nur 2 (5,1%) den Gastrointestinaltrakt. Bezieht man die beobach- Ergebnisse In dieser Beobachtungsstudie wurden von 25 NeurologInnen oder PsychiaterInnen im gesamten österreichischen Bundesgebiet 103 PatientInnen eingeschlossen. Das mittlere Alter der Teilnehmer war 79±7 Jahre, Abbildung 1: Zahl, Ursachen, und Zeitpunkte von Medikationsabbrüchen Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich 61 Köpersystem Beschreibung des Ereignisses Zahl der PatientInnen Gesamtkörper Tod 1 Gesamtkörper Unwohlsein 1 ZNS oder PNS Benommenheit 1 ZNS oder PNS Zittern 1 ZNS oder PNS Schwindel 1 Metabolismus & Ernährung Dehydrierung 1 Psychiatrische Erkrankung Aggression 1 Psychiatrische Erkrankung Verwirrtheit 1 Psychiatrische Erkrankung Halluzinationen 1 Psychiatrische Erkrankung Schlafstörung 1 Reproduktionssystem Prostataerkrankung 1 Respiratorisches System Pneumonie 2 Haut&Anhangsgebilde Pruritus 8 Haut&Anhangsgebilde Erythematöser Ausschlag 14 Haut&Anhangsgebilde Lokale Hautreaktion 1 Vaskuäres System Thrombophlebitis 1 Tabelle 1: Unerwünschte Ereignisse Abbildung 2: MMSE-Ergebnisse über den Studienverlauf teten unerwünschten Ereignisse auf die Gesamtzahl der behandelten Personen, dann hatten nur 1,9% der StudienteilnehmerInnen gastrointestinale Ereignisse;wogegen bei immerhin 21,4% der PatientInnen Hautirritationen unterschiedlichen Ausmaßes auftraten. Hautreaktionen wurden nie vor der 12. Behandlungswoche berichtet, in der Regel handelte es sich um einfache Rötungen im Pflasterbereich (68,2%) oder Rötungen mit Juckreiz (40,9%). Ausgeprägte Exantheme mit oder ohne Juckreiz wurden bei 31,8% der PatientInnen mit Hautreaktionen registriert. Bei 7 PatientInnen (6,8%) führten die Hautreaktionen zu einem Therapieabbruch. Vier PatientInnen hatten 5 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse. Diese inkludierten den Tod von 2 PatientInnen und bei je einer/m Schmidt et al. PatientIn Dehydrierung und Verwirrtheit, Pneumonie und Thrombophlebitis. Ein kausaler Zusammenhang mit dem Rivastigmin-Pflaster wurde von den behandelnden ÄrztInnen für alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse als unwahrscheinlich oder undeterminiert eingestuft. Bei 2 PatientInnen wurde die Behandlung mit dem Rivastigmin-Pflaster aufgrund der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse abgesetzt. Die behandelten PatientInnen zeigten eine durchschnittliche Verbesserung der Ergebnisse in der MMSE im Studienverlauf. Die durchschnittliche Verbesserung betrug im Vergleich zur Basisuntersuchung nach 12 Wochen 0,9 Punkte und nach 24 Wochen 0,7 Punkte (Friedman Test; p=0,01). Wie aus Abbildung 2 ersichtlich wurden zu Woche 12 und Woche 24 in der MMSE Verbesserungen (=>1Punkt ) bei 41,7% und 40,8% der PatientInnen beobachtet, während 18,4% und 21,4% der StudienteilnehmerInnen Verschlechterungen (<=1Punkt ) aufwiesen. Diskussion Diese Beobachtungsstudie zur Anwendung des Rivastigmin-Pflasters über einen 6-Monatszeitraum in der täglichen Praxis erbrachte drei Hauptergebnisse: 1. Die Klebeeigenschaften des Pflasters waren bei 85% aller PatientInnen sehr gut bis gut. 2. Unerwünschte Ereignisse traten bei 38% der StudienteilnehmerInnen auf. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse waren lokale Hautreaktionen bei etwa 23% der PatientInnen. Das Ausmaß der Hautveränderungen war meist gering. Gastrointestinale Nebenwirkungen waren selten und betrafen nur 2,9% der PatientInnen. 3. Über den Beobachtungszeitraum zeigten die Studienteilnehmer­ Innen eine Verbesserung der kog­nitiven Funktion. Die durch- 62 schnittliche Verbesserung im MMSE-Score entsprach in etwa den Ergebnissen der IDEAL­Studie. Mit nur 2.9% der StudienteilnehmerInnen mit Übelkeit und Erbrechen lag die Frequenz gastrointestinaler Nebenwirkungen in unserer Studie unter den Angaben der doppelblind geführten, randomisierten, placebokontrollierten IDEAL Studie, in der bei Anwendung des 10cm2-Pflasters über den gleichen Beobachtungszeitraum Übelkeit und Erbrechen von 6% der Untersuchten berichtet wurden (8). Zusätzlich hatten 6% der StudienteilnehmerInnen Durchfälle (8), ein Symptom, das in unserer Studie nicht auftrat. Unsere Daten sind ein weiteres Indiz dafür, dass durch das 10cm2-Rivastigminpflaster gastrointestinale Nebenwirkungen auf Placeboniveau gesenkt werden können (8). Eine frühere Anwendungsbeobachtung zu Rivastigmin-Kapseln in Österreich beschrieb bei 30,4% der PatientInnen gastrointestinale Nebenwirkungen (12), die Reduktion gastrointestinaler Symptome bei Pflasterapplikation auf ein Zehntel im Vergleich zu oraler Rivastigmintherapie ist erwähnenswert, obwohl ein direkter Vergleich der beiden Studien nur unzureichend möglich ist. Die Hauptursache für die wesentlich bessere gastrointestinale Verträglichkeit des Rivastigmin-Pflasters wird in der kontinuierlichen Abgabe der Substanz bei Pflasterapplikation mit signifikant reduzierten Fluktuationen der Rivastigmin-Spitzenplasmakonzentrationen gesehen (13). Im Gegensatz zu gastrointestinalen Nebenwirkungen waren lokale Hautreaktionen in der vorliegenden Beobachtungsstudie häufig und betrafen jede(n) fünfte(n) PatientIn. In der Regel handelte es sich bei den Veränderungen um Rötungen unterschiedlichen Ausmaßes mit oder ohne Juckreiz. Hautreaktionen schwereren Ausmaßes in Form von Erythemen wurden bei etwa 7% der PatientInnen beobachtet. Sieben StudienteilnehmerInnen brachen die Therapie aufgrund der Hautveränderungen ab. Bei 80% aller PatientInnen mit Hautreaktionen ist von einer Kontaktdermatitis auszugehen. Diese kann durch die Entfernung des Pflasters aber auch durch Blockade von Ausgängen der Schweißdrüsen verursacht werden. Die restlichen 20% der Hautveränderungen im Zusammenhang mit der Pflasterapplikationen sind als allergische Dermatitis zu werten, wobei die Überempfindlichkeit sowohl auf das Klebemittel als auch auf die verabreichte Substanz entstehen kann. Hinweis auf diese Form der Hautreaktion ist eine Rötung mit Zeichen einer Ausbreitung, welche über die Klebestelle des Pflasters hinausgeht (14). In jedem Fall bilden sich die Hautveränderungen in der Regel in weniger als 2 Wochen zurück (14). In unserer Studie wurden Hautreaktionen nie vor der 12. Woche gesehen. Dies ist ein für die tägliche Praxis wichtiger Befund, da in Österreich entsprechend den Verordnungsrichtlinien eine Kontrolluntersuchung bei Gabe von Cholinesterasehemmern zwar nach Erreichen der Erhaltungsdosis (also 4 Wochen nach der initialen Pflastergabe), danach aber erst nach 6 Monaten vorgesehen ist. Hautreaktionen auf das RivastigminPflaster treten also entsprechend der vorliegenden Untersuchung zu einem Zeitpunkt auf, zu dem die PatientInnen üblicherweise nicht von ihren behandelnden NeurologInnen oder PsychiaterInnen gesehen werden. Um die Therapietreue für das Rivastigmin-Pflaster aufrecht zu erhalten, erscheint eine detaillierte Information also nicht nur über die Häufigkeit, die Art, den Schweregrad, sondern vor allem auch über den zu erwarteten Zeitpunkt des Auftretens von Hautreaktionen von entscheidender Bedeutung. Diese Informationen müssen sowohl an die PatientInnen als auch ihre Betreuungspersonen weitergegeben werden, wobei auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Kontrolluntersuchung bei Anzeichen Rivastigmin-Pflaster in der ambulanten Versorgung in Österreich von Hautreaktionen im üblicherweise kontrollfreien Intervall zwischen der 4.Woche und dem 6.Monat der Therapie hinzuweisen ist. Obwohl die vorliegende offene Studie Therapiewirksamkeit nicht definitiv erheben kann, stimmen unsere Daten der MMSE mit den Ergebnissen kontrollierter Studien überein (8,15). Wir beobachteten eine durchschnittliche Verbesserung zwischen der Initialvisite und der letzten Untersuchung von 0,7 Punkten – ein Wert, der nur geringgradig unter der beobachteten Verbesserung der IDEAL-Studie liegt (8). Eine Verbesserung der MMSE bei Alzheimer-PatientInnen spricht für positive Behandlungseffekte des Rivastigmin-Pflasters in der täglichen Routine. Unser Ergebnis muss allerdings unter Berücksichtigung der Limitierungen eines offenen Studiendesigns interpretiert werden. Jedenfalls ist aufgrund publizierter Daten über den natürlichen Verlauf kognitiver Funktionen bei Alzheimer-Fällen über einen 6-Monatigen Zeitraum nicht von einer Leistungsverbesserung auszugehen. Im Gegenteil beträgt die erwartete Verschlechterung der MMSE-Ergebnisse etwa 0.4 bis 2 Punkte (16). Unsere naturalistische Studie zur Anwendung des Rivastigmin-Pflasters unterstreicht die Übertragbarkeit der Ergebnisse der randomisierten, doppelblinden, kontrollierten IDEALStudie (8) auf die tägliche Praxis. Die Verträglichkeit des Rivastigmin-Pflasters ist in der ambulanten täglichen Routine sehr gut. Die vorliegende Studie unterstreicht aber die Notwendigkeit, PatientInnen und ihre Be­ treuungspersonen auf die Möglich­keit von meist leichten, lokalen Hautreaktionen ab dem dritten Monat der Pflasteranwendung hinzuweisen. Exakte Information über diese relativ häu- fige, reversible und gut behandelbare Nebenwirkung ist erforderlich, um ungerechtfertigte Therapieab­brüche zu vermeiden. 63 8. Literatur 9. 1. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Birks J Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jan 25;(1):CD005593. Farlow MR, Cummings JL. Effective pharmacologic management of Alzheimer's disease. Am J Med 2007;120:388-97. Alf C, Bancher C.), Benke T, Berek K.,Bodner, T, Croy, A, Dal-Bianco P. Fischer P,Fruhwuerth G.,Gatterer G, Grossmann, J Hinterhuber H, Imarhiagbe, D.), Jaksch A, Jellinger K, Kalousek M, Kapeller P, Krautgartner M, Ladurner G, Leblhuber F, Lechner A, Lingg A, Marksteiner J, Nakajima T, Psota G Rainer M, Ransmayr G, Reisecker F, Schmidt R, Spatt J, Walch T, Walter A, Wancata J, Winkler A. Consensus statements "Dementia" of the Austrian Alzheimer Society - Update 2006; Neuropsychiatrie 2006; 20: 221-231 Alf C, Bancher C, Benke T, Berek K, Dal-Bianco P, Fischer P, Fruhwürth G, Gatterer G, Hinterhuber H, Jellinger K, Kalousek M, Kapeller P, Leblhuber F, Marksteiner J, Psota G, Rainer M, Ransmayr G, Schmidt R, Walch T, Walter A, Wancata J. Recommendations of NICE for treatment of the Alzheimer´s disease: Comments of the Austrian Alzheimer Society. Neuropsychiatrie 2006; 20: 137-139 Schmidt R, Assem-Hilger E, Benke T, Dal-Bianco P, Delazer M, Ladurner G, Jellinger K, Marksteiner J, Ransmayr G, Schmidt H, Stögmann E, Wancata J, Wehringer C. Geschlechtsspezifische Unterschiede der Alzheimer Demenz. Neuropsychiatrie 2008; 22: 1-15 Ransmayr G, Katzenschlager R, Dal-Bianco P, Wenning G, Bancher C, Jellinger K, Schmidt R, Poewe W. Lewy-Körper Demenz und ihre differentialdiagnostische Abgrenzung von Alzheimer´scher Erkrankung. Neuropsychiatrie 2007; 21: 63-74 Mercier F, Lefevre G, Huang H-L A, Schidli H, Amzal B, Appel-Dingemanse S. Rivastigmine exposure provided by 11. 12. 13. 14. 15. 16. transdermal patch versus capsules. Curr Med Res Opin 2007; 23:3199-04. Winblad B, Grossberg G, Frölich L, Farlow M, Zechner S, Nagel J, Lane R. IDEAL. A 6-month. Double-blind, placebo-controlled study of the first skin patch for Alzheimer disease. Neurology 2007; 69 (suppl1): S14-S22. Conato J. Observational Versus Experimental Studies: What's the Evidence for a Hierarchy? NeuroRx 2004; 1: 341-47. McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM: Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of the Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer’s Disease. Neurology 1984; 34:939–49. Folstein M, S. Folstein S, et al. (1975). " Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician." J Psychiatr Res 12: 189-98. Schmidt R, Lechner A, Petrovic K. Rivastigmine in outpatient services: experience of 114 neurologists in Austria Int Clin Psychopharmacol 2002; 17: 81-5. Cummings J, Lefevre G, Small G, Appel-Dingemanse S. Pharmacokinetic rationale for the rivastigmine patch. Neurology 2007; 69 (suppl 1): S10-S13. Persönliche Kommunkation Exelon Patch Advisory Board Meeting, December 4th, 2008; Berlin, Germany. Winblad B, Cummings J, Andeasen N, Grossberg G, Onofrj M, Sadowsky C, Zechner S, Nagel J, Lane R. A six-month double-blind, randomized, placebo-controlled study of a transdermal patch in Alzheimer disease-rivastigmine patch versus capsule. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 456-67. Behl P, Stefurak TL, Black SE. Cognitive Markers of Progression in Alzheimer´s disease. Can J Neurol Sci 2005; 32:14051. Univ.Prof.Dr.Reinhold Schmidt Universitätsklinik für Neurologie Medizinische Universität Graz [email protected] Neuropsychiatrie, Band 23, Nr. 1/2009, S. 64–70 Kritisches Essay Critical Essay Psychose im Diskurs der zeitgenössischen Philosophie Thomas Stompe1,2 und Kristina Ritter3 Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Mediznische Universität Wien Justizanstalt Göllersdorf 3 Institut für Suchtdiagnostik, Wien 1 2 Schlüsselwörter: Poststrukturalismus – philosophische Phänomenologie – Philosophy of Mind – Schizophrenie – Psychose Keywords: Post-structuralism – philosophical phenomenology – philosophy of mind – schizophrenia – psychosis Kritisches Essay Psychose im Diskurs der zeitgenössischen Philosophie Die Beschäftigung der Philosophie mit dem Wahnsinn lässt sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen. Psychotische Phänomene waren für Denker wie Descartes ein Sinnbild der Fragilität der menschlichen Geisteskräfte, während andere Philosophen wie Platon oder Nietzsche darin einen Fluchtweg aus den Zwängen der Vernunft sahen. In der zeitgenössischen Philosophie nach 1960 setzten sich vor allem drei Strömungen mit dem Themenfeld Wahnsinn – Schizophrenie – Psychose auseinander: In Nachfolge von Nietzsche und Bataille beschrieben sowohl Foucault als auch Deleuze und Guattari Wahnsinn als gesellschaftlich unterdrückte Kehrseite der abendländischen Vernunft. Die Werke dieser Autoren © 2009 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle ISSN 0948-6259 hatten großen Einfluss auf die antipsychiatrische Bewegung und damit auch auf die Entwicklung der institutionellen Psychiatrie in den letzten 30 Jahren. Die philosophische Phänomenologie wiederum setzte sich vor allem mit den ontologischen Fragen des psychotischen In-der-Welt-seins und den Schwierigkeiten der interpersonellen Begegnung auseinander. Die neue angloamerikanische analytische Philosophie (Philosophy of Mind) untersucht die logische Kohärenz des psychotischen Denkens und Erlebens. Vor allem die Schule der Philosophy of Mind erwies sich als anschlussfähig sowohl mit der psychopathologischen Forschung als auch mit den neuen Erkenntnissen der Neuroscience. The discourse of psychosis in contemporary philosophy The preoccupation of philosophy with madness can be traced back till the Greek antiquity. For many philosophers like Descartes psychotic phenomena were symbols for the fragility of human mental powers, while others like Plato or Nietzsche saw madness as a way to escape the constraints of rationality. After 1960 three direction of contemporary philosophy dealt with the topics madness – schizophrenia – psychosis: Following Nietzsche and Bataille, Foucault as well as Deleuze and Guattari considered schizophrenia as the societal oppressed reverse of modern rationality, a notion which had a strong influence on the anti-psychiatric movement. Philosophical phenomenology primarily focussed on ontological problems of the psychotic existence. Finally Philosophy of Mind, the modern Anglo-American version of analytical philosophy, analyzed the logical coherence of psychotic inferences and experiences. Especially the insights of analytical philosophy may be important for a more sophisticated interpretation of psychopathological research as well as of the new findings of neuroscience. Einleitung Die Beschäftigung der Philosophen mit dem Wahnsinn ist fast so alt wie die Philosophie selbst. Bereits in Ion, einem Frühdialog Platons wird der Wahnsinn als Kontrastfolie zur Normalität gesetzt. Im Gegensatz zu späteren Epochen wird der Wahnsinn von Platon positiv bewertet: Der Wahnsinn ist als die mänadische Raserei die Voraussetzung aller Künste: „Denn ein Dichter ist ein luftiges, leichtbeschwingtes Wesen und nicht eher vermögend zu dichten, als bis er in Begeisterung gekommen und außer sich geraten ist und die klare Vernunft nicht mehr in ihm wohnt; solange er aber diese klare Besinnung noch besitzt, ist jeder Mensch unfähig zu dichten und zu weissagen [1]. Psychose im Diskurs der zeitgenössischen Philosophie In der Geschichte der Psychiatrie fanden sich immer wieder Nervenärzte, die einen philosophischen Zugang zu psychotischen Erkrankungen pflegten. Prominent hier seien vor allem Existenzanalytiker wie Binswanger, Strauss, Zutt, v.Bayer, Tellenbach oder Blankenburg und in letzter Zeit Psychiater, die sich an den neueren Strömungen der analytischen Philosophie orientierten, wie etwa Spitzer und Northoff in Deutschland oder Fulford in England genannt [2]. Seit 1993 existiert mit der Zeitschrift Philosophy, Psychiatry & Psychology eine wissenschaftliche Plattform, in der ein intensiver interdisziplinärer Dialog gepflegt wird. Unser Anliegen ist an dieser Stelle allerdings nicht, den Diskurs der psychiatrischen Fachleute mit philosophischem Hintergrund zu beschreiben. Es geht auch nicht um die Ausarbeitung und Kritik der positivistischen Wurzeln des traditionellen Schizophrenieverständnisses [3]. Ebenso verzichtet wurde auf die Darstellung der Positionen von Autoren wie Gregory Bateson, der seine wissenschaftliche Karriere als Ethnologe begann, später als Kommunikationstheoretiker mit der Double-bind Theorie bedeutende Beiträge zur Ätiologie der Schizophrenie verfasste [4] und in weiterer Folge eine Brücke zwischen Systemtheorie und Philosophie schlug [5]. Was an dieser Stelle beschrieben werden soll, ist der philosophische Blick von Außen auf Psychose. Der Ertrag wäre nicht nur ein Erkenntnisgewinn über Psychose als anthropologische oder gesellschaftliche Möglichkeit menschlichen Daseins, sondern ebenso über die logisch-phänomenologischen Rahmenbedingungen von psychischer „Normalität“ und „Abnormität“. Dass die Interaktion der Fächer nicht mehr unidirektional von der Philosophie als Grundlagenwissenschaft zur Psychiatrie verläuft, wird inzwischen auch von den Philosophen anerkannt: „From now on it is unthinkable that one should construct a philosophical anthropology without the imput of psychoanalysis, psycho- pathology, and psychiatry“ [6]. Es gilt daher darüber hinaus auch Überlegungen über das Erkenntnisinteresse der Philosophen, bzw. der zeitgenössischen philosophischen Schulen an psychopathologischen Phänomenen anzustellen. Damit stellt sich das Problem der provisorischen Festlegung von „Zeitgenossenschaft“. Was ist im Kontext dieses Themas als zeitgenössische Philosophie zu bezeichnen? Die Eingrenzung muss willkürlich sein, allerdings sind wir in der günstigen Position, dass es ein Werk gibt, das ein unüberhörbares Signal gesetzt hat und die psychiatrische Fachwelt nachhaltig beeinflusst hat. 1961 ist das Jahr, in dem Michel Foucaults epochales Werk Folie et Déraison (deutsch: Wahnsinn und Gesellschaft) erschienen ist [7]. Dieses Werk leitete das Interesse des Poststrukturalismus an dem Themenfeld Wahnsinn – Psychose – Schizophrenie ein. Poststrukturalismus Der Begriff Poststrukturalismus kennzeichnet unterschiedliche geisteswissenschaftliche und philosophische Ansätze und Methoden, die Ende der 1960er Jahre zuerst in Frankreich entstanden sind. Die Abgrenzung vom klassischen Strukturalismus etwa von Roman Jakobson, Ferdinand de Saussure oder Claude Lévi-Strauss wird von den einzelnen Denkern des Poststrukturalismus unterschiedlich vollzogen. Als Gemeinsamkeit wird betont, dass entgegen der Ansicht der Strukturalisten bestehende Strukturen und Diskurse keine statischen und stabilen Gebilde sind; ins Blickfeld rücken stärker historische Diskontinuitäten, Brüche und vor allem die Konstruktionsbedingungen von Strukturen. Wichtige Exponenten dieser Richtung, die zwar einige Gemeinsamkeiten zeigen, aber keine einheitliche Schule gebildet haben, sind Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Judith Butler und Julia Kristeva. 65 Michel Foucault (1926-1984) In seinen Werken analysierte Foucault die Entstehung und Entwicklung verschiedener Wissensdiskurse und Machtsysteme und untersuchte die Formen der Genese des neuzeitlichen Subjekts. Der Wahnsinn ist nach Foucault Gegenstand einer ständigen Bestimmung durch gesellschaftliche Formationen [7]. Die Geschichte des Wahnsinns ist eine Geschichte des Ausschlusses, die im Spätmittelalter anhebt und deren Vorbilder die gesellschaftlichen Bewältigungsstrategien von Epidemien wie Lepra und Pest waren. Die Haltung der Intellektuellen der frühen Neuzeit zum Wahnsinn war ambivalent. Die visionären Bildräume eines Bosch, Breughel oder Dürer vermittelten die tragische Botschaft, dass die umgebende Realität nur eine dünne Hülle ist, hinter der die ganze Tragik der Welt als Wahnsinn lauert. Bei Erasmus von Rotterdam und Sebastian Brant findet Foucault ein kritisches Element: Der Humanismus bringt den Wahnsinn zur Sprache, wodurch die Vernunft langfristig zur Integration des Wahnsinns gezwungen wäre. Die Klassik – Foucault versteht darunter das Zeitalter des französischen Barock und Rokoko - dagegen reagierte auf die schmale Grenze zwischen Vernunft und Unvernunft mit einer konsequenten Ausschließung des Wahnsinns. Vom 17. Jahrhundert bis Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Irren in unterschiedlichste Einrichtungen gemeinsam mit Verbrechern, Arbeitslosen und Bettlern interniert. Dem Wahnsinn wurde damit ebenfalls der Status einer Ordnungswidrigkeit gegen die Arbeitspflicht der bürgerlichen Gesellschaft verliehen. Als diskursiver Seitenarm existierte allerdings daneben immer die Vorstellung von Wahnsinn als Krankheit, was zunächst zur Hospitalisierung führen konnte. Wenn sich allerdings das Krankheitsbild durch Aderlässe, Purganz oder Bäder nicht innerhalb einiger Wochen besserte, erfolgte die Internierung. Die Kontu- Stompe, Ritter ren dieser Krankheit zeichneten sich aber nur schwach vor dem Horizont einer insgesamt als undifferenziert wahrgenommenen Unvernunft ohne Inhalt ab. Die Vernunft konnte also nur sagen, dass der Wahnsinn die eigene Negation wäre, denn in der Klassik bestand die Manifestation des Wahnsinns vorwiegend in einem Benehmen oder einer Ausdrucksweise, die sich beim vernünftigen Menschen nicht fand. Das Maß des Wahnsinns lag daher im vernünftigen Menschen selbst. Vom Beginn des 16. und Ende des 18. Jahrhunderts blieb der Wahnsinn also eine semantische Leerstelle im Niemandsland der negativen Vernunftsdefinitionen und erhielt folgerichtig seinen angemessenen Status durch die Internierung. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts setzten nach Foucault verstärkt Bemühungen ein, mit den Gestalten der Demenz, der Manie, der Hysterie und der Melancholie die Negativität des Wahnsinns positiv als Ordnung der Geisteskrankheiten zu fassen. Eine Fortsetzung findet Foucaults Geschichte des Wahnsinns in der Vorlesung über die Macht der Psychiatrie [8], in der Foucault noch stärker als in Wahnsinn und Gesellschaft das Dispositiv der Macht mit dem Thema des Wahnsinns verknüpft in der Absicht, die Geschichte der Psychiatrie seit Pinel bis in die Gegenwart als eine Geschichte einer zunehmend an Subtilität gewinnenden Unterdrückung des Widerständigen des Wahnsinns zu beschreiben. Der Wahnsinn ist nach Foucault die unumgängliche Kehrseite der Entwicklung der neuzeitlichen Vernunft und der Selbstvergewisserung des autonomen Subjekts. Alle Versuche den Wahnsinn zu Sprache zu bringen, dienen auch gleichzeitig zu seiner Disziplinierung. Jacques Derrida (1930-2004) Derrida gilt als Begründer und Hauptvertreter des französischen De­kon­struk­tivismus. Sein Werk be­ein­flusste maßgeblich die fran- 66 zösische Gegenwartsphilosophie und Literaturwissenschaft. Zu seinen Hauptwerken zählen „Gram­ matologie“ [9], „Die Schrift und die Differenz“ [10] und „Randgänge der Philosophie“ [11]. Das Interesse Derridas an der Thematik der Psychose entzündete sich an Foucaults Interpretation der Gestalt des Wahnsinns in den "Meditationes" (4. Abschnitt) von Descartes. Sie wurde für Derrida Anlass, das Verhältnis von Wahnsinn und Vernunft zu bestimmen, das Cogito einer Neuinterpretation zu unterwerfen und das Verhältnis des Cogito zur Geschichtlichkeit zu bestimmen [10]. Derridas Kritik an Foucault ope­riert mit zwei verschiedenen Wahnsinnsbegriffen. Einer­ seits verwendet er denselben Wahnsinnsbegriff wie Foucault, um Foucaults Unternehmen "Wahnsinn und Gesellschaft" selbst zu kritisieren, andererseits verwendet er einen gemäßigten Wahnsinnsbegriff, um Descartes zu rechtfertigen. Derrida wirft Foucault vor, in "Wahnsinn und Gesellschaft" den Ausdruck "Wahnsinn" metaphorisch zu verwenden, weil die Sprache selbst den logos, d. h. Vernunft, voraussetzt. Sprache aber impliziert bereits eine Ordnung, eine Logik, eine Syntax, einen Plan. Weil Foucault den Wahnsinn als "Schweigen" bestimmt, in dem es keine Sprache und kein "Werk" gibt, ist es mit einem derart radikalen Wahnsinnsbegriff unmöglich, über den Wahnsinn adäquat zu sprechen. Im Gegensatz zu Foucault verlangt Derrida, dass der Ursprung der Entzweiung von Vernunft und Unvernunft reflektiert werden müsste, bevor der Wahnsinn als solcher thematisiert werden kann. Wäre Foucault in seiner Behandlung des Wahnsinns konsequent, dann bliebe ihm, so Derrida, nur die Alternative, über den Wahnsinn zu schweigen oder mit dem Wahnsinnigen selbst als Wahnsinniger ins Exil zu gehen. Gilles Deleuze (1925-1995) und Pierre-Félix Guattari (1930-1992) Zwei Schlüsselwerke der poststrukturalistischen Thematisierung der Psychose sind die beiden Bände von Kapitalismus und Schizophrenie (Anti-Ödipus und Tausend Plateaus) von Deleuze und Guattari [12,13]. Anti-Ödipus versteht sich als Kritik der Psychoanalyse von Jacques Lacan und Sigmund Freud. Im Anschluss an Lacan begreifen Deleuze und Guattari Sprache als Medium der Herrschaft über Bedürfnisse, Ansprüche und Wünsche. Anders als Lacan aber begreifen sie Sprache nicht zugleich auch als das Medium der Befreiung von sprachlichen Unterwerfungen. Die Psychoanalyse erscheint ihnen als Instrument der Aufrechterhaltung von (u.a. kapitalistischer) Dominanz und Repression, vor allem durch die Unterwerfung des Subjekts unter die phallische Struktur der Kultur. Dagegen entwerfen Deleuze und Guattari das Konzept der Wunschmaschine, eines maschinell gedachten Unbewussten, das, anders als in der Psychoanalyse, nicht sprachlich strukturiert ist. Trotz der Aufgabe des Freudschen Denkrahmens, die der Anti-Ödipus offen zum Ausdruck bringt, bewegen sich auch Deleuze und Guattari innerhalb des von Freud in der Schrift Das Unbehagen der Kultur [14] umrissenen problematischen Feldes: Das Begehren ist die treibende Kraft der Bewegung, die die Gesellschaft genauso durchzieht und bestimmt, wie die Entwicklung der Singularität des Wahnsinns. Im Anti-Ödipus wird das Konzept des Begehrens dem des Mangels gegenübergestellt. Der Mangel ist ein durch das Regime der Ökonomie, der Religion, der psychiatrischen Herrschaft determiniertes Produkt. Die Prozesse der Subjektivierung können sich allerdings nicht auf dem Mangel gründen, sondern benötigen das Begehren als Basis. Das Begehren ist nicht Ausdruck einer Struktur, sondern es kann tausend Strukturen schaffen. Die Beziehung zwischen Struktur und Be- Psychose im Diskurs der zeitgenössischen Philosophie gehren ist der Wendepunkt, der das schizo-analytische Denken, vor allem des Psychoanalytikers Guattari, außerhalb des Bereichs des Freudschen Denkens von Lacan ansiedelt. Der Schizophrene ist im Anti-Ödipus eine Variante des Nietzscheschen Übermenschen, wie Zarathustra ein Mensch des Wunsches: „Ungeahnte Leiden, Schwindel und Krankheiten kennen sie. Sie haben ihre Gespenster. Sie müssen jede Geste neu erfinden. Aber ein solcher Mensch erschafft sich als freier, unverantwortlicher, als einsamer und fröhlicher Mensch, der endlich fähig ist, ohne Erlaubnis in seinem Namen etwas Einfaches zu sagen und zu tun, Wunsch, dem nichts fehlt… Er hat aufgehört, Angst vor dem Verrücktwerden zu haben“ [12]. Kurz darauf betonen die beiden Autoren allerdings, dass dieses Bild des Schizophrenen wenig mit realen Patienten gemeinsam habe. Die Verrücktheit der realen Patienten sei eine schlechte, keinesfalls „die wahre Verrücktheit“ (ebd., S. 170). Die wahren Verrückten sind immer anderswo, utopische Menschen. Dass die Schizophrenie nun doch wirklich nicht das Wahre sein könne, gehört denn auch zur Standardkritik am AntiÖdipus. Sie verkennt allerdings die differential-diagnostischen Kriterien, die Deleuze und Guattari den „fröhlichen Schizo“ vom depressiv seine Schuld erfindenden Paranoiker zu unterscheiden erlauben. Wo jener das aristotelische Grunddenken preisgibt und als Grund die Freiheit erfährt, meint dieser, „Schulden gegen seinen Anfang“ und seinen Grund haben zu müssen. Wo jener zahllose „mikrophysikalische“ Wege und Umwege geht, treibt dieser eine „Makrophysik“, die überall auf die Geltung nur eines Gesetzes beharrt. Wo der Paranoiker nur den Repräsentanzen seine Aufmerksamkeit widmet, gilt das schizophrene Interesse einzig den „Wunschmaschinen“, die nicht repräsentieren, sondern das sind, was man mit ihnen macht [15]. Während im Anti-Ödipus, aber auch in den Tausend Plateaus Schizophrenie häufig auf Spaltungsprozesse und Selbstentfremdung des modernen Subjekts reduziert wird, andererseits auf das nomadische Widerstandspotential des Schizophrenen verwiesen wird, nähert sich Deleuze in Schizophrenie und Gesellschaft deutlich stärker der phänomenologischen Realität an. In seiner Theorie der Organmaschine und des organlosen Körpers gelingt es ihm, schwer verständliche Äußerungen vor allem von katatonen Patienten fassbarer und damit auch nachvollziehbarer zu machen [16]. Bei allen Unterschieden der theoretischen Konzeption von Geisteskrankheit im Poststrukturalismus lassen sich doch gemeinsame Erkenntnisinteressen ausmachen, die in der einen oder anderen Form bei den besprochenen Autoren auftauchen: 1. Der Wahnsinn, oder bei Deleuze, die Schizophrenie ist die Kehrseite der Herausbildung der spezifischen Form der abendländischen Vernunft. 2. Die Geschichte des Wahnsinns ist eine Geschichte der Verleugnung, Verdrängung und Unterdrückung. 3. Der Wahnsinn besitzt ein kreatives Potential, das der Vernunft verschlossen bleibt. Hier treffen sich die Poststrukturalisten mit Platon, aber auch mit Autoren der Avantgarde wie Bataille und Artaud. Entsprechend bestärkte der französische Poststrukturalismus die antipsychiatrische Bewegung um Laing [17], Sasz [18], Cooper [19] und Basaglia [20], die vor allem Wahnsinn und Gesellschaft, aber auch Anti-Ödipus als theoretische Rechtfertigung eigener Forderungen für die Liberalisierung bzw. Abschaffung psychiatrischer Institutionen betrachteten. Der Poststrukturalismus war die erste philosophische Richtung der Nachkriegszeit, die sich intensiver mit dem Phänomen des Wahnsinns auseinandergesetzt hat. Fasziniert waren diese Autoren von der Randständigkeit und dem Widerstand sich der abendländischen Rationalität unterzuordnen. 67 Verloren ging dabei allerdings einerseits die Wahrnehmung konkreter psychopathologischer Symptome aber vor allem auch der Blick auf die Leiden der Kranken, da die Neigung ganz offensichtlich war, die biologisch und biographische Fundierung psychotischen Krankseins in Gesellschafts- und Wissenschaftskritik aufzulösen. Philosophische Phänomenologie Die Phänomenologie (griechisch phainomenon „Sichtbares, Erscheinung“; logos „Rede, Lehre“) entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und geht auf Edmund Husserl zurück. Die phänomenologische Philosophie sieht den Ursprung jeder Erkenntnis in den unmittelbar umgebenden Erscheinungen, deren Zusammenhänge sie untersucht. Die wichtigsten Exponenten dieser philosophischen Denkrichtung waren neben Edmund Husserl in der deutschsprachigen Philosophie Martin Heidegger, Max Scheler, Eugen Fink und in den letzten 20 Jahren vor allem Hermann Schmitz und Bernhard Waldenfels, in Holland Dan Zahavi und in Frankreich JeanPaul Sartre, Emanuel Lévinas, Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, und Marc Richir. Die Aufgabe, in der phänomenologischen Tradition eine eigenständige, rein philosophische Betrachtungsweise der Psychose herauszuarbeiten, ist deutlich schwieriger als beim Poststrukturalismus. Die existentialanalytische Schule der Psychiatrie, die so wichtige Exponenten wie Ludwig Binswanger, Jürg Zutt und Wolfgang Blankenburg und in neuerer Zeit Harald Feldmann, Meinhard Schmidt-Degenhard oder Thomas Fuchs hervorgebracht hat, beruft sich ebenso wie die zeitgenössische phänomenologische Philosophie auf die Gründerväter der Phänomenologie Husserl, Heidegger und Scheler. Exemplarisch seien daher an dieser Stelle lediglich die Überlegun- Stompe, Ritter gen von Marc Richir und Bernhard Waldenfels zum Phänomen Psychose beschieben. Beiden Autoren gemeinsam ist, dass sie sich in ihren Argumentationslinien nicht nur auf Husserl und Heidegger, sondern vor allem auch auf französische Phänomenologen wie Sartre, Ricoeur und vor allem Merleau-Ponty beziehen. Bernhard Waldenfels (*1934) In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich Waldenfels vor allem mit Grenzfragen der Phänomenologie und besonders mit dem Phänomen der Leiblichkeit. Die Thematik der Psychose behandelt er vor allem in seinem vierbändigen Werk über die Phänomenologie des Fremden [2124]. Eine neuere Arbeit beschäftigt sich ganz konkret mit dem Problem der doppelten Fremdheit des psychotischen Menschen im transkulturellen Kontext [25]. Schizophrene und Wahnkranke verkörpern für Waldenfels eine von mehreren Dimensionen des Fremden. Am Rande unserer Kultur tauchen das Kind, der Wilde und der Irre oder Narr als historisch variable Figuren auf. Gleichwohl gäbe es, und hier nähert sich Waldenfels Freuds Theorien über das Unheimliche an, keine totale Fremdheit, da Fremdes nur als bestimmtes Fremdes in Abhebung von Eigenem entsteht. Nach Waldenfels wären verbale Halluzinationen, in denen der Patient sich selbst mit fremden Stimmen reden hört, undenkbar, wenn der eigenen Spracherfahrung nicht auch im Normalfall ein Moment der Selbstentfremdung, des Unpersönlichen innewohnte. Halluzinationen entziehen sich somit der Alternative von es-haftem Prozess und ich-haftem Akt. Beeinträchtigt ist zum einen die Fähigkeit, zwischen eigenen und fremden Äußerungen zu unterscheiden, zum anderen die Fähigkeit, auf Fremdes zu antworten. Waldenfels sieht in der Psychose eine Selbstentfremdung des Individuums, das uns als ein uns radikal Fremdes 68 begegnet. Das therapeutische Gelingen dieser Begegnung hängt davon ab, ob wir das Eigene im Fremden und das Fremde in uns akzeptieren können. Marc Richir (*1943) Ausgehend von Husserls Phänomenologie und deren Weiterentwicklung durch Marleau-Ponty, gilt Marc Richir als Begründer der Sprachphänomenologie. Seine Überlegungen zur Psychose sind eingebettet in eine Reihe von phänomenologischen Arbeiten zur Sinnstiftung in Träumen, Phantasien und mythischen Erzählungen [26,27]. Richir bezieht sich auf Grundannahmen der Heideggerschen Daseinsanalytik, die er einerseits weiterentwickelt aber andererseits auch, zumindest partiell, verwirft. Ausgehend von den Heideggerschen Ausführungen über Stimmung und Befindlichkeiten nimmt Richir an, dass die Stimmung offensichtlich ein besonders auffälliges Zeichen der Faktizität ist, insofern sie sich immer schon von der Vergangenheit her gezeitigt hat und damit das Dasein die Stimmung immer nur „vorfindet“ [28]. Auch in der die Jemeinigkeit der Welt und die Stimmung schließenden Faktizität der Psychose gäbe es noch etwas an „Subjektivität“. Wie an der Psychose zu erfahren ist, verliert die Faktizität allerdings gerade dann einen Teil ihres Sinns, wenn sie sich als solche entdeckt. Sie wandelt sich nach Richir in der Psychose in die anonyme Faktizität einer Erfahrung, die nicht mehr als meine eigene erlebt wird – oder nicht als eigene erlebt werden kann – weil sie gespalten ist und das Subjekt neben seiner Faktizität leben lässt. Über das NichtSelbstverständliche der Faktizität der Psychose schlägt Richir, wie Derrida, einen Bogen von Heidegger zurück in das 17. Jahrhundert zum „böswilligen Geist“ der Meditationen Descartes. Während die poststrukturalistischen Autoren eine Geschichte der Entwicklung des abendländischen Subjekts (dabei allerdings den Subjektbegriff immer wieder verwerfend) vor dem Hintergrund der Unterdrückung des Anderen, Abseitigen, Widerständigen und Verrückten entwickeln, ist die Intention der phänomenologischen Philosophen eine gänzlich andere. Hier geht es um das Fremdwerden der Innenwelt und der Dialektik des Vertrauten und des Unvertrauten. Über diese Dialektik versuchen die Autoren einen vertieften phänomenologischen Zugang zum personalen Erleben des Individuums zu erlangen. Philosophie des Geistes Die wohl intensivste und vielfältigste Auseinandersetzung der Gegenwartsphilosophie mit der Psychose findet heute durch die vorwiegend angelsächsische Richtung der analytischen Philosophie statt. Die Philosophie des Geistes (engl.: Philosophy of mind) ist eine angloamerikanische Weiterentwicklung der Ideen von Denkern der analytischen Philosophie (Rudolf Carnap, Bertrand Russel) und von Ludwig Wittgenstein und setzt sich mit der Natur geistiger oder mentaler Zustände, ihren Wirkungen und Ursachen auseinander. Neben diesen ontologischen Problemen beschäftigt sich die Philosophie des Geistes auch mit den erkenntnistheoretischen und epistemiologischen Fragestellungen. Wichtige angloamerikanische Vertreter dieser Denkschule sind Sprachphilosophen wie John Searles, Saul Kripke, Hillary Putnam, Donald Davidson, Peter Sellars, Richard Rorty oder Robert Brandom, und Bewusstseinsphilosophen wie Paul und Patricia Churchland, Richard Dennett, Paul Carruthers und David Chalmers. Aus dem deutschsprachigen Raum sind vor allem Thomas Metzinger und Peter Bieri zu erwähnen. Analytische Philosophen, die sich mit psychotischen Phänomenen auseinandergesetzt haben, sind Tim Bayne, Lisa Bortolotti, Christoph Hoerl, Jakob Howry oder Thomas Metzinger. Psychose im Diskurs der zeitgenössischen Philosophie Wie die Kognitionswissenschaften unterzieht auch die analytische Philosophie mentale Zustände einer funktionalen Analyse. Psychiatrische Störungsbilder werden als Störungen der Art und Weise, in der das Individuum die Welt und sich selbst für sich selbst repräsentiert gesehen [29]. Besondere Beachtung finden psychotische Phänomene wie Wahn [30-34] oder Schneidersche Erstrangsymptome wie die Gedankeneingebung [35]. Die analytisch-philosophische Literatur zur Psychose ist inzwischen so angewachsen, dass aus Platzgründen nur summarisch anhand ausgewählter Beispiele Einblick in die Themenstellungen dieser Denkrichtung gegeben werden kann. In der kritischen Auseinandersetzung mit der rationalistischen Sichtweise Campbells auf monothematische Wahnbildungen [36] weisen Bayne und Pacherie logisch nach [30], dass auch bei einem „eingekapselten“ Wahn die Verbindung zwischen Rationalität und Empirie nicht völlig verloren gegangen seien kann, da ansonsten keine Kommunikation mit diesen Patienten möglich wäre. Hoerl wiederum analysiert die logischen Konsequenzen der Durchlässigkeit der Ich-Grenzen anhand der Gedankeneingebung [35]. Ausgehend von dem Konzept der Rationalität von Davidson geht Bortolotti den Zusammenhängen von Rationalität und Intentionalität im Wahn akribisch nach [37,38]. Seit den 1980er Jahren entwickelte sich also eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die die Psychiatrie mit den besten philosophischen Theorien über das Entstehen mentaler Zustände in Kontakt brachte und die auf der anderen Seite verhinderte, dass die Philosophie des Geistes durch die rein logische Analyse psychologischer Konzepte zu einer blutleeren analytischen Scholastik wurde. Im angelsächsischen Bereich entwickelte sich eine „Angewandte Philosophie des Geistes“. Diese verhält sich in vieler Hinsicht zur reinen Philosophie des Geistes wie die „angewandte Ethik“ zur „Metaethik“. Die Untersu- chung veränderter Bewusstseinszustände oder psychotischer Phänomene soll zu Einsichten darüber führen, was mentale Zustände überhaupt sind, was es etwa bedeutet, dass man eine „subjektive Innenperspektive“ besitzt. Die Analyse von Grenzfällen wie eben Psychosen führt damit wieder zu Fortschritten auf der Ebene der Metatheorie, da sie eine feinkörnigere Auflösung des empirischen Materials erfordert. Darüber hinaus macht die Betrachtung psychopathologischer Phänomene unbewusste Vorannahmen deutlich, klärt intuitive Fehlschlüsse auf und macht Defizite bestehender Theorien sichtbar. Die Philosophy of Mind dürfte damit von den hier beschriebenen Richtungen gegenwärtig den höchsten Erklärungswert für die Gegenwartspsychiatrie haben, da sie einerseits die logischen Implikationen des psychotischen Erlebniswandels am besten darstellen kann, zum Anderen sich mit der modernen Neuroscience als hochgradig anschlussfähig erwiesen hat [39]. Das Studium der Psychopathologie der Psychosen dient nicht nur als Korrektiv für die Gegenwartsphilosophie. Auf der anderen Seite sollte auch die Psychiatrie die Vorläufigkeit und Wertgebundenheit ihrer Konzepte stärker philosophisch reflektieren [40]. Die alle Jahre stattfindende Modifikation unserer Klassifikationssysteme etwa zeigt deutlich, dass die psychiatrische Wissenschaft und damit auch das praktische Handeln auf sehr unsicheren Fundamenten basiert, das Linnésche Stadium des Faches noch gar nicht erreicht ist. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder auf die philosophischen Grundlagen des psychiatrischen Denkens und Tuns zu besinnen und einen für beide Seiten fruchtbaren Dialog von Philosophie und Psychiatrie zuzulassen und zu fördern. 69 Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Platon.: Ion. Sämtliche Werke Bd. 1. Rowohlt, Reinbeck 2004. Chung M.C., Fulford K.W.M., Graham G.: Reconceiving schizophrenia. Oxford University Press, Oxford, New York 2007. Musalek M.: Die unterschiedliche Herkunft von Schizophrenien und ihre philosophischen Grundlagen. Fortschr Neurol Psychiatr 73: 16-24 (2005). Bateson G. et al.: Schizophrenie und Familie. Beiträge zu einer neuen Theorie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002. Bateson G.: Ökologie des Geistes. Anthropologische, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981. De Waelhens A., ver Eecke W.: Phenomenology and Lacan on Schizophrenia, after the Decade of Brain. Leuven, University Press Leuven 2001. Foucault M.: Wahnsinn und Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1969. Foucault M.: Die Macht der Psychiatrie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005. Derrida J.: Grammatologie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983. Derrida J.: Cogito und Geschichte des Wahnsinns. In: ders. Die Schrift und die Differenz. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1976. Derrida J.: Randgänge der Philosophie. Passagen Verlag, Wien 1988. Deleuze G., Guattari P.-F.: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974. Deleuze G., Guattari P.-F.: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II. Merve, Berlin 1992. Freud S.: Das Unbehagen in der Kultur. 10. Aufl. Fischer, Frankfurt am Main 1994. Heinz H.: Drogierungen. Eine Fußnote zu Kapitalismus und Schizophrenie. In: Heinz R, Tholem G.C.: SchizoSchleichwege. Beiträge zum Anti-Ödipus. Bremen, Verlag Impuls 1981. Deleuze G.: Schizophrenie und Gesellschaft. Texte und Gespräche von 1975 bis 1995. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005. Laing R.D.: The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness. Penguin, Harmondsworth 1960. Sasz T.: The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct. Harper & Row, New York 1961. Cooper D.: Psychiatry and Anti-Psychiatry. Tavistock/Paladin, London 1967. Basaglia F.: Che cos'è la psychiatria? Amministrazione provinciale di Parma, Parma 1967. Stompe, Ritter [21] Waldenfels B.: Topographie des Fremden - Studien zur Phänomenologie des Fremden 1. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997. [22] Waldenfels B.: Grenzen der Normalisierung - Studien zur Phänomenologie des Fremden 2. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998. [23] Waldenfels B.: Sinnesschwellen - Studien zur Phänomenologie des Fremden 3. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999a. [24] Waldenfels B.: Vielstimmigkeit der Rede - Studien zur Phänomenologie des Fremden 4. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999b. [25] Waldenfels B. Doubled Otherness in Ethnopsychiatry. WCPRR 2, 69-79 (2007). [26] Richir M.: Das Abenteuer der Sinnbildung. Aufsätze zur Phänomenologie der Sprache. Turia & Kant, Wien 2000a. [27] Richir M.: Narrativität, Zeitlichkeit und Ereignis im mythischen Denken. In: Trinks J.: Möglichkeiten und Grenzen der Narration. Turia & Kant, Wien 2000. [28] Richir M.: Phänomenologische Meditationen. Zur Phänomenologie des Sprachlichen. Turia & Kant, Wien 2000b. 70 [29] Metzinger T.: Ich-Störungen als pathologische Formen mentaler Selbstmodellierung. In: Northoff G.: Neuropsychiatrie und Neurophilosophie. Schöningh, Paderborn 1997. [30] Bayne T., Pacherie E.: Bottom-up or top-down? Campbell's Rationalist Account of Monothematic Delusions. Philosophy, Psychiatry & Psychology 11/1, 1-11 (2004a). [31] Bayne T., Pacherie E.: Experience, belief, and the interpretive fold Philosophy, Psychiatry & Psychology 11, 81-86 (2004b). [32] Bayne T., Pacherie E.: In defence of the doxastic account of delusions. Mind & Language 20/2, 163-188 (2005). [33] Hoerl C.: Understanding, explaining and intersubjectivity in schizophrenia. Philosophy, Psychiatry & Psychology 8, 83-88 (2001a). [34] Pacherie E., Green M., Bayne T.: Phenomenology and delusions: Who put the ‘alien’ in alien control? Consciousness and Cognition 15, 566-577 (2006). [35] Hoerl C.: On Thought Insertion. Philosophy, Psychiatry & Psychology 8, 189200 (2001b). [36] Campbell J.: Rationality, meaning and the analysis of delusions. Philosophy, Psychiatry, & Psychology 8, 89-100 (2001). [37] Bortolotti L.: Can we interpret irrational behaviour? Behavior and Philosophy 32, 359-375 (2004). [38] Bortolotti L. Intentionality without rationality. Proceedings of the Aristotelian Society 105, 385-392 (2005). [39] Northoff G.: Das Gehirn. Eine neurophilosophische Bestandaufnahme. Mentis. Paderborn 2000. [40] Thornton T.: Reliablity and validity in psychiatric classification: values and Neo-Humeanism. Philosophy, Psychiatry and Psychology 3: 229-235 (2002). Univ.-Prof. Dr. Thomas Stompe Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien [email protected]