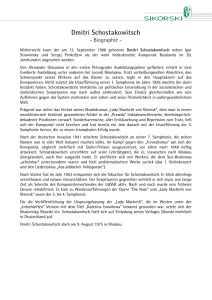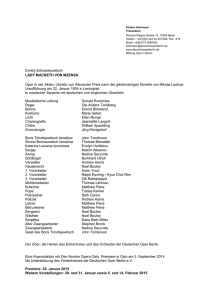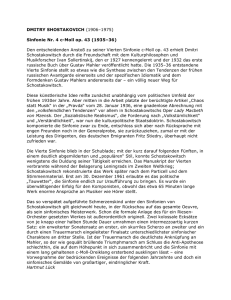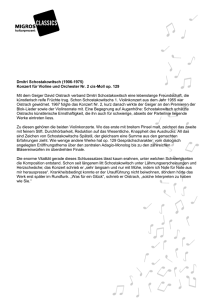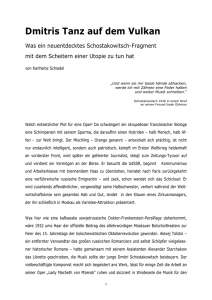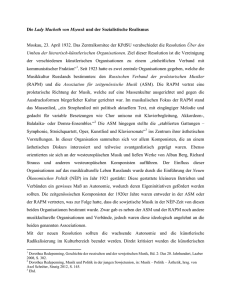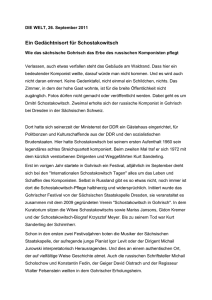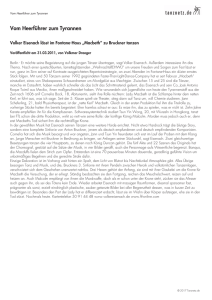GELSENKIRCHEN: LADY MACBETH VON MZENSK. Premiere
Werbung

09.02.2013, Der neue Merker GELSENKIRCHEN: LADY MACBETH VON MZENSK. Premiere GELSENKIRCHEN: LADY MACBETH VON MZENSK - Premiere am 9. Februar 2013 Foto: Musiktheater im Revier/Forster Die ironisch zeremoniell herum getragene Stalin-Büste erinnert an den Urheber eines der spektakulärsten Opernschicksale. „Lady Macbeth von Mzensk“, geschrieben von dem noch nicht 30jährigen Dmitri Schostakowitsch, streichelt (wie zuvor schon seine „Nase“) Mütterchen Russland nicht über die Wangen, sondern legt albtraumhafte Verhältnisse bloß und spart dabei nicht mit bruitistisch aufschreiender, ätzender Musik. Trotzdem – oder gerade deswegen – machte das Werk rasch Furore (auch im Ausland). Der Leningrader Uraufführung 1935 folgte bereits 2 Tage später die Moskauer Premiere. Stalin ließ sie Produktion des Nemirowitsch-Dantschenko-Theaters für eine einzige Vorstellung ins Bolschoi transferieren, weil es dort für ihn eine Sicherheitsloge gab. Bald danach war in der Prawda von „Chaos statt Musik“ zu lesen. Weitere Aufführungen wurden verboten. Nach Stalins Tod machte sich Schostakowitsch an eine Umarbeitung. Diese „Katerina Ismailowa“ wurde 1963 wiederum bei Nemirowitsch-Dantschenko herausgebracht, anschließend erfolgte eine Plattenaufnahme. Die Düsseldorfer Rheinoper spielte 1959 nochmals die Erstfassung (mit abenteuerlich erworbenem Notenmaterial – „Spiegel“-Bericht“ im Internet nachlesbar). Doch erst nach dem Tode des Komponisten verbreitete sich (unter Mithilfe von Mstistaw Rostropowitsch, der dann auch eine Aufnahme mit seiner Frau, der kürzlich verstorbenen Galina Wischnewskaja, vorlegte) das authentische Notenmaterial. Wuppertal präsentierte 1980 eine erste deutsche Aufführung, die damals entstandene Übersetzung von Jörg Morgener und Regisseur Siegfried Schoenbohm nutzt jetzt auch das Musiktheater im Revier, in Übernahme einer von Intendant MICHAEL SCHULZ im November 2011 für das Staatstheater Kassel erarbeiteten Inszenierung. Das letzte Bild der Oper ist tragisch umflort, auch hat Schostakowitsch einige Krassheiten der Erzählung von Nikolai Leskow (etwa Katerinas Tötung ihres minderjährigen Neffen) gestrichen, um seine Titelheldin moralisch verständlich bleiben zu lassen. Die Morde am verhassten, despotischen Schwiegervater Boris und an dem ungeliebten Gatten Sinowi waren ihm wohl genug. An der sexuellen Färbung des Sujets nahm Schostakowitsch allerdings keine Abstriche vor, scheute sich auch nicht vor musikalischen Vulgarisierungen (Beischlaf-Szene). Die Triebhaftigkeit von Katerina wird durchaus nicht bemäntelt, und der Regisseur zeigt vor Beginn der Aufführung eine stumme Sequenz mit der wollüstig um Schlaf ringenden Katerina. Später hört man während einer Szene mit ihr und dem neuen Lover Sergej aber auch eine lyrisch, fast tristanesk aufblühende Musik: Sex zwar sehr irdisch, aber doch auch von sublimen Gefühlsregungen durchzogen. Und hier ist Katerina dem Hallodri Sergej emotional fraglos voraus. Überhaupt wird die Männerwelt vor allem als rohes Kollektiv gezeichnet (Vergewaltigungsszene 1. Akt). Schostakowitsch wollte Abgründiges der Frauenseele durchaus nicht beschönigen, setzte sie jedoch mit emanzipatorischer Energie in Rechte ein, die ihr bislang verwehrt waren. All diese Facetten sind in der Darstellung YAMINA MAAMAR vereinigt. Die deutsche Sängerin mit tunesischen Wurzeln begann als Mezzo, wechselte 2006 ins jugendlich dramatische Fach (hierzu u.a. Auskünfte in einem „Merker“-Interview 6/2008). Einen eindrucksvollen Querschnitt ihres Repertoires kann man sich bei Youtube vergegenwärtigen (Fidelio, Salome, Ödipus der Tyrann, Kundry, Manon Lescaut). Yamina Maamar agiert mit großer Emphase, singt ausdrucksvoll und mit vehementer Leuchtkraft. Dieser wunderbaren Leistung möchte man eigentlich nicht entgegenhalten, dass für ein ideales Katerina-Porträt ein herbes Timbre von Vorteil wäre. TOMAS MÖWES wiederum dürfte als Boris von Renatus Mészár (als Boris bereits in Kassel zu erleben) überflügelt werden. Bei aller Persönlichkeitsstrahlung fehlt ihm ein wenig das Urige, er wirkt zu „domestiziert“. LARSOLIVER RÜHL ist ein vollpotenter Sergej, der tenoral vielversprechende HONGJAE LIM gibt den Sinowi mit primär heller, gleichwohl reicher Ausdruckspalette. Aus dem Ensemble überzeugender Comprimario-Sänger schälen sich noch PIOTR PROCHERA (virtuose Zeichnung des eitlen Polizeichefs) und JOACHIM GABRIEL MAASS (Pope) heraus. WILLIAM SAERTRE muss schon eine spezielle Partie wie den Schäbigen finden, um auch vokal akzeptiert werden zu können. RASMUS BAUMANN bringt mit der exzellentem NEUEN PHILHARMONIE WESTFALEN das musikalisch reiche Spektrum von Schostakowitschs kompromisslos zuspitzender Musik mit dramatischer Energie zum Klingen. „Lady Macbeth von Mzensk“ ließe sich fraglos realistischer inszenieren, als wie es Schulz tut. Doch für seine Entscheidung zur Stilisierung hat er den Komponisten auf seiner Seite, welcher beispielsweise mehrere anti-illusionistischer Banda-Auftritte vorsieht. Mit den stärksten Eindruck hinterlässt die Arbeit von Schulz im Finalbild. Die Decke von DIRK BECKERs klinisch weißer Raumeinkleidung (passende Kostüme: RENÉE LISTERDAL) senkt sich herab, ihr Rundausschnitt umfasst den Chor (superb im Einsatz) wie mit Gefängnismauern. Möglichkeiten zur Bewegung bleiben da kaum. Das ist besser als jeder Versuch, Lager-Tristesse mit realistischen Verzweiflungsgesten einzufangen (ein Problem immer wieder auch bei Janaceks „Totenhaus“). Über die etwas steife Chorführung ließe sich rechten, auch über bildnerische Entscheidungen wie die Tür als transportables Requisit im 2. Akt. Zwingend hingegen wirken bestimmte optische Akzentuierungen (Sergejs Flirten bereits während der Hochzeit) wie überhaupt dieses Bild gleich zu Beginn das Unglückhafte kommender Ereignisse unzweideutig einfängt. Dass Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ für Opernerbauung wenig taugt, zeigten die nach der Premierenpause gelichteten Zuschauerreihen. Insgesamt war die Zustimmung jedoch nachhaltig und eindeutig positiv. Christoph Zimmermann