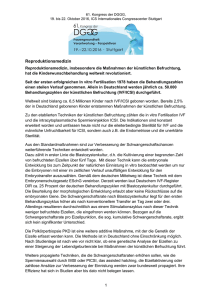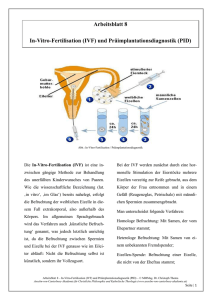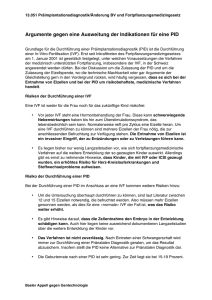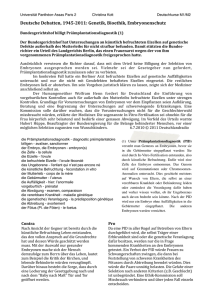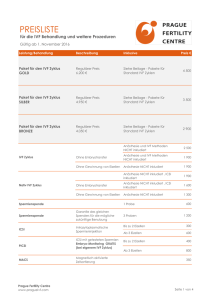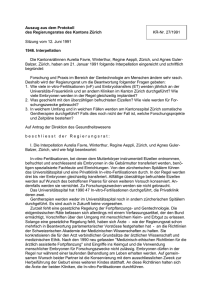Document
Werbung

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften Association of the Scientific Medical Societies in Germany Geschäftsstelle | office: Moorenstr. 5, Geb. 15.12 (Heinrich-Heine-Universität) D-40225 Düsseldorf Tel. (0211) 31 28 28 FAX (0211) 31 68 19 Referate bei der Sitzung des Arbeitskreises „Ärzte und Juristen“ am 29. und 30. November 1996 in Würzburg e-mail: [email protected] AWMF online: http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ 1. Thema: Das Arbeitszeitrecht im Spannungsfeld zwischen Patientenversorgung, Kostenbegrenzung und Haftungsrecht aus der Sicht des Leiters einer chirurgischen Klinik: Prof. Dr. H.-F. Kienzle, Köln Das Arbeitszeitgesetz hat uns nicht überrascht, gleichwohl unvorbereitet getroffen. Wie man die Diagnose einer schweren Erkrankung komplett verdrängen kann, schob man die Erarbeitung von Lösungsansätzen vor sich her, obwohl das Arbeitszeitgesetz am 1.7.1994 in Kraft getreten ist und seitdem klar ist, daß auch das Gesundheitswesen ab dem 1.1.1996 darauf verpflichtet sein würde. Der Leitende Arzt muß fürchtet Probleme bei der Dienstplan- und Arbeitseinteilung, der Stationsbesetzung und Kontinuität in der ärztlichen Betreuung, die nachgeordneten Ärzte sahen sich bei mehr - erwünschter - Freizeit erheblichen finanziellen Einbußen ausgesetzt. In Kenntnis der Probleme hat man den Krankenhäusern eineinhalb Jahre zum Nachdenken Zeit gelassen, doch diese Zeit verstrich in den allermeisten Fällen ungenutzt. Wir wurden von unserer Verwaltungsleitung im Juni 1995 informiert, daß das schwierige Problem bis zum 31.12.1995 gelöst sein müsse. Dr. Horstmann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, hat in einer Mitteilung der Arbeitsschutzverwaltung des Landes zur Umsetzung des Gesetzes die WHO-Formel vorangestellt: „Gesund sein heißt nicht nur, nicht krank zu sein, sondern auch sich körperlich und seelisch wohlzufühlen.“ Ziel dieses Gesetzes sei - Reduzierung von streßbedingten Belastungen, - Abbau von vermeidbarer Nacht- und Schichtarbeit, - gesundheitsgerechte Arbeitszeitgestaltung, - Vereinbarkeit von Familie und Beruf und - Freiraum für soziale Aktivitäten. Herr Dr. Horstmann weist auch darauf hin, daß gerade die „Fachleute für Gesundheit“ ein Vorbild für andere Bereiche des Arbeitslebens sein sollten. Das Gegenteil sei leider der Fall. In der Tat klafft zwischen den idealisierten Vorstellungen des Ministers und d er Realität eine kaum zu überbietende Kluft. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums hat man sogar das Emnid-Institut bemüht, um herauszufinden, daß „unregelmäßige und ungünstige Arbeitszeiten im Pflegebereich von etwa der Hälfte der Befragten als belastend empfunden würden, die Unzufriedenheit mit der Arbeitszeit sei in diesem Tätigkeitsbereich am höchsten.“ Um zu einer solchen Aussage zu kommen, benötigt man offenbar eine sicher nicht ganz billige Studie des Emnid-Institutes. Das Arbeitszeitgesetz soll also der Gesundheit der Mitarbeiter im Gesundheitswesen dienen, andererseits aber auch Patienten vor übermüdeten Ärzten schützen. Bereits im Jahre 1985 hat der BGH ein Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm bestätigt und festgestellt: „Der Krankenhausträger ist zum Schutz der Patienten verpflichtet, durch geeignete Organisationsmaßnahmen sicherzustellen, daß keine durch einen anstrengenden Nachtdienst übermüdeten Ärzte zu Operationen eingeteilt werden. Der Krankenhausträger kann sich von seiner Geschäftsherrenhaftung entlasten, wenn er nachweist, daß das Fehlen solcher Organisationsmaßnahmen sich auf den Einsatz des fehlerhaft operierenden Arztes nicht ausgewirkt hat.“ Dr. Steffen, der frühere Vorsitzende des 6. Senats des BGH hat in seinen „Entwicklungslinien des BGH zur Rechtssprechung im Arzthaftungsrecht“ festgestellt, daß Pläne sicherstellen müssen, daß kein durch einen anstrengenden Nachtdienst übermüdeter Arzt zu Operationen eingeteilt wird. Was besagt das Gesetz, von dem Ärzte und Patienten profitieren sollen? Das Arbeitszeitgesetz gilt für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen: ärztliches Personal, Pflegepersonal, Beschäftigte der Verwaltung und den Hausdienst. Ausgenommen sind Dienststellenleiter, Leitende Angestellte und Chefärzte. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 1 Die werktägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen ein Ausgleich auf durchschnittlich 8 Stunden gewährleistet ist. Damit ergibt sich eine gesetzlich höchstzulässige wöchentliche Arbeitszeit von (10 Stunden x 6 Werktage) 60 Stunden. Die tarifliche Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden muß aber durch den entsprechenden Freizeitausgleich gewährleistet sein. Auch Urlaubs- und Krankheitstage sind, soweit es sich um Werktage handelt, zum Ausgleich für Mehrarbeit über 8 Stunden berücksichtigungsfähig. Werktage sind alle Tage von Montag bis Samstag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage. Ruhepausen müssen im voraus feststehen und zwar 30 Minuten von 6 bis 9 Stunden Arbeitszeit, 45 Minuten bei 9 Stunden Arbeitszeit. Freistellungen unterhalb von 15 Minuten können grundsätzlich nicht als Ruhepause anerkannt werden. Eine Beschäftigung von mehr als 6 Stunden hintereinander ohne Ruhepause ist nicht zulässig. Die Beschäftigten sind während der Ruhepausen grundsätzlich von jeder Arbeit auch von jeglicher Verpflichtung zur Bereithaltung zur Arbeit, freizustellen. Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft sind keine Arbeitszeiten im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Sie sind Ruhezeiten, solange die Beschäftigten nicht zur Arbeitsleistung herangezogen werden. Die Beschäftigten müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden haben. Die Mindestruhezeit von 11 Stunden kann durch Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes oder der Rufbereitschaft auf eine Ruhezeit von mindestens 5,5 Stunden verkürzt werden. Dabei wird außer acht gelassen, wann im Falle einer Rufbereitschaft Arbeit geleistet wird. Liegt bei einer Gesamtarbeitsleistung von unter 5,5 Stunden die Tätigkeit zum Beispiel zwischen 1 und 4 Uhr in der Nacht, darf am nächsten Morgen übermüdet weitergearbeitet werden. Betrug die Gesamtarbeitszeit in der Rufbereitschaft für einen Oberarzt allerdings mehr als 5,5 Stunden, endete aber der zeitliche Einsatz um 24 Uhr, ist der erneute Arbeitsbeginn erst am nächsten Tag ab 10 Uhr möglich. Da der Bereitschaftsdienst an unserer Klinik, wie an vielen anderen, hochbelastet ist, und nach der Gruppe D honoriert wird, wird die 5,5 Stunden-Grenze in aller Regel überschritten, weshalb wir täglich 3 Ärzte nach Dienst nach Hause schicken müssen. Zur Gestaltung des Nachtdienstes gibt es schwierige Vorgaben, die ich in Einzelheiten hier nicht weiter ausführen will. Für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen müssen die Beschäftigten einen Ersatzruhetag erhalten, der in der vorgegebenen Zeit gewährt werden muß. Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen für den einzelnen Beschäftigten arbeitsfrei bleiben. Das Arbeitszeitgesetz und die geltenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen sind durch Aushang oder Auslage bekannt zu machen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, jede über 8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit an Werktagen und jede Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen aufzuzeichnen. Aus den Aufzeichnungen muß ersichtlich sein, ob und wann der erforderliche Ausgleich erfolgt ist. Die Aufzeichnungen müssen mindestens 2 Jahre aufbewahrt werden. Dienstpläne, die gegen die gesetzlichen Grenzen verstoßen, sind gesetzwidrig und damit unwirksam. Auch wenn das Personal bereit wäre, über die zulässige Höchstarbeitsgrenzen hinaus Überstunden zu leisten, oder ohne bzw. mit kürzeren Ruhepausen und -zeiten zu arbeiten, wäre dies nicht zulässig. Bei Verstoß gegen das Gesetz werden Geldbußen bis zu 30.000 DM fällig, bei Nichtaushang der gesetzlichen Vorschriften 5.000 DM. Im Wiederholungsfalle, ober bei vorsätzlicher Mißachtung, können Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr verhängt werden. Es gab in der Vergangenheit sicher wenig Krankenhäuser, in denen Ärzte nicht klaglos Überstunden geleistet haben, um eine ausreichende Versorgung der Patienten zu gewährleisten, wobei ich hierzu die notwendigen Gespräche mit den Patienten, mit deren Angehörigen und Hausärzten einschließen will. Nur in wenigen Fällen wurden die Überstunden bezahlt. Die stillschweigende Duldung zahlloser Überstunden wurde und wird seitens des Leitenden Arztes und des Trägers mit der ärztlichen Aufgabe und Pflicht erklärt, die in kein BATSchema zu pressen sei. Mit dem Inkrafttreten des Arbeitszeitgesetzes sind Überstunden nicht mehr erlaubt. Fallen Sie an, müssen sie dokumentiert und in Freizeit abgegolten werden. Zur Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes für den Bereitschaftsdienst der Assistenzärzte und die Rufbereitschaft der Oberärzte ergaben sich für uns 3 Lösungsansätze: 1. Nichts tun. Von verschiedenen Seiten wurde behauptet, daß das Arbeitszeitgesetz für den Krankenhausbereich nicht gelte, wenn Tarifverträge zur Arbeitszeitgestaltung und die Gestaltung von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften bestünden. Es ist jedoch vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung darauf hingewiesen worden, daß auch bei entsprechenden Sonderregelungen des BAT die verschärften Regelungen des Arbeitszeitgesetzes Geltung hätten. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage seien die tariflichen Regelungen jetzt zwingendes Recht, in dem die festgelegten Grenzen nicht überschritten werden dürften. Dennoch scheinen sich zahlreiche Kliniken dieser ersten Variante anzuschließen. Auch ein sogenannter Patientenanwalt hat in der Presse mitgeteilt, welche Auswirkungen das Arbeitszeitgesetz im Falle eines Schadenersatzprozesses für ihn bzw. den Patienten habe. 2. Freizeitausgleich, Zusetzung einer Stelle pro abfeierndem Arzt, damit aber auch erhebliche Geldeinbußen (bis zu 1.500 DM/Monat) für den jeweiligen Mitarbeiter. 3. Durch Inanspruchnahme der zulässigen Verlängerung der täglichen Arbeitszeit im Rahmen des § 3 des Arbeitszeitgesetzes werden freie Tage angespart. Durch die angesparte verlängerte tägliche Arbeitszeit kann nach dem Nachtdienst Freizeit gewährt werden, ohne daß Lohneinbußen entstehen. An unserer Klinik haben sich die Assistenten für diesen 3. Weg entschieden. Wir entsprechen damit den Forderungen des Arbeitszeitgesetzes. Die von uns praktizierte „Mehrarbeitsregelung“ trägt zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei, indem Geldeinbußen wegfallen und so in gewissem Maße die ohnehin geleisteten Überstunden honoriert werden. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 2 Gegen die Umsetzung nach dem Beispiel 2 sprach der verkürzte Stellenausgleich durch die Verwaltung (1,0 Stelle pro abfeiernden Arzt) sowie die Gehalteinbuße. Das Problem der täglichen Lücken durch abfeiernde Ärzte kann auch durch Modell 2 nicht gelöst werden. Auswirkungen des Gesetzes auf den Klinikbetrieb. Positiv ist der Wegfall der seit vielen Jahren von der Gesellschaft beklagten Überanstrengung der Ärzte im Nachtdienst mit nachfolgendem weiterem vollschichtigem Tagdienst. Dies ist nachvollziehbar und für die Mitarbeiter ein Erfolg. Der Marburger Bund als Interessenvertretung der angestellten Ärzte sieht sich in langjährigen Forderungen bestätigt. Für die Patienten ist günstig, daß sie nicht von Ärzten betreut werden, die möglicherweise am Ende ihrer Leistungskraft sind. Aus der Sicht des Leitenden Arztes sehe ich allerdings in der einseitigen Umsetzung des Gesetzes für den Klinikbetrieb erhebliche Nachteile, die trotz großer Anstrengungen nicht auszugleichen sind. Die finanzielle Lage der Kliniken läßt für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösungen nicht zu. Am Rande sei vermerkt, daß der Leitende Arzt der Einzige ist, der ohne Einschränkung einsetzbar ist. Nimmt er seine Aufgabe ernst, wird er in vielen Fällen, gerade auch bei schwerkranken Patienten auf der Intensivstation, für die kontinuierliche, lückenlose Versorgung notwendig sein. Aber auch in weniger brisanten Bereichen, wie z. B. der allgemein-chirurgischen Station, treten durch den häufigen Mitarbeiterwechsel unter Umständen Lücken auf, die für den Patienten schädlich sind und damit auch haftungsrechtliche Relevanz haben. Die Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter auf den Stationen und in den Funktionsbereichen ist sehr unterschiedlich, sie reicht vom Arzt im Praktikum über den Assistenten in Weiterbildung bis zum erfahrenen Facharzt und schließlich zum Oberarzt. Der verantwortlich visitierende Arzt wechselt oft täglich. Trotz ausführlicher schriftlicher Dokumentation bleiben Nuancen, die sich aus dem jeweiligen Arzt/Patientenverhältnis ergeben, mitunter unberücksichtigt. Auch wenn die Übergabeviste am nächsten Morgen ausführlich und verantwortungsvoll durchgeführt wird, fehlt an manchen Tagen der erfahrene Stationsarzt. Der für die jeweilige Station zuständige Oberarzt kann die Defizite nicht ohne weiteres ausgleichen, zudem muß auch ein Oberarzt Freizeitausgleich bekommen, wenn er während seiner Rufbereitschaft des Nachts eine Inanspruchnahme von über 5,5 Stunden überschritten hat. So treten Situationen ein, in denen einer Station oder einem Funktionsbereich sowohl der erstverantwortliche Arzt, als auch der Oberarzt fehlen. Gerade für einen Oberarzt ist nicht ohne weiteres Ersatz zu finden. Unter Umständen müssen Operationen von einem Tag auf den anderen verschoben werden, obwohl der Patient vorbereitet ist. Für Außenstehende ist schwer nachvollziehbar, was solch eine Operationsverschiebung für Patienten und Angehörige bedeutet, die psychischen Auswirkungen sind in manchen Fällen erheblich. Selbst Patienten, die das verstehen können, und die unseren Erklärungen zugänglich sind, haben letzten Endes unter den Vorgaben zu leiden. Ich spreche hier für die Chirurgie und aus der Sicht des Leitenden Arztes. Die genannten Beispiele lassen sich jedoch fraglos auch auf andere klinische Bereiche übertragen. Im Falle der Anästhesie wird so mancher am Vortag praemedizierende Arzt die Narkose am Folgetag nicht übernehmen können, obwohl dies eigentlich sachlich geboten und für den Patienten wichtig ist. Für die Stationsübergabe wird von der Verwaltung eine halbe Stunde für 35 Betten morgendlicher Visite zugebilligt. Die von den Assistenten erbetene Zusetzung auf eine ganze Stunde wurde vom Träger aus Kostengründen abgelehnt. Sibyllinisch wird im Ablehnungsschreiben mitgeteilt, daß strukturelle und organisatorische Änderungen innerhalb der Chirurgischen Klinik, die kostenneutral durchgeführt werden könnten, die einzige Möglichkeit seien, bei gleichbleibenden Personalkosten weiterhin eine optimale Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Im Klartext heißt dies, daß Mehrleistungen bei der Übergabevisite von den Assistenzärzten dokumentiert werden sollen, um sie dann zu gegebener Zeit mit Freizeit auszugleichen. Dies ist jedoch Illusion und jeder weiß, daß die Mehrleistungen einfach in Kauf genommen werden. Ich beklage dies nicht, weil ich schon der Meinung bin, daß ein Arzt über das vom BAT verordnete Maß hinaus sich um seine Patienten kümmern kann. Insofern stellt auch eine verlängerte Visitenzeit kein Unrecht dar. Halten wir uns aber an den Buchstaben des Gesetzes, ist meine Einstellung gesetzwidrig. Seitens des Trägers wird augenzwinkernd auf die Arbeitsbereitschaft der Ärzte vertraut, und seitens der Gesetzgebung werden Vorgaben geschaffen, die mangels Finanzierbarkeit nicht umgesetzt werden können. Im Telegrammstil seien weitere Auswirkungen des Gesetzes auf den Klinikbetrieb genannt, die auf den häufigen Mitarbeiterwechsel in einem bestimmten Bereich zurückzuführen sein können: Verlängerte Arbeitszeit, weil wichtige Entscheidungen nicht getroffen werden. Unterschiedlich qualifizierte Aufklärung, weil der verantwortliche Stationsarzt fehlt. Mißverständnisse in den Gesprächen mit Angehörigen und Patienten, weil trotz gleichen Sachverhaltes aus verschiedenen Blickrichtungen und mit unterschiedlicher Diktion argumentiert wird. Die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal leidet, weil durch wechselnde Visitenärzte die Anordnung z. T. inkonsequent und nicht geradlinig genug getroffen werden. Verlängerte Weiterbildungszeit für die Assistenzärzte, da sie an vielen Tagen im Jahr fehlen. Die häufig wiederkehrende Antwort auf eine Frage nach einem bestimmten Sachverhalt „weiß ich nicht, hatte gestern frei“ habe ich mir mittlerweile verbeten. Haftungsrechtliche Folgen des Arbeitszeitgesetzes können eintreten durch lückenhafte bzw. fehlerhafte Dokumentation, zeitgleiche Verzögerungen in Diagnostik und Therapie, sowie Fehler, die aus organisatorischen Mißverständnissen oder Fehleinschätzungen resultieren. Wesentliches kann zwar dokumentiert werden, personale Interaktionen und kleine Details sind aber nicht ohne weiteres weiterzugeben. Der Patient braucht eine durchgehende Bezugsperson, die krankhafte Veränderungen kontrollieren und kompetent beurteilen kann. N icht Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 3 alles, was mit dem Auge zu sehen, oder mit dem Finger zu tasten ist, kann so dokumentiert werden, daß das Gesehene oder Ertastete lückenlos von einem 2. oder 3. Kollegen, vielleicht aber noch unterschiedlicher Qualifikation, übernommen werden kann. Nur durch Kontinuität ist im Verlauf von vielen Behandlungstagen das nicht verzichtbare Arzt-/Patientenverhältnis und gegenseitiges Verständnis herzustellen. Auch in den Funktionsstellen (z. B. Endoskopie) zeigt es sich immer wieder, daß kurzfristige Umbesetzungen zu Fehlinformationen und damit zu falschen oder verzögerten diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen führen können. Fehler durch Informationslücken halte ich für schwerwiegender und eher denkbar als die hypothetischen Fehler durch Übermüdung. Fehler sind auch denkbar, wenn jüngere Mitarbeiter eingesetzt werden müssen, weil erfahrenere Mitarbeiter an bestimmten Tagen fehlen. man erkennt eben nur, was man kennt: Der Beginn eines Wundinfektes, oder diskrete Zeichen einer Gesamtverschlechterung im Verlauf, z. B. eine beginnende Pneumonie, wird im ungünstigsten Falle vielleicht zu spät erkannt, weil der junge Kollege gar nicht sieht, wann er einen Oberarzt hinzuziehen müßte. Last not least hat sich für den hier behandelten Bereich eine 2-Klassen-Medizin etabliert: Die Privatpatienten haben täglich denselben Ansprechpartner, der zweimal am Tag Visite macht und so einen konsequenten Behandlungsverlauf gewährleistet. Allgemeinpatienten erleben unter Umständen an 3 Tagen 3 verschiedene Ärzte unterschiedlicher Qualifikation. Die genannten Probleme verschärfen sich im kleinen Krankenhaus: wir sind immerhin in der glücklichen Lage, durch die Größe der Klinik Mitarbeiter zum Wechsel zu haben, an kleineren Kliniken sind Konstellationen denkbar, die eine Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes unmöglich machen, weil Mitarbeiter nach der Zahl einfach fehlen. Von ausreichender Qualifikation ganz zu schweigen. Abschließend die Frage, ob durch Teamwork die nicht mehr zu vermeidenden Lücken aufgefangen werden können. Es wäre ja denkbar, daß durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und dem Pflegepersonal ein echtes Stationsteam gebildet wird, so daß das Wissen um die Patienten eine breite Basis erhält (was der eine nicht weiß, weiß vielleicht der andere). Das Auseinanderdriften der beiden Bereiche und die zunehmende Tendenz des Pflegebereichs zur Verselbstständigung stehen dem jedoch entgegen. Zudem ist analog zum Stellenstop bzw. Stellenabbau im ärztlichen Bereich die Aufhebung der PPR (Pflegepersonal-Regelung) im Pflegebereich zu erwarten, so daß die Anhaltszahlen im Pflegebereich wieder auf 1969 zurückgestuft werden. Um die durch das Arbeitszeitgesetz entstandenen organisatorischen Probleme, Informationslücken und verschärften Haftungsprobleme zufriedenstellend zu lösen, bliebe nur eine bessere finanzielle Ausstattung der Kliniken. Wie es darum steht, ist jedermann bekannt. Die Probleme, die das Arbeitszeitgesetz den Kliniken gutmeinend bescherte, harren noch der Lösung. aus der Sicht einer Klinikumsverwaltung: Frau S. Schell, Personaldezernentin des Universitätsklinikums Tübingen Einleitung Was haben wir alle mit Britanniens Premier Major gemeinsam? Ärger mit dem Arbeitszeitrecht! In der EU gibt es „Richtlinien über die Arbeitszeitgestaltung“. Diese haben mit wöchentlicher Höchstarbeitszeit von 48 Stunden, mindestens einem freien Tag pro Woche und einer Ruhezeit von 11 Stunden die gleichen Grundregeln wie das deutsche Recht. Es sind ebenfalls Ausnahmen, z. B. für Forschungseinrichtungen und das Gesundheitswesen, vorgesehen. Die Briten haben sich aber das Recht vorbehalten, nicht an der europäischen Sozialpolitik teilzunehmen. Der EuGH verurteilte sie nun trotzdem, sich den EU-Regeln zu unterwerfen, da diese Ausfluß des Artikels 118a, das sind Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, des Gemeinschaftsvertrages wären. Major droht nun mit einer Blockade der Maastricht-Reform. Dieses Mittel steht uns leider nicht zur Verfügung. Wir müssen mit dem geltenden ArbZG zurechtkommen. Die Arbeitszeit von Wissenschaftlern, die in einen Klinikbetrieb integriert sind, teilt sich in der Regel in zwei Blöcke auf: einerseits in Forschung und Lehre und andererseits in Patientenversorgung. Die Zeit der Patientenversorgung ist überwiegend in Dienstplänen und Überstundenabrechnungen festgehalten. Die übrige Zeit unterliegt dieser Kontrolle nicht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes. 1. Arbeitszeitrecht Mehr oder weniger offen ausgesprochen wird das AZG von Herrn Blüm und seinem Ministerium als Vehikel zur Schaffung neuer, zusätzlicher Arbeitsplätze angesehen. Die vorhandene Arbeit soll auf mehr Köpfe verteilt werden. Was am Fließband nur eine Frage der Einteilung und Organisation ist, muß auch im Krankenhaus auf Biegen und Brechen umgesetzt werden. Ein Klinikum muß rund um die Uhr eine Maximalversorgung mit hochspezialisierten Fachärzten sicherstellen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden und gleichzeitig das ArbZG einzuhalten, müßten auch für sehr kleine Einheiten mehr dieser Spezialisten eingestellt werden. Dies wäre jedoch extrem unwirtschaftlich und ist unter den gegebenen Verhältnissen nicht finanzierbar. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat während des Gesetzgebungsverfahrens in Anhörungen und mit Eingaben Änderungen gefordert. Die Proteste richteten sich vor allem gegen die Bestimmungen über die Ruhezeit. Die DKG prognostizierte schon damals erhebliche Schwierigkeiten bei der Dienstplanerstellung und daraus folgend Stellenvermehrungen. Der Bundesrat hat das Anliegen der Krankenhäuser bezüglich der Weiterarbeit nach Bereitschaftsdiensten unterstützt. Er begründete u. a. mit „weniger Wechsel in der Bezugsperson für den Patienten“ und „größerer Sicherheit in der Behandlung und Pflege“. Alle diese Argumente der Praktiker konnten die „Experten“ am grünen Tisch jedoch nicht umstimmen. Auch die Beschäftigten waren nicht gerade begeistert über die staatliche Fürsorge, die sich mit diesem Gesetz über sie ergoß. Die Assistenzärzte fürchteten um einen nicht kleinen Teil ihrer Bezüge und erkannten schnell, daß es nun länger dauern würde bis zur Fach- Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 4 arztanerkennung. Die Krankenschwestern und -pfleger wollten die geliebte Schaukelschicht oder möglichst 20 Nachdienste à 10 Stunden am Stück beibehalten, damit die anschließende Freizeit länger wurde. Der Marburger Bund apellierte an seine Mitglieder, Überstunden und Dienste zugunsten arbeitsloser Kollegen aufzugeben. Der Personalrat versuchte dem Pflegepersonal die „gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit“ (§ 6, 1 ArbZG) näherzubringen. Nachdem unsere Vorschläge zur Tarifmodifizierung Anfang 1995 von der TdL leider nicht aufgenommen wurden, haben wir die Vorgesetzten im Universitätsklinikum über die notwendigen Änderungen informiert. In Detailfragen war dann schnell klar, daß es, wie bei jedem neuen Gesetz ohne höchstrichterliche Rechtssprechung, sehr unterschiedliche Rechtsmeinungen und Kommentierungen gibt. Da auch schon 1995 das Budget gedeckelt war und die Kassen keine zusätzlichen Stellen zur Umsetzung des ArbZG bewilligten, erschien uns der „berühmte“ § 19 als Retter in der Not. Für eventuell Nichteingeweihte: Dieser Paragraph läßt „bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben“ die Anwendung beamtenrechtlicher Bestimmungen zu. Wir konnten uns immerhin auf den Kommentar Zmarzlik/Anzinger, beide im Bundesarbeitsministerium tätig, stützen. Hoheitliche Aufgabe war und ist für uns die Lehre. Wir haben nie behauptet, daß Krankenversorgung eine hoheitliche Aufgabe sei. Nach den genannten Kommentar genügt es zur Anwendung des § 19, wenn „jedenfalls auch hoheitliche Aufgaben anfallen“. Sinn und Zweck dieser Norm ergibt sich jedoch nicht nur aus dem engeren Wortlaut. Es soll vielmehr vermieden werden, daß in einem Betrieb für die gleiche Arbeit je nach Dienstart (Beamter/Angestellter) unterschiedliches Recht angewandt wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß z. B. die ArbZVO des Landes Baden-Württemberg keine „Ruhepause“ kennt. Hier ist nur die Lage und Dauer der Mittagspause vorgeschrieben. Entweder ist es für die Schöpfer dieses Werks unvorstellbar, daß ein Beamter nachts arbeitet oder man geht davon aus, daß er dies ohne Pause kann. Weshalb der vielgepriesene Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer anders geregelt wird als für Beamte ist auch nicht einsichtig. Die beamtenrechtlichen Bestimmungen gelten bei Anwendung des § 19 auch für Angestellte und Arbeiter soweit keine entgegenstehenden Tarifregelungen existieren. Aus diesem Grund glaubten wir nicht an eine Dauerlösung. Wir rechneten mit neuen Tarifbestimmungen oder zumindest einer Öffnungsklausel im BAT für Betriebsvereinbarungen. Eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März diesen Jahres stellte unser Ministerium per Erlaß fest, daß die in § 19 ArbZG geforderten Voraussetzungen bei einem Universitätsklinikum nicht vorliegen würden. Gleichzeitig wurden wir aufgefordert, für die besonderen Problembereiche Ausnahmeanträge zu stellen. 2. Die Hauptprobleme 2 a) Ärztlicher Bereich Höchstarbeitszeiten (§ 3 ArbZG) Sowohl die Forderung nach einer durchschnittlichen 8-stündigen Arbeitszeit als auch die festgelegte Höchstarbeitszeit von täglich 10 Stunden ist insbesondere im Ärztlichen Dienst realitätsfremd. In einem Universitätsklinikum als Krankenhaus der Maximalversorgung müssen besondere Leistungen erbracht werden, und zwar rund um die Uhr, die nur von einer beschränkten Zahl hochqualifizierter Spezialisten beherrscht werden. Die, auch unter haftungsrechtlichen Aspekten, optimale Krankenbehandlung verlangt in vielen Fällen deren persönlichen Einsatz von mehr als 10 Stunden täglich. Würde man in diesem Bereich die Höchstarbeitszeiten konsequent einhalten, so müßten oftmals Patienten abgewiesen werden, weil derart erfahrene Ärzte nicht beliebig vermehrbar sind. Daneben ist es den Universitätskliniken auch nicht möglich, sie zu bezahlen. Außerdem beschränken sich die Tätigkeiten der Ärzte nicht nur auf die Krankenversorgung. Sie haben regelmäßig auch Aufgaben in Forschung und Lehre zu erbringen. Viele Ärzte mit dem Ziel der Habilitation vor Augen, arbeiten nach „Dienstschluß“ wissenschaftlich weiter. Das strikte Einhalten der Höchstarbeitszeiten hätte zumindest teilweises Verbot der wissenschaftlichen Arbeit an der Arbeitsstelle zur Folge. Ein Wissenschaftler mit klaren Karriere- und Forschungszielen wird sich jedoch kaum von seinen Forschungsaktivitäten abhalten lassen. Zu erwarten wäre daher eine Verlagerung dieser Arbeiten in die unkontrollierbare Freizeit. Wissenschaftler identifizieren sich mehr mit der grundsätzlich garantierten Freiheit von Forschung und Lehre als mit arbeitszeitrechtlichen Rahmenbedingungen. Bei Berücksichtigung der Arbeitszeit nach BAT errechnen sich monatlich ca. 41 maximal mögliche Überstunden. Nach bisher vorherrschender Rechtsmeinung sind dabei die tatsächlichen Inanspruchnahmen während der Bereitschaftsdienste und der Rufbereitschaften als Überstunden zu berücksichtigen. Damit bleibt für „reine“ Überstunden in vielen Fällen praktisch kein Raum mehr. Innerhalb eines 6-MonatZeitraums in 1995 haben wir 149 ermittelt, die diese Grenze überschritten haben. Ruhezeit (§ 5 ArbZG und SR 2c BAT) Wegen der dünnen Personaldecke müssen die meisten Ärzte nach den Bereitschaftsdiensten in Stufe C und D weiterarbeiten. Dies darf nach BAT jedoch nur in Ausnahmefällen eintreten. Der konsequente Freizeitausgleich für den Bereitschaftsdienst hätte einen Mehrbedarf von 48 Stellen zur Folge. Ruhepause (§ 4 ArbZG) Bis auf die Intensivstationen macht diese Regelung im ärztlichen Bereich keine Probleme. Allerdings wird beim Überschreiten der 9Stunden-Grenze niemand die dann zusätzlich notwendigen 15 Minuten Pause machen. 2 b) Pflegedienst Höchstarbeitszeit (§ 3 ArbZG) Hier gibt es keine besonderen Probleme. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 5 Ruhezeit (§ 5 ArbZG und SR 2a) In einigen Bereichen (z. B. Intensivstationen) hatte sich das Pflegepersonal mit seitenlangen Statements für die Beibehaltung des Schaukeldienstes ausgesprochen. Man hat hier einen Kompromiß gefunden. der auch vom Personalrat unterstützt wird. Zur Herbeiführung eines regelmäßigen Schichtwechsels soll die Ruhezeit viermal innerhalb eines Dienstplanzeitraums (4 Wochen/Monat) auf 8,5 oder 9 Stunden gekürzt werden. Dies ging als Vorschlag zur Tarifänderung an unser Ministerium, wird aber auch ohne diese Absegnung bereits praktiziert. Ruhepause (§ 4 ArbZG) Bisher haben Nachtwachen 10 und mehr Stunden am Stück gearbeitet. Obwohl normalerweise in diesem Zeitraum auch arbeitsfreie Abschnitte vorkommen, wurde die Gesamtzeit vergütet. Unter Berücksichtigung der BAG-Definitionen für eine Pause müßte man für fest eingeplante Pausen mit nur einer Pflegekraft pro Station eine Ablösung für die Pausenzeit organisieren. Wir prüften die Möglichkeiten einer Zusammenlegung von jeweils zwei Stationen. Dies wäre nicht im ganzen Klinikum möglich gewesen. Auch die Organisation eines Springerdienstes wäre sehr problematisch gewesen. Hier erhielten wir überraschenderweise Hilfe von unserem Sozialministerium, das entgegen der einschlägigen Kommentarmeinungen eine neue Pausendefiniton kreierte. Die Pausen in der Nachtschicht kann innerhalb eines „Pausenfensters“ in 15-minütige Kurzpausen aufgeteilt werden, wenn erfahrungsgemäß der Arbeitsanfall diese Pausen erwarten läßt. Die Pausen sind damit nicht konkret zeitlich festgelegt und die Pflegekraft muß bei Bedarf die Arbeit auch während einer Pause sofort aufnehmen. Da dies nicht der BAG-Definition entspricht, bleibt es bei der bezahlten Pause. 3. Die Hauptbereiche In monatelanger akribischer Arbeit und mit zum Teil erheblichem Druck auf die Ärztlichen Direktoren wurden die konkreten Probleme der einzelnen Abteilungen bei der Umsetzung des ArbZG eruiert. Flankierend dazu verlangte unser Personalrat, daß ihm sämtliche Dienstpläne vorgelegt wurden. Zu einem großen Teil konnte anhand dieser Pläne nicht kontrolliert werden, ob die Vorschriften zur Arbeitszeit eingehalten wurden. Umfangreiche Abstimmungsarbeiten waren notwendig. Bis Ende August konnten wir dann den letzten von insgesamt 18 Ausnahmeverträgen beim Gewerbeaufsichtsamt stellen. Als Gründe für die Anträge wurden die quantitativ und qualitativ limitierten Personalressourcen genannt, die wegen der finanziellen Restriktion nicht vergrößert werden können. Daneben wurde auch auf die Verlagerung der Facharztweiterbildung und, bei Personalvermehrung, auf die fehlenden Diensträume hingewiesen. Wie Sie aus der Aufstellung ersehen, sind besonders die chirurgischen Fächer und Bereiche mit intensivmedizinischer Betreuung betroffen. Auch relativ kleine Bereiche sind mit der Sicherstellung der Rund-um-die-Uhr-Versorgung überfordert. Hierzu das Beispiel der Neonatologischen Abteilung. Probleme bei einzelnen Berufsgruppen Höchstarbeitszeit innerhalb Ausgleichszeitraum Besonders bei Spe- In allen operativen zialisten Schichtdau- und intensiver am Wochenende medizinischen Fä12 bis 13 Std. chern wegen der Anrechnung des BD auf die Überstunden - Ruhepausen Ruhezeit Bis auf intensivmedizinische Bereiche keine Probleme. Bei Überschreitung der 9-Std.Grenze durch Überstunden keine zusätzliche Pause von 15 Min. Nachts auf Stationen mit nur einer Pflegekraft. Lösung: „Soz.MIn.Pause“ Kurzpausen von 15 Min. innerhalb eines „Pausenfensters“ - kein Entfernen vom Arbeitsplatz - keine exakte Festlegung In kleineren Einheiten kann keine Ruhezeit nach BD eingeräumt werden, da sonst der Tagdienst zu gering besetzt wäre täglich Ärzte Pflegepersonal Zu kurz bei Schaukelschicht Lösung: 4 x pro Dienstplan (4 Wochen/Monat) Verkürzung auf 8,5 oder 9 Std. zur Herbeiführung eines regelmäßigen Schichtwechsels (Tarifvertrag!). Unser Personalrat hat keinen unserer Anträge unterstützt, sondern in allen Fällen behauptet, unsere Begründungen seien nicht zutreffend bzw. könne die Finanzierungslücke als Grund nicht akzeptiert werden. Weder Zustimmung noch Ablehnung des Gewerbeaufsichtsamts liegen uns bisher vor. Es gab lediglich einige Rückfragen bzw. die Bitten um weitere Begründungen. Wie Sie auf meiner Übersicht erkennen können, bietet das ArbZG einige Möglichkeiten zur Modifizierung der Vorschriften. Darüber müssen sich die Tarifvertragsparteien bzw. Dienststelle/Personalrat einigen. Hier hat die ÖTV bereits versucht den Hebel anzusetzen und ein „Arbeitszeitkonto“ für jeden Beschäftigten gefordert. Verbunden damit wäre eine Faktorierung von Nachtdiensten in der Freizeit, z. B. eine Stunde Nachtdienst ergibt 1,5 Stunden Freizeit. Dies würde die bisherigen Zuschläge ersetzen, wäre aber für die Arbeitgeber erheblich teurer. Deshalb kam es bisher zu keinen tariflichen Lösungen zum ArbZG. Die Gewerkschaft will die Zwangssituation der Arbeitgeber zur Durchsetzung ihrer Forderungen nutzen. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 6 4. Finanzieller Rahmen für die Umsetzung Der 11.11. ist bereits vorbei und wir können in das Lied einstimmen: „Wer soll das bezahlen?“ Hier in Tübingen muß folgende Rechnung aufgemacht werden: Pflegesatz a) Die Unsicherheit über die Budgetfortschreibung durch Tarifabschluß kostet uns b) Ab 1.1.1997 wird pauschal eine Fehlbelegungsabgabe abgezogen, dies wiederholt sich in den Jahren 97 und 98, das sind jährlich 5 Millionen 5 Millionen ___________ 10 Millionen Daneben drohen weitere finanzielle Einbußen durch die verschärfte Deckelung des Budgets. Landeszuschuß Durch die Wegnahme von Rücklagen und weiteren Kürzungen wurde der Landeszuschuß um 15 % < gekürzt, das sind 25 Millionen Mark. Dem Klinikum fehlen in diesem und den nächsten Jahren also jeweils mindestens 35 Millionen DM! 5. Fazit Die organisatorischen Möglichkeiten zur Optimierung der Arbeitszeit sind ausgereizt. Auch der Marburger Bund hat diese Woche bei einer Veranstaltung für Assistenzärzte eingeräumt, daß es die intelligente Lösung nicht gibt. Mögliche Schlupflöcher über die Auslegung des Gesetzestextes werden derzeit aus arbeitsmarktpolitischen Gründen verstopft. Über die Genehmigung von Ausnahmen machen wir uns keine Illusionen. Das Personal muß aus finanziellen Gründen verringert werden. Wir haben unseren Minister, Herrn von Trotha, gebeten, seinen ganzen Einfluß zur Lösung dieses Dilemmas bei seinem Kollegen im Sozialministerium geltend zu machen. Als wirklich letzte Möglichkeit bliebe nur noch die Einschränkung von Leistungen. Da der Ambulanzbereich in der Vergütung eine starke Unterdeckung aufweist, sollten hier zuerst Leistungen abgebaut werden. Unser Ministerium hat nun das Sozialministerium nachdrücklich gebeten unter besonderer Berücksichtigung a) der Mischtätigkeit in Krankenversorgung sowie Forschung und Lehre und b) der gegenwärtigen finanziellen Situation, die keine Personalvermehrung zuläßt alle rechtlichen Möglichkeiten zur Bewilligung von Ausnahmen auszuschöpfen. Wir können also noch einmal hoffen. Aber, eine Rechnung, wonach ein Bundesministerium ein Gesetz erläßt, welches inzwischen mehr für arbeitsmarktpolitische Zwecke herhalten muß, und ein anderes Bundesministerium die dafür notwendige Finanzierung verhindert, kann nicht aufgehen. Hauptprobleme mit ArbZG ArbZG BAT Ausnahmebewilligung ArbZG Höchstarbeitszeiten täglich innerhalb Ausgleichszeitraum 10 Std. Ø 48 Std. pro Woche innerhalb 6 Mon. bzw. 24 Wochen seit 01.03.1996 gem. § 15, 1 BAT 12 Mon. im und zur Erreichung wenn zusätzlicher öffentlichen Freischichten Interesse dringend nötig täglich innerhalb Ausgleichszeitraum Ruhepausen Ruhezeit bis 6 Std.: keine bis 9 Std.: 30 Min. über 9 Std.: 45 Min. im Krankenhaus 10 Std.; BD = Ruhezeit, wenn mind. 5,5 Std. davon arbeitsfrei sind (ununterbrochen?) - SR 2a SR 2c „Soz.Min.Pause“ Kurzpausen von 15 Min. den Besonderheiten im öffentlichen Dienst entsprechend Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 7 Höchstarbeitszeiten Ruhepausen Ruhezeit 9 Std. mögliche an Sonn- und ohne Ausgleich Kurzpausen Feiertagen bis an 60 Werkta12 Std. zur gen 10 Std. Erreichung zusätzlicher Freischichten § 7 Abs. 2 Nr. 3 speziell bei Behandlung, Pflege und Betreuung von Bei entsprechendem Zeitausgleich Anpassung der Vorschriften an Eigenart dieser Tätigkeit und zum Wohl dieser Personen. Personen aufgrund ArbZG Tarifregelungen aus juristischer Sicht: Dr. C. Jansen, Düsseldorf „Kultur ist Reichtum am Problemen.“ Mit diesem Satz aus der berühmten „Kulturgeschichte der Neuzeit“ von Egon Fridell möchte ich Sie ermutigen, auch nach den inhaltsreichen Referaten meiner beiden Vorredner beim Thema zu verweilen. Über die Probleme der Patientenversorgung hat Herr Prof. Kienzle eindrucksvoll aus der Sicht des verantwortlichen chirurgischen Chefarztes gesprochen: Neben dem Wohlbefinden der Mitarbeiter und dem Interesse des Patienten an einem ausgeschlafenen und erholten Arzt besteht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Patientenversorgung, die durch das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gefährdet erscheint. Frau Schell schilderte die Schwierigkeiten, in denen sich die Krankenhausverwaltung in ihrem Bemühen befindet, den hohen gesetzlichen Anforderungen angesichts des Tiefstandes der öffentlichen Finanzen gerecht zu werden. Durch die beiden Referate wurden bereits die juristischen Grundlagen des Themas deutlich, ich möchte mich daher in meinem Beitrag aus juristischer Sicht der Vertiefung einiger grundsätzlicher Kernprobleme widmen. Dabei liegt die Betonung auf Kernprobleme. Ein für das Gesetz maßgeblich zuständiger Ministerialbeamter sagte einer Kollegin, allein für einen Absatz - nämlich § 5 Abs. 3 - gäbe es 48 verschiedene Auslegungsmöglichkeiten - das Gesetz ist also in der Tat ein Kulturprodukt i.S.v. Fridell. I. Verhältnis BAT / Arbeitszeitrechtsgesetz Eine wesentliche Frage lautet zunächst, inwieweit greift das Arbeitszeitrechtsgesetz überhaupt neben den einschlägigen tariflichen Regelungen insbesondere des BAT ein. Durch die Regelungen in §§ 7 und 25 wurde u. a. die Möglichkeit eröffnet, in den wesentlichen Bereichen der Arbeitszeit (§ 3), der Ruhepause (§ 4) und der Ruhezeit (§ 5) eine tarifliche Sonderregelung zu treffen. Das für das Arbeitszeitrechtsgesetz innerhalb der Bundesregierung federführende Bundesarbeitsministerium hat in einer Stellungnahme vom Januar 1996 geäußert, daß die Bestimmungen des § 15 Abs. 6 a und 6 b BAT und die Sonderregelungen SR 2 a und SR 2 c zum BAT als abweichende tarifliche Bestimmungen anzusehen sind, die insoweit dem ArbZG vorgehen. Dieser Auffassung haben sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die kommunalen Arbeitgeberverbände (KAV) angeschlossen, während der Marburger Bund und die ÖTV gegenteiliger Meinung sind. Die DKG hat eine ausführliche Synopse über die einschlägigen Bestimmungen von ArbZG und BAT erarbeitet (vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (Hrsg.): „Hinweise zum Arbeitszeitgesetz (ArbZG)“, Düsseldorf 1996, S. 40 ff). Einen besonderen Streitpunkt bildet die Frage, ob sich die Verweisung auf das vorgehende Tarifrecht in § 7 ArbZG auf § 5 Abs. 1 auch die Regelung des Bereitschaftsdienstes und der Rufbereitschaften in § 5 Abs. 3 ArbZG erfaßt. Da § 5 Abs. 3 ArbZG keine eigenständige Regelung enthält sondern lediglich eine abmildernde Modifikation der Regelung des § 5 Abs. 1 ArbZG enthält, ist davon auszugehen, daß die Verweisung in § 7 ArbZG auf § 5 Abs. 1 ArbZG auch den Anwendungsbereich des § 5 Abs. 3 ArbZG erfaßt. In einzelnen Problemfällen greift die Regelung über „außergewöhnliche Fälle“ in § 14 ArbZG ein. Nach dieser Bestimmung darf von den maßgeblichen Regelungen insbesondere über die Arbeitszeit, die Pausen und die Ruhezeit abgewichen werden „bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlingen drohen.“ II. Bußgeld- und Strafvorschriften Gemäß § 22 Abs. 1 ArbZG handelt u. a. ordnungswidrig, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Regelungen über die Arbeitszeit (§ 3), die Ruhepausen (§ 4) oder die Ruhezeit (§ 5) verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 DM geahndet werden. Gemäß § 23 ArbZG wird mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, wer als Arbeitg eber eine derartige Ordnungswidrigkeit vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers gefährdet oder beharrlich wiederholt. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 8 Es fragt sich, wen die ordnungswidrigkeitenrechtliche bzw. strafrechtliche Verantwortung trifft. Für die Ärzte unter uns ist von besonderer Bedeutung, ob diese Verantwortlichkeit auch den Chefarzt betrifft. Diese Frage ist anhand von § 14 Abs. 2 StGB zu beantworten. Diese Bestimmung, zu der es eine Parallelbestimmung in § 9 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) gibt, lautet wie folgt: „Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten 1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebes obliegen, und handelt er aufgrund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Merkmale die Strafbarkeit begründen, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen.“ Hinsichtlich einer straf-- oder ordnungswidrigkeitenrechtlichen Verantwortlichkeit der Chefärzte ist das Eingreifen von § 14 Abs. 2 Nr. 2 denkbar. Zahlreiche Chefarztverträge enthalten eine Bestimmung, wonach der Chefarzt für die Organisation des Bereitschaftsdienstes und der Rufbereitschaft sowie für die Diensteinteilung seiner ärztlichen Mitarbeiter verantwortlich ist. Allerdings hat der Chefarzt in der Regel keinerlei Bestimmungsrecht über den Stellenplan und keine Disziplinarbefugnis. Es ist in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, daß der Chefarzt nach Auffassung des Gesetzgebers des ArbZG kein leitender Angestellter ist, wie sich aus § 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG ergibt. Nach dieser Vorschrift gilt das ArbZG nicht für leitende Angestellte und Chefärzte; es handelt sich um die einzige gesetzliche Bestimmung unserer Rechtsordnung, in der der Begriff „Chefarzt“ verwendet wird. In den meisten Landeskrankenhausgesetzen wird schlicht vom „Abteilungsarzt“ gesprochen. Ein interessantes rechtliches Problem stellt die Frage dar, ob §§ 22, 23 ArbZG auch dann eingreift, wenn durch eine tarifliche Regelung (z. B. BAT) diejenigen Bestimmungen verdrängt werden, deren Nichteinhaltung den Ordnungswidrigkeiten- bzw. Straftatbestand darstellen. Ist in diesen Fällen eine Ordnungswidrigkeiten- bzw. strafrechtliche Verantwortung bei Verletzung des Tarifvertrages gegeben? Dies könnte gegen den Grundsatz „nulla pöna sine lege“ verstoßen, da es sich bei der im konkreten Fall verletzten Norm nicht um ein Gesetz handelt. Nach meinen Dafürhalten sind §§ 22, 23 ArbZG i.V.m. mit den Einzeltatbeständen als Straftatbestand bzw. Ordnungswidrigkeitentatbestand so zu lesen, daß derjenige rechtswidrig handelt, der §§ 22, 23 ArbZG i.V.m. der Einzelnorm erfüllt, wenn er nicht gem. §§ 7 oder 25 ArbZG im Rahmen eines Tarifvertrages handelt. Die Einhaltung eines das ArbZG verdrängenden Tarifvertrages bedeutet rechtsdogmatisch ein Rechtfertigungsgrund oder man könnte die Nichteinhaltung eines an sich einschlägigen Tarifvertrages als negatives Tatbestandsmerkmal ansehen. III. Auswirkungen auf zivilrechtliche Haftung Es erscheint zweifelhaft, ob das ArbZG einen direkten Einfluß auf die zivilrechtliche Haftung von Ärzten und Krankenhausträgern haben wird. Bereits nach der bisherigen Rechtssprechung konnte eine personelle Unterversorgung, die den erreichbaren medizinischen Standard einer sorgfältigen fachärztlichen Behandlung des Patienten gefährdet, kann bei Verwirklichung dieser Gefahr zu einer Haftung des Krankenhausträgers führen (BGHZ 95, 63). Es ist Aufgabe des Krankenhausträgers, organisatorisch zu gewährleisten, daß er mit dem vorhandenen ärztlichen Personal seine Aufgaben auch erfüllen kann, und zwar nicht nur durch ausreichend erfahrene und geübte Operateure, sondern auch durch Ärzte, die im Einzelfall mit der erforderlichen Konzentration und Sorgfalt operieren können. Deshalb dürfen Ärzte nicht zur Operation herangezogen werden, die durch einen vorhergehenden anstrengenden Nachtdienst übermüdet und deshalb nicht mehr voll einsatzfähig sind (BGH NJW 1986, 776). Die Beurteilung der Frage, ob noch eine genügende Einsatzkraft besteht, darf nicht dem Arzt selbst überlassen bleiben. Sie gehört zu den Organisations- und überwachungspflichten, die das Krankenhaus durch seine Chefärzte wahrzunehmen hat. Bereits nach der bisherigen Rechtsprechung durfte also ein übermüdeter Arzt nicht zu Operationen etc. eingesetzt werden. Entscheidend ist dabei die tatsächliche Müdigkeit und die jeweils konkrete Leistungsfähigkeit des einzelnen Arztes. Daran wird sich auch durch das ArbZG nichts ändern. Dies ergibt sich bereits aus dem in § 1 dargestellten Zweck des Gesetzes, welcher darin besteht, - die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie - den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. Daneben kann unterstellt werden, daß arbeitsmarktlenkende Hintergründe ebenfalls eine Rolle spielten. Ein derartig ausgerichtetes Gesetz kann jedoch nicht die Grundlage für haftungsrechtliche Regelungen dem Patienten gegenüber bilden. Unser Thema lautet: „Das Arbeitszeitrecht im Spannungsfeld zwischen Patientenversorgung, Kostenbegrenzung und Haftungsrecht.“ Für zusätzliche Spannung und Spannungen im Krankenhaus hat das ArbZG sicherlich gesorgt, Probleme sind hinzugekommen, ob das ArbZG jedoch zu mehr Kultur im Krankenhaus geführt hat, mag zweifelhaft erscheinen. In der Diskussion werden in erster Linie Fragen des Ruf- und Bereitschaftsdienstes sowie haftungsrechtliche Fragen angesprochen. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 9 2. Thema: BGH-Urteil vom 14. November 1995 (VI ZR 359/94) über Myelographieschäden (Aufklärung) aus ärztlicher Sicht: Prof. Dr. D. Böker, Giessen Falldarstellung: Zur Einleitung möchte ich kurz die Abläufe darstellen, die letztendlich zu dem unter dem Aktenzeichen VI ZR 359/94 am 14. November 1995 verkündeten Urteil des Bundesgerichtshofes geführt haben. Die Klägerin erhebt Ansprüche wegen angeblicher unzureichender Aufklärung über die Risiken einer bei ihr vorgenommenen lumbalen Myelographie. Ich habe das folgende dem Krankenblatt der Neurologischen Klinik der Universität Giessen entnommen. Die zum Zeitpunkt der stationären Behandlung 53-jährige Frau litt seit ca. 10 Jahren unter Rückenschmerzen, die im Laufe des Vormittags in beide Beine auszustrahlen begannen, dann anhaltend waren. Die Beschwerden wurden durch Belastungen verstärkt. Sie habe ein Gefühl „schwerer Beine“. Hinlegen führe zur Besserung der Beschwerden, so daß auch die Nachtruhe nicht gestört war. Seit gleichfalls etwa 10 Jahren bestünde eine Blasenentleerungsstörung mit wechselnd ausgeprägter Inkontinenz, aber zeitlicher Bindung: Die Beschwerden seien am Vormittag besonders ausgeprägt, so daß es - durch Husten, Niesen oder Pressen verstärkt - zu unwillkürlichem Harnabgang komme. Sie wage sich deswegen vormittags nicht mehr aus dem Haus. Vor 2 Jahren sei es zu einem Monate anhaltenden Zustand mit Taubheitsgefühl und Kribbeln aller 4 Extremitäten gekommen, verbunden mit Störungen der Feinmotorik der Hände. Diese Beschwerden haben sich spontan wieder verloren. 14 Tage vor stationärer Aufnahme seien akut Schmerzen am ganzen Körper aufgetreten, die vom Rücken her gekommen seien. Sie habe weder stehen noch gehen können. Gleichwohl war sie in der Lage, ohne Hilfe die Toilette aufzusuchen. Dieser Zustand habe zwei Tage angedauert. Zum Zeitpunkt der Aufnahmeuntersuchung (8.2.90) werden Schmerzen, Gefühlsstörungen in den Armen verneint. Dagegen werden weiter täglich auftretende Schmerzen in den Beinen beklagt. Wegen der Beschwerden war bereits 1989 eine Kernspintomographie durchgeführt worden, die in Höhe des 2. Brustwirbelkörpers eine kleine signalintensive Struktur nachgewiesen hatte, also den Verdacht auf das Vorliegen eines Tumors nahelegte. Der neurologische Untersuchungsbefund war ohne wesentliche Auffälligkeiten. Die dabei beschriebene Schmerzaustrahlung in die Beine entsprach etwa den Dermatomen S1. Aus der allgemeinen Vorgeschichte sind eine gynäkologische Operation 1974 mit „Blasenfixierung“ und 1986 eine „Blasenplastik“ erwähnenswert. Seit 3 Jahren wurde die Patientin mit einem Antidepressivum behandelt, seit 3 Monaten noch mit einem zweiten. Röntgenaufnahmen der Lendenwirbelsäule am 14.2.90 hatten eine Verschiebung des 5. Lendenwirbels gegenüber dem Kreuzbein um ca. 1 cm ergeben im Sinne einer (Pseudo-)Spondylolisthesis. Eine Kernspintomographie am 19.2.90 zeigte den bekannten Vorbefund in Höhe BWK 2 unverändert. Daneben „ausgeprägte Spondylochondrose L5/S1“ und „Nachweis einer dezenten Gefügestörung mit geringem Vertralversatz von L5 gegen S1“. Am 20.2.90 wird die Patientin laut Krankenblatteintrag über die Notwendigkeit einer Myelographie zur weiteren Abklärung der Beschwerden informiert und über die Untersuchung „eingehend aufgeklärt“. Nach erneuter Aufklärung über die vorgesehene Untersuchung durch die Neuroradiologen wurde die Untersuchung am 21.2.90 in der Zeit von 12.30 bis 14.00 Uhr durchgeführt. Wörtliches Zitat aus dem Untersuchungsprotokoll: „Nach Aufklärung der Patientin erfolgte die lumbale Punktion im Sitzen ...“ Laut einem Schreiben der Rechtsabteilung der Universität im weiteren Verlauf der rechtlichen Auseinandersetzung wurde die Patientin über „Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Möglichkeiten der Kontrastmittelallergie und Infektion“ aufgeklärt. „Angesprochen wurden aber ebenfalls Bewußtseinsstörungen, zu denen grundsätzlich auch epileptische Anfälle zu zählen sind“ (Wörtliches Zitat). Gemäß einem von einem Oberarzt der Neurologischen Klinik verfaßten Protokoll wurde die Patientin vor der Myelographie „von dem durchführenden Arzt über die möglichen Komplikationen, insbesondere auch das Auftreten epileptischer Anfälle und neurologischer Herdsymptome informiert“. Die Untersuchung selbst verlief komplikationslos. Zur weiteren Abklärung wurde anschließend eine Computertomographie durchgeführt, die gegen 15.00 Uhr beendet war. Kurz vor Beginn des Rücktransportes der Patientin, die bereits auf der Trage des Transportfahrzeuges lag, erlitt sie einen generalisierten Krampfanfall. Dabei sei sie nicht von der Trage gestürzt. Bei der unmittelbar nach Eintreffen in der Neurologischen Klinik anschließenden neurologischen Untersuchung (gg 16.00 Uhr) wurde eine sensorische Blindheit und eine kortikale Blindheit festgestellt, die sich bis zum Folgetag vollständig zurückbildeten. Die Patientin klagte über heftige Schmerzen im Bereich des rechten Schultergelenks. Eine Röntgenuntersuchung führte zum Nachweis einer subkapitalen Humerusfraktur mit Luxation des Humeruskopfes. Die operative Versorgung erfolgte noch am selben Abend. Dabei ließ sich eine Reposition des in mehrere Fragmente zerbrochenen Oberarmkopfes nicht erreichen, so daß dieser schließlich entfernt wurde. Nach Entfernung des Oberarmkopfes resultierte eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung des Schultergelenkes und eine auch elektromyographisch nachgewiesene neurogene Schädigung mehrerer vom oberen Armplexus versorgter Muskeln. Soweit die Darstellung des Falls. Da sich die Klage der Patientin letztlich gegen unzureichende Aufklärung über die Risiken einer Myelographie richtet, möchte ich jetzt noch eine kurze Übersicht über Komplikationsmöglichkeiten und - soweit dies der Literatur zu entnehmen Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 10 ist - Komplikationshäufigkeiten bei Myelographien geben. Dabei erscheint es nicht sinnvoll, die „Myelographie“ pauschal zu betrachten. Komplikationsmöglichkeiten sind bei dieser Untersuchung durch 1. Lokalanästhesie 2. Lumbalpunktion 3. Kontrastmittelinstillation gegeben. Es ist durchaus vorstellbar, daß z. B. eine Lokalanästhesie zu tief appliziert und das Medikament unmittelbar an oder in den Durasack injiziert wird. Mitteilungen über dadurch bedingte Komplikationen liegen in der Literatur nicht vor. Denkbar wären vorübergehende „Querschnittssyndrome“, wie sie im Rahmen einer Spinalanästhesie gewolltermaßen auftreten. Auch Mitteilungen, die zwischen Nebenwirkungen der bloßen Punktion des Liquorraums und denen der Kontrastmittelinstillation unterscheiden, fehlen in der Literatur. Die bekannten Nebenwirkungen bzw. Risiken der Lumbalpunktion bestehen in selten auftretenden entzündlichen Komplikationen seitens der Rückenmarkshäute, sei es als bloßer meningealer Reiz oder äußerst selten auch bis zur manifesten Meningitis. Häufiger sind Kopfschmerzen, die wohl in der Regel auf die Störung der intrakraniellen Druckverhältnisse zurückzuführen sind. Hierbei wäre das Ausmaß des Liquorverlustes zu berücksichtigen, der unter anderem von der Beschaffenheit und dem Schliff der zur Punktion verwendeten Nadel abhängt. Informationen hierzu fehlen in der Literatur betreffend Myelographie-Komplikationen völlig. Die postmyelographisch häufig beobachteten Kopfschmerzen werden also in der Regel auf die Tatsache der Punktion des Liquorraumes zurückzuführen sein. Andere, ernster zu nehmende Nebenwirkungen oder Komplikationen dagegen dürfen eher durch die Kontrastmitteleingabe bedingt sein. Sie sollten getrennt betrachtet werden. Dabei dürfen die alten, seit mehr als 20 Jahren nicht mehr verwendeten öligen Kontrastmittel außer Acht gelassen werden. Er erscheint mir auch gerechtfertigt, die ersten wasserlöslichen ionischen jodhaltigen Kontrastmittel, wie z. B. Dimer X, auszunehmen. Dieses Kontrastmittel war ohnehin nur zur lumbalen Myelographie zugelassen und wird gleichfalls seit etwa 20 Jahren nicht mehr verwendet. Die zur Myelographie des gesamten Spinalkanals zugelassenen wasserlöslichen, nicht ionischen Kontrastmittel zeichnen sich generell durch eine wesentliche bessere Verträglichkeit aus. Eben deswegen sind sie ja auch für die breitere Anwendung zugelassen worden. In weitverbreiteten neurologischen oder neurochirurgischen Lehrbüchern finden sich zu Risiken der Myelographie folgende Angaben: So schreibt SCHEID in seinem LEHRBUCH DER NEUROLOGIE 1980, daß bei Beachtung bestimmter Verhaltensweisen nach Myelographie mit jodhaltigen Kontrastmitteln in wäßriger Lösung nennenswerte Komplikationen oder Beschwerden nicht auftreten. In der „Klinischen Neurochirurgie“ von DIETZ, UMBACH und WÜLLENWEBER, erschienen 1982, heißt es zur „Myelographie mit wasserlöslichen Kontrastmitteln“, daß selten ernste Komplikationen wie epileptische Anfälle, Verwirrtheitszustände, Halluzinationen und Aphasien auftreten. „Diese sind vorübergehend.“ In dem 6-bändigen Werk „NEUROLOGICAL SURGERY“ von Youmans heißt es speziell zu dem nicht-ionischen wasserlöslichen Kontrastmittel Metrizamid, daß einzelne Berichte über Krampfanfälle vorliegen, die auf Interaktionen mit bestimmten Medikamenten zurückgeführt werden. Weitere wesentliche Komplikationen werden nicht genannt. Ich habe zur weiteren Klärung der Frage der Komplikationen und ihrer Häufigkeit eine Literaturrecherche für die Jahre 1977 bis 1993 durchgeführt. Die dabei gefundenen Daten möchte ich Ihnen noch kurz darstellen. Das älteste der modernen nicht-ionischen Kontrastmittel ist Metrizamid, das wegen Entwicklung neuer, besser verträglicher Substanzen schon seit Jahren wieder vom Markt genommen worden ist, meines Wissens schon 1990, als die „inkriminierte“ Myelographie stattfand, nicht mehr zur Verfügung stand. Ich habe in der Literatur Berichte über insgesamt rund 10.000 Myelographien mit Metrazamid gefunden, in denen auch zu Komplikationen Stellung genommen wird. Dabei hat sich ergeben, daß epileptische Anfälle nach rund 0,16 % der Myelographien beobachtet wurden, in 0,1 % wurden Halluzinationen beschrieben, vorübergehende Störungen der Blasenentleerung in 0,5 %, Taubheitsgefühle und Mißempfindungen in 0,1 %. Interessanterweise werden bei Diabetikern Komplikationen der beschriebenen Art rund 10mal häufiger beobachtet. Einzelfallberichte betreffen beidseitige subcorticale Blutungen, einen Fall mit passagerer Hemiparese und Aphasie sowie einen Patienten, der mehrere epileptische Anfälle erlitt. Eine Mitteilung über eine Querschnittslähmung habe ich nicht finden können. In der Literatur über gut 2.000 Myelographien mit Iohexol finden sich Angaben auch zu Kopfschmerzen, die in rund 25 % der Fälle beobachtet werden. Sie sind sicherlich eher auf die Tatsache der Lumbalpunktion zurückzuführen. Einzelfallberichte betreffen wieder epileptische Anfälle, eine intracerebrale Blutung und eine Psychose nach Myelographie. Auch zu diesem Kontrastmittel keine Mitteilung hinsichtlich Querschnittslähmung. Das auch heute noch weitestverbreitete Kontrastmittel für Myelographien ist Iopamidol. Es ist auch bei der fraglichen Myelographie verwendet worden. In der Literatur betreffend rund 5.000 Myelographien finden sich Angaben über epileptische Anfälle in 0,04 %, Augenmuskellähmungen werden in 0,1 % beschrieben. Einzelfallmitteilungen betreffen wiederum einen epileptischen Anfall und einmal eine Halbseitenlähmung bei dopplersonographisch nachgewiesenen Gefäßspasmen. Keine Mitteilung einer Querschnittslähmung. Zusammengenommen finden sich in der Literatur Mitteilungen über rund 18.000 Myelographien mit den drei genannten Kontrastmitteln, bei denen epileptische Anfälle in 0,1 % der Fälle aufgetreten sind, Halluzinationen in 0,07 %, Augenmuskellähmungen in 0,03 %. Nimmt man die Einzelfallbeschreibungen, in denen die Größe der Serie aus der sie stammen, nicht angegeben ist, mit hinzu, ändern sich die Zahlen nur unwesentlich. Lediglich Halluzinationen und psychotische Reaktionen finden sich dann in einer Häufigkeit von 0,3 %, wobei diese in der Bezugsarbeit als „altered mental status“ bezeichnet wurden, was immer das genau sein mag. Abschließend möchte ich noch einige Komplikationen erwähnen, die in Einzelfallbeschreibungen ohne Angabe des Kontrastmittels beschrieben worden sind. Es handelt sich dabei um 9 Fälle von Hörminderung, 6mal davon vorübergehend. Bei einem AIDS-Patienten trat ein subdurales Hämatom auf. Einmal wurde eine operativ versorgungsbedürftige Liquorfistel beschrieben. Bei einer Patientin mit einem Mammacarcinom war der N.phrenicus, der das Zwerchfell innerviert, tumorinfiltriert. Es kam bei der Myelographie zu einer tödlichen Atemlähmung. Die Phrenicusschädigung wurde erst autopisch festgestellt. In einigen Fällen wurden sämtlich vorübergehende AUgenmuskellähmungen beschrieben. Ich habe in der gesamten Literatur des Zeitraums 1977 - 1993 drei Fälle einer Querschnittslähmung im Zusammenhang mit einer Myelographie gefunden. Bei einem Patienten handelte es sich um einen perforierten thorakalen Bandscheibenvorfall, der operiert wurde, worauf die Lähmung sich zurückbildete. Eine aus den USA stammende Mitteilung betrifft das Kontrastmittel Iophendylat, das mehreren von mir befragten Neuroradiologen unbekannt war. Einer war der Ansicht, daß es sich dabei um eines der ganz alten öligen Kontrastmittel handele, das ohnehin nicht mehr verwendet wird. Die dritte Querschnittslähmung trat nach einer Myelographie mit dem gleichfalls seit rund 20 Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 11 Jahren nicht mehr verwendeten Mittel Dimer X auf, so daß zusammenfassend ich nicht einen einzigen Fall von Querschnittslähmung habe finden können, der nach Myelographie mit den heute gebräuchlichen Kontrastmitteln aufgetreten wäre. Diskussionsbemerkung: Prof. Dr. Schreiber faßt aus juristischer Sicht zusammen: Das Gericht sah es zwar nicht als notwendig an, daß über mögliche Schäden durch einen generalisierten Krampfanfall aufgeklärt wird - da aber im Aufklärungsgespräch nicht die Möglichkeit einer Querschnittslähmung erwähnt worden sei, müsse eine Haftung auch für jeden anderen schweren Schaden übernommen werden, auch wenn dieser selbst nicht aufklärungspflichtig ist. Dr. Steffen: Es muß nicht in medizinischen Termini detailliert aufgeklärt werden; um aber einen Eindruck von der Schwere eines bevorstehenden Eingriffs zu vermitteln, müssen alle spezifischen Risiken genannt werden. 3. Thema: Neuregelung der strafrechtlichen Behandlung der ärztlichen Tätigkeit Referat: Prof. Dr. H. L. Schreiber, Göttingen Prof. Schreiber stellt den aktuellen Entwurf des Bundesministeriums der Justiz zur strafrechtlichen Behandlung ärztlicher Tätigkeit vor: „§ 229 Eigenmächtige Heilbehandlung (1) Wer ohne wirksame Einwilligung bei einer anderen Person einen körperlichen Eingriff oder eine andere deren körperliche Integrität oder deren Gesundheitszustand nicht nur unwesentlich beeinflussende Behandlung vornimmt, um bei ihr oder ihrer Leibesfrucht vorhandene oder künftige körperliche oder seelische Krankheiten, Schäden, Leiden, Beschwerden oder Störungen zu erkennen, zu heilen, zu lindern oder ihnen vorzubeugen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. § 226 gilt sinngemäß. (2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Behandlung 1. der Erprobung einer neuen Behandlungsmethode dient, ohne daß dies im Interesse der behandelten Person oder ihrer Leibesfrucht geboten ist, oder 2. unter Abwägung des mit ihr verfolgten Zwecks und einer mit ihr für die behandelte Person verbundenen Gefährdung nicht verantwortet werden kann. (3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß 1. sie unter den in Absatz 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen begangen ist oder 2. die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. Stirbt die verletzte Person, so geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über. § 230 Fehlerhafte Heilbehandlung (1) Wer fahrlässig durch einen Behandlungsfehler eine andere Person im Rahmen einer den in § 229 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Zwecken dienenden Behandlung an ihrer Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) § 229 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 gilt entsprechend.“ 4. Thema: Rechtliche Fragen der Fortpflanzungsmedizin aus ärztlicher Sicht: Prof. Dr. K. H. Wulf, Würzburg und PD Dr. T. Steck, Würzburg Historische Entwicklung: Seit der Geburt des ersten „Retortenbabys“ weltweit 1978 in Cambridge und in Deutschland 1981 in Erlangen hat die Behandlung der extrakorporalen Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, IVF) eine große weltweite Verbreitung erfahren. Weltweit dürften heute etwa 200.000 Kinder ihre Existenz der IVF verdanken. In Deutschland wurden allein im Jahre 1995 mehr als 6.000 Schwangerschaften durch eine IVF induziert. Damit ist diese Therapie zu einem der Standardverfahren in der Frauenheilkunde geworden. Öffentliche Meinung: Im gewissen Gegensatz hierzu steht die öffentliche Meinung in Deutschland, die geprägt ist von einer Haltung des Mißtrauens und einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber der fortschreitenden Technisierung der assistierten Reproduktion. Die enorme psychische Belastung der Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 12 betroffenen Paare und das häufige Ausbleiben des gewünschten Erfolges führen verständlicherweise zu einer kritischen Einstellung gegenüber diesen Behandlungsverfahren. Diese Diskussion wird durch die aktuellen Finanzprobleme innerhalb des Gesundheitswesens noch verstärkt. Standardmethoden der Fertilitätsbehandlung: Zu den Standardmethoden der Fertilitätsbehandlung zählt zunächst die Ovulationsauslösung bei Zyklusdefekten, die von jedem Frauenarzt durchgeführt werden darf. Bei schlechter Spermaqualität wird diese kombiniert mit einer sogenannten homologen Insemination in Uterus oder Tube, gewissermaßen ein künstlicher Weg zu einer natürlichen Befruchtung. Die extrakorporale Befruchtung im eigentlichen Sinne ist an das Vorliegen bestimmter Indikationen geknüpft, sie darf nach § 27 a SGB V nur bei Ehepaaren und nach § 121 a SGB V nur von einem durch die zuständige Landesbehörde zugelassenen Zentrum durchgeführt werden, von denen es in Deutschland derzeit etwa 75 gibt. Nach § 27 a SGB V ist die Zahl der Behandlungsversuche in der Regel auf vier begrenzt. Beim intratubaren Transfer der Gameten (GIFT) oder Zygoten (ZIFT) werden entweder Eizellen und Spermien zusammen oder befruchtete Eizellen in die Eileiter transferiert. Bei der Mikromanipulation der Gameten in Form der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) wird bei extrem eingeschränkter Spermaqualität ein Spermium in das Ooplasma injiziert. Die ICSI wurde im Jahre 1995 an etwa 45 Zentren praktiziert. Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Verfahren fällt sie nicht in den derzeitigen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Über Art, Umgang und ErfoIge der Behandlungen haben die zugelassenen Zentren am Ende jedes Jahres eine Meldung an die zuständige Landesärztekammer abzugeben. Weitere Methoden der Fertilitätsbehandlung (keine Standardverfahren): Bei der heterologen Insemination (Denorinsemination, Samenspende) handelt es sich um ein erlaubtes Verfahren, das aufgrund der Problematik (z. B. Belastung der Partnerschaft, Identifikation des danach geborenen Kindes mit seinen Eltern, Recht des Kindes auf Kenntnis seines biologischen Vaters) zu Recht nicht in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen fällt. Jedoch stellt die Samenspende bei bestimmten Formen männlicher Unfruchtbarkeit die einzige realistische Alternative auf den Eintritt einer Schwangerschaft dar. Bei der Kryokonservierung von Spermien können diese über mehrere Jahre aufbewahrt werden. Dieses Verfahren kommt etwa vor einer geplanten Chemotherapie oder Bestrahlung, wenn dadurch mit einer Verschlechterung der Fertilität zu rechnen ist, zur Anwendung. Auch befruchtete Eizellen, die im Rahmen einer IVF entstehen, können kryokonserviert werden, wenn sie entweder überzählig sind (da nach dem Embryonenschutzgesetz nur maximal drei Embryonen zurückgesetzt werden dürfen) oder wenn von Seiten des Paares ausdrücklich der Transfer in einem späteren Zyklus gewünscht wird, um im IVF-Zyklus das Mehrlingsrisiko zu reduzieren. Die Kryokonservierung zählt nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Die Präimplantationsdiagnostik erlaubt die Feststellung genetischer Erkrankungen am Embryo, wodurch erkrankte Embryonen vom Transfer ausgeschlossen und somit die spätere Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches umgangen werden kann. Nach den vorliegenden Informationen befindet sich die Präimplantationsdiagnostik noch an keinem deutschen IVF-Zentrum in routinemäßiger Anwendung. Jedoch wird sie an einigen europäischen und außereuropäischen Instituten durchgeführt und es ist zu erwarten, daß sie in naher Zukunft auch in Deutschland eine gewisse Verbreitung erfahren wird. Die Gründe, die bislang eine Verbreitung dieser Technik verhindert haben, liegen wohl, neben den rechtlichen Aspekten, zum einen in der Seltenheit vieler genetischer Erkrankungen begründet, wodurch es einem einzelnen Zentrum schwerfällt, genügend große Erfahrungen mit der Methode zu sammeln, zum anderen in der technischen Schwierigkeit, aufgrund der Analyse einer einzigen embryonalen Zelle (Blastomere) eine verläßliche Diagnose zu stellen. Ablauf des intratubaren Gametentransfers (GIFT): Eine Stimulation des Zyklus zur Induktion mehrerer Follikel ist obligatorisch. Unmittelbar vor der medikamentös ausgelösten Ovulation werden die Follikel abgesaugt, die Eizellen gewonnen und maximal drei Eizellen zusammen mit den gewaschenen Spermien in eine Tube zurückgesetzt. Dieser Transfer kann entweder über eine Laparoskopie (Originalmethode) oder transvaginal erfolgen. Es handelt sich somit nicht um eine extra-, sondern um eine assistierte intrakorporale Befruchtung. Die Methode besaß Ende der 1980er Jahre eine gewisse Popularität, jedoch stagniert das Behandlungsvolumen seither. Die Zahl der im Jahre 1995 in Deutschland durchgeführten Zyklen betrug weniger als 1/10 der IVF-Zyklen. Die Gründe für diesen relativen Rückgang der GIFT-Behandlung liegen im gegenüber IVF erhöhten Risiko von Mehrlingen begründet, zum anderen auch in der Tatsache, daß bei vielen Indikationen (z. B. Tubenschäden, stark eingeschränkte Spermaqualität ) ein GIFT nicht praktikabel erscheint. Ablauf der extrakorporalen Befruchtung (IVF): Eine ovarielle Stimulation wird heute meist mit gonadotropen Hormonen durchgeführt, womit bewußt die Ausreifung zahlreicher Follikel induziert wird (polyfollikuläre Entwicklung). Nach Auslösung der Ovulation werden die Follikel in der Regel von der Vagina aus sonographisch gesteuert abpunktiert (Follikelpunktion, entweder in Vollnarkose oder in Lokalanästhesie) und aus dem Punktat die reifen Oozyten aufgesucht. Die Zahl der entnommenen Eizellen orientiert sich an der Spermaqualität und der zu erwartenden Befruchtungsrate (bei normaler Spermaqualität 70 - 80 %) sowie an der Höchstzahl von drei Embryonen, die pro Zyklus transferiert werden dürfen. Bei der konventionellen IVF wird jede reife Eizelle mit mehreren 100.000 motilen Spermien inseminiert und sodann in der Regel 48 Stunden unter streng kontrollierten Bedingungen in Kultur gehalten (Embryonenkultur). Das Ausbilden des weiblichen und männlichen Vorkerns ist nach etwa 18 - 24 Stunden zu erkennen. Etwa 40 Stunden nach der Befruchtung beginnt die Teilung der Embryonen. Der Embryotransfer erfolgt überlicherweise im Zwei- bis Achtzellstadium intrauterin in einem geringen Volumen (20 - 50 µ l) in einem weichen Plastikkatheter. Nach dem Transfer wird die Lutealphase überlicherweise hormonell unterstützt und nach 14 Tagen der Eintritt oder das Ausbleiben einer Schwangerschaft durch Bestimmung des ß-HCG im Serum festgestellt. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 13 Deutsches IVF-Zentralregister: Auf freiwilliger Basis melden die in Deutschland zugelassenen Zentren ihre Behandlungsdaten anonymisiert an ein Zentralregister, aus dessen Zahlen sich sowohl die Entwicklung im Verlauf der letzten Jahre, als auch die Befruchtungs-, Schwangerschafts-, Mehrlings- und Komplikationsraten ablesen lassen. Das IVF-Register erlaubt somit einen guten Überblick über die aktuelle Behandlungssituation in Deutschland. Im Jahre 1995 wurden von den insgesamt 80 zugelassenen Zentren 65 verwertbare Registermeldungen abgegeben, wobei die Zahl der zugelassenen Zentren während der letzten Jahre kontinuierlich zunahm. Gemeldet wurden 18.731 Behandlungszyklen einer IVF, 1.269 Zyklen eines GIFT bzw. ZIFT sowie 13.598 Zyklen einer IVF mit Mikromanipulation (ICSI). Die enorme Zahl von über 32.000 Behandlungsuzyklen IVF ohne oder mit ICSI unterstreicht die Verbreitung der Methode und die Akzeptanz, die die inzwischen bei den betroffenen Paaren gefunden hat. Damit ist die Follikelpunktion für IVF zu einem alltäglichen Eingriff in der frauenärztlichen Praxis und Klinik geworden. Die Schwangerschaftsrate betrug während der letzten Jahre relativ konstant rund 25 % pro Embryotransfer, ebenfalls mit einer ansteigenden Tendenz seit Mitte der 1980er Jahre. 3.515 Schwangerschaften allein nach konventioneller IVF wurden im Jahre 1995 registriert gegenüber 2.896 im Jahre 1994, ebenfalls mit einer steigenden Tendenz mit Ausnahme der Jahre 1989 und 1990, als die IVFBehandlung nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gehörte und es aufgrund der fehlenden Kostenerstattung sowohl zu einem Rückgang der Behandlungszyklen als auch der eingetretenen Schwangerschaften um etwa ein Viertel kam. Aufgrund dieser Erfahrung läßt sich prognostizieren, daß im Falle einer zukünftigen Streichung der IVF-Behandlung als Kassenleistung - wie sie in der öffentlichen Diskussion gelegentlich gefordert wird - mit einem Rückgang der nach IVF und verwandten Verfahren geborenen Kinder um ebenfalls etwa ein Viertel, also rund 1.000 Kinder, kommen dürfte. Nach Abzug der vorzeitig, als Abort oder als Tubargravidität endenden Schwangerschaften nach IVF, betrug die Rate an weiterführenden Schwangerschaften (> 20 SSW) rund 20 %. Da jenseits der 20. SSW das Abortrisiko verschwindend gering ist, entspricht diese Rate nahezu der sog. „baby take home rate“. Diese Zahlen sind im internationalen Vergleich als hervorragend zu bezeichnen, was den hohen Standard, den die IVF-Behandlung in Deutschland mittlerweile erreicht hat, eindrücklich unterstreicht. Mehrlingsrate nach IVF: Bei den weiterführenden Schwangerschaften (> 20 SSW) nach IVF waren im Jahre 1995 die Mehrzahl, nämlich 68 % Einlinge, von den übrigen verliefen die meisten (24,5 %) als Zwillinge. Höhere Mehrlinge als Drillinge wurden bei den Schwangerschaften nach konventioneller IVF überhaupt nicht, bei den Schwangerschaften nach IVF und ICSI nur in einem Fall beobachtet. Generell ist die Entstehung von Mehrlingsschwangerschaften aufgrund der Häufung geburtshilflicher Komplikationen wie Frügeburten und Präeklampsien unerwünscht. Die im Embryonenschutzgesetz enthaltene Limitierung der Zahl zurückgesetzter Embryonen auf maximal drei hat sich somit als geeignet erwiesen, die Entstehung höhergradiger Mehrlingsschwangerschaften möglichst zu verhindern. Manche Zentren gehen sogar dazu über, bei jungen Frauen mit einem statistisch erhöhten Mehrlingsrisiko nach Absprache die Zahl der zurückgesetzten Embryonen weiter (etwa auf zwei) zu begrenzen. IVF-Ergebnisse in Abhängigkeit vom Alter der Frau: Aus den Zahlen des IVF-Registers für 1995 geht eine eindeutige inverse Abhängigkeit der Schwangerschaftsrate pro Zyklus und pro Transfer vom Alter der Frau hervor. In der Altersgruppe > 39 Jahre war diese Rate nur etwa halb so hoch (12,9 %) als bei Frauen < 30 (25,1 %). Diese Abnahme entspricht auch dem Absinken der natürlichen Fruchtbarkeit der Frau mit fortschreitendem Alter. Es erscheint dennoch fragwürdig, eine Altersgrenze von 40 Jahren zu definieren, bei deren Überschreitung eine IVF nur noch in Ausnahmefällen in Betracht kommt (siehe Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen vom 14.08.1990 über künstliche Befruchtung), da auch eine 40-jährige Frau in Abhängigkeit von weiteren individuellen Prognosekriterien noch eine Chance von 10 - 15 % auf den Eintritt einer Schwangerschaft nach IVF besitzt. Kumulierte Schwangerschaftsrate nach IVF: Aus den Zahlen des IVF-Registers für 1995 ergibt sich weiterhin eine Abhängigkeit des Therapieerfolges von der Zahl der bereits zuvor durchgeführten Behandlungsversuche. Einer durchschnittlichen Schwangerschaftsrate von 21,3 % im ersten IVF-Zyklus steht eine solche von 18,3 im vierten Zyklus (nach drei erfolglosen Behandlungsversuchen) gegenüber. Allerdings ergab sich auch im siebten und weiteren IVF-Versuch noch eine statistische Aussicht auf eine Schwangerschaft von 12,5 %. Die kumulierte Schwangerschaftsrate in allen Zyklen betrug 75,5 %. Aufgrund dieser Zahlen ist die Begrenzung der Leistungspficht der gesetzlichen Krankenkassen nach § 27 a SGB V auf maximal vier Versuche sachlich nicht zu begründen. Im Gegenteil, die Chance auf den Erfolg steigt mit jedem unternommenen Versuch. Die tägliche Erfahrung mit der IVF zeigt, daß häufig gerade die Paare zu einer Schwangerschaft kommen, die die Behandlung hartnäckig weiterverfolgen und nicht die Therapie nach einem oder zwei erfolglosen Versuchen beenden. Komplikationen der IVF und verwandter Verfahren: Hier sind zunächst Komplikationen bei der Eizellentnahme zu nennen, wie Infektionen, Nachblutungen oder Verletzungen von Nachbarorganen der Ovarien. Diese Ergebnisse sind mit einer Häufigkeit von etwa 1 : 1.000 recht selten. Desweiteren besteht das Risiko einer sog. ovariellen Überstimmulation (Vergrößerung der Ovarien mit Beschwerden und Veränderungen der Gerinnung), die häufig eine Hospitalisierung erforderlich macht, meist jedoch konservativ behandelt werden kann. Für die Vermutung, daß eine Behandlung mit IVF in einem späteren Lebensalter ein erhöhtes Risiko für Mamma- oder Ovarialkarzinome bedingen würde, gibt es bislang keine Belege. Bezogen auf die entstandenen Schwangerschaften können auch die Aborte (15,2 % im Jahre 1995), Tubargraviditäten (4,2 %) und Mehrlinge (siehe oben) als „Komplikationen“ bezeichnet werden. Allerdings übersteigt die Aborthäufigkeit nach IVF nicht das sog. Basisrisiko von 15 - 20 %, dem jede Schwangerschaft unterliegt, so daß die Tatsache, daß eine Schwangerschaft durch eine IVF induziert wurde, wohl kein erhöhtes Abortrisiko bedingen dürfte. Die beobachtete Rate an Tubargraviditäten an IVF liegt ebenfalls nur wenig höher als das Basisrisiko von 1 - 2 %. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 14 Schwangerschafts- und Geburtsverläufe nach IVF und verwandten Verfahren: Nach heutigem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der weltweit verfügbaren großen Kollektive ist bei den nach einer IVF entstandenen Schwangerschaften die Rate an Chromosomenanomalien und Mißbildungen nicht erhöht. Durch diese Feststellung wird ein häufig geäußerter Einwand gegenüber der extrakorporalen Befruchtung zerstreut. Eindeutig erhöht ist dagegen die Rate an Frühgeburten., Wachstumsretadierung und anderen geburtshilflichen Komplikationen, die teilweise der erhöhten Rate an Mehrlingen anzurechnen sind. Umfangreiche Nachuntersuchungen an einer nach IVF geborenen Kindern haben zudem ergeben, daß sich diese Kinder bezüglich ihrer psychosozialen Entwicklung nicht von ihren Altersgenossen unterscheiden. Varianten der Mikromanipulation: Den Techniken der Mikromanipulation der Gameten ist die Absicht gemeinsam, das Eindringen eines Spermiums in die Eizelle aktiv zu unterstützen. Sie kommen nur bei schwersten Einschränkungen der Spermaqualität zur Anwendung. Die früher praktizierten Verfahren der partiellen Zonadissektion (PZD, Durchbohren der Zona pellucida der Eizelle mittels Laser oder mechanisch) und der subzonalen Spermieninjektion (SUZI, Injektion eines Spermiums hinter die Zona pellucida in den perivitellinen Spalt) haben heute nur noch historische Bedeutung angesichts der unbefriedigenden Befruchtungs- und Schwangerschaftsraten, die sich damit erzielen ließen. Durchgesetzt hat sich heute die intrazytoplasmische Spermieninjektion (ICSI), die 1992 und 1993 an der Arbeitsgruppe der Freien Universität Brüssel für die breite klinische Anwendung etabliert wurde. Für die Indikationen, medizinischen und organisatorischen Voraussetzungen wurden von einer Kommission der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Richtlinien erarbeitet. Danach ist eine ICSI indiziert bei schwerer Oligoasthenoteratozoospermie oder nach fehlgeschlagenen Versuchen einer konventionellen IVF ohne Feritilisation. Neben den bereits für eine IVF geforderten Voraussetzungen wird zusätzlich eine genetische Beratung sowie Chromosomenanalyse des männlichen Partners sowie im Bedarfsfall weitere genetische Analysen (Mukoviszidose, Azoospermiefaktor) gefordert. Die ICSI gilt heute als das Therapieverfahren der Wahl bei der Behandlung der schweren männlichen Subfertilität. Eine Untergrenze für die Spermaqualität für ICSI gibt es nicht, wenn wenigstens ein Spermium pro Eizelle zur Verfügung steht. Bei einem völligen Fehlen von Spermien im Ejakulat (Azoospermie) kann auf Spermien aus einer Biopsie des Nebenhodens (MESA) oder des Hodens (TESE) mit vergleichbarer Erfolgsaussicht zurückgegriffen werden. Angesichts der Häufigkeit schwerer andrologischer Einschränkungen unter den Paaren mit ungewollter Kinderlosigkeit ist für die Zukunft mit einer weiteren stetigen Zunahme der ICSI-Behandlung zu rechnen, und kann in vielen Fällen, in denen noch vor einigen Jahren eine Samenspende als die einzige realistische Aussicht auf den Eintritt einer Schwangerschaft erschien, noch die Chance auf ein Kind innerhalb dieser Beziehungen eröffnen. Behandlungsdaten für IVF mit ICSI aus dem deutschen IVF-Zentralregister: Nach den Zahlen des IVF-Zentralregisters wurde eine IVF mit ICSI als Zusatzmaßnahme im Jahre 1995 an 47 Zentren in 13.598 Zyklen durchgeführt, wodurch 2.891 klinische Schwangerschaften induziert wurden. Die Schwangerschaftsrate pro Transfer und die Rate weiterlaufender Schwangerschaften > 20 SSW nach IVF und ICSI waren im Jahre 1995 denen nach konventioneller IVF vergleichbar, mit einer ähnlich hohen Häufigkeit an Mehrlingen. Auch bei den nach Mikromanipulation entstandenen Schwangerschaften wird die Abhängigkeit der Konzeptionsrate von der Zahl der zurückgesetzten Embryonen und dem Alter der Frau erkennbar. Rechtliche Aspekte der Mikromanipulation: Für die IVF mit ICSI gelten die gleichen Bestimmungen wie für eine konventionelle IVF mit der Einschränkung, daß die Zusatzmaßnahme einer ICSI nicht unter die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen fällt. Auf Antrag erklären sich jedoch viele Krankenkassen bereit, als Einzelfallentscheidung die Kosten zu übernehmen. Im Hinblick darauf, daß die ICSI bei schwerer andrologischer Einschränkung heute die Therapie der Wahl darstellt, andere Behandlungsalternativen mit auch nur annähernd vergleichbarer Erfolgsaussicht nicht zur Verfügung stehen und es sich somit bei der ICSI nicht mehr um eine Außenseitermethode handelt, erscheint eine Aufnahme des Verfahrens in den Leistungskatalog der Krankenkassen wünschenswert. Kryokonservierung von imprägnierten Eizellen: Die Kryokonservierung wird heute in Deutschland fast ausschließlich mit befruchteten (imprägnierten) Eizellen durchgeführt, da das Einfrieren von Embryonen nach dem Embryonenschutzgesetz nicht zulässig ist und das Einfrieren von unbefurchteten Eizellen und deren spätere Verwendung für eine IVF zu einer schlechteren Schwangerschaftsrate führt. Überzählige imprägnierte Eizellen können bei einer IVF ohne oder mit ICSI entstehen, wenn sich mehr als drei Eizellen fertilisieren ließen, da aufgrund der Bestimmungen des Embryonenschutzgesetzes nur der Transfer von maximal drei Embryonen pro Zyklus gestattet ist, oder wenn das Paar ausdrücklich einen Transfer von weniger als drei Embryonen wünscht. Die bei - 196 °C tiefgefrorenen imprägnierten Eizellen können dann für einen Transfer in einem späteren Zyklus aufgetaut werden. Das noch nicht zufriedenstellend gelöste Problem bei der Kryokonservierung besteht in der recht hohen Verlustrate von 30 - 40 % der imprägnierten Eizellen, bedingt durch die Dehnung und Schrumpfung des Gewebes während des Einfrierens und Auftauens. Daher ist die Schwangerschaftsrate nach einem Transfer von eingefrorenen und wieder aufgetauten, später weiterentwikkelten Embryonen (Kryotransfer) stets niedriger als die nach einem Transfer „frischer“ Embryonen. Die Kryokonservierung kann somit helfen, die Mehrlingsrate zu reduzieren, und eröffnet zudem ein Paar im Falle einer ausbleibenden Schwangerschaft nach dem Transfer „frischer“ Embryonen noch eine weitere Chance auf Konzeption nach dem Kyrotransfer, ohne daß sich das Paar einem weiteren IVF-Zyklus unterziehen muß. Die Kryokonservierung fällt nicht in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 15 Behandlungsdaten für Kryokonservierung aus dem deutschen IVF-Zentralregister: Im Jahre 1995 meldeten 20 Arbeitsgruppen die Behandlungsergebnisse mit 1.261 Kryotransfers, durch die 162 klinische Schwangerschaften induziert werden konnten (13 % pro Transfer). Die Abortrate war der nach konventioneller IVF vergleichbar. Die bisherigen, auch internationalen Erfahrungen mit der Kryokonservierung lassen keine erhöhte Rate an Mißbildungen und Chromosomenanomalien erwarten, wenngleich exakte Zahlen an großen Kollektiven nachuntersuchter Kinder noch nicht vorliegen. Zukünftige Entwicklungen: Für die Zukunft ist eine weitere Zunahme insbesondere der ICSI-Behandlung und der Kryokonservierung zu erwarten, vorausgesetzt, die IVF mit ICSI steht als Maßnahme der gesetzlichen Krankenkassen weiterhin der breiten Bevölkerung offen. Über das im Embryonenschutzgesetz enthaltene Verbot der Eizellspende sollte nachgedacht werden. Es ist dem betroffenen Paar nur schwer verständlich zu machen, warum eine Eizellspende verboten, eine Samenspende jedoch erlaubt sein soll. Zum anderen wäre eine Eizellspende geeignet, bei Vorliegen einer schweren genetischen Erkrankung auf der weiblichen Seite eine Weitergabe an die Embryonen zu verhindern. Auch jungen Frauen, die infolge einer schweren Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation bereits die Ovarien verloren haben, könnte so noch zu einer Schwangerschaft verholfen werden. Um einer möglichen unkritischen Anwendung der Eizellspende vorzubeugen, könnte die vorherige Anrufung einer von der Ärztekammer einzurichtenden Kommission zur Auflage gemacht werden. Darüber hinaus sollte auch das Verbot einer Forschung an Embryonen, wie es im Embryonenschutzgesetz enthalten ist, kritisch überdacht werden, weil dieses Verbot in der Praxis der vergangenen Jahre dazu geführt hat, daß sich die Forschung auf relevanten Gebieten (z. B. Mikromanipulation, Präimplantationsdiagnostik) weitgehend im Ausland abgespielt hat. aus juristischer Sicht: Ministerialrätin B. Porz-Krämer, Bonn Ich bin im Bundesministerium der Justiz unter anderem für das am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Embryonenschutzgesetz zuständig, mit dem erstmals bestimmte Fragen der Fortpflanzungsmedizin sowie der Gentechnik eine gesetzliche Regelung gefunden haben. In meinem Vortrag will ich mich im wesentlichen diesem Gesetz und damit im Zusammenhang stehenden aktuellen Fragestellungen widmen. Die neuen Methoden der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnik, die uns soeben aus medizinischer Sicht so eindrucksvoll dargestellt wurden, haben zu vielen völlig neuen ethischen und rechtlichen Fragen geführt. Sie haben nicht nur Chancen, sondern auch die Möglichkeit des Mißbrauchs eröffnet. Der Gesetzgeber sah es daher als seine vordringliche Aufgabe an, möglichem Mißbrauch der neuen Techniken rechtzeitig zu begegnen und für die Betroffenen sowie für Ärzte und Forscher die Grenzen ihrer Anwendung beim Menschen festzulegen. Wesentliche Grundentscheidungen wurden durch das Embryonenschutzgesetz getroffen, mit dem der Gesetzgeber rechtliches Neuland betreten hat. Es ging um die Entwicklung und Gestaltung eines völlig neuen Rechtsgebietes, um das Setzen neuer Wertmaßstäbe. Das Embryonenschutzgesetz ist ein Strafgesetz. Es beschränkt sich, nicht zuletzt im Blick auf die durch Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes garantierte Forschungsfreiheit, darauf, strafrechtliche Verbote nur dort vorzusehen, wo sie zum Schutz besonders hochrangiger Rechtsgüter unverzichtbar erscheinen. Ziel des Gesetzes ist es, zweierlei sicherzustellen: Einmal, daß auch in einer zunehmend von medizinischen Techniken bestimmten Zukunft ein an der Würde des Menschen orientierter Umgang mit dem menschlichen Leben gewährleistet ist. Zum anderen, daß die Kinder, die ihr Leben der Anwendung neuer medizinischer Methoden verdanken, in ihrem seelischen Wohl keinen Schaden nehmen. Das Embryonenschutzgesetz stellt somit keine umfassende Regelung der mit der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnik zusammenhängenden Fragen dar. In der rechtspolitischen Diskussion - insbesondere während des Gesetzgebungsverfahrens - ist vielfach kritisiert worden, daß der Gesetzgeber die Materie in einem Strafgesetz regelt. Gefordert wurde und wird auch heute noch statt dessen ein umfassendes Fortpflanzungsmedizingesetz zu schaffen, welches insbesondere auch die vielfältigen gesundheits- und verwaltungsrechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang regelt. Maßgebend für den Bundesgesetzgeber war jedoch, daß er seinerzeit seine Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der künstlichen Befruchtung allein auf das Strafrecht (bzw. das Zivilrecht) stützen konnte. Zur Regelung gesundheits- und verwaltungsrechtlicher Fragen war keine Bundeskompetenz gegeben. Diese lag damals bei den Ländern. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für „die künstliche Befruchtung beim Menschen, die Untersuchung und die künstliche Veränderung von Erbinformationen“ ist erst durch Gesetz vom 27. Oktober 1994 geschaffen worden, und zwar durch Anfügung einer neuen Nummer 26 in Artikel 74 des Grundgesetzes. Das innerhalb der Bundesregierung für die noch offenen Fragen zuständige Bundesministerium für Gesundheit hat inzwischen eine Bund/LänderArbeitsgruppe zur künstlichen Befruchtung beim Menschen eingerichtet, der die Aufgabe zukommt, den weiteren gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu überprüfen. Ich werde zum Ende meines Vortrages hierauf nochmals zurückkommen. Lassen Sie mich nun in einem kurzen Überblick die wichtigsten Bestimmungen des Embryonenschutzgesetzes darstellen. Gemäß § 8 Abs. 1 ESchG gilt als Embryo bereits die befruchtete menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an. Das Gesetz läßt damit offen, wann menschliches Leben beginnt. Diese vielschichtige Frage kann und will es nicht beantworten. Es regelt allein die Frage, von welchem Zeitpunkt ab der menschliche Embryo gesetzlich geschützt wird. § 8 Abs. 1 Embryonenschutzgesetz stellt dem Embryo jede einem Embryo entnommene totipotente Zelle gleich, die sich bei Vorliegen der dafür erforderlichen weiteren Voraussetzungen zu teilen und zu einem Individuum zu entwickeln vermag. Im Interesse eines wirksamen Embryonenschutzes gilt die befruchtete Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 16 menschliche Eizelle in den ersten 24 Stunden nach der Kernverschmelzung als entwicklungsfähig, sofern nicht das Gegenteil ausnahmsweise im Einzelfall festgestellt werden kann (§ 8 Abs. 2 ESchG). Das Embryonenschutzgesetz will möglichem Mißbrauch schon bei der Anwendung der neuen Techniken entgegenwirken: Es verbietet die künstliche Befruchtung zu einem anderen Zweck als dem, eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG). Mit der in Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes getroffenen Entscheidung zugunsten des menschlichen Lebens wäre es kaum in Einklang zu bringen, extrakorporal menschliche Eizellen zu befruchten, wenn deren Transfer auf eine zur Austragung bereite Frau von vornherein ausgeschlossen wäre. Die Vorschrift verbietet demnach, menschliche Eizellen etwa zu Forschungszwecken künstlich zu befruchten. Die Bestimmung dient zugleich auch dazu, bereits im Vorfeld sogenannte gespaltene Mutterschaften zu verhindern, bei denen genetische und austragende Mutter nicht identisch sind. Die gleiche Zielsetzung verfolgt das Verbot der Übertragung fremder Eizellen auf eine Frau (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ESchG). Diese Regelungen sind von der Erwägung getragen, daß das Kind in seiner Entwicklung entscheidend sowohl durch die von der genetischen Mutter stammenden Erbanlagen als auch durch die während der Schwangerschaft bestehende enge Bindung zwischen ihm und der austragenden Mutter geprägt wird. Unter diesen Umständen liegt die Annahme nahe, daß dem jungen Menschen, der sein Leben drei verschiedenen Elternteilen gleichermaßen verdankt, die eigene Identitätsfindung wesentlich erschwert sein wird. Die Verbote sollen sicherstellen, daß ihm die Auseinandersetzung mit dem Umstand erspart bleibt, von zwei Müttern abzustammen. Der Gesetzgeber ging davon aus, daß auch sogenannte Ersatzmutterschaften (auch Leihmutterschaften genannt) regelmäßig dem Kindeswohl zuwiderlaufen, weil sie die psychosozialen Beziehungen zwischen der austragenden Frau und dem Kind völlig unberücksichtigt lassen. Es ist deshalb verboten, an einer künstlichen Befruchtung oder der Übertragung eines Embryos mitzuwirken, wenn die betreffende Frau bereit ist, ihr Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu überlassen (§ 1 Abs. 1 Nr. 7 ESchG). Um zu verhindern, daß bei der extrakorporalen Befruchtung überzählige Embryonen entstehen, die nicht ausgetragen werden können, untersagt das Gesetz, mehr Eizellen einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 ESchG). Der Gesetzgeber ging davon aus, daß es nach dem Stand von Wissenschaft und Praxis ausreicht, höchstens drei Eizellen zu befruchten und höchstens drei Embryonen zu übertragen, um die Einnistungsmöglichkeiten zu optimieren. Dem Ziel, die Überlebenschancen des Embryos in vertretbaren Grenzen zu gewährleisten und zugleich unerwünschten Mehrlingsschwangerschaften entgegenzuwirken, dienen deshalb die Verbote, innerhalb eines Zyklus mehr als drei Embryonen auf eine Frau zu übertragen oder durch intratubaren Gametentransfer mehr als drei Eizellen zu befruchten (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 ESchG). Einen umfassenden Schutz vor mißbräuchlicher Verwendung „verfügbar“ gewordener menschlicher Embryonen, z. B. solcher, die extrakorporal zwar mit dem Ziel des Embryonentransfers erzeugt worden sind, bei denen sich später aber ein derartiger Transfer - aus welchen Gründen auch immer - als unmöglich herausgestellt hat, will § 2 Embryonenschutzgesetz sicherstellen. Danach ist jede Veräußerung, jede Abgabe, jeder Erwerb und jede Verwendung eines extrakorporal erzeugten oder einer Frau vor der Einnistung entnommenen Embryos zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck ausnahmslos verboten (§ 2 Abs. 1, 2 ESchG). Von dem Verbot werden vor allem Experimente an und mit dem Embryo erfaßt. Die Vorschrift statuiert ein generelles, ausnahmsloses Verbot der verbrauchenden Forschung an menschlichen Embryonen. Nur wenn die Forschung dem Ziel dient, (auch) Leben und Gesundheit des betroffenen Embryos zu erhalten, handelt es sich um den grundsätzlich zulässigen Fall eines therapeutischen „Heilversuchs“. Das Embryonenschutzgesetz geht mithin davon aus, daß menschliches Leben auch in seinem Frühstadium unverfügbar ist. Es darf nicht zum Objekt fremdnütziger Zwecke gemacht werden. Zum Schutz vor Experimenten auf Kosten des menschlichen Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Menschenwürde verbietet § 5 Abs. 1, 2 ESchG grundsätzlich die künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen sowie die Verwendung einer menschlichen Keimzelle mit künstlich veränderter Erbinformation zur Befruchtung. Ziel eines Gentransfers in menschliche Keimbahnzellen könnte es sein, Erbleiden dadurch zu verhindern, daß man das jeweils defekte Gen bereits in der befruchteten Eizelle gegen ein intaktes austauscht, mit der Folge, daß nach den anschließenden Zellteilungen alle weiteren Zellen des Individuums das intakte Gen enthalten, welches auch auf nachfolgende Generationen übertragen wird. Dem Verbot dieser Methode liegt die Erwägung zugrunde, daß jeder Gentransfer in eine befruchtete menschliche Eizelle auf ein Experimentieren mit menschlichen Leben hinausliefe. Der Gentransfer kann ohne vorherige riskante Versuche am Menschen nicht entwickelt werden. Welche Risiken mit einem solchen Experimentieren für das betroffene Individuum, aber auch für seine Nachkommen verbunden wäre, läßt sich nicht vorhersehen. Sollte sich eines Tages die Methode des Gentransfers in menschliche Keimbahnzellen als risikolos erweisen, so wird der Gesetzgeber bei der Frage einer Freigabe der Methode auch die Gefahr sehen müssen, daß damit zugleich der Weg zu mißbräuchlicher Manipulation des Menschen geebnet werden kann. Enge Ausnahmen von dem Verbot des Gentransfers sind jedoch mit Rücksicht auf die durch Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes garantierte Forschungsfreiheit für solche Experimente vorgesehen, die zu keiner Gefährdung des Individuums zu führen vermögen. Ein Weg zur Manipulation der Nachkommenschaft, der letztlich Züchtungstendenzen Vorschub leisten könnte, ist auch die gezielte Festlegung des Geschlechts der künftigen Kindes. Das Embryonenschutzgesetz verbietet deshalb grundsätzlich eine Auswahl der Samenzelle nach dem in ihr enthaltenen Geschlechtschromosom. Ausgenommen von dem strafrechtlichen Verbot sind lediglich die Fälle, in denen die Auswahl durch den Arzt dazu dient, das Kind vor der Erkrankung an einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder einer ähnlich schwerwiegenden geschlechtsgebundenen Erbkrankheit zu bewahren (§ 3 ESchG). Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 17 Schließlich sind die Methoden des Klonens, der Chimären- und der Hybridbildung verboten. Es würde in besonders krasser Weise gegen die Menschenwürde verstoßen, gezielt einem künftigen Menschen seine Erbanlagen zuzuweisen. Dies gilt erst recht für die Erzeugung von Chimären unter Verwendung mindestens eines menschlichen Embryos oder Hybridwesens aus Mensch und Tier. Aus diesen Ausführungen möchte ich den kurzen Überblick über den Regelungsgehalt des Embryonenschutzgesetzes abschließen, um mich - wie angekündigt, aktuellen Fragen zuzuwenden. Ich werde drei Fallgestaltungen aufzeigen, die auch ein erhebliches Presseecho gefunden haben. Es geht um die Eispende, die Präimplantationsdiagnostik sowie die Problematik überzähliger Embryonen. Sie erinnern sich sicher an Pressemeldungen Anfang 1994, in denen mitgeteilt wurde, daß eine 59jährige Engländerin im Wege der künstlichen Befruchtung Mutter von Zwillingen geworden war. Ein italienischer Arzt hatte ihr mit dem Samen ihres Mannes befruchtete Eizellen einer jungen Frau eingesetzt. Der Fall der 59jährigen Britin hat zu einer kontroversen Diskussion über die ethischen Grenzen künstlicher Befruchtung geführt. Sie mündete unter anderem in die Forderung, bei uns eine Altersgrenze für Frauen, die eine künstliche Befruchtung vornehmen lassen, festzulegen. Einer solchen Altersgrenze bedarf es jedoch im Hinblick auf eine Eispende schon deshalb nicht, weil das Embryonenschutzgesetz diese Spende mit Rücksicht auf das Kindeswohl untersagt. Da in Deutschland jedoch die Samenspende gesetzlich nicht geregelt und damit nicht verboten ist, wird zum Teil - insbesondere von Frauen gefordert, auch das Verbot der Eispende aufzuheben oder zu lockern. Beide Fallgestaltungen müßten grundsätzlich rechtlich gleichbehandelt werden. Prof. Diedrich, der Direktor der Universitätsfrauenklinik in Lübeck, hat in einem Interview der Süddeutschen Zeitung am 4. Juli 1996 die Auffassung vertreten, bei einer Eizellspende könne es zwar nicht das Ziel sein, einer 60jährigen zu einer Schwangerschaft zu verhelfen. Es gebe aber auch die 20jöhrige Krebspatientin, deren Eierstöcke entfernt werden mußten. Hier könne man sich schon fragen, ob die Eispende nach Prüfung durch eine Ethikkommission erlaubt sein sollte. Während mithin bei uns in der rechtspolitischen Diskussion das Verbot der Eispende im Embryonenschutzgesetz von einigen in Frage gestellt wird, denkt man in Italien aufgrund der aktuellen Vorkommnisse gerade darüber nach, die Eispende zu verbieten. Das Thema spielt dort derzeit in der öffentlichen Debatte eine große Rolle. Dem italienischen Parlament liegen bisher fünf Gesetzentwürfe zum Thema künstliche Befruchtung und Embryonenschutz vor. Sie unterscheiden sich jedoch in einem solchen Ausmaße, daß mit einer gesetzlichen Regelung alsbald nicht zu rechnen ist. Der Nationalrat der italienischen Ärzte- und Zahnärztekammern hat in einer standesrechtlichen Regelung vom 2. April 1994 jede Art von Ersatzmutterschaft und Befruchtung von Frauen ab dem normalen Alter der Menopause abgelehnt. Mir fehlt ein vollständiger Überblick über die Rechtslage in anderen europäischen Ländern. Mitteilen kann ich jedoch, daß die Eispende in Österreich, Norwegen und Schweden untersagt ist. Zulässig ist sie dagegen in Dänemark, Frankreich und Großbritannien. In dem genannten Interview hat Prof. Diedrich nicht nur eine Ausnahme von dem Verbot der Eispende in Erwägung gezogen, sondern sich auch für die Zulässigkeit der Präimplantationsdiagnostik ausgesprochen, die im Ausland, z. B. in Belgien, den Niederlanden und in England praktiziert wird, um das Vorliegen einer schweren Erbkrankheit an einem in-vitro gezeugten Embryo bereits vor dessen Übertragung in die Gebärmutter auszuschließen. Wie inzwischen bekannt wurde, hat er ein solches Vorhaben der Ethikkommission der Medizinischen Universität zu Lübeck zur Beratung und Überprüfung vorgelegt. In dem konkreten Fall geht es um den Kinderwunsch eines Ehepaares, bei dem beide das Gen für die schwere Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose tragen. Es ist bereits zu zwei Abtreibungen und zu einer Totgeburt gekommen. Bei der Präimplantatsdiagnostik werden abgespaltene Zellen zur Erkennung genetischer Krankheiten verbraucht. Sofern dies unter Verwendung totipotenter Zellen, die wie ich eingangs ausgeführt habe, gemäß § 8 Abs. 1 ESchG einem Embryo gleichstehen, geschieht, stellt diese Methode neben einer Verletzung des Verbots des Klonens (§ 6 Abs. 1 ESchG) eine verbotene, nicht der Erhaltung des Embryos dienende Verwendung dar (§2 Abs. 1 ESchG). Beim menschlichen Embryo geht man bislang davon aus, daß die Zellen wohl bis zum 8Zellstadium totipotent sind. Nach den uns vorliegenden Informationen soll die von Prof. Diedrich beabsichtigte Diagnostik an noch totipotenten Zellen durchgeführt werden. Damit wäre die Maßnahme nach dem Embryonenschutzgesetz verboten. Hierauf weist auch die Ethikkommission in ihrem Votum hin. Im Gesetzgebungsverfahren war umstritten, ob man das Abspalten einer totipotenten Zelle eines menschlichen Embryos dann für vertretbar halten könnte, wenn diese Zelle diagnostischen Zwecken dienen soll und die Methode somit dazu beitragen könnte, eine spätere Abtreibung des von einer Erbkrankheit betroffenen transferierten Embryos zu vermeiden. Der Gesetzgeber hat sich indes für ein uneingeschränktes Verbot der Abspaltung totipotenter Zellen ausgesprochen. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung ist zur Begründung aufgeführt: „Unabhängig davon, daß sich aus den totipotenten Zellen unter bestimmten Voraussetzungen selbständiges menschliches Leben entwickeln könnte, wäre die Abspaltung einzelner Zellen eines Embryos im Frühstadium seiner Entwicklung vor allem deshalb problematisch, weil sich nicht mit Sicherheit ausschließen lasse, daß der Eingriff zu einer Schädigung des nach der Abspaltung verbleibenden und zur Embryoübertragung vorgesehen Embryos führe. Es wäre nicht vertretbar, die Abspaltung einzelner Zellen eines Embryos zuzulassen, Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 18 obwohl die Möglichkeit schwerer Beeinträchtigung des nach dem Eingriff ausgetragenes Kindes nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könne. Es bestehe deshalb derzeit kein Anlaß, Ausnahmen von dem strafrechtlichen Verbot - etwa für eine Präimplantionsdiagnostik - in Erwägung zu ziehen.“ Unabhängig von den mit der Methode verbundenen Gefahren und dem Verbot der Abspaltung und Vernichtung totipotenter Zellen werden grundsätzliche Bedenken gegen jegliche Präimplantationsdiagnostik erhoben, weil diese mit der Möglichkeit einer Selektion der zu übertragenden Embryonen auch die unbestreitbare Gefahr einer Menschenzüchtung eröffne. Zudem führe die Diagnostik zur Verwerfung als krank erkannter Embryonen. Es ist davon auszugehen, daß die angesprochenen Fragen zunehmend Gegenstand kontroverser rechtspolitischer Diskussion sein werden. Ich bin daher sehr interessiert daran, Ihre Auffassung zu hören. Schwierige Fragen stellten sich auch im Zusammenhang mit der Entstehung sogenannter überzähliger Embryonen. Im Sommer dieses Jahres hat die Vernichtung von rund 3.000 überzähligen Embryonen in England die Wellen der Empörung hochschlagen lassen. Es wurde u. a. diskutiert, ob angesichts solcher Maßnahmen künstliche Befruchtung beim Menschen überhaupt noch vertretbar sein könne. In England sehen die Bestimmungen eines 1991 in Kraft getretenen Gesetzes vor, daß kryokonservierte Embryonen nach fünf Jahren vernichtet werden müssen, wenn die Gametenspender bis zu diesem Zeitpunkt der weiteren Lagerung nicht zustimmen. Auch in Deutschland kann es zu sogenannten überzähligen Embryonen kommen, die tiefgefroren und gelagert werden. Die genaue Anzahl solcher aufbewahrter Embryonen ist uns nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, daß in der Praxis die Kryokonservierung und Lagerung von Embryonen anders als in England, nur äußerst selten vorkommt. Ziel des Embryonenschutzgesetzes ist es u. a. gerade das Entstehen sogenannter überzähliger Embryonen zu verhindern (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und § 1 Abs. 2 ESchG). Deshalb dürfen insbesondere nicht mehr Eizellen einer Frau befruchtet werden, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 ESchG). Das Gesetz beschränkt die Anzahl auf drei Embryonen pro Zyklus. Scheidet jedoch eine Übertragung der Embryonen, etwa infolge einer Erkrankung oder des Todes der Eispenderin, aus, wird das Ziel, die Entstehung überzähliger Embryonen zu verhindern, verfehlt. In diesen Ausnahmefällen ist zur Sicherung der Überlebenschancen sowohl die Embryospende als auch eine Kryokonservierung des Embryos nicht verboten. Die überzähligen Embryonen sind, wie ich ich in dem Überblick über das Gesetz dargelegt habe, umfassend vor Mißbrauch geschützt (§§ 2, 6, 7 ESchG). Sie dürfen unter anderem weder veräußert noch zu einem nicht ihrer Erhaltung dienenden Zweck abgegeben, erworben oder verwendet, noch extrakorporal weiterentwickelt werden. Das Embryonenschutzgesetz, welches lediglich das Mindestmaß an strafrechtlichen Verbotsnormen zum Schutz besonders hochrangiger Rechtsgüter getroffen hat, enthält darüber hinaus keine Regelungen zu der Frage des weiteren „Schicksals“ solcher Embryonen. Muß der Embryo kryokonserviert werden oder darf man ihn seinem „Schicksal“ überlassen, wenn eine Implantationsmöglichkeit fehlt? Wie lange darf, wie lange muß er gelagert werden? Muß die Möglichkeit einer Adoption genutzt werden? Wem kommt das Bestimmungsrecht über den Embryo zu? Diese Fragen sind noch offen und bedürfen vor allem auch unter ethischen Gesichtspunkten der weiteren Diskussion. Im Rahmen der künstlichen Befruchtung werden in der Praxis vielfach Eizellen im Vorkernstadium kryokonserviert. Dabei handelt es sich um Eizellen, in die eine Samenzelle zwar bereits eingedrungen ist, eine Befruchtung jedoch noch nicht stattgefunden hat. Nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 2 ESchG erscheint diese Maßnahme zulässig, wenn der Arzt das Ziel verfolgt, die imprägnierten Eizellen für einen weiteren Behandlungsversuch bei der Eizellspenderin in einem späteren Zyklus zu verwenden. Die betroffenen Frauen werden auf diese Weise von den körperlichen und psychischen Belastungen einer erneuten Eizellgewinnung verschont. Allerdings widerspricht diese Maßnahme der Intention des Gesetzgebers, der bewußt jede Erzeugung überzähliger Embryonen verhindern wollte. Da sich die Eizellen im Vorkernstadium nach dem Auftauen weiterentwickeln können, besteht auch hier die Gefahr der Entstehung überzähliger Embryonen. Ich habe viele Fragen gestellt, aber keine Antworten gegeben. Dies entspricht dem derzeitigen Stand der Dinge. Es sind zur Zeit keine Änderungen beim Embryonenschutzgesetz geplant. Wir werden die weitere Entwicklung verfolgen und die Ergebnisse der Beratungen der beim Bundesministerium für Gesundheit in diesem Jahr neu eingerichteten Bund/Länder-Arbeitsgruppe zur künstlichen Befruchtung beim Menschen abzuwarten haben. Die Arbeitsgruppe wird sich neben den aktuellen Fragen vielfältigen gesundheits- und verwaltungsrechtlichen Problemen zuwenden, wie z. B. der Zulässigkeitsvorausetzung einer künstlichen Befruchtung, deren Beratung und der Dokumentation. Darüber hinaus befaßt sie sich mit der Problematik der heterologen Insemination sowie der künstlichen Befruchtung bei alleinstehenden oder in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft stehenden Frauen. Der Gesetzgeber hat sich seinerzeit bewußt gegen eine Regelung dieser Fragen im Embryonenschutzgesetz ausgesprochen, weil die Erörterung der Probleme noch nicht abgeschlossen ist. Dabei wird heute auch der Frage nachzugehen sein, welche Bedeutung der heterologen Insemination, also der Befruchtung mit Fremdsamen, noch zuvorkommt, nachdem die Möglichkeit der Mikroinjektion gegeben ist. Diese Methode verhilft bei schlechter Samenqualität zur Überwindung männlicher Unfruchtbarkeit, indem eine einzelne Samenzelle in eine Eizelle verbracht wird. Insgesamt bedarf es hier noch einer sorgfältigen Prüfung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs. Ob es zu einem einheitlichen, umfassenden Fortpflanzungsmedizingesetz kommen wird, bleibt abzuwarten. In der Diskussion werden die Probleme der langfristigen "Erfolgskontrolle" angesprochen. Aus Sicht der Genetiker wäre eine kontrollierte klinische Studie zur Spermieninjektion notwendig, um Informationen über mögliche Gefahren (höhere Mißbildungsrate?) zu erhalten. Zumindest sollten multizentrische Verlaufsstudien angestrebt werden. Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 19 Dr. Neidert berichtet, daß im Bundesministerium für Gesundheit seit Frühjahr 1996 eine Arbeitsgruppe damit befaßt ist, Fragen der Fortpflanzungsmedizin zu diskutieren. Über die Tätigkeit und die Diskussionsergebnisse dieser Arbeitsgruppe kann bei einer späteren Sitzung des AK "Ärzte und Juristen" berichtet werden. ___________________________________________________________________ Nächste Sitzung des Arbeitskreises: 11. und 12. April 1997 in Halle/Saale Themen werden mit der Einladung bekanntgegeben Arbeitskreis „Ärzte und Juristen“ am 29. + 30. November 1996 - Seite 20