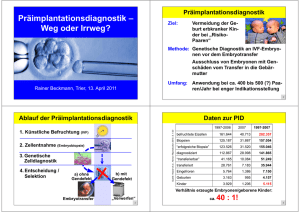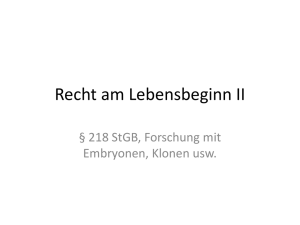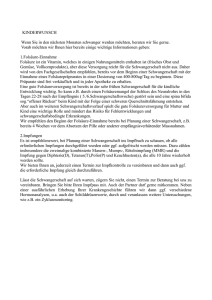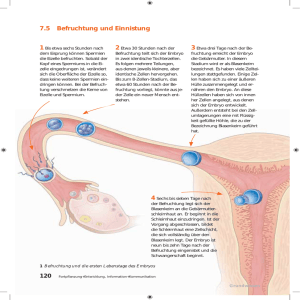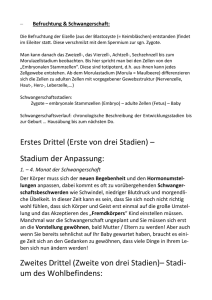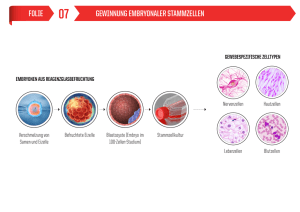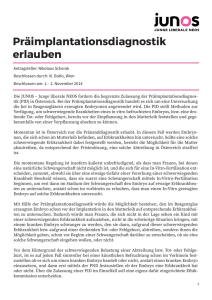Euphemismus - Deutsches Ärzteblatt
Werbung

D O K U M E N T A T I O N DISKUSSION zur Verfügung stehen. Der Verweis auf die Eltern als darüber bestimmende Personen kann zu schwierigen Situationen führen, da ein heterozygoter Befund in der Pränataldiagnostik in aller Regel nicht als Argument für eine unzumutbare Belastung der Schwangeren anerkannt würde. Mit welcher Begründung sollte er es dann in der Präimplantationsdiagnostik sein? Ich möchte daher die Frage in den Raum stellen, ob es nicht möglich wäre, bei PGD immer nur eine einzelne Eizelle zu befruchten, zu diagnostizieren und dann über diesen Embryo eine Ja-nein-Entscheidung zu treffen. Dies würde sowohl bei den Ärzten als auch bei den Eltern natürliche Hemmschwellen erhalten, mit dem „Embryonenmaterial“ nicht allzu großzügig und entpersonalisiert umzugehen. Es hätte außerdem den wichtigen Vorteil, dass auf diese Weise möglichst wenig Embryonen verworfen werden müssten, denn es leuchtet unmittelbar ein, dass umso mehr Embryonen das gesuchte genetische Merkmal aufweisen werden, je mehr pro Elternpaar erzeugt werden. Dies scheint mir auch dem Geist des Embryonenschutzgesetzes noch am ehesten nahe zu kommen. Viele Reproduktionsmediziner werden praktische Einwände gegen diesen Vorschlag erheben und insbesondere eine Verminderung der Schwangerschaftrate beziehungsweise eine Erhöhung der dafür notwendigen Zyklenzahl befürchten. Dies müsste möglichst gründlich und ohne Vorurteile untersucht werden. Die Daten, die anhand künstlicher Befruchtung (IVF und ICSI) gewonnen wurden, können jedoch nicht ohne weiteres dazu herangezogen werden, da es sich hierbei um Paare mit Fruchtbarkeitsstörungen gehandelt hat, was bei PGD in der Regel nicht der Fall wäre. Möglicherweise wird eine Frau auf diese Weise mehr Punktionen benötigen, dafür könnte eventuell auf die Stimulationsbehandlung verzichtet werden (?). Der Trend scheint aber in der Reproduktionsmedizin ohnehin zur Reduzierung der Embryonenzahl zu gehen, um die belastenden Mehrlingsschwangerschaften zu vermindern. Die neuen Richtlinien sehen deshalb bereits bei IVF und ICSI vor, einer Frau unter 35 Jahren nur noch maximal zwei Embryonen zu übertragen (Richtlinien zur assistierten Reproduktion, DÄ Heft 49/1998). Falls diese – nach meiner Ansicht optimale – Verbindung eines möglichst sicheren Embryonenschutzes bei gleichzeitiger Vermeidung von Schwangerschaftsabbrüchen (als das wesentliche Argument für PGD) nicht realisierbar sein sollte, müsste zumindest die Grenze von zwei oder drei Embryonen, die gleichzeitig erzeugt und untersucht werden dürfen, unbedingt eingehalten werden. Es sollte auch eindeutig geregelt werden, wie mit hetero- zygoten Embryonen bei rezessiven Erkrankungen umgegangen wird. Das ist keine akademische Diskussion ohne praktische Relevanz: In Belgien wird bei X-chromosomal rezessiven Erkrankungen auf Wunsch der Eltern bereits eine Selektion gegen weibliche verdeckte Anlageträger vorgenommen (Liebaers, persönliche Mitteilung). Da kein Embryo einer Frau gegen ihren Willen übertragen werden kann, wird jede vorherige Vereinbarung umgehbar bleiben. Analog zu der Geschlechtsmitteilung bei PND vor der 12. Schwangerschaftswoche könnte deshalb erwogen werden, einen heterozygoten Befund grundsätzlich nicht anders als einen homozygot unauffälligen Befund mitzuteilen (worauf die Eltern bereits im Vorfeld hingewiesen würden). Ärztliches Ziel der PGD kann nur die Hilfestellung bei einem bestehenden elterlichen Konflikt sein, nicht die möglichst effiziente Verhinderung von Menschen mit genetischen Erkrankungen. Insofern ist der Absatz: „Bei einer PGD darf nur auf diejenige Veränderung des Erbmaterials untersucht werden, die zu der infrage stehenden schweren genetischen Erkrankung führt, für die das Paar ein hohes genetisches Risiko hat.“ ausdrücklich zu begrüßen. Um das darin angestrebte Ziel der eigenen Beschränkung zu gewährleisten, sollte aber auch ein Screening der Eltern auf weitere genetische Veränderungen im Vorfeld der PGD abgelehnt werden. Der Qualität wäre es sicherlich zuträglich, wenn nur wenige, wissenschaftlich ausgerichtete Zentren für PGD entstehen dürften: Jede Technik muss ausreichend geübt werden, um möglichst zuverlässig zu sein. Schließlich werden die genannten Grenzen der PGD nur so lange wirksam bleiben, wie eine kommerzielle Nutzung auf Dauer verhindert werden kann, da eine Anschaffung der benötigten Ressourcen unter dem Druck steht, sich auch den entsprechenden Bedarf zu erzeugen. Dr. med. Barbara Leube, Institut für Humangenetik und Anthropologie, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf Euphemismus Die novellierte Fassung des § 218 ermöglicht es nach chromosomalen oder genetischen Defekten jeglicher Art zu untersuchen und anschließend die Schwangerschaft abzubrechen – und zwar zu jedem Zeitpunkt. Grundsätzlich ist auch eine Untersuchung auf das Geschlecht möglich. Damit hat der Gesetzgeber festgestellt, dass die „positive Eugenik“ im Rahmen der Schwangerschaft rechtens ist und die alleinige Entscheidung darüber bei der Frau A-1132 Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 17, 28. April 2000 liegt. Und tatsächlich ist dies in der Bundesrepublik jährlich zigtausendfache Praxis, und jeder tätige Frauenarzt und Humangenetiker weiß, dass die Vorstellungen darüber, was „defekt“ oder was „gesund“ ist, von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sind. Einen gewissen Einhalt bieten die Richtlinien der Humangenetiker (im Hinblick auf die Geschlechtsmitteilung), doch sind dies Selbstverpflichtungen der behandelnden und diagnostizierenden Ärzte – der Gesetzgeber schreibt dies keineswegs vor. Es ist kaum anzunehmen, dass der Gesetzgeber in der jahrelangen Diskussion über die Novellierung des § 218 es „übersehen“ hat, dass durch die jetzige Formulierung des § 218 der pränatalen Diagnostik nach allen erdenklichen Gesichtspunkten mit der Möglichkeit des nachfolgenden Schwangerschaftsabbruches de facto Tür und Tor geöffnet wurde. Die Präimplantationsdiagnostik würde diese Prinzipien, wie sie im Rahmen einer Schwangerschaft als legal erachtet werden, auf den Embryo vor seiner Einnistung übertragen. Mehr nicht. Wenn also schon „am Rande der schiefen Bahn“, dann hätte dieser Aufschrei im Rahmen der Novellierung des § 218 kommen müssen. Ist er aber nicht. Die vorgeschlagenen Richtlinien des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer nehmen sich im Gegensatz zur Praxis des novellierten § 218 ausgesprochen restriktiv aus. Der jetzige Aufschrei der Empörung hat deshalb euphemistische Züge, denn: wie will man es noch verstehen, dass ein und dieselbe Diagnostik und Vorgangsweise am Embryo vor seiner Einnistung verboten sein soll, während sie nach seiner Einnistung de facto ohne Einschränkung und in allen Lebensaltern (also auch an lebensfähigen Feten) zulässig ist. Nicht vergessen werden darf, dass das Verfahren der Pränataldiagnostik eine Befruchtung außerhalb des Körpers (Invitro-Fertilisation) voraussetzt, also vergleichsweise aufwendig ist. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die betroffenen Paare, sofern sie normal fertil sind, auch weiterhin auf die PGD verzichten, ihre Kinder auf normalem Wege zeugen und die Untersuchungen dann in der Schwangerschaft vornehmen lassen werden. Doch was ist mit solchen Ehepaaren, die auf eine In-vitro-Fertilisation angewiesen sind (zum Beispiel aufgrund beidseits fehlender Eileiter der Frau) und bei denen gleichzeitig eine bekannte genetische Vorerkrankung besteht? Muss man dann sehenden Auges auf die entsprechende Diagnostik bei dem Embryo-in-vitro verzichten, um ihn anschließend einzusetzen, und im Rahmen der Schwangerschaft exakt dieselbe Untersuchung durchzuführen – D O K U M E N T A T I O N DISKUSSION freilich mit der Konsequenz eines dritten Eingriffs, nämlich dem des Schwangerschaftsabbruches? Geht diese absichtliche Zumutung von zwei zusätzlichen Körperverletzungen (Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch) ethisch wirklich in Ordnung, oder ist das nicht auch schon längst „auf der schiefen Bahn“? Prof. Dr. Dr. W. Würfel, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), c/o Frauenklinik Dr. Wilhelm Krüsmann, Schmiedwegerl 2–6, 81241 München Gibt es ein Recht auf (gesunde) Kinder? In der Diskussion ethischer und juristischer Aspekte der Präimplantationsdiagnostik (PID) wird meist der Bezug zu den entsprechenden Regelungen im Rahmen der Pränataldiagnostik (FD) und des § 218a StGB Abs. 2 hergestellt (vgl. 1). Dieser Vergleich ist jedoch nicht zulässig. Bei der moralischen und juristischen Rechtfertigung eines Schwangerschaftsabbruchs aus medizinischer Indikation findet eine Abwägung zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und dem Lebensrecht der Frau statt. Von zentraler Bedeutung ist hierbei auch, dass die Schwangere „unschuldig“ in diese Konfliktsituation hineingeriet (hierzu 2). Im Fall der PID findet demgegenüber diese Abwägung definitiv nicht statt, da eine Schwangerschaft noch nicht besteht. Die noch nicht Schwangere hat zum Beispiel die Möglichkeit, bewusst auf eine Schwangerschaft zu verzichten und damit ein Risiko für ihren Gesundheitszustand aufgrund einer genetischen Erkrankung eines zukünftigen Kindes zu vermeiden; sie hat somit alternative Möglichkeiten, nicht „an der Furcht vor einem genetisch bedingt schwerstkranken Kind gesundheitlich zu zerbrechen“ (1). Die Abwägung besteht in dieser Situation somit zwischen dem bewussten Verzicht auf biologisch eigene Kinder und den Grundrechten des Gezeugten. Die meisten in genetischer Beratung und PD Tätigen können andererseits nicht an der Tatsache vorbeisehen, dass – vergleichbar einer zukünftigen Nutzung der PID – zunehmend die Entscheidung für die Durchführung einer PD schon primär mit dem Entschluss zu einer Schwangerschaft gefällt wird. Wir bezweifeln jedoch, dass diese Nutzung der PD und der medizinischen Indikation zum Schwangerschaftsabbruch – im Sinn einer „Schwangerschaft auf Probe“ – mit Geist und Buch- stabe des Gesetzes vereinbar ist: Ist Kinderlosigkeit tatsächlich als so schwere Beeinträchtigung des Gesundheitszustands anzusehen, dass dafür der Schutz des ungeborenen Lebens zurückstehen muss? Mit der Zulassung der PID würde von ärztlicher und gesetzgeberischer Seite auch dieser kalkulierte Einsatz der FD moralisch positiv sanktioniert; dies entspräche einem Paradigmenwandel der moralischen Rechtfertigung von PD sowie der Interpretation des § 218a Abs. 2 StGB. Sowohl die PID als auch sämtliche Verfahren der PD sind vor diesem Hintergrund kritisch zu hinterfragen, und die implizit im Raum stehende Frage „Gibt es ein Recht auf (gesunde) Kinder?“ ist explizit zu diskutieren. Dr. med. Hans-Jürgen Pander, Institut für Klinische Genetik, Städtische Frauenklinik, Obere Straße 2, 70190 Stuttgart, Dr. med. Monika Hagedorn-Greiwe, Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, Dr. med. K. Mennicke, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck 1. Hoppe, J.-D., und K.-F. Sewing, Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik – Vorwort, DÄ Heft 9/2000. 2. Böckle, F., Schwangerschaftsabbruch – 1. Ethik, in: Eser, A. et al. (Hg.), Lexikon Medizin, Ethik, Recht, Freiburg 1989, Sp. 963-969. Wir alle sind gefordert Eindeutige Stellungnahmen von Ärzten/Ärztinnen und gesellschaftlichen Organisationen sind dringend gefordert: ➀ Selektion der Eltern: Entgegen allen sprachlichen Verschleierungs- und Verharmlosungstendenzen der Mitglieder des Beirates bleibt festzuhalten: Die Ehepaare, bei denen – obwohl keine Unfruchtbarkeit vorliegt – vor extrakorporaler Befruchtung eine genetische Untersuchung der befruchteten Eizelle vorgenommen werden kann, werden ausgesucht – bestimmt – selektioniert – wie immer dies bezeichnet werden soll. Sie werden selektioniert nach ihrem Erbgut und der daraus resultierenden Krankheitsgefährdung des gewünschten Kindes. ➁ Selektion der Kinder: Die Entscheidung, ob die „geschädigte Eizelle“ implantiert oder „verworfen“ wird, richtet sich nach oberflächlichem Lesen nach der Beeinträchtigung der Mutter. De facto aber ist einzig und alleine das Ergebnis der genetischen Untersuchung entscheidend, denn warum sonst sollte sich ein Ehepaar dem Stress der künstlichen Befruchtung unterziehen, wenn das Ergebnis der Untersuchung für die Entscheidung der Implantation unerheblich wäre? ➂ Herabsetzung der Tötungsschwelle: Im Vorwort des Entwurfes ist es eindeutig beschrieben: „Die PGD kann allerdings im Einzelfall die spätere Pränataldiagnostik ersetzen und damit zu einer Konfliktreduzierung beitragen, weil sie Entscheidungen über einen eventuellen Abbruch einer fortgeschrittenen Schwangerschaft vermeidet.“ Mit anderen Worten: Ein totipotentes Acht-Zell-Stadium „verwirft“ man – mit weniger Bedenken –, bei einem Schwangerschaftsabbruch im dritten bis fünften Monat ist der Tod des sich entwickelnden Menschen greifbarer und führt sicherlich zu stärkeren Konflikten. Der Mechanismus der Konfliktreduktion durch Herabsetzung der Tötungsschwelle ist ein Mechanismus, der uns aus der Zeit des Nationalsozialismus gut bekannt ist und Werteänderungen nach sich zieht, die im Nationalsozialismus zur Vergasung Tausender behinderter Menschen geführt hat. ➃ Eigeninteresse der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates: Die Mitglieder des Beirates sind auch Forscher, die eigene Interessen an der Aufweichung von Forschungsgrenzen haben, die eventuell auch weitergehende eigene Forschungsvorhaben entwickeln. Wer sagt uns denn, ob nicht nach Durchsetzung der PGD der nächste Schritt die genetischen Reparationsversuche an den „kranken“ befruchteten Eizellen sein werden? Natürlich wieder zum Wohle des sich entwickelnden Menschen, den man dann nach „Reparatur“ ja doch implantieren könnte? Wer will denn letztlich verhindern, dass an den „verworfenen“ Zellen weitere Versuche gemacht werden? Das Interesse von Wissenschaftlern und deren Wunsch nach Anerkennung ist viel zu groß, als dass von dieser Seite eigene Sanktionen gegen Missbrauch greifen könnten. ➄ Die Zusammensetzung der Ethikkommissionen, die Beratung und Aufklärung: Die Beratung und Aufklärung unterliegt laut Entwurf dem Humangenetiker und dem Gynäkologen (die ausschließlich männliche Form ist auch so im Entwurf enthalten). Wie immer sind nichtärztliche Gruppen in den Regelberatungen nicht vorgesehen, sondern können zusätzlich angeboten werden. Dabei gilt festzuhalten, dass auf sozialpsychologischer Ebene – auf der zunächst der Konflikt überhaupt besteht – Mediziner/innen nach Aus- und Weiterbildung über keinerlei besondere Kompetenz verfügen, eine Beratung adäquat durchführen zu können. Das Gleiche gilt für die Zusammensetzung der Ethik-Kommissionen. ✁ Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 17, 28. April 2000 A-1133 D O K U M E N T A T I O N DISKUSSION Wir alle sind gefordert, der Aufweichung des Embryonenschutzgesetzes und dem Aufbau weiterer selektionierender Maßnahmen entgegenzutreten. Wer glaubt, durch Nichteinmischung der Verantwortung für ethische Fragen entgehen zu können, der irrt. Cornelia Femers, Kühlenberg 20, 58644 Iserlohn Erklärung Aus jahrzehntelanger weit überwiegend positiver Erfahrung als Patient und als jahrzehntelanger berufspolitischer Wegbegleiter der deutschen Ärzteschaft fühle ich mich zu einer Erklärung verpflichtet: Ich stimme der Stellungnahme von Joachim Kardinal Meisner vollinhaltlich zu. Dazu darf ich bemerken, dass ich der lutherischen Kirche angehöre, ohne mich wirklich als Christ bezeichnen zu können. Ich muss mich heute fragen, ob ich bei der damaligen Diskussion zur künstlichen Insemination meine grundsätzliche Ablehnung deutlich genug in den Gremien der Bundesärztekammer vertreten habe. Nach meinen Aufzeichnungen wäre die erste Stellungnahme anlässlich der Vorbereitungen und der Durchführung des 62. Deutschen Ärztetages 1959 in Lübeck fällig gewesen. Der Deutsche Ärztetag hielt damals eine homologe intrauterine künstliche Insemination in besonderen Ausnahmefällen mehrheitlich für ethisch vertretbar. Der 73. Deutsche Ärztetag 1970 in Stuttgart erhob dann mehrheitlich keine generellen Einwände mehr. Er bezeichnete diese nicht mehr als standeswidrig, aber empfahl sie auch nicht ausdrücklich. Ich entsinne mich sehr deutlich, dass ich damals bereits der Auffassung war, hier verletze der Mensch unter Missbrauch des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts eine ihm von der Natur selbst errichtete Grenze, einen kategorischen Imperativ des menschlichen Seins. Ich entsinne mich dieser meiner damaligen Auffassung um so deutlicher, als ebenfalls in die Siebzigerjahre eine lebhafte Diskussion zum Thema „Sterbehilfe als Lebenshilfe“ fällt, in der ich mich eindeutig gegen die Straffreiheit auch von „passiver“ Sterbehilfe ausgesprochen habe. Das geschah mit dem Hinweis, dass der Mensch gegebenenfalls, seinem Gewissen folgend, auch gegen geltendes Strafrecht handeln müsse. Er könne dann lediglich auf einen einsichtigen Richter hoffen, der wohl wissen sollte, dass als unverzichtbarer Bestandteil jeder sittlichen Rechtsordnung auch Gnade zu gelten habe. Prof. Dr. J. F. Volrad Deneke, Axenfeldstraße 16, 53177 Bonn Armutszeugnis Scham und Mitleid erfüllen einen, wenn man liest, was die Herren Hoppe und Sewing sowie die Arbeitsgruppe „Präimplantationsdiagnostik“ der Bundesärztekammer unter ihrem „Beitrag zur Schärfung des Problembewusstseins“ zur Präimplantationsdiagnostik verstehen. Mitnichten wird hier irgendeine ethische Problematik angeschnitten. Der vorgelegte „Diskussionsentwurf“ ist indes ein bloßes Abwicklungspapier, welches die genaueren Modalitäten der Präimplantationsdiagnostik festzulegen versucht. Besonders wertvoll erscheint mir dabei die Erkenntnis, dass „kein Arzt gegen sein Gewissen verpflichtet werden kann, an einer Präimplantationsdiagnostik mitzuwirken“, oder aber die Feststellung, dass die involvierten Ärzte über entsprechende Kenntnisse und Erfahrung verfügen müssen. Hierüber besteht in der Tat ein ganz erheblicher Diskussionsbedarf. Der Umstand, dass in den einleitenden Worten eine Präjudiz explizit ausgeschlossen wird, täuscht den intelligenten Leser und Herrn Kardinal Meisner nicht darüber hinweg, dass selbstverständlich ein Ergebnis vorweggenommen wird. Indem nämlich darüber lamentiert wird, unter welchen organisatorischen Rahmenbedingungen die bereits bejahte Präimplantationsdiagnostik letztendlich vorgenommen werden soll. Mit Spannung erwarte ich den „Diskussionsentwurf“, der sich damit beschäftigen wird, unter welchen Kautelen dann schließlich die Unterscheidung zwischen „krank“ und „gesund“ getroffen wird und welches Antragsverfahren für die nachfolgende Elimination des „Kranken“ erforderlich ist. Der „Diskussionsentwurf“ ist ein bemerkenswertes Armutszeugnis der deutschen Ärzteschaft und trägt nichts zu der inhaltlichen, das heißt sittlichen Auseinandersetzung mit der beschriebenen Problematik bei. Vielmehr scheint die Chance vertan, aus ärztlicher Sicht gerade im Hinblick auf den rasanten Zuwachs an diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten auf die sehr umfangreichen ethischen Folgeprobleme hinzuweisen. Dass ein Theologe uns auf die immer schwierigeren Grenzen zwischen medizinisch Machbarem und sittlich Zulässigem hinweisen muss, ist bitter. Man darf es getrost als eine Zumutung bezeichnen, auf welchem Niveau sich Kardinal Meisner mit den deutschen Ärzten beziehungsweise ihren repräsentativen Gremien verständigen muss. Dass er hierbei einen direkten Vergleich zum ärztlichen Mitwirken an der historischen „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ heran- A-1134 Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 17, 28. April 2000 zieht, ist völlig zutreffend und legitim. So wie damals Ärzte es waren, die ihr Wissen in den Dienst einer verwerflichen Weltanschauung stellten, ist es auch heute wieder unser Berufsstand, der eine vermeintlich ethische Pragmatik zur Verfügung stellt, um ein im Grunde unethisches Vorgehen zu ermöglichen. Heute wie damals wird sich unser Stand jedoch letztlich nicht seiner Verantwortung entziehen können. Unter diesen Umständen ist zu überlegen, inwieweit Stellungnahmen und so genannte Diskussionsentwürfe der Bundesärztekammer zu derlei Dingen überhaupt noch sinnvoll sind. Zur „Schärfung des Problembewusstseins im gesamtgesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess“ tragen sie jedenfalls sicherlich nicht bei. Dr. med. Karl-Anton Kreuzer, Abteilung für Innere Medizin, Medizinische Fakultät Charité der Humboldt-Universität zu Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin Thema verfehlt Zu der Stellungnahme von Kardinal Meisner . . . gibt es nur einen Kommentar: Thema verfehlt. Dr. Konrad Ringleb, Brunnenstraße 97, 99974 Mühlhausen Ausweg: Adoption Im Vorwort zum Diskussionsentwurf der BÄK-Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik steht, dass die damit verbundenen ethischen Konflikte nur dann zu vermeiden sind, wenn „betroffene Paare bewusst auf Kinder verzichten oder sich zu einer Adoption entschließen“. Jedoch würden diese Alternativen von Paaren mit hohen genetischen Risikofaktoren „häufig nicht akzeptiert“. Aus früherer andrologischer Praxis wohl bekannt sind mir viele Vorbehalte gegen eine Adoption, die bei spermatologisch gesicherter Infertilität zur Erfüllung des Kinderwunsches damals einzig offen stand (abgesehen von der ethisch und [Personenstands-]rechtlich absolut unzulässigen anonym-heterologen Insemination). Verständliche Ängste oder Vorurteile („Blamage“ für das Paar beziehungsweise den Mann, befürchtete Unterschiebung „minderwertiger“ Kinder durch die Gesundheitsämter u. a.) waren aber durch einfühlsame Aufklärung des Paares zu mildern oder zu entkräften. Auch heute noch könnte sachkundige Adoptionsberatung viel erreichen, wenn zum Beispiel auch die langwierige, oft als Zumutung empfundene Gründlichkeit der für beide Seiten – Adoptiveltern und Kind – gleichermaßen verantwortlichen Behör- D O K U M E N T A T I O N DISKUSSION/KOMMENTAR den erläutert wird, andererseits dem Paar die Minimierung von Risiken – Ausschluss erbkranker oder erkennbar belasteter Kinder durch pädiatrische Voruntersuchung, gesundheitsamtliche Überprüfung des sozialen Milieus und der Gesundheit der Mutter sowie (nach Möglichkeit) des Vaters – und die Chance der freien Wahl eines Wunschkindes unter verschiedenen Kleinkindern (nur zu Kleinkindern wurde geraten) im Waisenhaus klargemacht wird. Dies und nicht zuletzt die mit der Adoption gegebene „Gleichberechtigung“ hinsichtlich der Rechte und Pflichten zur Erziehung und Förderung des Kindes lässt die Adoption dann in neuem Licht erscheinen, nicht mehr als bloßen Notbehelf. Selbstverständlich setzt eine Beratung, die auch das Selbstvertrauen und die (durch die Wartefrist oft belastete) Frustrationstoleranz des Paares stützen soll, ein taktvoll-hilfsbereites Verhalten der Behördenpersonen voraus, um präsumptive Adoptiveltern nicht zu verunsichern. Möglicherweise beruht die geringe Akzeptanz des Adoptionsangebots auf mehreren Gründen. Zu geringes ärztliches Interesse an einer „nur“ sozio-therapeutischen (aber oft glücklichen) – statt einer instrumentell machbaren – Erfüllung des Kinderwunsches, unpersönlicher Formalismus bei Behörden, falsche Scham vor dem „Makel“ einer ungewollt kinderlosen Ehe usw. Hätten hier nicht die Jugendämter, die Kirchen und die „Medien“ eine wertvolle, gegenüber der uninformierten Öffentlichkeit viel zu lange vernachlässigte Aufgabe? Professor Dr. med. Otto P. Hornstein, Danziger Straße 5, 91030 Uttenreuth Dank an Kardinal Meisner . . . Die ethische Verrohung geht einher mit marktförderlichem Mechanismus. Der Utilitarismus eines Herrn Lenin lässt grüßen, ebenso der Sozialdarwinismus aller Schattierungen. Die Bundesärztekammer sollte im Wissen um das üble Erbe der Reichsärztekammer konsequente Hüterin des Lebens sein! Will man in 50 Jahren wieder behaupten, die katholische Kirche hätte zu leise gewarnt? Wer das 20. Jahrhundert unter Marktaspekten gleich Ideologieaspekten betrachtet, kommt zu der Feststellung, dass insbesondere die katholische Kirche ein Markthemmungsfaktor ist, den das 20. Jahrhundert erfolgreich beseitigt hat. Dem Deutschen Ärzteblatt ist für die Veröffentlichung der Stellungnahme von Kardinal Meisner außerordentlich zu danken. Dr. med. Stephan Kunze, FriedrichHegel-Straße 31, 01187 Dresden Wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer Von richtigen rechtlichen Voraussetzungen ausgehen Zur rechtlichen Bewertung der Präimplantationsdiagnostik Der vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer vorgelegte „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ hat unterschiedliche Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden. Dabei ist immer wieder die Frage nach der Vereinbarkeit der Präimplantationsdiagnostik mit dem Embryonenschutzgesetz aufgeworfen worden, so auch von Riedel (DÄ Heft 10/2000), die feststellt, die Präimplantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum Embryonenschutzgesetz. Es überrascht, wie apodiktisch und vehement zugleich Riedel zur Einleitung ihres Plädoyers für eine unvoreingenommene Debatte behauptet, eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik sei mit dem Embryonenschutzgesetz (EschG) nicht vereinbar, ohne dass eine nähere Auseinandersetzung mit dem Gesetzestext stattgefunden hat. Ihrem Beitrag, in dem sie die durchaus nachvollziehbare Forderung einer gesetzlichen Regelung erhebt, stellt Riedel die These voran, die Präimplantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum ESchG. Diesem zufolge, so heißt es, dürfe eine Eizelle nur zum Zweck der Herbeiführung einer Schwangerschaft bei der Frau, von der die Eizelle stammt, künstlich befruchtet werden; ein Embryo dürfe auch nur zu diesem Zweck weiterentwickelt und ein extrakorporal erzeugter Embryo dürfe zu keinem anderen Zweck als zu seiner Erhaltung verwendet werden, siehe § 1 l Nr. 2, § 2 l und II ESchG. Ziel der Regelung der künstlichen Befruchtung im ESchG sei die Behandlung von Fertilitätsstörungen, also die Erfüllung des Kinderwunsches einer Frau oder eines Paares. Dieses von Riedel so betonte Ziel wird im ESchG jedoch gerade nicht ausdrücklich benannt. Riedels Aussagen zeigen vielmehr, dass hier der Wunsch des Bestehens eines Verbotes Mutter der Argumentation ist, mehr jedoch nicht. Ein allgemeines Verbot der Präimplantationsdiagnostik könnte sich aus § 1 l Nr. 2 ESchG herleiten. Dort heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe werde bestraft, wer es unter- nimmt, eine Eizelle zu einem anderen Zweck künstlich zu befruchten, als eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Wenn ein Arzt im Rahmen einer Invitro-Fertilisation (IVF) eine Eizelle befruchtet und diese durch Entnahme einer nicht mehr totipotenten Zelle auf bestimmte genetische Defekte untersucht, um je nach Befund den Embryo zu transferieren oder nicht, ist fraglich, ob der Arzt die Eizelle gemäß § 1 l Nr. 2 EschG – wie Riedel behauptet – zu einem anderen Zweck künstlich befruchtet, als die Schwangerschaft einer Frau herbeizuführen – nämlich vielmehr, um eine „Selektionsmöglichkeit“ zu eröffnen. Tatbestandslos handelt, wer mit der Absicht handelt, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Riedel scheint der Ansicht zu sein, dass eine solche Absicht bei der Präimplantationsdiagnostik zum Zeitpunkt der Befruchtung noch nicht besteht. Diese Auffassung wird den tatsächlichen Gegebenheiten jedoch nicht gerecht, da sie eine künstliche Aufteilung eines einheitlichen Vorganges vornimmt. Die Betroffenen handeln von Beginn der IVF mit dem Bewusstsein, dass die gesamte Behandlung auf Herbeiführung einer Schwangerschaft ausgerichtet ist. Dass die Schwangerschaft noch von einer Bedingung abhängig gemacht wird, stellt dabei ein separat zu behandelndes Problem dar. So ist die Frage, ob die Absicht deshalb verneint werden könnte, weil ein später vorzunehmender Teilakt noch von einer weiteren Bedingung, das heißt der Entscheidung der Mutter zum Transfer, abhängig gemacht werden soll. Die Absicht wird allein nach der voluntativen Beziehung zwischen Täterpsyche und Taterfolg definiert. Bewusst herbeigeführte und erwünschte Erfolge sind immer beabsichtigt, auch wenn ihr Eintritt nicht sicher ist (Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band l, 3. Auflage, § 12 Rdnr. 11; Cramer in: Schönke/Schröder, 25. Auflage, § 15 Rdnr. 67, m. w. N.). Das Abhängigmachen der Vornahme eines zukünftig vorzunehmenden Teilaktes von einem Bedingungsschritt, hier der Annahme zur Übertragung eines Embryos auf die Mut- Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 17, 28. April 2000 A-1135 D O K U M E N T A T I O N KOMMENTAR ter, schließt die Absicht, eine Schwangerschaft herbeizuführen, gerade nicht aus. Eine Strafbarkeit nach § 1 l Nr. 2 ESchG kann daher nicht bejaht werden, wenn die Fertilisation erfolgt. Dieses Ergebnis ist naheliegend, bedenkt man, dass auch bei der Vornahme einer regulären IVF ohne Präimplantationsdiagnostik der Arzt den anschließenden Embryotransfer stets von der Bedingung abhängig macht, dass sich die Patientin auch später noch bereit erklärt, diesen vornehmen zu lassen (hierzu und im Folgenden demnächst Schneider in MedR 2000. Auf dem Weg zur Selektion – Strafrechtliche Aspekte der Präimplantationsdiagnostik). Weiterer Anknüpfungspunkt für eine mögliche Strafbarkeit nach § 1 l Nr. 2 ESchG kann sein, die „Ausschließlichkeit“ der Zweckverfolgung in Zweifel zu ziehen. Die Frage ist, ob nur derjenige tatbestandslos handelt, der die Eizelle ausschließlich deshalb künstlich befruchtet, um eine Schwangerschaft der Frau herbeizuführen, von der der Embryo stammt, oder ob der Täter auch einen anderen Nebenzweck mit der künstlichen Befruchtung verfolgen kann, ohne tatbestandsmäßig zu handeln. Aus dem Gesetzestext geht nicht hervor, dass die Absicht der Herbeiführung einer Schwangerschaft durch die gleichzeitige absichtliche Verfolgung eines anderen Zweckes – nämlich zuvor die genetische Struktur des Embryos zu prüfen – ausgeschlossen ist. Dieses Ergebnis ließe sich nur im Wege unzulässiger erweiternder Interpretation oder Analogie gewinnen. Die äußerste Auslegungsgrenze markiert jedoch nach der Rechtsprechung des BVerfG (BVerfGE 73, 206 [234 ff.]; 92, 1 [12]) und vorherrschender Ansicht im Schrifttum (Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, S. 323 m. w. N.) der mögliche Wortsinn eines gesetzlichen Begriffs. Im Strafrecht gilt ferner das Verbot der strafbarkeitsbegründenden oder -schärfenden Analogie (Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band l, 3. Auflage, § 5 Rdnr. 26 ff., m. w. N.). Art. 103 II GG macht die Strafbarkeit einer Tat von einer gesetzlichen Regelung abhängig und verbietet eine Ausdehnung der Strafbarkeit über den Gesetzeswortlaut hinaus auf ähnlich strafbedürftig und strafwürdig erscheinende Verhaltenweisen. Diese engen Grenzen verkennt Riedel. Für die Annahme einer „Ausschließlichkeit“ des verfolgten Zwecks im Sinne des Verbotes eines Nebenzwecks sind im Gesetz keine Anhaltspunkte ersichtlich. Von Riedel wird ferner der mit „Missbräuchliche Verwendung“ überschriebene § 2 l EschG als Argument für ein Verbot genannt. Dort heißt es, dass derjenige, der einen extrakorporal erzeugten [. . .] menschlichen Embryo [. . .] zu einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck [. . .] verwende, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werde. Fraglich ist, ob es eine „missbräuchliche Verwendung“ darstellt, den Embryo nach erfolgter Biopsie und der Feststellung von bestimmten genetischen Defekten nicht zu transferieren, sondern in der Petrischale liegen zu lassen, bis er sich nicht weiterentwickeln kann und daraufhin abstirbt. Dies setzt zunächst voraus, dass die „Verwendung“ im Sinne von § 2 l EschG auch durch Unterlassen begehbar ist (andere Auffassung Günther, in: Keller/ Günther/Kaiser, § 2 Rn. 34). Unterstellt man dies, ist im Falle der Vornahme eine Präimplantationsdiagnostik – welche im Einverständnis und auf Bitten des betroffenen Ehepaares durchgeführt wird – § 2 l ESchG in Form des Unterlassens deshalb nicht einschlägig, weil dem Arzt die Einsetzung der „selektierten“ Eizelle entweder gar nicht möglich ist oder es ihm nicht zuzumuten wäre, gegen den Willen der Patientin und entgegen dem Ziel der Behandlung die Eizelle dennoch – etwa unter Täuschung der Patientin – zu transferieren. Im Fall der Präimplantationsdiagnostik ist die Erfüllung des Tatbestandes von § 2 l ESchG durch Nichtübertragung des Embryos, sondern Liegenlassen, wenn die Patientin einen Transfer der belasteten Zelle ablehnt, nicht strafbar. PGD im Deutschen Ärzteblatt Die auf diesen Seiten dokumentierten Stellungnahmen und Leserzuschriften beziehen sich auf den von der Bundesärztekammer vorgelegten, von deren Wissenschaftlichem Beirat ausgearbeiteten „Diskussionsentwurf zu einer Richtlinie zur Präimplantationsdiagnostik“ (PGD = preimplantation genetic diagnosis) (Heft 9) sowie folgenden Beiträgen: „Auftakt des öffentlichen Diskurses“ von Sabine Rieser (Heft 9), „Am Rande der schiefen Bahn“ von Norbert Jachertz (Heft 9), „Plädoyer für eine unvoreingenommene, offene Debatte“ von Ulrike Riedel (Heft 10), „Mensch von Anfang an“ von Joachim Kardinal Meisner (Heft 14). Zu einigen zentralen Punkten der Diskussion nimmt der Wissenschaftliche Beirat in den beiden Kommentaren Stellung. NJ A-1136 Deutsches Ärzteblatt 97, Heft 17, 28. April 2000 Ein Verstoß gegen § 2 l ESchG wäre ferner denkbar, wenn man in der Entnahme und Untersuchung einer Zelle eine Verwendung des Embryos sehen würde, die einem nicht seiner Erhaltung dienenden Zwecke gewidmet ist, das heißt mit anderen Worten, wenn man argumentiert, „das Untersuchen“ diene nicht der Erhaltung und würde somit eine missbräuchliche Verwendung darstellen. Entnimmt der Arzt dem Embryo eine Zelle und beeinträchtigt das die späteren Weiterentwicklungschancen nicht, insofern als der Embryo noch mit den regulären Erfolgsaussichten auf Herbeiführung einer Schwangerschaft in den Mutterleib übertragen werden kann, ist die Behandlung als „neutrale Handlung“ zu werten. Die Untersuchung ist zwar nicht notwendig für die Erhaltung, zugleich beeinträchtigt sie eine solche Erhaltung auch nicht. Schon der objektive Tatbestand scheint nicht erfüllt zu sein. § 2 l ESchG verlangt jedoch weiter als spezielles subjektives Tatbestandsmerkmal die Absicht des Täters, einen nicht der Erhaltung des Embryos dienenden Zweck zu verfolgen. Eine solche Absicht in Form zielgerichteten Wollens ist jedoch nicht gegeben. Es kommt dem Arzt nicht darauf an, mit der Handlung einen Zweck zu verfolgen, der nicht der Erhaltung des Embryos dient. Ein Verstoß gegen § 2 l ESchG ist daher auch durch die Untersuchung nicht gegeben. Was den § 2 II ESchG betrifft, in dem es heißt: „Ebenso wird bestraft, wer zu einem anderen Zweck als der Herbeiführung einer Schwangerschaft bewirkt, dass sich ein menschlicher Embryo extrakorporal weiterentwickelt“, so muss auch hier auf das Erfordernis der Absicht, das heißt des dolus directus ersten Grades, hingewiesen werden. Ein solches zielgerichtetes Wollen ist nicht gegeben. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Ausgangspunkt Riedels, die Präimplantationsdiagnostik stehe im Widerspruch zum ESchG, nicht richtig ist. Welche Konsequenz die fehlende Regelung der Präimplantationsdiagnostik in Zukunft haben wird und ob der Gesetzgeber sie regeln sollte, ist damit jedoch noch keineswegs geklärt. Den Autoren des Diskussionsentwurfs eine einseitige Fehlinterpretation des Embryonenschutzgesetzes und eine schon deshalb falsche Position zur Präimplantationsdiagnostik vorzuwerfen, ist verfehlt. Der Entwurf dient gerade dazu, die öffentliche Diskussion anzuregen. Die in ihm vertretene Position ist rechtlich jedenfalls möglich. Man sollte bei der Beurteilung von richtigen rechtlichen Voraussetzungen ausgehen. Prof. Dr. Dr. med. h. c. H.-L. Schreiber, Direktor des Juristischen Seminars, Postfach 37 44, 37027 Göttingen