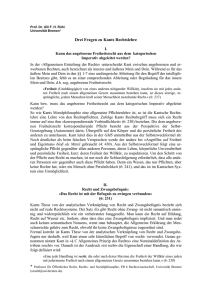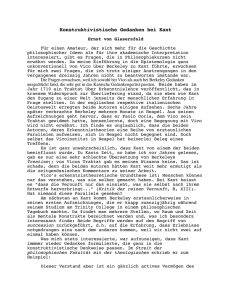Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden. Zwischen apriorischen
Werbung

Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden. Zwischen apriorischen Rechtsprinzipien und politischer Praxis Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie in der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen vorgelegt von Frédéric Rimoux aus Wissembourg (Frankreich) 2015 Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen Dekan: Prof. Dr. Jürgen Leonhardt Hauptberichterstatter: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otfried Höffe Mitberichterstatter: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Kristian Kühl Tag der mündlichen Prüfung: 26. Juli 2012 Universitätsbibliothek Tübingen, TOBIAS-lib Meinen Eltern in Liebe und Dankbarkeit gewidmet DANKSAGUNG Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung meiner im Sommer 2012 an der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen eingereichten Promotionsschrift. Eine Dissertation parallel zu meinen beruflichen Tätigkeiten zu verfassen, war für mich eine nicht immer einfache Aufgabe. Dieses Vorhaben ist mir nur gelungen, da ich vielerseits außerordentliche Unterstützung bekommen habe, für die ich mich auf dieser Seite bedanken möchte. Zunächst einmal möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Volker Gerhardt bedanken, ohne dessen Ermutigung aus meinen früheren Arbeiten eine Dissertation zu schreiben, ich vermutlich niemals diese Arbeit begonnen hätte. Die vorliegende Promotionsarbeit entstand unter der wissenschaftlichen Betreuung von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otfried Höffe, dem mein herzlichster Dank für seine beratende Unterstützung und seine zahlreichen anregenden Hinweise gilt. Besonderen Dank schulde ich auch Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Kristian Kühl für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die kritischen Anmerkungen zu meiner Arbeit, welche mich zu weiteren Überlegungen veranlasst haben. Ebenfalls bedanke ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden, die trotz meiner zurückgezogenen Lebensweise in den vergangenen Jahren immer viel Verständnis für mich aufgebracht haben. Insbesondere möchte ich mich aufrichtig bei Nadezda Perunovic und Dr. Christian Sigmund bedanken, weil sie mich in vielfältiger Weise bei dem Zustandekommen dieser Arbeit unterstützten. Ihre Unterstützung war sehr wichtig für mich und wurde von meiner Seite immer mit einem Gefühl tiefer Dankbarkeit wahrgenommen. Meinem Großvater, Marcel Rimoux, bin ich unendlich dankbar für die Liebe und die Fürsorge, die er mir all die Jahre gegeben hat. Großen und herzlichen Dank gilt vor allem meinen Eltern, Alain und Erika Rimoux, für ihre kontinuierliche Unterstützung und Ermutigung. Ich bin ihnen von ganzem Herzen für alles, was sie mir auf dem Weg mitgegeben haben dankbar sowie für jegliche Unterstützung von ihrer Seite: Sei es ihre logistische Hilfe oder für ihr Zuhören, ihren über all die Jahre anhaltenden Glauben an mich sowie auch für die Geduld und das Verständnis, welches sie mir entgegengebracht haben. Die größte Geduld hat jedoch meine geliebte Ehefrau, Stéphanie Rimoux, bewiesen. Sie hat mich nicht nur bei der Korrektur des Manuskripts tatkräftig unterstützt, sondern hat auch ausgesprochen viel Verständnis dafür aufgebracht, dass ich den größten Teil unserer gemeinsamen freien Zeit mit meiner Doktorarbeit verbringen musste. Sie hat mir auch in dieser wenig geruhsamen Phase stets Mut gemacht und ist gerade in den schwierigsten Zeiten immer stark an meiner Seite gestanden. Für all dies möchte ich ihr nochmals meine tiefste Dankbarkeit aussprechen. Paris, in Mai 2014 Frédéric Rimoux INHALT ZITIERWEISE UND ABKÜRZUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 EINLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 HAUPTTEIL A: KANTS VERNUNFTRECHTLICHE BEGRÜNDUNG EINER FRIEDENSFÄHIGEN WELTORDNUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1. KAPITEL: KANTS VERNUNFTBEGRÜNDUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS . . . . . . . . . . . . . . 1. Der praktische Freiheitsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Die doppelte Gestalt des Menschen als ein mit praktischer Vernunft begabtes Naturwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Die Lehre der doppelten Gesetzgebung der praktischen Vernunft . . . . . . . . . . . 1.3 Die Konstitution des juridischen Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Der Vernunftbegriff des Rechts und die Befugnis zu zwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Das Recht der Menschheit und die allgemeine Einteilung der Rechtspflichten . . . . . 3.1 Das angeborene Recht der Menschheit in der eigenen Person . . . . . . . . . . . . . 3.2 Kants Neuinterpretation der ulpianischen Formeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Der systematische Stellenwert der inneren Rechtspflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die notwendige Möglichkeit des Privatrechts in Ansehung äußerer Gegenstände . . 5. Der Beweis der Notwendigkeit des öffentlichen Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Der Naturzustand der Menschen als Vernunftidee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Die Idee des ursprünglichen Vertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KAPITEL: DIE NOTWENDIGEN RECHTSSCHRITTE AUF DEM WEG ZUM EWIGEN FRIEDEN 1. Die Präliminarartikel: Die negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Systematische Einordnung der Präliminarartikel im Rahmen der Kantischen Rechtstheorie vom Weltfrieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Erster Präliminarartikel: Das Verbot des geheimen Vorbehalts bei Friedensschlüssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Zweiter Präliminarartikel: Das Verbot des Erwerbs eines für sich bestehenden Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Dritter Präliminarartikel: Das Verbot des stehenden Heeres . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Vierter Präliminarartikel: Das Verbot der Staatsschulden für äußere Konflikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Fünfter Präliminarartikel: Das Verbot der gewalttätigen Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Sechster Präliminarartikel: Das Verbot friedensverhindernder Handlungen . . 2. Die Definitivartikel: Die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter Staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Erster Definitivartikel: Das Recht in den jeweiligen Staaten . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Zweiter Definitivartikel: Das Recht der Staaten im Verhältnis zueinander . . . 2.3 Dritter Definitivartikel: Das Recht des Weltbürgers jenseits des eigenen Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Über das Verhältnis der Definitivartikel zueinander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1- 23 25 25 26 30 31 35 35 38 40 44 52 52 58 61 64 65 65 69 71 73 75 77 79 84 86 101 114 122 3. KAPITEL: DER POLITISCHE REALITÄTSSINN DER KANTISCHEN RECHTSTHEORIE VOM WELTFRIEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Die juridische Legalität als notwendige und hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Die Einschränkung der juridischen Forderungen auf die Legalität der Handlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Das Gedankenexperiment bezüglich des Volks von Teufeln . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Die mit Verstand begabten selbstsüchtigen Teufel und der Mechanismus der Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Über das Böse in Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Kants Lehre vom radikalen Bösen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Die durch Erfahrung bestätigte Universalität des Bösen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Das Böse im Verhältnis der Völker und die weiterbestehende Möglichkeit des Friedens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HAUPTTEIL B: KANTS LEHRE VON DER POLITIK UND DAS PROBLEM DER ANWENDUNG DER VERNUNFTPRINZIPIEN AUF DIE ERFAHRUNGSFÄLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KAPITEL: ZUM VERHÄLTNIS VON MORAL, RECHT UND KLUGHEIT IN KANTS RECHTSTHEORIE VOM WELTFRIEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kants Definition der Klugheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kants Lehre von den hypothetischen Imperativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Die Unterscheidung zwischen kategorischem und hypothetischem Imperativ . 2.2 Die Unterscheidung zwischen technischem und pragmatischem Imperativ . . . 3. Kants Ablehnung des Anspruches der Politik auf Autonomie . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Der Anspruch der Politik auf Unabhängigkeit von Moral und Recht . . . . . . . . . 3.2 Kants Zurückweisung des Anspruches der Politik auf Autonomie . . . . . . . 4. Die geltungstheoretische Abhängigkeit der Politik von der Moral sowie dem Recht 4.1 Kants Bestimmung der Politik als ausübende Rechtslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Kants Gegenüberstellung von moralischer Politik und politischem Moralismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kants Zurückweisung eines despotisierenden Moralismus in der Politik . . . . . . . . . . . 6. Die Einhaltung der Rechtspflichten als Gebot der Sittlichkeit sowie als Ratschlag der Klugheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Die Einhaltung der Rechtspflichten ist möglich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Die Einhaltung der Rechtspflichten ist klug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KAPITEL: ÜBER DEN SYSTEMATISCHEN STELLENWERT DER URTEILSKRAFT INNERHALB KANTS RECHTSTHEORIE VOM WELTFRIEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Das Problem des unendlichen Regelregresses und der Versuch, die Urteilskraft für Kants praktische Philosophie zu rehabilitieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Das Problem des unendlichen Regelregresses in Kants praktischer Philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Das Risiko der Willkür bei der Anwendung der Vernunftprinzipien . . . . . . . . . 1.3 Kants scheinbare Abwertung der Urteilskraft und die Versuche, jene für seine praktische Philosophie zu rehabilitieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Bedeutung der reinen praktischen Urteilskraft für die Beurteilung der Prinzipien der Moralität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Die Aufgabe der praktischen Urteilskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Der Widersinn der praktischen Urteilskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Das Naturgesetz als Typus des Sittengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2- 125 127 127 130 131 137 137 142 147 153 154 156 159 159 164 174 174 176 178 178 181 184 186 186 188 190 191 191 193 195 197 197 200 202 3. Die Bedeutung der erfahrungsgeschärften Urteilskraft bei der Anwendung der Vernunftprinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Das Problem der Identifikation einer moralischen Aufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Das Problem der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Das Problem der Abwägung einander entgegengesetzter Prinzipien . . . . . . . . . 4. Die Vereinbarkeit von absoluter Verbindlichkeit universeller Vernunftprinzipien und individuellen Einzelfallentscheidungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Die fallgerechte Anwendung der Vernunftprinzipien als eine kontextabhängige und kreative Kompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Die zwei Fallklassen möglich auftretender Anwendungsfehler . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Die Urteilskraft als ein nicht lehrbares, jedoch durch Erfahrung zu verbesserndes Vermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Über das Verhältnis von Philosophie und Politik bei Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. KAPITEL: DAS PROBLEM DER WIDERSPRUCHSFREIEN ANWENDUNG DER APRIORISCHEN RECHTSPRINZIPIEN IN DER POLITISCHEN WIRKLICHKEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Das Problem der Pflichtenkollision am Beispiel Kants rechtsphilosophischer Erörterung der Lüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Kants Definition der Lüge: Die Unterscheidung von „Wahrheit“ und „Wahrhaftigkeit“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Kants Antwort auf Benjamin Constant in der Schrift Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Kants Argumentation zum rechtsphilosophischen Problem der Lüge in den weiteren Schriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Das Problem der Pflichtenkollision am Beispiel des Lügenverbotes und des Hilfsgebotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kants Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft vor dem Hintergrund seiner Theorie der Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Die Widersprüchlichkeit eines Gesetzes in Bezug auf bloß erlaubte Handlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Kants Bestimmung und Begründung der Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Kants Ablehnung von Ausnahmen von den praktischen Gesetzen . . . . . . . . . . . 2.4 Die Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft und die Gefahr der Willkür . . . . . . . 2.5 Die Erlaubnisgesetze im Zusammenhang mit Kants Reformkonzept . . . . . . . . 204 205 206 207 208 209 210 212 215 219 220 221 223 230 235 242 243 244 246 248 250 SCHLUSSFOLGERNDE BETRACHTUNG: DIE PUBLIZITÄT ALS PRÜFSTEIN MORALISCHER POLITIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 LITERATURVERZEICHNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 -3- ZITIERWEISE Kants Schriften werden nach den Seitenzahlen der Akademie-Ausgabe zitiert. Kants Schriften werden durch Abkürzungen angeführt, wobei die erste Zahl sich auf den Band der AkademieAusgabe bezieht und die anschließend durch Komma abgesetzte Zahl sich auf die Seitenzahl bezieht (z. B. Frieden: VIII, 366). Im Falle der Kritik der reinen Vernunft werden zusätzlich die Seitenzahlen der ersten (= A) oder der zweiten Auflage (= B) angegeben. Auf sonstige Literatur wird in den Fußnoten mit Verfassername, Titel, Erscheinungsort und -jahr Bezug genommen. Mögliche Zusätze, aber auch Auslassungen innerhalb von Zitaten werden in eckigen Klammern hinzugefügt. Durch solche eckigen Klammern werden ebenfalls grammatische Anpassungen gekennzeichnet. ABKÜRZUNGEN Anfang Anthropologie Aufklärung Frieden Gemeinspruch GMS Idee KpV KrV KUK Moralphilosophie Collins Praktische Philosophie Powalski Prolegomena Reflexion Religion RL Streit Theodizee TL Über die Pädagogik Verkündigung Vermeintes Rechts Vorarbeit VT Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (VIII 107-123) Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (VII 117-334) Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (VIII 33-42) Zum ewigen Frieden (VIII 341-386) Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (VIII 273-313) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (IV 385-464) Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (VIII 1531) Kritik der praktischen Vernunft (V 1-163) Kritik der reinen Vernunft (A: IV 1-252; B: III 1-552) Kritik der Urteilskraft (V 165-485) Moralphilosophie Collins (XXVIII 237-473) Praktische Philosophie Powalski (XXVII 91-236) Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (IV 253-384) Reflexionen (XIX ff.) Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (VI 1-202) Die Metaphysik der Sitten, I. Teil: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (VI 203-372) Der Streit der Fakultäten (VII 1-116) Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee (XXIII 255-271) Die Metaphysik der Sitten, II. Teil: Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre (VI 373-492) Über die Pädagogik (IX 437-500) Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie (VIII 411-422) Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (VIII 423-430) Handschriftlicher Nachlaß, Vorarbeiten und Nachträge (XXIII) Von einem neuerdings erhobenen Ton in der Philosophie (VIII 387-406) -4- EINLEITUNG Das Thema der vorliegenden Arbeit ist Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden sowie das Problem der Anwendung der apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Gesamtheit der Erfahrungsfälle. Die Entscheidung, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, bedarf jedoch vorab einer sorgfältigen Begründung, da es letzten Endes keinen Mangel an Aufsätzen und Monographien über Kants Rechtsphilosophie im Allgemeinen und seiner Friedenstheorie im Speziellen gibt. a) Die Rehabilitierung der Kantischen Rechtstheorie vom Weltfrieden In den vergangenen dreißig Jahren hat Kants politische Philosophie eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit gefunden, welche sie in der politischen Ideengeschichte bisher niemals im selben Ausmaß genossen hatte.1 Kants Friedenstraktat hatte zwar kurz nach seiner Veröffentlichung europaweit eine beachtliche Rezeption erfahren, aber relativ schnell und über einen langen Zeitraum hinweg ist jedoch seine politische Philosophie in den Hintergrund getreten.2 Dies lässt sich aus zwei voneinander unabhängigen Gründen erklären. Dass Kant mit seiner politischen Philosophie lange nicht dieselbe Beachtung gefunden hat wie die Kritik der reinen Vernunft und die Kritik der praktischen Vernunft liegt zunächst darin begründet, dass seine kleineren geschichts- und rechtsphilosophischen Schriften, wie beispielsweise die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Über den Gemeinspruch oder Zum ewigen Frieden, herablassend als populärere Gelegenheitsarbeiten interpretiert worden sind. In diesem Zusammenhang sei lediglich auf die Vorlesungen Über Kants Politische Philosophie hinzuweisen, welche von Hannah Arendt im Jahre 1970 gehalten wurden. In diesen Vorlesungen spricht Hannah Arendt den Kantischen politischen Schriften die „Qualität und Tiefe“3 seiner anderen Werke ab. Der ironische Ton des philosophischen Entwurfes Zum ewigen Frieden wird zudem als Beleg dafür angeführt, dass Kant seine bei weitem bedeutendste politische Schrift „nicht zu ernst nahm“.4 Dementsprechend sucht Hannah Arendt die Begründung der Kantischen politischen Philosophie nicht in der praktischen Vernunft, sondern in der ästhetischen Urteilskraft und erliegt dabei einer Fehlinterpretation. Die Rechtslehre galt ihrerseits lange als ein misslungenes Alterswerk, von welchem sich sogar überzeugte Kantianer enttäuscht abwandten.5 Symptomatisch für die Geringschätzung der Rechtslehre ist, dass bis vor Kurzem in den juridischen Darstellungen der Rechts- und Staatsphilosophie nur selten ein Kapitel bezüglich Kants Rechtslehre zu finden war. Für die Juristen wie auch die Philosophen erschien Kant über eine lange Zeit 1 Wenn wir in Bezug auf Kant von einer „politischen Philosophie“ sprechen, dann wird dieser Ausdruck als Oberbegriff für Kants Rechts- und Friedenstheorie einerseits sowie seiner Geschichtsphilosophie andererseits verwendet. Die politische Philosophie Kants bezieht sich sowohl auf die Frage der Bestimmung und Begründung der apriorischen Prinzipien des Rechts als auch auf die (weniger beachtete) Frage der Anwendung dieser Prinzipien auf die Erfahrungsfälle. Darüber hinaus beschäftigt sich Kants politische Philosophie mit der Frage, ob die bisherige Geschichte der Menschengattung zur Hoffnung berechtigt, trotz aller Rückschritte und Umwege einen allmählichen Fortschritt auf dem Weg zum ewigen Frieden anzunehmen. 2 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 183ff. 3 Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, München/Zürich 1985, S. 17. 4 Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, München/Zürich 1985, S. 17. 5 Vgl. Ludwig, Bernd: Einleitung, in: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Hamburg 1998, S. XII. -5- hinweg als eine Randfigur der Rechtsphilosophie. Er stand dabei im Schatten von anderen Rechtsphilosophen wie Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau oder Hegel. Dies lässt sich im Wesentlichen auf zweierlei Gründe zurückführen. Erstens: Kants rechtsphilosophisches Hauptwerk, die Rechtslehre, galt lange als ein Werk von geringer philosophischer Qualität. Exemplarisch hierfür schreibt Schopenhauer, dass die Rechtslehre eine „sonderbare Verflechtung einander herbeiziehender Irrtümer“ sei, die sich aus seiner Sicht nur „aus Kants Altersschwäche“6 erklären lassen. Zweitens: Ein sachlicher Grund für diese verbreitete Sichtweise liegt bestimmt auch in der äußeren Gestalt der Rechtslehre, die viel Verwirrung und Ratlosigkeit nach sich gezogen hat. Der Verdacht, dass es sich dabei um ein mit nachlassenden geistigen Kräften verfasstes Alterswerk Kants handelt, bot eine einfache wie bequeme Erklärung, welche ihrerseits eine intensivere Beschäftigung mit der nicht immer einfachen Argumentation der Rechtslehre ersparte. Lange Zeit vernachlässigt, erfreut sich Kants Rechts- und Friedenstheorie mittlerweile eines weltweiten und fachübergreifenden Interesses. Selbst wenn die Rechtslehre sich weiterhin schwerer, und auch nicht immer unberechtigter Kritik ausgesetzt sieht, hat sich die Einsicht in ihre philosophische Qualität allmählich durchgesetzt. Es wird außerdem argumentiert, dass die vermeintliche Unzugänglichkeit der Rechtslehre nicht dem fortgeschrittenen Alter ihres Autors, sondern vielmehr einer verfehlten Drucklegung verdankt.7 Es hat lange gedauert, bis Kants Rechts- und Friedenstheorie letztlich von den Kommentatoren verstanden und übernommen wurden. Seit den 1980er Jahren nimmt die Zahl der Monographien und Aufsätze zur Kants politischen Philosophie jedoch wieder einen beachtlichen Platz in der Fachliteratur ein. Heute sind sogar Bezugsnahmen auf Kant sowohl in der politischen Philosophie als auch in der Wissenschaft der internationalen Beziehungen weitverbreitet. Dass sich Philosophen und Politikwissenschaftler in den letzten Jahrzehnten wieder Kants politischer Philosophie intensiver zugewandt haben, ist im Wesentlichen zwei Gründen zuzuschreiben. Zum einen begann mit dem Erscheinen des Buches A Theory of Justice von John Rawls im Jahre 1971 ein bis einschließlich heute anhaltender Aufschwung der politischen Philosophie im Allgemeinen und des politischen Liberalismus im Speziellen. Diese Renaissance der politischen Philosophie entfaltete sich unter anderem in der Debatte zwischen Kommunitaristen und Liberalen. Während die Ersteren sich in ihrer Argumentation eher an Aristoteles orientieren, berufen sich die Zweiten vornehmlich auf Kant.8 Zum anderen diente Kants Friedenstheorie nach dem unerwarteten Ende des OstWest-Konflikts als Bezugspunkt in der Diskussion um die Zukunft der neuen internationalen Ordnung. Als einer der wichtigsten Vertreter eines normativen Ansatzes der internationalen Beziehungen wurde Kant zum Gegenstand zahlreicher Diskussion bezüglich normativer 6 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung, Frankfurt a. M., 1986, S. 459f. Die These vom verfehlten Alterswerk ist aber auch deshalb zurückzuweisen, weil ein massiver Abfall der Arbeitsproduktivität bei Kant erst zwei Jahre nach Abschluss des Manuskripts der Rechtslehre zu verzeichnen ist. Vgl. Ludwig, Bernd: Einleitung, in: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Bernd Ludwig, Hamburg 1998, S. XXVII. 7 Bernd Ludwig vertritt die These, dass „der Schrift von 1797 ein auf dem Wege zur Drucklegung verderbtes Manuskript zugrunde [lag], welches sich mittels philologischer Methoden aus dem überlieferten Text rekonstruieren lässt“, in: Ludwig, Bernd: Einleitung, in: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Hamburg 1998, S. XXIX. 8 Einen informativen Überblick über diese Fragen bietet Wolfgang Kersting in der beigefügten Einleitung „Kant und die politische Philosophie der Gegenwart“ seiner Monographie Wohlgeordnete Freiheit. Vgl. Ders.: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 13-70. -6- Probleme der neuen Weltordnung, wie etwa bei Fragen des Interventionsrechts9 oder der Reform der Vereinten Nationen.10 Die Wiederentdeckung des sogenannten „KantischenTheorems“ bezüglich der Friedfertigkeit der Demokratien führte außerdem zu einer kontroversen Debatte, welche wie keine in der Wissenschaft der internationalen Beziehungen dermaßen große Aufmerksamkeit gefunden hat. Die ursprüngliche Behauptung, dass Demokratien (zumindest gegeneinander) keine Kriege führen, hat bis heute eine erhebliche Differenzierung, Ausweitung und Fortentwicklung erfahren.11 b) Schwerpunkte und Mängel der jüngeren Literatur zu Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden Es wurde gesehen, dass Kants Rechts- und Friedenstheorie heute nicht mehr zu entdecken ist. Die mangelnde Beachtung, unter welcher sie in den 1980er Jahren noch gelitten hat, hat sich erheblich verbessert. Die Schrift Zum ewigen Frieden ist zusammen mit der Rechtslehre aus dem Kanon der großen Werke der abendländischen politischen Philosophie nicht mehr wegzudenken.12 Die Forschung hat beide Schriften ausgiebig diskutiert. Vor allem um die Zeit des 200. Jahrestages des Erscheinens Kants philosophischen Entwurfes Zum ewigen Frieden sind weltweit eine Vielzahl von Sammelbänden, Monographien und Aufsätzen bezüglich Kants Friedenstheorie erschienen.13 In diesen zahlreichen Veröffentlichungen wurden viele wichtige Aspekte Kants politischer Philosophie diskutiert und ausgeleuchtet. Viele Mängel der Forschung konnten somit weitgehend behoben werden. Dazu zählen Themen wie etwa das Kriegsrecht, der Charakter des Völkerrechts, das 9 Siehe die entsprechenden Textstellen in: Hoffmann, Stanley: Duties Beyond Borders. On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics, New York 1981; Rawls, John: The Law of Peoples (with The Idea of Public Reason revisited), Cambridge (Massachusetts)/London 1999. 10 Vgl. Archibugi, Daniele: From the United Nations to Cosmopolitan Democracy, in: Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order, hrsg. v. Daniele Archibugi und David Held, Cambridge 1995, S. 121-162; Albrecht, Ulrich: Kants Entwurf einer Weltfriedensordnung und die Reform der Vereinigten Nationen, in: Friedenswarte 71, 1995, S. 195-210; Höffe, Otfried: Ausblick: die Vereinten Nationen im Lichte Kant, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 245-272. 11 In der umfassenden fachwissenschaftlichen Literatur zur sogenannten „Theorie vom demokratischen Frieden“ sei unter anderem auf die folgenden Beiträge hingewiesen: Doyle, Michael W.: Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, Part I & II, in: Philosophy and Public Affairs 12(3-4), 1983a-b, S. 205-235 und S. 323-353; Hasenclever, Andreas: Liberale Ansätze zum Demokratischen Frieden, in: Theorien der Internationalen Beziehungen, hrsg. v. Siegfried Schieder und Manuela Spindler, Opladen 2003, S. 199-226; Huntley, Wade: Kant’s Third Image: Systemic Sources of the Liberal Peace, in: International Studies Quarterly 40, 1996, S. 4576; Hurrel, Andrew: Kant and the Kantian Paradigm in International Relations, in: Review of International Studies 16, 1990, S. 183-205; Moravcsik, Andrew: Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, in: International Organization 51:4, 1997, S. 513-553; Russett, Bruce: Why Democratic Peace?, in: Debating the Democratic Peace, hrsg. v. Michael Brown, Sean Lynn-Jones, und Steven Miller, Cambridge 1996, S. 82-115; Russett, Bruce / Starr, Harvey: From Democratic Peace to Kantian Peace. Democracy and Conflict in the International System, in: Handbook of War Studies, hrsg. v. Manus Midlarsky, Ann Arbor 2000, S. 93-128. 12 Heute könnte die Rechtslehre nur schwerlich als ein „wenig bedeutendes Werk“ abgewiesen werden, wie beispielsweise Pierre Hassner es noch vor 50 Jahren gemacht hat. Vgl. Hassner, Pierre: Situation de la philosophie politique chez Kant, in: Annales de philosophie politique 4, 1962, S. 78. 13 Um nur einige Sammelbände in deutscher Sprache zu nennen: Bialas, Volker/Häßler, Hans-Jürgen (Hrsg.): 200 Jahre Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Idee einer globalen Friedensordnung, Würzburg 1996; Höffe, Otfried (Hrsg.): Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004; Kodalle, Klaus-Michael (Hrsg.): Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, Würzburg 1996; Lutz-Bachmann, Matthias/Bohman, James (Hrsg.): Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung. Frankfurt a. M. 1996; Merkel, Reinhard/Wittmann, Roland (Hrsg.): »Zum ewigen Frieden«. Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, Frankfurt a. M. 1996. In französischer Sprache ist vor allem der folgende Sammelband zu nennen: Laberge, Pierre/Lafrance, Guy/Dumas, Denis (Hrsg.): L’Année 1795: Kant, Essais sur la Paix, Paris 1997. -7- Erlaubnisgesetz oder die Bedeutung der Französischen Revolution für die Kantische Friedenstheorie. Im deutschsprachigen Raum hat sich in diesem Zusammenhang vor allem Otfried Höffe besondere Verdienste erworben, dessen zahlreiche Aufsätze und Monographien seit mehr als zwanzig Jahren erheblich zur Rehabilitierung der Kantischen Rechts- und Friedenstheorie beigetragen haben.14 Entsprechendes gilt für die grundlegenden und umfassenden Werke von Wolfgang Kersting15 oder Reinhard Brandt16. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls auf die prinzipientheoretischen Beiträge von Georg Geismann unter starker Berufung auf die älteren Schriften von Julius Ebbinghaus hinzuweisen.17 Unter den zahlreichen Monographien, welche sich umfassend mit Kants Friedensschrift im Speziellen auseinandersetzen, sind außerdem die Arbeiten von Georg Cavallar18 (von historischem und rechtsphilosophischem Interesse) und von Volker Gerhardt19 (von vornehmlich politiktheoretischem Interesse) erwähnenswert. Trotz weiterbestehender Unterschiede bezüglich der Interpretation besonderer Aspekten der Friedenstheorie (insbesondere bezüglich des weiterhin kontrovers diskutierten Völkerrechts), lässt sich eine gewisse Konvergenz der Kant-Literatur feststellen. Der Kerngedanke der Friedenstheorie lässt sich somit in seinen Grundzügen weitgehend festhalten: Kants Rechtsphilosophie vom Weltfrieden ist das Ergebnis eines konsequenten Versuches, die notwendigen Bedingungen gesicherter Rechtsverhältnisse zu bestimmen. Sie setzt mit dem Naturzustand der Menschen ein, welcher den Charakter eines Rechtsprovisoriums besitzt, da es keine präzise Bestimmung und keine Garantie für das innere und äußere Privatrecht gibt und überhaupt geben kann. Um den gesetzlosen Naturzustand zu überwinden, ist zunächst die Stiftung des Staates unerlässlich. Aber auch mit der Gründung eines territorial begrenzten Systems öffentlicher Zwangsgesetze ist das Rechtsprovisorium noch nicht vollständig abgeschafft. Der Einzelstaat bietet selbst nur ein provisorisches Recht, da er sich mit anderen Seinesgleichen in einem gesetzlosen Zustand befindet. Aus diesem Grund muss der Verrechtlichungsprozess auf das Verhältnis der Staaten 14 Viele der von Höffe veröffentlichten Monographien und Aufsätze beinhalten jedoch nicht im Titel den Namen Kants, obgleich sie sich häufig seiner Rechts- und Staatsphilosophie ausführlich widmen. Unter den wichtigsten davon sind vor allem die folgenden Monographien zu erwähnen: Höffe, Otfried: Lebenskunst und Moral. Oder: Macht Tugend glücklich?, München 2007; Ders.: Immanuel Kant. Leben - Werk - Wirkung, München 1983, 7. Aufl. 2007; Ders.: Politische Gerechtigkeit: Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt a. M. 2002; Ders.: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001; Ders. (Hrsg.): Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004; Ders. (Hrsg.): Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Berlin 1999; Ders.: Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt a. M. 1990, 3. Aufl. 1995. 15 Vgl. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007; Ders.: Kant. Über Recht, Paderborn 2004. 16 Vgl. Brandt, Reinhard: Immanuel Kant. Was bleibt?, Hamburg 2010, Ders. (Hrsg.): Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Hamburg 2000; Ders.: Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Hamburg 1999; Ders.: Zu Kants politischer Philosophie, Stuttgart 1997; Ders.: Eigentumstheorien von Grotius bis Kant, Stuttgart - Bad Cannstatt 1974. 17 Vgl. Ebbinghaus, Julius: Kants Lehre vom ewigen Frieden und die Kriegsschuldfrage, in: Gesammelte Schriften, Bd. I, Sittlichkeit und Recht. Praktische Philosophie 1929 – 1954, hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Bonn 1986, S. 1-34; Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012; Ders.: Kant und kein Ende, Studien zur Rechtsphilosophie, Bd. 2, Würzburg 2010; Ders.: Kant und kein Ende, Studien zur Moral-, und Religions- und Geschichtsphilosophie, Bd. 1, Würzburg 2009; Ders.: World Peace: Rational Idea and Reality. On the Principles of Kant’s Political Philosophy, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Würzburg 1996, S. 265-319, Ders.: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 363-388. 18 Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992. 19 Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995. -8- untereinander (Völkerrecht) sowie auf das Verhältnis der Staaten und ihre Staatsbürger zu den Staatsbürgern anderer Staaten (Weltbürgerrecht) ausgedehnt werden. Es wäre jedoch verfehlt zu meinen, dass nach allen diesen Fortschritte nichts mehr Neues in Kants politischer Philosophie zu finden wäre. Wie noch zu sehen sein wird, ist Kants rechtsphilosophische Rehabilitierung zwar längst auf einem guten Weg angelangt, ihre politiktheoretische Rehabilitierung muss dagegen noch weiter vollgezogen werden. Selbst wenn die Kant-Forschung in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht hat, sind in der Sekundärliteratur vor allem zwei Mängel erkennbar. In vielen Texten lässt sich feststellen, dass bei der Diskussion einzelner Aspekte das Gesamtkonzept der Kantischen politischen Philosophie häufig aus den Augen verloren geht. Kants Rechtsphilosophie vom Frieden wird häufig auf die Frage der innerstaatlichen Friedensordnung, das heißt auf das Staatsrecht, reduziert.20 Insbesondere in der Wissenschaft der internationalen Beziehungen kommt Kant häufig ziemlich verzerrt in Erscheinung. Der Blick wird dermaßen auf den ersten Definitivartikel der Friedensschrift gerichtet, dass Kants systematische Friedenskonzeption kaum, wenn überhaupt noch sichtbar wird. Ein näherer Blick auf die Literatur zur Friedenstheorie Kants lässt außerdem deutlich erkennen, dass es vornehmlich philosophische und politikwissenschaftliche Fragestellungen und Herangehensweisen gibt.21 So sind Politikwissenschaftler vor allem an dem praktischen Nutzen und der Anwendbarkeit der Friedensschrift interessiert. Ausgehend von Kants Definitivartikeln versuchen sie gesetzmäßige Zusammenhänge herauszuarbeiten sowie kausale Hypothesen zu formulieren, um diese anschließend empirisch zu testen. Die Friedensschrift wird hier weitgehend unabhängig von den anderen Schriften Kants zur politischen Philosophie gelesen. In Abgrenzung dazu greifen Philosophen in größerem Maße auf weitere Schriften zurück, um dunkle Textstellen zu klären, Entwicklungen in Kants Denken aufzuzeigen und die gedankliche Stimmigkeit systematisch zu überprüfen. In der Folge gibt es ebenfalls voneinander weitgehend unabhängige fachspezifische Auslegungen der Kantischen Friedenstheorie. Diese fachspezifischen Interpretationen sind an sich durchaus legitim, da Philosophie und Politikwissenschaft nicht nur andere Methoden haben, sondern auch ein anderes Erkenntnisinteresse verfolgen. Bedauerlicherweise kann man aber allzu häufig das starke Abgrenzungsbedürfnis und monodisziplinäre Vorgehen der jeweiligen Fächer feststellen.22 20 Dies gilt selbst für Wolfgang Kerstings Werk Wohlgeordnete Freiheit. In der ersten Auflage dieser grundlegenden Darstellung von Kants Rechtsphilosophie wurde das Völker- und Weltbürgerrecht gänzlich außer Acht gelassen. Erst in der Einleitung der Taschenbuchausgabe wird Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden erörtert. Vgl. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, 3. Aufl. 2007. Siehe ebenfalls: Ders.: Kant. Über Recht, Paderborn 2004. Auch dort wird Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden nur am Rande behandelt (S. 149-168). Kersting widmet sich Kants Konzeption einer weltweiten Friedensordnung in den folgenden Beiträgen: Ders.: Weltfriedensordnung und globale Verteilungsgerechtigkeit. Kants Konzeption eines vollständigen Rechtsfriedens und die gegenwärtige politische Philosophie der internationalen Beziehungen, in: Zum ewigen Frieden. Grundlage, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, hrsg. v. Reinhard Merkel und Roland Wittmann, Frankfurt a. M. 1996; Ders.: Globale Rechtsordnung oder weltweite Verteilungsgerechtigkeit? Über den systematischen Grundriss einer politischen Philosophie der internationalen Beziehungen; in: Politisches Denken, Jahrbuch 1995/96, S. 197-246. 21 Vgl. Fröhlich, Manuel: Mit Kant, gegen ihn und über ihn hinaus: Die Diskussion 200 Jahre nach Erscheinen des Entwurfs »Zum ewigen Frieden«, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 7, 1997, S. 517. 22 Nur zu selten finden politikwissenschaftliche Beiträge eine Resonanz in den philosophischen Debatten und umgekehrt. In den zahlreichen Sammelbänden, die zum Anlass des 200. Jahrestages des Erscheinens Kants philosophischen Entwurfes Zum ewigen Frieden veröffentlicht worden sind, kommen zum Beispiel nur zu selten Politikwissenschaftler zum Wort. Nennenswerte Ausnahmen sind etwa: Czempiel, Ernst-Otto: Kants Theorem und die zeitgenössische Theorie der internationalen Beziehungen, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. -9- Besonders problematisch ist außerdem, dass eine vorrangig prinzipientheoretische Lektüre der Friedensschrift Gefahr läuft, die Frage der konkreten Friedensstiftung zu verfehlen. Derartige Interpretationsansätze, welche sich ausschließlich auf die Begründung der Vernunftprinzipien des Rechts konzentrieren und wiederum das Problem der Anwendung dieser Prinzipien auf die Erfahrungsfälle nicht beachten, werden der Komplexität der Kantischen politischen Philosophie des Friedens nicht gerecht. Wenn man einmal die Begründung der Vernunftprinzipien des Rechts untersucht hat, hat man nur den halben Weg bis zu einer systematisch geschlossenen allgemeinen Friedenstheorie durchgelaufen: Es soll nämlich immer noch die Frage nach der Umsetzung dieser Vernunftprinzipien in die konkrete politische Praxis untersucht werden. Kants zufolge ist dies die Aufgabe der Politik. c) Der vermeintliche „blinde Fleck“ des Politischen bei Kant Wer sich dem Problem der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle widmen möchte, muss sich also mit Kants Verständnis der Politik auseinanderzusetzen. Biographien beweisen diesbezüglich, dass politische Theorien Kant schon früh beschäftigt haben.23 So unterschiedliche Autoren wie Hobbes, Locke, Montesquieu oder Rousseau haben auf Kant einen wichtigen Einfluss ausgeübt. Des Weiteren verfolgte Kant mit großem Interesse die zeitgenössischen Weltereignisse: Er begrüßte enthusiastisch die Freiheitskämpfe der Nordamerikaner gegen die englische Unterdrückung sowie vor allem den Ausbruch der Französischen Revolution. Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen, die sich spätestens nach der Terrorherrschaft der Jakobiner von den Prinzipien der Französischen Revolution abwandten, beweisen viele Zeugnisse, dass Kant bis zum Ende ein entschlossener Republikaner blieb. Wenn man Kants Verständnis der Politik untersuchen möchte, stößt man allerdings schnell auf eine überraschende Schwierigkeit: Kant hat nur im sparsamen Maße direkte Aussagen über genuin politische Fragestellungen gemacht. Es kann festgehalten werden, dass Kant das Substantiv „Politik“ sowie das Adjektiv „politisch“ in zwei verschiedenen Kontexten verwendet.24 Zum einen wird der Begriff der Politik in einem empirischen Sinne verwendet, um jene Klasse von Phänomenen zu bezeichnen, bei denen es entweder um die Machtvergrößerung nach außen oder um die Verfestigung der staatlichen Obrigkeit nach innen geht. Zum anderen benutzt Kant den Begriff der Politik auch in einem normativen Sinne. Abgesehen von wenigen, unbedeutenden Textstellen findet sich diese Verwendungsweise vor allem an drei Stellen seines Werkes: Im dritten Stück der Religionsschrift, im Anhang zur Friedensschrift sowie im Schlussteil der Lügenschrift. In der Religionsschrift konstituiert der auf äußere Freiheit bezogene Begriff der Politik den Kontrapunkt des auf innere Freiheit bezogenen Begriffs der Ethik. Diese Zweiteilung entspricht der Gliederung der Metaphysik der Sitten in Rechtslehre und Tugendlehre. Im Anhang zur Friedensschrift wird näher definiert, was unter dem Begriff der „Politik“ in einem normativen Sinne zu verstehen ist. Dort wird Politik als „ausübende Rechtslehre” definiert. Dies will heißen, dass sie die Rechtsbegriffe auf die Erfahrungsfälle anwenden soll. Im Anschluss daran schreibt Kant in der Lügenschrift, dass das politische Handeln im Wesentlichen nicht mehr als ein „Mechanism der Rechtsverwaltung“25 zu betrachten ist, insofern der Politiker die apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Vielfältigkeit der jeweils M. 1996, S. 300-323; Doyle, Michael W.: Die Stimme der Völker. Politische Denker über die internationalen Auswirkungen der Demokratie, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2004, S. 221-244. 23 Vgl. u.a. die zum Klassiker gewordene Biographie: Vorländer, Karl: Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Wiesbaden 1924, Nachdruck 2004, insbesondere Kapitel 5.4 („Kant als Politiker“). 24 Vgl. auch: Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 235. 25 Vermeintes Recht: VIII, 429 - 10 - geographischen und historischen Situationen anwenden soll. Es ist Kant nicht mehr gelungen aus seinen verstreuten politischen Ansätzen eine Theorie der Politik systematisch auszuarbeiten, wie er das noch im Jahre 1801 dem Magister Andreas Richter berichtete, der ihm eine solche „systematische Politik nach kritischen Grundsätzen“ in Grundzügen vorlegte.26 An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob damit bereits alles gesagt ist. Ist Kant Verständnis der Politik damit erschöpfend dargestellt worden? Hat sich Kant zum Problem der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle nicht weiter geäußert? Es wird sich zeigen, dass Kant sich an zahlreichen Stellen seiner Schriften direkt und indirekt über das politische Problem der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle geäußert hat. Des Weiteren wird sich zeigen, dass der Blick der herkömmlichen Kant-Interpretation dermaßen auf die Begründung der apriorischen Prinzipien des Rechts gerichtet ist, so dass das komplementäre Problem deren fallgerechter Anwendung übereilt als problemlos vorausgesetzt wird. Es kann Volker Gerhardt zugestimmt werden, wenn er feststellt, dass „unter dem Titel der Politik […] die akademische Zunft ausschließlich rechts- und geschichtsphilosophische Fragen [diskutiert]. Politik ist für sie das, was den Staat betrifft, und der interessiert nur unter dem Gesichtspunkt von Legitimation und Organisation“.27 Gerade dies ist einer der entscheidendsten Mängel der heutigen Kant-Literatur. Der Kant-Forschung scheint gelegentlich entgangen zu sein, dass Kant sich insbesondere in der Friedensschrift dem politischen Problem der Anwendung der apriorischen Prinzipien des Rechts auf Erfahrungsfälle widmet. In der Sekundärliteratur wurde lange angenommen, dass Kant gar keinen eigenständigen Begriff der Politik hat. Dieser Kritik zufolge macht Kant keinen Unterschied zwischen Politik und Recht. So wirft bereits Kurt von Borries Kant vor, dass seine Definition der Politik als ausübende Rechtslehre letztlich in einer „durchaus unpolitischen Auffassung der Politik“28 münde. In Frankreich behauptet seinerseits Pierre Hassner nicht viel anderes: „[I]l n’y pas de philosophie politique kantienne à proprement parler […] On pourrait presque dire […] que la philosophie politique de Kant est une philosophie politique sans politique“.29 Hannah Arendt behauptet ihrerseits, dass es zwar „bei Kant eine Politische Philosophie gibt“, dass er diese jedoch „im Gegensatz zu anderen Philosophen niemals geschrieben hat“.30 Ebenso kritisch schreibt Arendt’s Schüler Ernst Vollrath: „Die Praktische Philosophie Kants ist Metaphysik der Sitten. In ihrem Rahmen hat eine Politische Philosophie als ein eigenständiger Entwurf keinen Ort“.31 In einer späteren Veröffentlichung spricht er von einem „außerordentlich geschrumpfte[n] Politik-Verständnis, das für Politik nichts übrig lässt“.32 In diese philosophische Tradition reiht sich Jürgen Habermas ein, wenn er die (freilich etwas schwächere) These vertritt, dass bei Kant „Politik grundsätzlich in Moral überführt werden kann“.33 Dieselbe Meinung wird von Peter Koslowski vertreten, wenn er schreibt, dass der „Politik-Begriff […] bei Kant eine erhebliche Einschränkung, sozusagen einen 26 Vgl. Briefwechsel: XII, 330ff. und 333f. Gerhardt, Volker: Das Recht in weltbürgerlicher Absicht. Kants Zweifel am föderalen Weg zum Frieden, in: Kant im Streit der Fakultäten, hrsg. v. Volker Gerhardt und Thomas Meyer, Berlin/New York 2005, S. 286f. 28 Borries, Kurt von: Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizismus, Aalen 1973 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1928), S. 145. 29 Hassner, Pierre: Les concepts de guerre et de paix chez Kant, in: Revue française de science politique 11-3, 1961, S. 642. 30 Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, München/Zürich 1985, S. 46. 31 Vollrath, Ernst: Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen, Würzburg 1987, S. 92. 32 Vollrath, Ernst: Was ist das Politische? Eine Theorie des Politischen und seiner Wahrnehmung, Würzburg 2003, S. 65. 33 Habermas, Jürgen: Publizität als Prinzip der Vermittlung von Politik und Moral, in: Materialen zu Kants Rechtsphilosophie, hrsg. v. Zwi Batscha, Frankfurt a. M., 1976, S. 180 (meine Hervorhebungen). 27 - 11 - Funktionsverlust [erfährt], weil Politik in Recht und Ökonomie überführt wird“.34 In jüngerer Vergangenheit konnte man ebenfalls eine ähnliche Einschätzung der Kantischen politischen Philosophie bei Georg Geismann finden. So schreibt er beispielsweise, dass man bei Kant von einer „Theorie der Politik” lediglich als Synonym für eine „Theorie des öffentlichen Rechts” sprechen kann.35 Alle diese Vorwürfe werden von Patrick Savidan unter dem Ausdruck des „blinden Flecken des Politischen bei Kant“ („point aveugle du politique chez Kant“)36 zusammengefasst. Diese bis heute weit verbreitete Deutung ist in der Literatur jedoch nicht alternativlos geblieben. So scheint Pierre Hassner schon seine frühere Ansicht zu revidieren, wenn er in einem späteren Aufsatz feststellt: „[T]out ce que l’analyse de la philosophie pratique kantienne révèle vraiment ce sont des tendances à la fusion de la morale [et] de la politique; mais le fait que ces tendances ne l’emportent pas sur la distinction des domaines n’est pas moins intéressant que leur existence“.37 Leider geht Pierre Hassner selbst nicht auf den Unterschied von Recht und Politik näher ein. Näheren Aufschluss über das spezifisch politische Problem der Anwendung der apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Erfahrungsfälle geben etwa die verschiedenen Veröffentlichungen von Reinhard Brandt, in welchen die Bedeutung der Temporalität in der Politik, das heißt des bewussten Umgangs mit Zeit, hervorgehoben wird.38 Überhaupt lesenswerte Überlegungen zu Kants Reformkonzept finden sich ebenfalls in der Dissertation von Claudia Langer.39 Ausschlaggebend sind in diesem Zusammenhang aber vor allem die Arbeiten von Otfried Höffe, in welchen überzeugend gezeigt wird, dass Kants rechts- und friedenstheoretische Überlegungen einen ausgeprägten Sinn für die Realitäten der Politik aufweisen. Otfried Höffe versucht aber vor allem zu zeigen, dass und inwiefern zur Politik auch Urteilskraft und Klugheit gehören. Eine solche Betrachtungsweise findet letztlich ihre Zuspitzung in den Arbeiten von Ulrich Sassenbach und vor allem von Volker Gerhardt, dem zufolge die Friedensschrift eine genuine „Theorie der Politik“ enthält, in deren Zentrum der Begriff der ausübenden Rechtslehre steht.40 Selbst wenn Gerhardts These nicht bis ins Detail gefolgt werden kann41, hat sie einen interessanten Aspekt der Friedensschrift hervorgehoben, der bedauerlicherweise vielen Kant34 Koslowski, Peter: Staat und Gesellschaft bei Kant, Tübingen 1985, S. 36f. Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 235. Bereits in: Ders.: Nachlese zum Jahr des „ewigen Friedens”. Ein Versuch, Kant vor seinen Freunden zu schützen, in: Logos 3, 1996, S. 321. 36 Savidan, Patrick: Le républicanisme de Kant, in: Kant et les kantismes dans la philosophie contemporaine 1804-2004, hrsg. v. Christian Berner und Fabien Capeillères, Villeneuve d’Ascq 2007, S. 44. 37 Hassner, Pierre: Situation de la philosophie politique chez Kant, in: Annales de philosophie politique 4, 1962, S. 93 (meine Hervorhebungen). 38 Vgl. Brandt, Reinhard: Klugheit bei Kant, in: Klugheit, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerswist-Metternich 2005, S. 98-133; Ders.: Zu Kants politischer Philosophie, Stuttgart 1997; Ders.: Vernunftrecht und Zeit bei Kant, in: Recht zwischen Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire. Deutsch-französisches Symposion, hrsg. v. Jean-François Kervégan und Heinz Mohnhaupt, Frankfurt a. M. 1997, S. 45-72; Ders.: Das Problem der Erlaubnisgesetze im Spätwerk Kants, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 69-86; Ders.: Das Erlaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants Rechtslehre, in: Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel, hrsg. v. Reinhardt Brandt, Berlin – New York 1982, S. 233-285. 39 Vgl. Langer, Claudia: Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Stuttgart 1986. 40 Vgl. Gerhardt, Volker: Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik, in: Kant in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Gerhard Schönrich und Yasushi Kato, Frankfurt a. M. 1996, S. 464-488; Ders.: Eine kritische Theorie der Politik. Über Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 5-20; Ders.: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995; Siehe auch: Sassenbach, Ulrich: Der Begriff des Politischen bei Immanuel Kant, Würzburg 1992. 41 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Studien zur Rechtsphilosophie, Bd. 2, Würzburg 2010, S. 293ff. 35 - 12 - Kommentatoren entgangen ist, nämlich dass Kant in seinem Friedensentwurf spezifisch politische Aufgaben und Verfahren bestimmt. Im Gegensatz zu der Deutung von Kurt von Borries, Hannah Arendt, Ernst Vollrath, Jürgen Habermas und Georg Geismann soll im zweiten Hauptteil der vorliegenden Dissertation gezeigt werden, dass Politik und Recht bei Kant nicht zusammenfallen. Es soll darüber hinaus gezeigt werden, dass die Friedensschrift neben einem deskriptiv-empirisch beschränkten Begriff der Politik als Staatskunst einen umfassenden normativ-apriorischen Begriff der Politik als ausübende Rechtslehre enthält, welcher den spezifischen Gehalt der Politik zu fassen versucht. Die Tatsache, dass der Begriff der Politik einen apriorischen Kern hat, bedeutet jedoch mitnichten, dass Politik keine empirischen Elemente wie etwa die Erfahrungserkenntnis der Menschen oder die Klugheit enthalten darf. Für Politik spielen Klugheit und Urteilskraft eine durchaus wichtige Rolle. Die Politik ist jedoch den erfahrungsunabhängigen Prinzipien des Rechts verpflichtet. Die hierarchische Voranstellung der apriorischen Rechtsprinzipien darf nicht verletzt werden. d) Das Ziel und die These der vorliegenden Dissertation Die Entscheidung, sich Kants Rechts- und Friedenstheorie im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu widmen, ist auf zwei Gründe zurückzuführen. Der erste Anstoß für diese Dissertation besteht in der Überzeugung, dass Kants Rechts- und Friedenstheorie nicht bloß von geschichtlichem Interesse sind, sondern dass sie bis heute nicht an Aktualität eingebüßt haben und mit guten Gründen zentrale Bedeutung in den großen Debatten der politischen Philosophie der Gegenwart inne haben.42 Wenn Kants Friedenstheorie in einzelnen Punkten der Aktualisierung bedarf, so ist diese stets unter Wahrung der systematischen Konstruktion und des gesamten Gedankenzusammenhangs durchzuführen. Dies führt zu dem zweiten Anstoß für die vorliegende Arbeit nämlich die Unzulänglichkeit eines Teils der Kant-Literatur, die entgegen aller Belege in Kants Texten sowie der einschlägigen Sekundärliteratur immer noch ein partielles, politisch verkürztes Verständnis von Kants politischer Philosophie hat, indem sie sich auf das Problem der Begründung der Vernunftprinzipien konzentriert und das komplementäre Problem der Anwendung derselben Prinzipien auf die Erfahrungsfälle nicht vollständig, aber doch weitgehend vernachlässigt. Die vorliegende Arbeit verfolgt ein systematisches Ziel. Es geht dabei nicht darum, die jeweiligen Schriften Kants zur politischen Philosophie bis ins Einzelne zu referieren, sondern es geht vielmehr darum, den Kerngehalt Kants Überlegungen möglichst klar wiederzugeben, seine systematischen Zusammenhänge aufzuzeigen sowie letztlich problematische Abschnitte aufzuklären. Weil Kants Rechtsphilosophie nicht mit historischem Interesse, sondern in systematischer Absicht erörtert wird, sollen zwei Fragen erschlossen werden, welche eine jede Rechtslehre berücksichtigen muss, wenn sie als systematisch vollständig gelten möchte: Die Frage der Begründung der Prinzipien des Rechts einerseits und die Frage der Anwendung dieser Prinzipien in der politischen Wirklichkeit andererseits. Der Leitfaden, welcher sich durch diese Arbeit zieht, ist die umfassendere Grundfrage, welche Kants gesamter politischer Philosophie zugrunde liegt, nämlich jene nach den notwendigen Bedingungen der Möglichkeit des vernünftigen Zusammenlebens der Menschen auf Erden. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation soll gezeigt werden, dass Kants Antwort auf diese Frage aus zweierlei Gründen einzigartig ist. (i.) Kants erste epochale Leistung im Bereich der politischen Philosophie liegt darin, dass er auf die oben angeführte Frage eine rechtsphilosophische Antwort a priori gibt. Dies wiederum hat zweierlei zu bedeuten. 42 Eine eingehende Darstellung Kants Aktualität findet sich bei: Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 15ff. - 13 - Der rechtsphilosophische Charakter seiner politischen Philosophie wird dadurch gegeben, dass Frieden lediglich durch die Stiftung eines mit Hilfe öffentlicher Gesetze endgültig gesicherten Rechtszustandes aller Menschen und aller Völker der Welt erreicht werden kann. Der Kerngedanke der Friedensschrift ist jener einer universalen Rechtsordnung. Aus der Erkenntnis (und nicht der bloßen Annahme), dass der Naturzustand ein Zustand permanenter und unaufhebbarer Streitigkeit des geltenden (Vernunft-)Rechts ist, das heißt, dass es weder eine präzise Bestimmung noch eine Garantie für das angeborene sowie erworbene Recht gibt, folgt als Postulat der reinen praktischen Vernunft, dass die Menschen diesen Zustand verlassen und in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand eintreten sollen. Nur auf diesem Wege kann a priori gesichert werden, dass die Menschen ihre je eigene wie auch immer definierte Zwecke unabhängig von einer anderen nötigenden Willkür verfolgen können. Die Verwirklichung dieser Idee einer sich weltweit erstreckenden öffentlichen Rechtsordnung erfolgt im Wesentlichen in drei Schritten: Universelle Demokratisierung, Stiftung eines Völkerstaats als Weltrepublik, Schaffung eines Weltgastrechts. Apriorischen Charakter erhält Kants Philosophie dadurch, dass sich die Rechtsprinzipien aus Grundsätzen der reinen Vernunft, also notwendig und unabhängig von jeglichen Erfahrungsbedingungen (wie etwa anthropologischen Annahmen), ergeben. Da es im Rechtsbegriff lediglich um das wechselseitige Verhältnis der Menschen als äußerlich freie Wesen geht, sind moralische Bewegungsgründe, inhaltliche Zwecksetzungen und materielle Bedürfnisse irrelevant. Die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens hängt keinesfalls davon ab, dass die Menschen einen sittlich-moralischen Gebrauch ihres freien Willens machen. Kant fordert ausschließlich die von den Bewegungsgründen völlig absehende bloße Erfüllung der Rechtspflichten, weil sich nämlich die Forderung einer moralischen Triebfeder gegenüber anderen Menschen rechtlich gar nicht begründen lässt und die Moralität der Gesinnung ohnehin nicht in Erscheinung tritt. Die bloße Erfüllung der Rechtspflichten ist die notwendige und hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens. Ob die Rechtspflichten aus Kalkül, Zwang, Selbstinteresse oder lediglich aus Pflicht erfüllt werden, ist rechtlich ohne jede Bedeutung, da es sich phänomenal um identische Handlungen handelt. (ii.) Damit ist jedoch nur ein (freilich ganz entscheidender) Aspekt der eigentlichen epochalen Leistung Kants im Bereich der politischen Philosophie genannt. Darüber hinaus darf jedoch nicht übersehen werden, dass Kant sich insbesondere in der Friedensschrift dem Problem der Anwendung der apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Erfahrungsfälle widmet. Die hier aufgeworfene Frage ist jene nach dem Verhältnis von Apriorität und Empirie oder anders ausgedrückt von Normativität und Faktizität. Das Mittelglied der Verknüpfung und des Übergangs von den ersteren zu den letzteren sieht Kant in der Figur des moralischen Politikers. In der Friedensschrift weist Kant die These der Unabhängigkeit der Politik von Moral und Recht und somit eine doppelte Moral entschieden zurück. Er stellt dagegen der Politik als ausübende Rechtslehre die Moral als theoretische Rechtslehre begrifflich gegenüber. Moral und Politik stehen somit im Verhältnis zueinander wie die Theorie zur Praxis. In der Folge kann es keinen Widerstreit zwischen Moral, Recht und Politik geben. Wahre Politik soll sich der Moral und dem Recht systematisch unterwerfen. Die Aufgabe der Politik besteht darin, zwecks der moralisch gebotenen Friedensstiftung die apriorischen Prinzipien des Rechts in der politischen Realität zu verwirklichen. Diese Definition der Politik öffnet einen Handlungsspielraum, welcher über das hinausgeht, was moralisch geboten und rechtlich erzwungen werden kann. Kant ist nämlich ein erfahrungsoffener, kontextsensibler Rechtsphilosoph, welcher der Erfahrungserkenntnis der Menschen, der Klugheit und der erfahrungsgeschärften Urteilskraft eine gewichtige Rolle einräumt. Die bloße Erkenntnis der erfahrungsunabhängigen Prinzipien des Rechts reicht nicht aus, wenn Politik erfolgreich sein soll. Bei der Vermittlung dieser allgemeinen Prinzipien des Rechts mit dem konkreten Einzelfall bedarf der Politiker ebenfalls der - 14 - Urteilskraft. Jene sorgt für die fallgerechte Anwendung der Prinzipien des Rechts in der politischen Realität bzw. für die „Ausführung des Rechtsbegriffs“.43 Die Moral und das Recht geben letztlich den Rahmen verbindlich vor, in welchem sich die Politik zu bewegen hat. Innerhalb dieses Rahmens steht aber der Politik die Entscheidung über Mittel und Wege völlig frei. Es gibt keine Autonomie der Politik, also keine Eigengesetzlichkeit, wohl aber eine Eigenständigkeit. Während die rechtsphilosophische Pointe der Friedensschrift heute immer mehr anerkannt wird, wird diese politiktheoretische Pointe in der Kant-Forschung immer noch nicht ausreichend wahrgenommen.44 e) Methodisches Vorgehen Kant hat die soeben angeführten Überlegungen nicht an einer einzigen Stelle seines Werkes zusammengefasst. Sie werden vielmehr in einer Vielzahl zumeist kleineren Schriften ausgeführt, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven der doppelten Frage nach der Begründung vernunftrechtlicher Prinzipien und deren Umsetzung in konkrete politische Praxis widmen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Werke für die folgende Arbeit in Betracht zu ziehen sind. Die hier aufgeworfene Frage ist also jene nach der Identifikation und Selektion des zu untersuchenden Textkorpus. Der ausgewählte Textkorpus, auf den sich die folgende Arbeit stützt, besteht zunächst aus den kurzen moral- und rechtsphilosophischen Schriften aus den 1780er und 1790er Jahren. Dort wendet sich Kant nicht länger primär an den kleinen Kreis seiner gelehrten Fachkollegen, sondern richtet sich vielmehr an das größere gebildete Publikum seiner Zeit. Nebst der leichter erfassbaren Ausdrucksweise zeigt sich dies in dem gelegentlich ironischen und sogar polemischen Ton, den Kant häufig in diesen Schriften verwendet. Aufschlussreich ist diesbezüglich auch, dass von den Abhandlungen, die Kant von 1784 bis 1797 geschrieben hat, alle, mit einer Ausnahme, in der Berlinischen Monatsschrift, die als Hauptorgan der Berliner Spätaufklärung galt45, zuerst veröffentlicht worden sind. Zu den für uns interessante Schriften zählt zunächst die philosophische Abhandlung: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784). Dazu zählen ebenfalls die Aufsätze zur Geschichtsphilosophie: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784) und Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (1786). Auch in dieser letzten, weniger bekannten Abhandlung lassen sich wichtige Gedanken der Kantischen Ethik finden, wie zum Beispiel die Auffassung vom Menschen als Selbstzweck.46 Das Gleiche gilt auch für 43 Vorarbeit: XXIII, 189 Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die neuerlich erschienenen Handbücher zur politischen Philosophie. Es zeigt sich, dass Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden heute in nahezu sämtlichen Werken behandelt wird. In den meisten Werken kommt dagegen der Begriff der Politik als ausübende Rechtslehre überraschenderweise überhaupt nicht vor. Dies gilt zu Beispiel für die folgenden Werke: Becker, Michael / Schmidt, Johannes / Zintl, Reinhard: Politische Philosophie, Stuttgart 2009; Hartmann, Martin / Offe, Claus: Politische Theorie und Politische Philosophie: Ein Handbuch, München 2011; Marti, Urs: Studienbuch Politische Philosophie, Stuttgart 2008. In den wenigen Werken, in welchen Kants Begriff der Politik als ausübende Rechtslehre überhaupt erwähnt wird, geschieht dies in der Regel nur beiläufig. Vgl. Pfetsch, Frank R. / Kreihe, Thomas: Theoretiker der Politik: von Platon bis Habermas, Stuttgart 2003, S. 364. 45 Die von Johann Erich Biester und Friedrich Gedike herausgegebene Zeitschrift gilt als eines der wichtigsten Presseorgane der Berliner aufgeklärten Reformbewegung. Von 1783 bis 1796 brachte sie monatlich Fachaufsätze, Berichtsinformationen und Gedichte, u. a. von Persönlichkeiten wie Immanuel Kant, Justus Möser, Moses Mendelssohn oder Wilhelm von Humboldt heraus. Näher dazu: Meyen, Eduard: Die Berliner Monatsschrift von Gedike und Biester. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Journalismus, in: Literarhistorisches Taschenbuch, hrsg. v. Robert Eduard Prutz, Hannover 1847, S. 151-222; Hellmuth, Eckhart: Berlinische Monatsschrift, in: Lexikon der Aufklärung, hrsg. v. Werner Schneiders, München 1996, S. 62-64. 46 Vgl. Anfang: VIII, 114 44 - 15 - den Aufsatz Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie (1797), in welchem sich unter anderem wichtige Gedanken zur Lüge finden lassen. Weitere zentrale Textquellen für eine möglichst umfassende Auseinandersetzung mit unserer Problematik können letztlich in den folgenden Schriften gefunden werden: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793), Zum ewigen Frieden (1795) und Der Streit der Fakultäten (1797). Unter den von Kant vornehmlich für die Berlinische Monatsschrift verfassten kurzen Abhandlungen sind dagegen für die hier diskutierte Problematik weniger aufschlussreich: Was heißt: sich im Denken orientieren? (1786), Das Ende aller Dinge (1784) und Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie (1796). Auch die noch zu Kants Lebzeiten veröffentlichten Vorlesungen, wie die Logik (1800), die Physische Geographie (1802) und die Bemerkungen Über Pädagogik (1803) sind für die hier behandelte Problemstellung wenig interessant. Das gleiche gilt für das unvollendete Nachlasswerk (das sogenannte Opus postunum), an dem Kant in seinen letzten Lebensjahren gearbeitet hat. Unter diesen verschiedenen Schriften nimmt die Abhandlung Zum ewigen Frieden einen besonderen Stellenwert ein, da Kant sich dort spezifisch und am ausführlichsten dem Problem des friedlichen Zusammenlebens der Menschen auf Erde widmet. Die Friedensschrift ist aber zugleich die prägnanteste Darstellung Kants politischer Philosophie in ihrer Gesamtheit. Eine umfassende und systematische Darstellung seiner verstreuten moral- und rechtsphilosophischen Ansätze unternimmt Kant erst in der zwei Jahre später erschienenen Metaphysik der Sitten (1797). Diese erscheint in zwei gesonderten Teilen: Die systematische Darlegung der Rechtsphilosophie erscheint im ersten Teil, die Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre, während der zweite Teil, die Metaphysischen Anfangsgründen der Tugendlehre, Kants systematische Moralphilosophie enthält. Bemerkenswert ist, dass im Gegensatz zur Rangfolge im Bereich der theoretischen Philosophie, hier die kleineren und populäreren Schriften der umfangreicheren und systematischen vorangehen. Die Rechtslehre kann somit ohne Zweifel als das Ergebnis einer langjährigen, anhaltenden Beschäftigung mit rechtsphilosophischen Fragen gesehen werden. Dass Kant mit den rechtsphilosophischen Debatten seiner Zeit sehr gut vertraut war, zeigt ebenfalls die Tatsache, dass er zwischen 1767 und 1788 zwölf Vorlesungen über das Naturrecht und insbesondere über das Werk des Göttinger Rechtsgelehrten Gottfried Achenwall Elementa juris naturae gehalten hat. Erwähnenswert sind außerdem die naturrechtlichen Stellen in den Vorlesungen nach Baumgartens praktischen Schriften.47 Dabei soll allerdings zweierlei beachtet werden: In der Rechtslehre wird das öffentliche Recht relativ kurz behandelt, am kürzesten noch das Völker- und Weltbürgerrecht, da diese Thematik bereits in der Friedensschrift besonders ausführlich behandelt wurde. Wichtig ist ebenfalls festzuhalten, dass das Problem der fallgerechten Anwendung der apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Erfahrungsfälle, mithin das Problem der Politik, in der Rechtslehre weitgehend ausfällt. Insofern Kants Rechtsphilosophie durch das allgemeine Sittengesetz mit seiner Ethik verbunden ist, soll ebenfalls auf seine ethischen Schriften zurückgegriffen werden. Kants Interesse für ethische Fragen geht bis in die 1760er Jahre zurück. Selbst wenn die wesentlichen Grundsätze seiner kritischen Ethik bereits Anfang der 1780er Jahren feststehen, wird die systematische Aufarbeitung und Darstellung dieser Grundsätze zunächst durch die Abfassung der Kritik der reinen Vernunft verzögert.48 Erst nach dem Erscheinen der ersten 47 Vgl. insbesondere Kants Reflexionen zu Baumgartens Initia Philosophiae Practicae (XIX, 7-91) Freilich lassen sich bereits in der Kritik der reinen Vernunft, insbesondere im abschließenden Teil der »Transzendentale[n] Methodenlehre« (Vgl. KrV: IV, A 705 / III, B 733), und dort vor allem im zweiten Hauptstück »Der Kanon der reinen Vernunft« (Vgl. KrV: IV, A 795 / III, B 823) sowie im dritten Hauptstück »Die Architektonik der reinen Vernunft« (Vgl. KrV: IV, A 832 / III, B 860), die Grundsteine der Kantischen 48 - 16 - Kritik im Jahre 1781 und ihrer Erläuterungsschrift, den Prolegomena, im Jahre 1783 konnte sich Kant den ethischen Fragen ausführlich widmen, die ihm seit so langen Jahren beschäftigten. Im Jahre 1785 erscheint Kants erstes Hauptwerk zur Moralphilosophie, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, welches die zwei Jahre später erschienene Kritik der praktischen Vernunft in allen Grundzügen ankündigt. Als drittes wesentliches ethisches Werk kommt letztlich für unser Anliegen der erst 1797 veröffentlichte zweite Teil der Metaphysik der Sitten, die Tugendlehre, in Betracht. Die vorliegende Dissertation beruht auf der Überzeugung eines weitgehend konsistenten, systematischen Zusammenhangs des Kantischen Gedankens zum Frieden. Auf der Grundlage des oben erwähnten Textkorpus wird versucht, die verstreuten Überlegungen zusammenzustellen und ihre systematischen Zusammenhänge herauszuarbeiten. Dies erklärt, dass auf den folgenden Seiten häufig zum selben Punkt auf verschiedene Schriften verwiesen wird. Zugleich soll versucht werden, mögliche Verschiebungen oder Selbstkorrekturen zu erkennen und zu erklären. Selbst wenn Kant darum bemüht war, seine Grundsätze rein rational, also unabhängig von jeglichen empirischen Bedingungen aufzustellen und zu begründen, fließen zuweilen empirische Elemente in seine Argumentation ein. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn er schreibt, dass nur die ökonomisch unabhängigen Staatsbürger das Recht auf Mitgesetzgebung haben.49 Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben einer gründlichen Untersuchung und Darstellung der Kantischen Rechtstheorie, auf solche Elemente hinzuweisen, wobei allerdings zugleich darauf aufmerksam gemacht werden soll, wenn solche Argumentationsschwächen die prinzipientheoretische Reflexion unberührt lassen. Das schließt außerdem nicht aus, dass an anderer Stelle eine grundsätzliche Kritik an Kant angebracht sein kann. Weil die vorliegende Arbeit zunächst ein systematisches Ziel verfolgt, sollen historische Erörterungen weitgehend ausgeklammert werden. Nur wenn es für ein angemessenes Verständnis des Kantischen Gedankengangs notwendig ist, wird auf die damaligen politischen, kulturellen oder militärischen Zusammenhänge hingewiesen. Diese Einschränkung soll dafür sorgen, dass die innersystematische Konstruktion der Friedenstheorie Kants und ihre Begründung nicht aus den Augen verloren gehen. Aus demselben Grund wurde entschieden, sich gänzlich auf Kant zu konzentrieren. Damit wird nicht übersehen, dass Autoren wie Hobbes, Rousseau und Hume maßgeblich Kant geprägt haben. Die Konzentration auf Kants Friedenstheorie führt ebenfalls dazu, dass viele an sich interessante Nebenthemen nicht behandelt werden. So wird beispielsweise das Privatrecht (insbesondere das zweite und dritte Hauptstück des ersten Teils der Rechtslehre) relativ vernachlässigt. Bei der Interpretation der Kantischen Überlegungen wird Kant vielfach zitiert. Dies liegt darin begründet, dass nur auf diesem Weg belegt werden kann, was Kant tatsächlich gemeint hat. Zu Kants Vernunftprinzipien vom Weltfrieden gelangen wir nur über die Kantischen Texte selbst. Erst auf der Grundlage einer genaueren Textanalyse, können wir außerdem beurteilen, ob die einzelnen Auslegungen in der Sekundärliteratur als richtig oder falsch zu betrachten sind. f) Der Umgang mit Kants Texten Den verschiedenen Textquellen kommt wohlgemerkt nicht dieselbe Bedeutung zu. Die Frage, die sich vor diesem Hintergrund aufdrängt, ist jene, wie man mit den verschiedenen Moralphilosophie finden. Siehe dazu: Höffe, Otfried: Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie, München 2004, Kapitel 21, S. 286ff. 49 Vgl. RL: VI, 314 - 17 - Textquellen umgehen soll. Der Leser kann sich hierfür an unterschiedlichen Kriterien orientieren. Ein erstes Kriterium für eine angemessene Behandlung der Kantischen Schriften ist zunächst jenes ihrer chronologischen Erscheinung. Die noch zu Kants Lebzeiten veröffentlichten Werke sollen somit den Vorrang vor jenen haben, die erst nach seinem Tod veröffentlicht wurden. Im Gegensatz zu dem, was in der Sekundärliteratur gelegentlich noch zu lesen ist, dürfen Kants spätere Werke, insbesondere die Rechtslehre, nicht unter dem Vorwand vernachlässigt werden, dass sie die vermeintliche, nachlassende Geisteskraft ihres Autors widerspiegeln. Es soll vielmehr davon ausgegangen werden, dass auch und vor allem ein solches Werk besonders ernst genommen werden muss, weil es das krönende Ergebnis einer mehr als vierzigjährigen, anhaltenden Beschäftigung mit rechtsphilosophischen Fragen darstellt. In der Sekundärliteratur kommt es auch gelegentlich vor, dass (selbst namenhafte) Autoren den Vorlesungsnachschriften und den Reflexionen den Vorrang vor den veröffentlichten Texten einräumen.50 Im Gegensatz dazu wird hier davon ausgegangen, dass die veröffentlichten Werke wichtiger sind als die Vorlesungsnachschriften, die selbst wichtiger sind als die losen Reflexionen. Desweiteren wird häufig behauptet, dass man Kants kleineren, zumeist populäreren Schriften nicht dieselbe Autorität zusprechen kann, wie seine umfassenderen, wissenschaftlichen Werken, wie etwa den drei Kritiken oder den zwei Teilen der Metaphysik der Sitten. Angesichts der hier diskutierten Problemstellungen wird dagegen davon ausgegangen, dass dem Friedenstraktat und der Rechtslehre im Vergleich zu den anderen Schriften der sachliche Vorrang gebühren sollte. Dieses Vorgehen wirft jedoch die methodische Frage auf, wie man mit dem handschriftlichen Nachlass sowie mit den Vorlesungsnachschriften umgehen soll. Diese Frage kann leider hier nicht erschöpfend beantwortet werden. An dieser Stelle reicht es aus zu bemerken, dass der Rückgriff auf diese Textquellen aus drei verschiedenen Gründen heikel sein kann: Ein erstes Problem, welches sich beim Umgang mit dem Nachlass stellt, besteht darin zu wissen, wann die herangezogenen Textstellen geschrieben wurden. Diesbezüglich sind zumeist nur vorsichtige Vermutungen möglich. Ein weiteres Problem stellt sich für die Nachschriften aus den Vorlesungen über Moralphilosophie, die von Kant in den späten 1770er und frühen 1780er Jahren in Königsberg gehalten wurden. Die uns überlieferten Nachschriften wurden nämlich nicht von Kant selbst, sondern zumeist von seinen Studenten angefertigt. Streng genommen handelt es sich dabei nicht mehr um Primärtexte. Bereits aus diesem einfachen Grund können sie nicht allein als Beweis für Kants Positionen herangezogen werden. Vor allem aber muss man vorsichtig mit diesen Texten umgehen, weil Kant selbst diesen Nachschriften mit einer gewissen Distanz gegenüber stand.51 Diesbezüglich ist außerdem zu bedauern, dass es bisher keine gründliche und umfassende Untersuchung über das Verhältnis von den Vorlesungsnachschriften zu den veröffentlichten Werken gibt, auf welche man sich stützen könnte. Der handschriftliche Nachlass, welcher zum Teil aus losen Blättern besteht, die Kant benutzte, um verschiedene Reflexionen festzulegen, enthält Gedanken, die Kant aus welchem Grund auch immer in seinen veröffentlichen Werken letztlich nicht übernommen hat. Diese 50 Ein Beispiel für dieses bedenkliche Vorgehen mit Kants Texten liegt in Herbert J. Patons Interpretation von Kants rechtlichem Verbot der Lüge. In einem einflussreichen Aufsatz gewährt er der von Kant in der Moralphilosophie Collins vertretenen These eines relativen Lügenverbotes den Vorrang vor seiner These eines absoluten Lügenverbotes im Lügenaufsatz. Vgl. Paton, Herbert J.: An alleged right to lie. A problem in Kantian ethics, in: Kant und das Recht der Lüge, hrsg. v. Georg Geismann und Hariolf Oberer, Würzburg 1986, S. 55. 51 Vgl. der Brief von Kant an Marcus Herz am 20. Oktober 1778 (Briefe: X, 242). - 18 - Textquellen sind dennoch interessant, weil sie Einblicke in Möglichkeiten geben, die Kant in Betracht gezogen hat ohne sie in seine späteren Schriften zu übernehmen. Mit Sicherheit können jene für die Auslegung unklarer Textstellen besonders aufschlussreich sein. Die Tatsache, dass Kant diese Reflexionen letztlich nicht in seine veröffentlichten Schriften übernommen hat, verbietet jedoch, diese Reflexionen als entscheidenden Beweis zu Gunsten oder zu Ungunsten einer bestimmten Auslegung zu benutzten. Dies gilt vor allem dann, wenn die unveröffentlichten Reflexionen von anderen Textstellen aus den veröffentlichten Schriften abweichen. Kants Reflexionen aus dem Nachlass werden also nur dann als Argument herangezogen, wenn sie von keinen anderen, konkurrierenden Textstellen in den veröffentlichten Werken abweichen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus diesen Textquellen allein keine sichere Erkenntnis bezüglich Kants Stellung gewonnen werden kann. Kants Reflexionen aus dem Nachlass, insbesondere aus den sogenannten Vorarbeiten, sowie den Nachschriften können jedoch für ein besseres Verständnis der veröffentlichten Texte hinzugezogen werden. Sie werden somit nur benutzt, um Klarheit einiger Textstellen in Bezug auf die veröffentlichten Werke zu gewinnen. g) Aufriss der Untersuchung Im Folgenden soll nun eine knappe Übersicht über die Gliederung und den Inhalt dieser Arbeit gegeben werden. Der Aufbau der Arbeit zerfällt in zwei Haupteile. Der erste Hauptteil (A) der folgenden Arbeit behandelt Kants vernunftrechtliche Begründung einer friedensfähigen Weltordnung. Dabei wird sich herausstellen, dass Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden einen bemerkenswerten politischen Realitätssinn aufweist, weil ihre Notwendigkeit ausnahmslos vernunftrechtlich begründet ist und ihre Möglichkeit keinesfalls von der moralisch guten Gesinnung der Menschen abhängt. Im ersten Kapitel (1) geht es um die Vernunftbegründung des öffentlichen Rechts. Dieses erste Kapitel erläutert die rein rationale Grundlage von Kants Rechtsphilosophie und folgt anschließend ihrer Ausdifferenzierung in der Lehre vom Privatrecht und vom öffentlichen Recht. Es wird zunächst gezeigt, wie es Kant ausgehend von einem rein rationalen Begriff der Freiheit gelingt, einen ebenso rein rationalen Begriff vom Recht überhaupt und vom ursprünglichen Recht der Menschheit in der Person jedes einzelnen Menschen aufzustellen und zu begründen. Anschließend wird auf Kants transzendentalphilosophische Eigentumsbegründung näher eingegangen. Die Behandlung des Privatrechts scheint zunächst für den Zweck der vorliegenden Arbeit von zweitrangiger Bedeutung. Sie ist aber insofern wichtig, als Kant aus dem rein rational begründeten Privatrecht die ebenso rein rationale Notwendigkeit des öffentlichen Rechts ableitet. Hier greift Kant auf zwei Argumentationsfiguren zurück, die für die politische Theorie der Neuzeit charakteristisch sind, nämlich die Idee des Naturzustandes und jene des ursprünglichen Vertrages. Kant zeigt, dass der Naturzustand der Menschen ein Zustand permanenter und unaufhebbarer Rechtsunsicherheit ist und dass es ein Postulat der reinen praktischen Vernunft ist, diesen Zustand zu verlassen und sich gemeinsam einer allgemeinen öffentlichen Gesetzgebung zu unterwerfen. Das gleiche gilt im Prinzip ebenfalls für die Staaten. Das zweite Kapitel (2) widmet sich spezifisch Kants Rechtsphilosophie vom Weltfrieden. Es geht darum, die jeweiligen Rechtsschritte darzustellen, welche eine friedensfähige Weltordnung möglich machen sollen. Die Ausführungen werden dabei weitgehend der Gliederung des Kantischen philosophischen Entwurfes Zum ewigen Frieden in Präliminar- und Definitivartikel folgen. Das zweite Kapitel besteht somit aus zwei Teilen. In einem ersten Schritt werden die Präliminarartikel als die negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens dargestellt und diskutiert. Anschließend werden die - 19 - Definitivartikel als die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens kritisch erläutert. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem in der Sekundärliteratur immer noch kontrovers diskutierten zweiten Definitivartikels bezüglich des Völkerrechts gewidmet. An dieser Stelle wird insbesondere auf die häufig formulierte Kritik eingegangen, wonach Kant im zweiten Definitivartikel die vernunftrechtliche Ebene seiner Argumentation verlasse und sich auf eine bloß empirische Ebene beschränkte. Im dritten und letzten Kapitel (3) geht es um die Möglichkeit der Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens. Im ersten Teil soll gezeigt werden, dass für Kant die Stiftung einer friedensfähigen Weltordnung nicht von der moralischen Gesinnung der Menschen abhängt, sondern vielmehr von ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse. In kritischer Auseinandersetzung mit Kants Gedankenexperiments bezüglich des Volks von Teufeln soll gezeigt werden, dass die juridische Legalität die notwendige und zugleich hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens ist. Im zweiten Teil wird auf die Kritik eingegangen, dass die von Kant genannten selbstsüchtigen Teufel noch viel zu engelhafte Züge aufweisen. Im Anschluss wird auf die weitere Kritik eingegangen, dass Kant mit seiner Lehre vom radikalen Böse ungewollt seine Lehre vom Weltfrieden untergräbt. Es wird sich herausstellen, dass selbst aus der Annahme eines bösen Prinzips im Menschen nicht auf die Unmöglichkeit der Stiftung eines Zustandes des ewigen Frieden geschlossen werden kann. Der zweite Hauptteil (B) der vorliegenden Arbeit behandelt Kants Lehre von der Politik und das Problem der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle. Das erste Kapitel (1) wird das Verhältnis von Moral, Recht und Klugheit in Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden behandeln. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Begründung der geltungstheoretischen Abhängigkeit der Politik von der Moral und dem Recht. Kants Bestimmung der Politik als „ausübender Rechtslehre“ hat für viele Missverständnisse gesorgt. Auf Grundlage dieses Gedanken wurde Kant häufig vorgeworfen, dass er ein weltfremder Rechtsphilosoph sei, welcher die Erfahrung missachte und kein Interesse für die konkreten Probleme der Menschen zeige. Des Weiteren wurde Kant für seine vermeintliche Abwertung der Klugheit als die tradierte pragmatische Kompetenz kritisiert. Dieser einseitigen Auslegung wird hier entgegengehalten, dass Kant insbesondere im ersten Anhang der Friedensschrift, um eine Vermittlung von den universalen Vernunftprinzipien mit den einzelnen, konkreten Fällen bemüht war. Es wird sich zeigen, dass Kant auf dem absoluten Vorrang des formalen Rechtsprinzips beharrt, aber den hypothetischen Imperativen der Klugheit einen weit größeren Freiraum einräumt, als dies in der Sekundärliteratur häufig angenommen wird. Im zweiten Kapitel (2) wird der systematische Stellenwert der Urteilskraft innerhalb Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden erörtert. Für Kant kommt dem moralischen Politiker die Aufgabe zu, die apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Erfahrungsfälle anzuwenden. Der Akzent liegt in Kants Definition der Politik ausdrücklich auf der Ausübung. Wer die Politik als angewandte Rechtslehre bestimmt, betont ausdrücklich den Anteil der praktischen Urteilskraft. Was den Vernunftprinzipien entspricht, ist bereits gegeben und kann selbst von dem gemeinsten Verstand jederzeit erkannt werden. Die Tatsache, dass die Vernunftprinzipien in abstracto von jedermann leicht erkannt werden können, lässt jedoch die doppelte Frage unbeantwortet, auf welche Erfahrungsfälle und auf welche Art und Weise jene in concreto angewandt werden sollen. Auf diese Problematik soll im zweiten Kapitel ausführlich eingegangen werden. Dabei werden sowohl die Bedeutung der (reinen) praktischen Urteilskraft für die Beurteilung der Prinzipien der Moralität als auch die Bedeutung der erfahrungsgeschärften Urteilskraft bei der Anwendung der Vernunftprinzipien untersucht. Es wird sich zeigen, dass die absolute Verbindlichkeit der universellen Vernunftprinzipien sehr wohl mit individuellen Einzelfallentscheidungen vereinbar ist. - 20 - Im dritten Kapitel (3) soll auf das Problem der Abwägung einander entgegengesetzter Vernunftprinzipien eingegangen werden. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Kants Argumentation bezüglich der Unmöglichkeit eines Widerstreits der Pflichten. Im Anschluss daran soll der Frage nachgegangen werden, auf welche theoretischen Instrumente die Urteilskraft zurückgreifen kann, um möglich auftretenden Prinzipienkonflikte zu vermeiden. Als Antwort hierauf wird zunächst der Vorrang der vollkommenen Rechtspflichten vor den unvollkommenen Tugendpflichten am Beispiel von Kants rechtsphilosophischer Erörterung der Lüge diskutiert. Abschließend wird die Begründung der Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft am Beispiel des dritten Präliminarartikels untersucht. Es wird sich dabei zeigen, dass Kant in der Friedensschrift der Politik einen Freiraum zugesteht, der selbst auf einen vernunftrechtlichen Grund zurückgeht. - 21 - HAUPTTEIL A KANTS VERNUNFTRECHTLICHE BEGRÜNDUNG EINER FRIEDENSFÄHIGEN WELTORDNUNG - 22 - 1. KAPITEL: KANTS VERNUNFTBEGRÜNDUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS Die Grundfrage, welche Kants politischer Philosophie zugrunde liegt, ist jene nach den Bedingungen der Möglichkeit des friedlichen Zusammenlebens der Menschen als äußerlich freie Wesen in unvermeidlich raum-zeitlichen Gemeinschaften. Auf diese Frage gibt Kant eine rechtsphilosophische Antwort a priori.52 Dies hat zweierlei zu bedeuten. Es bedeutet einerseits, dass Frieden unter den Menschen erst und ausschließlich unter Bedingung effektiven öffentlichen Rechts erwartet werden kann. Andererseits bedeutet es, dass Kant seine Grundsätze rein rational entwickelt, also notwendig und unabhängig von jeglichen Erfahrungsbedingungen. Es ist insbesondere dieser letzte Punkt, der die epochale Leistung von Kants Friedenstheorie deutlich macht. Ehe Kants rechtsphilosophische Argumentation Schritt für Schritt dargestellt und erläutert wird, soll einleitend noch kurz die Vorrede zur Metaphysik der Sitten in den Blick genommen werden, weil Kant dort sein Programm einer apriorischen Rechtslehre näher bestimmt. Dort definiert er die Rechtslehre zunächst als ein „aus der Vernunft hervorgehendes System“, welches „man die Metaphysik des Rechts nennen könnte“.53 Der Konjunktiv „könnte“ deutet aber gleich darauf hin, dass Kant den Ausdruck „Metaphysik des Rechts“ für problematisch hält. Es handelt sich dabei um ein „System der Erkenntniß a priori aus bloßen Begriffen“.54 Diese zweiteilige Definition bedarf ihrerseits weiterer Erklärungen. Ein „System“ bestimmt Kant als „die Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee“.55 Ein System zeichnet sich durch eine vollständige und bestimmte Einteilung ihrer Erkenntnis aus. Es soll aber ein „gegliedertes“ und kein „gehäuftes“ Ganzes sein.56 In einem System sollen also die verschiedenen Teile der Erkenntnis eine geordnete Stelle im Verhältnis zu allen anderen Teilen erhalten und kein bloßes Aggregat bilden, sondern nach notwendigen Gesetzen zusammenhängen. Eine solche vollständige und notwendig zusammenhängende Einteilung der Erkenntnis wird von Kant als „wahre Wissenschaft“57 bezeichnet. Auch für seine Rechtstheorie beansprucht Kant streng wissenschaftlichen Charakter.58 Diesem Anspruch kann nur eine apriorische Rechtslehre gerecht werden. Was ist aber unter einer solchen zu verstehen? Aus der ersten Kritik ist zu entnehmen, dass „Erkenntnisse a priori“ derart beschaffen sind, dass sie sich gänzlich ohne Rückgriff auf Erfahrung begründen lassen.59 Kant definiert deshalb die apriorische Rechtslehre als ein „Vernunftsystem“.60 Dass ein Urteil a priori gilt, bedeutet jedoch nicht notwendig, dass alle Begriffe, die es enthält, nicht empirisch sind. Was in einem apriorischen Urteil „schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden“ sollte, ist nur die Verbindung, die zwischen den Begriffen des Urteils hergestellt wird. Die apriorischen Erkenntnisse unterscheiden sich von den empirischen anhand von zwei „Merkmal[en]“61. Gemeint sind einerseits die absolute Notwendigkeit, nach 52 Dazu siehe vor allem die prinzipientheoretischen Aufsätze von Georg Geismann. Vgl. Ders.: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012; Ders.: World Peace: Rational Idea and Reality. On the Principles of Kant’s Political Philosophy, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Würzburg 1996, S. 265-319; Ders.: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 363-388. 53 RL: VI, 205 54 RL: VI, 216 55 KrV: III, 538f. 56 Vgl. KrV: III, 539 57 TL: VI, 375 58 Vgl. TL: VI, 375 59 Vgl. KrV: III, 28 60 RL: VI, 357 61 KrV: III, 28 - 23 - welcher etwas nicht anderes sein kann als es ist, und andererseits die strenge Allgemeinheit, die „gar keine Ausnahme als möglich verstattet“.62 In der Rechtslehre führt Kant anschließend aus, dass der Begriff des Rechts zwar „ein reiner, jedoch auf die Praxis (Anwendung auf in der Erfahrung vorkommende Fälle) gestellter Begriff ist“.63 Der Praxisbezug ist also für den Rechtsbegriff konstitutiv. Der Rechtsbegriff bezieht sich auf eine unendliche und daher niemals vollständig zu erblickende Mannigfaltigkeit an möglichen Erfahrungsfällen, die sich gerade aus diesem Grund unmöglich gänzlich systematisch einteilen lassen.64 Da der Forderung nach Systematizität nicht vollständig Genüge getan werden kann, kann es auch keine „Metaphysik des Rechts“ bzw. kein „metaphysisches System des Rechts“ im strengen Sinne geben. Es kann „nur Annäherung zum System, nicht dieses selbst erwartet werden“.65 Deshalb wird auch der „für den ersten Theil der Metaphysik der Sitten allein schickliche Ausdruck sein metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre“.66 Wenngleich eine Metaphysik des Rechts mit Praxisbezug nicht möglich ist, so besteht dennoch die Möglichkeit ihrer prinzipientheoretischen Grundlegung. Im ersten Teil der Metaphysik der Sitten beschränkt sich Kant auf das, was im Rechtsbegriff rein ist und sich vollständig einteilen lässt. Gemeint ist die Bestimmung und Begründung jener Prinzipien des Rechts, deren Verwirklichung das vernünftige Zusammenleben der Menschen auf Erde ermöglichen soll. Wie in den folgenden Ausführungen ausführlich zu sehen sein wird, gelingt es Kant diese Prinzipien vom Standpunkt reiner praktischer Vernunft, mit dem Anspruch auf strenge Allgemeinheit, absolute Notwendigkeit und damit verbunden auf objektive Geltung für die Praxis zu begründen. Bereits (und vielleicht vor allem) hierin zeigt sich auch Kants tiefes Verständnis für die komplexe Realität der Politik. Denn allein die rein rationale Begründung formaler Rechtsprinzipien, mithin der Verzicht auf jegliche geographisch, historisch und damit auch kulturell abhängigen Argumente, ermöglicht die große Vielfalt heterogener moralischer Personen hinsichtlich ihres Zusammenlebens auf gemeinsame Prinzipien festzulegen. Methodologisch hat Kant in seiner Argumentation stets darauf geachtet stringent zwischen rein apriorischen und empirisch abhängigen Argumenten zu unterscheiden. Entsprechend behandelt er im Haupttext der Rechtslehre lediglich das, was „zum a priori entworfenen System gehört“, während er die Anwendung des Rechts auf besondere Erfahrungsfälle „in zum Theil weitläuftige Anmerkungen“67 bringt. Andernfalls könnte „das, was hier Metaphysik ist, von dem, was empirische Rechtspraxis ist, nicht wohl unterschieden werden“.68 In den folgenden Ausführungen soll versucht werden beide Argumentationsebenen nicht zu vermischen. Ausgehend von Kants praktischem Freiheitsbegriff (1) erörtert das folgende Kapitel sukzessiv Kants rein rationale Begründung vom Recht überhaupt sowohl von der Befugnis zu zwingen (2), das Privatrecht vom inneren Mein und Dein (3) sowie die entsprechenden Rechtpflichten (5). Das Kapitel widmet sich dann dem Beweis der notwendigen Möglichkeit des Privatrechts vom äußeren Mein und Dein (6) und schließt mit der umstrittenen Begründung des Übergangs vom Mein und Dein im Naturzustand zu jenem im rechtlichen Zustand (6). 62 KrV: III, 28 RL: VI, 205 64 Vgl. RL: VI, 205 65 RL: VI, 205 (meine Hervorhebung) 66 RL: VI, 205 (meine Hervorhebung) 67 RL: VI, 205f. 68 RL: VI, 206 63 - 24 - 1. Der praktische Freiheitsbegriff 1.1 Die doppelte Gestalt des Menschen als ein mit praktischer Vernunft begabtes Naturwesen Die rechtsphilosophischen Überlegungen Kants nehmen ihren Ausgangspunkt in einem praktischen Freiheitsbegriff. Was kann man unter einem solchen verstehen? Bei dem Begriff der praktischen Freiheit handelt es sich um das „Vermögen durch Vorstellungen von dem, was selbst auf entferntere Art nützlich oder schädlich ist, die Eindrücke auf unser sinnliches Begehrungsvermögen zu überwinden“.69 Im unmittelbaren Anschluss daran führt Kant folgendermaßen fort: „[D]iese Überlegungen aber von dem, was in Ansehung unseres ganzen Zustandes begehrungswerth, d.i. gut und nützlich ist, beruhen auf der Vernunft [im praktischen Gebrauch]“.70 Mit anderen Worten bezeichnet der praktische Freiheitsbegriff das Vermögen des Menschen sich Vorstellungen von dem zu machen, was für ihn gut bzw. nützlich ist und sein Handeln auf Basis dieser Vorstellungen - man spricht ebenfalls von Zwecken bzw. Zweckvorstellungen - zu bestimmen. Man muss sich somit zunächst einen Begriff davon machen, was für einen persönlich gut oder nützlich ist, um schließlich sein Handeln dieser Vorstellung entsprechend anzupassen. Dabei ist es ohne jede Bedeutung, worauf sich diese Vorstelllungen begründen. Freiheit im gekennzeichneten Sinne kommt jedem (geistig gesunden) Menschen kraft seines Menschseins zu. Dies will heißen, dass sie jedem Menschen ursprünglich, also mit seiner menschlichen Natur gegeben ist. Kant definiert nämlich den Menschen als ein vernunftbegabtes Tier (animal rationabile), das die Möglichkeit besitzt, aus sich selbst ein vernünftiges Tier zu machen (animal rationale).71 Festzuhalten ist an dieser Definition zunächst, dass der Mensch jeweils als „Tier“ (animal), dies will heißen als Sinnenwesen, bezeichnet wird.72 Die bloßen Sinnenwesen unterliegen den Naturgesetzen, das heißt ihre Handlungsziele werden ausschließlich, unerlässlich und unwiderstehlich durch Triebe und Bedürfnisse bestimmt. Im Unterschied zu den anderen Tieren ist der Mensch jedoch kein bloßes Sinnenwesen. Als Sinnenwesen unterliegt er zwar ständig Bedürfnissen und Trieben, aber als ein mit praktischer Vernunft begabtes Wesen kann er sich von der Nötigung der sinnlichen Antriebe befreien und sein Handeln aufgrund von jenen eigenen, wie auch immer motivierten Zweckvorstellungen selbst bestimmen.73 Dieses Vermögen nennt Kant die „Willkür“.74 Es handelt sich dabei, um „das Begehrungsvermögen nach Begriffen, sofern der Bestimmungsgrund desselben zur Handlung in ihm selbst, nicht in dem Objecte angetroffen wird“.75 Die Willkür ist somit „ein Vermögen nach Belieben zu thun oder zu lassen“.76 Die Willkür, die durch reine Vernunft bestimmt werden kann, nennt Kant die „freie Willkür“. Kant grenzt anschließend die „thierische[n] Willkür“, die nur durch sinnlichen Antrieb (stimulus) bestimmbar ist, von der „menschliche[n] Willkür“, die zwar durch Antriebe affiziert, aber nicht bestimmt wird. Die menschliche Willkür kann dagegen zu 69 KrV: III, A802 / III, B830 (das von Kant durch kursive Kennzeichnung hervorgehobene Wort wurde aufgehoben) 70 KrV: III, A802 / III, B830 (das von Kant durch kursive Kennzeichnung hervorgehobene Wort wurde aufgehoben) 71 Vgl. Anthropologie: VII, 322 72 Kant spricht ebenfalls von „Naturdingen“ oder „Naturwesen“. 73 Vgl. Anfang: VIII, 112 74 RL: VI, 213 75 RL: VI, 213 76 RL: VI, 213 - 25 - Handlungen „aus reinem Willen“77 bestimmt werden. In diesem Fall wird der innere Bestimmungsgrund der Handlung in der praktischen Vernunft selbst angetroffen. Die Freiheit der Willkür bezeichnet somit (negativ formuliert) „jene Unabhängigkeit ihrer Bestimmung durch sinnliche Antriebe“78 und (positiv formuliert) das „Vermögen der reinen Vernunft für sich selbst praktisch zu sein“.79 Diese freie Willkür entspricht nichts anderem als der anfänglich erwähnten Freiheit im praktischen Sinne. Dieser praktische Freiheitsbegriff ist jedoch kein empirischer Begriff. Es handelt sich vielmehr um eine transzendentale Idee, die als solche unabhängig von jeglichen Erfahrungsbedingungen ist. Die Freiheit im praktischen Sinne kann nicht in einem empirischen Sinne bewiesen werden. Sie wird von Kant in jedem Menschen vorausgesetzt. Als ein mit praktischer Vernunft begabtes Sinnenwesen steht der Mensch unvermeidlich vor einem doppelten Problem: Jenem der Willensfreiheit und jenem der Handlungsfreiheit.80 Das erste Problem bezieht sich auf den Gebrauch der inneren Freiheit (die Bestimmung der Zwecke). Es wirft die Frage auf, durch welche Zweckvorstellungen der Mensch seinen Willen bestimmen soll. Das zweite Problem bezieht sich dagegen auf den Gebrauch der äußeren Freiheit (das Handeln aufgrund von Zwecken). Es wirft die Frage auf, welche Handlungen vollzogen werden sollen, um die jeweiligen Zweckvorstellungen zu erreichen. An dieser Stelle ist es wichtig zweierlei festzuhalten. Erstens: Die zwei zuvor erwähnten Probleme sind für Kant beide moralischer Natur in einem weiten Sinne. Der Gegenstand von Kants Moralphilosophie ist weder auf den Gebrauch der inneren Freiheit noch auf den Gebrauch der äußeren Freiheit begrenzt. Ihr geht es vielmehr um die moralischen Gesetze, welche den Freiheitsgebrauch überhaupt bestimmen.81 Der oberste Grundsatz der Kantischen Moralphilosophie ist das allgemeine Sittengesetz. Je nachdem, ob sich jenes auf die innere oder auf die äußere Freiheit bezieht, tritt es als Tugendgesetz oder als Rechtsgesetz auf. Entsprechend gliedert sich auch Kants Moralphilosophie in zwei unterschiedliche Zweige: Die Tugendlehre als die Lehre von den Tugendgesetzen einerseits und die Rechtslehre als die Lehre von den Rechtsgesetzen andererseits. Zweitens: Der Gegenstand der Rechtslehre ist ausschließlich das Problem des äußeren Freiheitsgebrauchs mehrere Personen, die denselben Raum einer geschlossenen Welt teilen und somit notwendigerweise Einfluss aufeinander haben.82 Während das Problem der Willensfreiheit ausschließlich jeden einzelnen Menschen betrifft, so schließt jenes der Handlungsfreiheit die anderen Individuen gerade ein und kann somit lediglich unter Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen diesen gelöst werden. 1.2 Die Lehre der doppelten Gesetzgebung der praktischen Vernunft Das Recht darf lediglich die Übereinstimmung der menschlichen Handlungen mit den Rechtsgesetzen erzwingen. Es kann allerdings nicht die innere Einstellung bei der Befolgung der Gesetze erzwingen. Im hier diskutierten Zusammenhang kommt der Unterscheidung von 77 RL: VI, 213 RL: VI, 213 79 RL: VI, 213 80 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende. Studien zur Rechtsphilosophie, Band 2, Würzburg 2010, S. 11. Hier wird die in der Sekundärliteratur üblich verwendete Terminologie übernommen. Kant spricht gelegentlich von Freiheit im äußeren und im inneren Gebrauche der Willkür (Vgl. etwa RL: VI, 214). Soweit mir bekannt ist, verwendet Kant selbst den Ausdruck „Handlungsfreiheit“ nicht. Dagegen verwendet er den Ausdruck „Freiheit des Willens“ vielfach. Vgl. u. a. Idee: VIII, 17; GMS: IV, 434, 447, 450, 457, 459, 461; KUK: V, 354; Streit: VII, 72. 81 Diesem Punkt soll im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit noch näher nachgegangen werden. 82 Vgl. RL: VI, 230, 238 78 - 26 - Legalität und Moralität eine besondere Bedeutung zu. Es besteht diesbezüglich Erklärungsbedarf darüber, was unter diesen Begriffen genau zu verstehen ist, und wie sie zueinander im Verhältnis stehen. In der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« definiert Kant die Legalität (Gesetzmäßigkeit) als die bloße Übereinstimmung einer Handlung mit dem Pflichtgesetz, ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben.83 Die Legalität bezieht sich, anders formuliert, auf Handlungen, die im Einklang mit den Geboten der Vernunft sind. Kant spricht in diesem Fall von pflichtmäßigen Handlungen. Wichtig ist dabei zu sehen, dass der Beweggrund für diese Handlung beliebig ist. Die Legalität ist eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung der Moralität. Jede moralische Handlung ist notwendig auch eine pflichtmäßige Handlung. Das Umgekehrte gilt allerdings nicht: Nicht jede pflichtmäßige Handlung ist auch eine moralische Handlung. Moralität (Sittlichkeit) bedarf einer weiteren Bedingung, „[d]enn bei dem, was moralisch gut sein soll, ist es nicht genug, daß es dem sittlichen Gesetze gemäß sei, sondern es muß auch um desselben willen geschehen“.84 Damit eine Handlung als moralisch gilt, sollen somit zwei kumulative Bedingungen erfüllt werden: Die Moralität fordert die Übereinstimmung der Handlung mit dem Gesetz sowie zugleich, dass die Handlung aus Pflicht, das heißt allein aus Achtung für das Pflichtgesetz geschehe. Mit anderen Worten kann man sagen, dass die Moralität pflichtgemäße Handlungen aus Pflicht fordert. Es zeigt sich sofort, dass die Legalität kein Konkurrent der Moralität ist, sondern vielmehr ihre notwendige Bedingung darstellt. Nur wenn eine pflichtmäßige Handlung zugleich aus Pflicht geschieht, gilt sie als moralisch. Die Moralität schließt die Legalität ein (da die moralisch gebotene Handlung dem Gesetz gemäß sein soll), fügt jedoch als weitere Bedingung hinzu, dass diese Handlung auch um ihrer willen geschehen soll. In diesem Sinne kann die „Moralität als Überbieten von Legalität“85 begriffen werden. Der Gegenbegriff der Legalität ist also nicht jener der Moralität, sondern jener der Gesetzwidrigkeit. Gesetzeswidrigkeit meint hier die Nichtübereinstimmung einer Handlung mit dem Pflichtgesetz. Der Gegenbegriff der Moralität ist wiederum nicht die Legalität, sondern die Bösartigkeit im strengen Sinne (auch Bosheit genannt). Die Legalität als solche ist somit weder positiv noch negativ bestimmt. Vor diesem Hintergrund kann Wolfgang Kersting nur schwerlich zugestimmt werden, wenn er schreibt, dass die Legalität als „Gegenbegriff zu Moralität […] eine defiziente Gestalt der inneren sittlichen Verfassung des Handlungssubjekts“86 bezeichnet. Weil die Legalität ausschließlich die bloße Übereinstimmung einer Handlung mit dem Pflichtgesetz bezeichnet, ist die Frage noch gar nicht gestellt, ob die Handlung um des Gesetzes willen geschehen ist oder nicht. Was die Legalität von der Moralität unterscheidet, ist somit nicht der Inhalt des jeweils Gebotenen oder Verbotenen, sondern ausschließlich die handlungsbestimmende Motivation. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Legalität und Moralität sich phänomenal gar nicht unterscheiden lassen. In Erscheinung tritt allein die Legalität der Handlungen, niemals aber die Moralität der Gesinnung. Die Moralität der Gesinnung lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, sondern lediglich erschließen.87 Ferner stellt sich die Frage, ob sich Legalität und Moralität der juridischen und ethischen Gesetzgebung zuordnen lassen. In der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« 83 Vgl. RL: VI, 219, 224; Vgl. auch KpV: V, 71f., 81, 118, 151 GMS: IV, 390 85 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 108. 86 Vgl. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 141. 87 Darauf soll im dritten Kapitel des ersten Hauptteils der vorliegenden Dissertation noch näher eingegangen werden. 84 - 27 - folgt die bereits aus der Grundlegung und der zweiten Kritik bekannte Unterscheidung von Legalität und Moralität unmittelbar aus der Bestimmung der juridischen und ethischen Gesetzgebungen. Mit Kants eigenen Worten heißt es dort: „Die Gesetze der Freiheit heißen zum Unterschiede von Naturgesetzen, moralisch. So fern sie nur auf bloße äußere Handlungen und deren Gesetzmäßigkeit gehen, heißen sie juridisch; fordern sie aber auch, daß sie […] selbst die Bestimmungsgründe der Handlungen sein sollen, so sind sie ethisch, und alsdann sagt man: die Übereinstimmung mit den ersteren ist die Legalität, die mit den zweiten die Moralität der Handlung“.88 Bei übereilter Betrachtung erweckt diese Textstelle leicht den Eindruck, dass die Legalität sich ausschließlich auf die juridische Gesetzgebung beziehe, während die Moralität allein die ethische Gesetzgebung betreffen würde. Es würde sich jedoch dabei um ein Missverständnis handeln. Die Unterscheidung von Legalität und Moralität entspricht keinesfalls der Unterscheidung von juridischer und ethischer Gesetzgebung. Wie noch zu sehen sein wird, können sich die Legalität und die Moralität sowohl auf die Rechtspflichten als auch auf die Tugendpflichten beziehen. Um dies verstehen zu können, muss in Erinnerung behalten werden, dass für Kant die Rechtspflichten ein Teilbereich der ethischen Pflichten darstellen. Die juridische Gesetzgebung macht ausschließlich äußere Handlungen zu Pflichten. Mit Kants eigenen Worten heißt es: „Die Pflichten nach der rechtlichen Gesetzgebung können nur äußere Pflichten sein, weil diese Gesetzgebung nicht verlangt, daß die Idee dieser Pflicht, welche innerlich ist, für sich selbst Bestimmungsgrund der Willkür des Handelnden sei, und, da sie doch einer für Gesetze schicklichen Triebfeder bedarf, nur äußere mit dem Gesetze verbinden kann“.89 Die ethische Gesetzgebung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie nur die Idee der Pflicht selbst als Triebfeder der Handlung zulässt, macht zwar auch, aber nicht nur innere Handlungen zu Pflichten. Die ethische Gesetzgebung „geht auf alles, was Pflicht ist, überhaupt“.90 Alle Pflichten gehören, weil sie Pflichten sind, mit zur Ethik. Dies bedeutet, dass alle Rechtspflichten (als Pflichten überhaupt) auch dem Bereich der ethischen Pflichten angehören. Man muss deshalb bei den ethischen Pflichten jene, die bloß ethische Pflichten sind, von jenen unterscheiden, die zugleich auch Rechtspflichten sind. Die ersteren sind direkt-ethische Pflichten, mithin Tugendpflichten. Die anderen sind nur indirekt-ethische Pflichten, mithin Rechtspflichten.91 Die Tatsache, dass die Rechtspflichten andere Bestimmungsgründe des Willens als allein die Achtung für das Gesetz zulassen, hat mitnichten zu bedeuten, dass ihre Erfüllung nicht zur Ethik gehört und schlechterdings geboten ist. Aus der Kombination der von Kant verwendeten Begriffspaare ergibt sich das folgende Schema: Abbildung 1: Kants Gegenüberstellung von Legalität und Moralität Pflichtmäßige Handlung Pflichtmäßige Handlung aus Pflicht Rechtspflichten (indirekt-ethische Pflichten) juridische Legalität juridische Moralität 88 RL: VI, 214 (meine Hervorhebungen) RL: VI, 219 90 RL: VI, 219 91 Vgl. RL: VI, 219 89 - 28 - Tugendpflichten (direkt-ethische Pflichten) genuin ethische Legalität genuin ethische Moralität Dass es eine ethische und eine juridische Moralität gibt, wird von niemandem ernsthaft bestritten. Der moralische Wille ist ein solcher, der sich allein durch die Idee der Pflicht selbst bestimmen lässt. Wenn man allein aus Achtung für das ethische Gesetz pflichtmäßig handelt, dann beweist man ethische Moralität. In diesem Sinne ist Moralität nicht spezifisch für die Ethik. Wenn man die Rechtspflichten als indirekt-ethische Pflichten betrachtet, das will heißen, wenn man allein aus Achtung für das juridische Gesetz pflichtmäßig handelt, dann beweist man juridische Moralität. Wenn man dagegen seine Rechtspflicht aus irgendeinem anderen Grund erfüllt, das heißt, wenn wir zwar pflichtmäßig aber nicht zugleich allein aus Pflicht handeln, dann kommt unserem Verhalten lediglich juridische Legalität zu. Es liegt nahe dasselbe in Bezug auf die Tugendpflichten zu behaupten: Wenn man eine materiale Tugendpflicht nicht allein aus Achtung für das Sittengesetz erfüllt, dann sollte unserem Verhalten ausschließlich ethische Legalität zukommen. Die hier vorgetragene Einteilung wurde von Kant schon früher vertreten. In der Kritik der praktischen Vernunft, im dritten Hauptstück der Elementarlehre unter der Überschrift »Von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft«, schreibt Kant, dass es „von der größten Wichtigkeit [ist] in allen moralischen Beurtheilungen, auf das subjective Princip aller Maximen mit der äußersten Genauigkeit acht zu haben, damit alle Moralität der Handlung in der Nothwendigkeit derselben aus Pflicht und aus Achtung fürs Gesetz […] gesetzt werde“.92 Es zeigt sich, dass Kant hier nachdrücklich die Achtung für das Gesetz bei allen moralischen Beurteilungen, das will heißen sowohl für die Rechts- als auch für die Tugendpflichten, fordert. Die oben vorgeschlagene Einteilung scheint somit plausibel zu sein. Diese Interpretation stößt jedoch an eine besondere Schwierigkeit in Bezug auf die ethische Legalität, denn in der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« ist ebenfalls zu lesen, dass man von einer ethischen Gesetzgebung nur dann sprechen kann, wenn der Mensch „eine Handlung zur Pflicht und diese Pflicht zugleich zur Triebfeder macht“.93 Durch die Verwendung des Adverbs „zugleich“ ergibt sich der Eindruck, dass für Kant die ethische Gesetzgebung pflichtgemäße Handlung aus Pflicht fordert. Andere Triebfedern dürfen nicht mitwirken. Sie sollen vielmehr alle abgewiesen werden, da sie dem ethischen Gesetze zuwider sind. Damit scheint Kant jedoch die Möglichkeit einer ethischen Legalität auszuschließen. Außerdem scheint er die ethische Gesetzgebung allein der Moralität zuzuordnen. Kurzum: Kant scheint hier zu meinen, dass es nur eine ethische Moralität gibt, jedoch keine ethische Legalität. Einen möglichen Ausweg aus dieser Schwierigkeit wird von Otfried Höffe vorgeschlagen, indem er auf die Unterscheidung von „Wohltätigkeit“ und „Wohlwollen“ aufmerksam macht.94 Wohltaten können sowohl aus Pflicht als auch aus einem anderen beliebigen Grund erfolgen. Höffe betont dagegen, dass das Wohlwollen ein dem Willen zugehöriges Merkmal ist. Es liegt lediglich dort vor, wo der Mensch nicht nur pflichtmäßig für die fremde Glückseligkeit sorgt, sondern wo seine Wohltat sich zugleich allein aus dem Willen ergibt, dass es den anderen Menschen gut ergehe. Dort, wo das Wohlwollen vorliegt, handelt der Mensch aus Pflicht. Die ethische Gesetzgebung fordert nicht nur Wohltaten, sondern auch, dass die Wohltaten sich allein aus dem Wohlwollen ergeben. Die ethische Moralität beschränkt sich nicht auf das pflichtmäßige Handeln, sondern erstreckt sich ebenfalls auf den zugrunde liegenden Willen, mithin auf das Handeln aus Pflicht. Unter diesen Bedingungen kann es nur eine ethische Moralität geben. Wenn man sich jedoch nicht länger allein auf den Willen konzentriert, sondern sich auf die bloßen Handlungen beschränkt, dann zeigt sich auch eine ethische Legalität. Kants Konzentration auf den guten Willen in der 92 KpV: V, 81 (meine Hervorhebungen) RL: VI, 219 (meine Hervorhebung) 94 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 115f. 93 - 29 - »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« hat ihn davon abgehalten, die Möglichkeit der ethischen Legalität zu betrachten. Letztere ergibt sich jedoch sowohl aus Kants prinzipiellen Überlegungen als auch aus vereinzelten Gedanken seiner früheren Werke. 1.3 Die Konstitution des juridischen Problems Der Gebrauch der äußeren Freiheit eines jeden Menschen stellt nur deshalb ein juridisches Problem dar, weil die räumliche Begrenztheit der Erde dazu führt, dass die Menschen nicht vermeiden können, in Beziehung zueinander zu treten. Kants Argumentation impliziert also zwei grundlegende empirische Prämissen, die das Problem überhaupt erst konstituieren, welches seine Rechts- und Friedenstheorie zu lösen versucht. Kant greift an unterschiedlichen Stellen seiner Werke immer wieder auf die Kugelgestalt der Erde zurück. In der Rechtslehre betont er beispielsweise, dass „der Erdboden eine nicht gränzenlose, sondern sich selbst schließende Fläche ist“.95 Ferner im selben Text heißt es, dass die Natur die Menschen „alle zusammen (vermöge der Kugelgestalt ihres Aufenthalts, als globus terraqueus) in bestimmte Grenzen eingeschlossen [hat]“.96 Die räumliche Begrenztheit der Erde hat zur Folge, dass die Menschen „nicht umhin können, in wechselseitigen Einfluß auf einander zu geraten“.97 Kant zufolge lässt es sich für den Menschen nicht vermeiden, mit Seinesgleichen in Beziehung zu treten. Ferner führt Kant aus, dass die Menschen „sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch neben einander dulden müssen“.98 Die räumliche Begrenztheit der Erde führt also dazu, dass die Menschen unvermeidbar in Beziehung zueinander treten müssen, so dass es überhaupt erst zu Handlungskonflikten und somit zu einem Problem des Rechts kommen kann. Wichtig ist dabei zu sehen, dass ein Problem des Rechts sich bereits aus dem bloßen Zusammenkommen zweier Menschen und nicht erst aus deren Zusammenleben ergibt. Das Problem des Rechts ist somit ein vorstaatliches und sogar vorgesellschaftliches Problem. Es stellt sich unabhängig von der Existenz des Staates und sogar des Zusammenlebens in Gesellschaft. Dieser bescheidenden und überzeugenden Prämisse fügt Kant allerdings eine weitergehende Prämisse hinzu, wenn er die These vertritt, dass der Mensch zum Leben in einer Gemeinschaft bestimmt ist, in welcher er seine technischen, pragmatischen und moralischen Anlagen überhaupt erst vollständig entfalten kann. In Kants eigenen Worten heißt es beispielsweise: „Der Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, in einer Gesellschaft mit Menschen zu sein und in ihr sich durch Kunst und Wissenschaften zu cultiviren, zu civilisiren und zu moralisiren“.99 Ferner im selben Text spricht Kant von der „Nothwendigkeit, ein Glied irgend einer bürgerlichen Gesellschaft zu sein“.100 Der Mensch ist hier nicht länger aufgrund der räumlichen Begrenztheit der Erde gezwungen mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, sondern ist durch seine eigene Vernunft bestimmt, sich mit anderen Menschen zu vergesellschaften. Selbstverständlich soll das nicht bedeuten, dass Kants Argumentation ausschließlich diese zwei empirischen Prämissen impliziert.101 Wichtig ist an dieser Stelle zu beachten, dass die 95 RL: VI, 311; Vgl. ebenfalls RL: VI, 262, 312, 352 RL: VI, 352 97 Gemeinspruch: VIII, 289 98 Frieden: VIII, 358 99 Anthropologie: VII, 324 (meine Hervorhebung) 100 Anthropologie: VII, 330 101 Otfried Höffe nennt weitere empirische Prämissen wie beispielsweise die Tatsache, „dass endliche Vernunftwesen Leib und Leben haben, die verletzt werden können; dass es Gegenstände im Raum gibt, die man zu Eigentumstiteln machen kann; dass man als Leib- und Lebenswesen ohne derartige Gegenstände nicht auskommt; dass man Verträge abschließt und Geld verwendet; dass es Mann, Frau und Kinder gibt“. Siehe: Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 96 - 30 - Prämisse, dass der Mensch als ein mit praktischer Vernunft begabtes Wesen es nicht vermeiden kann, in raum-zeitlicher Gemeinschaft mit Seinesgleichen in Beziehung zu treten, ausschließlich das Problem konstituiert, welches Kant zu lösen versucht. Die empirische Prämisse hat keine legitimatorische Kraft. Sie bestimmt lediglich das, was John Rawls im Anschluss an David Hume die „Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit“102 (circumstances of justice) nennt. Bei der Lösung des Problems lässt Kant dagegen jegliche empirische Bedingung, wie etwa anthropologische Annahmen, außer Acht. 2. Der Vernunftbegriff des Rechts und die Befugnis zu zwingen Kant leitet den Begriff des Rechts unmittelbar aus jenem der Freiheit der Menschen im Verhältnis zueinander ab. Im Gemeinspruch heißt es eindeutig und unmissverständlich: „Der Begriff […] eines äußeren Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äußeren Verhältnisse der Menschen zu einander hervor“.103 Um dies zu verstehen, muss daran erinnert werden, dass äußere Freiheit (positiv formuliert) das Vermögen sein Handeln aufgrund eigener Zweckvorstellungen zu bestimmen oder (negativ formuliert) die Unabhängigkeit von der nötigenden Willkür der Anderen104 bezeichnet. Äußere Freiheit im gekennzeichneten Sinne kann nicht als uneingeschränkt gedacht werden. Sollte sie nämlich uneingeschränkt sein - das heißt sollte jeder lediglich nach Gutdünken handeln können -, dann könnte der äußere Freiheitsgebrauch von jedem Menschen jederzeit mit dem äußeren Freiheitsgebrauch jedes anderen kollidieren, so dass der jeweils gesetzte Zweck für den einen oder den anderen in Frage gestellt wird. Im immer möglichen Fall eines Handlungskonflikts würde aber eine uneingeschränkte Freiheit die Möglichkeit der Unterwerfung eines beliebigen Menschen unter die Willkür eines anderen einschließen. Dies würde aber der ursprünglichen Freiheit eines jeden Menschen widersprechen. Aus diesem Grunde kann die äußere Freiheit überhaupt lediglich als eingeschränkte Freiheit gedacht werden. Die Einschränkung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen auf die Bedingungen ihrer Übereinstimmung mit der äußeren Freiheit aller anderen Menschen, also auf die Bedingung ihrer eigenen Möglichkeit, kann wiederum nur rechtsgesetzlich geschehen.105 Kant definiert entsprechend das Recht als den „der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann“.106 Zu dieser Definition des (moralischen107) Rechtsbegriffes gelangt Kant im grundlegenden § B der Rechtslehre durch eine dreifache Einschränkung seines Anwendungsgebietes. Kant beschränkt zunächst den Begriff des Rechts auf das Verhältnis des eigenen äußeren Freiheitsgebrauchs in Bezug auf den äußeren Freiheitsgebrauch anderer Personen. Im 2001, S. 130f. Siehe ebenfalls: Ders.: Der kategorische Rechtsimperativ: „Einleitung in die Rechtslehre“, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 49. 102 Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1975, S. 150ff. 103 Gemeinspruch: VIII, 289; Vgl. auch TL: VI, 396 104 Vgl. RL: VI, 237 105 Vgl Gemeinspruch: VIII, 289f. 106 RL: VI, 230 107 Wenn Kant vom „moralische[n] Begriff“ des Rechts spricht, dann meint er keinesfalls, dass die Menschen sich aus moralisch-rechtlicher Gesinnung an das Recht halten sollen. Dies wäre mit dem Begriff des Rechts wiedersprüchlich, weil das Recht sich mit dem äußeren Verhalten zufrieden gibt. Was Kant im Sinne hat, ist der rein rationale (metaphysische) Begriff des Rechts im Gegensatz zum positiven Begriff desselben, von dem unmittelbar zuvor in der Einleitung in Bezug auf eine „bloß empirische Rechtslehre“ die Rede war. Der rein rationale Begriff wird deshalb moralisch genannt, weil er das Kriterium von Recht und Unrecht angibt. Wer dies übersieht, kann dem gravierenden Missverständnis unterliegen, dass Kant das Recht nicht juridisch, sondern ethisch begründet habe. - 31 - Wortlaut heißt es: „Der Begriff des Rechts […] betrifft erstlich nur das äußere und zwar praktische Verhältnis einer Person gegen eine andere, sofern ihre Handlungen als Facta aufeinander […] Einfluß haben können“.108 Die hier von Kant verwendeten Begriffe der „Person“ und der „Handlungen als Facta“ werden in der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« näher definiert. Dort ist zunächst folgendes zu lesen: „Person ist dasjenige Subject, dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind“.109 Ferner im Text bestimmt Kant die Zurechnung (imputatio) als „das Urtheil, wodurch jemand als Urheber (causa libera) einer Handlung, die alsdann That (factum) heißt und unter Gesetzen steht, angesehen wird“.110 Eine Person ist also ein zurechnungsfähiges Subjekt, insofern es keinen anderen Gesetzen unterworfen ist, als denen, die es sich selbst gibt.111 Eine Person kann für ihr Tun und Lassen zur Verantwortung gezogen werden, weil sie sich selbst dafür entschieden hat. Die Person stellt Kant der Sache gegenüber. Es handelt sich dabei um ein Ding, welches keiner Zurechnung fähig ist.112 Wenn Kant ferner von „Handlungen als Facta“ spricht, dann bezieht er sich auf Handlungen insofern sie bloß als frei (mithin als selbstverursacht) betrachtet werden. Ein Problem des Rechts ergibt sich also nur aus dem Verhältnis des äußeren Freiheitsgebrauchs mindestens zweier Personen. Das Handeln einer moralischen Person allein stellt noch kein Problem des Rechts. Ein solches Problem tritt erst auf, wenn es eine Pluralität von Personen gibt, die sich durch ihre Handlungen wechselseitig beeinflussen können. Wenn es nur eine einzige Person geben würde bzw. wenn mehrere Personen niemals im praktischen Verhältnis zueinander geraten könnten, würde es auch kein Rechtsproblem geben. Damit werden Handlungen im bloßen Selbstverhältnis (wie etwa der Selbstmord) aus dem Bereich des Rechts ausgeschlossen. Die im Anschluss an Hobbes und Rousseau entflammte anthropologische und geschichtsphilosophische Debatte, wie (nämlich aggressiv oder friedlich) und warum (von Natur oder infolge ihrer Vergesellschaftung) sich mehrere Personen wechselseitig beeinflussen können, tritt hier in den Hintergrund. Entscheidend ist allein die Tatsache, dass die Menschen sich durch ihre Handlungen überhaupt beeinflussen und sich damit gegenseitig lädieren können. Der Begriff des Rechts bedeutet zweitens „nicht das Verhältniß der Willkür auf den Wunsch (folglich auch auf das bloße Bedürfniß) des Anderen, wie etwa in den Handlungen der Wohlthätigkeit oder Hartherzigkeit, sondern lediglich auf die Willkür des Anderen“.113 Es wurde bereits gesehen, dass die Willkür ein Vermögen nach Belieben zu tun oder zu lassen bezeichnet. Sie unterscheidet sich vom bloßen Wunsch dadurch, dass im letzten Fall die Handlungsfreiheit nicht mit „dem Bewußtsein des Vermögens seiner Handlung zur Hervorbringung des Objects verbunden ist“.114 Während sich also Wünsche auf Ziele richten können, die außerhalb des Rahmens des Möglichen liegen, richtet sich die Willkür lediglich auf Ziele, die durch bestimmte Handlungen tatsächlich erreichbar sind. Im Recht geht es allein um das „wechselseitig[e] Verhältniß der Willkür“.115 Der mögliche Einfluss meiner Handlungen auf die Wünsche und damit auch auf die Bedürfnisse anderer ist rechtlich ohne jede Bedeutung. Umgekehrt hat dies zu bedeuten, dass keine Rechtsansprüche aus meinen möglichen Wünschen und Bedürfnissen erwachsen. Die bloßen Wünsche einer Person führen 108 RL: VI, 230 RL: VI, 223 110 RL: VI, 227 111 Vgl. RL: VI, 223 112 Vgl. RL: VI, 223 113 RL: VI, 230 (meine Hervorhebungen) 114 RL: VI, 214 115 RL: VI, 230 109 - 32 - zu keinen möglichen Handlungen und können deshalb nicht die Handlungssphäre einer anderen Person beeinflussen oder beeinträchtigen. Der Begriff des Rechts sieht drittens von den Zweckvorstellungen der handelnden Personen ab. Es „kommt auch gar nicht die Materie der Willkür, d. i. der Zweck, den ein jeder mit dem Object, was er will, zur Absicht hat, in Betrachtung […], sondern nur nach der Form im Verhältniß der beiderseitigen Willkür, sofern sie bloß als frei betrachtet wird, und ob durch die Handlung eines von beiden sich mit der Freiheit des andern nach einem allgemeinen Gesetze zusammen vereinigen lasse“.116 Die Zweckvorstellungen sind rechtlich beliebig, solange die Handlungen zur Erreichung dieser Zwecke mit der Freiheit aller anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können. Das Recht fragt nicht nach der Verträglichkeit der einzelnen Zweckvorstellungen, sondern nur nach der Verträglichkeit der äußeren Handlungen eines jeden mit den Handlungen aller anderen nach einem allgemeinen Gesetz. Damit ist das „allgemeine Kriterium“ bestimmt, anhand von welchem sich Recht und Unrecht a priori unterscheiden lassen: „Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze bestehen kann“.117 Im Umkehrschluss hat dies zu bedeuten, dass jede Handlung unrecht ist, die nicht mit der Freiheit eines jeden nach einem allgemeinen Gesetz bestehen kann. Damit ist auch jede Behinderung einer Handlung, die mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann unrecht, da diese Behinderung unmöglich mit der Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz bestehen kann. Es ist das allgemeine Rechtsgesetz, welches die äußere Freiheitssphäre aller Menschen auf die Bedingungen ihrer streng allgemeinen Übereinstimmung mit der äußeren Freiheitssphäre aller anderen einschränkt. In der Form des Gebots lautet dieses: „handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne“.118 Das allgemeine Rechtsgesetz ist für Kant ein Postulat der reinen praktischen Vernunft, das mit apodiktischer Gewissheit besagt, dass die menschliche Freiheit „in ihrer Idee darauf eingeschränkt [ist] und von andern auch thätlich eingeschränkt werden [darf]“.119 Das allgemeine Rechtsgesetz hat seinen Ursprung im allgemeinen Sittengesetz und somit allgemeine und objektive Gültigkeit. Es bestimmt allerdings nicht den Gebrauch der inneren Freiheit, sondern ausschließlich jenen der äußeren Freiheit. Der Grund für die Einhaltung des Rechtsgesetzes ist somit - juridisch gesehen - ohne Belang. Wie im dritten Kapitel noch ausführlicher zu sehen sein wird, fordert Kant die von den Triebfedern völlig absehende, bloße Einhaltung des Rechtsgesetzes: die juridische Legalität.120 Es ist nicht nötig - empirisch gesehen ist es sogar nicht einmal zu erwarten -, dass die Menschen sich aus Rechtsliebe an das Rechtsgesetz halten. Der Grund für die Einhaltung des Rechtsgesetzes kann völlig äußerlich sein, wie beispielsweise die Angst vor dem äußeren Zwang. Mit dem Recht überhaupt hängt die „Befugniß zu zwingen“ unmittelbar zusammen. Kant begründet das Zwangsrecht rein rational. Das bedeutet, er greift nicht auf empirische Bedingungen wie etwa die Bösartigkeit der menschlichen Natur zurück. Seine prägnante Begründung lautet wie folgt: „Der Widerstand, der dem Hindernisse einer Wirkung entgegengesetzt wird, ist eine Beförderung dieser Wirkung und stimmt mit ihr zusammen. Nun ist alles, was unrecht ist, ein Hinderniß der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen: der Zwang aber ist ein Hinderniß oder Widerstand, der der Freiheit geschieht. Folglich: wenn ein 116 RL: VI, 230 RL: VI, 231 (meine Hervorhebungen) 118 RL: VI, 231 119 RL: VI, 231 (meine Hervorhebung) 120 Vgl. RL: VI, 231 117 - 33 - gewisser Gebrauch der Freiheit selbst ein Hinderniß der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen (d. i. unrecht) ist, so ist der Zwang, der diesem entgegengesetzt wird, als Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammen stimmend, d. i. recht: mithin ist mit dem Rechte zugleich eine Befugniß, den, der ihm Abbruch thut, zu zwingen, nach dem Satze des Widerspruchs verknüpft“.121 Die Befugnis zu zwingen stellt keine Einschränkung der äußeren Freiheit von jedermann dar, sondern macht die rechtsgesetzliche äußere Freiheit in Gemeinschaft mit anderen Menschen überhaupt erst möglich. Kant führt seine Argumentation in zwei Schritten durch. Er erbringt zunächst den Nachweis für die Notwendigkeit des Rechts zur Anwendung von Zwang, fügt dennoch eine einschränkende Bedingung bezüglich seiner Anwendung hinzu. Ohne die Befugnis zu zwingen wäre die äußere Freiheit von jedermann unter einem allgemeinen Gesetz gar nicht möglich, weil das Recht im immer möglichen Fall eines Handlungskonflikts wirkungslos bleiben würde. Dies bedeutet, dass ohne das Recht zur Anwendung von Zwang die Einschränkung oder sogar Aufhebung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen durch den unrechtmäßigen Gebrauch der äußeren Freiheit eines anderen gar nicht verhindert werden könnte. Dies würde aber im Widerspruch zu dem unbedingten Geltungsanspruch des Rechtsgesetzes stehen. Es lässt sich somit festhalten, dass die Befugnis zum Zwang die notwendige Bedingung der Möglichkeit der äußeren Freiheit von jedermann unter einem allgemeinen Gesetz ist. Sie sorgt dafür, dass das Rechtsgebot überhaupt wirksam wird, also von jedermann eingehalten wird. Die Befugnis zu zwingen kann dennoch nicht als uneingeschränkt betrachtet werden. Die Ausübung von Zwang ist nur insofern legitim, als sie die unrechtmäßige Einschränkung der äußeren Freiheit von jedermann verhindert. Weil die Verhinderung eines rechtlichen Gebrauchs der äußeren Freiheit ein Unrecht darstellt, handelt es sich bei dem Widerstand, der dieser unrechten Verhinderung des äußeren Freiheitsgebrauchs entgegensteht, um ein Recht. Es handelt sich laut Otfried Höffe um einen „Gegen-Zwang“: „Der legitime Zwang ist nicht aggressiver, sondern defensiver Natur; er greift nicht an, sondern verteidigt“.122 Der legitime Zwang ist kein Zwang, der die äußere Freiheit vernichtet, sondern vielmehr ein der Freiheit und Gleichheit einer jeden moralischen Person schützender wechselseitiger Zwang. Kant definiert das strikte Recht als „die Möglichkeit eines mit jedermanns Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmenden durchgängigen wechselseitigen Zwanges“.123 Das Recht formuliert somit die „Koexistenzbedingung freier Individuen“.124 Kant kommt somit zu dem Schluss, dass der Begriff des Rechts überhaupt die Befugnis zu zwingen enthält: „Recht und Befugnis zu zwingen bedeuten also einerlei“.125 Es sei darauf hingewiesen, dass Kant hier nicht bloß vom „Zwang“ spricht, sondern von der „Befugnis zu zwingen“. Die Einhaltung des Rechts ist somit nicht immer auf der tatsächlichen Anwendung von Zwang angewiesen. Aus diesem Grunde spricht Kant in Bezug auf das Recht auch vom „Princip der Möglichkeit eines äußeren Zwanges“.126 Die Anwendung von Zwang ist nicht notwendig für die Einhaltung des Rechts, sondern soll bloß notwendig möglich sein. Die Menschen können sich auch aus anderen beliebigen Gründen an das Recht halten. Im immer möglichen Konfliktfall soll aber die Anwendung von Zwang notwendig möglich sein, 121 RL: VI, 231 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 142. Vgl. Ders.: Der kategorische Rechtsimperativ: „Einleitung in die Rechtslehre“, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 56f. 123 RL: VI, 232 124 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 81. 125 RL: VI, 232 126 RL: VI, 232 (meine Hervorhebung) 122 - 34 - um an sich gültiges Recht auch gegen mögliche Widerstände wirksam zu machen. Nur die Befugnis zu zwingen ermöglicht gültiges, aber strittiges Recht wirksam zu machen. Wenn bei Kant zu lesen ist, dass mit dem strikten (engen) Recht (und damit auch mit jeder strikten Rechtspflicht) die „Befugniß zu zwingen“ verbunden ist, dann ist damit gemeint, dass das strikte Recht die Möglichkeit eines „wechselseitigen Zwanges“127 enthält. Kant bestimmt den Begriff des Rechts auch als der „unter allgemeine Gesetze gebrachte, mit ihm zusammenstimmende durchgängig wechselseitige und gleiche Zwang“.128 Die mit dem Recht verbundene Befugnis zu zwingen bezieht sich somit auf das eigene (moralische) Vermögen, andere zu verpflichten und auf das korrespondierende (moralische) Vermögen der anderen, mich zu verpflichten. 3. Das Recht der Menschheit und die allgemeine Einteilung der Rechtspflichten 3.1 Das angeborene Recht der Menschheit in der eigenen Person In der Rechtslehre unterscheidet Kant das Recht in angeborenes Recht und erworbenes Recht.129 Kant spricht diesbezüglich ebenfalls vom inneren Mein und Dein (meum internum) einerseits und vom äußeren Mein und Dein (meum externum) andererseits. Das erworbene Recht behandelt Kant im ersten Teil der Rechtslehre unter der Überschrift »Das Privatrecht vom äußeren Mein und Dein überhaupt«, während er auf das angeborene Recht in einem kurzen Abschnitt in der »Einleitung in die Rechtslehre« eingeht. Dieser Abschnitt hat für die gesamte Rechtslehre grundlegenden Charakter, da das angeborene Recht der Geltungsgrund sowohl des erworbenen Privatrechts, als auch des öffentlichen Rechts ist. In den Vorarbeiten zur Tugendlehre schreibt Kant, dass „das Recht der Menschheit in unserer eigenen Person […] aller anderen Verbindlichkeit vorgeht“.130 Im unmittelbaren Anschluss daran führt Kant aus, dass das Recht der Menschheit sogar „die oberste Bedingung aller Pflichtgesetze [ist] weil das Subject sonst aufhören würde ein Subject der Pflichten (Person) zu seyn und zu Sachen gezählt werden müßte“.131 Erklärungsbedürftig ist an dieser Stelle, worin das erwähnte Recht der Menschheit genau besteht und wie Kant dieses begründet. Es wurde zuvor gesehen, dass die (äußere) Freiheit der Menschen im Verhältnis zueinander ohne Widerspruch nur als gesetzlich eingeschränkte Freiheit, das will heißen, als rechtliche Freiheit gedacht werden kann. Aus dem allgemeinen Gesetz des Rechts folgt aus diesem Grund das Recht eines jeden Menschen auf den beliebigen Gebrauch seiner freien Willkür, insofern (und nur insofern) dieser mit der Freiheit von allen anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann.132 Freiheit im gekennzeichneten ist das „einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht“.133 Dieses Recht kommt also jedem Mensch zu, bloß weil er Mensch ist. Um dies zu betonen spricht Kant vom „ursprüngliche[n]“ und vom „angeborne[n] Recht der Freiheit“, weil es 127 RL: VI, 232 (meine Hervorhebung) RL: VI, 233 (meine Hervorhebungen) 129 Vgl. RL: VI, 237 130 Vorarbeit: XXIII, 390 (meine Hervorhebung) 131 Vorarbeit: XXIII, 390 132 Vgl. RL: VI, 237 133 RL: VI, 237. Kant spricht in der Rechtslehre ausdrücklich vom angeborenen Recht der Menschheit im Singular. „Das angeborne Recht ist nur ein einziges“ (RL: VI, 237) heißt es dort. In Anlehnung an Kant versucht Otfried Höffe jedoch die Pluralisierbarkeit der Menschenrechte zu beweisen. Vgl. Ders.: Ist Kants Rechtsphilosophie noch aktuell?, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 27. 128 - 35 - „unabhängig von allem rechtlichen Act jedermann von Natur zukommt“.134 Wie im nächsten Kapitel noch ausführlich zu sehen sein wird, müssen alle weiteren Rechte jederzeit zunächst erworben werden. Das Recht der Menschheit wird von Kant ebenfalls das „innere[] Recht“135 und ferner das „innere[] Mein und Dein“136 genannt. Weil diese Bestimmung leicht Missverständnisse erwecken kann, mögen einige Erläuterungen dazu von Nutzen sein. Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass das Recht der Menschheit auf die eigene Person bezogen ist. In den Vorarbeiten zur Rechtslehre bestimmt Kant das innere Recht als „das Recht der Menschheit zu des Menschen eigener Person“.137 Wenn Kant von einem inneren Recht spricht, hat er diesen Selbstbezug im Sinne. Das Recht der Menschheit ist aber zugleich ein auf die anderen Personen bezogenes Recht. Es bezieht sich ausschließlich auf den äußeren Freiheitsgebrauch.138 Es betrifft „nur meine äußere Freiheit, mithin nur den Besitz meiner selbst, kein Ding außer mir“.139 Kants Rede vom „Besitz meiner selbst“ kann nun entweder in einem bloß physischen oder in einem rechtlichen Sinne verstanden werden. Im ersten Fall würde sich das Recht der Menschheit nur auf die Integrität des eigenen Leibes und Leben beziehen. Entsprechend würde mich der äußere Freiheitsgebrauch anderer Menschen dann lädieren, wenn ihre Handlungen negativ auf meinen Körper einwirken ohne, dass ich dazu meine Zustimmung gegeben hätte (also etwa wenn andere mich verletzen, behindern, oder festhalten). Solche Handlungen würden Abbruch an meiner äußeren Freiheit tun und damit zugleich eine Läsion meines angeborenen Rechts darstellen. Daraus folgt allerdings nicht, dass das Recht der Menschheit mit körperlicher Integrität gleichzusetzen ist. Im dem von Kant verwendeten rechtlichen Sinne bezeichnet der Ausdruck „sich selbst zu besitzen“ allgemeiner die „Qualität des Menschen sein eigener Herr (sui iuris) zu sein“.140 Das Recht der Menschheit in der eigenen Person bedeutet somit (positiv) ein „Recht auf Selbstbestimmung“ und (negativ) die „Abwehr von Fremdbestimmung“.141 Es ist also das Recht seine Zwecke selbst zu bestimmen und solche Handlungen hierfür vorzunehmen, die mit der Freiheit von allen anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können. An dieser Stelle ist es nicht ganz ohne Wichtigkeit festzuhalten, dass das soeben definierte Recht der Menschheit ein Recht auf Eigenart und auf Identität einschließt.142 In Kants Rede vom „Recht der Menschheit“ ist der Begriff der Menschheit eine Idee, in welcher der Mensch „nach der Eigenschaft seines Freiheitsvermögens, welches ganz übersinnlich ist, also auch bloß nach seiner Menschheit, als von physischen Bestimmungen unabhängiger Persönlichkeit (homo noumenon)“143 vorgestellt wird. Diese Idee der Menschheit wird in jedem einzelnen Mensch verkörpert. Kants Begriff der Menschheit ist somit ein der praktischen Philosophie und nicht der empirischen Anthropologie zugehöriger Begriff. Der Menschheitsbegriff ist nicht der Gegenbegriff der Tierheit. Er bezeichnet nicht in 134 RL: VI, 237 RL: VI, 232 136 Vgl. RL: VI, 238 137 Vorarbeit: XXIII, 276 138 Daraus folgt, dass jeder Mensch durch den äußeren Freiheitsgebrauch der anderen hinsichtlich seines inneren (ursprünglichen) Rechts ebenso lädiert werden kann, wie hinsichtlich seines äußeren (erworbenen) Rechts. Ein Verstoß gegen das innere Recht verletzt aber nicht nur das Recht eines gegebenen Menschen, sondern kränkt die Menschheit in seiner Person und damit aller anderen Menschen. Es ist Unrecht überhaupt. 139 RL: VI, 254 (meine Hervorhebungen) 140 RL: VI, 238 141 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 161. 142 Vgl. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 161. 143 RL: VI, 239; Religion: VI, 26 135 - 36 - einem bloß empirischen Sinne die Gesamtheit aller sich durch bestimmte gemeinsame biologisch-morphologische Merkmale gekennzeichneten Mitglieder der menschlichen Gattung. Der Menschheitsbegriff ist nicht primär in einem sinnlichen, sondern in einem übersinnlichen Sinne zu verstehen. Gemeint ist also primär die Gesamtheit aller Menschen als Vernunftwesen und damit einhergehend als Besitzer einer Persönlichkeit und einer Würde. Am Ende seiner Ausführungen zum Recht der Menschheit erwähnt Kant die „angeborne Gleichheit“, verstanden als „die Unabhängigkeit nicht zu mehrerem von Anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden kann“.144 Die angeborene Gleichheit liegt „schon im Princip der angebornen Freiheit“ und ist „wirklich von ihr nicht […] unterschieden“.145 Die angeborene Gleichheit bedeutet, dass alle möglichen empirischen Unterschiede zwischen den Individuen rechtlich ohne Bedeutung sind. Alle möglichen Formen von (religiösen, ethnischen, sozialen, usw.) Diskriminierungen sind damit rechtlich ausgeschlossen. Es muss an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Recht der Menschheit (sowie das allgemeine Rechtsgesetz) sich nicht auf die Menschen als Individuen, sondern auf die Menschen als Personen im zuvor definierten juridischen Sinne bezieht. Vor diesem Hintergrund ist die Kritik, dass Kant eine individualistische Position vertritt gänzlich zu verwerfen.146 Um Missverständnisse zu vermeiden und konzeptionelle Klarheit zu gewinnen, wird deshalb im Folgenden stets vom Recht der Menschheit in der je eigenen Person bzw. vom Recht der Menschheit in der Person jedes einzelnen Menschen die Rede sein. Abschließend zu diesem Teil könnte es noch sachdienlich sein kurz auf zwei Kritikpunkte einzugehen, die gelegentlich zu lesen sind. Eine erste Kritik wird von Wolfgang Kersting formuliert, wenn er bedauert, dass Kant „weder die allgemeinen Bedingungen der Verwirklichung menschenrechtlicher Freiheit in das Konzept des Menschenrechts [aufnimmt], noch […] auf besondere, geschichtlich erfahrene Freiheitsgefährdungen“147 reagiert. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange man in Erinnerung behält, dass Kant sich in der Rechtslehre ein ganz anderes Ziel gesetzt hat. Auch hier hält Kant mit guten Gründen an dem Programm eines a priori entworfenen Systems des Rechts fest, das er in der Vorrede zur Rechtslehre bestimmt hat. Ferner ist gelegentlich die Kritik zu lesen, dass das innere Recht kein Recht im strengen Sinne sei. Diese Kritik scheint auf den ersten Blick von Kant selbst bestätigt zu werden, wenn er schreibt: „Ein strictes (enges) Recht kann man also nur das völlig äußere nennen“.148 Die Frage ist also, ob das innere Recht als ein völlig äußeres bezeichnet werden kann. Wie das Recht überhaupt, hat auch das innere Recht nur das zum Gegenstand, „was in Handlungen äußerlich ist“.149 Dem inneren Recht ist „nichts Ethisches beigemischt“.150 Es fordert „keine andern Bestimmungsgründe der Willkür als bloß die äußern“ und ist alsdann „rein und mit keinen Tugendvorschriften vermengt“.151 Damit ist zunächst gemeint, dass das Recht der Menschheit sich nicht auf einen material bestimmten Zweck bezieht. Es bedeutet 144 RL: VI, 238 RL: VI, 238 146 Stellvertretend hierfür ist: Detjen, Joachim: Pluralismus und klassische politische Philosophie, in: Jahrbuch für Politik 2, 1991, S. 151-189. Ein ähnliches Missverständnis ist in der schon veralteten, leider wirkungsmächtigen Interpretation des französischen Juristen Michel Villey zu finden, wenn er schreibt: „c’est là une manière profane d’envisager le droit, vu seulement par ses conséquences pour les intérêts de la vertu, d’un point de vue strictement individualiste […] Kant ne voit le droit qu’en fonction et à partir de l'individu“ (Villey, Michel: Préface à la Métaphysique des mœurs: Doctrine du droit, Paris 1993, S. 17). 147 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 165. 148 RL: VI, 232 (meine Hervorhebungen) 149 RL: VI, 232 150 RL: VI, 232 151 RL: VI, 232 145 - 37 - außerdem, dass das Recht der Menschheit gar nicht verlangt, dass die Idee der Pflicht zugleich die Triebfeder der Handlungen sei. Weil das innere Recht unmittelbar bloß äußere Handlungen fordert, erlaubt es auch keinen Spielraum hinsichtlich seiner Einhaltung. Es ist insofern striktes Recht. 3.2 Kants Neuinterpretation der ulpianischen Formeln Dem ursprünglichen Recht der Menschheit entsprechen jedem Mensch drei ebenfalls kraft seiner Menschheit zukommenden Rechtspflichten. Kant bestimmt und erläutert diese drei Rechtspflichten in wenigen kurzen Absätzen der Rechtslehre im Abschnitt unter der Überschrift »Allgemeine Eintheilung der Rechtspflichten«. Hierfür verwendet er die drei klassischen Formeln des römischen Juristen Ulpian: „honeste vive“, „honestas iuridica“, „neminem laede“. Aufgrund ihrer äußersten Kürze bereitet Kants neue Lesart der ulpianischen Formeln einige wichtige begründungstheoretische und systematische Schwierigkeiten, auf welche nun kurz eingegangen werden soll.152 Die erste innere Rechtspflicht bestimmt Kant folgendermaßen: „Sei ein rechtlicher Mensch (honeste vive)“. Gefordert ist hier „rechtliche Ehrbarkeit (honestas iuridica)“.153 In der Form des Gebots lautet diese Rechtspflicht: „Mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich Zweck“.154 Entsprechend sind alle Handlungen unrechtmäßig, durch welche die Menschen sich zu bloßen Mitteln degradieren lassen. Der Mensch darf sich nicht zu einer Sache machen, mit welcher andere beliebig umgehen dürfen. Jeder Mensch soll vielmehr „im Verhältniß zu Anderen seinen Werth als den eines Menschen“155 behaupten. Gemeint ist hier, dass jeder Mensch im Verhältnis zu anderen Menschen sich als Urheber des eigenen Handelns, mithin als vernunftbegabtes und freies Wesen, betrachten soll und damit verbunden sich als Träger von Rechten und Pflichten behaupten soll. Mit anderen Worten: Jeder Mensch soll durch Aufhebung aller möglichen (u. a. sozialen, kulturellen oder ökonomischen) Hindernisse die eigene Rechtspersönlichkeit im Verhältnis zu anderen Menschen behaupten und bewahren. Die zweite, nun äußere Rechtspflicht lautet: „Thue niemanden Unrecht (neminem laede)“.156 Diese Rechtspflicht ist bloß negativ, da die Menschen dazu aufgefordert werden, auf jede Handlung zu verzichten, welche die äußere Freiheitssphäre eines anderen beeinträchtigen würde. Es geht also um eine Unrechtsvermeidung. Positiv formuliert, hat dies zu bedeuten, dass der äußere Freiheitsgebrauch eines jeden Menschen derart eingeschränkt werden soll, dass er mit der Freiheit von Jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Die dritte ebenfalls äußere Rechtspflicht formuliert Kant folgendermaßen: „Tritt […] in eine Gesellschaft mit Andern, in welcher Jedem das Seine erhalten werden kann (suum cuique tribue)“.157 Jeder Mensch steht vor einer radikalen Alternative: Entweder soll er „aus 152 Lesenswerte Überlegungen zum systematischen Stellenwert und zur Begründung der allgemeinen Einteilung der Rechtspflichten in Kants Rechtslehre sind u.a. in den folgenden Werken zu finden: Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 13ff. und Ders.: Kant und kein Ende, Studien zur Rechtsphilosophie, Bd. 2, Würzburg 2010, S. 132ff.; Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 147ff.; Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 167ff. Vgl. auch: Pinzani, Alessandro: Der systematische Stellenwert der pseudo-ulpianischen Regeln in Kants Rechtslehre, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 59, 2005, S. 7194. 153 RL: VI, 236 154 RL: VI, 236 155 RL: VI, 236 156 RL: VI, 236 157 RL: VI, 237 - 38 - aller Verbindung mit andern heraus gehen und alle Gesellschaft meiden“158 oder in einen Zustand eintreten, worin „Jedermann das Seine gegen jeden Anderen gesichert sein kann“.159 Es wurde allerdings bereits gesehen, dass aufgrund der räumlichen Begrenztheit der Erde und infolge der menschlichen Natur grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Menschen im konfliktträchtigen Verhältnis zueinander kommen. Aus diesem Grund reduziert sich die eingangs erwähnte Alternative in einem einzigen seit Hobbes bekannten Gebot: exeundum esse e statu naturali. Am Ende seiner Erläuterungen zu den drei Rechtspflichten fügt Kant noch eine kurze Bemerkung zu ihrem systematischen Verhältnis zueinander hinzu. Dort erklärt er, dass die dritte (äußere) Rechtspflicht sich aus der Ableitung der zweiten (äußeren) Rechtspflicht vom Prinzip der ersten (inneren) durch Subsumtion ergibt.160 Was ist darunter zu verstehen? Es wurde bereits gesehen, dass die erste innere Rechtspflicht von den Menschen fordert, sich nicht zum bloßen Mittel degradieren zu lassen, sondern sich immer als Rechtsperson zu behaupten. Die zweite äußere Pflicht verlangt wiederum von den Menschen, dass sie sich jeder Handlung enthalten, die mit dem Recht der anderen nicht verträglich ist. Solange es jedoch keine Garantie dafür gibt, dass alle Menschen sich an die äußere Rechtspflicht halten werden, kann auch nicht gesichert werden, dass die Menschen ihre innere Rechtspflicht einhalten werden können. Aus diesem Grund ist es den Menschen geboten mit allen anderen in einen Zustand einzutreten, in welchem die Möglichkeit der Erfüllung der ersten beiden Rechtspflichten durch jedermann gesichert ist.161 Wichtig ist hier festzuhalten, dass für Kant die Ableitung der dritten (äußeren) Rechtspflicht die beiden vorhergehenden (inneren und äußeren) Rechtspflichten voraussetzt. Kant leitet also die Rechtspflicht aus dem Naturzustand herauszutreten nicht allein aus der notwendigen Möglichkeit des äußeren Mein und Dein, sondern auch aus dem inneren Mein und Dein. Im Unterschied zu vielen andersartigen Meinungen lässt sich bereits hier festhalten, dass Kant eine Begründung der Notwendigkeit des bürgerlichen Zustandes leistet, die nicht ausschließlich auf den äußeren Mein und Dein gründet. Abschließend zum hier diskutierten Thema ist noch auf eine Entwicklung in Kants Gedanken aufmerksam zu machen. In der Friedensschrift führte Kant noch aus, dass ich im Naturzustand jeden anderen nötigen kann, „entweder mit mir in einen gemeinschaftlichgesetzlichen Zustand zu treten, oder aus meiner Nachbarschaft zu weichen“.162 Was in der Friedensschrift noch in der vorsichtigen Form einer Befugnis ausgedrückt wurde (Kant schreibt: „kann“ im Sinne von „darf“), wird in der zwei Jahre später erschienen Rechtslehre als ein unbedingtes Vernunftgebot bestimmt („Tritt […] in eine Gesellschaft …“ und „Tritt in einen Zustand ...“). Selbst wenn dies von Kant nicht explizit formuliert wird, darf hinzugefügt werden, dass die dritte Rechtspflicht sich auf den gesamten Bereich des öffentlichen Rechts bezieht. Die Forderung beschränkt sich also nicht auf das Staatsrecht, sondern erstreckt sich ebenfalls auf das Völker- und Weltbürgerrecht. 3.3 Der systematische Stellenwert der inneren Rechtspflicht 158 RL: VI, 236 RL: VI, 237 160 Vgl. RL: VI, 236 161 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 157. Siehe ebenfalls: Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 15. 162 Frieden: VIII, 349 159 - 39 - Es wurde zuvor darauf hingewiesen, dass Kant das Gebot „honeste vive“ ausdrücklich als innere Rechtspflicht bezeichnet.163 Auf den ersten Blick scheint der Begriff einer inneren Rechtspflicht ein Widerspruch zu enthalten, denn nach der Rechtslehre sind alle Pflichten „entweder Rechtspflichten (officia iuris), d.i. solche, für welche eine äußere Gesetzgebung möglich ist, oder Tugendpflichten (officia virtutis s. ethica), für welche eine solche nicht möglich ist“.164 Es lässt sich aber leicht einsehen, dass die Einhaltung der Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit durch keinen äußeren Zwang möglich ist. Es scheint somit nahe zu liegen, das Gebot „honeste vive“ den Tugendpflichten zuzuordnen. Wie im Folgenden zu sehen sein wird, hat Kant vor der Veröffentlichung der Rechtslehre zum Teil kontradiktorische Aussagen bezüglich der systematischen Zuordnung der inneren Rechtspflichten und der ersten ulpianischen Formel gemacht. Der Begriff einer inneren Rechtspflicht gegen sich selbst taucht zum ersten Mal in der von Johann Friedrich Vigilantius abgeschriebenen Vorlesung zur Metaphysik der Sitten auf, die Kant wahrscheinlich im Wintersemester 1793-94 gehalten hat. Dort erklärt er mit aller wünschenswerten Deutlichkeit: „[E]s giebt Rechtspflichten oder officia stricta, zu denen man gezwungen werden kann, ohne daß ein anderer mich zwingen kann; z.E. es ist strenge Pflicht der Menschheit in meiner eigenen Person, daß ich über meinen Körper nicht als Eingenthümer disponieren kann“.165 Kant erklärt, dass es Rechtspflichten sowohl „gegen mich selbst“ als „gegen andere“ gibt. Während die ersten innere Rechtspflichten sind (officia iuris interna), handelt es sich bei den zweiten um äußere Rechtspflichten (officia iruris externa). Nur die äußeren Rechtspflichten sind „Zwangspflichten oder eigentliche officia juridica“.166 Selbst wenn Kant die Rechtspflichten gegen sich selbst in der Vigilantius-Vorlesung nicht für eigentliche Rechtspflichten hält, so räumt er ihnen doch einen hohen Stellenwert ein: „[S]o sind die Rechtspflichten gegen sich selbst die höchsten Pflichten unter allen. Sie betreffen das correspondirende Recht der Menschheit in seiner eigenen Person, sind daher vollkommene Pflichten, und jede Pflichthandlung wird von dem Recht der Menschheit unerlässlich gefordert, und ist an und für sich selbst Pflicht“.167 Ferner im Text heißt es: „Eine jede Uebertretung ist also Verletzung des Rechts der Menschheit in seiner eigenen Person, er macht sich also des ihm anvertrauten Besitzes seiner Person unwürdig, und wird nichtswürdig, da die Erhaltung seines eigenen Whertes nur in der Beobachtung der Rechte seiner Menschheit besteht: er verliert allen inneren Werth, und kann höchstens als ein Instrument für andere, deren Sache er geworden, angesehen werden“.168 Im Unterschied zu der späteren Rechtslehre wird die innere Rechtspflicht gegen sich selbst jedoch nicht dem ulpianischen Grundsatz „honeste vive“ zugeordnet. In Übereinstimmung mit den herkömmlichen naturrechtlichen Deutungsmustern wird die erste ulpianische Formel nicht zur Rechtslehre, sondern ausdrücklich zur Ethik gezählt: „Es enthält dieser Ausdruck des Ulpians […] den ganzen Complexum der ethischen Pflichten, die er dadurch von den rechtlichen abschneidet“.169 Bereits in einer Reflexion aus dem 1770er Jahren hatte Kant den Grundsatz „honeste vive“ als das „ethische principium“ bezeichnet, das „die Rechtschaffenheit (der Gesinnung)“170 verlange. Vor der Veröffentlichung der 163 Vgl. RL: VI, 237 RL: VI, 239 165 Vigilantius: XXVII, 581 166 Vigilantius: XXVII, 582 167 Vigilantius: XXVII, 604 168 Vigilantius: XXVII, 604 169 Vigilantius: XXVII, 527 170 Reflexion 7078: XIX, 243 164 - 40 - Rechtslehre lässt sich keine Stelle finden, in welche Kant das Gebot „honeste vive“ als innere Rechtspflicht bezeichnet und in einem Recht der Menschheit begründet hat.171 Aber auch in den späteren Vorarbeiten zur Tugendlehre verwendet Kant die drei klassischen ulpianischen Formeln zur Kennzeichnung des grundsätzlichen Unterschieds von Rechts- und Tugendpflichten. Dort führt er aus, dass das Gebot „honeste vive“ zu den Tugendpflichten gehört: „Die Moral besteht aus der Rechtslehre (doctrina iusti) und der Tugendlehre (doctrina honesti) jene heißt auch ius im allgemeinen Sinne, diese Ethica in besondrer Bedeutung (denn sonst bedeutet auch Ethic die ganze Moral). - Wenn wir die letztere zuerst nehmen so können wir mit Ulpian die Formel derselben so ausdrücken: honeste vive - Die Rechtslehre enthält zwey Theile die des Privatrechts und des öffentlichen Neminem laede, sum cuique tribue also das Recht des Naturzustandes und des bürgerlichen“.172 Interessant ist des Weiteren ein Blick auf die spätere Tugendlehre. Dort unterscheidet Kant die Pflichten gegen sich selbst danach, ob „das Subject der Pflicht (der Mensch) sich selbst entweder als animalisches (physisches) und zugleich moralisches, oder blos als moralisches Wesen betrachtet“.173 Was die Pflicht des Menschen gegen sich selbst als animalisches und zugleich moralisches Wesen betrifft, so besteht sie in der physischen Erhaltung seiner selbst und seiner Art. Was aber die Pflicht des Menschen gegen sich selbst bloß als moralisches Wesen betrifft, so besteht sie in der Bewahrung und Sicherung der Würde der Menschheit in seiner Person. Kant spricht diesbezüglich von „moralische[r] Selbsterhaltung“ bzw. von „moralische[r] Gesundheit […] des Menschen“.174 Wolfgang Kersting bemerkt hier, dass diese zweite Art von Pflichten formal und negativ ist, und somit die Merkmale besitzt, die den Rechtspflichten zukommen.175 Nichtsdestotrotz zählt Kant sie ausdrücklich zu den Tugendpflichten.176 Es besteht hier Erklärungsbedarf darüber, warum Kant die Pflicht der moralischen Selbsterhaltung in der Tugendlehre als Tugendpflicht bezeichnet, und die Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit in der Rechtslehre als Rechtspflicht. Bei näherer Analyse zeigt sich, dass der eingangs erwähnte (scheinbare) Widerspruch im Begriff der inneren Rechtspflicht nur dann besteht, wenn man davon ausgeht, dass der äußere Zwang das notwendige und hinreichende Kriterium zur Bestimmung der Rechtspflichten ist. Ohne sich dem Unterschied von Rechts- und Tugendpflichten an dieser Stelle ausführlich widmen zu wollen177, soll hier darauf hingewiesen werden, dass für Kant die äußerliche Erzwingbarkeit nicht das bestimmende Merkmal der Rechtspflichten darstellt. Ohne Zweifel sind alle erzwingbaren Pflichten (äußerliche) Rechtspflichten. Dies hat allerdings nicht zu bedeuten, dass alle Rechtspflichten erzwingbar sind. Und alle Pflichten, die nicht erzwingbar sind, sind nicht Tugendpflichten. Dies wird von Kant angedeutet, wenn er in der Einleitung zur Metaphysik der Sitten die juridische Gesetzgebung als diejenige definiert, die „auch äußerlich sein kann“.178 Kant hat offensichtlich dieser Einsicht nur spät gewonnen. In den Vorarbeiten zur Rechtslehre ist zum Beispiel noch zu lesen, dass das innere Recht „zur Ethik“ gehört, weil es nicht mit der Befugnis andere zu zwingen verbunden ist.179 Diese innere Rechtspflicht weist offensichtlich eine gewisse Eigentümlichkeit im Vergleich zu den anderen Rechtspflichten auf. Im Unterschied sowohl zu den herkömmlichen 171 Vgl. ebenfalls: Naturrecht Feyerabend: XXVII, 1336f. und Praktische Philosophie Powalski: XXVII, 144 Vorarbeit: XXIII, 386 173 TL: VI, 420 174 TL: VI, 419 175 Vgl. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 170. 176 Vgl. TL: VI, 419 177 Darauf soll im letzten Kapitel des zweiten Hauptteils noch näher eingegangen werden. 178 RL: VI, 220 (meine Hervorhebungen) 179 Vgl. Vorarbeit: XXIII, 276 172 - 41 - naturrechtlichen Deutungsmustern, als auch zu seinen früheren Erläuterungen in anderen Werken bestimmt Kant das Ehrbarkeitsgebot als eine lediglich durch Selbstzwang zu bewirkende innere Rechtspflicht gegen sich selbst. Kants Bestimmung der inneren Rechtspflicht in der Rechtslehre ist somit in zweierlei Hinsicht originell. Erstens: Die Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit ist nicht den anderen Menschen, sondern der Menschheit in der jeweils eigenen Person geschuldet. Das Gebot „honeste vive“ legt somit den Menschen eine rechtliche Verbindlichkeit gegen sich selbst auf. Zweitens: Die Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit scheint deshalb keine strikte Rechtspflicht zu sein, da „mit jedem Recht in enger Bedeutung […] die Befugniß zu zwingen verbunden“180 ist, die Einhaltung der inneren Rechtspflicht aber nicht äußerlich erzwungen werden kann. Niemand kann äußerlich gezwungen werden, seine eigene Rechtspersönlichkeit im Verhältnis zu anderen Menschen zu behaupten und zu bewahren. Die Einhaltung der inneren Rechtspflicht kann somit lediglich durch einen (wie auch immer motivierten) Selbstzwang bewirkt werden.181 Trotz dieser Eigentümlichkeit besitzt die innere Rechtspflicht alle Merkmale, die den üblichen Rechtspflichten zukommen. Die Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit bezieht sich zunächst lediglich auf bloß äußere Handlungen. In den Vorarbeiten zur Tugendlehre heißt es diesbezüglich: „Die Pflicht Maximen anzunehmen die zur allgemeinen Gesetzgebung taugen folgt nicht aus dem Rechte Anderer sondern diese fordern nur Handlungen als officia. Auch nicht das Recht der Menschheit in unserer Person in seine Maxime aufzunehmen denn diese (die Menschheit) fordert nur Handlungen“.182 Auch die innere Rechtspflicht lässt keinen Spielraum hinsichtlich ihrer Erfüllung zu. Die innere Rechtspflicht gebietet außerdem jedem Menschen äußere Handlungen unabhängig von den Triebfedern derselben. „Das Recht der Menschheit in unserer eigenen Person gehört […] nicht in die Tugendlehre weil sie auch nicht verlangt daß die Idee der Pflicht gegen sich selbst zugleich die Triebfeder der Handlungen sey“.183 Die innere Rechtspflicht fordert keinen inneren Bestimmungsgrund für die Einhaltung der Rechtspflicht. Es zeigt sich also, dass die innere Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit mit guten Gründen als eine strenge Rechtspflicht betrachtet werden kann.184 Zusammenfassend kann mit Wolfgang Kersting festgehalten werden, dass Kants gedankliche Entwicklung „den Weg einer Aufspaltung der juridisch-ethischen Doppelinstanz des Rechts der Menschheit in uns und damit des komplexen Bereichs der vollkommenen inneren Pflichten gegen sich selbst in eine juridische und eine ethische Hälfte [nimmt]: Das Recht der Menschheit verlässt die Ethik und erweitert als Grund innerer Rechtspflichten die Prinzipienlehre des Rechts“.185 Dabei bleibt allerdings die entscheidende Frage offen, warum Kant diese Erweiterung der Prinzipienlehre des Rechts vornimmt und wie er sie begründet. Näheren Aufschluss darüber erfahren wir erneut in der Metaphysik der Sitten Vigilantius. Dort führt Kant aus, dass die innere Rechtspflicht „aus dem Begriff der Freiheit durch das Gesetz des Widerspruchs, mithin analytisch, abgeleitet“186 wird. Darunter ist zu verstehen, dass die 180 RL: VI, 233 (meine Hervorhebung) Ohne die nachstehenden Erläuterungen vorgreifen zu wollen, kann bereits an dieser Stelle betont werden, dass jeder alle anderen Menschen dazu zwingen darf, die Bedingungen zu schaffen unter denen jeder prinzipiell von den anderen nicht gehindert werden kann, seine Rechtspersönlichkeit zu behaupten und zu bewahren. Dies ist aber nur mit dem Übergang vom Naturzustand in den bürgerlichen Zustand möglich. Mit der Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit ist somit die Befugnis verbunden, die anderen zu zwingen mit mir in einem Zustand des öffentlichen Rechts einzutreten. 182 Vorarbeit: XXIII, 381 183 Vorarbeit: XXIII, 390 184 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Studien zur Rechtsphilosophie, Bd. 2, Würzburg 2010, S. 136. 185 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 170f. 186 Vigilantius: XXVII, 587 181 - 42 - innere Rechtspflicht sich auf Handlungen bezieht, welche eine analytische Bedingung der Möglichkeit rechtlicher Freiheit sind. Die Behauptung und Bewahrung der eigenen Rechtspersönlichkeit ist eine vorhergehende Bedingung dafür, dass es Rechtspersonen und damit überhaupt Recht geben kann. Otfried Höffe bezeichnet die Pflicht zur rechtlichen Ehrbarkeit in diesem Sinne als eine „rechtsmoralische Vor-Leistung“.187 Damit ist gemeint, dass dort wo die Menschen sich als bloße Mittel behandeln lassen anstatt sich als Träger von Rechten zu behaupten, es überhaupt kein Recht (weder ein angeborenes noch ein erworbenes) geben kann. Die Einhaltung der inneren Pflicht ist somit die notwendige Vorbedingung allen Rechts überhaupt. Fassen wir den Gang der bisherigen Erläuterungen zusammen, dann zeigt sich, dass es Kant gelungen ist, ausgehend von einem rein rationalen Begriff der Freiheit einen ebenso rein rationalen Begriff des Rechts überhaupt sowie das ursprüngliche Recht der Menschheit und die korrespondierenden Rechtspflichten zu begründen. Bevor wir uns im nächsten Abschnitt der Begründung der notwendigen Möglichkeit des äußeren Privatrechts zuwenden, könnte noch eine Erläuterung zu Kants allgemeiner Einteilung der Rechtspflichten von Nutzen sein. Oberflächlich betrachtet besteht die Rechtslehre aus zwei Teilen. Gemeint sind das Privatrecht und das öffentliche Recht. Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch sofort, dass das Privatrecht vom „äußeren Mein und Dein“, ein Privatrecht vom „inneren Mein und Dein“ vorausgeht. Die Rechtslehre besteht also nicht aus zwei, sondern aus drei systematischen Teilen. Nur weil es „in Ansehung des angebornen, mithin inneren Mein und Dein keine Rechte, sondern nur Ein Recht giebt“188, mithin wegen des äußerst ungleichen Umfangs der drei Teile der Rechtslehre, wird der systematisch erste Teil „in die Prolegomenen geworfen“189, nämlich in die Einleitung in die Rechtslehre. Wenn bei Kant zu lesen ist, dass die drei klassischen ulpianischen Formeln als „Eintheilungsprincipien des Systems der Rechtspflichten“190 dienen, dann soll jedoch nicht verstanden werden, dass die drei Rechtspflichten die soeben genannte Dreiteilung der Rechtslehre in Lehre vom Privatrecht des inneren Mein und Dein, vom Privatrecht des äußeren Mein und Dein und vom öffentlichen Recht widerspiegeln.191 Dass die erste Rechtspflicht sich auf das innere Mein und Dein, die dritte aber auf das öffentliche Recht bezieht, ist eindeutig und wird nicht bestritten. Vorderhand könnte man davon ausgehen, dass die zweite Rechtspflicht sich lediglich auf das Privatrecht des äußeren Mein und Dein beläuft. In Wirklichkeit wird aber gefordert, dass die Menschen kein Unrecht schlechthin begehen. Die zweite Rechtspflicht bezieht sich somit sowohl auf das angeborene als auch auf das erworbene Recht. Aus dem rein rationalen Recht der Menschheit in der Person jedes einzelnen Menschen leitet Kant anschließend ebenso rein rational die notwendige Möglichkeit des Privatrechts vom äußeren Mein und Dein ab. Dies zu zeigen ist das Ziel der folgenden Ausführungen. 4. Die notwendige Möglichkeit des Privatrechts in Ansehung äußerer Gegenstände 187 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 158 und 160. 188 RL: VI, 238 189 RL: VI, 238 190 RL: VI, 237 191 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 155ff. - 43 - In der Rechtslehre führt Kant seine Argumentation bezüglich der notwendigen Möglichkeit des Privatrechts hauptsächlich im ersten Hauptstück des ersten Teils unter der Überschrift »Von der Art etwas Äußeres als das Seine zu haben « aus.192 Dort beginnt Kant seiner Erläuterung mit einer Bestimmung, die für die weiteren Überlegungen grundlegend ist. So heißt es zunächst: „Das rechtlich Meine (meum iuris) ist dasjenige, womit ich so verbunden bin, daß der Gebrauch, den ein Anderer ohne meine Einwilligung von ihm machen möchte, mich lädiren würde. Die subjektive Bedingung der Möglichkeit des Gebrauchs überhaupt ist der Besitz“.193 Es kann argumentiert werden, dass die zitierte Stelle sich auf das rechtliche Meine überhaupt bezieht, das heißt sowohl auf das (zuvor behandelte) innere Mein und Dein als auch auf das (nun näher zu erläuternde) äußere Mein und Dein.194 Es wurde zuvor gesehen, dass das innere Mein und Dein sich auf alles bezieht, was zu mir als moralische Person gehört, einschließlich auf das, was mein Dasein als Person überhaupt bedingt, nämlich mein Leib und Leben. Dass der Gebrauch, den ein Anderer ohne meine Einwilligung von mir als Person macht, dem Rechtsgesetz widerspricht und somit ein Unrecht darstellt, leuchtet von selbst ein und bedarf keiner weiteren Erläuterung.195 Das Gleiche gilt allerdings nicht für das äußere Mein und Dein. Ein äußerer Gegenstand kann nämlich nur dann als das rechtliche Meine gelten, wenn ich annehmen darf, dass der Gebrauch, den ein anderer ohne meine Einwilligung von diesem Gegenstand macht, mich selbst dann lädieren kann, wenn ich ihm nicht physisch innehabe. Die zuvor angeführte Definition des rechtlichen Mein würde sich also selbst widersprechen, wenn der Begriff des Besitzes nicht in zweierlei Bedeutung zu verstehen wäre. Gemeint sind der physische (sinnliche) Besitz einerseits und der bloß rechtliche (intelligible) Besitz andererseits.196 In der zweiten Bedeutung handelt es sich um einen Vernunftbesitz. 192 Diesbezüglich habe ich mich insbesondere von den mittlerweile schon alten, allerdings immer noch hilfreichen Monographien von Reinhard Brandt und Kristian Kühl belehren lassen. Vgl. Brandt, Reinhard: Eigentumstheorien von Grotius bis Kant, Stuttgart - Bad Cannstatt 1974; Kühl, Kristian: Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur Aktualität der Kantischen Rechts- und Eigentumslehre, Freiburg - München 1984. Überaus lesenswerte Überlegungen zur Kants Eigentumstheorie sind ebenfalls in den einschlägigen Kapiteln der folgenden Monographien zu lesen. Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 19-46; Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 177-229. 193 RL: VI, 245 194 Wolfgang Kersting zufolge hat Kant dagegen „wohlweislich nie das rechtlich Meine als obersten eingeteilten Begriff hinsichtlich des inneren und äußeren Meinen gebraucht. Das rechtlich Meine hat das Eigentumsfähige überhaupt als seinen möglichen Gegenstand, bezieht sich auf das Verhältnis der Willkür zu ihren Gegenständen. Wäre das innere Mein durch systematische Einteilung des rechtlich Meinen konstituiert, dann würde ersteres in den Bestimmungsbereich des Eigentumsbegriffs gezogen; nichts liegt Kant aber ferner“ (Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 180). Dieser Argumentation ist zunächst entgegenzuhalten, dass das innere Mein von Kant nur deshalb „in die Prolegomenen geworfen“ wird, weil seine Ausführungen zu diesem einzigen Recht deutlich knapper ausfallen als jene zum äußeren Privatrecht und zum öffentlichen Recht (Vgl. RL: VI, 238). Selbst wenn das innere und äußere Mein aus diesem Grund von Kant getrennt behandelt werden, nämlich einmal in der Einleitung und einmal im ersten Teil der Rechtslehre, handelt es sich um die zwei Seiten des einen und selben rechtlichen Mein verstanden als „das von dessen Gebrauch meine bloße Willkühr jeden andern abhält“ (Vorarbeit: XXIII, 212). Es ist allerdings Wolfgang Kersting zuzustimmen, wenn er meint, dass der Mensch nicht „Eigentümer“ (im strengen Sinne des Wortes) seiner selbst ist. Der Mensch ist nicht befugt über sich nach Belieben disponieren. Kant spricht zwar in Bezug auf das innere Mein auch vom „Besitz meiner selbst“ (RL: VI, 254). Er weist aber auch wiederholt darauf hin, dass der Mensch zwar sein „eigener Herr“ ist, aber eben nicht „Eigentümer von sich selbst“, weil er der Menschheit in seiner eigenen Person verantwortlich ist. Der Mensch kann seine ihm kraft seiner Menschheit zukommende Rechtspersönlichkeit niemals aufgeben. (Vgl. Gemeinspruch: VIII, 293; RL: VI, 238, 270; Vorarbeit: XXIII, 358). 195 Vgl. RL: VI, 248, 250 196 Vgl. RL: VI, 245 - 44 - Der Ausdruck des „äußeren Mein“ bezieht sich auf einen Gegenstand „außer mir“. Dies bedeutet wiederum nicht, dass dieser Gegenstand sich „in einer anderen Stelle (positus) im Raum oder in der Zeit“ befindet, sondern nur, dass er ein von mir als (Rechts-)Subjekt „unterschiedener“ Gegenstand ist.197 Der intelligible Besitz abstrahiert also gänzlich von der raum-zeitlichen Verknüpfung der besitzenden Person zu dem von ihr besessenen Gegenstand und beschränkt sich auf eine bloß intellektuelle Beziehung zwischen denselben. Es ist somit rechtlich ohne jede Bedeutung, dass der besessene Gegenstand sich an einem anderen Ort und in einem anderen Zeitpunkt befindet und dass jemand anders ihn empirisch innehat. Dies meint Kant, wenn er schreibt, dass ein intelligibler, bloß rechtlicher Besitz ein „Besitz ohne Inhabung (detentio)“198 ist. Um leicht auftretende Missverständnisse zu vermeiden, soll gleich darauf hingewiesen werden, dass Kant im § 1 der Rechtslehre lediglich behauptet, dass die Möglichkeit eines äußeren Mein den Begriff des bloß rechtlichen Besitzes voraussetzt. Damit ist allerdings die Möglichkeit eines äußeren Mein und Dein noch nicht bewiesen worden. Die bisher noch unbeantwortete Frage, ob ein äußeres Mein überhaupt möglich ist, wird aber dann zu Beginn des § 2 in der Form eines rechtlichen Postulats der praktischen Vernunft gesetzt199 und durch eine apagogische Beweisführung200 zu untermauern versucht. Seine positive Formulierung besagt, dass es möglich ist, einen jeden äußeren Gegenstand meiner Willkür als das Meine zu haben.201 Negativ formuliert, hat dies zu bedeuten, dass eine „Maxime, nach welcher, wenn sie Gesetz würde, ein Gegenstand der Willkür an sich (objectiv) herrenlos (res nullius) werden müßte, […] rechtswidrig“202 ist. Kant führt anschließend seine Argumentation bezüglich der Rechtswidrigkeit eines objektiv herrenlosen äußeren Gegenstandes in drei Schritten durch. 197 Vgl. RL: VI, 245 RL: VI, 246 199 Im Aufbau des ersten Hauptstücks des ersten Teils der Rechtslehre bezüglich des Privatrechts sind erhebliche Unterschiede zwischen der Akademie-Ausgabe und der von Bernd Ludwig herausgegebenen Ausgabe im Felix Meiner Verlag zu verzeichnen. In letzerer Ausgabe wurden z. B. Kants Ausführungen zum rechtlichen Postulat der praktischen Vernunft inmitten des § 6 gesetzt und der § 3 ersatzlos gestrichen. Im Unterschied zu vielen Autoren, die den Umstellungen Ludwigs folgen, soll im Folgenden weiter der Akademie-Ausgabe gefolgt werden. Bernd Ludwig erläutert die von ihm vorgenommenen Textumstellungen in den folgenden Beiträge: Ludwig, Bernd: Einleitung, in: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Metaphysik der Sitten. Erster Teil, hrsg. v. Bernd Ludwig, Hamburg 1988, 2. Aufl. 1998, S. XIII-XL; Ders.: Postulat, Deduktion und Abstraktion in Kants Lehre vom intelligiblen Besitz. Einige Reflexionen im Anschluss an den vorstehenden Aufsatz von Y. Saito, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 82, 1996, S. 250-259; Ders.: Der Platz des rechtlichen Postulats der praktischen Vernunft innerhalb der Paragraphen 1 – 6 der kantischen Rechtslehre, in: Rechtsphilosophie der Aufklärung, Symposium Wolfenbüttel, hrsg. v. Reinhardt Brandt, Berlin – New York 1982, S. 218-232. Die darauf folgende systematische Debatte hat sich u. a. in den folgenden Beiträge entfaltet: Fulda, Hans Friedrich: Erkenntnis der Art, etwas Äußeres als das Seine zu haben, in: Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999; Saito, Yumi: Die Debatte weitet sich aus – zu Bernd Ludwigs vorstehender Replik, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 82, 1996, S. 259-265; Ders.: War die Umstellung von § 2 der Kantischen ‚Rechtslehre‘ zwingend?, in: Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie 82, 1996, S. 238-250; Tuschling, Burkhard: Das ‚rechtliche Postulat der praktischen Vernunft‘: seine Stellung und Bedeutung in Kants ‚Rechtslehre‘, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer und Gerhard Seel, Würzburg 1988, S. 273-292. 200 Wie nun zu sehen sein wird, sucht Kant den postulierten Grundsatz von der Möglichkeit des äußeren Mein und Dein indirekt und negativ in der Unmöglichkeit seines Gegenteils zu beweisen: Es kann kein allgemeines Gesetz der praktischen Vernunft geben nach welchem äußere Gegenstände der Willkür für objektiv herrenlos betrachtet werden sollen. Es sei allerdings daran erinnert, dass für Kant der apagogische Beweis „zwar Gewißheit, aber nicht Begreiflichkeit der Wahrheit in Ansehung des Zusammenhanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit hervorbringen“ kann (KrV: III, 514). Er kann nur da erlaubt sein, „wo es unmöglich ist, das Subjective unserer Vorstellungen dem Objectiven, nämlich der Erkenntniß desjenigen, was am Gegenstande ist, unterzuschieben“ (KrV: III, 514f.). 201 Vgl. RL: VI, 246 202 RL: VI, 246 198 - 45 - In einem ersten Schritt stellt Kant folgende Behauptung auf: Sollte der Gebrauch eines äußeren Gegenstandes meiner Willkür rechtlich ausgeschlossen sein, das heißt mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz nicht zusammen bestehen können, dann würde die Freiheit sich selbst des Gebrauchs ihrer Willkür in Ansehung eines Gegenstandes derselben berauben, obgleich die Willkür formaliter im Gebrauch der Sachen mit jedermanns äußeren Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmte.203 In einem solchen Fall würden (physisch) brauchbare Gegenstände (rechtlich) außer aller Möglichkeit des Gebrauchs gesetzt, das heißt in praktischer Rücksicht vernichtet und zur res nullis gemacht. Es kann festgehalten werden, dass Kant hier den Konjunktiv, und nicht den Indikativ verwendet. Die weiteren Ausführungen lassen jedoch keinen Zweifel daran bestehen, dass für Kant die Willkür, formaliter, im Gebrauch der Sachen mit jedermanns äußerer Freiheit tatsächlich zusammenstimmt. Kant erbringt allerdings nicht gleich den Nachweis dafür, dass meine äußere Freiheit unmöglich von einer anderen Willkür im Gebrauch der (herrenlosen) äußeren Gegenstände beeinträchtigt werden kann. Näheren Aufschluss darüber erfahren wir erst im § 3 sowie in den Vorarbeiten zur Rechtslehre.204 Für Kant darf einzig ein Unrecht verhindert werden. Unrecht ist jede Handlung, welche mit der äußeren Freiheit eines jeden Menschen nach einem allgemeinen Gesetz nicht zusammen bestehen kann. Es geschieht mir aber kein Unrecht, wenn ein Anderer von einem herrenlosen äußeren Gegenstand, in dessen Besitz ich also nicht bin, Gebrauch macht, weil dasselbe Objekt zugleich ebenso Gegenstand der Willkür anderer ist folglich mit der Freiheit anderer es zu gebrauchen nach allgemeinen Gesetzen gar wohl zusammenbesteht.205 Jeder ist gleich befugt, einen herrenlosen äußeren Gegenstand zu gebrauchen. Deswegen tut die Verhinderung meines Gebrauchs eines herrenlosen äußeren Gegenstandes durch jemanden anderen, der diesen Gegenstand zuerst in Besitz genommen hat, zwar meiner Willkür, aber nicht meiner Freiheit Abbruch. Solange ich einen herrenlosen äußeren Gegenstand nicht besitze, habe ich auch kein Recht in Ansehung desselben. In der Folge geschieht mir auch kein Unrecht, wenn dieser herrenlose Gegenstand meiner Willkür von einem anderen besitzt wird und ich dadurch von jedem Gebrauch desselben abgehalten werde.206 Weil der Besitz und der Gebrauch eines äußeren Gegenstandes nicht die äußere Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz beeinträchtigt, also kein Unrecht darstellt, können der Besitz sowie der Gebrauch eines äußeren Gegenstandes nicht verboten werden. Die Möglichkeit, einen äußeren Gegenstand zu erwerben und zu gebrauchen, kann somit nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. In einem zweiten Schritt zeigt Kant, dass die Möglichkeit des Besitzes sich ausnahmslos auf alle äußeren Gegenstände der Willkür bezieht. In Kants eigenen Worten heißt es: „Da nun die reine praktische Vernunft keine andere als formale Gesetze des Gebrauchs der Willkür zum Grunde legt und also von der Materie der Willkür, d. i. der übrigen Beschaffenheit des Objects, wenn es nur ein Gegenstand der Willkür ist, abstrahirt, so kann sie in Ansehung eines solchen Gegenstandes kein absolutes Verbot seines Gebrauchs enthalten, weil dieses ein Widerspruch der äußeren Freiheit mit sich selbst sein würde“.207 Das allgemeine Rechtsgesetz als ein Gesetz der reinen praktischen Vernunft bestimmt die äußere Freiheit lediglich der Form nach. Es bezieht sich keinesfalls auf die Materie der äußeren Freiheit, das heißt im hier diskutierten Zusammenhang auf alle einzelnen, empirisch möglichen äußeren Gegenstände der Willkür. Das allgemeine Rechtsgesetz kann lediglich zeigen, ob es rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, überhaupt äußere Gegenstände zu besitzen 203 Vgl. RL: VI, 246 Vgl. Vorarbeit: XXIII, 225, 324 205 Vgl. Vorarbeit: XXIII, 324 206 Vgl. Vorarbeit: XXIII, 225 207 RL: VI, 246 204 - 46 - und zu gebrauchen. Im ersten Schritt wurde aber gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, äußere Gegenstände meiner Willkür zu besitzen und zu gebrauchen. Da die reine praktische Vernunft von der „Beschaffenheit des Objects“ abstrahiert, gibt es keinen Grund, bestimmte äußere Gegenstände als mögliche Gegenstände meiner Willkür auszuschließen. Für Kant sollen also alle Gegenstände der Willkür besessen und gebraucht werden können.208 Im dritten und zugleich letzten Schritt bestimmt Kant, was genau ein äußerer Gegenstand der Willkür ist. Es handelt sich dabei um alle von mir unterschiedene Gegenstände, die „zu gebrauchen ich physisch in meiner Macht habe“.209 Dabei ist die Frage ohne jede Bedeutung, ob dieser Gegenstand zusätzlich in meiner Gewalt ist oder nicht. Ein Gegenstand ist in meiner Macht (potentia), wenn ich das physische Vermögen habe, von ihm einen beliebigen Gebrauch zu machen. Gemeint ist also die Möglichkeit des Gebrauchs eines äußeren Gegenstandes. Um denselben Gegenstand in meiner Gewalt (potestas) zu haben, muss ein „Akt der Willkür“210 hinzukommen, nämlich die Ausübung des erwähnten Vermögens.211 In den Vorarbeiten definiert Kant die äußeren Gegenstände der Willkür ebenfalls als solche, die „ich mir zum künftigen Gebrauch vorbehalte“212 sowie als solche, „wovon ich einen Gebrauch beabsichtigen kann“.213 Diese zukunftsgestaltende Dimension betont Kant, wenn er in Bezug auf den intelligiblen Besitz vom „intentionellen“214, „potentialen“215, und „virtuellen“216 Besitz spricht. In Abgrenzung dazu wird der empirische Besitz als „potestativer“217 bezeichnet. Kant kommt letztlich zum Schluss, dass es eine „Voraussetzung a priori der praktischen Vernunft [ist], einen jeden Gegenstand meiner Willkür als objectiv mögliches Mein oder Dein anzusehen und zu behandeln“.218 Negativ ausgedrückt, hat dies zu bedeuten, dass es keine objektiv herrenlose äußere Gegenstände der Willkür geben darf. Positiv formuliert bedeutet dies wiederum die „Uneingeschränktheit der Willkürfreiheit gegenüber Sachen und damit die grundsätzliche Eigentumsfähigkeit aller Willkürgegenstände“.219 Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass was im § 1 der Rechtslehre lediglich als Möglichkeit ausgeführt wurde, hier als notwendige Voraussetzung der reinen praktischen Vernunft selbst erklärt wird. Am Ende des § 2 führt Kant noch an, dass man dieses Postulat ein „Erlaubnißgesetz (lex permissiva) der praktischen Vernunft“220 nennen kann. Diese Formulierung hat mitnichten zu bedeuten, dass an sich verbotene Handlungen, durch das rechtliche Postulat der praktischen Vernunft erlaubt werden. Im Gegensatz zu dem, was gelegentlich zu lesen ist, 208 Ohne die Möglichkeit, äußere Gegenstände rechtmäßig zu besitzen und zu gebrauchen, könnte das angeborene Recht der Menschheit auf den allgemein gesetzlichen Gebrauch der äußeren Freiheit gar nicht verwirklicht werden. Georg Geismann stellt zutreffend fest: „Das Recht der Menschheit in der je eigenen Person auf den allgemein gesetzlich bestimmten Gebrauch der freien Willkür wäre buchstäblich gegenstandlos, wenn dieses Eine (angeborene) Recht (des inneren Mein und Dein) nicht in bestimmten (erworbenen) Rechten (des äußeren Mein und Dein) gleichsam konkret würde, so daß äußere Gegenstände meiner Willkür von mir auch rechtmäßig gebraucht werden können“ (Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 21). 209 RL: VI, 246 210 RL: VI, 246 211 Vgl. RL: VI, 246; Vorarbeit: XXIII, 312 212 Vorarbeit: XXIII, 291 213 Vorarbeit: XXIII, 307 214 Vorarbeit: XXIII, 282 215 Vorarbeit: XXIII, 321 216 Vorarbeit: XXIII, 326 217 Vorarbeit: XXIII, 321 218 RL: VI, 246 219 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 193. 220 RL: VI, 247 - 47 - wird mit dem rechtlichen Postulat der praktischen Vernunft keine Einschränkung oder Ausnahme zum allgemeinen Rechtsgesetz geschaffen.221 Kant weist vielmehr explizit darauf hin, dass die praktische Vernunft sich mit diesem Postulat erweitert. Was ist darunter zu verstehen? Wie bereits gesehen wurde, enthält das Recht eine Befugnis zu zwingen. Das Recht einen jeden äußeren Gegenstand meiner Willkür als das Meine zu besitzen enthält somit einer korrespondierenden Befugnis (bzw. Erlaubnis), „allen andern eine Verbindlichkeit aufzulegen, die sie sonst nicht hätten“222, sich des Gebrauchs gewisser Gegenstände meiner Willkür zu enthalten, weil ich sie zuerst (und damit formaliter mit der äußeren Freiheit von jedermann nach einer allgemeinen Gesetzgebung zusammenstimmend) in meinem Besitz genommen habe. Die erwähnte „Erweiterung“223 besteht also darin, dass mit dem rechtlichen Postulat der praktischen Vernunft die zunächst bloß formaliter eingeschränkte Freiheit nun zusätzlich materialiter bestimmt wird.224 Durch diese Erweiterung bleibt die Gesetzgebung der praktischen Vernunft nicht länger auf dem Recht einer jeden Person in Ansehung ihrer selbst beschränkt, sondern erstreckt sich nun auch auf dem Recht derselben in Ansehung äußerer Gegenstände der Willkür. Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass es rechtlich möglich ist, etwas Äußeres als das Seine zu haben. Spätestens an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Kant im § 2 noch keinen Gebrauch von der im § 1 getroffenen Unterscheidung von sinnlichem und intelligiblem Besitz macht. Im Folgenden soll deshalb auf die doppelte Frage eingegangen werden, was genau unter einem solchen äußeren Mein zu verstehen ist, und wie ein solches möglich ist. Im § 3 stellt Kant die folgende Behauptung auf: „Im Besitze eines Gegenstandes muss derjenige sein, der eine Sache als das Seine zu haben behaupten will“.225 Die Behauptung, dass ein Gegenstand außer mir das Meine sei und von mir gebraucht werden kann, setzt den Besitz dieses Gegenstand voraus, denn sonst würde mich der Gebrauch, den ein anderer ohne meine Einwilligung davon machen würde, mich nicht lädieren können. Wenn einen Gegenstand etwas außer mir, mit dem ich gar nicht rechtlich verbunden ist, affiziert, kann mich dieser Gegenstand auch nicht affizieren und Unrecht tun.226 Nach den Kategorien der Relation (Substanz, Kausalität, Gemeinschaft) zwischen mir und den äußeren Gegenständen nach Freiheitsgesetzen unterscheidet Kant anschließend die drei einzig denkbaren Arten von äußeren Gegenständen meiner Willkür bei deren Gebrauch sich Personen gegenseitig lädieren können. Gemeint sind: a) allen vom Rechtssubjekt unterschiedenen, körperlichen Sachen (Substanz); b) die Willkür eines Anderen zu einer mir zustehenden Leistung (Kausalität); c) der Zustand eines Anderen (wie Ehepartner, Kind, 221 So schreibt beispielsweise Wolfgang Kersting: „Da das Postulat zu einer Einschränkung der Willkür anderer befugt, die aus dem Rechtsgesetz selbst nicht ableitbar ist, zu Unterlassungen verpflichtet, die nach dem Pflichtgesetz der Handlungen nicht unter das Rechtsverbot fallen, kommt dem Vernunftpostulat durchaus die Funktion einer Einschränkung der allgemeinen Gültigkeit des Rechtsgesetzes zu“ (Ders.: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 195). Vgl. auch Brandt, Reinhard: Das Erlaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants Rechtslehre, in: Ders. (hrsg.): Rechtsphilosophie der Aufklärung, Berlin/New York 1982, S. 256ff. Dagegen: Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 23ff; Oberer, Hariolf: Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Bd. III, Würzburg 1997, S. 197ff. 222 RL: VI, 247 223 RL: VI, 247 224 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 23. 225 RL: VI, 247 226 Vgl. RL: VI, 247 - 48 - usw.) in Verhältnis auf das Subjekt (Gemeinschaft).227 Diese Dreiteilung begründet die dreifache Unterteilung des zweiten Hauptstücks des ersten Teils der Rechtslehre in das Sachenrecht, das persönliche Recht und das auf dingliche Art persönliche Recht. Darauf soll allerdings nicht näher eingegangen werden. Bei der Exposition des Begriffs vom äußeren Mein und Dein ist es für uns wichtig festzuhalten, dass ich einen von mir unterschiedenen Gegenstand nur dann als äußeres Mein bezeichnen kann, wenn, obgleich ich nicht im physischen Besitz desselben bin, ich dennoch in einem bloß rechtlichen Besitz desselben zu sein behaupten darf.228 Darauf aufbauend bestimmt Kant im § 5 das äußere Mein, als den Inbegriff jeder einzelner, von mir unterschiedener Gegenstände, in deren Gebrauch mich zu stören selbst dann Läsion (Unrecht) wäre, wenn ich nicht im physischen Besitz derselben bin. Der Begriff des äußeren Mein ist somit ein bloß intellektueller Besitz. Es ist kein „Besitz in der Erscheinung (possessio phaenomenon)“, sondern ein „intelligibler Besitz (possessio noumenon)“.229 Im § 4 hatte Kant gezeigt, dass das äußere Mein auf einem bloß rechtlichen Besitz gründet. Im hier behandelten § 5 folgert Kant aus der im § 2 postulierten Möglichkeit, etwas Äußeres als das Seine zu haben, dass ein intelligibler Besitz als möglich vorausgesetzt werden muss.230 Es wurde gesehen, dass die Begründung der Möglichkeit des Besitzes für Kant gänzlich von allen empirischen Bedingungen, das will heißen von der Tatsächlichkeit der Inhabung, unabhängig sein muss. Kant führt hierfür den folgenden Grund an: „Alle Rechtssätze sind Sätze a priori, denn sie sind Vernunftgesetze (dictamina rationis)“.231 Den Rechtssatz a priori in Ansehung des empirischen Besitzes zu begründen, stellt keine besonderen Schwierigkeiten dar, da er aus diesem analytisch232 folgt. Wer ohne meine Einwilligung von einem äußeren Gegenstand meiner Willkür, den ich physisch besitze, affiziert, affiziert dadurch zugleich meine innere Freiheit. Derartige Handlungen sind rechtswidrig, da sie dem „Axiom des Rechts“233 widersprechen, das heißt mit der Freiheit eines jeden nach einem allgemeinen Gesetz nicht zusammen bestehen können. Die Frage, wie ein äußeres Mein und Dein möglich sei, löst sich daher in diejenige auf: wie ist ein bloß rechtlicher (intelligibler) Besitz möglich? Um dagegen den Rechtssatz a priori in Ansehung des intelligiblen Besitzes zu begründen, stößt man dagegen auf ersthafte Schwierigkeiten. Der intelligible Besitz abstrahiert nämlich von allen Bedingungen des empirischen Besitzes im Raum und Zeit, und damit von der physischen Verknüpfung zwischen dem Gegenstand und dem ihn besitzenden Rechtssubjekt. Das rechtliche Mein ist unabhängig vom physischen Besitz, mithin von der tatsächlichen Inhabung. Die Möglichkeit eines intelligiblen Besitzes ergibt sich nicht aus dem Rechtsbegriff selbst. Dass der Gebrauch, den jemand wider meiner Einwilligung von einem äußeren Gegenstand meiner Willkür, den ich physisch nicht besitze, macht, meine Freiheit 227 Vgl. RL: VI, 247, 259 RL: VI, 248 229 RL: VI, 249 230 Vgl. RL: VI, 249 231 RL: VI, 249 232 Was unter einem analytischen Satz zu verstehen ist, hatte Kant insbesondere im vierten Absatz seiner Einleitung in der Kritik der reinen Vernunft erläutert (Vgl. KrV: IV, A 7). Für Kant sind alle Urteile, worin das Verhältnis eines Subjekts zu einem Prädikat gedacht wird, entweder analytisch oder synthetisch. Ein Urteil ist analytisch, wenn das Prädikat im Subjekt schon enthalten ist. Analytische Urteile werden von Kant als Erläuterungsurteile bezeichnet, weil sie nicht unsere Erkenntnis bereichern, sondern nur das aussagen, was sich aus den Begriffen bereits ergibt. Im Unterschied dazu ist ein Urteil synthetisch, wenn seine Bedeutung sich aus der Erfahrung ableitet. In einem synthetischen Satz wird durch das Prädikat dem Subjekt etwas hinzugefügt. Synthetische Urteile werden auch von Kant als Erweiterungsurteile bezeichnet, da jene unsere Erkenntnis bereichern, weil sie mehr aussagen, als was die Begriffe hergeben. Vgl. GMS: IV, 417. 233 RL: VI, 250 228 - 49 - affiziert und lädiert, steht nicht in seiner Maxime mit dem Rechtsgesetz im geraden Widerspruch. Der Rechtssatz a priori in Ansehung des intelligiblen Besitzes ist somit synthetisch. Fraglich ist vor diesem Hintergrund, wie ein solcher synthetischer (den Begriff des empirischen Besitzes erweiternde) Satz a priori möglich ist? Als Antwort hierauf führt Kant zunächst aus, dass die Möglichkeit eines nichtempirischen und doch rechtlichen Besitzes, mithin die Deduktion des Begriffs des bloß rechtlichen Besitzes, auf dem rechtlichen Postulat der praktischen Vernunft gründet. Seine von der im § 2 anzutreffende abweichende Formulierung dieses Postulat lautet: „daß es Rechtspflicht sei, gegen Andere so zu handeln, daß das Äußere (Brauchbare) auch das Seine von irgend jemanden werden könne“.234 Demnach ist jeder rechtlich dazu verpflichtet, sich so zu verhalten, dass es für irgendjemand möglich ist, etwas Äußeres als das Seine zu haben. Negativ formuliert, hat dies bedeuten, dass es Rechtspflicht sei, niemanden am Besitz und Gebrauch äußerer Gegenstände nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zu hindern. Wenn Kant hier vom (äußeren) „Sein“ spricht, dann ist es offensichtlich, dass er den intelligiblen Besitz im Sinne hat. Die Möglichkeit des letzteren kann nicht für sich bewiesen werden, „weil es ein Vernunftbegriff ist, dem keine Anschauung correspondirend gegeben werden kann“.235 Die Möglichkeit des bloß rechtlichen Besitzes ist, so schreibt Kant, eine „unmittelbare Folge aus dem gedachten Postulat“.236 Kants entscheidende Begründung hierzu ist, dass die notwendige Bedingung eines notwendigen Rechtsgrundsatzes selber möglich sein muss. Damit ist Deduktion des Begriffs des bloß rechtlichen Besitzes am Ende gelangt. Unbeantwortet bleibt dagegen die weitere Frage, aus welchem Grund und auf welche Art und Weise ein äußeres Gegenstand meiner Willkür das rechtliche Meine und nicht eben das Seine jemanden anders erklärt werden kann. Die Art und Weise wie äußere Gegenstände von den einzelnen Rechtssubjekten erworben werden, muss Grundsätzen unterliegen, welche mit dem allgemeinen Rechtsgesetz und dem angeborenen Recht der Menschheit in Einklang sein sollen. Im begrenzten Rahmen der vorliegenden Arbeit kann jedoch nicht weiter auf diesen Punkt eingegangen werden.237 Denn wir wollten nicht Kants Eigentumstheorie an sich und bis in jedes Detail untersuchen, sondern nur seine systematische Bedeutung für den Übergang in den bürgerlichen Zustand. Diesbezüglich stellt Kant im § 8 der Rechtslehre die folgende These auf: „Etwas Äußeres als das Seine zu haben, ist nur in einem rechtlichen Zustande, unter einer öffentlichgesetzgebenden Gewalt, d. i. im bürgerlichen Zustande, möglich“.238 Mit der Behauptung, dass etwas Äußeres das Meine sei, wird jedem eine Verbindlichkeit auferlegt, die sie sonst nicht hätten, sich den Gegenstand meiner Willkür zu enthalten. Wenn ich also erkläre, dass ich einen äußeren Gegenstand meiner Willkür besitze, dann erkläre ich damit zugleich, dass alle anderen am Besitz und am Gebrauch desselben Gegenstandes ausgeschlossen sind. Ich erkläre, dass ich als einziger diesen Gegenstand gebrauchen kann, und dass ich alle anderen von seinem Gebrauch ausschließen kann.239 Mit dieser zunächst scheinbar anmaßenden Behauptung ist allerdings die „Bekenntniß“ verbunden, „jedem Anderen in Ansehung des 234 RL: VI, 252 RL: VI, 252 236 RL: VI, 252 237 Kant geht auf diese Frage im zweiten Hauptstück des ersten Hauptteils unter der Überschrift »Von der Art etwas Äußeres zu erwerben« ein. Siehe dazu: Kühl, Kristian: Von der Art, etwas Äußeres zu erwerben, insbesondere vom Sachenrecht, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 117-133. 238 RL: VI, 255 239 Wolfgang Kersting betont zu Recht, dass mit der Behauptung, dass etwas Äußeres das Meine sei, eine „uneinschränkbare Dispositionsbefugnis mit einer allseitig gerichteten Ausschlussbefugnis“ verbunden ist (Ders.: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 200). 235 - 50 - äußeren Seinen wechselseitig zu einer gleichmäßigen Enthaltung verbunden zu sein“.240 Meine Behauptung, dass etwas Äußeres das Meine sei, lässt sich demnach nur dann rechtfertigen, wenn ich allen Anderen das reziproke Recht zugestehe, etwas Äußeres als das Ihrige zu erklären und ich mich dazu verpflichte, mich dieser Gegenstände zu enthalten. Das rechtliche Meine gründet auf diese „Reciprocität der Verbindlichkeit“.241 Das erwähnte Bekenntnis reicht allerdings nicht allein aus, um sicher zu stellen, dass jedermann das äußere Sein aller Anderen unangetastet lassen wird. Eine solche Sicherheit kann ein „einseitige[r] Wille“ nicht leisten, weil es „der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen Abbruch thun würde“.242 Diese Sicherheit kann also überhaupt nur ein „collectiv allgemeiner (gemeinsamer) und machthabender Wille“243 leisten. Kant fährt dann folgendermaßen fort: „Der Zustand aber unter einer allgemeinen äußeren (d. i. öffentlichen) mit Macht begleiteten Gesetzgebung ist der bürgerliche. Also kann es nur im bürgerlichen Zustande ein äußeres Mein und Dein geben“.244 Aus der im § 2 postulierten Möglichkeit einen äußeren Gegenstand als das Seine zu haben, folgt daher die Erlaubnis eines jeden, „jeden Anderen, mit dem es zum Streit des Mein und Dein über ein solches Object kommt, zu nöthigen, mit ihm zusammen in einer bürgerliche Verfassung zu treten“.245 Aus der doppelten Feststellung, dass es jedem möglich sein soll, etwas Äußeres als das Seine zu haben, und dass das rechtliche Mein nur im bürgerlichen Zustand wirklich werden kann, ergibt sich das Recht eines jeden, jeden Anderen zum Eintritt in den bürgerlichen Zustand zu nötigen. Dies ist Kants Begründung der Notwendigkeit des Eintritts in den bürgerlichen Zustand aus der notwendigen Möglichkeit des äußeren Mein und Dein. Seine vorhergehenden Erläuterungen präzisierend, führt Kant im § 9 aus, dass im Naturzustand doch „ein wirkliches, aber nur provisorisches äußeres Mein und Dein statt haben“246 kann. Die statutarischen Gesetze, die im bürgerlichen Zustand verabschiedet werden, sind an das Naturrecht, mithin an den apriorischen Prinzipien des Rechts gebunden und dürfen jenen nicht widersprechen. Aus diesem Grund bleibt selbst im bürgerlichen Zustand das Vernunftprinzip des Rechts bestehen, wonach derjenige, „welcher nach einer Maxime verfährt, nach der es unmöglich wird einen Gegenstand meiner Willkür als das Meine zu haben, [mich] lädirt“.247 Der bürgerliche Zustand, der im § 8 als die notwendige Bedingung der Möglichkeit des äußeren Mein und Dein dargestellt wurde, bestimmt Kant nun präziser als den rechtlichen Zustand, „durch welchen jedem das Seine nur gesichert, eigentlich aber nicht ausgemacht und bestimmt wird“.248 Mit dem Eintritt in den bürgerlichen Zustand wird das äußere Mein und Dein rechtlich gesichert. Alle Garantie setzt aber „das Seine von jemanden (dem es gesichert wird) schon voraus“.249 Also „muß vor der bürgerlichen Verfassung (oder von ihr abgesehen) ein äußeres Mein und Dein als möglich angenommen werden“.250 Dieses von der bürgerlichen Verfassung gesicherte, aber logisch und faktisch vorausliegende Mein und Dein bezeichnet Kant als ein „provisorisch rechtlicher Besitz“.251 Im bürgerlichen Zustand wird der bloß 240 RL: VI, 255 RL: VI, 256. Die Reziprozität bedeutet wiederum, dass ich nicht verbunden bin, „das äußere Seine des Anderen unangetastet zu lassen, wenn mich nicht jeder Andere dagegen auch sicher stellt, er werde in Ansehung des Meinigen sich nach ebendemselben Princip verhalten“ (RL: VI, 255f.). 242 RL: VI, 256; Vgl. RL: VI, 264 243 RL: VI, 256 244 RL: VI, 256 245 RL: VI, 256 246 RL: VI, 256 (meine Hervorhebungen) 247 RL: VI, 256 248 RL: VI, 256 249 RL: VI, 256 250 RL: VI, 256 251 RL: VI, 257 241 - 51 - provisorische Besitz von einer jedermann verbindenden, mithin allgemeinen und machthabenden Gesetzgebung gesichert. Dieser Besitz wird alsdann zu einem „peremtorische[n] Besitz“.252 Weil es überhaupt (also unabhängig von jeglichen Erfahrungsbedingungen) möglich sein soll, äußere Gegenstände der Willkür zu besitzen und zu gebrauchen, gibt es bereits vor dem Eintritt in den bürgerlichen Zustand berechtigte Ansprüche auf den Besitz und den Gebrauch äußerer Gegenstände der Willkür. In Abwesenheit einer allgemeinen und machthabenden Gesetzgebung können jedoch die Besitzansprüche verschiedener Rechtssubjekte jederzeit miteinander kollidieren, ohne dass dazu eine rechtliche Lösung gefunden werden kann. Denn der Wille eines Anderen, mir eine Verbindlichkeit aufzulegen, von einem gewissen Besitz abzustehen, ist bloß einseitig und kann im Naturzustand ebenso wenig allgemeine Verbindlichkeit und Notwendigkeit beanspruchen, wie mein eigener. In Kants eigenen Worten heißt es, dass „die Willkür des Einen mit der des Anderen […] nicht als für sich selbst als nothwendig zusammenstimmend (mithin den Rechtsbegriffen gemäs) angenommen werden“253 kann. Aus der rechtlichen Unmöglichkeit objektiver Herrenlosigkeit der äußeren Gegenstände einerseits und der ebenso rechtlichen Unmöglichkeit einseitiger Rechtsdurchsetzung andererseits folgert Kant das Recht eines jeden Rechtssubjekts allen anderen zum Eintritt in den bürgerlichen Zustand zu nötigen, wenn (und nur wenn) er selbst dazu bereit ist, in einen solchen Zustand zu treten. Die entscheidende systematische Bedeutung, die dem provisorischen Besitz zukommt, soll an dieser Stelle unterstrichen werden. Es ist nämlich der provisorische Besitz, welcher den Menschen zwingend fordert in einen bürgerlichen Zustand einzutreten, sich also einer öffentlichen Gesetzgebung zu unterwerfen. Dies wird an späterer Stelle von Kant mit aller wünschenswerten Deutlichkeit ausgedrückt: „Wollte man vor Eintretung in den bürgerlichen Zustand gar keine Erwerbung, auch nicht einmal provisorisch für rechtlich erkennen, so würde jener selbst unmöglich sein […] Es würde also, wenn es im Naturzustande auch nicht provisorisch ein äußeres Mein und Dein gäbe, auch keine Rechtspflichten in Ansehung desselben, mithin auch kein Gebot geben, aus jenem Zustande herauszugehen“.254 5. Der Beweis der Notwendigkeit des öffentlichen Rechts Aufbauend auf seine Theorie vom Privatrecht zeigt Kant anschließend rein rational, dass es im Naturzustand keine Garantie für das innere und äußere Mein und Dein geben kann, und dass somit die Menschen die Pflicht haben, in einen bürgerlichen Zustand einzutreten. 5.1 Der Naturzustand der Menschen als Vernunftidee Im Folgenden soll Kants Beweis für die Notwendigkeit des Übergangs vom natürlichen Zustand zum bürgerlichen Zustand erläutert werden. Kant hat seine Lehre vom Naturzustand an verschiedenen Stellen seiner Werke entfaltet. Die systematische Entfaltung seiner Gedanken zum Naturzustand findet sich allerdings im § 41, 42 und 44 der Rechtslehre, worauf nun näher eingegangen werden muss. Im § 41 der Rechtslehre bezeichnet Kant den Naturzustand (status naturalis) zunächst als ein „nicht-rechtliche[r] Zustand“, in welchem es „keine austheilende Gerechtigkeit“255 gibt. Dem soeben definierten Naturzustand stellt Kant den bürgerlichen Zustand (status civilis) gegenüber und nicht den gesellschaftlichen, weil „es in jenem zwar gar wohl 252 RL: VI, 257 Vorarbeit: XXIII, 215 254 RL: VI, 312f. 255 RL: VI, 306; Vgl. RL: VI, 312 253 - 52 - Gesellschaft geben kann, aber nur keine bürgerliche (durch öffentliche Gesetze das Mein und Dein sichernde)“.256 Ferner im selben Text heißt es: „[E]s kann auch im Naturzustande rechtmäßige Gesellschaften (z.B. eheliche, väterliche, häusliche überhaupt und andere beliebige mehr) geben, von denen kein Gesetz a priori gilt: „Du sollst in diesen Zustand treten“, wie es wohl vom rechtlichen Zustande gesagt werden kann, daß alle Menschen die miteinander […] in Rechtsverhältnisse kommen können, in diesen Zustand treten sollen“.257 An dieser Stelle besteht Erklärungsbedarf darüber, wie Kant die hier erwähnte Rechtspflicht begründet, aus dem Naturzustand herauszutreten. In den folgenden Ausführungen soll gezeigt werden, dass Kant zwei unterschiedliche Argumentationsmuster entwickelt, um die Notwendigkeit des Übergangs vom natürlichen in den bürgerlichen Zustand zu begründen. Im § 42 der Rechtslehre argumentiert Kant zunächst bloß durch Bezugnahme auf die empirischen Bedingungen der menschlichen Natur. Erst im § 44 behandelt Kant den Naturzustand als reine Vernunftidee. Diese beiden Argumentationsmuster werden in der Sekundärliteratur selten deutlich voneinander unterschieden, obwohl sie argumentativ nicht miteinander zu verwechseln sind. Der § 42 der Rechtslehre setzt mit dem „Postulat des öffentlichen Rechts“ ein. Dieses lautet wie folgt: „[D]u sollst im Verhältnisse eines unvermeidlichen Nebeneinanderseins mit allen anderen aus jenem heraus in einen rechtlichen Zustand, d. i. den einer austheilenden Gerechtigkeit übergehen“.258 Im Anschluss daran führt Kant aus, dass der Grund davon sich „analytisch aus dem Begriffe des Rechts im äußeren Verhältniß im Gegensatz der Gewalt“259 ergibt. An dieser Stelle soll zweierlei bemerkt werden. Erstens: Der § 42 steht ganz am Ende des ersten Teils der Rechtslehre bezüglich des Privatrechts vom äußeren Mein und Dein in einem Kapitel unter der Überschrift »Übergang von dem Mein und Dein im Naturzustande zu dem im rechtlichen Zustande überhaupt«.260 Während Kants Argumentation im § 41 noch an seine direkt vorhergehende Ausführungen bezüglich des Privatrechts vom äußeren Mein und Dein anknüpft, erweitert er im § 42 die Perspektive und bezieht sich dort nicht mehr nur auf das Privat des äußeren Mein und Dein, sondern auch auf das Privatrecht des inneren Mein und Dein. Für diese Interpretation spricht zunächst die Tatsache, dass Kant im Titel allgemein vom „Übergang von dem Mein und Dein im Naturzustande“ und nicht speziell vom „Übergang von dem äußeren Mein und Dein im Naturzustande“ spricht. Als weitere Hinweis für unsere Interpretation gilt, dass für Kant das Postulat des öffentlichen Rechts sich aus dem Privatrecht im natürlichen Zustand ergibt, ohne hier wieder zu präzisieren, ob damit das innere (angeborene) Mein und Dein, das äußere (erworbene) Mein und Dein, oder beides gemeint ist. Letztlich darf nicht übersehen werden, dass Kant im § 42 zwar von „Besitz“261 spricht, aber auch mit aller wünschenswerten Deutlichkeit vom „Begriffe des Rechts im äußeren Verhältniß im Gegensatz der Gewalt“, also vom Recht überhaupt, und anschließend noch vom „Recht der Menschen“.262 Zweitens: Kants relativ knapp gehaltene Begründung der Notwendigkeit des Übergangs vom natürlichen im bürgerlichen Zustand ist empirisch bedingt. Im § 42 führt Kant zunächst aus, dass niemand rechtlich verpflichtet ist, sich dem Eingriff in den Besitz eines anderen zu enthalten, wenn dieser ihm nicht eine reziproke Enthaltsamkeit sichert.263 Kant spricht hier explizit aus, was in der Einleitung in die Rechtslehre noch implizit war, nämlich dass die Rechtspflicht „neminem laede“ unter der Bedingung der Wechselseitigkeit 256 RL: VI, 242 RL: VI, 306 258 RL: VI, 307 259 RL: VI, 307 260 Vgl. RL: VI, 305 261 RL: VI, 307 262 RL: VI, 307 263 Vgl. RL: VI, 307 257 - 53 - gilt. Kant fügt hinzu, dass die Menschen nicht abwarten müssen, durch die „traurige Erfahrung“ von der „wirkliche[n] Feindseligkeit“ belehrt zu werden, um zu erkennen, dass es im Naturzustand keine solche gegenseitige Sicherheit geben kann. Es reicht aus, dass alle Menschen angesichts der Kenntnis, die sie jederzeit von sich selbst (durch Introspektion) haben können, die Möglichkeit eines unrechtmäßigen Freiheitsgebrauchs erkennen. Für Kant kann jeder Mensch in sich selbst die böse Neigung hinreichend wahrnehmen „über andere den Meister zu spielen (die Überlegenheit des Rechts anderer nicht zu achten, wenn sie sich der Macht oder List nach diesen überlegen fühlen)“.264 Kants anthropologisches Argument könnte allerdings noch pointierter formuliert werden. Es zeigt sich nämlich, dass die gebotene wechselseitige Enthaltsamkeit jedes Menschen in der äußeren Freiheitssphäre aller anderen im nicht-rechtlichen Naturzustand angesichts der menschlichen Natur notwendig unmöglich ist. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass die Menschen sich des Eingriffs in der äußeren Freiheit der anderen enthalten, aber diese Enthaltsamkeit kann eben nicht garantiert werden, das heißt ein Abbruch an der eigenen Freiheit muss notwendig von allen Menschen jederzeit als möglich betrachtet werden.265 Kant kommt somit zum entscheidenden Schluss, dass der Mensch „zu einem Zwange gegen den befugt [ist], der ihm schon seiner Natur nach damit [mit wirklichen Feindseligkeiten; F.R.] droht“.266 Im Naturzustand ergibt sich aus der menschlichen Natur eine rechtliche Unsicherheit, woraus das Recht eines jeden Menschen folgt, den anderen zum Verlassen dieses Zustands zu nötigen.267 Kant beschränkt sich allerdings nicht auf diese anthropologische Begründung. Im § 44 behandelt er den Naturzustand als reine Vernunftidee, also diesmal ohne jegliche Bezugnahme auf die empirischen Bedingungen der menschlichen Natur. Dort greift er auf die bereits in der Religionsschrift sich andeutende rein rechtslogische Begründung der Notwendigkeit des Übergangs vom natürlichen Zustand zum bürgerlichen Zustand aufgrund der unaufhebbaren rechtlichen Widersprüchlichkeit des Naturzustandes zurück.268 Dort führt Kant aus, dass im juridischen Naturzustand „ein jeder sich selbst das Gesetz“ gibt, dass jeder „sein eigner Richter“ ist, und dass „keine öffentliche machthabende Autorität [vorhanden ist], die nach Gesetzen, was in vorkommenden Fällen eines jeden Pflicht sei, rechtskräftig bestimme und jene in allgemeine Ausübung bringe“.269 Daraus folgt, dass der juridische Naturzustand „ein Zustand des Krieges von jedermann gegen jedermann“270 ist. In der Religionsschrift kommt Kant letztlich zum folgenden Schluss: „So wie nun ferner der Zustand einer gesetzlosen äußeren (brutalen) Freiheit und Unabhängigkeit von Zwangsgesetzen ein Zustand der Ungerechtigkeit und des Krieges von jedermann gegen 264 RL: VI, 307 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 54f. 266 RL: VI, 307 (meine Hervorhebung) 267 Vgl. auch Frieden: VIII, 349 268 Vgl. Religion: VI, 95ff. 269 Religion: VI, 95 270 Religion: VI, 96. In einer durch ein Sternchen abgesetzten Anmerkung kommentiert Kant Hobbes Lehre vom Naturzustand folgendermaßen: „Hobbes' Satz: status hominum naturalis est bellum omnium in omnes, hat weiter keinen Fehler, als daß es heißen sollte: est status belli etc.. Denn wenn man gleich nicht einräumt, daß zwischen Menschen, die nicht unter äußern und öffentlichen Gesetzen stehen, jederzeit wirkliche Feindseligkeiten herrschen: so ist doch der Zustand derselben (status iuridicus), d. i. das Verhältniß, in und durch welches sie der Rechte (des Erwerbs oder der Erhaltung derselben) fähig sind, ein solcher Zustand, in welchem ein jeder selbst Richter über das sein will, was ihm gegen andere Recht sei, aber auch für dieses keine Sicherheit von andern hat oder ihnen giebt, als jedes seine eigene Gewalt; welches ein Kriegszustand ist, in dem jedermann wider jedermann beständig gerüstet sein muß. Der zweite Satz desselben: exeundum esse e statu naturali, ist eine Folge aus dem erstern: denn dieser Zustand ist eine continuirliche Läsion der Rechte aller andern durch die Anmaßung in seiner eigenen Sache Richter zu sein und andern Menschen keine Sicherheit wegen des ihrigen zu lassen, als bloß seine eigene Willkür“ (Religion: VI, 97). 265 - 54 - jedermann ist, aus welchem der Mensch herausgehen soll, um in einen politisch-bürgerlichen zu treten“.271 Im § 44 der Rechtslehre zeigt sich, dass der Naturzustand bei Kant keinesfalls als eine bestimmte historische Periode begriffen werden kann, sondern ausschließlich als eine bloße Idee der reinen praktischen Vernunft. Es handelt sich genauer gesagt, um das von allen Erfahrungsbedingungen abstrahierte, rein rationale Gedankenexperiment eines Zusammenlebens äußerlich freier Wesen in Abwesenheit einer übergeordneten Rechtsinstanz, welche über die immer möglichen menschlichen Handlungskonflikte verbindlich entscheiden könnte. Der Naturzustand ist also für Kant ein Zustand der Anarchie im etymologischen Sinne des Wortes, also im Sinne von Abwesenheit von (übergeordneter) Herrschaft. Da im Naturzustand keine übergeordnete Instanz mit Rechtssetzungsund Rechtsdurchsetzungskompetenz vorhanden ist, gibt es ebenfalls keine rechtsgesetzliche Einschränkung für den Gebrauch der äußeren Freiheit von jedermann, so dass alle Menschen gänzlich nach Gutdünken handeln können. In seinen verschiedenen Schriften verwendet Kant eine je nach Zusammenhang abwechslungsreiche Terminologie, um diesen Punkt zu betonen. In der Idee spricht er von „gesetzlose[r] Freiheit“272, von „regelloser Freiheit“273 und von „ungebundener Freiheit“.274 In derselben Abhandlung spricht er auch von „wilder Freiheit“275, „brutale[r] Freiheit“276 oder von „barbarische[r] Freiheit“.277 In der Rechtslehre bezeichnet er ferner den Naturzustand als ein Zustand „äußerlich gesetzloser Freiheit“.278 Entscheidend ist im diskutierten Zusammenhang, dass es unter der Bedingung der Anarchie keine rechtliche Lösung bezüglich der stets möglichen menschlichen Handlungskonflikte gibt (und überhaupt geben kann). Im § 44 der Rechtslehre führt Kant aus, dass im Naturzustand das „Recht streitig (ius controversum)“ ist, weil es „kein[en] kompetente[n] Richter“ gibt, der über die menschlichen Handlungskonflikte der Menschen rechtskräftig entscheiden könnte. In Abwesenheit eines solchen „kompetente[n] Richter[s]“ ist jeder sein eigener Richter, das heißt jeder entscheidet für sich selbst, ob sein Gebrauch der äußeren Freiheit rechtmäßig ist. Kant schreibt, dass jeder „seinem eigenen Kopfe folgt“ und die Rechtmäßigkeit seiner Handlungen „nach jedes seinen Rechtsbegriffen“279 urteilt. Das Urteil eines jeden Menschen über die Rechtmäßigkeit des eigenen Gebrauchs der äußeren Freiheit kann aber jederzeit mit dem Urteil jedes beliebigen anderen im Widerspruch stehen. Die gleichberechtigten Rechtsauffassungen der jeweiligen Menschen stoßen aufeinander, ohne dass entschieden werden kann, welche Seite sich im Recht befindet. Im Naturzustand sind somit Handlungskonflikte rechtlich prinzipiell unauflöslich. Aus diesem Grund bezeichnet Kant den Naturzustand der Menschen als einen Zustand einer „völligen Gesetzlosigkeit“280 und als einen „Zustand der Rechtlosigkeit (status iustitia vacuus)“.281 Damit wird selbstverständlich nicht übersehen, dass der Naturzustand in einem weiten Sinne bereits ein Rechtszustand ist, wenn man darunter einen Zustand des (inneren und äußeren) Privatrechts versteht. Was Kant im Sinne hat, wenn er in Bezug auf den Naturzustand von einem Zustand der Gesetzlosigkeit bzw. der Rechtlosigkeit spricht, ist aber, dass der Naturzustand aufgrund des Fehlens einer übergeordneten Instanz mit 271 Religion: VI, 97 Idee: VIII, 25 273 Idee: VIII, 22, 24 274 Idee: VIII, 30 275 Idee: VIII, 22 276 Idee: VIII, 24 277 Idee: VIII, 26 278 RL: VI, 307 279 RL: VI, 312 (meine Hervorhebung) 280 Gemeinspruch: VIII, 301 281 RL: VI, 312 272 - 55 - Rechtssetzungs- und Rechtsdurchsetzungskompetenz notwendig ein Zustand völliger Unwirksamkeit des geltenden Rechts ist.282 Insofern Handlungskonflikte letztlich nur durch die willkürliche Gewaltanwendung (violentia) jedes einzelnen Menschen (im Gegensatz zum institutionalisierten, rechtsgesetzlichen Zwang) zu lösen sind, ist der Naturzustand der Menschen ein Zustand des Krieges aller gegen alle.283 Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, soll darauf hingewiesen werden, dass Kants Bezeichnung des Naturzustandes als Kriegszustand mitnichten zu bedeuten hat, dass die Menschen im Naturzustand sich „einander nur nach dem bloßen Maße [ihrer] Gewalt“284 begegnen. Es bedeutet lediglich, dass im Naturzustand die menschlichen Handlungskonflikte letztlich durch militärische Gewalt entschieden werden, so dass Krieg immer möglich oder faktisch herrscht. In diesem Sinne stellt der Naturzustand eine permanente Läsion aller Staaten durch ihr bloßes Nebeneinandersein dar.285 „Der Mensch aber (oder das Volk) im bloßen Naturstande […] lädirt mich schon durch eben diesen Zustand, indem er neben mir ist, obgleich nicht thätig (facto), doch durch die Gesetzlosigkeit seines Zustandes (statu iniusto), wodurch ich beständig von ihm bedroht werde“.286 Kant spricht daher auch von einer durch den Zustand vor aller Tat gegebenen Rechtsverletzung, also von einer „laesio per statum“.287 Der Naturzustand ist zwar ein Zustand der Rechtlosigkeit nicht aber der Ungerechtigkeit (iniustus), weil es in Abwesenheit einer obersten Rechtsinstanz gar nicht feststeht, was öffentliches Recht und Unrecht ist. Um es einfach auszudrücken: Wo kein Recht, da kein Unrecht. Die Menschen tun sich dennoch überhaupt unrecht, indem sie in einem Zustand sind und auch bleiben, in welchem „Niemand des Seinen wider Gewaltthätigkeit sicher ist“288, also in welchem es keine Garantie für das innere und äußere Mein und Dein gibt und überhaupt geben kann. Die Menschen tun sich jedoch im höchsten Grade unrecht, wenn sie im Naturzustand bleiben, weil sie „dem Begriff des Rechts selber alle Gültigkeit nehmen und alles der wilden Gewalt gleichsam gesetzmäßig überliefern“.289 Hier zeigt sich erneut, dass die Menschen auch durch das ursprüngliche Recht der Menschheit zum Verlassen des natürlichen Zustandes verpflichtet sind. Die im Naturzustand unauflösbare Unsicherheit des angeborenen und erworbenen Rechts steht nämlich im Widerspruch zum ursprünglichen Recht der Menschheit und zur vernunftnotwendigen Möglichkeit des Besitzes äußerer Gegenstände. Aus der Feststellung, dass es im Naturzustand keine Garantie für den inneren und äußeren Mein und Dein geben kann, folgt, dass die Menschen den Naturzustand verlassen und in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand eintreten sollen. Wenn die Menschen nicht allen Rechtsbegriffen entsagen wollen, sollen sie „aus dem Naturzustande […] herausgehen und sich mit allen anderen […] dahin vereinigen, sich einem öffentlich gesetzlichen äußeren Zwange zu unterwerfen, also in einen Zustand treten, darin jedem das, was für das Seine anerkannt werden soll, gesetzlich bestimmt und durch hinreichende Macht (die nicht die seinige, sondern eine äußere ist) zu Theil wird“.290 Die allgemeine Unsicherheit und damit 282 Nur mit Bezug auf die Wirksamkeit des Rechts ist der Naturzustand ein Zustand der Rechtlosigkeit. Mit Bezug auf dessen Geltung ist es dagegen bereits ein Zustand des Privatrechts. Siehe dazu: Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 17 und S. 67ff. 283 Vgl. Religion: VI, 97; RL: VI, 307; Reflexion 7646: XIX, 476; Reflexion 7936: XIX, 560; Reflexion 8076: XIX, 603 284 RL: VI, 312 (meine Hervorhebung) 285 Vgl. Frieden: VIII, 354; RL: VI, 346 286 Frieden: VIII, 349 287 Reflexion 7647: XXIII, 211 288 Vgl. RL: VI, 307 289 Vgl. RL: VI, 307 290 RL: VI, 312 - 56 - Strittigkeit des angeborenen und erworbenen Privatrechts sind inhärente Merkmale des Naturzustands, die erst und ausschließlich durch den Übergang in den bürgerlichen Zustand aufgehoben werden können. Aus diesem Grunde kommt jedem Mensch das Recht zu, jeden anderen zur Unterwerfung unter ein allgemeines Rechtsgesetz zu zwingen. Jedermann darf „den Anderen mit Gewalt antreiben“291 in einen rechtlichen Zustand zu treten. Jedermann hat aber zugleich die unbedingte Rechtspflicht zu einer solchen gemeinsamen Unterwerfung, weil erst und ausschließlich auf diesem Wege jedermanns Rechte überhaupt gesichert werden können. An dieser Stelle soll erneut hervorgehoben werden, dass die Notwendigkeit, den Naturzustand zu verlassen und in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand einzutreten, keinesfalls aus der Erfahrung abgeleitet ist, sondern rein a priori in der Vernunftidee des Naturzustandes liegt. Kants Argumentation abstrahiert von jeglichen empirischen Elementen und basiert ausschließlich auf Rechtsgründen. Kants zuvor erwähnte anthropologische Aussagen bezüglich der menschlichen Natur sind hier ohne jede Bedeutung. Die von Kant erwähnte allgemeine Unsicherheit und damit Strittigkeit des Rechts sind nicht empirisch bedingt, sondern a priori (sogar vor jeglicher Handlung) gegeben. Selbst unter der Annahme, dass alle Menschen gutartig und rechtliebend wären, könnte in einem solchen Zustand niemand jemals sicher sein „aus jedes seinem eigenen Recht zu thun, was ihm recht und gut dünkt, und hierin von der Meinung des Anderen nicht abzuhängen“.292 Es ist Kant gelungen, zu zeigen, dass „bevor ein öffentlich gesetzlicher Zustand errichtet worden [ist], vereinzelte Menschen, Völker und Staaten, niemals vor Gewalttätigkeit gegeneinander sicher sein können“.293 Selbst bei Annahme einer moralisch-rechtlich guten Gesinnung der Menschen können Handlungskonflikte nicht ausgeschlossen werden und sind in Abwesenheit einer übergeordneten Rechtsinstanz rechtlich unauflösbar. Wie bereits gesehen wurde stellt Kant dem Naturzustand den bürgerlichen Zustand gegenüber. Im § 41 der Rechtslehre definiert Kant den bürgerlichen Zustand als „dasjenige Verhältniß der Menschen unter einander, welches die Bedingungen enthält, unter den allein jeder seines Rechts theilhaftig werden kann“.294 Den bürgerlichen Zustand nennt Kant gelegentlich auch „rechtlich-bürgerlicher (politischer) Zustand“295, „bürgerlich-gesetzlichen Zustand“296 oder „öffentlich gesetzliche[n] Zustand“.297 Mit dem Prädikat „gesetzlich“ meint Kant, dass Rechtsregeln existieren, welche das Zusammenleben äußerlich freier Wesen in Gemeinschaft regeln, weil ihre Einhaltung durch eine übergeordnete Rechtsinstanz garantiert ist. Die Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung liegt also nicht mehr bei den einzelnen Menschen, sondern beim Staat. Im bürgerlichen Zustand wird das Recht durch eine öffentliche (distributive) Gerechtigkeit bestimmt und durch eine dieses Recht ausübende Gewalt für alle gleich gesichert. Mit dem Prädikat „öffentlich“ wird wiederum hervorgehoben, dass diese Rechtsregeln, insofern sie den Gebrauch der äußeren Freiheit betreffen, notwendig als öffentliche, das heißt als nicht-private Regeln gedacht werden müssen. Sie erfordern somit eine allgemeine Bekanntmachung und Absicherung.298 Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der bürgerliche Zustand sich anhand von zwei Merkmalen bestimmen und begrifflich vom Naturzustand abgrenzen lässt: Gemeint ist die öffentliche Bestimmung und Sicherung des geltenden Rechts durch eine mit Macht begleitete allgemeine äußere Gesetzgebung. 291 RL: VI, 312 RL: VI, 312; Vgl. ebenfalls: Religion: VI, 95ff.; RL: VI, 349; Frieden: VIII, 355 293 RL: VI, 312 294 RL: VI, 307 295 Religion: VI, 95 296 Frieden: VIII, 349, 355 297 RL: VI, 312 298 Vgl. RL: VI, 306, 311 292 - 57 - Abschließend zu diesem Teil kann noch eine wichtige begriffliche Unterscheidung von Nutzen sein. Kant schreibt nämlich, dass man den Naturzustand, den des Privatrechts, und den bürgerlichen Zustand aber den des öffentlichen Rechts nennen kann.299 Damit greift er auf die in der Einleitung in der Rechtslehre getroffene Unterscheidung des Naturrechts im natürlichen und bürgerlichen Recht zurück.300 Dort ist zu entnehmen, dass das erste das Privatrecht, das zweite das öffentliche Recht genannt wird. Im § 42 der Rechtslehre fügt Kant jedoch eine wichtige Präzisierung hinzu. Der bürgerliche Zustand „enthält nicht mehr oder andere Pflichten der Menschen unter sich, als in jenem [dem Naturzustand; FRX] gedacht werden können; die Materie des Privatrechts ist eben dieselbe in beiden“.301 Der Naturzustand ist somit ein Zustand des bloßen Privatrechts302, das heißt ein Zustand des bereits geltenden, wenn nicht notwendig wirksamen Privatrechts. Der bürgerliche Zustand ist dagegen ein Zustand des gesetzlich bestimmten und durch hinreichende Macht gesicherten Privatrechts. Die Verfassung eines bürgerlichen Staates kann für Kant nicht beliebig sein, sondern muss durch ein strenges allgemeines Gesetz bestimmt werden, da die Verfassung das friedliche Zusammenleben der Menschen als äußerlich freie Wesen garantieren soll. An dieser Stelle greift Kant auf die Idee des ursprünglichen Vertrages zurück. 5.2 Die Idee des ursprünglichen Vertrages Wie bereits angeführt wurde, bezeichnet die äußere Freiheit das Vermögen, sein Handeln aufgrund von je eigenen Zwecken selbst, also unabhängig von eines Anderen nötigender Willkür, zu bestimmen. Wenn man nun das allgemeine Rechtsgesetz als die Einschränkung der äußeren Freiheit auf die Bedingungen ihrer allgemeinen gesetzlichen Übereinstimmung mit jedermanns Freiheit versteht, dann ergibt sich daraus notwendigerweise die Idee des ursprünglichen Vertrages.303 Die gesetzliche Einschränkung der äußeren Freiheitssphäre eines jeden Menschen kann nämlich nicht widerspruchsfrei von einer fremden Willkür bestimmt werden, da dies zugleich die ebenso gesetzliche Aufhebung der eigenen Freiheit bedeuten würde. Aus diesem Grunde kann die gesetzliche Einschränkung der äußeren Freiheitssphäre eines jeden Menschen ausschließlich als eine freiwillige Selbsteinschränkung gedacht werden. Weil eine äußere Nötigung nicht widerspruchsfrei gedacht werden kann, bleibt nur noch die Selbstnötigung übrig. Was den Menschen zur Einhaltung des Rechtsgesetzes - das heißt zur Einschränkung der eigenen äußeren Freiheit auf die Bedingungen ihrer allgemeinen Übereinstimmung mit der Freiheit von jedermann - veranlasst, ist nichts anderes als die praktische Vernunft. Die im Naturzustand unauflösbare Unsicherheit des inneren und äußeren Privatrechts kann nämlich vernünftigerweise nicht gewollt werden. Die Menschen sind somit kategorisch aufgefordert den rechtlosen Naturzustand zu verlassen und in einen bürgerlichen Zustand einzutreten, was konkret nicht anderes zu bedeuten hat, als ein Staat (civitas) zu konstituieren. Es handelt sich dabei um eine a priori aus der reinen praktischen Vernunft gebotenen und sich rechtslogisch aus dem ursprünglichen Vertrag ergebenden „Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“.304 Der Eintritt in einen bürgerlichen Zustand, das heißt die Unterwerfung 299 Vgl. RL: VI, 307 Vgl. RL: VI, 242 301 RL: VI, 307 302 Vgl. Frieden: VIII, 385 303 Kant spricht vom „ursprünglichen Vertrag“ (Gemeinspruch: VIII, 295, 302; RL: VI, 266, 340), vom „gesellschaftlichen Vertrag“ (RL: VI, 340), vom „contractus originarius“ (Gemeinspruch: VIII, 297) und vom „pactum sociale“ (Gemeinspruch: VIII, 289, 297) bedeutungsgleich, um jeweils den rechtslogischen Ursprung und Vernunftprinzip der Beurteilung einer jeden bürgerlichen Gesellschaft zu bezeichnen. 304 RL: VI, 313. Es sei hier darauf hingewiesen, dass für Kant die Begriffe des „Staates (civitas)“ und der „bürgerlichen Gesellschaft (societas civilis)“ gleichbedeutend sind. Vgl. etwa RL: VI, 314 300 - 58 - unter ein allgemeines Rechtsgesetz, bedeutet nicht, dass die Menschen ihre Freiheit aufgeben: „Der Act, wodurch sich das Volk selbst zu einem Staat constituirt […] ist der ursprüngliche Contract, nach welchem alle (omnes et singuli) im Volk ihre äußere Freiheit aufgeben, um sie als Glieder eines gemeinen Wesens, d. i. des Volks als Staat betrachtet (universi), sofort wieder aufzunehmen, und man kann nicht sagen: der Staat, der Mensch im Staate habe einen Theil seiner angebornen äußeren Freiheit einem Zwecke aufgeopfert, sondern er hat die wilde, gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen, um seine Freiheit überhaupt in einer gesetzlichen Abhängigkeit, d. i. in einem rechtlichen Zustande, unvermindert wieder zu finden, weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt“.305 Im ursprünglichen Vertrag geht das Wollen aller einzelnen Menschen in einem einzigen kollektiven Wollen zusammen. In der Rechtslehre spricht Kant deshalb vom „vereinigten Willen des Volkes“.306 Dieser Wille besteht ausschließlich in der Überwindung des Naturzustandes und im korrespondierenden Eintritt in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand, in welchem das innere und äußere Privatrecht gesetzlich bestimmt und gesichert werden. Es geht darum den „Rechtsbegriffe Effect zu verschaffen“307, also Wirksamkeit zu verschaffen. Kant betont wiederholt, dass der ursprüngliche Vertrag keinesfalls als eine historische Beschreibung der Staatserrichtung begriffen werden kann. Der ursprüngliche Vertrag ist nicht der „Geschichtsgrund“308, sondern das von aller Erfahrung abstrahierende „Vernunftprincip“309 von Herrschaft.310 In Kants eigenen Worten heißt es zunächst unmissverständlich: „Allein dieser Vertrag […] ist keinesweges als ein Factum vorauszusetzen nöthig (ja als ein solches gar nicht möglich)“.311 Kant führt anschließend aus, dass der ursprüngliche Vertrag „eine bloße Idee der Vernunft [ist], die aber ihre unbezweifelte (praktische) Realität hat: nämlich jeden Gesetzgeber zu verbinden, daß er seine Gesetze so gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volks haben entspringen können, und jeden Unterthan, so fern er Bürger sein will, so anzusehen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammen gestimmt habe. Denn das ist der Probirstein der Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes“.312 Ferner führt Kant im Text letztlich aus, dass der ursprüngliche Vertrag lediglich ein „Vernunftprincip der Beurtheilung aller öffentlichen rechtlichen Verfassung überhaupt“313 ist. Er ist also ein regulatives Prinzip, das heißt ein Maßstab, an welchem jedermann seine Absichten und Handlungen überprüfen und ausrichten soll.314 Der ursprüngliche Vertrag gilt als Maßstab für das positive Recht, das heißt er bestimmt sowohl für den Politiker als auch für den Bürger was rechtlich erlaubt oder unerlaubt sein soll. Die Glückseligkeit der Menschheit kann dagegen nicht zum Grundsatz politischen Handelns gemacht werden. Dies liegt darin begründet, dass der Begriff der Glückseligkeit kontingent ist. Das bedeutet, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt außer für mich selbst gar nicht feststeht, was der Glückseligkeit überhaupt entspricht. Im Gemeinspruch schreibt Kant folgendes dazu: „In Ansehung [der Glückseligkeit] kann gar kein allgemeingültiger Grundsatz 305 RL: VI, 315f. (meine Hervorhebungen) RL: VI, 313 307 Frieden: VIII, 378 308 RL: VI, 319 309 RL: VI, 319 310 An dieser Stelle soll ebenfalls darauf aufmerksam gemacht werden, dass auch der „vereinigte Wille des Volkes“ kein empirisches Faktum ist. Wie Kant zu seiner Zeit selber feststellen konnte, können Missverständnisse bezüglich der Begriffe des ursprünglichen Vertrags und des vereinigten Willens des Volkes also die Vermischung von normativer und empirischer Ebene - in der Anwendung leicht zu dem schlimmsten Despotismus führen. Vgl. Gemeinspruch: VIII, 302. Dazu siehe: Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Leben - Werk Wirkung, München 1983, 7. Aufl. 2007, S. 229f. 311 Gemeinspruch: VIII, 297 312 Gemeinspruch: VIII, 297 313 Gemeinspruch: VIII, 302 314 Vgl. Sassenbach, Ulrich: Der Begriff des Politischen bei Immanuel Kant, Würzburg 1992, S. 55ff. 306 - 59 - für Gesetze gegeben werden. Denn sowohl die Zeitumstände, als auch der sehr einander widerstreitende und dabei immer veränderliche Wahn, worin jemand seine Glückseligkeit setzt (worin er sie aber setzen soll, kann ihm niemand vorschreiben), macht alle feste Grundsätze unmöglich und zum Princip der Gesetzgebung für sich allein untauglich“.315 Wer dennoch die Glückseligkeit als Zweck des politischen Handelns erhebt und willkürlich, also subjektiv bestimmt, worin diese besteht, verletzt (juridisch gesehen) die Rechtspflicht und handelt (politisch gesehen) unklug. Es ist weder rechtlich erlaubt, noch politisch klug die Glückseligkeit zu einem politischen Zweck zu erklären. Bezüglich des letzten Punkts merkt Kant an: „Der Souverän will das Volk nach seinen Begriffen glücklich machen und wird Despot; das Volk will sich den allgemeinen menschlichen Anspruch auf eigene Glückseligkeit nicht nehmen lassen und wird Rebell“.316 Das Streben nach Glückseligkeit muss also dem jeweiligen Menschen überlassen werden: „Niemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt“.317 Die Aufgabe des Staates besteht lediglich darin, die Rechtsbedingungen zu schaffen, unter denen der einzelne Mensch seine eigene Glückseligkeit verwirklichen kann. Solange es kein Recht gibt, werden die Menschen jedoch niemals ihre Zwecke unabhängig von der nötigenden Willkür anderer verfolgen können. Die Bedingung dafür, dass die Menschen überhaupt ihre je eigenen wie auch immer motivierten Zwecke verfolgen können, liegt in der Existenz eines bürgerlich-gesetzlichen Zustandes. Kant formuliert dies wie folgt: „[D]as öffentliche Heil, welches zuerst in Betrachtung zu ziehen steht, ist gerade diejenige gesetzliche Verfassung, die jedem seine Freiheit durch Gesetze sichert: wobei es ihm unbenommen bleibt, seine Glückseligkeit auf jedem Wege, welcher ihm der beste dünkt, zu suchen, wenn er nur nicht jener allgemeinen gesetzmäßigen Freiheit, mithin dem Rechte anderer Mitunterthanen Abbruch thut“.318 Es wurde zuvor gesehen, dass die Existenzberechtigung und somit zugleich der Zweck des Staates in der allgemein-gesetzlichen Bestimmung und Sicherung der äußeren Freiheit von jedermann bestehen. Die Gewährleistung der Sicherheit des Rechts entspricht dem Gemeinwohl, welches für jeden Gesetzgeber die „ewige Norm“319 darstellen soll. Entsprechend ist das politische Handeln auch am Gebot der Erhaltung dieser öffentlichrechtlichen Form der Gemeinschaft, also am Gebot der Staatserhaltung, auszurichten. Der Rückfall in den Naturzustand soll schlechtweg vermieden werden, weil „irgend eine rechtliche, obzwar nur in geringem Grade rechtmäßige, Verfassung besser ist als gar keine“.320 Um Missverständnisse im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit zu vermeiden, soll bereits an dieser Stelle betont werden, dass der Staat kein Selbstzweck, sondern ein bloßes Mittel zum Zweck ist. Zu Recht spricht Otfried Höffe in diesem Zusammenhang von einer „sekundären“ bzw. „subsidiären Institution“.321 Der Staat ist letztlich die notwendige institutionelle Garantie des Rechts der Menschheit in der je eigenen Person sowie der daraus gegründeten privaten Rechte. 5.3 Der Sozialstaat im Dienst der Freiheit? 315 Gemeinspruch: VIII, 298 Gemeinspruch: VIII, 302 317 Gemeinspruch: VIII, 290 318 Gemeinspruch: VIII, 298 (meine Hervorhebung); Vgl. RL: VI, 318 319 Streit: VII, 91 320 Frieden: VIII, 373 321 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 25. 316 - 60 - Dem Staat kommt die Aufgabe zu, für die äußere Freiheit von jedermann unter einem allgemeinen Gesetz zu sorgen. Es geht ihm nicht darum, für den Nutzen oder für die Wohlfahrt der einzelnen Bürger (und auch nicht für eine Mehrheit derselben) zu sorgen. Damit werde nahe gelegt, dass es im Kantischen Staatsrecht keinen Platz für andere staatliche Leistungen wie etwa eine Sozialpolitik gäbe. In der Sekundärliteratur bleibt es jedoch bis heute umstritten, ob und inwiefern Kants Staatsrechts mit einer Sozialpolitik vereinbar ist. Wie weiter unten zu sehen ist, liegt eine besondere Schwierigkeit darin, dass Kants direkten Ausführungen zu dieser Thematik spärlich sind und außerdem manchmal als unklar und schwankend angesehen werden können. Es kann zunächst festgehalten werden, dass Kant im Abschnitt B der »Einleitung in die Rechtslehre« ausdrücklich „den Handlungen der Wohltätigkeit oder Hartherzigkeit“ dem Begriff des Rechts entzieht.322 Nur in der Tugendlehre erklärt Kant, dass die physische Wohlfahrt und das moralische Wohlsein zur fremden Glückseligkeit gehören, und dass jene zu befördern für uns ein objektiver Zweck sei, der zugleich auch Pflicht ist.323 Die Wohlfahrt anderer (und somit auch die Wohlhabenheit der Bevölkerung) zu befördern, ist somit keine vollkommene Rechtspflicht, sondern bloß eine unvollkommene Tugendflicht.324 Des Weiteren kann festgehalten werden, dass Kant die paternalistische Herrschaft durch den absolutistischen Staat des 17. und 18. Jahrhunderts entschieden zurückweist. Im Gemeinspruch beispielsweise heißt es unmissverständlich: „Eine Regierung, die auf dem Princip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters gegen seine Kinder errichtet wäre, d. i. eine väterliche Regierung (imperium paternale), wo also die Unterthanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich ist, sich bloß passiv zu verhalten genöthigt sind, um, wie sie glücklich sein sollen, bloß von dem Urtheile des Staatsoberhaupts und, daß dieser es auch wolle, bloß von seiner Gütigkeit zu erwarten: ist der größte denkbare Despotismus“.325 Fraglich ist hier, ob diese Kritik am staatlichen Paternalismus einer Ablehnung jeder Sozialpolitik gleichkommt. Manches spricht dafür, dass die Antwort auf diese Frage negativ ausfällt. Was Kant mit seiner Paternalismuskritik im Sinne hat, ist eine Politik, die auf ein vormundschaftliches Verhältnis zwischen Regierung und Staatsbürger gründet. Eine derartige Politik mündet notwendigerweise im blanken Despotismus, weil die Regierung „das Volk nach seinen Begriffen glücklich machen“326 will und somit die staatsbürgerliche Freiheit der Untertanen missachtet. Eine solche Politik unterscheidet sich jedoch grundsätzlich von einer Fürsorgepolitik, welche sich selbst in den Dienst der Freiheit stellt, indem sie die ökonomischen und sozialen Voraussetzungen des äußeren Freiheitsgebrauchs überhaupt erst schafft. Eine derartige Begründung eines „freiheitsfunktionale[n] Sozialstaates“327 darf allerdings nicht mit der Argumentation verwechselt werden, die Kant in der »Allgemeine[n] Anmerkung C« der Rechtslehre entwickelt. Dort führt Kant aus, dass dem Staatsoberhaupt ein indirektes Recht zukommt, die Bevölkerung mit Abgaben zu ihrer Erhaltung zu belasten. Diese Abgaben sollen der Finanzierung von „Armenwesen“, „Findelhäusern“, „Witwenhäusern“ und „Hospitälern“ dienen.328 Diese Behauptung scheint zunächst Kants Definition des allgemeinen Prinzips des Rechts im Abschnitt C der »Einleitung in die 322 Vgl. RL: VI, 230 Vgl. TL: VI, 393f. 324 Auf diese Unterscheidung soll im dritten Kapitel des zweiten Hauptteils noch näher eingegangen werden. 325 Gemeinspruch: VIII, 290f. 326 Gemeinspruch: VIII, 302 327 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 133ff. 328 Vgl. RL: VI, 326 323 - 61 - Rechtslehre« zu widersprechen. Es besteht also Erklärungsbedarf darüber, wie Kant dieses indirekte Recht begründet. Kants Begründung dazu lautet: „Der allgemeine Volkswille hat sich […] zu einer Gesellschaft vereinigt, welche sich immerwährend erhalten soll, und zu dem Ende sich der inneren Staatsgewalt unterworfen, um die Glieder dieser Gesellschaft, die es selbst nicht vermögen, zu erhalten“.329 Die Gesellschaft, die sich hier immerwährend erhalten soll, ist die bürgerliche Gesellschaft (societas civilis). Die Regierung ist somit berechtigt (wohlgemerkt: nicht juridisch verpflichtet), eine „zu ihrem Dasein nöthige Vorsorge des gemeinen Wesens“330 zu leisten. Es geht nicht darum, das Volk wider seinen Willen glücklich zu machen, sondern lediglich dafür zu sorgen, dass es als gemeines Wesen weiterhin existieren kann. Es soll hier daran erinnert werden, dass für Kant die größte soziale Ungleichheit mit rechtlicher Gleichheit vereinbar ist.331 Die soziale Ungleichheit wird erst dann ein Problem des Rechts, wenn Armut und Elend ein solches Ausmaß erreichen, dass sie die dauerhafte Erhaltung der bestehenden Rechtsordnung ernsthaft gefährden. Die Regierung ist befugt eine Sozialpolitik zu betreiben, nicht etwa weil die Staatsbürger ein individuelles Erhaltungsrecht haben, sondern nur weil die durch Armut und Elend hervorgerufene Instabilität den dauerhaften Bestand der bürgerlichen Gesellschaft (und das damit bereits erreichte Maß an Rechtssicherheit und somit an Freiheit) gefährden könnte.332 Die Armutsbekämpfung ist kein Zweck, sondern bloß ein Mittel zur Existenzsicherung der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft. Diese Sozialpolitik kann „durch Belastung des Eigenthums der Staatsbürger, oder ihres Handelsverkehrs, oder durch errichtete Fonds und deren Zinsen“333 geschehen. Gemeint sind also nicht bloß freiwillige Beiträge, sondern „gesetzliche Auflage[n]“334, also zwangsmäßige Beiträge, weil hier von einem Recht des Staats gegen das Volk die Rede ist und mit dem Recht die Befugnis zu zwingen unmittelbar zusammen hängt. Kant betont jedoch einschränkend, dass die Regierung beachten soll, dass die Gewährleistung existenzsichernder Versorgungseinrichtungen nicht missbraucht wird. So schreibt er, dass man nicht „das Armsein zum Erwerbmittel für faule Menschen machen“ darf, weil dies ein „ungerechte Belästigung des Volks durch die Regierung“335 wäre. Kants restriktives Verständnis legitimer Sozialpolitik zeigt sich ebenfalls in der Verwendung des Superlativs: Der Staat ist berechtigt jene Armen zu versorgen, die von selbst nicht fähig sind, ihre „nothwendigsten“ (anstatt „notwendigen“) Naturbedürfnissen zu erfüllen.336 Es hat sich gezeigt, dass Kant in der Rechtslehre keine Begründung individueller Sozialrechte geleistet hat. Die weitere Frage, ob sich ein solches Sozialrecht ausgehend von Kants Vernunftprinzipien begründen lässt, wird in der Sekundärliteratur weiter diskutiert.337 Eine eingehendere Berücksichtigung dieser Diskussion würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wird deshalb unterlassen. 329 RL: VI, 326 RL: VI, 326 331 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 291 332 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 298 333 RL: VI, 326 334 RL: VI, 326 335 RL: VI, 326 336 Vgl. RL: VI, 326 337 Dazu siehe u.a.: Ebbinghaus, Julius: Sozialismus der Wohlfahrt und Sozialismus des Rechts, in: Gesammelte Schriften, Bd. I, Sittlichkeit und Recht, hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Bonn 1986, S. 231-264; Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 132-137; Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 42-59; Kühl, Kristian: Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur Aktualität der Kantischen Rechts- und Eigentumslehre, Freiburg München 1984, S. 264ff. 330 - 62 - In diesem ersten Kapitel wurde gezeigt, dass es Kant gelungen ist, die Notwendigkeit des öffentlichen Rechts rein rational zu begründen. Damit wäre Kant am Ende seines rechtsphilosophischen Beweisgangs angelangt, und es wäre nur noch die inhaltliche Bestimmung des öffentlichen Rechts erforderlich, wenn es lediglich eine einzige Gemeinschaft freier Menschen, das heißt nur einen einzigen Staat, auf der Erde geben würde. Empirisch kann dennoch festgestellt werden, dass eine Pluralität von Staaten über die gesamte Erdoberfläche verteilt ist. Aus diesem Grunde stellt sich die anfangs erwähnte Frage erneut, jedoch auf einer höheren Ebene. Gemeint ist die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des friedlichen Zusammenlebens einer Pluralität von voneinander unabhängigen, staatlich organisierten Gemeinschaften freier Menschen. Kants Argumentation bei der Beantwortung dieser Frage soll nun im zweiten Kapitel näher erläutert werden. - 63 - 2. KAPITEL: DIE NOTWENDIGEN RECHTSSCHRITTE AUF DEM WEG ZUM EWIGEN FRIEDEN Im ersten Kapitel wurde gezeigt, dass Frieden zwischen den Menschen erst und ausschließlich unter Bedingung effektiven öffentlichen Rechts erwartet werden kann. Es ist daher eine unbedingte Rechtspflicht, den rechtlosen Naturzustand zu verlassen, um in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand einzutreten, in welchem die angeborenen und erworbenen Rechte von jedermann gesetzlich bestimmt und mit hinreichender Macht gesichert werden. Im folgenden Kapitel soll nun gezeigt werden, dass dasselbe im Prinzip ebenfalls für die Staaten gilt.338 Auch sie befinden sich in ihren äußeren Beziehungen „(wie gesetzlose Wilde) von Natur in einem nicht-rechtlichen Zustande“.339 Dies liegt darin begründet, dass es über die einzelnen Staaten keine Rechtsinstanz mit Zwangsgewalt gibt, welche die zwischenstaatlichen Konflikte rechtsverbindlich lösen könnte. In dem modernen Sprachgebrauch des Fachgebiets der Internationalen Beziehungen würde man sagen, dass die Struktur des internationalen Systems anarchisch ist. Der Naturzustand der Staaten zueinander ist - genau wie der Naturzustand der Menschen – ein „Zustand der Rechtlosigkeit (status iustitia vacuus)“340 im Sinne permanenter Unsicherheit und möglicher Unwirksamkeit des geltenden Privatrechts. Unter dieser Bedingung können nämlich die zwischenstaatlichen Konflikte letztlich nur durch Gewalt gelöst werden. Es kommt zwar nicht immer zum wirklichen Krieg, aber es herrscht eine immerwährende Hostilität, die jederzeit zu eskalieren droht, und welche in militärischen Gewalttätigkeiten enden kann. Ein solcher Zustand ist ein Zustand des virtuellen oder faktischen Krieges aller gegen alle, also ein Zustand, in welchem das Recht des Stärkeren herrscht. Kant bezeichnet der Naturzustand als einen „Kriegszustand“ im Sinne einer permanenten Läsion aller Staaten durch ihr bloßes Nebeneinandersein.341 Des Weiteren spricht er von einer „laesio per statum“342, das heißt von einer durch den Zustand selbst, also vor aller Tat gegebenen Rechtsverletzung aller Staaten. Ein derartiger Zustand ist im höchsten Grade unrecht, weil es keine Garantie für das angeborene Recht der Menschheit sowie für die erworbenen Rechte gibt und überhaupt geben kann. Es folgt somit als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft, dass die Staaten den rechtlosen Zustand verlassen sollen, und dass sie gemeinsam einen rechtlichen Zustand des Weltfriedens stiften sollen. Das Gebot des exeundum e statu naturali gilt somit nicht nur für die Menschen sondern auch für die Staaten.343 Die vernunftgebotene Überwindung des rechtlosen Naturzustandes erfolgt im Wesentlichen in drei Schritten: Zunächst durch die Stiftung einer republikanischen Verfassung in den einzelnen Staaten, anschließend durch die Stiftung einer Rechtsordnung zwischen den Staaten, und letztlich durch die Schaffung des Weltbürgerrechts. Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle der Umstand, dass Kant als erster und einziger politischer Philosoph der frühen Neuzeit das Staatsrecht um ein Völkerrecht und Weltbürgerrecht erweitert hat. Bis dahin hatten sich Philosophen von Hobbes, über Locke bis Rousseau in ihren Haupttexten nahezu ausschließlich der Rechtsordnung in den einzelnen Staaten gewidmet. Kants dreistufiger Verrechtlichungsprozess berechtigt dagegen zum ersten 338 Kants gesamter Gedankengang wird in einer äußerst prägnanten Form im § 54 der Rechtslehre dargestellt. Wie noch ausführlicher zu sehen sein wird, ist die Argumentation dabei zum Teil an anderen Voraussetzungen gebunden, die entsprechend auch anderen Folgen mit sich bringen. 339 RL: VI, 344 340 RL: VI, 312 341 Vgl. Frieden: VIII, 354; RL: VI, 346 342 Reflexion 7647: XXIII, 211 343 Vgl. Religion: VI, 97; RL: VI, 307, 312 - 64 - Mal in der politischen Ideengeschichte von einer „Theorie des vollständigen Rechtsfriedens“344 bzw. von einer „umfassende[n] Friedenstheorie“345 zu sprechen. Im folgenden Kapitel soll nun ausführlich auf die Frage eingegangen werden, welche Schritte Kant für die Stiftung einer sich weltweit erstreckenden Rechtsordnung für notwendig aufzeigt, und wie er jene begründet. Dieses Thema ist in der Sekundärliteratur zwar schon vielfach interpretiert worden, aber es soll erneut darauf eingegangen werden, um manche Missverständnisse von Kants apriorischer Rechtstheorie aus dem Weg zu räumen und jene auf ihre wenig beachtete Umsetzung hin zu erläutern. Die weiteren Ausführungen orientieren sich dabei weitgehend an Kants Gliederung der Friedensschrift in Präliminar- und Definitivartikel und bestehen entsprechend aus zwei Teilen. In einem ersten Schritt werden die Präliminarartikel als die negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens dargestellt und diskutiert (1). Anschließend werden die Definitivartikel als die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens kritisch erläutert (2). Bei Bedarf werden allerdings zusätzliche Textstellen, insbesondere aus dem zweiten und dritten Teil der Schrift Über den Gemeinspruch sowie aus dem zweiten Teil der Rechtslehre, herangezogen. 1. Die Präliminarartikel: Die negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens 1.1 Systematische Einordnung der Präliminarartikel im Rahmen der Kantischen Rechtstheorie vom Weltfrieden Bevor die einzelnen Forderungen dargestellt und erläutert werden können, ist es erforderlich, die Präliminarartikel im Rahmen der Kantischen Friedenstheorie richtig einzuordnen. Ehe sich dem Inhalt der Friedensschrift ausführlicher gewidmet wird, muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kant sich bezüglich der Form der Friedensschrift an den völkerrechtlichen Friedensverträgen des 17. und 18. Jahrhunderts orientiert hat. Zu jener Epoche ging dem Abschluss eines definitiven Friedensvertrags zwischen Staaten zuweilen ein Präliminarvertrag voraus, in welchem sich die Konfliktparteien über die Bedingungen der Beendigung der Gewalttätigkeiten und des Abschlusses des zukünftigen Friedensvertrages einigten.346 Nach diesem Muster hat Kant seine Friedensschrift ausgearbeitet. Sie besteht entsprechend aus sechs Präliminarartikeln, drei Definitivartikeln, einem zweiteiligen Zusatz sowie aus einem zweiteiligen Anhang. Dabei heben die Präliminarartikel die negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter den Staaten hervor. Die Definitivartikel wiederum heben die positiven (Rechts-)Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens zwischen Staaten hervor. Der Zusatz behandelt seinerseits die Garantie des ewigen Friedens. Der zweite Teil dieses Zusatzes unter der Überschrift »Geheimer Artikel zum ewigen Frieden« war nicht in der ersten Auflage vorhanden, sondern wurde in der 344 Kersting, Wolfgang: Weltfriedensordnung und globale Verteilungsgerechtigkeit. Kants Konzeption eines vollständigen Rechtsfriedens und die gegenwärtige politische Philosophie der internationalen Beziehungen, in: Zum ewigen Frieden. Grundlage, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, hrsg. v. Reinhard Merkel und Roland Wittmann, Frankfurt a. M. 1996, S. 175 (meine Hervorhebung). 345 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 163 (meine Hervorhebung). 346 Vgl. Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 44. - 65 - zweiten Auflage von 1796 von Kant hinzugefügt.347 Zuletzt behandelt der Anhang das geltungstheoretische Verhältnis von Moral, Recht und Politik. Manches spricht dafür, dass Kant mit dieser einzigartigen Gestaltung nicht nur einen ironischen Abstand gegenüber der diplomatischen Praxis seiner Zeit einnimmt, wie es in der Sekundärliteratur gelegentlich zu lesen ist.348 Die Gestaltung der Friedensschrift in Form eines Vertragswerks hat außerdem einen prinzipientheoretischen Grund: Die vertragsförmige Gestaltung der Friedensschrift entspricht der Idee des allgemeinen, ursprünglichen Vertrages, den die Staaten miteinander abschließen sollen, um den rechtlosen Naturzustand zu verlassen. Der ursprüngliche Vertrag der Staaten ist keinesfalls als ein empirischer Vertrag zu verstehen, welchen die Staaten tatsächlich zu schließen haben. Es handelt sich vielmehr, um einen Vernunftvertrag, das heißt, um eine bloße Idee der reinen praktischen Vernunft. Er dient als Maßstab und Grundlage für jeden Vertrag, insbesondere für alle möglichen Friedensverträge zwischen Staaten. Zu Recht führt Georg Geismann an, dass der ursprüngliche Vertrag „nicht einmal als abschließbar gedacht werden [kann], so als ob durch den Abschluß erst das in dem Vertrag formulierte Recht geschaffen würde. Vielmehr enthält er die Norm und Legitimationsgrundlage für jeden Vertrag, durch den positives öffentliches Recht geschaffen werden soll“.349 An dieser Stelle lässt sich der Gegenstand der Friedensschrift genauer festhalten. Es geht nicht darum, konkrete Vorschläge zur Lösung eines bestimmten Krieges zu machen. Ihr Gegenstand ist vielmehr der Übergang vom Naturzustand zum bürgerlichen Zustand, mithin vom Kriegszustand zum Friedenszustand. Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, weshalb Kant die Friedensschrift als einen philosophischen Entwurf (in Abgrenzung zu einem positiv-rechtlichen Entwurf) bezeichnet. Über einen langen Zeitraum hinweg wurde den Präliminarartikeln in der KantForschung ausgesprochen wenig Aufmerksamkeit geschenkt.350 Erst in jüngerer Vergangenheit wurden jene wieder intensiver diskutiert.351 Dieses mangelnde Interesse ist im Wesentlichen auf zweierlei Gründe zurückzuführen.352 Es wurde zunächst häufig davon ausgegangen, dass Kants Forderungen, zu sehr an die damaligen politischen und militärischen 347 Vgl. Klemme, Heiner F.: Einleitung, in: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis / Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Heiner Klemme, Hamburg 1992, S. XXXVII. 348 Siehe beispielsweise: Goyard-Fabre, Simone: Les articles préliminaires, in: L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 43. 349 Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 181. Vgl. Ders.: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 369. 350 Kurt von Borries zum Beispiel behandelt die Präliminarartikel nicht. Er scheint sie sogar zu übersehen, wenn er schreibt, dass man sich bezüglich Kants Friedenstheorie keine allzu großen Erwartungen machen darf, „da Kant natürlich seinen rein formalen Gesichtspunkt nicht aufzugeben vermag“. Vgl. Borries, Kurt von: Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizismus, Aalen 1973 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1928), S. 203. Eine ähnliche Sichtweise ist später noch bei Karl Jasper zu beklagen, wenn er schreibt, dass „Kant keine sofort in die Praxis umzusetzenden Vorschläge in der konkreten Situation seiner Zeit macht“. Vgl. Jasper, Karl: Kants »Zum ewigen Frieden«. Wiederabgedruckt, in: Ders.: Aneignung und Polemik, hrsg. v. Hans Saner, München 1968, S. 124. 351 Siehe vor allem: Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 100-132; Geismann, Georg: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 368-373; Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 41-73; Hennigfeld, Jochen: Der Friede als philosophisches Problem. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 8, 1983, S. 24-28. Erwähnenswert sind außerdem die zwei folgenden Beiträge, die sich mit den Präliminarartikeln im Speziellen auseinandersetzen: Goyard-Fabre, Simone: Les articles préliminaires, in: L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 41-59; Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 43-67. 352 Vgl. Hennigfeld, Jochen: Der Friede als philosophisches Problem. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 8, 1983, S. 24. - 66 - Zusammenhänge gebunden seien, um für die zeitgenössische Weltordnung überhaupt noch relevant sein zu können. Ihr philosophischer Gehalt wurde außerdem von vielen Kommentatoren für äußerst gering eingeschätzt. Wie auf den folgenden Seiten zu sehen sein wird, greifen beide Auffassungen zu kurz. Mit Sicherheit betritt Kant im ersten Abschnitt der Friedensschrift kein Neuland. Dort greift er auf Gedanken zurück, die teilweise bereits Jahrzehnte zuvor von Autoren wie Grotius, Pufendorf oder Abbé de Saint-Pierre dargelegt wurden. Diesbezüglich soll zweierlei bemerkt werden. Erstens: Selbst wenn die inhaltlichen Bestimmungen der Präliminarartikeln nicht gänzlich neu sind, so ist Kants Originalität jedoch größer, als in der Literatur häufig angenommen wird.353 Zweitens: Aus rechtsphilosophischer Perspektive ist nicht die Frage entscheidend, ob Kants inhaltliche Forderungen neu sind oder nicht, sondern allein wie jene begründet werden. Nicht die Originalität der Präliminarartikel, sondern deren Begründung wird uns hier interessieren. Damit fangen allerdings bereits die ersten Schwierigkeiten an. Als erste Annäherung an dieses Problem kann Hans Saners Auffassung herangezogen werden, nach welcher eine Auseinandersetzung mit den Präliminarartikeln aus zweierlei Gründen unentbehrlich ist: „[S]ystematisch gesehen bilden sie den negativen Teil von Kants Philosophie des Friedens, und pragmatisch gesehen greifen nur sie konkret in den politischen Alltag ein“.354 Dies hat zweierlei zu bedeuten. Es bedeutet einerseits, dass die sechs Präliminarartikel die negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter Staaten bestimmen. In der abschließenden Anmerkung zum ersten Abschnitt der Friedensschrift führt Kants aus, dass alle sechs Präliminarartikeln „lauter Verbotgesetze (leges prohibitivae)“355 sind, die bestimmte kriegsverursachende oder friedensverhindernde staatliche Handlungen untersagen. Kant beansprucht für die Präliminarartikel absolute Notwendigkeit. Er führt nämlich aus, dass alle sechs Präliminarartikeln objektive Verbotsgesetze sind, die als solche für jeden politischen Entscheidungsträger ohne Ausnahme verbindlich sind.356 Die Präliminarartikel bestimmen die notwendigen Bedingungen, unter denen der Abschluss eines definitiven Friedensvertrages überhaupt erst möglich ist.357 Dieser lässt sich erst auf der Grundlage der drei Definitivartikel erreichen, welche die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens hervorheben. Wenn die Präliminarartikel die objektive praktische Notwendigkeit gewisser Handlungen ausdrücken, dann kann deren Begründung nicht bloß auf Erfahrung beruhen. Der unbedingte Geltungsanspruch der Präliminarartikel wird allerdings in der Sekundärliteratur teilweise bestritten, da Kant jene nicht vernunftrechtlich, sondern bloß pragmatisch begründen würde. So behauptet beispielsweise Karl Jaspers, dass aus den sechs Präliminarartikeln lediglich drei einen „dauernden und schlechthin verbindlichen Sinn“ haben (nämlich die Artikel Nr. 1, 5 und 6), während die anderen lediglich „zeitbedingt“ sind und deshalb keine besondere Aufmerksamkeit verdienen.358 In jüngerer Vergangenheit ist auch bei Hans Saner 353 Dies zeigt Simone Goyard-Fabre. Vgl. Ders.: Les articles préliminaires, in: L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 41-59. 354 Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 48 (meine Hervorhebung). 355 Frieden: VIII, 347 356 Vgl. Frieden: VIII, 347 357 In diesem Punkt stimmen Georg Cavallar und Georg Geismann überein. Vgl. Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 103; Geismann, Georg: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 369. 358 Jasper, Karl: Kants »Zum ewigen Frieden«. Wiederabgedruckt, in: Ders.: Aneignung und Polemik, hrsg. v. Hans Saner, München 1968, S. 205. - 67 - zu lesen, dass die Präliminarartikel „nicht als rechtsanalytische Herleitungen entstanden [sind], sondern als Einsprüche der Vernunft gegen die vorherrschende politische Praxis“.359 Wolfgang Kersting schreibt seinerseits, dass die Präliminarartikel „als unerlässliche Voraussetzungen eines rechtlich befestigten Friedens empirisch ausweisbar sind“.360 Heiner F. Klemme kommt somit zu dem Schluss, dass nichts dagegen spricht, die Präliminarartikel im Lichte neuer Erfahrungen zu modifizieren bzw. zu ergänzen, ohne daß das Projekt der […] Schrift von vornherein als gescheitert einzustufen wäre“.361 Wie sind diese verschiedenen Stellungnahmen zu bewerten? Ist es tatsächlich so, dass die Präliminarartikel sich bloß auf Erfahrung stützen und somit (im Gegensatz zu dem, was von Kant behauptet wird) keine allgemeine und objektive Notwendigkeit haben können? Kurzum: Welchen Geltungsmodus haben die Präliminarartikel? Auf den folgenden Seiten wird sich zeigen, dass Kants Begründung der Präliminarartikeln zwar teilweise pragmatisch ist, jedoch vor allem vernunftrechtlich ist.362 Die vernunftrechtliche Begründung der Präliminarartikeln kann leicht übersehen werden, weil Kant sich in der Friedensschrift nur in ausgesprochen knapper Form darauf eingeht. Eine umfassendere und vor allem systematischere Darstellung seiner dort nur kurz vorgetragenen rechtslogischen Argumentation unternimmt Kant erst in der späteren Rechtslehre. Die pragmatische Begründung der Präliminarartikeln ist dagegen unübersehbar. Die im Titel der Präliminarartikel enthaltenen Forderungen greifen ganz konkret in die politische Realität ein. Sie verbieten konkrete und spezifische Handlungen oder Institutionen. Eine Lektüre der Friedensschrift, die sich ausschließlich auf die Definitivartikel beschränken würde, läuft somit Gefahr, die konkrete Frage der Friedensstiftung zu verfehlen. Was sich Kant in den Präliminarartikel vornimmt ist also, eine inhaltliche Bestimmung, Spezifizierung und Konkretisierung seiner abstrakten Vernunftprinzipien angesichts der Weltlage, die er damals vor den Augen hatte. Die zugrunde liegenden Vernunftprinzipien sind also von deren historisch kontingenten Umsetzungs- und Konkretisierungsvorschlägen zu unterscheiden. Nur letztere sollen an die heutigen weltpolitischen Bedingungen angepasst werden. Vor diesem Hintergrund ergibt es sich, dass die konkreten Forderungen der Präliminarartikel zeitbedingt sind und an die heutigen Verhältnisse problemlos angepasst werden können, solange (und nur solange) die den jeweiligen inhaltlichen Forderungen zugrunde liegenden vernunftrechtlichen und somit zeitlosen Begründungen davon unberührt bleiben. Der Tatsache, dass die Präliminarartikel unter anderem mit Blick auf die militärischen und politischen Zusammenhänge des späten 18. Jahrhunderts formuliert wurden, darf nicht zu große Bedeutung beigemessen werden. Die gegenwärtige Weltpolitik ist nämlich trotz maßgeblicher politischer, wirtschaftlicher, technischer und nicht zuletzt kultureller Veränderungen immer noch teilweise von jenen Problemen bestimmt, die in den Präliminarartikeln erörtert werden. Besonders auffallend und ein wenig irritierend an der Lektüre des ersten Abschnittes der Friedensschrift ist, dass Kant die Präliminarartikel argumentativ nur wenig miteinander verknüpft. Es gibt für sie also keine systematische Einordnung - ausgenommen die 359 Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 49. 360 Kersting, Wolfgang: Weltfriedensordnung und globale Verteilungsgerechtigkeit. Kants Konzeption eines vollständigen Rechtsfriedens und die gegenwärtige politische Philosophie der internationalen Beziehungen, in: Zum ewigen Frieden. Grundlage, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, hrsg. v. Reinhard Merkel und Roland Wittmann, Frankfurt a. M. 1996, S. 175. 361 Klemme, Heiner F.: Einleitung, in: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis / Zum ewigen Frieden, Hamburg 1992, S. XXXVII. 362 Vgl. Hennigfeld, Jochen: Der Friede als philosophisches Problem. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 8, 1983, S. 24. - 68 - nachträgliche Unterscheidung zwischen leges strictae und leges latae.363 Einen Versuch der rechtsphilosophischen Systematisierung hat bekanntlich Georg Geismann unternommen.364 Dieser Versuch stößt jedoch rasch an eine Grenze. Im Gegensatz zu Kants Einteilung des öffentlichen Rechts in den Definitivartikeln ist die Einteilung der verschiedenen Forderungen in den Präliminarartikel nicht systematisch aus einem gemeinsamen Vernunftprinzip abgeleitet, welches dieser Einteilung Notwendigkeit und Vollständigkeit verleihen würde. In den folgenden Ausführungen werden wir uns deshalb an die von Kant selbst gewählte Reihenfolge der Präliminarartikel halten. 1.2 Erster Präliminarartikel: Friedensschlüssen Das Verbot des geheimen Vorbehalts bei Als erste von sechs negativen Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter den Staaten nennt Kant im ersten Präliminarartikel: „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden“.365 Der erste Präliminarartikel hat Grundlagencharakter für die gesamte Abhandlung, weil dort definiert wird, was unter dem Begriff des Friedens überhaupt zu verstehen ist. Gleich im ersten Satz der Erläuterungen heißt es, dass Frieden im eigentlichen Sinne des Wortes mehr als ein „bloßer Waffenstillstand“ oder ein „Aufschub der Feindseligkeiten“366 sei. Für Kant bedeutet Frieden nichts anderes als das „Ende aller Hostilitäten“.367 Bei einem Waffenstillstand ändert sich grundsätzlich nichts am Verhältnis der Staaten untereinander. Die Probleme, welche einmal zum Krieg führten, sind nicht gelöst, sondern werden nur aufgeschoben. Es handelt sich, um eine bloß vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten zwischen mindestens zwei Staaten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei erster Gelegenheit der einmal besiegte Staat einen neuen Krieg auslösen wird, um seine Rechte zurückzugewinnen. So dauerhaft und stabil er auch sein mag, kann ein Waffenstillstand also nicht als Frieden gelten. Die Befriedung der zwischenstaatlichen Verhältnisse durch eine Hegemonialmacht oder eine Gleichgewichtpolitik wird somit von Kant als bloße Waffenstillstände zurückgewiesen.368 Nimmt man Kants Definition des Friedens ernst, so zeigt sich, dass die bisherige Menschheitsgeschichte eine ununterbrochene Abfolge von Kriegen mit mehr oder minder langen Zeiten der Waffenruhe war. Es herrschte eine andauernde Hostilität im Verhältnis der Staaten zueinander. Die Friedensschlüsse der Vergangenheit waren zumeist der Erschöpfung einer der Kriegsparteien zuzuschreiben, so dass sie eine jederzeitige Fortsetzung des Krieges in sich bargen.369 Das Aufhören der Feindseligkeiten, das heißt der faktischen äußeren Gewalttätigkeiten zwischen zwei oder mehreren Staaten, ist zwar eine notwendige, dennoch keine hinreichende Bedingung der Möglichkeit des Friedens. Frieden erfordert darüber hinaus das Ende aller 363 Vgl. Frieden: VIII, 347. Darauf soll im zweiten Hauptteil der vorliegenden Dissertation noch näher eingegangen werden. 364 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 181; Ders.: Geismann, Georg: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 369. 365 Frieden: VIII, 343 366 Frieden: VIII, 343 367 Frieden: VIII, 343 368 Kant lehnt jede Gleichgewichtspolitik auf ironische Weise ab: „[E]in daurender allgemeiner Friede, durch die so genannte Balance der Mächte in Europa ist, wie Swifts Haus, welches von einem Baumeister so vollkommen nach allen Gesetzen des Gleichgewichts erbauet war, daß, als sich ein Sperling drauf setzte, es so fort einfiel, ein bloßes Hirngespinst“ (Gemeinspruch: VIII, 312f.). 369 Vgl. Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 50. - 69 - Hostilitäten. Der Begriff „Hostilität“ bezieht sich auf die Absicht der Staaten und bezeichnet die Kriegsbereitschaft eines Staates, die dem tatsächlichen Ausbruch der Feindseligkeiten vorangeht.370 Gefordert ist hier also der bedingungslose Wille aller Staaten, dem Krieg ein tatsächliches Ende zu setzten. Solange eine immerwährende Hostilität zwischen den Staaten herrscht, das will heißen, solange zumindest ein Staat kriegsgeneigt ist, wird die Gefahr eines Ausbruches der Feindseligkeiten stets vorhanden sein. Die elementare Voraussetzung des Friedens besteht letztlich darin, dass er von allen Seiten ohne irgendeinen Vorbehalt, also aufrichtig und beharrlich gewollt sein muss. In diesem Zusammenhang ist Volker Gerhardt zuzustimmen, dass „die Einrichtung eines rechtsverbindlichen äußeren Zustands [...] von der inneren Einstellung der handelnden Personen nicht zu trennen“ ist.371 Es sollte lediglich hinzugefügt werden, dass das Motiv für den notwendigen Friedenswillen der Staaten rechtlich ohne jede Bedeutung ist. Ob er auf moralischen Vorgaben, pazifistischen Grundüberzeugungen oder lediglich auf einem rationalen Selbstinteresse gründet, ist rechtlich ohne Belang. Vor diesem Hintergrund lässt sich leichter verstehen, was Kant im Sinne hat, wenn er erklärt, dass der Ausdruck „ewiger Frieden“ ein schon verdächtiger Pleonasmus sei.372 Dieser Ausdruck setzt nämlich voraus, dass es auch einen Frieden auf Zeit geben könnte. Ein Friedensschluss, der aufgrund des Willens der Vertragspartner zeitlich begrenzt wäre, wäre nichts als ein bloßer Waffenstillstand. Nach dem Willen der unterzeichnenden Staaten soll der Friedensschluss notwendigerweise ohne zeitliche Einschränkung gelten. Der ewige Frieden ist also nicht als ein zeitloses oder übergeschichtliches Phänomen zu begreifen. Der Ausdruck enthält auch keine theologische Konnotation. Er bezieht sich lediglich auf den vorbehaltlosen Friedenswillen der Vertragspartner, der ohne zeitliche Einschränkung gelten soll.373 Wenn der Friedenswille der Einzelstaaten wirklich vorbehaltlos ist, dann sollen alle möglichen Gründe zum künftigen Krieg mit dem Abschluss des Friedensvertrages für null und nichtig betrachtet werden. In Wortlaut Kant heißt es: „Die vorhandene […] Ursachen zum künftigen Kriege sind durch den Friedenschluß insgesammt vernichtet“.374 Der Abschluss eines Friedensvertrages leitet eine neue Ära der Verhältnisse der unterzeichnenden Staaten untereinander ein. Zu Recht spricht Hans Saner in diesem Zusammenhang vom „epochalen Charakter“375 des Friedensvertrages. Mit dem Abschluss des Friedensvertrages scheidet der Krieg als Mittel der Politik aus. Wenn die Menschen wirklich ernsthaft Frieden wollen, weil sie beispielsweise erkannt haben, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, wenn weitere menschliche wie auch materielle Verluste vermieden werden sollen, werden sie 370 In der Rechtslehre schreibt Kant ausdrücklich, dass die „erste Aggression“ von der „ersten Hostilität“ zu unterscheiden sei (RL: VI, 346). Diese begriffliche Unterscheidung wird in den verschiedenen französischen Übersetzungen der Friedensschrift zumeist übersehen. Dort werden die Begriffe „Feindseligkeit“ und „Hostilität“ beide mit dem Substantiv „hostilité“ übersetzt (siehe etwa die Übersetzung von Jean-François Poirier und Françoise Proust oder jene von Max Marcuzzi). 371 Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 42. 372 Vgl. Frieden: VIII, 343 373 Vgl. Höffe, Otfried: Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 6. 374 Frieden: VIII, 343 Dieselbe Argumentation ist ebenfalls in der folgenden Reflexion Kants zu lesen: „Ein Friede muß jederzeit als ewige Aufhebung alles Rechtsstreits aus Gründen, die Gegenwärtig existiren, angesehen werden; denn sonst ist die Suspension der Feindseelichkeiten nur ein armistitium, wo man sich noch immer Gründe zu künftigen Feindseeligkeiten vorsetzlich aufbehält. Also setzt ein jeder Friede voraus, daß alle Ansprüche, die bis auf den Zeitpunct ein Staat auf den andern haben konnte und die zu Feindseeligkeiten Anlas geben könnten, abgethan und für Null erklärt sind. Mithin macht der Friede einen neuen Abschnitt zwischen zwey Staaten, über den hinaus zurük nichts hervorgesucht werden darf, was nicht als abgemacht betrachtet würde“ (Reflexion 7837: XIX, 530). 375 Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 51. - 70 - ihre Konflikte mit den anderen Staaten auf einem friedlichen Weg zu lösen versuchen. Der Abschluss des Friedensvertrages bedeutet die Aufhebung aller denkbaren Kriegsgründe zwischen den Staaten. Die bedingungslose, wechselseitige Anerkennung des Satus quo ist somit eine notwendige Bedingung der Möglichkeit des Abschlusses eines definitiven Friedensvertrages.376 Der Friedensvertrag darf ungelöste Probleme nicht in die Zukunft verschieben. Dies bedeutet durchaus nicht, wie Hans Saner schreibt, dass dies eine „Friedhofsruhe“377 wäre. Eine Änderung des Status quo bleibt weiterhin möglich, darf allerdings nur auf dem friedlichen Weg geschehen. Im letzten Teil des ersten Präliminarartikels verwirft Kant die Mentalität des Vorbehalts (reservatio mentalis). Die Geschichte darf nicht bei der erstbesten Gelegenheit, wie etwa bei einer Machtverschiebung, zum Auffinden neuer oder alter Kriegsgründe verwendet werden. Derartige „Jesuitencasuistik“ wäre, so schreibt Kant, unter der „Würde der Regenten“ sowie unter der „Würde eines Ministers“.378 Kant lehnt geheime Vorbehalte bei dem Abschluss eines Friedensvertrages deshalb ab, weil eine solche Mentalität bereits die Keime des nächsten Krieges in sich birgt und das wechselseitige Vertrauen in die Absichten des anderen - ohne den es keinen Frieden geben kann - zerstört. 1.3 Zweiter Präliminarartikel: Das Verbot des Erwerbs eines für sich bestehenden Staates Im zweiten Präliminarartikel stellt Kant folgendes Verbot auf: „Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung, erworben werden können“.379 Mit Sicherheit handelt es sich hier um einen bislang zu wenig beachteten Artikel, der eine nähere Betrachtung verdient. Das mangelnde Interesse für diesen Artikel liegt vermutlich darin begründet, dass die im Titel enthaltene Forderung zu sehr an die politischen Zusammenhänge zur Zeit Kants gebunden zu sein scheint, um heute überhaupt noch relevant sein zu können. Seit dem Ende der absolutistischen Monarchien in Europa oder spätestens seit dem Ende der Kolonialpolitik der europäischen Mächte ist es in der Tat kaum noch zu erwarten, dass ein Staat von einem anderen vererbt, getauscht oder verschenkt wird. Gleichermaßen scheint es heute so gut wie ausgeschlossen zu sein, dass „Staaten einander heirathen“.380 Dass die inhaltliche Forderung beträchtlich an Aktualität eingebüßt hat, lässt sich kaum bestreiten. Die dem Verbot zugrunde liegende rechtsphilosophische Begründung bleibt dagegen davon wiederum schlechthin unberührt. In den Erläuterungen gibt Kant nämlich eine erste, für die weiteren Erläuterungen entscheidende Definition des Staatsbegriffs. In äußerster Kürze heißt es zunächst: „Ein Staat ist nämlich nicht (wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat) eine Habe (patrimonium). Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er selbst zu gebieten und zu disponiren hat“.381 Im direkt anschließenden Satz führt Kant aus, dass der Staat eine „moralische[] Person“382 ist. Diese äußerst gedrängte Definition des Staates bedarf der weiteren Erläuterung. Im ersten Kapitel wurde bereits gesehen, dass eine moralische Person ein Rechtssubjekt ist, welches keinen 376 Vgl. Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 105; Georg Geismann: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 370. 377 Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 51. 378 Frieden: VIII, 344 379 Frieden: VIII, 344 380 Frieden: VIII, 344 381 Frieden: VIII, 344 382 Frieden: VIII, 344; Vgl. RL: VI, 343 - 71 - anderen Gesetzen unterworfen ist, als denen, die es sich selbst (entweder allein, oder wenigstens zugleich mit anderen) gibt.383 Dass der Mensch, als ein mit praktischer Vernunft begabtes Wesen, eine moralische Person ist, versteht sich von selbst. Erklärungsbedürftig ist dagegen, warum Kant ebenfalls den Staat als eine moralische Person bezeichnet. In seiner Begründung greift Kant auf die Idee des ursprünglichen Vertrages zurück. Im zweiten Abschnitt des Gemeinspruch heißt es, dass der ursprüngliche Vertrag (der Idee nach) eine Vielzahl freier Menschen in einem Staatsvolk vereinigt. Der Staat ist also nichts anderes als eine Gemeinschaft freier Menschen, die sich gemäß der Idee des ursprünglichen Vertrags zusammengeschlossen haben, das heißt, die sich gemeinsam einer allgemeinen Gesetzgebung unterworfen haben. Die Idee des ursprünglichen Vertrages ist, so schreibt Kant, eine bloße Idee der Vernunft, welche jedoch praktische Realität hat. Sie verpflichtet nämlich den Gesetzgeber, die öffentlichen Gesetze so zu geben, als hätten sie aus dem vereinigten Willen des ganzen Volks entspringen können.384 Unter dieser Bedingung kann die Gesetzgebung als Ausdruck des durch den ursprünglichen Vertrag vereinigten Willens aller Staatsbürger betrachtet werden. In den Vorarbeiten zur Rechtslehre definiert Kant den Staat entsprechend als „ein Volk das sich selbst beherrscht“.385 Weil jeder Staatsbürger als Mensch zugleich eine moralische Person ist, ist der Staat als Ausdruck und Verkörperung dieses vereinigten Willens ebenfalls eine moralische Person. Als solche genießt der Staat ähnliche Grundrechte wie der Mensch. Gemeint ist hier vornehmlich die Autonomie, das heißt, das Recht „sich selbst nach Freiheitsgesetzen“386 zu bilden und zu erhalten. Der Staat ist ein mit Autonomie ausgestattetes Gebilde, das will heißen, ein Gebilde, das über sich selbst entscheidet. Dies setzt selbstverständlich die Unabhängigkeit von der Willkür der anderen Staaten voraus. Dieses Recht gilt in gleicher Weise für alle Staaten, also unabhängig von der Größe der Bevölkerung, der militärischen Stärke oder irgendeiner anderen empirischen Bedingung.387 Der Staat darf also nicht zu einer Sache gemacht werden. Er ist keine Habe, also kein Objekt, sondern ein Subjekt des Völkerrechts. Der Erwerb eines Staates durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung würde die moralische Persönlichkeit des Staates - und damit auch jener der Menschen, die den Staat konstituieren - völlig aufheben. Das Recht eines Volkes (als Staat) über sich selbst zu entscheiden würde man heute als Souveränität bezeichnen.388 Das Verbot eines jeden Staates wie eine Habe zu behandeln, gilt notwendig auch für seine Bürger. Kant schreibt diesbezüglich: „Auch die Verdingung der Truppen eines Staats an einen andern gegen einen nicht gemeinschaftlichen Feind ist dahin zu zählen; denn die Unterthanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbraucht“.389 Das Staatsvolk im Allgemeinen darf nicht wie eine Sache aufgefasst und behandelt werden, weil dies in Widerspruch zu der moralischen Persönlichkeit eines jeden Untertanen als Mensch stehen würde. Darauf soll im anschließenden Abschnitt bezüglich des dritten Präliminarartikel noch näher eingegangen werden. Festzuhalten ist bereits an dieser Stelle, dass für Kant kein Machthaber nach Belieben über das Staatsvolk verfügen darf. In der durch ein Sternchen von den eigentlichen Erläuterungen abgesetzten Anmerkung führt Kant aus, dass es der Staat sei, welcher einen Regenten erwirbt und nicht umgekehrt. Damit hebt 383 Vgl. RL: VI, 223 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 297 385 Vorarbeit: XXIII, 347 386 RL: VI, 318 387 Vgl. Frieden: VIII, 344 388 Kant selbst spricht selten von „Souveränität“ aber deutlich häufiger von „Souverän“. Diese beiden Begriffe werden jedoch von Kant lediglich in Bezug auf das Staatsrecht verwendet und werden dabei generell jeweils als Synonyme für „Herrschergewalt“ und „Staatsoberhaupt“ verwendet. Vgl. RL: VI, 313, 317, 319, 321, 323, 328, 334, 337f., 340f., 345; Frieden: VIII, 383. 389 Frieden: VIII, 344 384 - 72 - Kant hervor, dass die Souveränität des Staates nicht beim Regenten, sondern beim Volk liegt, das sich seinen Regenten auswählt. 1.4 Dritter Präliminarartikel: Das Verbot des stehenden Heeres Im dritten Präliminarartikel fordert Kant die vollständige Auflösung der Institution des stehenden Heeres. Dies heißt im Wortlaut: „Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören“.390 Es besteht hier zunächst Erklärungsbedarf darüber, was Kant genau unter „stehenden Heeren“ versteht. Der Militärhistoriker Gerhard Papke verweist auf die Existenz vielfältiger Typen stehender Heere.391 Das einzige allgemein verbindliche Merkmal zur Definition der miles perpetuus sieht er in ihrer Dauereinrichtung. Dies legt die Vermutung nahe, dass Kant alle auf Dauer aufgestellte und bewaffnete Armeen im Sinne hat. Seine Forderung richtet sich somit sowohl an das Söldnerheer als auch an das Berufsheer.392 Zur Begründung der Forderung bezüglich der Abschaffung der stehenden Heere führt Kant zwei Argumente an. Das erste Argument beschreibt die kriegsverursachende Eigendynamik des Wettrüstens, welche sich zwangsläufig aus der bloßen Existenz des stehenden Heeres herausbildet. Kant führt seine Argumentation in vier Etappen durch. Der Ausgangspunkt seiner Argumentation lautet: Stehende Heere „bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg durch die Bereitschaft, immer dazu gerüstet zu erscheinen“.393 Durch die Existenz eines ständig in Waffen gehaltenen Heeres erhöht sich die Kriegsfähigkeit und Kriegsbereitschaft aller Staaten im internationalen System. Das stehende Heer ermöglicht nämlich dem Staat jederzeit sich gegen äußere Bedrohungen zu bewahren und ggf. andere Staaten anzugreifen. Es wird zu einer unablässigen Bedrohung für alle Staaten, da kein Staat sich sicher sein kann, dass das Heer eines anderen nicht gegen ihn ausgerichtet wird. Stehende Heere „reizen [die Staaten] an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen“.394 Im Naturzustand scheint es für jeden Staat folgerichtig zu sein, seine angrenzenden Staaten zumindest als potenzielle Feinde zu betrachten und dementsprechend mit ihnen umzugehen. Jeder Staat hat ein fundamentales Interesse daran, durch die Vergrößerung seines stehenden Heers sich in die Lage zu versetzen, jederzeit mögliche Feinde zu besiegen. Da allerdings jeder Machtzuwachs eines einzelnen Staates eine Gefahr für die anderen Staaten darstellt, werden sich letztere ebenfalls zur Gegenrüstung veranlasst sehen. Infolgedessen wird eine Rüstungsspirale ausgelöst, welche nach Kant (der Idee nach) keine Grenzen kennt. Kant argumentiert anschließend, dass „durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg“.395 Der eben skizzierte Rüstungswettlauf ist nämlich für alle Staaten mit erheblichen Kosten verbunden. Die Eigendynamik der Rüstung, obwohl sie abstrakt gesehen keine Grenze kennt, stößt in der Realität an die Grenzen der Kapazitäten der jeweiligen Staaten. Diese Aufrüstung wird daher erst dann unterbrochen, 390 Frieden: VIII, 345 Papke, Gerhard: Von der Miliz zum Stehenden Heer. Wehrwesen im Absolutismus, in: Deutsche Militärgesichte in sechs Bänden 1648-1939, hrsg. v. militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 1, Abschnitt I, München 1983, S. 155ff. 392 Das Söldnerheer besteht meist aus fremden Truppen, welche von einem Staat bezahlt sind, um seine sicherheitspolitischen Ziele zu verfolgen. Das Berufsheer besteht dagegen aus professionellen Soldaten, welche sich zur Verteidigung ihres eigenen Landes für eine gegebene Zeit engagiert haben. Eine Einführung in die Militär- und Kriegsgeschichte findet sich bei: Nowosadtko, Jutta: Krieg, Gewalt und Ordnung. Einführung in die Militärgeschichte, Tübingen 2002. 393 Frieden: VIII, 345 394 Frieden: VIII, 345 395 Frieden: VIII, 345 391 - 73 - wenn die Kosten der Aufrüstung für einen Staat schließlich die geschätzten Kosten eines kurzen Krieges überschreiten. Kant kommt letztlich zu dem Schluss, dass das stehende Heer, aufgrund der mit ihm verbundenen Kosten, „selbst Ursache von Angriffskriegen“396 wird. Aus präskriptiver Sicht lässt sich folgerichtig schließen, dass erst eine allgemeine Abrüstung die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden kann. Wichtig ist hier festzuhalten, dass die bloße Existenz des stehenden Heeres, unabhängig von den realen Zwecken der politischen Entscheidungsträger im zwischenstaatlichen Naturzustand kriegsverursachend wirkt. Die Frage, ob die Aufstellung eines stehenden Heers ursprünglich Expansionsbestrebungen oder Verteidigungszwecken zugrunde liegt, spielt hier keine Rolle. Im Naturzustand der Staaten im Verhältnis zueinander stellt das stehende Heer ein ständiges Bedrohungselement dar, welches allein zum Ausbruch eines Krieges führen kann. Diese Argumentation stellt wahrscheinlich die „erste moderne strukturelle Beschreibung der prinzipiell unbegrenzten Aufrüstung und ihrer Eigendynamik“397 dar. Sie wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von John Herz als „Sicherheitsdilemma“ definiert.398 Neben diesem strukturbezogenen Argument führt Kant ein moralisch begründetes Argument an, welches sich implizit auf die Formel der Menschheit als Zweck an sich selbst bezieht. Die Selbst-Zweck-Formel des kategorischen Imperativs wird im zweiten Abschnitt der Grundlegung folgendermaßen formuliert: „[H]andle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchtest“.399 Kant leitet diese Formel aus seiner Bestimmung des Menschen als Person, welche im Gegensatz zu einer Sache über einen absoluten Wert verfügt und also als Zweck an sich selbst existiert. Aus diesem Grunde darf er nie bloß als Mittel benutzt werden. Wer aber Menschen in Sold nimmt, um zu töten oder sie töten zu lassen, macht nämlich von ihnen Gebrauch als „bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern (des Staats)“.400 Diese Instrumentalisierung der Menschen im Krieg steht im Widerspruch zu „dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person“.401 Für Kant ist die Institution des stehenden Heeres somit moralisch verwerflich und ihre Abschaffung unbedingt geboten. 396 Frieden: VIII, 345 Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 62. 398 Vgl. Herz, John H.: Idealist Internationalism and the Security Dilemma, in: World Politics 2, 1950, S. 157180. In diesem einflussreichen Artikel definiert John Herz das Sicherheitsdilemma folgendermaßen: „Groups or individuals living in [an anarchic society; F. R.] must be, and usually are, concerned about their security from being attacked, subjected, dominated, or annihilated by other groups and individuals. Striving to attain security from such attack, they are driven to acquire more and more power in order to escape the impact of the power of others. This, in turn, renders the others more insecure and compels them to prepare for the worst. Since none can ever feel entirely secure in such a world of competing units, power competition ensues, and the vicious circle of security and accumulation is on” (Herz 1950, S. 157). Festzuhalten ist an Herz’ Erklärungsansatz des Sicherheitsproblems, dass er wie Kant auf keine Annahmen über die menschliche Natur beruht. Für Herz gilt: „Whether man is by nature peaceful and cooperative, or domineering and aggressive is not the question“ (Herz 1950, S. 157). Wie bei Kant ist das Sicherheitsdilemma ein strukturelles Problem. In der realistischen Denkschule der Internationalen Beziehungen ist das Sicherheitsdilemma der wichtigste Interaktionsmechanismus der internationalen Beziehungen und das zentrale Hindernis für den zwischenstaatlichen Frieden. Weitere Beiträge der realistischen Denkschule zum Sicherheitsdilemma finden sich in: Jervis, Robert: Cooperation under the security dilemma, in: World Politics 30, 1978, S. 167- 214; Grieco, Joseph M.: Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism, in: International Organization 42, 1988, S. 485-506; Glasner, Charles L.: The Security Dilemma Revisited, in: World Politics 50, 1997, S. 171-201. 399 Vgl. GMS: IV, 429 400 Frieden: VIII, 345 401 Frieden: VIII, 345 397 - 74 - Kant setzt sich jedoch nicht nur für die Abschaffung der stehenden Heere ein. Er plädiert ebenfalls für eine „freiwillig[] periodisch vorgenommene[] Übung der Staatsbürger in Waffen“.402 Gemeint ist hier eine Milizarmee. Dass diese Bezeichnung in Zum ewigen Frieden nie vorkommt, lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass Friedrich Wilhelm I. das Wort „Miliz“ nach 1733 verbieten ließ.403 Kants „Staatsbürger in Waffen“ lassen sich anhand von drei Merkmalen näher bestimmen und konzeptuell vom stehenden Heer abgrenzen. Das erste Merkmal besteht darin, dass die Teilnahme an der Milizarmee ausschließlich auf der freiwilligen Entscheidung eines jeden Staatsbürgers beruht. Das Recht des Menschen in der je eigenen Person auf den rechtsgesetzlichen Gebrauch seiner äußeren Freiheit setzt nämlich voraus, dass kein Mensch zum Wehrdienst ohne seine Zustimmung einberufen werden darf. Das zweite Merkmal der Milizarmee ist deren rein defensiver Charakter. Der defensive Charakter ist dadurch gesichert, dass die Milizarmee aus mit Verstand ausgestatteten Staatsbürgern besteht, welche (solange sie nicht angegriffen werden) nicht gewillt sein können Krieg zu führen, weil sie die direkten Kosten dafür zu tragen haben.404 Die friedensfördernde Wirkung der Milizarmee wird schließlich durch ihr drittes und letztes Merkmal verstärkt: Im Gegensatz zum stehenden Heer ist die Milizarmee nicht ständig in Waffen gehalten. Kant spricht in diesem Zusammenhang von „periodischen“ Übungen der Staatsbürger. Nach außen bewirkt dies eine Entschärfung (freilich nicht: Aufhebung) des Sicherheitsdilemmas, da eine Milizarmee nicht ständig kampfbereit ist, und übrigens kaum in der Lage wäre Angriffskriege zu führen. 1.5 Vierter Präliminarartikel: Das Verbot der Staatsschulden für äußere Konflikte Im vierten Präliminarartikel stellt Kant die folgende Forderung auf: „Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden“.405 Der vierte Artikel knüpft unmittelbar an den dritten an. Am Ende seiner Erläuterungen zum stehenden Heer wendet sich Kant gegen die „Anhäufung eines Schatzes“406, das will heißen, gegen die Anhäufung von unverhältnismäßigen, finanziellen Reserven, welche jederzeit zu militärischen Zwecken benutzt werden können. Kant begründet dieses Verbot mit dem Argument, dass von der Anhäufung eines Schatzes tendenziell dieselbe Kriegsgefahr ausgeht wie von den stehenden Heeren. Diesbezüglich schreibt er, dass „unter den drei Mächten, der Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht, die letztere wohl das zuverlässigste Kriegswergzeug“407 ist. Heute würde man sagen, dass die Geldmacht eine hoch fungible Macht ist. Sie versetzt einen Staat nämlich in die Lage jederzeit mühelos seine eigenen militärischen Kapazitäten auszubauen (wie etwa durch den Kauf neuer Rüstungen und fremder Truppen), Verbündete finanziell zu unterstützen, Allianzen zu bilden oder Gegnerstaaten zu bestechen. Im rechtlosen Naturzustand kann kein Staat sich sicher sein, dass die Geldmacht eines anderen Staates nicht gegen ihn ausgerichtet wird. Aus diesem Grunde wird die Vergrößerung der finanziellen Macht eines Staates von allen anderen Staaten als eine unablässige „Bedrohung mit Krieg“ angesehen, welche diese wiederum zu „zuvorkommenden Angriffen“408 nötigen kann. Dieselbe Argumentation hatte Kant bereits im Gemeinspruch ausgeführt: „Denn da die fortrückende Cultur der Staaten mit dem zugleich wachsenden Hange, sich auf Kosten der 402 Frieden: VIII, 345 Vgl. Schmidt, Hans: Staat und Armee im Zeitalter des „miles perpetuus“, in: Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit, hrsg. v. Johannes Kunisch, Berlin 1986, S. 217. 404 Vgl. Frieden: VIII, 351 405 Frieden: VIII, 345 406 Frieden: VIII, 345 407 Frieden: VIII, 345 408 Frieden: VIII, 345 403 - 75 - Andern durch List oder Gewalt zu vergrößern, die Kriege vervielfältigen und durch immer (bei bleibender Löhnung) vermehrte, auf stehendem Fuß und in Disciplin erhaltene, mit stets zahlreicheren Kriegsinstrumenten versehene Heere immer höhere Kosten verursachen muß; indeß die Preise aller Bedürfnisse fortdaurend wachsen, ohne daß ein ihnen proportionirter fortschreitender Zuwachs der sie vorstellenden Metalle gehofft werden kann; kein Frieden auch so lange dauert, daß das Ersparniß während demselben dem Kostenaufwand für den nächsten Krieg gleich käme, wowider die Erfindung der Staatsschulden zwar ein sinnreiches, aber sich selbst zuletzt vernichtendes Hülfsmittel ist“.409 Der vierte Präliminarartikel betrachtet die gleiche Problematik aus einem anderen Blickwinkel. Denn der Aufbau der finanziellen Macht eines Staats muss nicht notwendig durch jahrelange Ersparnisse angehäuft werden, sondern kann leicht durch den Rückgriff auf Kredite geschehen. Das Kreditsystem ist als solches nicht untersagt. Gegen Ausleihen „zum Behuf der Landesökonomie (der Wegebesserung, neuer Ansiedelungen, Anschaffung der Magazine für besorgliche Mißwachsjahre u.s.w.)“410 lässt sich Kant zufolge nichts einwenden. Der Staat kann nämlich die finanziellen Mittel benutzen, um wichtige Aufbauund Infrastrukturmaßnahmen zu finanzieren, welche mittelfristig die Leistungsfähigkeit der gesamten Wirtschaft steigern werden, und also Mittel erwirtschaften, welche wiederum eine Rückzahlung mit Zinsen ermöglichen werden.411 Das zuvor Erwähnte gilt jedoch nicht für Militärausleihen. Für Kant führen diese finanziellen Mittel zum Aufbau der eigenen militärischen Kapazitäten unausweichlich in den Staatsbankrott.412 Kant bietet hierfür keine explizite Begründung. Es liegt aber nahe, dass für ihn militärische Ausleihen eine Ressourcenverschwendung darstellen, weil sie nicht zur wirtschaftlichen Entwicklung des Staates beitragen. Weil aber das internationale Kreditsystem vielfach ökonomische Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Staaten erzeugt, würde der Bankrott eines einzelnen Staates ebenfalls mehreren anderen Staaten Schaden zufügen, obwohl diese unverschuldet sind. Dies würde aber eine Verletzung ihrer Rechte darstellen. Für Kant sind aber Kredite zum militärischen Zweck nicht nur deshalb verwerflich, weil sie unproduktiv sind und (ihrer Logik nach) zum Staatsbankrott führen. Sie sind schon deshalb verwerflich, weil sie aufgrund einer nie zuvor vorhandenen Leichtigkeit zum Krieg verleiten.413 Die Leichtigkeit Geld anzusammeln, um Krieg zu führen, ist eine offene Tür für alle möglichen Missbräuche. Während es Jahre dauern kann, um einen Kriegsschatz anzuhäufen, können alle Staaten schnell und relativ mühelos durch Kredite einen „Schatz zum Kriegführen“414 erlangen. Mit diesem System können außerdem die Kosten eines Krieges teilweise auf die nächsten Generationen übertragen werden. Das internationale Kreditsystem steht also dem ewigen Frieden deswegen entgegen, weil die Entscheidung zum Krieg für die Staatsoberhäupter leichter und schneller fällt. Der Leichtigkeit des Krieges entspricht übrigens der Neigung der Machthabenden und scheint der menschlichen Natur eingeartet zu sein.415 Wenn der Friedenswille der Staaten wirklich bedingungslos ist, dann sollen sie auf die Erhöhung ihrer Kriegskapazitäten durch das Mittel der Verschuldung verzichten. Diese Forderung entspricht keiner anderen als jener der Abrüstung. 409 Gemeinspruch: VIII, 311 Frieden: VIII, 345 411 Vgl. Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 60. 412 Vgl. Frieden: VIII, 346 413 Vgl. Frieden: VIII, 345 414 Frieden: VIII, 345 415 Vgl. Frieden: VIII, 345 410 - 76 - 1.6 Fünfter Präliminarartikel: Das Verbot der gewalttätigen Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates Die im fünften Präliminarartikel enthaltene Forderung heißt: „Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig einmischen“.416 Kants rechtsphilosophische Begründung dieser Forderung lässt sich in drei Argumentationsschritte einteilen, in welchen die Problematik der militärischen Einmischung aus einer jeweils anderen Rechtsperspektive behandelt wird. Zuerst wird diese Problematik aus der Perspektive des allgemeinen Rechtsgesetzes, anschließend aus jener des Staatsrechts und schließlich aus jener des Völkerrechts erörtert. In einem ersten Schritt stellt Kant die Behauptung auf, dass, selbst wenn der Verfassung und Regierung eines Staates keine Rechtsgrundsätze zugrundeliegen, die anderen Staaten dennoch nicht dazu berechtigt sind, sich in die inneren Angelegenheiten dieses Staates gewaltsam einzumischen. Kant benennt hierfür den folgenden Grund: „[D]as böse Beispiel, was eine freie Person der andern giebt, [ist] keine Läsion derselben“.417 Kant nimmt implizit auf das allgemeine Rechtsgesetz Bezug.418 Eine „Läsion“ ist nämlich eine Verletzung der Rechte anderer, oder, in Kants eigenen Worten, ein „Abbruch an meiner Freiheit, die mit der Freiheit von Jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann“.419 Das schlechte Beispiel, welches ein Staat durch seine Gesetzlosigkeit anderen bietet, stellt aber keine Verletzung des Rechts anderer Staaten dar. Die Art und Weise wie ein Staat seine inneren Angelegenheiten regiert, kann nämlich unmöglich eine Einschränkung der Freiheit eines anderen Staates nach einem allgemeinen Gesetz darstellen. Für Kant darf die Ausübung von Zwang einzig nur ein Unrecht (also eine tatsächliche Läsion) verhindern oder zurückfordern. Eine Handlung, die niemand lädiert und somit in Übereinstimmung mit der äußeren Freiheit einer jeden moralischen Person nach einem allgemeinen Gesetz steht, darf nicht mit Zwang verhindert werden. Aus diesem Grund sind militärische, das heißt nötigende Interventionen in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates schlechterdings verboten. In einem zweiten Schritt greift Kant auf die im zweiten Präliminarartikel angeführte Definition des Staates zurück. Dort heißt es, dass der Staat eine Gesellschaft von Menschen ist, über die niemand anders als er selbst zu gebieten und zu disponieren hat.420 Der Staat darf, als eine moralische Person, nicht zum völkerrechtlichen Objekt gemacht werden, sondern soll von den anderen Staaten immer als selbstgesetzgebend betrachtet und behandelt werden. Dieses Selbstbestimmungsrecht gilt, so schreibt Kant, selbst dann, wenn ein Staat „sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete“.421 Die moralische Persönlichkeit eines jeden Staates verbietet eine Einmischung äußerer Mächte in die inneren Angelegenheiten, solange der Staat als solches noch existiert. Solange es sich um einen innerstaatlichen Konflikt handelt, das will heißen, solange der Bürgerkrieg offensichtlich noch nicht gänzlich in Anarchie - im etymologischen Sinne - umgeschlagen ist, ist eine gewaltsame Intervention äußerer Mächte verboten, weil es sich dabei um eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines freien (mithin souveränen), wenn auch fragilen Staates handeln würde. Solange es sich um einen innerstaatlichen Konflikt handelt, 416 Frieden: VIII, 346 Frieden: VIII, 346 418 Vgl. RL: VI, 231 419 RL: VI, 249 420 Vgl. Frieden: VIII, 344 421 Frieden: VIII, 346 417 - 77 - das heißt solange es einen Staat gibt und somit keine Anarchie vorliegt, wäre jede gewalttätige Einmischung ein „Skandal“.422 Wenn ein Staat sich aber im Zuge eines Bürgerkrieges aufgelöst hat und an seiner Stelle zwei neue Gebilde entstanden sind, von denen jede den Anspruch auf das gesamte Gebiet des ehemals einheitlichen Staats erhebt, so dass letztlich ein Zustand der Anarchie vorliegt, dann wäre ein „Beistand“ an eine der zwei Seiten nicht länger als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates zu betrachten, sondern als berechtigte Hilfeleistung zu einem neuen, wenn auch nicht notwendig institutionell gefestigten Völkerrechtssubjekt in einem äußeren Krieg gegen einen anderen. Diese Argumentation stellt also keinesfalls, wie häufig zu lesen ist, eine „Einschränkung“, und erst recht keine „Ausnahme“423 des Einmischungsverbots dar, sondern eine konsequente und differenzierte Anwendung auf ein besonders heikles Problem der internationalen Politik. In einem dritten Schritt argumentiert Kant, dass die Intervention eines Staates in die inneren Angelegenheiten eines anderen, ohne vorangegangene Läsion, nicht nur die Völkerrechtspersönlichkeit dieses bestimmten Staates aufheben würde, sondern zugleich auch die „Autonomie aller Staaten unsicher machen“424 würde. Jeder Staat hat eine rechtliche Verfassung, welche die Bedingungen der Möglichkeit des friedlichen Zusammenlebens einer Vielzahl freier Menschen schafft. Diese Verfassung ist ausschließlich die Sache der jeweiligen Staaten als moralische Personen. Die Intervention eines Staates, als gewaltsamer Eingriff in die inneren Angelegenheiten eines anderen, ohne vorherige Läsion, wäre somit eine Verletzung der Selbstbestimmung dieses Staates und somit die Aufhebung seiner Völkerrechtspersönlichkeit. Eine derartige Intervention enthält außerdem in sich die Möglichkeit die Völkerrechtspersönlichkeit aller anderen Staaten jederzeit nach Belieben aufheben zu können. Diese Möglichkeit steht aber im Widerspruch zur Idee des ursprünglichen Friedensvertrages autonomer Staaten und ist aus diesem Grunde rechtlich ausgeschlossen. Kant fasst seine Argumente für das Interventionsverbot in einer äußerst gedrängten Form zusammen. Es kann festgehalten werden, dass viele Fragen wie etwa die Problematik militärischer Interventionen in Bürgerkriegen von Kant nicht oder nur unzureichend beantwortet werden.425 Fraglich ist beispielsweise: Wie lässt sich in der Praxis der Übergang von einem Zustand des Bürgerkrieges in einen der Anarchie feststellen? Wer stellt überhaupt fest, dass es sich um Anarchie handelt? Unter welchen Bedingungen darf ein Teil eines ehemaligen Staats als selbständiges Völkerrechtssubjekt anerkannt werden? Diese Fragen lassen dem politischen Handelnden einen gewissen Interpretationsspielraum und erfordern vom Politiker eine „durch Erfahrung geschärfte Urteilskraft“.426 Auf diese Problematik soll im zweiten Hauptteil der vorliegenden Arbeit noch ausführlich eingegangen werden. Es darf hier auch nicht übersehen werden, dass Kant damals offenbar nicht an Massenund Völkermorde gedacht hat. Man kann vermuten, dass er eher das republikanische Frankreich vor Augen hatte, welches in der Pillnitzer Deklaration aus dem Jahre 1791 mit einer militärischen Intervention von dem Habsburger Kaiser Leopold II und König Friedrich Wilhelm II von Preußen bedroht wurde. Wichtig ist allerdings, dass Kant diesem zeitgenössischen Hintergrund in seiner Argumentation unbeachtet lässt und sein striktes Interventionsverbot ausnahmslos vernunftrechtlich begründet. Mit Blick auf die seit den 422 Frieden: VIII, 346 Siehe beispielsweise: Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 57. 424 Frieden: VIII, 346 (meine Hervorhebung) 425 Vgl. Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 64. 426 GMS: IV, 389 423 - 78 - 1990er Jahren neu entflammte Debatte um die „humanitäre Intervention“ und das „Recht auf Einmischung“427 lässt sich aus Kantischer Perspektive folgendes sagen: Für Kant ist eine militärische Intervention im zwischenstaatlichen Naturzustand dann zulässig, wenn die Verhältnisse innerhalb eines Staates eine Läsion anderer Staaten bedeuten. Eine militärische Intervention, ohne vorangegangene Läsion, ist dagegen für Kant einzig im Falle eines Staatszerfalles berechtigt, also in einer Situation, in welcher von Einmischung in innere Angelegenheiten gar nicht mehr gesprochen werden kann. Damit wird insbesondere jedes Recht zur militärischen Intervention in anderen Staaten zum Zweck der Einführung einer republikanischen Verfassung abgelehnt: Kein Staat darf einen anderen zur Übernahme einer bestimmen Verfassung nötigen. Im Streit der Fakultäten schreibt Kant diesbezüglich, dass „ein Volk von anderen Mächten nicht gehindert werden [darf], sich eine bürgerliche Verfassung zu geben, wie sie ihm selbst gut zu sein dünkt“.428 Wichtig ist letztlich festzuhalten, dass lediglich gewalttätige Einmischungen verboten sind. Damit werden alle weiteren gewaltfreien Formen der Einflussnahme von Kant stillschweigend akzeptiert. Dazu gehört selbstverständlich in erster Linie die öffentliche Kritik. Ob und inwiefern wirtschaftliche Sanktionen ebenfalls zu den gewaltfreien Interventionen zu zählen sind, kann lediglich von Fall zu Fall beurteilt werden.429 Was Kant fordert ist nicht die blinde Billigung anderer Regierung, also ihre zustimmende Beurteilung (Akzeptanz), sondern lediglich deren Duldung, mithin deren neutrales Gewährenlassen (Toleranz). 1.7 Sechster Präliminarartikel: Das Verbot friedensverhindernder Handlungen Im sechsten Präliminarartikel stellt Kant die folgende Forderung auf: „Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: als da sind, Anstellung der Meuchelmörder (percussores), Giftmischer (venefici), Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats (perduellio) in dem bekriegten Staat etc“.430 Es wurde bereits gesehen, dass Kant an unterschiedlichen Stellen seiner Werke klar gemacht hat, dass der Naturzustand der Staaten im Verhältnis zueinander ein Zustand der Rechtlosigkeit ist, das heißt ein Zustand permanenter Unsicherheit und damit Streitigkeit des geltenden Rechts ist. Dies gilt nicht zuletzt, wenn die Staaten ihre Streitigkeiten mit militärischer Gewalt austragen, wenn also faktisch Krieg herrscht. Krieg ist nämlich die Negierung und Aufhebung allen bürgerlichen Rechts. Da, wo das bürgerliche Recht herrscht, darf es keinen Krieg geben (bürgerliche Zustand), und da, wo es Krieg gibt, herrscht kein bürgerliches Recht (Naturzustand). 427 Eine einführende Diskussion findet sich bei: Hinsch, Wilfried: Kant, die humanitäre Intervention und der moralische Exzeptionalismus, in: Kant im Streit der Fakultäten, Berlin/New York 2005, hrsg. v. Volker Gerhardt, S. 205-228. Siehe auch die folgenden Sammelbände: Brunkhorst, Hauke (Hrsg.): Einmischung erwünscht? Menschenrechte und bewaffnete Intervention, Frankfurt a. M. 1998; Debiel, Tobias/ Nuscheler, Franz (Hrsg.): Der neue Interventionismus. Humanitäre Einmischung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Bonn 1996; Hoffmann, Stanley (Hrsg.): The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, Notre-Dame 1996; Matthies, Volker (Hrsg.): Frieden durch Einmischung?, Bonn 1993. 428 Streit: VII, 85. Vgl. auch: RL: VI, 344; Vorarbeit: XXIII, 188, 352. Dass Kant im Streit der Fakultät die militärische Intervention der Koalitionsmächte in Frankreich für völkerrechtwidrig erklärt, liegt nicht darin begründet, dass Frankreich ein republikanischer Staat war während die Koalition aus despotischen Staaten bestand, sondern ist lediglich darauf zurückzuführen, dass es sich bei Frankreich um einen freien, mithin souveränen Staat handelt. 429 Eine systematische Diskussion über Strategien, Methoden und Instrumente friedlicher Intervention findet sich in: Czempiel, Ernst-Otto: Friedensstrategien. Eine systematische Darstellung aussenpolitischer Theorien von Machiavelli bis Madariaga, Opladen/Wiesbaden, 1998. 430 Frieden: VIII, 346 - 79 - Die Abwesenheit eines bürgerlichen bzw. öffentlichen Rechts bedeutet jedoch nicht, dass die Staaten berechtigt sind, alles zu machen, was sie wollen. Für Kant gibt es nämlich selbst im Kriegszustand ein für alle Staaten gültiges Völkerrecht, nämlich das Kriegsrecht. Letzteres gründet im Postulat der reinen praktischen Vernunft, welches besagt, dass die Staaten den Naturzustand unbedingt verlassen sollen, um in einen sich weltweit erstreckenden, öffentlich-rechtlichen Zustand einzutreten. Entsprechend verpflichtet das Kriegsrecht die Staaten, Kriege nur so zu beginnen (Recht zum Krieg), so zu führen (Recht im Krieg) und so zu beenden (Recht nach dem Krieg), dass es immer noch möglich bleibt, aus dem Naturzustand herauszutreten.431 Der sechste Präliminarartikel in Zum ewigen Frieden entspricht dem § 57 der Rechtslehre, welcher das Recht im Krieg behandelt. Er findet seine Ergänzung in § 56 und § 58 der Rechtslehre, die wiederum das Recht zum Krieg sowie das Recht nach dem Krieg behandeln. Im Folgenden soll der sechste Präliminarartikel im Zusammenhang mit den entsprechenden Textstellen aus der Rechtslehre systematisch erläutert und diskutiert werden.432 a) Das Recht zum Krieg Gleich im ersten Satz des § 56 der Rechtslehre, die das Recht zum Krieg behandelt, führt Kant folgendes aus: „Im natürlichen Zustande der Staaten ist das Recht zum Kriege […] die erlaubte Art, wodurch ein Staat sein Recht gegen einen anderen Staat verfolgt, […] weil es durch einen Prozeß (als durch den allein die Zwistigkeiten im rechtlichen Zustande ausgeglichen werden) in jenem Zustande nicht geschehen kann“.433 Die Bezeichnung des Rechts zum Krieg als die „erlaubte Art“, durch welche die Staaten im Naturzustand ihre Rechte verfolgen können, kann leicht missverstanden werden und bedarf weiterer Erläuterungen. Es sei gleich darauf hingewiesen, dass mit der Formulierung „erlaubte Art“ kein bedingungsloses Recht zum Krieg eingeräumt wird. Das Recht zum Krieg stellt mitnichten eine Erlaubnis der Kriegsführung zur Erlangung irgendwelcher außenpolitischer Ziele dar. Selbst im rechtlosen Naturzustand ist das Auslösen eines Krieges (sei es durch tatsächliche oder bloß angedrohte Gewalt), um den anderen Staaten den eigenen Willen aufzuzwingen, schlechterdings verboten, weil die Maxime, die einer derartigen Handlung zugrunde liegt, nicht zu einem allgemeinen Gesetz taugt.434 Die Anerkennung eines Rechts zum Krieg (aus welchem Grund auch immer) würde nämlich die Idee einer sich weltweit erstreckenden Rechtsordnung autonomer Staaten a priori unmöglich machen. Damit sind auch alle denkbaren Begründungsversuche eines gerechten Krieges ausgeschlossen. Es sei ebenfalls daran erinnert, dass Krieg selbst dann rechtlich ausgeschlossen ist, wenn es darum geht, ein Volk von einer despotischen Herrschaft zu befreien und zur Stiftung einer republikanischen Verfassung zu verhelfen. Selbst der „Krieg wider dem Krieg“ – nach dem Motto: „einmal für allemal ungerecht zu sein, um nachher die Gerechtigkeit desto sicherer zu gründen und 431 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 188; Ders.: Geismann, Georg: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 372. 432 Vgl. ebenfalls: Reflexionen 7816-7839: XIX, 524ff.; 8061-8073: XIX, 598ff. 433 RL: VI, 346 434 Hariolf Oberer definiert die Tauglichkeit zu einem allgemeinen Gesetz anhand von vier Kriterien: „schlechthinnige Universalität, absolute, ausnahmslose Notwendigkeit für alle Fälle des Gesetzes, Notwendigkeit für Freiheit (Autonomie, Selbstzweckhaftigkeit), interne und externe Widerspruchsfreiheit“. Vgl. Oberer, Hariolf: Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori, in: Kant. Analysen - Probleme - Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Bd. III, Würzburg 1997, S. 174. - 80 - aufblühen zu machen“435 – ist unrechtmäßig. Abgesehen von der Verteidigung des eigenen Rechts kann es bei Kant gar kein Rechtsgrund zum Krieg geben. Es gilt vielmehr, dass „die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht“.436 Erklärungsbedürftig ist an dieser Stelle, was Kant dann unter der „erlaubten Art“ versteht. Im Naturzustand verfügen die Staaten - analog zu den einzelnen Menschen - über bestimmte Rechte, die zwar gültig, jedoch (mangels einer obersten Zwangsgewalt) im Streitfall nicht wirksam sind. Das Recht zum Krieg besteht dann lediglich darin, dass im Naturzustand jeder Staat im Streit mit anderen Seinesgleichen sein Recht letztlich durch eigene Gewalt zu bewahren suchen kann. In der Friedensschrift schreibt Kant, dass der Krieg lediglich das „traurige Nothmittel im Naturzustande ist (wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urtheilen könnte), durch Gewalt sein Recht zu behaupten“.437 Erst mit der Schaffung eines Völkerbundes mit Richtergewalt und anschließender Schaffung eines Völkerstaats können die Staaten „ihre Streitigkeiten auf civile Art, gleichsam durch einen Proceß“, und „nicht auf barbarische (nach Art der Wilden), nämlich durch Krieg“438 entscheiden. Der Krieg hat also nur deshalb eine Berechtigung, weil im Naturzustand keine oberste Rechtsinstanz des friedlichen Konfliktaustrags vorhanden ist, welche die Rechte der jeweiligen Staaten bewahren könnte. Das Recht zum Krieg „hat solche Ursachen an dem Feinde zum Grunde, welche in einem allgemeinen Staatenbunde notwendig verboten werden würden“.439 In Abwesenheit einer überstaatlichen Zwangsgewalt kann jeder Staat sein eigenes Recht letztlich (also nach Erschöpfung aller anderen Möglichkeiten des Konfliktaustrags) nur mit militärischer Gewalt bewahren. Unter dieser Bedingung ist Krieg erlaubt, weil jedes Recht mit einer Befugnis zu zwingen verbunden ist. Da ein Eingriff in die Rechte einer anderen moralischen Person ein Unrecht darstellt, ist der gewalttätige Widerstand, der diesem Eingriff entgegensteht, rechtmäßig. Der Ausgang des Krieges schafft dann „Recht“ wie ein Gottesurteil.440 Kant erkennt ein bedingtes Recht zum Krieg sowohl im Frieden als auch in der Rechtslehre. In der Rechtslehre ergänzt Kant jedoch seine frühere Argumentation, indem er darauf hinweist, dass ein Staat im Naturzustand nicht nur dann zum Krieg berechtigt ist, wenn eine „thätige[] Verletzung“ seiner Rechte vorliegt, sondern bereits wenn eine unmittelbare „Bedrohung“ vorliegt.441 Daraus ergibt sich ein „Recht des Zuvorkommens (ius praeventionis)“.442 Für Kant sind somit mindermächtige Staaten dazu berechtigt sich gegen „die zuerst vorgenommene Zurüstung“ sowie gegen die „fürchterlich (durch Ländererwerbung) anwachsende Macht (potentia tremenda)“ eines anderen Staates präventiv zu sichern.443 Selbst wenn Kant dies nicht explizit schreibt, darf man annehmen, dass eine offensichtliche und unverzügliche Bedrohung der eigenen Rechte vorliegen muss, welche nahe legt, dass der mindermächtige Staat seine Rechte überhaupt nicht verteidigen könnte, wenn er länger warten würde.444 435 RL: VI, 353 Frieden: VIII, 356 437 Frieden: VIII, 346 (meine Hervorhebung) 438 RL: VI, 351 439 Reflexion 8061: XIX, 598 440 Vgl. Frieden: VIII, 346 441 Vgl. RL: VI, 346 442 RL: VI, 346 443 Vgl. RL: VI, 346; Kants frühere Ansicht findet sich in: Frieden: VIII, 384 444 Im Falle einer Reaktion auf eine Lädierung würde es sich um einen Verteidigungskrieg handeln. Im Falle einer Reaktion auf eine Bedrohung würde es sich um einen Präventivkrieg handeln. Weil auch ein präventiver Angriff Verteidigungsziele haben kann, lässt sich Kants Begründung des Rechts zum Krieg schwerlich mit dem 436 - 81 - Aufgrund des Fehlens einer unabhängigen, überstaatlichen Rechtsinstanz, die den Rechtsstreit „auf civile Art, gleichsam durch einen Proceß […] entscheiden“445 könnte, können einzig nur die betroffenen Staaten entscheiden, ob eine Verletzung des eigenen Rechts vorliegt. Die Bewertung der Handlung eines anderen Staates als Verletzung oder Bedrohung des eigenen Rechts kann also im zwischenstaatlichen Naturzustand nicht anders als bloß subjektiv sein. Das Rechtsurteil eines jeden Staates kann allerdings jederzeit mit dem Rechtsurteil jedes anderen Staates kollidieren, ohne dass es möglich ist objektiv zu bestimmen, wer sich im Recht oder im Unrecht befindet. Vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, warum für Kant ein Staat zum Krieg berechtigt ist, wenn er sich von einem anderen Staat lädiert glaubt.446 Dies impliziert keinesfalls, dass die Staaten beliebig ein Recht zum Krieg beanspruchen können. Vor ihrem Gewissen sind die Staatsoberhäupter strikt dazu verpflichtet, Kriege nur dann zu führen, um sich gegen eine vorangehende bzw. unmittelbar vorstehende Läsion zu wehren. Im Verhältnis der Staaten zueinander bedeutet dies jedoch, dass jeder Staat im Naturzustand frei (souverän) über sein Recht zum Krieg urteilen kann. Abschließend zu diesem Teil sei noch darauf hingewiesen, dass die Wertschätzung des Krieges, die Kant an verschiedenen Stellen seines Werkes laut machen lässt447, nichts an seiner absoluten Ablehnung des Krieges als rechtmäßiges Mittel der Politik ändern. Die geschichtsphilosophische These, dass der Krieg einen entscheidenden Beitrag zur Kulturentwicklung des menschlichen Geschlechts geleistet hat, und langfristig auf dessen höheren Zweck des ewigen Friedens auf Erde führe, ist von der rechtsphilosophischen These der Unrechtmäßigkeit des Krieges ebenso unterschieden, wie miteinander verträglich. In den Vorarbeiten zur Friedensschrift heißt es: „Die Ordnung der Natur will daß vor dem Recht die Gewalt und der Zwang vorhergehe denn ohne diesen würden Menschen selbst nicht einmal dahin gebracht werden können sich zum Gesetzgeben zu vereinigen. – Aber die Ordnung der Vernunft will daß nachher das Gesetz die Freyheit regulire und in Form bringe“.448 b) Das Recht im Krieg Das Recht im Krieg, welches nach Kant ebenfalls Teil des Völkerrechts ist, bringt die meisten Schwierigkeiten mit sich. Vom Recht im Krieg zu sprechen heißt nämlich, sich ein Gesetz im gesetzlosen Zustand zu denken.449 Der Krieg bedeutet die Aufhebung des Rechts. Im Zustand des Krieges entscheidet allein die Gewalt über „Recht“ und „Unrecht“: Wer militärisch überlegen ist und den Krieg gewinnt, setzt das Faustrecht durch. Nichtsdestoweniger lehnt Kant das Prinzip inter arma silent leges ab, nach welchem im Krieg alle Gesetze außer Kraft gesetzt werden.450 Kant widmet sich dem schwierigen Problem des Rechts im Krieg im sechsten Präliminarartikel des Friedenstraktats sowie im § 57 der Rechtslehre. Das Recht im Krieg legt den Konfliktparteien die unbedingte Pflicht auf - wenn es schon einmal zu einem Krieg gekommen ist - sich ausschließlich solcher Mittel der Kriegsführung zu bedienen sowie solche Kriegszwecke zu setzten, welche den Abschluss und die Einhaltung eines Friedensvertrages nicht von vornherein (also notwendig) unmöglich machen würden. Das Recht im Krieg verpflichtet die Staaten den Krieg lediglich „nach solchen Grundsätzen zu führen, nach welchen es immer noch möglich bleibt, aus jenem gegensätzlichen Begriffspaar des erlaubten „Verteidigungskrieges“ und des verbotenen „Angriffskrieges“ zusammenfassen. 445 RL: VI, 351 446 Vgl. RL: VI, 346 447 Vgl. Idee: VIII, 24ff.; Anfang: VIII, 120f.; Frieden: VIII, 365, 367; Anthropologie: VII, 330 448 Vorarbeit: XXIII, 169 449 Vgl. RL: VI, 346 450 Vgl. RL: VI, 347 - 82 - Naturzustande der Staaten (im äußeren Verhältnis gegen einander) herauszugehen, und in einen rechtlichen zu treten“.451 Schlechterdings unerlaubt sind jene Kriegsmittel, welche „das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen“.452 Gemeint sind hier beispielsweise: Meuchelmord, Giftmischerei, Brechung der Kapitulation, Anstiftung zum Verrat, Spionage, Verbreitung falscher Nachrichten, Plünderung des Volkes und Heckenschützen.453 Diese „ehrlose[n] Stratagemen“454 vernichten das wechselseitige Vertrauen in „die Denkungsart des Feindes“.455 Dieses Vertrauen ist aber eine notwendige Bedingung der Möglichkeit des Abschlusses eines Friedensvertrages, weil im Naturzustand keine oberste Rechtsinstanz vorhanden ist, welche für die Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen rechtskräftig sorgen könnte. Ein Mindestmaß an Vertrauen und Zuverlässigkeit unter den Staaten muss selbst inmitten des Krieges übrig bleiben. Dies setzt voraus, dass diese sich inmitten der Kriegsführung weiterhin gegenseitig als moralische Personen betrachten. Die oben zitierten Mittel der Kriegsführung sind außerdem deshalb verboten, weil sie sich bis in den Friedenszustand (gemeint ist hier der Waffenstillstand) auswirken und die Staaten erneut in den Krieg führen. Im Wortlaut Kants heißt es, dass diese niederträchtigen Kriegsmittel „sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten […], sondern auch in den Friedenszustand übergehen, und so die Absicht desselben gänzlich vernichten“.456 Weil im zwischenstaatlichen Naturzustand die Möglichkeit eines Ausbruches des Krieges stets vorhanden ist, und weil die Staaten den Zustand des Krieges unbedingt verlassen sollen, um letztlich in einen bürgerlichen Zustand einzutreten, muss selbst inmitten des Krieges die Möglichkeit eines zukünftigen Friedens immer weiter bestehen. Der Krieg soll also nach solchen Grundsätzen geführt werden, die den Übergang vom natürlichen in den bürgerlichen Zustand ermöglichen. Weil der Krieg lediglich ein „traurige[s] Nothmittel im Naturzustande“457 ist, anhand von welchem die Staaten ihr Recht suchen, darf er weder absolut noch ewig sein. Aus diesem Grund müssen seine Zwecke ebenfalls eingegrenzt werden. Diese notwendige Eingrenzung der Kriegszwecke gilt gleichermaßen für alle Staaten, selbst also für jene, die in ihren Rechten von einem anderen Staat verletzt wurden, und also prinzipiell ein Recht zum Krieg haben. Der Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ist schlechterdings unerlaubt, weil sein Ziel lediglich in der bloßen Vernichtung aller Untertanen eines anderen Staates liegt, was aber unmittelbar dem Recht der Menschheit in der Person jedes einzelnen Menschen widerspricht. Für Kant ist grundsätzlich nur diejenige Gewaltanwendung im Krieg erlaubt, die „mit der Erhaltung des menschlichen Geschlechts zusammen bestehen kann“.458 Der Bestrafungskrieg (bellum punitivum) ist wiederum unerlaubt, weil alle Staaten gleichermaßen über die Völkerrechtspersönlichkeit verfügen und also „zwischen ihnen kein Verhältniß eines Obern zu einem Untergebenen statt findet“.459 Da die Staaten eine Völkerrechtspersönlichkeit haben, stehen sie per definitionem unter keiner obersten, öffentlich-rechtlichen Zwangsgewalt, die über ihre Streitigkeiten rechtsverbindlich entscheiden könnte. Schließlich verbietet die Rechtslehre den Unterjochungskrieg (bellum subiugatorium), mit der Begründung, dass er „eine moralische Vertilgung eines Staates“460 darstellen würde. 451 RL: VI, 347 Frieden: VIII, 346 (meine Hervorhebung) 453 Vgl. Frieden: VIII, 346; RL: VI, 346 454 Frieden: VIII, 346 455 Frieden: VIII, 346 456 Frieden: VIII, 347 457 Frieden: VIII, 346 (meine Hervorhebung) 458 Reflexion 8067: XIX, 600 459 Frieden: VIII, 347 460 RL: VI, 347 452 - 83 - c) Das Recht nach dem Krieg Das Recht nach dem Krieg besteht darin, dass der Sieger unilateral die Bedingungen stellt, unter welchen der Friedensvertrag abgeschlossen werden soll, „und zwar nicht gemäß irgend einem vorzuschützenden Recht […] sondern […] sich stützend auf seine Gewalt“.461 Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Kant hier den Begriff des Rechts nicht im Sinne von Gerechtigkeit versteht. Gemeint ist lediglich, dass der Sieger sein eigenes, also notwendig subjektives Rechtsurteil gegen den Willen der anderen durchsetzt. Das Recht nach dem Krieg ist im Grunde nichts anderes als das Recht des Stärkeren. Kant hebt hier die Willkür aller Abkommen hervor, welche als Ergebnis eines Krieges (also einer äußerlichen Nötigung) zustande gekommen sind. Diese sind nicht mit dem Friedensvertrag zu verwechseln, welche die Staaten nach der Idee des allgemeinen, ursprünglichen Vertrages zusammenschließen sollen. Weil Gewalt und Recht sich wechselseitig ausschließen, soll der Sieger die Völkerrechtspersönlichkeit des Besiegten respektieren. Die Aufhebung der Völkerrechtspersönlichkeit eines besiegten Staates würde die Stiftung einer sich weltweit erstreckenden Rechtsgemeinschaft autonomer Staaten in ihrer Möglichkeit a priori aufheben. Dies bedeutet konkret, dass die Siegermacht darauf verzichten muss, den besiegten Staat und sein Volk als eine Habe, das heißt als eigenes Mein und Dein zu behandeln. Weil es unter Bedingungen internationaler Anarchie keine öffentliche Gerechtigkeit gibt, kann es keine Verurteilung oder Bestrafung des besiegten Staates geben. Die Siegermacht kann aus demselben Grund keinen Anspruch „auf Erstattung der Kriegskosten“462 erheben. Dies würde bedeuten, dass sein Krieg ungerecht war.463 Das Recht nach dem Krieg stellt außerdem die Pflicht zur „Auswechslung der Gefangenen, ohne auf Gleichheit der Zahl zu sehen“.464 Dies liegt darin begründet, dass die Untertanen des jeweils einen Staates nicht die Habe des anderen sein dürfen. Alle Bewohner des besiegten Staates behalten ihre „staatsbürgerliche Freiheit“.465 Die Präliminarartikel sind notwendige, jedoch keine hinreichenden Bedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter den Staaten. Ihre Einhaltung ermöglicht einen Zustand vorläufiger Kriegsabwesenheit. Die Präliminarartikel schaffen somit lediglich die Bedingungen, unter denen der Abschluss eines Definitivvertrags überhaupt erst möglich ist.466 Welche Forderungen der Definitivvertrag enthält und wie Kant jene begründet, soll im folgenden Abschnitt näher gezeigt werden. 2. Die Definitivartikel: Die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter Staaten Im Gegensatz zum ersten Abschnitt der Friedensschrift hat Kant dem zweiten Abschnitt seiner Abhandlung, in welchem die Definitivartikel zum ewigen Frieden formuliert werden, eine kurze Einleitung hinzugefügt. Diese verdient besondere Aufmerksamkeit, weil dort die innersystematische Konstruktion des Friedensentwurfes hervorgehoben wird. Kant 461 RL: VI, 348 RL: VI, 348 463 Vgl. RL: VI, 348 464 RL: VI, 348 465 RL: VI, 348 466 Es ist Georg Geismann zuzustimmen, wenn er schreibt, dass die Präliminarartiel lediglich die Grundlage für die „Ermöglichung“ eines Zustandes des Weltfriedens bilden, während die Definitivartikel die Grundlage für dessen „Verwirklichung“ sind. Vgl. Ders.: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 180. 462 - 84 - führt zunächst aus, dass die Menschen sich von Natur aus in einem Zustand des Krieges befinden, „d.i. wenn gleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben“.467 Die Gründe hierfür sind bereits ausführlich erläutert worden. Festzuhalten ist hier nur folgendes: Weil es keine von Natur aus gegebene Harmonie gibt, soll der Zustand des Friedens zuerst „gestiftet“ werden. Dies hat wiederum zu bedeuten, dass der Frieden in der Macht der Menschen liegt. Er muss aber aktiv gewollt und durch beständige Anstrengung hergestellt werden. In den drei Definitivartikeln hält Kant die notwendigen Rechtsschritte für die Realisierung der Möglichkeit des Friedens fest. Die drei Definitivartikel heben die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens hervor. In der durch ein Sternchen abgesetzten Anmerkung führt Kant aus, dass allen drei Definitivartikeln das Postulat des öffentlichen Rechts zugrunde liegt. Dieses lautet: „Alle Menschen, die auf einander wechselseitig einfließen können, müssen zu irgend einer bürgerlichen Verfassung gehören“.468 Alle Menschen müssen sich in irgendeinem das provisorische Recht sichernden Zustand befinden. Die drei Definitivartikel beziehen sich auf die drei denkbaren Varianten einer bürgerlichen Verfassung: „Alle rechtliche Verfassung […] ist, was die Personen betrifft, die darin stehen, 1) die nach dem Staatsbürgerrecht der Menschen in einem Volke (ius civitatis), 2) nach dem Völkerrecht der Staaten in Verhältniß gegen einander (ius gentium), 3) die nach dem Weltbürgerrecht, so fern Menschen und Staaten, in äußerem auf einander einfließendem Verhältniß stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzusehen sind (ius cosmopoliticum)“.469 Kant übernimmt dieselbe Einteilung im Zweiten Teil der Rechtslehre, dessen drei Abschnitte wie folgt heißen: »Das Staatsrecht«, »Das Völkerrecht« und »Das Weltbürgerrecht«. Diese Dreiteilung ist erwartungsgemäß von Kant nicht willkürlich gewählt worden, sondern ergibt sich notwendigerweise aus der Idee des ewigen Friedens. In § 44 der Rechtslehre schreibt Kant, dass es a priori in der Vernunftidee des Naturzustandes liege, „daß, bevor ein öffentlich gesetzlicher Zustand errichtet worden, vereinzelte Menschen, Völker und Staaten, niemals vor Gewaltthätigkeit gegen einander sicher sein können, und zwar aus jedes seinem eigenen Recht zu thun, was ihm recht und gut dünkt, und hierin von der Meinung des Anderen nicht abzuhängen“.470 Das Prinzip des Rechts ist somit in allen drei denkbaren Rechtsbeziehungen zu verwirklichen. Der Naturzustand der Menschen ist prinzipiell ein Zustand permanenter Unsicherheit des Rechts. Um diese grundsätzliche konfliktträchtige Rechtsunsicherheit ein für allemal zu beseitigen, soll sich eine begrenzte Gemeinschaft von Menschen einer allgemeinen Gesetzgebung unterwerfen, also einen Staat errichten. Solange sich aber die Staaten in ihren äußeren Verhältnissen zueinander im Naturzustand befinden, bleibt die Rechtsunsicherheit weiterhin bestehen. Dies liegt darin begründet, dass selbst wenn die Menschen in ihren jeweiligen Staaten gesicherte Rechte haben, sie vor den Eingriffen anderer Staaten nie sicher sein können. Die einmal erreichte innerstaatliche Rechtssicherheit kann nämlich jederzeit durch zwischenstaatliche Kriege verloren gehen. Aus diesem Grund darf der Rechtszustand nicht auf das Verhältnis der Menschen in den einzelnen Staaten beschränkt bleiben (Staatsrecht), sondern soll sich ebenfalls auf das Verhältnis der Staaten zueinander (Völkerrecht) sowie auf das Verhältnis der Staaten zu den Bürgern anderer Staaten und auf das Verhältnis von Bürgern verschiedener Staaten (Weltbürgerrecht) erstrecken. In der Rechtslehre führt Kants aus, dass „wenn unter diesen drei möglichen Formen des rechtlichen Zustandes es nur einer an dem die äußere Freiheit durch Gesetze einschränkenden Princip fehlt, das Gebäude aller übrigen unvermeidlich untergraben werden 467 Frieden: VIII, 349 Frieden: VIII, 349 469 Frieden: VIII, 349 470 RL: VI, 312 (meine Hervorhebungen) 468 - 85 - und endlich einstürzen muß“.471 Erst in der Einheit des öffentlichen Rechts, das heißt in der Einheit von Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht, ist ein wirklich universeller Frieden möglich. 2.1 Erster Definitivartikel: Das Recht in den jeweiligen Staaten Für Kant nimmt die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens ihren Ausgangspunkt in der inneren Ausgestaltung der einzelnen Staaten, also im Staatsrecht. Als erste von drei positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter Staaten nennt Kant entsprechend im ersten Definitivartikel: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“.472 Kants Gedankengang bei der Begründung dieser Forderungen lässt sich in drei Schritte einteilen. Im ersten Teil führt Kant ein staatsrechtliches Argument zugunsten seiner These an. Dort heißt es, dass die republikanische Verfassung die einzige ist, welche der Idee des ursprünglichen Vertrages gemäß ist. Im zweiten Teil führt Kant wiederum ein völkerrechtliches Argument an. Dort stellt er die zentrale These auf, dass die republikanische Verfassung die einzige ist, welche zum ewigen Frieden führen kann. Der hier zugrunde liegende Gedanke ist, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Herrschaftsform eines Staates und seinem Verhältnis zu den anderen Staaten gibt. Im dritten und letzten Teil unterscheidet Kant zwischen Herrschaftsform und Regierungsart. a) Die apriorischen Prinzipien der republikanischen Verfassung Es besteht zunächst Erklärungsbedarf darüber, was genau unter dem Begriff einer republikanischen Verfassung zu verstehen ist. Auf diese Frage gibt Kant gleich zu Beginn des ersten Definitivartikels eine Antwort. Dort heißt es: „Die erstlich nach Principien der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen); zweitens nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Unterthanen); und drittens, die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger) gestiftete Verfassung […] ist die republikanische“.473 Wie die Rezeptionsgeschichte des Definitivartikels zeigt, bedarf diese äußerst prägnante und inhaltsreiche Definition der republikanischen Verfassung weiterer Erläuterungen und Begründungen. Ihr Verständnis fällt allerdings nicht leichter, wenn man sie im Zusammenhang mit anderen Textstellen liest. Im Gemeinspruch474 und - mit wenigen Abweichungen - in der Rechtslehre475 zählt Kant nämlich die drei folgenden Prinzipien einer jeden republikanischen Verfassung auf: Freiheit als Mensch, Gleichheit als Untertan, Selbständigkeit als Bürger. Im Gegensatz zu den Ausführungen in der Friedensschrift enthält diese Einteilung nicht das Prinzip der Abhängigkeit, sondern jenes der Selbständigkeit. Dieser Abweichung wurde in der Sekundärliteratur kaum Aufmerksamkeit geschenkt, bedarf aber ebenfalls der Erklärung.476 471 RL: VI, 311 Frieden: VIII, 349 473 Frieden: VIII, 349f. (meine Hervorhebungen) 474 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 290ff. 475 Vgl. RL: VI, 314 476 Georg Cavallar zum Beispiel bemerkt diese Abweichungen, geht aber nicht wirklich auf sie ein. Vgl. Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 143. Diesen Abweichungen widmen sich dagegen vor allem Volker Gerhardt und Jochen Hennigfeld. Vgl. Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 85-87; Hennigfeld, Jochen: Der Friede als philosophisches Problem. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 8, 1983, S. 29. 472 - 86 - Anhand der folgenden Ausführungen soll zunächst versucht werden, Kants Bestimmung der republikanischen Verfassung in der Friedensschrift zu erläutern, um anschließend auf die zuvor angedeuteten Abweichungen ausführlicher einzugehen. Aus der schematischen Darstellung der Prinzipien der republikanischen Verfassung, die Kant in den verschiedenen Schriften anführt, ergibt sich das folgende Bild: Abbildung 2: Die Prinzipien der republikanischen Verfassung in den verschiedenen Schriften Gemeinspruch Freiheit als Menschen Gleichheit als Untertan Selbständigkeit als Bürger Zum ewigen Frieden Freiheit als Menschen Abhängigkeit als Untertan Gleichheit als Staatsbürger Rechtslehre gesetzliche Freiheit bürgerliche Gleichheit bürgerliche Selbständigkeit Das erste Prinzip der republikanischen Verfassung ist jenes der rechtlichen Freiheit aller Individuen im Staat als Menschen. Im ersten Kapitel wurde bereits gesehen, dass für Kant die Freiheit das einzige angeborene Recht der Menschheit in der je eigenen Person ist. Es handelt sich dabei um nichts anderes als das Vermögen sein Handeln aufgrund eigener Zweckvorstellungen selbst zu bestimmen. Es wurde aber auch gesehen, dass in Gemeinschaft mit anderen Menschen die Freiheit widerspruchsfrei lediglich als rechtsgesetzlich eingeschränkte Freiheit gedacht werden kann. Die notwendige Einschränkung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen kann jedoch nicht ohne Widerspruch von einem anderen aufgezwungen werden, weil dies die Unabhängigkeit jedes Menschen von der Willkür anderer missachten würde. Die Einschränkung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen auf die Bedingungen ihrer Übereinstimmung mit der äußeren Freiheit von jedermann kann also nur durch die Unterwerfung unter eine allgemeine, das heißt notwendigerweise mich selbst einschließende Gesetzgebung infrage kommen. Nur auf diesem Weg geht die eigene äußere Freiheit nicht verloren, weil ihre Einschränkung aus dem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Die Unterwerfung unter eine allgemeine Gesetzgebung verletzt somit nicht meine eigene Freiheit, sondern macht sie zuallererst rechtlich sicher. Das Prinzip der Freiheit fordert somit die Mitgesetzgebung eines jeden Menschen. Nur wenn die Gesetze aus der Freiheit der Menschen entspringen können, sind sie mit dem Recht der Menschheit in Übereinstimmung. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann sind die Gesetze unrechtsmäßig. In der Rechtslehre heißt es dazu, dass der Staatsbürger „im Staat immer als mitgesetzgebendes Glied betrachtet werden muß“.477 An dieser Stelle soll auf ein möglicherweise auftretendes Missverständnis hingewiesen werden. Kant schreibt nämlich, dass die gesetzliche Freiheit darin besteht, „keinem anderen Gesetz zu gehorchen, als zu welchem [man] seine Beistimmung gegeben hat“.478 Dies hat mitnichten zu bedeuten, dass die Staatsbürger allen einzelnen positiven Gesetzen (dem Inhalt nach) zustimmen müssen. Gefragt ist lediglich die Zustimmungsmöglichkeit der Staatsbürger (der Form nach), was wiederum lediglich zu bedeuten hat, dass die Staatsbürger nicht von vornherein an der inhaltlichen Bestimmung der positiven Gesetze ausgeschlossen werden dürfen. Gefragt ist also (positiv formuliert) ein Recht auf Mitgesetzgebung und (negativ formuliert) die Unabhängigkeit von einer fremden Willkür in Bezug auf die Gesetzgebung. Für Kant besteht die gesetzliche Freiheit vielmehr darin, keinem anderen Gesetz zu gehorchen, als zu welchem man seine Zustimmung hätte geben können.479 Im hier diskutierten Zusammenhang weist 477 RL: VI, 345 RL: VI, 314 (meine Hervorhebung) 479 Vgl. Frieden: VIII, 350 478 - 87 - Otfried Höffe zu Recht darauf hin, dass Kants „legitimatorische[r] Individualismus […] die Zustimmungswürdigkeit, nicht die tatsächliche Zustimmungen jedes Betroffenen fordert“.480 Als zweites Prinzip benennt Kant in der Friedensschrift die Abhängigkeit aller Individuen als Untertanen von einer einzigen allgemeinen Gesetzgebung. In der Sekundärliteratur wird generell davon ausgegangen, dass Kant hier die Gleichheit aller Staatsmitglieder vor der Gesetzgebung hervorhebt.481 Für diese Auslegung spricht die Tatsache, dass Kant sowohl im Gemeinspruch als auch in der Rechtslehre die Gleichheit als zweites Prinzip der republikanischen Verfassung anführt und sie im Gemeinspruch explizit auf den Untertan bezieht. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass Kant hier von „Abhängigkeit“ und nicht von „Gleichheit“ spricht. Die Gleichheit wird in der Friedensschrift erst als drittes Prinzip erwähnt. Sie bezieht sich dabei nicht auf das Individuum als Untertan, sondern als Staatsbürger. Aus diesem Grund wird hier eine andere Erklärungsmöglichkeit vorgezogen. Was Kant unter dem Grundsatz der Abhängigkeit versteht, ist die strikte Bindung aller Untertanen an die geltende Gesetzgebung des eigenen Staates. Dies setzt selbstverständlich auch Gleichheit voraus. Hervorgehoben wird aber die absolute und allgemeine Gültigkeit der öffentlichen Gesetzgebung. Das bedeutet, dass alle Untertanen überall und unter allen Umständen den öffentlichen Gesetzen unterworfen sind. Für die Einhaltung der öffentlichen Gesetze sorgt die staatliche Zwangsgewalt. Die öffentlichen Gesetze sind somit Zwangsgesetze.482 Ohne den Zwangscharakter der öffentlichen Gesetze könnte jeder gänzlich nach Gutdünken handeln, was das Zusammenleben äußerlich freier Wesen in Gemeinschaft unmöglich machen würde. Das friedliche Zusammenleben wird zuallererst durch die Zwangsgesetze ermöglicht. Diese haben somit nicht nur regulativen, sondern auch konstitutiven Charakter. Kant spricht deshalb von „Abhängigkeit“, weil ohne Zwangsgesetze die Menschen gar nicht zusammen in Gemeinschaft leben könnten. Als drittes und zugleich letztes Prinzip benennt Kant die Gleichheit der Individuen im Staat als Staatsbürger desselben. Der Begriff der Gleichheit bezeichnet hier die Wechselseitigkeit rechtlicher Verpflichtungen. Alle Mitglieder des Staates sind gleichermaßen den öffentlichen Gesetzen unterworfen. Empirisch gesehen sind zwar alle Individuen verschieden, aber rechtlich sind sie alle gleich. Dies bedeutet, dass sie alle über dieselben Rechte und Pflichten verfügen. Rechtlich sind weder negative noch positive Diskriminierungen unter den Staatsbürgern zugelassen.483 Jeder hat dieselbe Zugangsmöglichkeit zu den rechtlichen und gesellschaftlichen Positionen und jeder hat in gleicher Weise die Möglichkeit äußere Gegenstände der Willkür als das Seine zu erwerben. Um Missverständnisse zu vermeiden, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Prinzip der Gleichheit sich ausschließlich auf die rechtlichen Verhältnisse der Individuen untereinander bezieht. Es verlangt somit nicht die Abschaffung möglicher sozioökonomischer Disparitäten.484 Die republikanische Verfassung sichert die rechtliche Freiheit der Individuen im Staat, da diese an der Gestaltung der öffentlichen Gesetzgebung gleichermaßen mitwirken dürfen und von dieser gemeinsamen Gesetzgebung gleichermaßen abhängig sind. Sie ist somit die einzige Verfassung, welche der Idee des ursprünglichen Vertrages gemäß ist. Dies bedeutet, 480 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 210f. 481 Siehe beispielsweise: Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 146; Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 91 und schon Ders.: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 377. 482 Vgl. Religion: VI, 95 483 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 292 484 Vgl. Kersting, Wolfgang: Kant über Recht, Paderborn 2004, S.127f. - 88 - dass sie die einzige Verfassung ist, welche mit dem angeborenen Recht der Menschheit in der je eigenen Person in Übereinstimmung steht. Das zuvor Geschriebene bezieht sich auf Kants Einteilung in der Friedensschrift. An anderen Stellen seiner Werke, nämlich im Gemeinspruch und in der Rechtslehre, zählt Kant jedoch andere Prinzipien auf. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, worin diese Unterschiede genau bestehen und wie sie erklärt werden können. Es kann zunächst festgehalten werden, dass die Bestimmung des ersten Prinzips (Freiheit als Mensch) in allen drei Werken weitgehend deckungsgleich ist. Die Bestimmung des dritten Prinzips in der Friedensschrift (Gleichheit als Staatsbürger) entspricht auch weitgehend den Ausführungen des zweiten Prinzips (Gleichheit als Untertan) im Gemeinspruch und in der Rechtslehre. Dabei wird nicht übersehen, dass Kant das Prinzip der Gleichheit einmal auf den Staatsbürger und einmal auf den Untertan bezieht. Festzuhalten ist allerdings, dass Kant in der Anmerkung zum zweiten Definitivartikel den Ausdruck „das Recht der Gleichheit aller Staatsbürger, als Unterthanen“485 verwendet. Damit betont Kant, dass in der republikanischen Verfassung jeder Staatsbürger zugleich auch Untertan ist. Im Gegensatz zu dem, was in dem Friedenstraktat steht, nennt Kant sowohl im Gemeinspruch als auch in der Rechtslehre das Prinzip der Selbständigkeit des Staatsbürgers als zweites Element der republikanischen Verfassung. Es besteht hier Erklärungsbedarf darüber, was Kant unter dem Begriff der Selbständigkeit versteht. Es wurde zuvor gesehen, dass das Prinzip der gesetzlichen Freiheit darin besteht, nur solchen Gesetzen unterworfen zu sein, zu welchen man seine Zustimmung hätte geben können, und damit das Recht auf Mitgesetzgebung. Nur setzt dieses Recht auf Mitgesetzgebung auch die Fähigkeit zur Mitgesetzgebung voraus. Die Fähigkeit zur Mitgesetzgebung bestimmt Kant wiederum in der erwähnten Selbstständigkeit; verstanden als die Unabhängigkeit vom Willen der anderen.486 Jeder Bürger, der seine Zustimmung unabhängig vom Willen der anderen erteilen kann, ist zur Mitgesetzgebung fähig. Die Gewährung eines Rechts auf Mitgesetzgebung an jemandem, der vom Willen der anderen abhängig ist, würde im Widerspruch zum Grundsatz der rechtlichen Gleichheit aller stehen. Wenn man ein Recht auf Mitgesetzgebung an einem Staatsbürger gewähren würde, der vom Willen eines anderen abhängig wäre, dann würde man demjenigen, von dessen Willen dieser Staatsbürger abhängig ist zwei Stimmen anerkennen. Nur wenn man unabhängig vom Willen eines anderen handeln kann, darf man an der Gesetzgebung mitwirken. Die hier vertretene prinzipientheoretische Argumentation ist durchaus konsistent und überzeugt. Dasselbe lässt sich allerdings nicht in Bezug auf dessen Anwendung auf die Erfahrung sagen. Gemeint ist Kants Kriterium zur Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Staatsbürgern. Als aktive Staatsbürger gelten lediglich jene Personen, die im gesellschaftlichen Leben selbstständig sind. Für Kant haben nur sozio-ökonomisch unabhängige Staatsbürger das Recht auf Mitgesetzgebung. Als passive Staatsbürger bezeichnet Kant wiederum ausdrücklich die Angestellten, Dienstboten, Unmündigen, Frauen und „überhaupt jedermann, der nicht nach eigenem Betrieb, sondern nach der Verfügung Anderer (außer der des Staats), genöthigt ist, seine Existenz (Nahrung und Schutz) zu erhalten“.487 Die passiven Staatsbürger genießen als Staatsbürger, also genauso wie die aktiven Staatsbürger, den Schutz der öffentlichen Gesetze (Kant spricht von „Schutzgenossen“488). Sie dürfen jedoch nicht zu deren Gestaltung (sei es mittelbar oder unmittelbar) mitwirken.489 Während Kants Unterscheidung sich etwa in Bezug auf 485 Frieden: VIII, 350 Vgl. RL: VI, 314 487 RL: VI, 314 (meine Hervorhebungen) 488 Gemeinspruch: VIII, 294 489 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 294 486 - 89 - Minderjährige und geistig Schwerbehinderte vielleicht rechtfertigen lässt, ist der von Kant angenommene Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der sozio-ökonomischen Stellung und dem Wahlverhalten problematisch. Es darf nämlich bezweifelt werden, dass die sozial und ökonomisch Abhängigen nicht eine andere Wahl treffen können als diejenige von dem sie abhängig sind. Kant macht hier offensichtlich eine falsche Anwendung des Prinzips der Selbständigkeit auf die Erfahrungsfälle. Otfried Höffe stellt diesbezüglich fest, dass Kant in der Friedensschrift demokratischer als in der Rechtslehre und dem Gemeinspruch ist.490 Erklärungsbedürftig ist, wie diese Abweichung erklärt werden kann. Man könnte diese Abweichung, wie Jochen Hennigfeld vorschlägt, als Beleg dafür sehen, dass Kant bei der Fassung dieses dritten Prinzips unsicher war.491 Damit wird allerdings noch nichts erklärt. Einen plausiblen Grund für diese Abweichung wird von Hajo Schmidt vorgeschlagen. Er geht nämlich davon aus, dass Kant in der Friedensschrift das Prinzip der Selbständigkeit durch jenes der Gleichheit ersetzt hat, weil er sich dessen bewusst war, dass sein Argument bezüglich der tendenziellen Kriegsabneigung der Staatsbürger nicht in gleicher Weise für „reiche wie für arme Länder, für saturierte wie für solche Bürger [gilt], die nichts zu verlieren haben“.492 Die Einführung des Prinzips der Abhängigkeit an der Stelle jenes der Selbständigkeit sollte Kants Argument bezüglich der Friedfertigkeit der Republik untermauern, weil die passiven Staatsbürger im Falle eines Krieges tatsächlich nicht im selben Ausmaß etwas zu verlieren haben wie die aktiven Staatsbürger. Die zuvor festgestellten Unterschiede zwischen den verschiedenen Werken Kants würden somit bloß auf einer jeweils unterschiedlichen Aufgabenstellung beruhen. Es darf in der Tat nicht übersehen werden, dass die systematische Stelle des zweiten Definitivartikels in Zum ewigen Frieden sich von den zwei anderen Textstellen in der Rechtslehre und im Gemeinspruch unterscheidet. Unbestritten ist, dass alle drei das Staatsrecht behandeln. Im Unterschied zu den zwei letztgenannten Textstellen ist aber der erste Definitivartikel ein integrativer Teil eines Entwurfes zum ewigen Frieden unter den Staaten. Der erste Definitivartikel behandelt nicht die Frage der vernunftrechtlichen inneren Gestaltung des Staates an sich, sondern diese Frage spezifisch mit Blick auf den ewigen Friedens unter den Staaten. Dies alles deutet darauf hin, dass Kant die Unterscheidung zwischen passiven und aktiven Staatsbürgern in der Friedensschrift zwar ganz ausgeklammert hat, jedoch nicht aufgegeben hat. Zusammenfassend zu diesem Teil und unter Berücksichtigung dessen, was Kant im Gemeinspruch und in der Rechtslehre schreibt, kann gesagt werden, dass für Kant die republikanische Verfassung auf insgesamt vier Prinzipien beruht: Die rechtliche Freiheit der Menschen, ihre Gleichheit vor dem Gesetz, ihre Selbstständigkeit sowie ihre Abhängigkeit vor der staatlichen Gesetzgebung. b) Die republikanische Verfassung als friedensfunktionale Verfassung Im zweiten Absatz des ersten Definitivartikels zum ewigen Frieden stellt Kant die berühmte, aber auch umstrittene These auf, dass die republikanische Verfassung, die einzige sei, welche zum ewigen Frieden hinführen könne. Im Wortlaut Kants heißt es: „Nun hat aber die republikanische Verfassung außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich 490 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 211. 491 Vgl. Hennigfeld, Jochen: Der Friede als philosophisches Problem. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 8, 1983, S. 29. 492 Schmidt, Hajo: Durch Reform zu Republik und Frieden? Zur politischen Philosophie Immanuel Kants, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 71, 1985, S. 301. - 90 - den ewigen Frieden“.493 In diesem Sinne ist die republikanische Verfassung die einzige sowohl innerlich als auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung.494 Kant fügt also dem staatsrechtlichen Argument, wonach die republikanische Verfassung, die einzige mit der äußeren Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz in Übereinstimmung stehende bürgerliche Verfassung ist, ein völkerrechtliches Argument hinzu, wonach die republikanische Verfassung auch der Stiftung eines Friedenszustands dient. Im späteren Streit der Fakultäten ändert Kant nichts an seiner früheren These. Dort erklärt er, „daß diejenige Verfassung eines Volks allein an sich rechtlich und moralisch gut sei, welche ihrer Natur nach so beschaffen ist, den Angriffskrieg nach Grundsätzen zu meiden, welche keine andere als die republicanische Verfassung, wenigstens der Idee nach, sein kann“.495 Im weiteren Verlauf desselben Texts führt Kant aus, dass die republikanische Verfassung die einzige ist, welche „den Krieg, den Zerstörer alles Guten, entfernt zu halten“496 vermag. Es gilt deshalb, „zu einer Verfassung hinzustreben, welche nicht kriegssüchtig sein kann, nämlich der republicanischen“.497 Hier stellt sich die Frage, warum die republikanische Verfassung (der Idee nach) nicht kriegssüchtig sein kann. In der Friedensschrift nennt er hierfür den folgenden Grund: „Wenn (wie es in dieser Verfassung nicht anders sein kann) die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein solle, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als daß, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten (als da sind: selbst zu fechten; die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine, den Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen“.498 Dieses Argument hatte Kant bereits im Gemeinspruch ähnlich formuliert. Dort führt Kant aus, dass die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens damit anfängt, dass „ein jeder Staat in seinem Inneren so organisirt werde, daß nicht das Staatsoberhaupt, dem der Krieg (weil er ihn auf eines Andern, nämlich des Volks, Kosten führt) eigentlich nichts kostet, sondern das Volk, dem er selbst kostet, die entscheidende Stimme habe, ob Krieg sein solle oder nicht (wozu freilich die Realisirung jener Idee des ursprünglichen Vertrags nothwendig vorausgesetzt werden muß)“.499 Kants Argumentation impliziert die Prämisse, dass die Staatsbürger (gemeint sind nicht alle Untertanen, sondern nur die aktiven Staatsbürger) in einem republikanisch verfassten Staat selbst, sei es direkt oder durch ihre Repräsentanten vermittelt über Krieg und Frieden entscheiden können.500 Weil jedoch der Staatsbürger erstens ein mit Verstand ausgestattetes Wesen ist und zweitens die direkten sowie indirekten Kosten des Krieges (sei es als Soldat oder als Steuerzahler) zu tragen hat, wird er sich tendenziell (Kant schreibt: „sich sehr bedenken werden“501) gegen den Krieg entscheiden. Aus diesem Grunde werden 493 Frieden: VIII, 351 Vgl. Idee: VIII, 27 495 Streit: VII, 85f. (meine Hervorhebung) 496 Streit: VII, 91 497 Streit: VII, 88 498 Frieden: VIII, 351 499 Gemeinspruch: VIII, 311 500 In § 55 der Rechtslehre führt Kant aus, dass der Staatsbürger „zum Kriegführen nicht allein überhaupt, sondern auch zu jeder besondern Kriegserklärung, vermittelst seiner Repräsentanten, seine freie Beistimmung geben muß“ (meine Hervorhebung). Die Staatsbürger haben somit ein Recht, über ihre Repräsentanten vermittelt, ihre Zustimmung zu jeder Kriegserklärung zu geben oder zu verweigern. 501 Frieden: VIII, 351 494 - 91 - republikanisch verfasste Staaten tendenziell nicht gewillt sein Kriege zu führen - zumindest solange sie nicht angegriffen werden.502 Für das Verständnis der hier diskutierten These ist es unbedingt erforderlich auf das Attribut „tendenziell“ zu bestehen. An den oben angeführten Zitaten ist nämlich festzuhalten, dass Kant im Gemeinspruch und in der Friedensschrift seiner These der Friedfertigkeit republikanisch verfasster Staaten eine durchaus mäßige oder vorsichtige Fassung gibt. Kant schreibt lediglich, dass die Bürger „sich sehr bedenken werden“503 einen Krieg zu beginnen. Ferner führt er im Text aus, dass eine Republik „zum ewigen Frieden geneigt sein muß“.504 Im Gegensatz zu dem, was seit Friedrich von Gentz und G. W. F. Hegel immer wieder zu lesen ist505, behauptet Kant also keinesfalls, dass die republikanisch verfassten Staaten niemals Kriege führen werden, und dass es somit letztendlich keine Kriege mehr geben wird, sobald alle Staaten eine republikanische Verfassung haben. Kurt von Borries zum Beispiel übersieht dies, wenn er Kants Gedanken folgendermaßen zu wiedergeben glaubt: „Die Kriege werden aus der Welt verschwinden, wenn die Völker vorher um ihre Zustimmung gefragt werden müssen“. Mit dem historischen Abstand zu Kant glaubt Borries behaupten zu können, dass Kants Aussage bezüglich der Friedensfertigkeit der republikanisch verfassten Staaten ein „Trugschluss“, ein „Irrtum“ und eine „Illusion“ sei, die sich lediglich aus der „unhistorischen Denkweise“ des 18. Jahrhunderts erklären lasse.506 Ähnliche Missverständnisse finden sich heute noch in der gegenwärtigen Debatte um die im Anschluss an Kant entwickelte Theorie des demokratischen Friedens.507 Es wird Kant etwas vorgeworfen, was er an keiner Stelle behauptet hat. Es wird hier nicht übersehen, dass im späteren Streit der Fakultäten Kant folgendes erklärt: „Die Idee einer mit dem natürlichen Rechte der Menschen zusammenstimmenden Constitution […] entfernt allen Krieg“.508 Wichtig ist allerdings festzuhalten, dass hier lediglich von der respublica noumenon die Rede ist. In Bezug auf die respublica phaenomenon benutzt Kant im weiteren Verlauf des Textes eine deutlich abgeschwächte Formulierung. Er schreibt nämlich nur, dass die republikanische Verfassung sich „zur besten unter allen [qualifiziert], um den Krieg, den Zerstörer alles Guten, entfernt zu halten“.509 Kant erwartet tatsächlich, dass die Stiftung einer republikanischen Verfassung in den einzelnen Staaten friedensförderliche Auswirkungen hat. Die republikanische Verfassung, so friedensförderlich sie auch sein mag, 502 Diese auch als „Kants - Theorem“ bezeichnete These ist Ausgangspunkt für die gegenwärtig in der Wissenschaft der internationalen Beziehungen heftig debattierte These der Friedfertigkeit der Demokratien untereinander. Den entscheidenden Anstoß hierfür haben die zwei Beiträge von Michael Doyle geleistet. Vgl. Doyle, Michael W.: Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, Part I, in: Philosophy and Public Affairs 12(3), 1983a, S. 205-235 und Ders.: Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, Part II, in: Philosophy and Public Affairs 12(4), 1983b, S. 323-353. Vgl. Ders.: Die Stimme der Völker. Politische Denker über die internationalen Auswirkungen der Demokratie, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 221-243. Vgl. ebenfalls: Czempiel, Ernst-Otto: Kants Theorem und die zeitgenössische Theorie der internationalen Beziehungen, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 300-323. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels soll noch näher darauf eingegangen werden. 503 Frieden: VIII, 351 (meine Hervorhebung) 504 Frieden: VIII, 356 (meine Hervorhebung) 505 Vgl. Raumer, Kurt von: Ewiger Friede, Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, München 1953, Kapitel 6 „Kant und Gentz. Vom idealistischen zum realistischen Friedensgedanken“, S. 151ff. 506 Vgl. Borries, Kurt von: Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizismus, Aalen 1973 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1928), S. 218ff. 507 Um nur einen Beispiel unter vielen zu nennen, ist bei Marc Schattenmann folgendes zu lesen: „[D]as prinzipielle und unwiderlegbare Argument lautet: Wenn alle Staaten reine Republiken wären, gäbe es keinen (Angriffs-)Krieg mehr“ (Schattenmann, Marc: Wohlgeordnete Welt. Immanuel Kants politische Philosophie in ihren systematischen Grundzügen, München 2006, S. 229). 508 Streit: VII, 90f. (meine Hervorhebung) 509 Streit: VII, 90f. - 92 - ist jedoch allein keine Garantie für den Frieden. Mit Kants eigenen Worten könnte man sagen, dass es a priori in der Vernunftidee des Naturzustandes liegt, dass bevor ein öffentlich gesetzlicher Zustand errichtet worden ist, kein Staat (gäbe es auch nur Republiken) niemals vor den Gewalttätigkeiten eines anderen sicher sein könnte.510 Bei der republikanischen Verfassung handelt es sich somit um eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung des Friedens. Grundsätzlich verhält es sich in einem despotischen Staat anders, das will heißen in einem Staat, in welchem ein Einzelner regiert. Da das Staatsoberhaupt als Staatsbesitzer von den Lasten des Krieges nicht direkt betroffen wäre, zeigt er nicht dieselbe Kriegsabneigung wie die Staatsbürger. In einem despotischen Staat ist die Kriegserklärung „die unbedenklichste Sache von der Welt […], weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigenthümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten u. d. gl. durch den Krieg nicht das Mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen […] kann“.511 Kant zufolge ist es somit zu erwarten, dass despotisch verfasste Staaten häufiger Kriege führen werden, als republikanisch verfasste Staaten. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass Kriege ihren Ursprung letztlich in der Fürstenwillkür haben.512 Kant argumentiert hier völlig pragmatisch. Die Kriegsaversion der Staatsbürger beruht nicht auf moralischen Vorgaben, sondern auf rationalen Kosten-Nutzen-Kalkülen. Die mit dem Krieg einhergehenden Kosten führen dazu, dass die Staatsbürger nicht gewillt sein können einem so unsicheren Unternehmen wie dem Krieg zuzustimmen. Genauso wie republikanisch verfasste Staaten Angriffskriege aufgrund des oben genannten rationalen Kosten-Nutzen-Kalküls der Staatsbürger unterlassen werden, tragen sie allerdings zugleich zur größeren Bereitschaft der Staatsbürger bei, ihr Land gegen Angriffe zu verteidigen.513 Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Frieden allein schon durch das „aufgeklärte Selbstinteresse“514 der Bürger zu erwarten ist. In Kants eigenen Worten heißt es: „[S]o sehen sich Staaten (freilich nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den edlen Frieden zu befördern“.515 Abschließend zu diesem Teil ist auf die Unzulänglichkeit vieler vornehmlich sozialund politikwissenschaftlicher Beiträge zu verweisen, welche Kants Rechtsphilosophie vom Weltfrieden auf die Demokratiefrage reduzieren und das Zustandekommen des Weltfriedens aus der - gegebenenfalls militärisch erzwungenen - Verbreitung republikanischer Herrschaftsform erwarten. Gegen eine derartige These lassen sich aus Kantischer Sicht drei Einwände geltend machen. Erstens: In Kants staatsrechtlichem Gedanken steht die Idee der staatlichen Souveränität im Mittelpunkt. Im Zusammenhang mit dem fünften Präliminarartikel wurde gezeigt, dass es für Kant keine gewaltsame Intervention in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates geben darf. Zweitens: Wie bereits angeführt wurde, ist eine republikanische Verfassung keine Garantie für den Frieden, sondern verringert die Wahrscheinlichkeit des Kriegsausbruches. 510 Vgl. RL: VI, 312 Frieden: VIII, 351; Vgl. Gemeinspruch: VIII, 311; RL: VI, 345 512 Eine weitere von Kant identifizierte Kriegsursache liegt, wie bereits gezeigt wurde, im Sicherheitsdilemma. 513 Im Streit der Fakultät schreibt Kant diesbezüglich: „Durch Geldbelohnungen konnten die Gegner der Revolutionirenden zu dem Eifer und der Seelengröße nicht gespannt werden, den der bloße Rechtsbegriff in ihnen hervorbrachte, und selbst der Ehrbegriff des alten kriegerischen Adels […] verschwand vor den Waffen derer, welche das Recht des Volks, wozu sie gehörten, ins Auge gefaßt hatten“ (Streit: VII, 86). 514 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 214. 515 Frieden: VIII, 368 (meine Hervorhebungen) 511 - 93 - Drittens: Die Reduzierung der Kantischen Rechtsphilosophie vom Weltfrieden auf die Demokratiefrage übersieht die Systematik der Friedensschrift. Für Kant kann Frieden erst in der Einheit von Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht wahrhaft gegeben sein. Selbst wenn alle Staaten eine republikanische Verfassung hätten, würde dies noch keine ausreichende Garantie für den Frieden sein, weil diese republikanischen Staaten sich weiterhin im rechtlosen zwischenstaatlichen Naturzustand befinden würden. Dieser Zustand ist ein Zustand permanenter Unsicherheit und Strittigkeit des Rechts und somit ein Zustand des Krieges (nämlich unabhängig von der inneren Verfasstheit der Staaten). Aus diesem Grund bedarf es als weitere Bedingungen der Möglichkeit des Friedens notwendigerweise einer völkerrechtlichen Regelung. c) Herrschaftsform und Regierungsart Im Fortgang des ersten Definitivartikels zum ewigen Frieden führt Kant zwei weitere Bestimmungen ein, nämlich die Herrschaftsform und die Regierungsart, ohne diese miteinander sowie diese mit den zuvor angeführten apriorischen Prinzipen der republikanischen Verfassung in einen systematischen Zusammenhang zu bringen. Festzuhalten ist, dass Kants Konzeption der Republik neben den vernunftrechtlichen Komponenten, also den zuvor angeführten apriorischen Prinzipien der republikanischen Verfassung, auch eine empirisch-institutionalistische Komponente enthält. Diese bleibt allerdings ziemlich undeutlich, da Kant seiner Verfassungslehre eine äußerst gedrängte Fassung gibt und viele Gesichtspunkte zu wenig spezifiziert.516 Kant unterscheidet zwischen „Form der Beherrschung (forma imperii)“ und „Form der Regierung (forma regiminis)“.517 In einer etwas modernisierten Formulierung würde man von Herrschaftsform und Regierungsart sprechen. Es wird sich nun zeigen, dass Kants Verfassungslehre quantitative und qualitative Einteilungskriterien kombiniert. Die Herrschaftsformen werden nämlich „nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberste Staatsgewalt inne haben“518 in Autokratie (Herrschaft von einem), Aristokratie (Herrschaft von einigen) und Demokratie (Herrschaft von allen) eingeteilt. Die Regierungsart wiederum wird, je nachdem, ob sie der Idee des allgemeinen Vertrages gemäß ist oder nicht, in republikanisch oder despotisch eingeteilt. Für Kant ist nicht die Zahl der Personen, welche die Staatsgewalt ausüben, entscheidend. Die republikanische Regierungsart verlangt nach keiner besonderen Herrschaftsform. In den Vorarbeiten zur Friedensschrift schreibt Kant, dass in „allen drey Staatsformen […] die Regierungsform republicanisch seyn“519 kann. Ferner im Text heißt es, dass der Unterschied der Herrschaftsform „in Ansehung des Zwecks der gesetzlichen Verfassung nicht wesentlich ist“.520 Die These, dass die republikanische Regierungsart prinzipiell bei allen Herrschaftsformen möglich ist, ist zuletzt auch mit aller wünschenswerten Deutlichkeit in der folgenden Reflexion zu finden: „Ein absoluter Monarch kann doch auf republicanische Art regieren, ohne in seiner Stärke einzubüßen“.521 Es kann somit Wolfgang Kersting zugestimmt werden, wenn er schreibt, dass Kant die quantitative Trichotomie der Herrschaftsformen wertindifferent auffasst.522 Dementsprechend ist dem Volk „an der 516 Vgl. Kersting, Wolfgang: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 103. 517 Frieden: VIII, 352; Vgl. Vorarbeit: XXIII, 165 518 Frieden: VIII, 352 519 Vorarbeit: XXIII, 159 520 Vorarbeit: XXIII, 161f. 521 Reflexion 8077: XIX, 610 522 Vgl. Kersting, Wolfgang: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 99; Vgl. Cavallar, - 94 - Regierungsart […] ohne alle Vergleichung mehr gelegen, als an der Staatsform“.523 Dies hat allerdings nicht zu bedeuten, dass die Herrschaftsform (als Mittel) ohne Bedeutung für die republikanische Regierungsart (als Zweck) ist. Kant führt aus, dass sowohl die Autokratie als auch die Aristokratie republikanisch regiert sein können, fügt jedoch hinzu, dass die Demokratie notwendigerweise auf den Despotismus hinaus läuft. In Kants eigenen Worten heißt es: „Unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie, im eigentlichen Verstande des Worts, nothwendig ein Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt), mithin Alle, die doch nicht Alle sind, beschließen; welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist“.524 Wichtig ist hier zu sehen, dass Kant die Demokratie im etymologischen Sinne des Wortes als die direkte Herrschaft aller Bürger im Staat über sich selbst ohne Gewaltenteilung versteht. In den Vorarbeiten zur Friedensschrift definiert Kant die Demokratie ganz in diesem Sinne als die „nichtrepräsentative Volksmacht“.525 Kant lehnt die Demokratie als despotisch ab, weil in ihr Gesetzgeber (Legislative) und Vollstrecker der Gesetze (Exekutive) zusammenfallen. Unter einer derartigen Verfassung wäre die Möglichkeit stets gegeben, dass sich die Masse gegen den Willen Einzelner richtet und diese schlicht überstimmt, was aber ein Widerspruch des allgemeinen Willens (verstanden als der Wille aller) wäre. Kant lehnt also nicht das Prinzip der Volksherrschaft als solche ab, sondern lediglich die besondere Gestaltung dieser Herrschaft. In den Vorarbeiten zum ewigen Frieden bezeichnet Kant diese besondere Gestaltung der Volksherrschaft als die „bloße Demokratie“.526 Die Pointe der Unterscheidung von Herrschaftsform und Regierungsart liegt darin, dass auch Autokratien und Aristokratien „dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart“527 annehmen können. Im Streit der Fakultäten bestätigt Kant seine frühere Ansicht, wenn er schreibt, dass auch Autokratien (und Aristokratien) „republicanisch, d. h. im Geiste des Republicanism und nach einer Analogie mitdemselben regieren [können]“.528 Wenn bei Kant zu lesen, dass die Staatsoberhäupter „autokratisch herrschen und dabei doch republicanisch regieren“529 können, wird kein Verzicht auf das angestrebte Ziel, mithin die Schaffung einer „wahre[n] Republik“ (respublica noumenon), impliziert. Zur Regierung im Geist des ursprünglichen Vertrags gehört die „Verbindlichkeit der constituirenden Gewalt, die Regierungsart [ihr] angemessen zu machen und so sie, wenn es nicht auf einmal geschehen kann, allmählich und continuirlich dahin zu verändern, dass sie mit der einzig rechtsmässigen Verfassung, nämlich der einer reinen Republik, ihrer Wirkung nach zusammenstimme“.530 Die autokratisch und aristokratisch verfassten Staaten sollen sich also durch langsame und unablässige Reformen allmählich einer republikanischen Verfassung annähern. Zu Recht schreibt Wolfgang Kersting: „Nicht auf die Ablösung der überkommenen Herrschaftsformen ist Kants vernunftrechtlicher Konstitutionalismus aus, sondern auf deren innere Verwandlung durch Republikanisierung“.531 Dies hat wiederum zu bedeuten, dass die friedensfördernde Wirkungen der republikanischen Verfassung nicht von einer bestimmten Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 143. 523 Frieden: VIII, 353 524 Frieden: VIII, 352 525 Vorarbeit: XXIII, 161 526 Vorarbeit: XXIII,166 (meine Hervorhebung) 527 Frieden: VIII, 352 528 Streit: VII, 87 529 Streit: VII, 87 530 RL: VI, 340 531 Kersting, Wolfgang: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 104. - 95 - Herrschaftsform abhängt. Der Weg zum ewigen Frieden beginnt nicht erst dann, wenn alle Staaten tatsächlich über eine republikanische Verfassung verfügen. Der erste Schritt auf diesem Weg wäre schon, dass die Staaten zumindest wie Republiken regiert werden.532 Was das Verhältnis der Staaten zueinander betrifft, so könnte dies bereits eine Entschärfung des Sicherheitsdilemmas bewirken. Die republikanische Verfassung zeichnet sich durch drei verbindliche Merkmale aus: Die Gewaltenteilung, die Souveränität des Volkes und die Repräsentation des allgemeinen Volkswillens. Die Gewaltenteilung ist eine notwendige Bedingung einer republikanischen Verfassung. Entsprechend definiert Kant der Republikanismus als „das Staatsprincip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden“.533 In der Friedensschrift betont Kant, dass die Exekutive von der Legislative strikt getrennt sein muss. Diese Auffassung präzisierend schreibt Kant in der Rechtslehre, dass jeder Staat insgesamt drei Gewalten enthält. Der allgemeine vereinigte Volkswille kommt „in dreifacher Person (trias politica)“534, mithin in drei spezifischen Staatsgewalten zum Ausdruck. Zu der Legislativen (Kant schreibt: „Herrschergewalt (Souveränität)“535) als gesetzgebende Gewalt in der Person des Gesetzgebers und der Exekutiven als die vollziehende Gewalt in der Person des Regierenden kommt nun die Judikative als rechtsprechende Gewalt in der Person des Richters hinzu.536 In einer republikanischen Verfassung sind Legislative, Exekutive und Judikative strikt getrennt. Hier stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die drei Gewalten zueinander stehen. Kants Gedankengang bei der Beantwortung dieser Frage lässt sich in zwei Schritten nachvollziehen Erstens: Kant schreibt, dass alle drei Gewalten im Staat einander „beigeordnet“537 sind und sich zur Vollständigkeit der Staatsverfassung ergänzen. Jede Gewalt hat eine spezifische und komplementäre Funktion im Staat zu erfüllen. Dies bedeutet wiederum, dass die drei Staatsgewalten nicht ineinander aufgehen dürfen. Erst beim Nebeneinanderbestehen dieser drei Staatsgewalten kann vom Staat, also vom bürgerlichen Zustand im strengen Sinn gesprochen werden. Zweitens: Alle drei Gewalten sind aber auch einander „untergeordnet“, was zur Folge hat, dass „eine nicht zugleich die Function der anderen, der sie zur Hand geht, usurpiren kann“.538 Zwar haben alle drei Gewalten „ihr eigenes Princip“539, aber die vollziehende und rechtssprechende Gewalt sind der gesetzgebenden Gewalt untergeordnet, insofern dem Willen der zwei ersteren durch den Willen der letzteren bedingt ist. Sowohl die vollziehende Gewalt als auch die rechtssprechende sind an die Gesetze verbindlich gebunden, welche ihr von der oberen Staatsgewalt gegeben sind. Erst wenn die Staatsgewalten sowohl einander beigeordnet als auch untergeordnet sind wird „jedem Unterthanen sein Recht“540 erteilt. In Abgrenzung dazu zeichnet sich der Despotismus dadurch aus, dass der Exekutive zugleich die rechtssprechende und/oder gesetzgebende Gewalt zukommt. Eine solche Verfassung würde nach dem despotischen Prinzip handeln, der „eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst 532 Vgl. Langer, Claudia: Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Stuttgart 1986, S. 118f. 533 Frieden: VIII, 352 534 RL: VI, 313 535 Frieden: VIII, 352 536 Vgl. RL: VI, 313 537 Vgl. RL: VI, 313 538 RL: VI, 316 539 RL: VI, 316 540 RL: VI, 316 - 96 - gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird“.541 Nun soll auf das zweite Merkmal der republikanischen Verfassung kurz eingegangen werden. Gemeint ist die Volkssouveränität. Es wurde bereits gesehen, dass die gesetzgebende Gewalt (der Idee nach) nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen kann.542 Nach dem heutigen Sprachgebrauch würde man sagen, dass die Souveränität im Volkswillen gegründet ist. Unter dieser Bedingung werden (der Idee nach) notwendigerweise gerechte Gesetze verabschiedet. Weil die gesetzgebende Gewalt vom vereinigten Volkswillen ausgeübt wird, kann diese „schlechterdings niemand unrecht thun“.543 Kant benennt hierfür den folgenden Grund: „Nun ist es, wenn jemand etwas gegen einen Anderen verfügt, immer möglich, daß er ihm dadurch unrecht thue, nie aber in dem, was er über sich selbst beschließt (denn volenti non fit iniuria). Also kann nur der übereinstimmende und vereinigte Wille Aller, so fern ein jeder über Alle und Alle über einen jeden ebendasselbe beschließen, mithin nur der allgemein vereinigte Volkswille gesetzgebend sein“.544 In einer republikanischen Verfassung wirken alle (aktiven) Staatsbürger gleichermaßen an der Gesetzgebung mit und sind zudem gleichermaßen von dieser abhängig. Daraus folgt, dass alles, was jeder über die anderen beschließt, zugleich über sich selbst beschließt. Nach dem Prinzip volenti non fit iniuria kann eine Entscheidung nicht ungerecht sein, zu welcher die von ihr Betroffenen freiwillig ihre Zustimmung gegeben haben. Aus diesem Grunde müssen die Gesetze einer republikanischen Verfassung notwendigerweise gerecht sein.545 Von den drei Gewalten schreibt Kant, sie seien „Würden“ und „als wesentliche aus der Idee eines Staats überhaupt zur Gründung desselben (Constitution) nothwendig hervorgehend, Staatswürden“.546 Die Würde des Gesetzgebers besteht darin, dass sein Willen „untadelig (irreprehensibel)“547 ist. Diese Untadeligkeit bezieht sich lediglich auf die Legislative, und erstreckt sich keinesfalls auch auf die Exekutive und Judikative. Die vollziehende und rechtsprechende Gewalt stehen unter den ihnen von der Legislative vorgegebenen Gesetzen und sind verbunden danach zu handeln, das heißt sie sollen jene Gesetze auf die Erfahrungsfälle anwenden. Dabei verfügen sie in ihrer Ausübung „etwas gegen einen Anderen“, so dass es „immer möglich ist“, dass sie diesem Anderen unrecht tun.548 Die 541 Frieden: VIII, 352 Vgl. RL: VI, 313 543 RL: VI, 313 544 RL: VI, 313 f. 545 Wolfgang Kersting hebt hervor, dass Kant einen „prozeduralen Gerechtigkeitsbegriff“ lehrt. Im Anschluss daran schreibt er: „Nicht die Übereinstimmung mit materialen Gerechtigkeitsnormen qualifiziert ein Gesetz als gerechtes, sondern die Art und Weise seiner Entstehung: Die Gerechtigkeit eines Gesetzes wird durch das Verfahren seiner Genese garantiert“ (Kersting, Wolfgang: Kant über Recht, Paderborn 2004, S. 133). Dies würde sicherlich der Fall sein, wenn die Menschen immer von sich aus vernünftig handeln würden. Dies ist aber empirisch nicht zu erwarten. Wenn die Souveränität im Volkswillen gegründet ist, dann werden der Idee nach gerechte Gesetze verabschiedet. Dies hat allerdings nicht zu bedeuten, dass alle verabschiedeten Gesetze dann auch tatsächlich gerecht sind. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das Vernunftrecht die „unwandelbaren Principien“ (RL: VI, 229) gibt, nach dessen Muster das „positive (statutarische) Recht“, mithin „was aus dem Willen eines Gesetzgebers hervorgeht“ (RL: VI, 237) sich orientieren soll. Nur wenn das positive Recht in Übereinstimmung mit dem Vernunftrecht steht, kann wahrhaft von Recht gesprochen werden. Wenn das positive Recht gegen das Vernunftrecht verstößt, kann er nicht als Recht betrachtet werden. Es ist daher Georg Geismann zuzustimmen, wenn er schreibt, dass „[n]icht die demokratische Genese, sondern allein die Form der Tauglichkeit zu einem allgemeinen Gesetz für die Einschränkung der äußeren Freiheit von jedermann und also die Übereinstimmung mit der Idee des allgemeinen Willens […] die Rechtmäßigkeit eines positiven Gesetzes [garantier]“ (Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 122). 546 RL: VI, 315 547 RL: VI, 316 548 Vgl. Reflexion 7725: XIX, 500; 7781: XIX, 515; 7791: XIX, 518; 7941: XIX, 561 542 - 97 - Exekutive und die Judikative sind genötigt, dem Gesetz gemäß zu urteilen, so dass sie unrecht tun können. Die Würde der vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt besteht somit nicht in der Untadeligkeit, sondern im Falle der Exekutive in der Unwiderstehlichkeit des Ausführungsvermögens des Oberbefehlshabers (summi rectoris) und im Falle der Judikative in der Unabänderlichkeit des Rechtsspruchs des obersten Richters (supremi iudicis).549 Da die gesetzgebende Gewalt dem vereinigten Willen des Volks zukommt, kann sie gar keine physische Person, sondern nur eine moralische Person (das vereinigte Volk selbst) sein. Aber auch die beiden anderen Gewalten können nicht einer einzelnen physischen Person zukommen, wenn sie ihre je eigene Funktion erfüllen sollen. Weil die vollziehende und die rechtssprechende Gewalt unter den Gesetzen stehen, dürfen der Regierer und der Richter nicht mit dem Gesetzgeber ein und dieselbe Person sein. Die drei Gewalten können nicht in einer und derselben physischen Person vereinigt gedacht werden. Diese Gewalten sollen also drei verschiedenen moralischen Personen zukommen. Diese Forderung bestätigt, was den Leser bereits aus der Religionsschrift bekannt war, nämlich dass die dreifache Qualität des Oberhaupts „in einem juridisch-bürgerlichen Staate nothwendig unter drei verschiedenen Subjecten verteheilt sein müßte“.550 Kurzum: Die drei Gewalten sollen jeweils voneinander getrennt sein. Das dritte Merkmal der republikanischen Verfassung ist die Repräsentation des allgemeinen Volkswillens. Die drei Gewalten im Staat, in denen der allgemein vereinigte Volkswille zum Ausdruck kommt, sind „eine reine Idee von einem Staatsoberhaupt, welche objective praktische Realität hat“.551 Ferner im Text heißt es, dass dieses Staatsoberhaupt (der Souverän) „ein (das gesamte Volk vorstellendes) Gedankending“552 ist. Um dieser Idee des vereinigten Volks Wirklichkeit zu verschaffen, bedarf es einer physischen Person, welche die „höchste Staatsgewalt vorstellt“.553 Nachdem die apriorischen Prinzipien der republikanischen Verfassung bestimmt wurden, geht es nun um dessen empirische Konkretisierung. Es wurde bereits gesehen, dass je nach der Zahl der physischen Personen, welche die oberste Staatsgewalt haben, die Staatsform autokratisch, aristokratisch oder demokratisch ist. Hinzu kommt, dass je nach der Art und Weise, „wie der Staat von seiner Machtvolkommenheit Gebrauch macht“554, d. i. der Freiheit und Gleichheit angemessen handelt, ergibt sich eine republikanische oder eine despotische Regierung. Für Kant ist die republikanische Verfassung notwendigerweise als repräsentatives System konstituiert. Was Kant unter dem Begriff der Repräsentation versteht, ist allerdings nicht immer leicht zu verstehen und bedarf einer kurzen Erläuterung.555 Ein „repräsentatives System“556 bezeichnet ein System, in welchem der allgemein vereinigte Wille in jeder Art von Ausübung staatlicher Gewalt repräsentiert wird. Bereits hier lässt sich feststellen, dass sich bei Kant die Begriffe der Republik und der Repräsentation aufeinander beziehen. In der Rechtslehre schreibt Kant diesbezüglich: „Alle wahre Republik aber ist und kann nichts anders sein als ein repräsentatives System des Volks, um im Namen desselben, durch alle Staatsbürger vereinigt […] ihre Rechte zu besorgen“.557 Kants zufolge kann man nämlich nur dann von einem repräsentativen System sprechen, wenn die Regierungsart republikanisch ist, das heißt wenn sie „auf dem Geist des allgemeinen Volkswillen“ und nicht auf „irgend einem 549 Vgl. RL: VI, 316 Religion: VI, 140 551 RL: VI, 338 552 RL: VI, 338 553 RL: VI, 338 554 Frieden: VIII, 352 555 Einen erhellenden Beitrag hierzu findet man bei: Joung, Ho-Won: Volkssouveränität, Repräsentation und Republik: Eine Studie zur politischen Philosophie Immanuel Kants, Würzburg 2006. 556 Vgl. Frieden: VIII, 352f.; 166; RL: VI, 341; Vorarbeit: XXIII, 161 557 RL: VI, 341 550 - 98 - Privatwillen gegründet ist“.558 Der Begriff der Repräsentation, wie jener der Republik, bezieht sich somit auf den Gegensatz von Privatwillkür und Volkswillen.559 In der Republik als repräsentativem System gründet die Herrschaft im allgemein vereinigten Volkswillen. Das Staatsoberhaupt kann „nur durch den Gesammtwillen des Volks über das Volk, aber nicht über den Gesamtwillen selbst, der der Urgrund aller öffentlichen Verträge ist, disponiren“.560 Gerade das Gegenteil gilt in Bezug auf den Despotismus. Es kann aber auch festgehalten werden, dass Kants Begriff der Repräsentation unmittelbar auf den Begriff der Gewaltenteilung hinweist. So heißt es in der Friedensschrift: „Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens […] sein kann“.561 Einzig eine repräsentative Verfassung mit Gewaltenteilung bietet nämlich Schutz davor, dass die Mehrheit sich gegen den Willen Einzelner richtet und diese schlicht überstimmt. Nur die repräsentative Verfassung mit Gewaltenteilung sichert die Freiheit der Menschen und ihre Gleichheit als Staatsbürger vor dem Recht. Entscheidend ist somit nicht die Frage, ob das Volk die Herrschaft direkt oder indirekt ausübt. Wichtig ist erstens, dass das Volk überhaupt gesetzgebend ist (sei es direkt, wie etwa für Entscheidungen über Krieg und Frieden562, oder indirekt vermittelt durch seine Repräsentanten) und zweitens, dass die Exekutive an den Willen des Volks gebunden ist, indem sie von der Legislativen (vom Volks selbst gewählt oder ihm repräsentierend) bestellt wird und von ihr entlassen werden kann.563 Zusammenfassend zu diesem Teil kann gesagt werden, dass eine angemessene Verwirklichung der apriorischen Prinzipien der republikanischen Verfassung sich in einer Demokratie mit Repräsentationssystem und Gewaltenteilung findet. In den Vorarbeiten zum ewigen Frieden spricht Kant seinerseits von einer „demokratische[n] Verfassung in einem repräsentativen System“.564 Kant fordert somit eine repräsentative Herrschaftsform mit strikter Trennung von Exekutive und Legislative. Die genaue Gestaltung der Republik sowie ihrer verschiedenen Institutionen bleibt bei Kant für individuelle Unterschiede weitgehend offen. Gemeint sind hier zum Beispiel die Fragen des Wahlsystems und der Kompetenzverteilung. Kant räumt somit dem Politiker bei der genauen Institutionalisierung der Republik einen erheblichen Freiraum ein. Die Konzentration der Kantischen Staatslehre auf die Grundprinzipien ist insofern konsequent, als sie versichert, dass sich die Vernunftprinzipien auf die Vielzahl der empirischen (also geographischen sowie historischen und damit auch kulturellen) Bedingungen anwenden lassen. Wenn man die prinzipientheoretisch nicht zu rechtfertigende Einteilung in aktive und passive Staatsbürger beiseitelässt565, so zeigt sich, dass Kants Konzeption weitgehend jener der modernen Demokratie entspricht. d) Kants Theorem im Lichte der zeitgenössischen Theorien des demokratischen Friedens Auf die Frage, ob republikanisch verfasste Staaten tatsächlich friedfertiger sind als autokratisch verfasste Staaten, soll heute eine differenzierte Antwort gegeben werden. Die zahlreichen historisch-statistischen Untersuchungen kommen nämlich zu einem spannungsreichen Doppelbefund. Auf der Analyseebene der Interaktion zwischen zwei 558 Vorarbeit: XXIII, 161 Vgl. Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 148. 560 RL: VI, 342 561 Frieden: VIII, 352 562 Siehe: Gemeinspruch: VIII, 311; Frieden: VIII, 351; Streit: VII, 90; Reflexion 8077: XXIII, 606f. 563 Vgl. RL: VI, 317; Vorarbeit: XXIII, 433; Reflexion 7971 und 7972: XIX, 567; Reflexion 8046: XIX, 591 564 Vorarbeit: XXIII, 166 565 Dies hat Kersting überzeugend bewiesen: Vgl. Kersting, Wolfgang: Kant über Recht, Paderborn 2004, S. 133. 559 - 99 - Staaten (dyadische Analyseebene) kommen diese Studien zu dem robusten Ergebnis, dass Demokratien seit 1816 fast keine Kriege mehr gegeneinander geführt haben. Sie haben einen sogenannten „Separatfrieden“ (separate peace) geschlossen. Auf der Analyseebene des Außenverhaltens der einzelnen Staaten (monadische Analyseebene) kommen wiederum die meisten Untersuchungen zu dem viel diskutierten Ergebnis, dass demokratisch verfasste Staaten nicht per se friedfertiger als nicht-demokratisch verfasste Staaten sind. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass demokratisch verfassten Staaten ähnlich häufig in militärische Kriege verwickelt sind wie nicht-demokratisch verfasste Staaten, und außerdem spezifische Formen militärischer Interventionen entwickelt haben. Letztlich widersprechen die empirischen Befunde auf der systemischen Analyseebene, das heißt auf der Ebene des internationalen Staatensystems, der ursprünglichen Hoffnung, dass je mehr Demokratien es im internationalen System gibt, desto friedlicher die internationalen Beziehungen sein werden. Es zeigt sich dagegen, dass die Anzahl von Demokratien im internationalen System keinen signifikanten Einfluss auf die Gewalttätigkeit der internationalen Beziehungen hat, und dass Regimewandel sogar die Konfliktneigung im internationalen System kurzfristig erhöht. Über Kants Begründung der tendenziellen Friedfertigkeit der Demokratien aus den Nutzenerwägungen der Staatsbürger hinausgehend liegen heute mehrere Erklärungsansätze vor, die das Außenverhalten der Demokratien auf die monadische und dyadische Analyseebene anhand von weitgehend ähnlichen Argumenten zu erklären versuchen. Gemeint sind hier zum Beispiel die normativen Einstellungen der Staatsbürger und ihre Präferenz für gewaltfreie Konfliktlösungen, die gewalthemmende Wirkung zwischendemokratischer Institutionen, die Schwerfälligkeit und Transparenz der demokratischen Entscheidungsprozesse oder die Einbettung in internationale Interdependenzstrukturen. Ohne sich diesen verschiedenen Ansätzen länger widmen zu wollen, muss jedoch festgehalten werden, dass in der umfangreichen politikwissenschaftlichen Debatte zur Theorie des demokratischen Friedens es heute immer noch weitgehend offen bleibt, warum die Demokratien in Verhältnis zueinander sich friedlich verhalten, während sie sich gegenüber nicht-demokratisch verfassten Staaten anders verhalten. Mit anderen Worten: Aus welchen Kausalmechanismen kann der Frieden zwischen Demokratien erklärt werden, wenn sie gegenüber Autokratien nicht funktionieren? Ein möglicher Ausweg aus dieser Schwierigkeit wurde von Harald Müller gezeigt. Er argumentiert überzeugend, dass die bisherigen Theorien des demokratischen Friedens (in ihren verschiedenen Varianten) unterspezifiziert sind, weil ein und dieselbe identifizierte erklärende Variable des demokratischen Außenverhaltens häufig sowohl kriegsfördernd als auch kriegshemmend wirksam sein kann.566 Im Rahmen der vorliegenden Dissertation kann nicht näher auf diesen Erklärungsansatz sowie auf die daraus folgende Debatte näher eingegangen werden. Interessant ist für uns lediglich die Frage, ob Kants These der tendenziellen Friedfertigkeit demokratisch verfasster Staaten überhaupt noch haltbar ist. Diesbezüglich ist zunächst auf eine methodologische Schwierigkeit hinzuweisen. Es ist nämlich fraglich, ob und inwiefern man problemlos Kants apriorischen Entwurf der republikanischen Verfassung mit den empirischen Verfassungen in den einzelnen Staaten identifizieren kann.567 Abgesehen von diesem methodologischen Problem muss eingesehen 566 Vgl. Müller, Harald: Demokratien im Krieg – Antinomien des demokratischen Friedens, in: Demokratien im Krieg, hrsg. v. Christine Schweitzer, Björn Aust und Peter Schlotter, Baden-Baden, S. 35-52. Siehe ebenfalls: Geis, Anna/Müller, Harald/Wagner, Wolfgang (Hrsg.): Schattenseiten des Demokratischen Friedens. Zur Kritik einer Theorie liberaler Außen- und Sicherheitspolitik, Frankfurt a. M. 2007. 567 Vgl. Cavallar, Georg: Kantian perspectives on democratic peace: alternatives to Doyle, in: Review of International Studies 27, 2011, S. 229-248; Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 196; Thiele, Ulrich: Demokratischer Pazifismus. Aktuelle - 100 - werden, dass das Argument bezüglich der Kosten des Krieges ambivalent ist. Gute Gründe sprechen zum Beispiel dafür, dass die gegenwärtige (Re-)Privatisierung von Sicherheit und die sogenannte Revolution der militärischen Angelegenheiten (revolution of military affairs) in der öffentlichen Wahrnehmung wohlhabender Demokratien zu einer veränderten Einschätzung der Kosten und Gewinne des Krieges führen: Ein leicht zu gewinnender und wahrscheinlich sehr kurzer Krieg kann Zustimmung seitens der Staatsbürger finden. Kants Begründung der Kriegsabneigung der Demokratien aus den Kosten des Krieges für die Staatsbürger kann also nur begrenzt überzeugen. Es kann allerdings argumentiert werden, dass Kant die Möglichkeit einer bürgerlichen Zustimmung für den Krieg eingesehen hat, insofern er ausdrücklich betont, dass die Republiken nur tendenziell kriegsabgeneigt sind. Aus heutiger politikwissenschaftlicher Sicht liefert noch keine Theorie eine deutliche Antwort auf die Frage, warum Demokratien aufgrund der Kosten des Krieges keine Kriege gegeneinander führen. Sollten Demokratien wirklich Kosten und Gewinne für ihre Teilnahme an einem Krieg abwägen, würde dies bedeuten, dass bei einer ausreichenden Reduzierung der Kosten, ein Krieg zwischen Demokratien denkbar wäre. Die Grundfrage, welche sich vor diesem Hintergrund aufdrängt ist jene, ob das Kosten-Argument ausreicht, um das friedliche Verhältnis der Staaten untereinander zu erklären, oder ob andere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Anders formuliert: Wenn die demokratische Verfassung des Staates (aufgrund des Kosten-Arguments) notwendig, jedoch nicht hinreichend für ein friedliches Außenverhalten ist, dann stellt sich die Frage, welche andere Faktoren hierfür verantwortlich sind. Um solche Fragen zu beantworten, kann Kants Argumentation im zweiten Definitivartikel der Friedensschrift richtungsweisend sein. 2.2 Zweiter Definitivartikel: Das Recht der Staaten im Verhältnis zueinander Die Errichtung einer republikanischen Verfassung in den einzelnen Staaten stellt noch keine Garantie für den Frieden zwischen ihnen dar. Die Überwindung des zwischenstaatlichen Naturzustandes bedarf darüber hinaus der Stiftung einer Rechtsordnung zwischen den Staaten. Es geht also hier um das Problem der Errichtung „eines gesetzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses“.568 Die Forderung des zweiten Definitivartikels lautet entsprechend: „Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein“.569 Im Folgenden soll versucht werden den Kerngehalt und die Begründung dieses Artikels systematisch darzustellen und zu erläutern. Dabei soll zugleich ausführlich auf die wichtigsten Schwierigkeiten und Kontroversen eingegangen werden, die in der Sekundärliteratur zu finden sind. Um Missverständnisse im weiteren Verlauf der Diskussion zu vermeiden und konzeptionelle Klarheit zu gewinnen, soll vorab zwei kurze terminologische Bemerkung gemacht werden. Erstens: Im Friedenstraktat verwendet Kant das Substantiv „Völker“ zumeist im Sinne von „Staaten“. Dieses Substantiv sowie seine Derivate „Völkerrecht“, „Völkerbund“ und „Völkerstaat“ beziehen sich somit keinesfalls auf ethnische, kulturelle oder sprachliche Menschengruppen, sondern ausschließlich auf staatlich organisierte Gemeinschaften. Dabei ist die Frage ohne Belang, ob diese Gemeinschaften ethnisch, kulturell oder sprachlich homogen sind. Kant ist sich dieser terminologischen Zweideutigkeit durchaus bewusst. Gleich zu Beginn des zweiten Definitivartikels weist er darauf hin, dass das Völkerrecht sich auf Interpretationen des ersten Definitivartikels der Kantischen Friedensschrift, in: Kant-Studien 99, 2008, S. 180199. 568 Idee: VIII, 24 569 Frieden: VIII, 354 - 101 - „Völker als Staaten“570 bezieht. Im § 53 der Rechtslehre schreibt er, dass der Terminus „Völkerrecht“ (der dem lateinischen ius gentium wörtlich entspricht) nicht ganz richtig sei, weil es dabei nicht um das Recht der Völker geht, sondern um jenes der Staaten im Verhältnis zueinander. Es wäre somit angemessener vom „Staatenrecht (ius publicum civitatum)“571 zu sprechen. Zweitens: Das Völkerrecht bestimmt die Bedingungen der Möglichkeit des friedlichen Zusammenlebens „freier Staaten“572, im Sinne von rechtlich voneinander unabhängigen Staaten, in notwendigem Verhältnis zueinander. Die Forderung des zweiten Definitivartikels ist also so zu verstehen: Das Völkerrecht soll auf einem „Föderalismus souveräner Staaten“ und nicht „auf einem Föderalismus republikanischer Staaten“ gegründet sein. Der Artikel fordert an keiner Stelle, dass die Staaten „Republiken“ im Sinne des ersten Definitivartikels sein sollen. Die Mitgliedschaft zum geforderten Föderalismus ist keinesfalls von einer besonderen Herrschaftsform abhängig. Sie ist nicht auf republikanisch verfasste Staaten beschränkt. a) Die Analogie zwischen einzelnen Menschen und Staaten Kants völkerrechtliche Überlegungen nehmen ihren Ausgangspunkt in einer Analogie zwischen den einzelnen Menschen und den Staaten. Dies lässt sich an drei Stellen festhalten. Im Gemeinspruch heißt es ausdrücklich, dass es zur Überwindung des Naturzustandes „kein anderes Mittel [gibt], als ein auf öffentliche mit Macht begleitete Gesetze, denen sich jeder Staat unterwerfen müßte, gegründetes Völkerrecht (nach der Analogie eines bürgerlichen oder Staatsrechts einzelner Menschen) möglich“.573 Das gleiche Argument findet sich dann in der Friedensschrift: „Für Staaten im Verhältnisse unter einander kann es nach der Vernunft keine andere Art geben, aus dem gesetzlosen Zustande, der lauter Krieg enthält, herauszukommen, als daß sie, eben so wie einzelne Menschen ihre wilde (gesetzlose) Freiheit aufgeben, sich zu öffentlichen Zwangsgesetzen bequemen und so einen (freilich immer wachsenden) Völkerstaat (civitas gentium), der zuletzt alle Völker der Erde befassen würde, bilden“.574 Zuletzt ist in der Rechtslehre folgendes zu lesen: „Da der Naturzustand der Völker, eben so wohl als einzelner Menschen, ein Zustand ist, aus dem man herausgehen soll, um in einen gesetzlichen zu treten: so ist, vor dieser Ereignis, alles Recht der Völker […] bloß provisorisch, und kann nur in einem allgemeinen Staatenverein (analogisch mit dem, wodurch ein Volk Staat wird) peremtorisch geltend und ein wahrer Friedenszustand werden“.575 Eine Analogie definiert Kant allgemein als eine quantitative oder qualitative Gleichheit von Verhältnissen. Analogie als ursprünglich mathematischer Terminus für bestimmte Zahlenverhältnisse bezeichnet in der Philosophie die Gleichheit von zwei qualitativen Verhältnissen. In der dritten Kritik definiert Kant die Analogie in qualitativer Bedeutung als „die Identität des Verhältnisses zwischen Gründen und Folgen (Ursachen und Wirkungen), sofern sie ungeachtet der specifischen Verschiedenheit der Dinge, oder derjenigen Eigenschaften an sich, welche den Grund von ähnlichen Folgen enthalten (d. i. außer diesem Verhältnisse betrachtet), Statt findet“.576 Wenn Kant von Analogie spricht, dann meint er also „nicht eine vollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge“, sondern „eine 570 Frieden: VIII, 354 RL: VI, 343 572 Vgl. Frieden: VIII, 354; RL: VI, 344 573 Gemeinspruch: VIII, 312 (meine Hervorhebung) 574 Frieden: VIII, 357 (meine Hervorhebung) 575 RL: VI, 350 (meine Hervorhebungen; die von Kant durch kursive Kennzeichnung hervorgehobenen Wörter wurden aufgehoben) 576 KUK: V, 464 571 - 102 - vollkommene Ähnlichkeit zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen“.577 Obwohl die einzelnen Menschen und die Staaten unterschiedlicher Natur sind, sind beide moralische Personen. Diese besondere Ähnlichkeit erlaubt es einem schließlich von Analogie zwischen einzelnen Menschen und Staaten zu sprechen. Was für die einzelnen Menschen gilt, gilt somit im Prinzip entsprechend auch für die Staaten. Kants Argumentation lässt in allen drei zuvor zitierten Textstellen nur wenig Interpretationsspielraum zu. Es wird deutlich, dass für Kant die Analogie zwischen den Menschen und den Staaten in zweierlei Hinsicht zutrifft, nämlich einmal im Hinblick auf den jeweils zu verlassenden Naturzustand und einmal im Hinblick auf den zu stiftenden bürgerlichen Zustand. Für Kant befinden sich ursprünglich sowohl die einzelnen Menschen als auch die Staaten im juridischen Naturzustand, mithin im „Zustand einer gesetzlosen äußeren (brutalen) Freiheit und Unabhängigkeit von Zwangsgesetzen“.578 In Abwesenheit einer öffentlichen Gesetzgebung und einer diese Gesetzgebung durchsetzenden Zwangsgewalt ist der Naturzustand der Menschen genau wie jener der Staaten ein Zustand beständiger und unauflösbarer Unsicherheit und damit Strittigkeit des Rechts. Es folgt somit als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft, dass die Staaten ebenso wie die Menschen den juridischen Naturzustand verlassen sollen, um in einen bürgerlichen Zustand einzutreten, in welchem jedermanns Recht nach einem allgemeinen Gesetz gleich gesichert wird.579 Analog zu den einzelnen Menschen haben somit die Staaten die Pflicht miteinander einen öffentlichen Rechtszustand zu stiften. Weil für die einzelnen Menschen und für die Staaten dasselbe Gebot der Vernunft gilt, lässt sich die Rechtsordnung zwischen den Staaten auf die gleiche Weise wie jene im Inneren der Staaten begründen. Die Wiederholung des ursprünglichen Vertrages auf Ebene der Staaten führt zu demselben Ergebnis. Wie der Naturzustand der Menschen durch die Stiftung des Staates (civitas) überwunden wird, so soll auch der Naturzustand der Staaten zueinander durch die Stiftung eines Völkerstaates (civitas gentium) überwunden werden. Es steht fest, dass Kant den Völkerstaat für die einzige rechtliche Möglichkeit ansieht, den zwischenstaatlichen Naturzustand zu überwinden und den Krieg endgültig zu verbannen. Vor diesem Hintergrund scheint Kants Schlussbetrachtungen im zweiten Definitivartikel besonders irritierend: „Da sie [die Staaten; F.R.] dieses [der Völkerstaat; F.R.] aber nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht wollen, mithin, was in thesi richtig ist, in hypothesi verwerfen, so kann an die Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik (wenn nicht alles verloren werden soll) nur das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden, und sich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtscheuenden, feindseligen Neigung aufhalten, doch mit beständiger Gefahr ihres Ausbruchs“.580 Diese 577 Prolegomena: IV, 357 Religion: VI, 97 579 Spätestens an dieser Stelle soll Jürgen Habermas widersprochen werden, wenn er schreibt, dass Kant die „Wünschbarkeit“ des Friedens „mit den Übeln jener Art von Krieg, den die Fürsten Europas damals mit Hilfe ihres Söldnerheere führten“ begründet (Vgl. Habermas, Jürgen: Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von zweihundert Jahren, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 8). Es geht nämlich bei Kant nicht um die pragmatische Wünschbarkeit der Friedensstiftung, sondern um ihre praktische Notwendigkeit. Dies hat wiederum zu bedeuten, dass das Ausmaß des Schreckens, die die jeweiligen historischen Kriege hinterlassen, den vernunftrechtlichen Beweis der Notwendigkeit aus dem Naturzustand herauszutreten schlechterdings unberührt lassen. Die Behauptung zum Beispiel, dass die moderne Kriegführung mehr Übel nach sich zieht als die Kabinettskriege des 17. und 18. Jahrhunderts mag den Frieden vielleicht heute noch wünschenswerter machen als je zuvor. Es ändert allerdings nichts an der Erkenntnis, dass heute wie zu Kants Zeiten die Staaten den rechtslosen Naturzustand verlassen und in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand eintreten sollen, weil einzig auf diesem Weg ihre angeborenen und erworbenen Rechte nach einem allgemeinen Gesetz gesichert werden können. 580 Frieden: VIII, 357 578 - 103 - Textstelle wird in der Sekundärliteratur nahezu einhellig für grundsätzlich ambivalent, inkonsistent oder sogar widersprüchlich gehalten.581 Sie wird zumeist so verstanden, als ob Kant dort behaupten würde, dass die Idee des Völkerstaates in der Theorie (in thesi) zwar richtig sei, jedoch für die politische Praxis (in hypothesi) nicht taugen würde. Es wird davon ausgegangen, dass Kant den vernunftnotwendigen Weltstaat ablehnt und aus pragmatischen Gründen (nämlich aufgrund des fehlenden Wollens der Staaten) für die Stiftung eines Friedensbundes plädiert. Kant habe sich, so verschiedene Kommentatoren, durch pragmatische Argumente von seinem Begründungszusammenhang abbringen lassen und übersehe gänzlich, dass aus seinen eigenen vernunftrechtlichen Prämissen die Stiftung eines mit Zwangsgewalt ausgestatteten Weltstaats notwendig folgen müsste.582 Auf den folgenden Seiten soll gezeigt werden, dass diese Auslegung nicht gänzlich überzeugt. In Anlehnung an die Arbeiten von Georg Geismann, Völker Gerhard und Pauline Kleingeld583 soll hier die These vertreten werden, dass Kant den Völkerbund und den Völkerstaat keinesfalls als sich gegenseitig ausschließende Alternativen begreift. Kants These ist weder „Völkerbund, nicht Weltrepublik“ noch „Weltrepublik, nicht Völkerbund“, sondern vielmehr „erst Völkerbund und dann Weltrepublik“. In äußerster Kürze kann Kants These folgendermaßen zusammengefasst werden: Da eine Beschränkung der einzelstaatlichen Souveränität mit Gewalt rechtlich nicht durchzusetzen ist, tritt an der Stelle des vernunftnotwendigen Völkerstaates („wenn nicht alles verloren werden soll“584) zunächst der Völkerbund als sein negatives Surrogats ein. Der Völkerbund ist bloß der vorläufige Ersatz der Idee eines Völkerstaates, welcher stets das angestrebte Ziel bleibt. Am Anfang des 581 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit siehe: Carson, Thomas: Perpetual Peace: What Kant Should Have Said, in: Social Theory and Practice 14, 1988, S. 173-214; Cheneval, Francis: Das Problem der supranationalen Zwangsgewalt am Beispiel Kants, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 83, 1997, S. 175-192; Habermas, Jürgen: Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von zweihundert Jahren, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 7-24; Höffe, Otfried: Völkerbund oder Weltrepublik?, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 109-132; Ders.: Fédération de peuples ou république universelle?, in: L’Année 1795: Kant, Essais sur la Paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 140-159; Kersting, Wolfgang: Globale Rechtsordnung oder weltweite Verteilungsgerechtigkeit? Über den systematischen Grundriß einer politischen Philosophie der internationalen Beziehungen; in: Politisches Denken. Jahrbuch 1995/96, S. 197-246; Lutz-Bachmann, Matthias: Kants Friedensidee und das rechtsphilosophische Konzept einer Republik, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 25-44; Seel, Gerhard: « Mais il y aurait là contradiction ». Une nouvelle lecture du deuxième article définitif, in: L’Année 1795: Kant, Essais sur la Paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 160-182. 582 Diese Interpretation wird selbst von einem Autor wie Wolfgang Kersting vertreten, wenn er schreibt, dass „der weltberühmte Experte der Furcht [gemeint ist Thomas Hobbes; F.R.] den Philosophen der unerschrockenen praktischen Vernunft so sehr eingeschüchtert [hat], dass dieser vor den Implikationen seiner allgemeinen Theorie zurückgescheut ist“ (Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 76). Andere Autoren haben sich dieser Interpretation angeschlossen. So schreibt zum Beispiel Marc Schattenmann, dass Kant „offenbar vor dem Gedanken einer Weltrepublik zurück[schreckt]“ (Schattenmann, Marc: Wohlgeordnete Welt. Immanuel Kants politische Philosophie in ihren systematischen Grundzügen, München 2006, S. 242). Gerhard Seel spricht seinerseits von einem „faule[n] Kompromiß zwischen Vernunftgebot und Menschenwille“ (Seel, Gerhard: Darin wäre aber ein Widerspruch. Der zweite Definitivartikel zum ewigen Frieden neu gelesen, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Bd. III, Würzburg 1997, S. 332). 583 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 210ff.; Ders.: World Peace: Rational Idea and Reality. On the Principles of Kant’s Political Philosophy, in: Kant. Analysen - Probleme - Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Würzburg 1996, S. 265-319; Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf ‚Zum ewigen Frieden’: eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 91-102; Kleingeld, Pauline: Kants Argumente für den Völkerbund, in: Recht-Geschichte-Religion. Kants Bedeutung für die Gegenwart, hrsg. v. Herta Nagl-Docakal und Rudolf Langthaler, Berlin 2004, S. 99-111. 584 Frieden: VIII, 357 - 104 - Rechtswegs zum Weltfrieden steht zunächst ein lockerer Völkerbund, während am Ende dieses Wegs die Weltrepublik steht. Dass Kant zunächst für die Stiftung eines Völkerbundes plädiert, ist nicht allein pragmatisch begründet, sondern ergibt sich aus Gründen, die im Rahmen seines rechtsphilosophischen Gedanken durchaus konsistent sind. Um dies zu zeigen, sollen die folgenden Erläuterungen weitgehend Kants Argumentationsweg in der Friedensschrift und in der Rechtslehre folgen. b) Der Begriff des Völkerstaates und die Voraussetzungen des Völkerrechts Kants Ausführungen gleich zu Beginn des zweiten Definitivartikels verdienen ausführlich zitiert zu werden: „Völker, als Staaten, können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande […] schon durch ihr Nebeneinandersein lädiren, und deren jeder um seiner Sicherheit willen von dem andern fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann. Die wäre ein Völkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müßte. Darin aber wäre ein Widerspruch: weil ein jeder Staat das Verhältniß eines Oberen (Gesetzgebenden) zu einem Unteren (Gehorchenden, nämlich dem Volk) enthält, viele Völker aber in einem Staate nur ein Volk ausmachen würden, welches (da wir hier das Recht der Völker gegen einander zu erwägen haben, so fern sie so viel verschiedene Staaten ausmachen und nicht in einem Staat zusammenschmelzen sollen) der Voraussetzung widerspricht“.585 Wie die Rezeptionsgeschichte dieser wenigen Sätze zeigt, bedürfen sie dringend weiterer Erläuterungen. In der Sekundärliteratur wird nämlich häufig angenommen, dass der Satzteil „Darin aber wäre ein Widerspruch“ sich auf eine begriffliche Inkonsistenz der Idee des Völkerstaates beziehe. Dieser Auslegung zufolge ist der Begriff des Staates für Kant untrennbar mit jenem der Souveränität verbunden. Die einzelstaatliche Souveränität wäre grundsätzlich unantastbar und unaufhebbar. Dies bedeutet, dass ein nicht-souveräner oder ein nicht-ganz-souveräner Staat ein sachleerer Begriff wäre. Die Stiftung eines Völkerstaates würde aber die Aufhebung der einzelstaatlichen Souveränität und die bloße Subsumierung aller Staaten unter einen einzigen Weltstaat bedeuten. Aus diesem Grund, so wird behauptet, hält Kant die Idee des Völkerstaates für widersprüchlich. Daran anknüpfend wird Kant vorgeworfen, dass er die Möglichkeit einer partiellen Übertragung der hoheitlichen Kompetenzen der einzelnen Staaten auf föderaler Ebene des Völkerstaates völlig übersehen habe. Wie im Folgenden gezeigt werden soll, kann eine derartige Auslegung nicht gänzlich befriedigend sein. Es wird dagegen die These vertreten, dass Kant innerhalb eines Begriffsrahmens argumentiert, welcher die Existenz voneinander unterschiedlicher Staaten voraussetzt und also die Existenz einer Weltrepublik ausschließt. Damit ist eine föderale Weltrepublik an sich nicht ausgeschlossen. Nur innerhalb des gewählten Begriffsrahmens ist sie nach dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit ausgeschlossen. Um Kants Argumentation im zweiten Definitivartikel nachvollziehen zu können, muss stets in Erinnerung behalten werden, dass Kant sich hier ausschließlich mit dem Völkerrecht auseinandersetzt.586 Im Titel des Artikels heißt es unmissverständlich: „Das Völkerrecht soll …“. Wie bereits angeführt wurde, bezieht sich das Völkerrecht auf das Verhältnis souveräner, also rechtlich unabhängiger Staaten im Verhältnis zueinander. Es impliziert also die Prämisse, dass es eine Pluralität von Staaten gibt, die jeweils Richter in eigenen Angelegenheiten sind. Kant drückt dies wie folgt aus: „Die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler von 585 Frieden: VIII, 354 Für das Verständnis der hier diskutierten These ist es unbedingt erforderlich auf das stets übersehene Adverb „hier“ aufmerksam zu machen: „Da wir hier das Recht der Völker gegen einander zu erwägen haben“ (Frieden: VIII, 354). 586 - 105 - einander unabhängiger benachbarter Staaten voraus“.587 Sollte es nicht eine Vielzahl souveräner Staaten geben, die unvermeidlich und jederzeit in Verhältnis zueinander kommen könnten, würde es auch kein Problem des Völkerrechts geben. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun die Frage leicht beantworten, worauf sich der von Kant angedeutete „Widerspruch“ bezieht. Dieser bezieht sich keinesfalls auf die (angebliche) Inkonsistenz der Idee des Völkerstaates. Der Widerspruch liegt vielmehr zwischen dem Begriff des Völkerstaats und den Voraussetzungen des Völkerrechts. Weil das Völkerrecht per definitionem eine Vielzahl souveräner Staaten voraussetzt, der Völkerstaat dagegen per definitionem dem Zusammenschluss der einzelnen souveränen Staaten und ihrer Unterwerfung unter eine überstaatliche Zwangsgewalt entspricht, kann das Völkerrecht widerspruchsfrei nur die Form eines Völkerbundes annehmen. Im Rahmen völkerrechtlicher Erörterungen gibt es keinen Platz für die Idee eines Völkerstaates, da diese Idee der Voraussetzung des Völkerrechts widerspricht. Diese These wird durch Kants Ausführungen in seinen Vorarbeiten zum ewigen Frieden bekräftigt: „Diese Sicherheit kan nach dem Völkerrecht von einer Vereinigung nach Bürgerlichen Gesetzen mithin der Unterwerfung unter eine über Staaten herrschende obere Gewalt (eines größern Staatskörpers) nicht erwartet werden denn das ist dem Begriffe des Völkerrechts zuwieder und setzt demnach eine Vereinigung des Willens aller zu dieser Absicht voraus die aber frey seyn und bleiben muß. Eine solche Verbindung ist eine Bundesgenossenschaft (Föderalism)“.588 Entscheidend ist hier festzuhalten, dass Kant die Idee des Völkerstaates als solche keinesfalls zurückweist. Von einer grundsätzlichen Zurückweisung der Idee einer überstaatlichen Zwangsgewalt kann hier schlechthin nicht die Rede sein. Diese Idee hat lediglich keinen Platz im Rahmen der hier angestrebten völkerrechtlichen Diskussion. Sie gehört zu jenem Teil des Rechts, welchen Kant selbst als „Völkerstaatsrecht“589 bezeichnet. c) Kants Konzeption staatlicher Souveränität Als Argument für die Stiftung eines Völkerbundes führt Kant aus, dass „jeder Staat seine Majestät […] gerade darin [setzt], gar keinem äußeren gesetzlichen Zwange unterworfen zu sein“.590 Ferner führt Kant im Text aus, dass die Staaten den Völkerstaat „nach ihrer Idee vom Völkerrecht durchaus nicht wollen“.591 Wie zuvor angeführt wurde, wird diese Begründung in der Sekundärliteratur zumeist für inkonsistent oder sogar widersprüchlich angenommen. Es wird allerseits behauptet, dass Kant hier die normative Ebene seiner Argumentation verlasse und auf das empirisch Gewollte der Staaten zurückgreife. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass auch diese Auslegung einer näheren Analyse des Textes nicht standhält, und dass Kant sich keinesfalls für einen Mittelweg zwischen Pflicht und Gewolltem ausspricht. Kant stellt zunächst als ein historisches Faktum fest, dass die einzelnen Staaten und deren Staatsoberhäupter nicht auf ihre Souveränität verzichten möchten. Dies hat zur Folge, dass sie faktisch darauf beharren in einem Zustand zu bleiben (nämlich dem rechtlosen Naturzustand), welchen sie verpflichtet sind zu verlassen. Die Tatsache, dass die Staaten keinen Völkerstaat wollen liegt darin begründet, dass dies die Aufhebung ihrer Souveränität zur Folge haben würde. Es gibt also einen Gegensatz zwischen dem, was die Vernunft gebietet (die Stiftung eines Völkerstaates) und dem, was die Staaten offensichtlich wollen (die 587 Frieden: VIII, 367; Vgl. auch Vorarbeit: XXIII, 171 Vorarbeit: XXIII, 168 589 RL: VI, 311 590 Frieden: VIII, 354 591 Frieden: VIII, 357 (meine Hervorhebung) 588 - 106 - Bewahrung ihrer Souveränität). Kurzum: Die Staaten wollen faktisch nicht, was sie wollen sollen. Dies hat jedoch nicht notwendig zu bedeuten, dass Kant in Empirismus verfällt. Festzuhalten ist zunächst, dass der oben skizzierte empirische Sachverhalt lediglich das völkerrechtliche Problem bildet, welches Kant insbesondere im hier diskutierten zweiten Definitivartikel zu lösen versucht. Es handelt sich um die zuvor angeführten Voraussetzungen des Völkerrechts. Am Ausgangspunkt Kants völkerrechtlicher Überlegungen findet sich die historische, also empirische Feststellung des Nebeneinanderseins einer Vielfalt souveräner Staaten. Wie bereits mehrmals erläutert wurde, sollen die Staaten aus Vernunftgründen den Naturzustand verlassen und einen Völkerstaat stiften. Wichtig ist hier zu sehen, dass der Naturzustand der Menschen und jener der Staaten nicht völlig gleich ist, so dass „von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Zustande nach dem Naturrecht gilt“.592 Gemeint ist hier die Tatsache, dass die Staaten „als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter eine erweiterte gesetzliche Verfassung zu bringen, entwachsen sind“.593 Die von Kant angezeigte Analogie zwischen einzelnen Menschen und Staaten ist somit eine bloß unvollständige Analogie. Für Kant besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem juridischen Naturzustand der Menschen und jenem der Staaten. Dieser Unterschied führt dazu, dass die jeweils vernunftnotwendige Überwindung des Naturzustandes auch nicht auf genau demselben Weg geschehen kann. Von Natur aus befinden sich die Individuen miteinander in einem rechtlosen Zustand, in welchem sie über nichts anderes als ihre zügellose Freiheit verfügen. Erst mit dem Eintritt in den bürgerlichen Zustand, das heißt erst mit der Gründung eines Staates, kann vom Recht im strengen Sinne die Rede sein. Dies rechtfertigt, dass die Menschen dazu gezwungen werden dürfen ihre rechtlose Freiheit zugunsten der rechtgesetzlichen Freiheit aufzugeben. Das Gesagte trifft jedoch nicht für die Staaten zu. Zwar befinden sich die Staaten von Natur aus ebenfalls im rechtlosen Naturzustand, aber lediglich äußerlich, das heißt in ihrem Verhältnis zu den anderen Staaten. Innerlich haben sie wiederum eine bürgerliche Verfassung und befinden sich somit bereits in einem Zustand des Rechts. Zu Recht weist Georg Geismann darauf hin, dass „es sich bei den einzelnen Staaten – im Unterschied zu den einzelnen Individuen – um einheitliche juridische Gebilde handelt, die in sich bereits einen öffentlich-rechtlichen Zustand darstellen, – gleichsam um Inseln des (mehr oder weniger gesicherten) Rechtsfriedens innerhalb des Weltnaturzustandes“.594 In Abgrenzung zu den Menschen reicht es also nicht, dass die Staaten ihre gesetzlose Freiheit aufgeben. Sie haben außerdem die Rechtspflicht dafür zu sorgen, dass sie dabei das innere erreichte Maß an Rechtssicherheit bezüglich des Gebrauchs der äußeren Freiheit der Untertanen nicht beeinträchtigen. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es sowohl für die Individuen als auch für die Staaten eine Rechtspflicht ist den Naturzustand zu verlassen, um in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand einzutreten, aber eben nicht auf dieselbe Art und Weise. Kein Staat darf einen anderen mit Gewalt zum Zusammenschluss zu einem Völkerstaat nötigen, da dies die rechtliche Unabhängigkeit eines jeden Staates (als Gemeinschaft freier Wesen) von einer anderen nötigenden Willkür verletzten würde. Alle völkerrechtlichen Schritte auf dem Weg zum ewigen Frieden sollen also die einzelstaatliche Souveränität beachten. Die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens muss gänzlich auf 592 Frieden: VIII, 355 (meine Hervorhebung) Frieden: VIII, 355f. 594 Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 175 (meine Hervorhebung). Vgl. Ders.: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 367. 593 - 107 - Mittel der Gewalt verzichten. Die Tatsache, dass das Verlassen des Naturzustandes unbedingt geboten ist, ändert nichts daran. Es sind also keine pragmatischen, sondern lediglich vernunftrechtlichen Gründe, die Kant dazu veranlassen zunächst die Stiftung eines Völkerbundes zu fördern. Weil Verstöße gegen die einzelstaatliche Souveränität schlechterdings unerlaubt sind, kann die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens rechtlich lediglich auf einer freiwilligen Basis geschehen.595 Die einzige rechtliche Möglichkeit um zu einem Zustand des Weltfriedens zu gelangen, ist das wechselseitige Übereinkommen. Kant plädiert somit für einen „Vertrag der Völker unter sich“.596 An einer anderen Stelle heißt es diesbezüglich: Der „status iuridicus muß aus irgend einem Vertrage hervorgehen, der nicht eben (gleich dem, woraus ein Staat entspringt,) auf Zwangsgesetze gegründet sein darf, sondern allenfalls auch der einer fortwährend-freien Association sein kann“.597 Also ist die föderative Vereinigung der Staaten der „einzige mit der Freiheit derselben vereinbare rechtliche Zustand“.598 d) Die notwendigen Rechtsschritte auf dem Weg zum ewigen Frieden unter Staaten Auf den kommenden Seiten wird sich zeigen, dass die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens als ein fortschreitender Rechtsprozess zu verstehen ist. In den Definitivartikeln fordert Kant keine Maßnahmen, die man gänzlich und auf einmal umsetzen sollte (und könnte), um gleich einen Zustand des ewigen Friedens unter Staaten zu erreichen. Kant plädiert vielmehr für eine kontinuierliche Annäherung eines sich weltweit erstreckenden Friedenszustandes. Kant interessiert sich nicht so sehr für den Zustand des ewigen Friedens, als vielmehr für den Weg zu ihm. Diese prozessuale Dimension lässt sich bereits im Titel der Friedensschrift festhalten: Zum ewigen Frieden. Dieser Titel ist jedoch mehrdeutig. Nicht selten wird der Titel „Zum ewigen Frieden“ fälschlicherweise als „Vom ewigen Frieden“ verstanden. Der Titel der Friedensschrift bedeutet nichts anderes als: Entwurf der Vernunftprinzipien des Rechts, welche zum ewigen Frieden führen. Der zweite Definitivartikel hebt die notwendigen Rechtsschritte auf dem Weg zum ewigen Frieden unter Staaten im Speziellen hervor. Die Durchführung der dort vorgelegten völkerrechtlichen Schritte hat zur Folge, dass die zwischenstaatlichen Beziehungen dem bürgerlichen Zustand immer ähnlicher werden. Wie im Folgenden gezeigt wird, ist die Stiftung eines Völkerbundes der erste Schritt auf dem Weg zum ewigen Frieden. Der letzte und entscheidende Schritt besteht in der Stiftung eines Völkerstaates. Mit dem Zustandekommen des Völkerstaates sind aber die Verhältnisse zwischen den lediglich noch innerlich souveränen Staaten nicht länger Gegenstand des Völkerrechts, sondern des Staatenstaatsrechts. An dieser Stelle können zwei terminologische Bemerkungen von Nutzen sein. Es sei erstens darauf aufmerksam gemacht, dass Kant in seinen verschiedenen Schriften eine abwechslungsreiche Terminologie verwendet. In der Idee zu einer allgemeinen Geschichte 595 Bereits im Gemeinspruch ist die Rede vom „Vorschlag zu einem allgemeinen Völkerstaat, unter dessen Gewalt sich alle einzelne Staaten freiwillig bequemen sollen“ (Gemeinspruch: VIII, 312f., meine Hervorhebung). Vgl. ebenfalls: Reflexion 8065: XIX, 599. Hier ist eine wichtige Entwicklung in Kants Gedanken zu verzeichnen. In den 1770er Jahren war Kant offensichtlich noch einer anderen Meinung: „Der Satz: exeundum est e statu naturali bedeutet: Man kann ieden zwingen mit uns oder unserer republic in statum civilem zu treten. Daher der Krieg in dieser Absicht allein gerecht ist“ (Reflexion 7735: XIX, 503). 596 Frieden: VIII, 356 597 Frieden: VIII, 383 598 Frieden: VIII, 385 - 108 - und in der Rechtslehre verwendet Kant den Begriff „foedus Amphictyonum“.599 Im Gemeinspruch spricht Kant wiederum von einem „rechtliche[n] Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht“.600 In der Friedensschrift spricht er vom „Friedensbund (foedus pacificum)“.601 In der Rechtslehre spricht Kant ebenfalls von „Genossenschaft (Föderalität)“602, von „Verbündung“603, von „wechselseitiger Verbindung (Bundsgenossenschaft) mehrerer Staaten“604 oder auch von „Congreß“.605 Alle diese Begriffe bezeichnen ein und dieselbe Idee mit jeweils unterschiedlichen Akzentsetzungen je nachdem, ob die Zwecke oder die innere Ausgestaltung des Völkerbundes hervorgehoben werden. Zweitens – und wichtiger – ist die Tatsache, dass Kant den Begriff des „Völkerbundes“ in zwei Sinne verwendet, nämlich einerseits zur Bezeichnung eines „Bundes“ mit allgemeiner Gesetzgebung und oberster Zwangsgewalt sowie andererseits zur Bezeichnung eines „Bundes“ ohne allgemeine Gesetzgebung und oberste Zwangsgewalt. Als Beispiel für den ersten Fall können zwei Stellen angeführt werden. In der Idee spricht sich Kant für einen „großen Völkerbunde“ aus, in welchem „jeder, auch der kleinste Staat seine Sicherheit und Rechte […] von einer vereinigten Macht und von der Entscheidung nach Gesetzen des vereinigten Willens erwarten könnte“.606 Kant meint nichts anderes, wenn er in der Religionsschrift von einem „Völkerbund als Weltrepublik“607 spricht. Im Unterschied dazu schreibt Kant in der späteren Friedensschrift von einem „Völkerbund, der aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müßte“.608 In der Rechtslehre spricht Kant wiederum von einem „Völkerbund“, welcher „keine souveräne Gewalt (wie in einer bürgerlichen Verfassung), sondern nur eine Genossenschaft (Föderalität) enthalten müsse“.609 Im Folgenden werden wir durchgängig vom Völkerbund in diesem späteren, bescheidenen Sinne zur Bezeichnung eines „Bundes“ ohne allgemeine Gesetzgebung und oberste Zwangsgewalt sprechen. Es besteht zunächst Erklärungsbedarf darüber, was Kant genau unter dem Begriff des Völkerbundes versteht und wie er sich vom Völkerstaat unterscheiden lässt. Es wird sich dabei zeigen, dass sich der Völkerbund insbesondere durch zwei Merkmale auszeichnet: Der Völkerbund hat für Kant ausschließlich eine kriegsabwehrende Funktion. In Abgrenzung zu einem bloßen Friedensvertrag (pactum pacis) besteht sein Ziel nicht darin einem besonderen Krieg ein Ende zu setzen, sondern vielmehr den Rückfall in den Zustand wirklichen Krieges überhaupt abzuwehren.610 Das einzige Ziel der Stiftung des Völkerbundes besteht darin, die Staaten „unter einander und zusammen gegen andere Staaten […] im Frieden zu erhalten“.611 Er soll lediglich für die „Erhaltung und Sicherung der Freiheit eines Staats, für sich selbst und zugleich anderer verbündeten Staaten“612 sorgen. In den Vorarbeiten zum ewigen Frieden ist zu lesen, dass die Funktion des Friedenbundes „blos 599 Vgl. Idee: VIII, 24; RL: VI, 344; Die Amphictyonen waren Verbände hellenistischer Staaten, welche zumeist defensiven Charakter hatten. Vgl. Pinzani, Alessandro: Das Völkerrecht §§ 53-61, in: Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 239. 600 Gemeinspruch: VIII, 311 601 Frieden: VIII, 356 602 RL: VI, 344 603 RL: VI, 344 604 RL: VI, 349 605 RL: VI, 351 606 Idee: VIII, 24 (meine Hervorhebungen) 607 Religion: VI, 34 608 Frieden: VIII, 354 609 RL: VI, 344 610 Vgl. Frieden: VIII, 356; RL: VI, 344 611 Frieden: VIII, 383 612 Frieden: VIII, 356 - 109 - negativ“613 ist. Kant betont ausdrücklich, dass der Völkerbund keine Expansionsbestrebungen haben soll. Für die Mitgliedstaaten handelt es sich darum, „sich gegen alle äußere oder innere etwanige Angriffe gemeinschaftlich zu vertheidigen; nicht ein Bund zum Angreifen und innerer Vergrößerung“.614 Desweiteren darf der Völkerbund die Freiheit seiner Mitgliedstaaten keinesfalls beeinträchtigen. Er darf sich „nicht in die einheimische[n] Mißhelligkeiten“ derselben mischen, sondern nur sie „gegen Angriffe der äußeren“615 schützen. Heute würde man von einem Bündnis der kollektiven Sicherheit sprechen. Es zielt darauf ab einerseits den Frieden zwischen den Mitgliedstaaten des Völkerbundes aufrechtzuerhalten sowie andererseits ihre gemeinsame Sicherheit gegen andere Staaten zu gewährleisten. Es handelt sich somit um einen Nichtangriffspakt zwischen den Vertragspartnern und ein Defensivbündnis gegenüber Drittstaaten. Der Völkerbund beruht auf der freiwilligen Solidarität der Vertragspartner und verfügt über keine eigenen militärischen Kapazitäten. Nur die einzelnen Staaten verfügen über militärische Kräfte und zwar über die von Kant im dritten Präliminarartikel geforderten defensiven Milizarmeen. Der von Kant geforderte Völkerbund ist als eine lose Verbindung äußerlich freier, mithin souveräner Staaten zu verstehen, der zunächst nicht über eine bloße horizontale Verhaltenskoordination hinausgeht. Dies hat zweierlei zu bedeuten. Erstens: Der Völkerbund ist eine auf Dauer gestellte Einrichtung, welche jedoch zu jedem Zeitpunkt auflösbar ist. In der Rechtslehre schreibt Kant, dass der Völkerbund „nur eine willkürliche, zu aller Zeit auflösliche Zusammentretung verschiedener Staaten“ ist, und „nicht eine solche Verbindung, welche (so wie die der amerikanischen Staaten) auf einer Staatsverfassung gegründet, und daher unauflöslich ist“.616 Beitritt und kontinuierliches Engagement in den Völkerbund können nur freiwillig geschehen. Zweitens: Es gibt weder öffentlich-rechtliche Gesetze noch eine oberste Zwangsgewalt.617 Die Souveränität liegt gänzlich in den Einzelstaaten. Es gibt jedoch bereits eine gewisse Institutionalisierung der Verhältnisse der Staaten untereinander. Die Konflikte der Vertragspartner werden nicht weiterhin auf dem militärischen, sondern nun auf dem zivilen Weg (das will heißen durch Schlichtungsverfahren, Verhandlungen, Tauschgeschäfte usw.) beigelegt.618 Mit der Stiftung des Völkerbundes treten also die Staaten in einen „rechtlichen“ (oder genauer formuliert: völkerrechtlichen) Zustand ein.619 Im Gemeinspruch spricht Kant ebenfalls von einem „rechtliche[n] Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht“.620 Die Staaten befinden sich also nicht länger im bloßen natürlichen Zustand, jedoch (auch noch) nicht in einem bürgerlichen Zustand. Kant spricht deshalb von einer „bürgerlichen ähnliche[n] Verfassung“.621 Der völkerrechtliche Zustand ist, um es anders zu formulieren, „einen dem rechtlichen sich annähernden Zustand“.622 Der völkerrechtliche Zustand wird dem bürgerlichen Zustand schrittweise immer ähnlicher. Nach der Stiftung des Friedensbundes könnte ein weiterer (rechtmäßig ebenfalls nur freiwillig möglicher) Schritt auf dem Weg zum ewigen Frieden in der Einsetzung eines gemeinsamen Richters ohne Zwangsgewalt bestehen. In der Rechtslehre erwähnt Kant das Beispiel der Minister europäischer Staaten der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die sich „ganz Europa als einen einzigen föderirten Staat dachten, den sie in jener ihren öffentlichen 613 Vorarbeit: XXIII, 168 RL: VI, 349 615 RL: VI, 344 616 RL: VI, 351 617 Vgl. Frieden: VIII, 355 618 Vgl. RL: VI, 351 619 Vgl. Frieden: VIII, 311, 383, 385 620 Gemeinspruch: VIII, 311 621 Frieden: VIII, 354 (meine Hervorhebung) 622 RL: VI, 344 (meine Hervorhebung) 614 - 110 - Streitigkeiten gleichsam als Schiedsrichter annahmen“.623 Selbst mit der Stiftung eines Völkerbundes und eines gemeinsamen Richters wäre der Naturzustand noch nicht komplett überwunden. Von einem „allgemeine[n] und machthabende[n] Völkerrecht“624 kann noch nicht die Rede sein. Hierfür fehlt noch eine oberste Zwangsgewalt, die zur Durchsetzung des Rechts fähig wäre. Der völkerrechtliche Zustand ist somit nur ein transitorischer Zustand zwischen dem bloßen Naturzustand und dem bürgerlichen Zustand. Mit der Stiftung eines Völkerbundes hat sich der Zustand, in welchem sich die Vertragspartner befinden, juridisch verändert. Im rechtlosen Naturzustand können sich die Staaten wechselseitig kein Unrecht tun, weil es gar nicht feststeht, was genau dem Recht und dem Unrecht entspricht. Mit der Stiftung eines Friedensbundes und der daraus resultierenden Institutionalisierung der zwischenstaatlichen Verhältnisse ist es dagegen möglich festzulegen, ob ein Staat sich (beispielsweise bei einem Vertragsbruch) im Recht befindet oder nicht. Im völkerrechtlichen Zustand bleibt jeder Staat sein eigener Richter. Dies bedeutet wiederum, dass der völkerrechtliche Frieden in letzter Konsequenz von dem subjektiven Rechtsurteil (Kant spricht seinerseits von „eigener rechtlichen Beurtheilung“625) der jeweiligen Staaten abhängt. Im völkerrechtlichen Zustand, also in Abwesenheit eines unabhängigen Richters, ist es den Staaten überlassen, über die Rechtmäßigkeit eigenen und fremden Verhaltens zu urteilen. Selbst bei allgemeiner Einigkeit über das geltende Recht und bei ebenso allgemeiner Bereitschaft sich an dieses Recht zu halten, kann es jedoch jederzeit zu einem Streit kommen, ob in einer gegebenen Situation ein Rechtsverstoß vorliegt. In Abwesenheit eines obersten Schiedsrichters können nur die Staaten selbst über die Rechtmäßigkeit ihres eigenen Verhaltens beurteilen. Unter dieser Bedingung kann es noch keine endgültige Garantie für die Sicherheit des Rechts eines jeden Staates geben. Im völkerrechtlichen Zustand ist das (angeborene und erworbene) Recht eines jeden Staates zwar ein gültiges, jedoch im Streitfall (aufgrund des Fehlens einer übergeordneten Rechtsinstanz) unwirksames Recht. Mit Kants eigenen Worten heißt dies, dass das Recht der Staaten bloß provisorischen Charakter hat. Erst mit dem vollständigen Übergang in den bürgerlichen Zustand, also mit der Stiftung eines Weltstaates, wird das Recht der Staaten peremtorisch. Mit der Stiftung des Völkerbundes ist der ewige Frieden im strengen Sinne noch nicht gegeben. Es handelt sich vielmehr um die völkerrechtliche Minimalbedingung, um den Kriegsausbruch möglichst zu verhindern.626 Der Völkerbund soll „den Verfall in den Zustand des wirklichen Krieges“627 unter seine Mitgliedstaaten abwehren.628 Weil der Abschluss eines derartigen Völkerbundes keinen Eingriff in die Souveränität der Staaten darstellt, gibt es keinen Grund ihn abzulehnen. Es gilt also: Wer diesen Völkerbund nicht will, will keinen Frieden. Zu Recht weist Georg Geismann darauf hin, dass die Stiftung eines Völkerbundes das einzige Mittel ist, durch welches „bei Wahrung der staatlichen Souveränität dennoch wenigstens ein erster Schritt auf dem Weg zum globalen Rechtszustand gemacht ist“.629 So rückt das Ziel des dauerhaften Friedens unter strikter Wahrung der einzelstaatlichen Souveränität historisch näher. 623 RL: VI, 350 (meine Hervorhebung) Religion: VI, 123 625 Idee: VIII, 24 (meine Hervorhebungen) 626 Georg Geismann schreibt hier zu Recht, dass die Schaffung eines Völkerbundes lediglich eine „Bändigung“, nicht aber eine „grundsätzliche Aufhebung“ des Naturzustandes als Kriegszustand bedeutet (Ders.: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 202) 627 RL: VI, 344 628 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 202. 629 Geismann, Georg: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 381. 624 - 111 - Erst mit dem letzten, für die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens notwendigen, jedoch rechtlich nur freiwillig möglichen Schritt, treten die Staaten in den bürgerlichen Zustand ein. Gemeint ist hier die Stiftung eines Weltstaates. Bevor Kants Vorstellung des Völkerstaates dargestellt wird, soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kant in seinen verschiedenen Schriften eine abwechslungsreiche Terminologie verwendet, um den Völkerstaat zu bezeichnen. In der Schrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte spricht Kant vom „weltbürgerlichen Zustand der öffentlichen Staatssicherheit“.630 Im Gemeinspruch heißt es „allgemeinen Völkerstaat“631 und „weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt“.632 In der Friedensschrift spricht Kant ebenfalls vom „allgemeinen Menschenstaat“.633 In der Rechtslehre heißt es „allgemeinen Staatenverein“634, „Völkerstaat“635 und „permanenten Staatencongreß“.636 Im Folgenden soll durchgängig der Terminus „Völkerstaat“ verwendet werden. Dass Kant die Stiftung einer überstaatlichen Zwangsgewalt für die einzige rechtliche Möglichkeit ansieht den zwischenstaatlichen Naturzustand zu überwinden und den Krieg endgültig zu verbannen, wurde bereits gesehen. Hier muss nur noch der Frage nachgegangen werden, wie der Völkerstaat gestaltet werden soll. Kants Antwort auf diese Frage fällt relativ kurz aus, da die genaue Gestaltung des Völkerstaates nicht das Anliegen der Philosophen ist und deshalb den Politikern und Juristen überlassen wird. Es kann allerdings zweierlei festgehalten werden: Erstens: Festzuhalten ist zunächst, dass Kant sich den Völkerstaat keinesfalls als einen sich weltweit erstreckenden Einheitsstaat vorstellt. Diesbezüglich schreibt er im zweiten Definitivartikel eindeutig und unmissverständlich, dass die Staaten „nicht in einem Staat zusammenschmelzen sollen“.637 Ferner im selben Text führt er aus, dass der völkerrechtliche Zustand obgleich er an sich ein Zustand des Krieges ist, so ist er doch „nach der Vernunftidee, besser als die Zusammenschmelzung derselben, durch eine die andere überwachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht“.638 Ferner spricht sich Kant gegen den „Grab der allgemeinen Alleinherrschaft“639 aus. Kant führt mehrere durchaus plausible empirische Argumente gegen den einheitlichen Weltstaat aus.640 Zum Beispiel, dass „die Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen, und ein seelenloser Despotism, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt“.641 Der einheitliche Weltstaat ist deshalb zurückzuwerfen, weil „bei gar zu großer Ausdehnung eines solchen Völkerstaats über weite Landstriche, die Regierung desselben, mithin auch die Beschützung eines jeden Gliedes endlich unmöglich werden muß“642, was wiederum einen Kriegszustand herbeiführen soll. Wichtig ist hier festzuhalten, dass Kant die Idee einer bloßen und vollständigen Aufhebung der einzelnen Staaten und ihre Subsumierung (Kant schreibt: „Zusammenschmelzung“) unter einen einheitlichen Weltstaat (Kant schreibt: „Universalmonarchie“643) entschieden zurückweist. Diese besondere Art der Weltregierung läuft Gefahr die angeborenen und erworbenen Rechte jedermanns zu verletzen 630 Idee: VIII, 26 Gemeinspruch: VIII, 312, 313 632 Gemeinspruch: VIII, 311 633 Frieden: VIII, 349 634 RL: VI, 350 635 RL: VI, 350 636 RL: VI, 350 637 Frieden: VIII, 354 (meine Hervorhebung) 638 Frieden: VIII, 367 (meine Hervorhebung) 639 Religion: VI, 34; Vgl. Gemeinspruch: VIII, 311 640 Vgl. Religion: VI, 34; Frieden: VIII, 367; RL: VI, 350 641 Frieden: VIII, 367 642 RL: VI, 350 643 Vgl. Religion: VI, 34; Frieden: VIII, 367; Vorarbeit: XXIII, 171 631 - 112 - und zu einem „seelenlose[n] Despotism“644 zu führen. Der erreichte Frieden wäre somit ein „Kirchhofe der Freiheit“.645 Zweitens: Es sei hier erneut darauf aufmerksam gemacht, dass Kant beständig von „freien Staaten“, nicht von „Republiken“ spricht.646 Mit dem Adjektiv „frei“ bezeichnet Kant die äußere Freiheit eines jeden Staates im Verhältnis zu den anderen. Dabei ist die Frage rechtlich ohne Belang, ob die Staaten eine republikanische Verfassung haben oder nicht. Man darf die Autonomie eines Staates nach innen von seiner Autonomie nach außen nicht miteinander verwechseln.647 Die steht in keinem Widerspruch mit der Feststellung, dass für Kant die Stiftung des Völkerstaates zwischen republikanisch verfassten Staaten leichter zu realisieren wäre: „Der Völkerbund ist keine allgemeine Monarchie. Denn alsdenn wären die cives nicht völker, welches doch hier Gefordert wird. Ein solcher Bund wäre aber schwer möglich, wenn die Staaten nicht jeder für sich ein Freystaat wäre“.648 Kants Zurückweisung der Universalmonarchie bedeutet jedoch keinesfalls eine prinzipielle Ablehnung einer überstaatlichen Rechtsautorität. In der Schrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte plädiert Kant für die Gründung einer weltweiten „Staatenverbindung“, die über eine eigene Zwangsgewalt verfügen sollte.649 In der Friedensschrift spricht sich Kant für die Stiftung eines Völkerstaates als Weltrepublik aus.650 Unter diesem Begriff ist eine weltweite Bundesrepublik freier, aber äußerlich nicht länger souveräner Gemeinschaften zu verstehen, wobei von Staaten in einem strengen Sinne nicht mehr die Rede sein kann. Im Unterschied zum Völkerbund gibt es im Völkerstaat sowohl öffentlich-rechtliche Gesetze als auch eine oberste (also überstaatliche) Zwangsgewalt, die für die Einhaltung der öffentlichen Gesetze sorgt. Mit dem (rechtlich lediglich freiwillig möglichen) Beitritt zum Völkerstaat verzichten die Staaten auf ihre äußere Souveränität und treten in den bürgerlichen Zustand ein. Die Staaten hören nicht auf als jeweils besondere Gemeinschaften von Menschen zu existieren, verfügen somit letztlich noch über ihre innere Souveränität. Im föderalen Völkerstaat behalten die einzelnen Staaten ihre je eigene staatsrechtliche und damit auch kulturelle Identität und Eigenart. Zu welchem genauen Zeitpunkt, mit welcher Geschwindigkeit und durch welche Maßnahmen der Weg zum vernunftgebotenen Weltstaat eingeschlagen werden kann, hängt von den politischen Umständen ab. Es steht allerdings fest, dass die von Kant skizzierten Rechtsschritte auf dem Weg zum ewigen Frieden dem Politiker einen beachtlichen Spielraum lässt, um die Annäherung auch unter den existierenden Anwendungsbedingungen ins Werk zu setzen. Der angestrebte Völkerstaat muss zum Beispiel nicht von Anfang an alle Staaten der Welt umfassen. Kants dynamisches Verständnis der Stiftung eines bürgerlichen Zustandes zeigt sich in der Friedensschrift, wo Kant von einem „sich immer ausbreitenden“ und „immer wachsenden“ Völkerstaat, ausspricht der „zuletzt alle Völker der Erde befassen“651 soll. Es reicht völlig aus, wenn der Völkerstaat anfänglich nur „einige[] Staaten“652 vereinigt und sich dann allmählich auf die ganze Welt erstreckt. Der Beitritt in diesen Völkerstaat soll „jedem 644 Für eine Diskussion Kants Argumentation gegen einen einheitlichen Völkerstaat siehe: Kyora, Stefan: Kants Argumente für einen schwachen Völkerbund heute, in: 200 Jahre Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Idee einer globalen Friedensordnung, hrsg. v. Volker Bialas und Hans-Jürgen Häßler, Würzburg 1996, S. 96-107; Kleingeld, Pauline: Approaching Perpetual Peace: Kant’s Defence of a League of States and His Ideal of a World Federation, in: The European Journal of Philosophy 12, 2004, S. 304-325. 645 Frieden: VIII, 367 646 Vgl. Frieden: VIII, 343, 348, 354ff. 647 Für den ersten Fall siehe etwa: RL: VI, 318. Für den zweiten dagegen: Frieden: VIII, 346 648 Reflexion 8056: XIX, 596f. 649 Vgl. Idee: VIII, 26 650 Vgl. Frieden: VIII, 357 651 Frieden: VIII, 357 (meine Hervorhebung) 652 RL: VI, 350 - 113 - benachbarten“ Staat jederzeit offen stehen, und zwar gänzlich unabhängig von seiner inneren Verfasstheit.653 Die Stiftung eines Völkerstaates ist die notwendige Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens. Mit diesem letzten und entscheidenden Schritt auf dem Weg zum ewigen Frieden unter Staaten verwandelt sich das bloß provisorische Völkerrecht in ein peremptorischen Staatenstaatsrecht bzw. Völkerstaatsrecht.654 ²Mit dem Übergang in den bürgerlichen Zustand der Staaten ist die beständige Gefahr des Ausbruchs der Gewalttätigkeiten rechtlich ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass alle möglichen Rechtsgründe zu streiten beseitigt sind, was aber längst nicht bedeutet, dass die in der menschlichen Natur verwurzelte Streitlust ihrerseits beseitigt ist.655 In seiner geschichtsphilosophischen Schrift aus dem Jahre 1784 war noch zu lesen, dass die Stiftung eines Völkerstaates der „letzte Schritt“656 auf dem Weg zum ewigen Frieden darstellt. Wie bereits gesehen wurde, geht Kant allerdings in der Friedensschrift und anschließend in der Rechtslehre einen weiteren Schritt: die Stiftung eines Weltbürgerrechts. Darauf soll im Folgenden näher eingegangen werden. 2.3 Dritter Definitivartikel: Das Recht des Weltbürgers jenseits des eigenen Staates Kants Weltbürgerrecht (ius cosmopoliticum) erwächst aus einer doppelten Tradition. Gemeint sind einerseits die seit der griechisch-römischen Antike lebendige Tradition des Kosmopolitismus sowie die neuzeitliche Tradition des allgemeinen völkerrechtlichen Fremdenrechts andererseits. Im Gegensatz oder als Ergänzung zum Patriotismus657 betont der Kosmopolitismus in seinen verschiedenen Varianten, dass die ganze bewohnte Welt als Heimat, und dass alle Menschen als Mitbürger, oder sogar als Brüder zu betrachten sind. Der kosmopolitische Gedanke geht bis auf Diogenes von Sinope zurück, der sich erstmals als „Bürger der Welt“ (kosmou politês) definiert hat. Dieser Gedanke diente allerdings zunächst nur als moralisches Prinzip für eine vernünftige Lebensführung. In den philosophischen Schulen der Kyniker und der Stoiker wird der Gedanke des Kosmopolitismus jedoch allmählich weiter entwickelt und vor allem um eine neue politische Dimension erweitert.658 Im Anschluss daran wird auch das christliche Denken die Notwendigkeit des Zusammenhaltens aller Menschen und der allgemeinen Menschenliebe betonen. Eine erhebliche Ausweitung und Fortentwicklung erfährt der kosmopolitische Gedanke dann noch im Zeitalter der Aufklärung. Das allgemeine völkerrechtliche Fremdenrecht, welches die Verhältnisse der Staaten zu fremden Staatsbürgern (Reisende, Pilgern, Händlern, Flüchtlingen, usw.) regelt, hat seinerseits eine jüngere Tradition, die teilweise bis im Mittelalter und in der Renaissance reicht, jedoch vor allem zu Beginn der Neuzeit neue Impulse erfahren hat. Das allgemeine Fremdenrecht wird unter anderem vom Schweizer Natur- und Völkerrechtler Emeric de Vattel in seinem Hauptwerk Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite 653 Vgl. RL: VI, 350 Vgl. RL: VI, 350 655 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 174. 656 Idee: VIII, 26 657 Zu Kants Verständnis des Patriotismus siehe: Kleingeld, Pauline: Kantian Patriotism, in: Philosophy & Public Affairs 29-4, 2000, S. 313-341. 658 Eine eingehende Darstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kant und seinen stoischen Vorgängen bietet der folgende Aufsatz: Nussbaum, Martha C.: Kant und stoisches Weltbürgertum, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 45-75. 654 - 114 - et aux affaires des nations et des souverains systematisch bearbeitet und einem breiten Publikum bekannt gemacht.659 In seinen verschiedenen Schriften übernimmt Kant also einen Grundgedanken der philosophischen Diskussion seiner Zeit und verleiht ihm eine neue, erweiterte Bedeutung.660 Der Kosmopolitismus zieht sich nämlich durch Kants Gesamtwerk. Es ist sogar nicht übertrieben zu behaupten, wie Otfried Höffe es tut, dass Kant eine „universale kosmopolitische Philosophie“ entwickelt hat, die nicht nur auf Wissen und Moral beschränkt bleibt, sondern auch die Bereiche der Erziehung, der Geschichtsphilosophie, der Teleologie, der Ästhetik und nicht zuletzt der Rechtsphilosophie mit einbezieht.661 Ganz in diesem Sinne schreibt auch Reinhard Brandt, dass Kant ein „dezidierter Weltphilosoph“ ist, dessen „Bemühungen in der theoretischen und praktischen Philosophie […] der Etablierung einer öffentlichen gemeinsamen Welt“662 gelten. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation werden wir uns allerdings lediglich auf Kants politischen Kosmopolitismus beschränken. Kants politischer Kosmopolitismus tritt zunächst in seinen zwei kleineren geschichtsund rechtsphilosophischen Schriften Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht und Über den Gemeinspruch zutage.663 Kant widmet sich aber dem Weltbürgerrecht vornehmlich in der Friedensschrift und - mit wenigen Unterschieden - in der Rechtslehre. In der Friedensschrift erscheint das Weltbürgerrecht sogar an prominenter Stelle, nämlich im abschließenden dritten Definitivartikel. Dieser Artikel findet seine Entsprechung und Ergänzung im abschließenden § 62 der Rechtslehre. Die abschließende Stellung des Weltbürgerrechts darf allerdings nicht über die Bedeutung, welche Kant ihm beimisst, täuschen. Es ist nicht ohne Belang festzuhalten, dass der dritte Definitivartikel nur etwa zwei Drittel des Umfangs im Vergleich zum ersten oder zum zweiten Definitivartikel ausmacht. Des Weiteren kann festgehalten werden, dass der § 62 bezüglich des Weltbürgerrechts in der Rechtslehre nur etwa ein Sechstel des Umfangs im Vergleich zum zweiten Abschnitt bezüglich des Völkerrechts ausmacht. Dies ist vielleicht einer der Gründe, weshalb die Kant-Literatur sich lange vornehmlich auf das Staats- und Völkerrecht konzentriert hat, während dem Weltbürgerrecht weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Erst in jüngerer Vergangenheit hat sich die Sekundärliteratur dem Weltbürgerrecht ausführlicher gewidmet.664 Ein weiterer möglicher Grund für die lange Zeit andauernde geringere Beachtung des Weltbürgerrechts liegt ebenfalls darin, dass es für viele Kommentatoren nicht ganz erkenntlich war, ob und inwiefern sich das Weltbürgerrecht vom Völkerrecht unterscheidet. In den folgenden Seiten soll daher auf die 659 Vgl. Vattel, Emeric de: Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Paris 1863 [1757], insbesondere Buch II, Kapitel VIII. 660 Vgl. Cavallar, Georg: Cosmopolis. Supranationales und kosmopolitisches Denken von Vitoria bis Smith, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 53, 2005, S. 49-67. 661 Vgl. Höffe, Otfried: Kants universaler Kosmopolitismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55, 2007, S. 179-191. 662 Brandt, Reinhard: Vom Weltbürgerrecht, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 133. 663 Vgl. Idee: VIII, 24ff.; Gemeinspruch: VIII, 289ff. 664 Hingewiesen sei vor allem auf die folgenden Aufsätze: Brandt, Reinhard: Vom Weltbürgerrecht, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 133-148; Höffe, Otfried: Kants universaler Kosmopolitismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55, 2007, S. 179-191; Kleingeld, Pauline: Kants politischer Kosmopolitismus, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 5, 1997, S. 333-348; Müller, Jörg Paul: Das Weltbürgerrecht (§ 62) und Beschluss, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 257-279. Dagegen ist es überraschend, wenn Geismann in seiner Monographie sich dem Weltbürgerrecht in nicht mehr als drei Seiten widmet. Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 218-220. - 115 - Frage nach dem genauen Inhalt, der Adressaten und der Begründung des Weltbürgerrechts näher eingegangen werden. a) Das Weltbürgerrecht als eine eigenständige Form des öffentlich-rechtlichen Zustandes Mit dem Weltbürgerrecht findet Kants Einteilung des öffentlichen Rechts ihren systematischen Abschluss. Überall dort, wo moralische Personen (Menschen oder Staaten, das gilt hier gleichviel) miteinander interagieren, also überall dort, wo die äußere Freiheitssphäre einer jeden moralischen Person mit der äußeren Freiheitssphäre jeder anderen kollidieren kann, bedarf es einer öffentlichen Gesetzgebung, um diese Verhältnisse zu regeln. Das Staatsrecht betrifft somit die Verhältnisse der Menschen in einem Staat. Das Völkerrecht betrifft wiederum das Verhältnis der Staaten untereinander. Als dritte und letzte denkbare Rechtsform betrifft das Weltbürgerrecht das äußere Verhältnis der Staaten zu den Bürgern anderer Staaten sowie das Verhältnis von Bürgern verschiedener Staaten. Das Weltbürgerrecht garantiert also, dass kein Raum der Rechtlosigkeit bestehen bleibt. Der systematische Stellenwert des Weltbürgerrechts im Rahmen der Kantischen Rechtstheorie vom Weltfrieden ist allerdings nicht so eindeutig wie zunächst angenommen werden könnte. Es bleibt nämlich noch zu hinterfragen, worin der genaue Unterschied zwischen dem Völkerrecht und dem Weltbürgerrecht besteht. Diese Frage drängt sich bereits deshalb auf, weil Kants Verwendungsweise der Ausdrücke „Weltbürgerrecht“, „Weltbürger“ und „weltbürgerlich“ in Zum ewigen Frieden und anschließend in der Rechtslehre sich von seiner früheren Verwendungsweise in der Idee und im Gemeinspruch unterscheidet. In der Idee führt Kant die Ausdrücke „Weltbürger“ und „weltbürgerlich“ nur an vier Stellen aus. In der Einführung führt Kant aus, dass die Menschen (als endliche Vernunftwesen) weder bloß wie instinktmäßige Tiere verfahren, noch wie „vernünftige Weltbürger“665 handeln. Im Siebten Satz bezeichnet Kant den „weltbürgerlichen Zustand“666 als einen sich weltweit erstreckenden öffentlichen Rechtszustand, in welchem eine übergeordnete, vereinigte Macht für die öffentliche Staatssicherheit zuständig ist. Im Achten Satz definiert Kant wiederum den „allgemeine[n] weltbürgerliche[n] Zustand“ als die höchste Absicht der Natur und „als der Schooß, worin alle ursprüngliche Anlagen der Menschengattung entwickelt werden“.667 Mit dem Zusatz „allgemein“ betont Kant, dass der weltbürgerliche Zustand ein allen Staaten der Welt einschließenden, und somit universellen Rechtszustand ist. Im Neunten Satz versucht Kant letztlich zu zeigen, dass „ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plan der Natur, der auf die vollkommene Vereinigung in der Menschengattung abziele, zu bearbeiten, […] als möglich und selbst für diese Naturabsicht beförderlich angesehen werden“668 muss. Kant führt insbesondere aus, dass es zur „Idee einer Weltgeschichte“ gehöre, zu zeigen, „was Völker und Regierungen in weltbürgerlicher Absicht geleistet oder geschadet haben“.669 Diesen verschiedenen Textstellen ist zu entnehmen, dass Kant in der Idee den „weltbürgerlichen Zustand“ noch als Gegenbegriff zum „Naturzustand“ versteht. Der weltbürgerliche Zustand bezeichnet dort einen aller Staaten der Welt umfassenden und übergeordneten Völkerstaat. Diese Auslegung wird von Kants Verwendungsweise des Ausdrucks „weltbürgerlich“ im Gemeinspruch bestätigt. Dort verwendet Kant den Ausdruck „weltbürgerliche Verfassung“ 665 Idee: VIII, 17 Idee: VIII, 26 667 Idee: VIII, 28 668 Idee: VIII, 29 669 Idee: VIII, 31 666 - 116 - in Analogie zu „staatsbürgerlicher Verfassung“.670 Kant zeigt, dass genauso wie die Gewalttätigkeiten der Menschen gegeneinander und die daraus entspringende Not das Volk letztlich dazu zwingen mußte eine staatsbürgerliche Verfassung zu stiften, so wird auch die sich aus den beständigen Kriegen ergebende Not die Staaten dazu veranlassen, sich unter den Zwang öffentlicher Gesetze zu begeben und in einem weltbürgerlichen Zustand einzutreten. Im Unterschied zu dieser Verwendungsweise unterscheidet Kant in der Friedensschrift zum ersten Mal ausdrücklich nicht nur zwei, sondern drei unterschiedliche Formen des öffentlichrechtlichen Zustandes. Dort führt er nämlich einen erweiterten Begriff des öffentlichen Rechts ein, welcher neben dem Staatsrecht und dem Völkerrecht nun auch das Weltbürgerrecht umfasst. Spätestens ab 1795 betrachtet Kant also das Weltbürgerrecht als einen eigenständigen Zweig des öffentlichen Rechts, der sich weder unter das Staatsrecht noch unter das Völkerrecht ganz subsumieren lässt. Erklärungsbedürftig ist an dieser Stelle, ob und inwiefern das Weltbürgerrecht tatsächlich ein eigenständiger Teil des öffentlichen Rechts darstellt, und gegebenenfalls inwiefern es sich vom Völkerrecht unterscheidet. Kant gibt hierauf keine direkte und eindeutige Antwort. Es liegt allerdings nahe, dass sich das Völker- und Weltbürgerrecht hinsichtlich ihrer Adressaten unterscheiden.671 Es steht zunächst fest, dass das Völkerrecht das Verhältnis der Staaten untereinander betrifft. Das Völkerrecht umfasst aber auch das Verhältnis der Staaten zu den Staatsbürgern anderer Staaten. Wichtig ist allerdings dabei zu sehen, dass die einzelnen Menschen nicht als direkte Völkerrechtssubjekte betrachtet werden. Das Völkerrecht bezieht sich unmittelbar auf die Staaten und nur mittelbar auf die Menschen. Diese werden nicht in ihrer Qualität als Menschen, sondern lediglich in ihrer Qualität als Staatsbürger betrachtet. Im Unterschied dazu bezieht sich das Weltbürgerrecht unmittelbar auf die Staaten und auf die Menschen als solche, das heißt auf alle Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen Staatsbürgerschaft. In der Friedensschrift schreibt Kant ausdrücklich und unmissverständlich, dass das Weltbürgerrecht ein Recht ist, welches „allen Menschen zusteht“.672 Ferner heißt es, dass das Weltbürgerrecht sich unmittelbar auf die „Menschen und Staaten, in äußerem auf einander einfließenden Verhältniß stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats“673 bezieht. Kants Ausführungen in der Rechtslehre weichen nur in sehr geringem Maße davon ab. Dort bezeichnet er das „Volk“ und der „Erdbürger“ als die Subjekte des Weltbürgerrechts.674 Nachdem die Adressaten des Weltbürgerrechts bestimmt wurden, soll nun auf die Frage nach der Begründung und dem Inhalt des Weltbürgerrechts eingegangen werden. b) Das Weltbürgerrecht als ein jedem Mensch kraft seiner Menschheit zustehendes allgemeines Besuchsrecht Die weltbürgerrechtlichen Überlegungen Kants nehmen ihren Ausgangspunkt in der Idee einer ursprünglichen, aller Menschen einschließenden Gemeinschaft des physischen (mitnichten rechtlichen) Besitzes der Erdoberfläche.675 Die räumliche Begrenztheit der Erde führt dazu, dass die Menschen „sich nicht ins Unendliche zerstreuen können“676, sondern notwendigerweise miteinander in Kontakt kommen und sich also wechselseitig erdulden 670 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 310 Dies wird von Pauline Kleingeld mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hervorgehoben. Vgl. Ders.: Kants politischer Kosmopolitismus, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 5, 1997, S. 338f. 672 Frieden: VIII, 358 673 Frieden: VIII, 349 (meine Hervorhebung) 674 Vgl. RL: VI, 352f. 675 Vgl. Frieden: VIII, 358; Vgl. ebenfalls RL: VI, 352, 252, 258 676 Frieden: VIII, 358 671 - 117 - müssen. Aus dieser Idee der ursprünglichen Gemeinschaft des physischen Besitzes lassen sich zwei Rechte ableiten, welche jedem Menschen derselben Welt zustehen. Erstens kommt jedem Mensch (und somit jedem Volk) als Glied dieser einen ursprünglichen Gemeinschaft ein ursprüngliches Recht zu, sich auf irgendeinen Teil der Erdoberfläche niederzulassen und damit irgendeinen Teil von ihr zu besitzen. In der Friedensschrift führt Kant aus, dass „ursprünglich […] niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der Andere“.677 Zweitens hat jeder Mensch (und somit jedes Volk) ein Recht darauf, die ganze Erdoberfläche zwecks eines möglichen Verkehrs mit allen anderen Menschen und Völkern zu benutzen, ohne daran durch den eigenen Staat gehindert werden zu können, sowie ohne durch fremde Staaten feindselig behandelt zu werden. In der Rechtslehre führt Kant dazu aus, dass alle Völker ursprünglich in „einer Gemeinschaft […] der physischen möglichen Wechselwirkung (commercium)“ stehen, „d.i. in einem durchgängigen Verhältnisse, eines zu allen Anderen, sich zum Verkehr untereinander anzubieten, und haben ein Recht, den Versuch mit demselben zu machen, ohne daß der Auswärtige ihm darum als einem Feind zu begegnen berechtigt wäre“.678 Die Menschen haben das Recht ihren eigenen Staat zu verlassen und den Kontakt mit Menschen anderer Staaten zu suchen. Darauf soll nun näher eingegangen werden. Im dritten Definitivartikel zum ewigen Frieden stellt Kant die folgende Forderung auf: „Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein“.679 Die Frage, die sich hier stellt, ist jene, was genau darunter zu verstehen ist. In der Friedensschrift schreibt Kant, dass es im dritten Definitivartikel, wie bereits in den vorigen Definitivartikeln, nicht von Philanthropie, sondern allein vom Recht die Rede ist.680 Anschließend definiert Kant dieses Recht in einem zunächst negativen, dann aber auch positiven Sinne. In einem ersten Schritt bestimmt Kant, was das Weltbürgerrecht nicht ist. Diesbezüglich führt er zunächst aus, dass es weder ein „Gastrecht“681 noch ein „Recht der Ansiedelung auf dem Boden eines anderen Volks (ius incolatus)“682 ist. Es ist auch kein Recht der „Anwohnung (accolatus) und Besitznehmung in der Nachbarschaft eines Volks, das in einem solchen Landstriche schon Platz genommen hat“.683 Kant verteidigt das territoriale Besitzrecht der nomadischen Völker (Kant spricht seinerseits von „Hirten- oder Jagdvölkern“), deren Unterhalt von großen, durch keine Einzäunung und Abmarkung geteilten Landstrecken abhängt. Das Weltbürgerrecht enthält somit ein unbedingtes Verbot jeglicher Form von Imperialismus und Kolonialismus.684 In der Friedensschrift wendet sich Kant entschieden gegen „das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Welttheils“685 gegenüber den Kolonialgebieten, deren Einwohner die Europäer „für nichts“ hielten. In der Rechtslehre fügt Kant hinzu, dass die vermeintlich guten Absichten der kolonialen Mächte die Rechtswidrigkeit ihrer Handlungen nicht zu rechtfertigen vermögen.686 677 Frieden: VIII, 358; RL: VI, 262, 352 RL: VI, 352 679 Frieden: VIII, 357 680 Vgl. Frieden: VIII, 357; RL: VI, 352 681 Frieden: VIII, 358 682 RL: VI, 353 683 RL: VI, 353 684 Zu Kants Kolonialismuskritik siehe u.a.: Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar, 1992, S. 227ff.; Väyrynen, Kari: Weltbürgerrecht und Kolonialismuskritik bei Kant, in: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses, hrsg. v. Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann und Ralph Schumacher, 2001, S. 302-309. 685 Frieden: VIII, 358 686 Vgl. RL: VI, 353 678 - 118 - Es wurde bisher gesehen, dass aus der ursprünglichen Gemeinschaft des physischen Besitzes der Erde kein Recht sich auf dem Boden eines anderen Volks ohne seine Zustimmung anzusiedeln oder zu begeben folgt. Hierfür wäre „ein besonderer wohlthätiger Vertrag“687 erforderlich. Damit ist nicht nur die Gewaltanwendung ausgeschlossen, sondern Kant weist in der Rechtslehre ausdrücklich darauf hin, dass der unterschriebene Vertrag das Ergebnis einer echten Willensübereinkunft sein soll. Dies bedeutet, dass die beiden Vertragspartner den Vertrag wissentlich und willentlich unterschrieben haben müssen. Ein Vertragspartner darf sich nicht etwa die „Unwissenheit“ der einheimischen Bevölkerung zunutze machen. In einem positiven Sinne bedeutet das allgemeine Recht auf Hospitalität (Wirtbarkeit) ein allseitiges „Besuchsrecht“.688 Es handelt sich dabei um das „Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden“.689 Dies bedeutet mit anderen Worten, dass jedem Mensch das Recht zukommt, sich an irgendeinem Ort der Erde als Besucher zu begeben, den Kontakt mit Menschen anderer Staaten zu suchen ohne gleich von diesem Staat feindselig behandelt zu werden. Dieses jedem Mensch zukommende Recht den Zugang zu Menschen anderer Staaten zu suchen, hat allerdings mitnichten zu bedeuten, dass es für die Staaten eine allgemeine Pflicht besteht, den Eingang in das eigene Territorium zu gestatten. Die Textlage ist hier eindeutig: In der Friedensschrift schreibt Kant lediglich, dass die Menschen das Recht haben „sich zur Gesellschaft anzubieten“.690 Des Weiteren heißt es, dass die Menschen das Recht haben „einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen“.691 In der Rechtslehre schreibt Kant wiederum, dass die Menschen das Recht haben „sich zum Verkehr untereinander anzubieten“.692 Ferner im Text schreibt Kant, dass die Menschen das Recht haben „die Gemeinschaft mit allen zu versuchen“.693 Dies hat zu bedeuten, dass ein Staat sehr wohl berechtigt ist, den Eingang eines fremden Menschen auf seinem Territorium zu verweigern.694 Insofern ist es folgerichtig, dass Kant die Politik Chinas und Japans unterstützt, die den Kontakt mit den Europäern streng begrenzt haben. Kurzum: Die Staaten und die einzelnen Menschen haben das Recht, den Kontakt mit anderen Staaten und ihrer Bewohner zu suchen. Sie haben jedoch kein Recht in das Territorium eines anderen Staates ohne dessen Erlaubnis einzutreten. Jeder Staat ist somit berechtigt über das gewünschte Ausmaß seiner Interaktionen mit anderen Staaten zu entscheiden. Es kann somit Otfried Höffe zugestimmt werden, wenn er schreibt: „Alle Menschen haben ein bescheidenes Recht auf eine umfassende Kooperationsgemeinschaft […] ohne andererseits auf persönliche und kollektive Eigenarten verzichten zu müssen. Schon bei Kant verbindet sich also ein Recht auf universale Kooperation mit einem Recht auf Differenz“.695 Aufgrund seiner Einschränkung auf die Bedingungen der allgemeinen Hospitalität scheint das Weltbürgerrecht zunächst zu wenig ambitioniert zu sein. Kant fügt allerdings diesem allgemeinen Recht auf Hospitalität eine weitere Bedingung hinzu, die weitreichende 687 Frieden: VIII, 358 Vgl. Frieden: VIII, 358; RL: VI, 353 689 Frieden: VIII, 358 690 Frieden: VIII, 358 (meine Hervorhebung) 691 Frieden: VIII, 358 (meine Hervorhebung) 692 RL: VI, 352 (meine Hervorhebung) 693 RL: VI, 353 (meine Hervorhebung) 694 Es wird somit etwa Jörg Paul Müller nicht zugestimmt, wenn er ohne weitere Präzisierungen von einem „Besuchsrecht mit entsprechender Hospitalitätspflicht“ seitens des Staates spricht. Vgl. Ders.: Das Weltbürgerrecht (§ 62) und Beschluss, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 266. 695 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 170. 688 - 119 - Folgen hat. Er schreibt nämlich, dass der besuchte Staat fremde Menschen nicht von seinem Territorium verweisen darf, wenn dies ihren „Untergang“696 zur Folge habe. Kant spricht von „Untergang“ ohne zu spezifizieren, ob dieser Untergang aufgrund gezielter staatlicher Maßnahmen erfolgen soll oder nicht. Nichts spricht somit dagegen den Begriff des „Untergangs“ in einem weiten Sinne zu verstehen, als alle Situationen, in welchen der Besucher aus welchem Grund auch immer (politische Verfolgung, Hungersnot, Naturkatastrophe, usw.) in seinem Land den Tod oder irgendeine Aufhebung seiner moralischen Persönlichkeit riskiert. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Staaten die Pflicht haben, den Eingang in ihr Territorium für fremde, lebensgefährdete Menschen zu ermöglichen. Mit anderen Worten hat es zu bedeuten, dass schutzsuchende Menschen ein Recht haben, von den anderen Staaten in Schutz genommen zu werden. Bei drohender Lebensgefahr sowie bei Gefahr unmenschlicher oder entwürdigender Behandlungen sind die Staaten auch rechtlich verpflichtet diesen Schutz tatsächlich zu garantieren. Jeder Staat soll gewährleisten, dass kein Mensch an seiner Grenze abgewiesen wird oder der Eingang in das Territorium verwiesen wird, wenn mit guten Gründen angenommen werden kann, dass er in seinem Heimatstaat getötet oder gefoltert wird. Kein Mensch darf von einem fremden Staat gezwungen werden, in ein Staatsgebiet zurückzukehren oder dort zu verbleiben, wenn er vom „Untergang“ bedroht ist. Das allgemeine Besuchsrecht ist somit als „Minimalgarantie für Fremde“697 zu verstehen. Diese Minimalgarantie wird jedem Mensch unabhängig von seiner Staatsbürgerschaft gegen die Regierung eines anderen Staates zugestanden. Abschließend zu diesem Teil ist es nicht unwesentlich darauf hinzuweisen, dass die soeben definierte Weltbürgerschaft keine eigene, den einzelnen Staatsbürgerschaften konkurrierende Bürgerschaft ist. Die Weltbürgerschaft ergänzt die Staatsbürgerschaft, ohne diese zu ersetzen. Otfried Höffe schreibt zu Recht, dass Kant „keinen exklusiven, sondern einen komplementären Kosmopolitismus“698 vertritt. c) Das allgemeine Besuchsrecht als Wegbereiter einer friedlichen durchgängigen Gemeinschaft aller Völker auf Erde Wer den dritten Definitivartikel der Friedensschrift flüchtig liest, kann leicht den Eindruck gewinnen, dass das Weltbürgerrecht zu bescheiden ist. Dabei wird allerdings übersehen, dass das Verbot, in einem anderen Staat als Feind behandelt zu werden Kants Hoffnung auf die Schaffung einer „friedlichen, wenn gleich noch nicht freundschaftlichen, durchgängigen Gemeinschaft aller Völker auf Erden“699 berechtigt. Darauf soll in den folgenden Ausführungen näher eingegangen werden. Es wurde bisher gesehen, dass das Weltbürgerrecht das Recht aller Menschen ist, nach bestimmten, allgemeinen Gesetzen in Beziehung zueinander zu treten und im Falle der Gefahr des eigenen Untergangs den Schutz der anderen Staaten zu bekommen. An dieser Stelle sei erneut daran erinnert, dass es hier ausschließlich um Prinzipien des Rechts, und keinesfalls um jene der Ethik bzw. der Philanthropie geht.700 Mit dem Recht hängt jedoch die Befugnis zu zwingen unmittelbar zusammen. Die Frage, die sich vor diesem Hintergrund aufdrängt, ist jene, wie und von wem dieser Zwang ausgeübt werden soll. Problematisch ist, dass Kants 696 Frieden: VIII, 358 Müller, Jörg Paul: Das Weltbürgerrecht (§ 62) und Beschluss, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 267. 698 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 168. 699 RL: VI, 352 700 Vgl. Frieden: VIII, 357; RL: VI, 352 697 - 120 - direkte Ausführungen zum Problem der institutionellen Gestaltung und Sicherung des Weltbürgerrechts in Zum ewigen Frieden wie in der Rechtslehre äußerst sparsam sind. Diesbezüglich bemerkt Georg Geismann zu Recht, dass das Weltbürgerrecht ein bloß „in der Idee“ öffentliches Recht bleiben würde, solange es keine öffentliche Gesetzgebung gibt, welche das Verhältnis der Menschen als Weltbürger bestimmt.701 Das öffentliche Recht bezeichnet den Inbegriff der Gesetze, die einer öffentlichen Bestimmung bedürfen, und deren Erhaltung durch eine öffentliche Zwangsgewalt gesichert ist. Dies gilt nicht nur für das Staats- und Völkerrecht, sondern ebenfalls für das Weltbürgerrecht. Anstelle vom „ungeschriebenen Codex“702 (subjektives Weltbürgerrecht) muss somit ein öffentlicher, notwendig aller Menschen der Welt (vermittelt durch ihre Repräsentanten) einschließender Vertrag treten, durch welchen das Recht aller Völker und Menschen in Verhältnis zueinander öffentlich bestimmt wird (objektives Weltbürgerrecht).703 Durch den eben erwähnten Vertrag wird ein allgemeiner weltbürgerlicher Wille gebildet und bekannt gegeben. Das Weltbürgerrecht soll nach Maßgabe dieses weltbürgerlichen Willens bestimmt und durch eine oberste Zwangsgewalt gesichert werden. Solange es keine übergeordnete Rechtsinstanz gibt, um die Einhaltung des Weltbürgerrechts zu garantieren, wird das Weltbürgerrecht ein bloß provisorisches Recht, das heißt ein zwar gültiges, jedoch im Streitfall unwirksames Recht bleiben. Unabhängig von der Frage nach der genauen institutionellen Gestaltung und Verfestigung des Weltbürgerrechts, sieht Kant die ersten, friedensförderlichen Ansätze zu einer Weltöffentlichkeit in dem zunehmenden wirtschaftlichen Austausch zwischen den Völkern. Insbesondere in der Friedensschrift betont Kant nachdrücklich die vergemeinschaftende Kraft des Handelsgeists. Kant geht dabei davon aus, dass „unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten (Mitteln) die Geldmacht wohl die zuverlässigste“704 ist. Im Fortgang stellt er die folgende These auf: „Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, und der früher oder später sich jedes Volks bemächtigt“.705 Es ist also für Kant der „wechselseitige[] Eigennutz“706, welcher die Hoffnung auf einen Fortschritt zu einem weltbürgerlichen Zustand berechtigt. Es ist, um es anders zu formulieren, das gemeinsame Interesse an Handel und Wohlfahrt einerseits sowie die wirtschaftlichen Schäden des Krieges andererseits, die uns hoffen lassen, dass die Menschen immer weniger bereit sein werden Kriege zu führen. Selbst wenn Kant sich in der Friedensschrift vornehmlich auf die völkerverbindende Kraft der grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen konzentriert, spricht nichts dagegen, davon auszugehen, dass durch das allgemeine Besuchsrecht jeglicher möglicher politischer, wissenschaftlicher, sozialer und kultureller Austausch zwischen den Völkern befördert wird. Kant weiß sehr wohl, dass die Menschen und Völker aufeinander angewiesen sind. Die Zunahme der grenzüberschreitenden Austausche jeglicher Art soll dazu beitragen, dass trotz der Verschiedenheit der Sprachen und Religionen707 sich allmählich ein Gefühl der wechselseitigen Abhängigkeit und der sich daraus ergebenden Solidarität zwischen den Menschen und Völkern entwickelt. Kant hat die zunehmende Interdependenz, die sich aus dem unbehinderten Verkehr von Menschen, Waren und Informationen ergibt, vorhergesehen. 701 Vgl. Geismann, Georg: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 385. 702 Frieden: VIII, 360 703 Vgl. Frieden: VIII, 383; Die angegebene Textstelle bezieht sich auf das Völkerrecht. Ferner schreibt aber Kant, dass aufgrund der Analogie von Völkerrecht und Weltbürgerrecht jene Maxime, die für das Völkerrecht gilt, ebenfalls für das Weltbürgerrecht gilt (Vgl. Frieden: VIII, 384). 704 Frieden: VIII, 368 705 Frieden: VIII, 368 706 Frieden: VIII, 368 707 Vgl. Religion: VI, 123 - 121 - In der Idee spricht Kant in Bezug auf Europa von einem „sehr verketteten Welttheil“.708 In der Friedensschrift betont Kant, dass die Kommunikationsmittel seiner Zeit, wie etwa das Schiff oder das Kamel, es den Menschen ermöglichen sich Menschen anderer Kontinente zu nähern und mit ihnen in Verkehr zu kommen. Kants zufolge müssen die zunehmenden Beziehungen der Völker untereinander dazu führen, dass „Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird“709 bzw. dass „Übel und Gewaltthätigkeit an einem Orte unseres Globs an allen gefühlt wird“.710 Kant ist sich allerdings dessen bewusst, dass diesem gewünschten, wachsenden Bewusstsein der wechselseitigen Angewiesenheit dem „Charakter des Volks“ entgegensteht, für den die „Verachtung aller Auswärtigen ein trotziges Betragen gegen jeden anderen [ist], aus vermeinter Selbständigkeit, wo man keines anderen zu bedürfen, also auch der Gefälligkeit gegen andere sich überheben zu können glaubt“.711 Aus dem allen Menschen zustehenden allgemeinen Besuchsrecht erhofft sich Kant eine allmähliche Entwicklung der Verhältnisse der Staaten untereinander. In der Friedensschrift spricht Kant die Hoffnung aus, dass die zwischenmenschlichen Verhältnisse, die durch dieses Recht geschaffen werden, letztlich dazu führen, dass sogar „entfernte Welttheile mit einander friedlich in Verhältnisse kommen, die zuletzt öffentlich gesetzlich werden“.712 Kant hofft also, dass die zunehmenden Verhältnisse zwischen den Bürgern verschiedener Staaten auch zu rechtmäßigeren Verhältnisse zwischen den einzelnen Staaten führen werden. Wichtig ist dabei zu sehen, dass Kant die Aufgabe der Friedensstiftung in die Hände der einzelnen Menschen legt. Nicht nur der moralische Politiker, sondern auch die einzelnen Menschen sind für die Friedensstiftung zuständig. Der Fortschritt zum Besseren kann nicht nur von Oben herab (top-down approach), sondern ebenfalls von Unten hinauf (bottom-up approach) geschehen. Der Beitrag der einzelnen Menschen als Weltbürger zum Weltfrieden wird von Kant nicht näher thematisiert. Er besteht zumindest darin, dass sie ihren Geschäften mit Menschen anderer Staaten nachgehen, und dabei auf Gewalt verzichten. Durch die Ausbreitung der Handelsbeziehungen zwischen den Menschen und Völkern erhofft sich Kant eine korrespondierende Zivilisierung der Verhältnisse der Staaten zueinander. Es zeigt sich, dass das Weltbürgerrecht der Ausdruck des einen menschlichen angeborenen Rechts auf den rechtsgesetzlichen Gebrauch seiner äußeren Freiheit ist, welches jedem Menschen kraft seiner Menschheit zukommt. Es bestätigt eine grundlegende Einheit des menschlichen Geschlechts jenseits seiner Fragmentierung in einer Vielfalt staatlich verfasster Gemeinschaften. Das Weltbürgerrecht ist dasjenige Recht, das die Menschen über ihre trennenden ethnischen, religiösen oder sprachlichen Unterschiede hinweg als Menschen der einen Welt verbindet. Ohne Unterschied der ethnischen Herkunft, der Religion und der Sprache können die Weltbürger gleichberechtigt als Menschen friedlich in Kontakt zueinander kommen. 2.4 Über das Verhältnis der Definitivartikel zueinander Abschließend zu diesem zweiten Kapitel soll noch kurz auf die Frage eingegangen werden, in welchem systematischen Zusammenhang die drei Definitivartikel und die darin enthaltenen vernunftrechtlichen Gebote zueinander stehen. Die hier u. a. im Anschluss an Reinhard Brandt aufgeworfene Frage ist jene nach ihrer „zeitlichen Strukturierung“.713 Mit 708 Idee: VIII, 28 Frieden: VIII, 360 710 RL: VI, 353 711 Anthropologie: VII, 331 712 Frieden: VIII, 358 713 Brandt, Reinhard: Vernunftrecht und Zeit bei Kant, in: Recht zwischen Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire. Deutsch-französisches Symposion, hrsg. v. Jean-François Kervégan und Heinz Mohnhaupt, Frankfurt 1997, S. 62. 709 - 122 - anderen Worten: In welcher Reihenfolge sollen die einzelnen Rechtsschritte auf dem Weg zum ewigen Frieden begangen werden? Dass Kant sich hinreichend bewusst war, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht gibt, ist unzweifelhaft. Kant war sich bewusst, dass die Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen der Republikanisierung in den einzelnen Staaten förderlich ist, und dass umgekehrt die Republikanisierung der einzelnen Staaten dem allgemeinen Frieden näher macht. Umgekehrt war er sich bewusst, dass die Bereitschaft und Fähigkeit der Staaten sich allmählich zu republikanisieren von der Verrechtlichung und dem damit verbundenen Maß an Sicherheit der internationalen Beziehungen abhängig war. In der Friedensschrift ist zum Beispiel folgendes zu lesen: „Was aber das äußere Staatenverhältniß betrifft, so kann von einem Staat nicht verlangt werden, daß er seine, obgleich despotische, Verfassung […] ablegen solle, so lange er Gefahr läuft, von andern Staaten sofort verschlungen zu werden; mithin muß bei jenem Vorsatz doch auch die Verzögerung der Ausführung bis zu besserer Zeitgelegenheit erlaubt sein“.714 Die Frage, die sich im Anschluss daran stellt, ist, ob dem Staatsrecht, dem Völkerrecht oder dem Weltbürgerrecht den Vorrang gebührt? Reinhard Brandt fasst seine These folgendermaßen zusammen: „Vor 1795 nimmt Kant die Präzedenz eines Völkerbundes vor der rechtlichen Ordnung der Staaten an; 1795 lautet dagegen die Reihenfolge: Erst die Republik, dann der – modifizierte – Völkerbund“.715 In seinen Schriften aus den Jahren 1784 und 1793 scheint Kant tatsächlich die Meinung zu vertreten, dass die innere Verfassung der einzelnen Staaten weitgehend von der Gestaltung ihrer äußeren Verhältnisse abhängig ist. Die Errichtung einer republikanischen Verfassung in den einzelnen Staaten würde von der vorhergehenden Stiftung eines Völkerbundes als Weltrepublik abhängen. Ohne die Stiftung eines Völkerbundes, welcher dem Naturzustand der Staaten untereinander ein Ende setzt, wäre eine Republikanisierung der einzelnen Staaten kaum zu hoffen.716 Aufschlussreich ist im hier diskutierten Zusammenhang unter anderem die folgende Reflexion: „Durch den allgemeinen Frieden allein […] kan auch das innere der bürgerlichen Verfassung allein ihre Vollkommenheit gewinnen“.717 Erst die Schaffung eines übergeordneten Völkerbundes würde die Republikanisierung der einzelnen Staaten sowie die Verwirklichung des Weltbürgerrechts ermöglichen. In der Friedensschrift sowie in seinen anschließenden Schriften scheint Kant jedoch diese Reihenfolge zu verkehren: Erst die Republik, dann der Völkerbund heißt es alsdann. Am Anfang des Rechtswegs zum ewigen Frieden steht nicht länger der Völkerbund, welcher dann zu einem Völkerstaat als Weltrepublik wird, sondern vielmehr die Umwandlung einzelner Staaten in Republiken. Als erste von drei positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens unter Staaten nennt Kant im ersten Definitivartikel: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“.718 Erst an der zweiten Stelle stellt Kant die Forderung auf, wonach „[d]as Völkerrecht […] auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein“719 soll. Auch wenn im äußeren Verhältnis der Staaten zueinander noch der Naturzustand herrscht, kann innerhalb der einzelnen Staaten bereits eine republikanische Verfassung gestiftet werden. Es darf angenommen werden, dass für Kant die republikanischen Staaten aufgrund ihres friedlichen Charakters sich leichter aufeinander verlassen können, um zunächst einen lockeren Völkerbund, dann aber einen Völkerstaat zu stiften. Die Frage, ob der 714 Frieden: VIII, 373 Brandt, Reinhard: Vernunftrecht und Zeit bei Kant, in: Recht zwischen Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire. Deutsch-französisches Symposion, hrsg. v. Jean-François Kervégan und Heinz Mohnhaupt, Frankfurt 1997, S. 62. 716 Vgl. Idee: VIII, 24; Streit: VII, 93 717 Reflexion 1468: XV, 648 718 Frieden: VIII, 349 719 Frieden: VIII, 354 715 - 123 - Völkerbund sowie der Völkerstaat auch für despotische Staaten offen stehen sollen, wurde bereits ausführlich beantwortet. Es hat sich dabei gezeigt, dass der zweite Definitivartikel gar nicht fordert, dass die Staaten „Republiken“ im Sinne des ersten Definitivartikels sein sollen. Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken, dass das Völkerrecht im Hinblick auf die Verwirklichung des Friedens zeitlich nicht mehr an erster, sondern an zweiter Stelle steht. In der Friedensschrift ist die anratende Verlaufszeit die folgende: Zuerst die Gründung von Republiken, dann die Schaffung eines Völkerbündes, und endlich die Stiftung eines Völkerstaates als Weltrepublik und dadurch die Verwirklichung des Weltbürgerrechts. Wie im späteren Streit der Fakultäten zu entnehmen ist, gab die Französische Revolution Kant die Hoffnung, dass alle Völker bei der ersten Gelegenheit versuchen würden, ihrem Staat eine republikanische Verfassung zu geben. Diese Hoffnung erklärt auch, warum es für Kant so wichtig ist, dass ein Volk von anderen Mächten nicht gehindert werden darf, sich eine bürgerliche Verfassung zu geben, wie sie ihm selbst gut zu sein dünkt.720 An dieser Stelle ist es unbedingt erforderlich sich zu vergegenwärtigen, dass die in den Definitivartikeln enthaltenen Forderungen unbedingten Gebote der praktischen Vernunft sind. Als solche haben sie denselben Geltungsmodus.721 Dies bedeutet, dass alle drei Definitivartikel in gleicher Weise gelten. Die Forderungen der Definitivartikel sind als drei argumentativ, nicht zeitlich aufeinander folgende Rechtschritte auf dem Weg zum ewigen Frieden zu verstehen. Einleitend zu diesem zweiten Kapitel wurde bereits gesehen, dass alle drei Rechtsschritte sich zur Vollständigkeit des öffentlichen Rechts ergänzen. Erst in der Einheit des öffentlichen Rechts, das heißt in der Einheit von Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht, ist ein wirklich universeller Frieden möglich.722 Im Umkehrschluss hat dies zu bedeuten, dass der Frieden nicht durch die Verwirklichung der einen oder anderen Definitivartikel allein erreicht werden kann. Es kann also vernunftrechtlich auch keine Priorität zwischen ihnen geben. Nur mit Blick auf die zufälligen empirischen Umstände ihrer Verwirklichung, kann sich der Politiker aus pragmatischen Gründen dafür entscheiden (wenn alle Gebote nicht gleichzeitig und vollumfänglich umgesetzt werden können), zunächst an der Verwirklichung der einen oder der anderen Forderung zu arbeiten. 720 Vgl. Streit: VII, 85 Ganz abwegig ist deshalb Wolfgang Röds Ansicht, wonach die „völkerrechtliche[n] Normen […] schwächer als die Normen der staatlichen Rechtsordnung [sind]. Noch weniger bindend als die Normen des Völkerrechts sind die Normen des Weltbürgerrechts“ (Ders. (Hrsg.): Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Neuzeit, Band 3, München 2006, S. 128). 722 Vgl. RL: VI, 311 721 - 124 - 3. KAPITEL: DER WELTFRIEDEN POLITISCHE REALITÄTSSINN DER KANTISCHEN RECHTSTHEORIE VOM Im vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, dass Kants Friedenstheorie ein ganz besonderer Stellenwert unter den vielfältigen Friedensplänen zukommt, die seit der Renaissance entworfen wurden.723 Sie bietet als erste den Nachweis (und nicht etwa die bloße Annahme) darüber, dass eine friedensfähige Weltordnung lediglich durch die Stiftung von Rechtsverhältnissen zwischen allen moralischen Personen denkbar ist. Wichtig ist dabei zu sehen, dass jeder einzelner Schritt auf dem Weg zum ewigen Frieden vernunftrechtlich (und nicht etwa pragmatisch oder anthropologisch) begründet ist. Bereits hierhin liegt ein wesentlicher Aspekt des politischen Realitätssinns der Kantischen Friedenstheorie. Allein die vernunftrechtliche Begründung formaler Rechtsprinzipien, also das Absehen von jeglichen geographisch, historisch und damit auch kulturell abhängigen Argumente, ermöglicht es heterogene Staaten hinsichtlich ihres Zusammenlebens auf gemeinsame Prinzipien zu verpflichten. Es wurde ebenfalls gesehen, dass die Einhaltung der Rechtspflichten die notwendige Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens ist, weil nur auf diesem Weg die äußere Freiheit von jedermann in Bezug auf alle anderen a priori gesichert werden kann. Dieser letzte Punkt erklärt, dass seit der Veröffentlichung der Friedensschrift im Jahre 1795 und bis zum heutigen Zeitpunkt sich Kant der anhaltenden Kritik ausgesetzt sieht, ein politischer Utopist zu sein. Es wird Kant immer wieder vorgeworfen, dass seine Friedenstheorie bloße Schwärmerei sei, weil die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens, so wird behauptet, letztlich davon abhängen würde, dass die Menschen einen sittlichen Gebrauch ihres freien Willens machen.724 Den Kritikern zufolge wäre dies jedoch empirisch nicht zu erwarten. Es wird also immer wieder behauptet, dass Kants Friedenstheorie, wie auch etwa schon jene des Abbé de Saint-Pierre, in dieser Welt und unter diesen Menschen nicht realisierbar sei. Die Frage, die es vor diesem Hintergrund zu beantworten gilt, besteht darin, ob der Vorwurf utopischen Denkens auf Kants Friedenstheorie zutrifft. Der Begriff der Utopie ist dem Griechischen (Οὐτοπεία) entlehnt und bedeutet so viel wie Nirgendheim bzw. Nirgendwo. In ihrer ursprünglichen Bedeutung bezeichnet also eine Utopie einen Ort, welcher nirgendwo vorhanden ist. Der Begriff der Utopie selbst stammt bekanntlich von dem um 1516 veröffentlichten Werk De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia des englischen Humanisten Thomas Morus. Seine Beschreibung einer erdichteten Insel und der dort anzutreffenden idealen Gesellschaft, wo alle Genüsse des Lebens ohne Arbeit und Anstrengung genossen werden, gab den Anstoß zum literarischen Genre der Sozialutopie. Im Anschluss an dieses Werk hat man jedes Werk, in dem eine erfundene, ideale Gesellschaft dargestellt wird, als Utopie bezeichnet. Weitere bedeutende Utopien waren etwa Campanellas Sonnenstaat (1623), Bacons Neu-Atlantis (1626) oder Fénelons Aventures de Télémaque (1700). Darauf anspielend, bezeichnet man spöttisch auch als „utopisch“, politische und soziale Entwürfe, die nicht die Bedingungen der Möglichkeit ihrer Realisierung angeben und deshalb zwar als denkbar, jedoch nicht als realisierbar eingeschätzt werden. Bei genauem Hinschauen erweist sich der Vorwurf der Utopie bereits in Bezug auf Abbé de Saint-Pierre, wenngleich nicht als ganz unbegründet, doch als allzu einseitig und undifferenziert. In seinem Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, welches erstmals 723 Eine gute Darstellung der Friedensentwürfe von Erasmus von Rotterdam über Emeric Crucé und Saint-Pierre, bis hin zu Kant bietet der schon alte, jedoch immer noch lesenswerte und informative Band: Raumer, Kurt von: Ewiger Friede, Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, München 1953. 724 Bereits im Jahre 1797 hat Johann Adam Bergk der Kantischen Rechtstheorie vom Weltfrieden gegen den damals schon gewöhnlichen Vorwurf der Träumerei in Schutz genommen. Vgl. Bergk, Johann Adam: Briefe über Kants metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Leipzig/Jena 1797, S. 227ff. - 125 - 1711/12 und 1713 in zwei Bänden vorgelegt und 1717 um einen dritten Band ergänzt wurde, vertritt Abbé de Saint-Pierre die These, dass alle christlichen Staatsoberhäupter ein ständiges, jedoch zu jeder Zeit aufhebbares Bündnis errichten sollen, wenn sie wirklich einen dauerhaften Frieden in Europa wollen. Im Rahmen dieses europäischen Staatenbundes soll jeder Staat weiterhin autonom bleiben, wenngleich die Außen-, Zoll- und Militärpolitik auf den Bund übertragen wird. Noch zu Lebzeiten wurde Saint-Pierre europaweit vielfach diskutiert (etwa von Voltaire, Friedrich II., Leibniz oder Rousseau) und auch häufig spöttisch kritisiert. Die von Saint-Pierre wiederholte Behauptung, dass die europäischen Staatsoberhäupter tatsächlich erkennen könnten, dass ein derartiger Bund im allgemeinen sowie in ihrem jeweiligen besonderen Interesse sei, hat ihm vielfach den Vorwurf eingetragen, ein aussichtsloser und naiver Utopist zu sein.725 Dabei wird jedoch zumeist übersehen, dass es sein Verdienst ist, versucht zu haben, die von Thomas Hobbes erstmals entfaltete Lehre vom Naturzustand und vom Gesellschaftsvertrag auf das Verhältnis der Staaten untereinander zu übertragen. Wenn der Vorwurf der Utopie bereits in Bezug auf Abbé de Saint-Pierre differenziert betrachtet werden muss, so ist jener Vorwurf in Bezug auf Kant entschieden zurückzuweisen. Mit einem manchmal scharfen polemischen Ton wehrt sich Kant selbst gegen diesem Vorwurf. In einer Anmerkung aus dem Streit der Fakultät setzt Kant seine Hoffnung auf einen Rechtsfortschritt ausdrücklich von „Platos Atlantica, Morus‘ Utopia, Harringtons Oceana und Allais‘ Severambia“726 ab. Kants einsichtige Sichtweise lässt sich bereits aus der geschichtsphilosophischen Schrift von 1784 festhalten, wo zu lesen ist, dass die Menschen noch die „härtesten Übel“ und alle „Verwüstungen, die der Krieg anrichtet“727 erdulden müssen, ehe ein Zustand des Weltfriedens erreicht werden könne. Gleich zu Beginn der Friedensschrift bekennt Kant, dass „die Menschen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhäupter [den] Krieg[] nie satt werden können“, und dass der ewige Frieden ein „süße[r] Traum“728 ist, welchem nur die Philosophen haben. Im weiteren Verlauf des Textes und insbesondere im ersten Zusatz »Von der Garantie des ewigen Friedens« versucht er nachzuweisen, dass der ewige Frieden ein „nicht bloß schimärische[r]“729 Zweck, mithin ein Hirngespinst sei. Am Ende der Friedensschrift kommt Kant letztlich zum Schluss, dass der ewige Frieden „keine leere Idee, sondern eine Aufgabe [ist], die, nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele […] beständig näher kommt“.730 Fraglich ist, wie und inwiefern es Kant gelungen ist, einen konsistenten Nachweis für die Möglichkeit des ewigen Friedens zu geben. Darauf soll im folgenden Kapitel näher eingegangen werden. Es soll dabei gezeigt werden, dass die Vorwürfe der Utopie und des Wunschdenkens nicht für tragfähig gehalten werden können. Solche Vorwürfe übersehen insbesondere, dass die Bindung des allgemeinen Rechtsgesetzes an das allgemeine Sittengesetz seine Legitimation begründet, nicht aber notwendigerweise dessen Wirksamkeit. Entgegen einer immer wieder neu formulierten Kritik soll hier die These bekräftigt werden, dass Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden nicht einfach als Träumerei eines weltfremden Philosophen abgewiesen werden kann, weil ihre Notwendigkeit ausnahmslos vernunftrechtlich begründet ist und ihre Möglichkeit keinesfalls von der moralisch-guten Gesinnung der Menschen abhängt. Des Weiteren soll gezeigt werden, dass es Kant gelungen ist, zu beweisen, dass die natürliche Entwicklung der menschlichen Gattung tendenziell auf einen derartigen Zustand 725 Einen informativen Überblick über diese Frage bietet der folgende Sammelband: Ferrari, Jean/Simone, Goyard-Fabre (Hrsg.): L’année 1796: sur la paix perpétuelle de Leibniz aux héritiers de Kant, Paris 1998. 726 Streit: VII, 92; Vgl. Gemeinspruch: VIII, 276; Frieden: VIII, 343 727 Idee: VIII, 26 728 Frieden: VIII, 343 In einem Brief an Kiesewetter vom 15. Oktober 1795 spricht Kant ebenfalls von seinen „reveries“ zum ewigen Frieden (Brief: XII, 45). 729 Frieden: VIII, 368 730 Frieden: VIII, 386 - 126 - des Weltfriedens hinauslaufe. Er beruft sich in diesem Zusammenhang unter anderem darauf, dass die Stiftung und Erhaltung einer republikanischen Verfassung selbst einem Volk selbstinteressierter Teufel auf Dauer gelingen kann, sofern jene mit Verstand begabt sind. Kant gibt zu, dass die republikanische Verfassung die schwerste zu stiften, vielmehr aber noch zu erhalten ist. Wenn die Stiftung und Erhaltung einer derartigen Verfassung lediglich von der Moralität der Menschen abhängen würde, dann könnte man mit gewissen Gründen bezweifeln, ob die Menschen je dieser Verfassung fähig wären. In der Tat müsse es sich in diesem Fall um einen „Staat von Engeln“731 handeln. Das folgende Kapitel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil untersucht die juridische Legalität als notwendige und zugleich hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens (1). Das von Kant in der Garantieerklärung zum ewigen Frieden vorgetragene Gedankenexperiment bezüglich des Volks von Teufeln zeigt, dass die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens keinesfalls an die moralische Gesinnung der Menschen gebunden ist. Da das Recht sich mit der äußeren Freiheit zufrieden gibt, genügt das wohlverstandene Eigeninteresse. Der zweite Teil über das Böse in Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden weist die Kritik zurück, Kants selbstsüchtige Teufel seien noch zu engelhaft (2). Es wird sich dabei herausstellen, dass Kants hoch differenzierter Begriff des Bösen kein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zum ewigen Frieden darstellt. Selbst aus der Annahme eines bösen Prinzips im Menschen kann nicht auf die Unmöglichkeit der Stiftung eines Zustandes des ewigen Frieden geschlossen werden. 1. Die juridische Legalität als notwendige und hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens 1.1 Die Einschränkung der juridischen Forderungen auf die Legalität der Handlungen Im Ersten Zusatz der Friedensschrift übernimmt Kant die seit Aristoteles732 klassisch gewordene Unterscheidung vom „guten Mensch“ und „guten Bürger“.733 Kant zufolge ist es weder erforderlich, noch empirisch zu erwarten, dass der Bürger ein „guter Mensch“ sei (mithin aus moralischer Gesinnung handelt). Es reicht aus und macht übrigens keinen empirisch sichtbaren Unterschied, wenn der Mensch ein „guter Bürger“ ist (sich mithin aus welchem Grund auch immer an das allgemeine Rechtsgesetz hält). Das allgemeine Rechtsgesetz ist „zwar ein Gesetz, welches mir eine Verbindlichkeit auferlegt, aber ganz und gar nicht erwartet, noch weniger fordert, daß ich ganz um dieser Verbindlichkeit willen meine Freiheit auf jene Bedingungen selbst einschränken solle“.734 Bemerkenswert ist, dass Kant an keiner Stelle seiner Schriften die Moralität der Gesinnung als eine notwendige Bedingung der Möglichkeit des Weltfriedens nennt. Im Gegensatz zu dem, was überraschenderweise heute noch gelegentlich zu lesen ist735, fordert Kant ausschließlich die von den Bewegungsgründen völlig absehende bloße Erfüllung der Rechtspflichten. Es geht also lediglich um die juridische Legalität, nicht zusätzlich um die Moralität. Wenn der Friede davon abhängen würde, dass die Menschen einen sittlich-moralischen Gebrauch ihres freien Willens machen, dann könnte befürchtet werden, dass die Stiftung eines Friedenszustandes ad calendas graecas ausgesetzt wird. 731 Frieden: VIII, 366 Vgl. u. a. Politik: III, 4, 1276 b 20-35 733 Vgl. Frieden: VIII, 366 734 RL: VI, 231 (meine Hervorhebungen) 735 Es ist schwer zu verstehen wie Reinhard Brandt behaupten kann, dass „in der Friedensschrift […] der gute Wille vielfältig als conditio sine qua non der Republik angerufen“ wird. Vgl. Brandt, Reinhard: Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 79. 732 - 127 - Mehrere Textstellen können als Beleg hierfür angeführt werden. Im siebten Satz der Idee stellt Kant beispielsweise fest, dass die Menschen im hohen Grade kultiviert und zivilisiert sind, jedoch noch weit davon entfernt sind, schon moralisiert zu sein.736 In der Religionsschrift schreibt Kant nüchtern, dass es nicht zu erwarten sei, dass die Menschen wahrhaft moralisch handeln, denn „wie kann man […] erwarten, daß aus so krummem Holze etwas völlig Gerades gezimmert werde?”.737 In der Friedensschrift schreibt Kant, dass man „an den wirklich vorhandenen, noch sehr unvollkommen organisirten Staaten sehen [kann], daß sie sich doch im äußeren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nähern, obgleich das Innere der Moralität davon sicherlich nicht die Ursache ist“.738 An einer einzigen Textstelle in der Friedensschrift sieht es zunächst so aus, als würde Kant die Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens von der moralisch-guten Gesinnung der Menschen abhängig machen. Dort ist zu lesen, dass man den ewigen Frieden „nicht bloß als physisches Gut, sondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgehenden Zustand wünscht“.739 Festzuhalten ist im hier diskutierten Zusammenhang, dass Kant für die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens die sittliche Achtung vor dem moralischen Gesetz zwar für wünschenswert, dennoch nicht für notwendig hält. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Kant im späteren Streit der Fakultät seine früheren Ausführungen zum Teil rückgängig machen. Dort sieht Kant in die Teilnehmung externer Zuschauer an der Französischen Revolution das Zeichnen einer parallelen Revolution in der öffentlichen Denkungsart. Diese Teilnahme von Menschen, die nicht selbst in den Taten und Untaten der Revolution verwickelt sind und deren Äußerung mit Gefahr verbunden sein kann, beweist „einen moralischen Charakter“ des Menschengeschlechts, „der das Fortschreiten zum Besseren nicht allein hoffen lässt, sondern selbst schon ein solches ist“.740 Die Teilnahme am Kampf für die Stiftung einer republikanischen Verfassung sieht Kant als das Ergebnis einer „moralische[n] einfließende[n] Ursache“741, das will heißen als Folge der Präsenz der Rechtsidee, die sich sogar in einem Enthusiasmus für den Rechtsbegriff ausdrücken lässt. Kant sieht darin den Beweis für die „moralische Tendenz des Menschengeschlechts“.742 Es ist weder der Eigennutz des Volks von Teufeln noch die moralische Gesinnung des einzelnen Politikers, sondern der Enthusiasmus der Rechtsbehauptung für das menschliche Geschlecht, von welchem die Stiftung und Erhaltung der republikanischen Verfassung erwartet werden kann. Wie jeder Affekt ist auch dieser Gemütszustand blind. Aus diesem Grunde kann die Vernunft ihn nicht ganz billigen. Kant führt jedoch aus, dass wahrer Enthusiasmus immer auf das rein Moralische zurückgeht und nicht auf den Eigennutz der Menschen zurückgeführt werden kann. Andere Textstellen im Streit der Fakultät zeigen jedoch, dass Kant an der Einschränkung der juridischen Forderungen auf bloß pflichtgemäße Handlungen festhält. Im Abschnitt unter der Überschrift »Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei« führt Kant unmissverständlich aus: „Nicht ein immer wachsendes Quantum der Moralität in der Gesinnung, sondern Vermehrung der Producte ihrer Legalität in pflichtmäßigen Handlungen, durch welche Triebfeder sie auch veranlaßt sein mögen […] wird der Ertrag (das Resultat) der Bearbeitung desselben zum Besseren allein gesetzt werden können“.743 Festzuhalten ist hier, dass die juridische Legalität eine hinreichende Bedingung für die Schaffung eines Zustands des Weltfriedens ist. Im Text 736 Vgl. Idee: VIII, 26 Religion: VI, 100 738 Frieden: VIII, 366 739 Frieden: VIII, 377 (meine Hervorhebung) 740 Streit: VII, 85 741 Streit: VII, 85 742 Streit: VII, 85 743 Streit: VII, 91 (meine Hervorhebung) 737 - 128 - heißt es ferner ebenso deutlich: „Allmählich wird der Gewaltthätigkeit von Seiten der mächtigen weniger, der Folgsamkeit in Ansehung der Gesetze mehr werden. Es wird etwa mehr Wohlthätigkeit, weniger Zank in Processen, mehr Zuverlässigkeit im Worthalten u.s.w. theils aus Ehrliebe, theils aus wohlverstandenem eigenen Vortheil im gemeinen Wesen entspringen und sich endlich dies auch auf die Völker im äußeren Verhältniß gegen einander bis zur weltbürgerlichen Gesellschaft erstrecken, ohne daß dabei die moralische Grundlage im Menschengeschlechte im mindesten vergrößert werden darf“.744 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kant in Bezug auf den ewigen Frieden kein naiver Träumer ist, sondern vielmehr eine bescheidende und zugleich realistische These vertritt. Für ihn ist die bloße Erfüllung der Rechtspflichten, unabhängig von den Bewegungsgründen derselben, die notwendige und hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens. Kants Begründung der Möglichkeit des ewigen Friedens kann vor diesem Hintergrund nur schwerlich als die „Träumerei eines überspannten Kopfs“745 abgewiesen werden. In systematischer Hinsicht lässt sich die Beschränkung der juridischen Forderungen auf die bloße Legalität aus zweierlei Gründen als folgerichtig begründen. Erstens: Die Forderung nach moralischem Handeln ist nicht nur unmöglich äußerlich zu erzwingen, sondern lässt sich vor allem gegenüber anderen Menschen rechtlich gar nicht begründen, da die in der Rechtslehre formulierten Gesetze sich ausschließlich auf den Gebrauch der äußeren Freiheit beziehen. Die Prinzipien des Rechts betreffen nicht den Gebrauch der inneren Freiheit.746 Zweitens: Ob die Erfüllung bloß aus Neigung oder aus Pflicht geschieht, macht rechtlich gar kein Unterschied, da es sich phänomenal um identische Handlungen handelt.747 Wenn ein Mensch sich bloß aus Neigung an das allgemeine Rechtsgesetz hält, so macht dies rechtlich gar kein Unterschied, als wenn er die gebotene Handlung aus Pflicht durchführen würde. Mit der Erfüllung der kategorisch gebotenen Handlung ist die Pflicht als Rechtspflicht vollständig erfüllt. Für Kant ist nämlich das unbedingt Gute nichts anderes als der gute Wille selbst, das heißt der Wille zur Pflicht um dieser selbst willen. Eine Handlung gilt nur dann als moralisch, wenn sie rein aus Pflicht, das heißt ohne Rücksicht auf die sinnlichen Triebfedern, geschieht. Da es bei einer moralischen Handlung allein auf den guten Willen ankommt, lässt sich Moralität nicht empirisch aus einem beobachtbaren Verhalten feststellen. Nur die Legalität des Verhaltens tritt in Erscheinung, niemals aber die Moralität der Gesinnung. Ausschlaggebend ist lediglich, dass die Rechtspflicht überhaupt erfüllt wird. Wohlgemerkt macht es nicht nur moralisch (mit Bezug auf die Moralität der Menschen), sondern auch empirisch (mit Bezug auf die Zuverlässigkeit des Friedens) einen grundsätzlichen Unterschied. In der Tat steigt die Zuverlässigkeit der Erfüllung der Rechtspflichten, wenn die Menschen diese aus moralischer Gesinnung durchführen. Dies liegt darin begründet, dass die Erfüllung in diesem Fall nicht von den menschlichen Neigungen und somit von kontingenten Umständen, abhängig ist.748 Der erwähnte Unterschied bezüglich der empirischen Zufälligkeit der Pflichterfüllung, und somit letztlich bezüglich der Dauerhaftigkeit des Friedens, lässt 744 Streit: VII, 91f. (meine Hervorhebung) Streit: VII, 92 746 Volker Gerhardt hat dies folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Es geht nicht um die Einstellung der Individuen zu sich selbst, also auch nicht um ihre Überzeugungen oder ihren Glauben, sondern nur um die Worte und Taten, mit denen sie sich wechselseitig Schaden zufügen können“. Vgl. Ders.: Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik, in: Kants in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Yasushi Kato und Gerhard Schönrich, Frankfurt a. M. 1996, S. 477. 747 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende. Studien zur Rechtsphilosophie, Band 2, Würzburg 2010, S. 146; Ders.: World Peace: Rational Idea and Reality. On the Principles of Kant’s Political Philosophy, in: Kant. Analysen - Probleme - Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Würzburg 1996, S. 294f. 748 Vgl. Religion: VI, 30f. 745 - 129 - jedoch den rechtslogischen Beweis der Notwendigkeit und Möglichkeit des Friedens schlechterdings unberührt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kant die juridische Forderung auf die bloße Legalität der Handlungen beschränkt. Die Moralität ist keine notwendige Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens. Dies zu zeigen ist auch der Sinn des Gedankenexperiments bezüglich des Volkes von Teufeln. 1.2 Das Gedankenexperiment bezüglich des Volks von Teufeln In der Friedensschrift führt Kant die folgende These aus: „Das Problem der Staatserrichtung ist […] selbst für ein Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben), auflösbar“.749 Kants vertritt hier die These, dass die Staatserrichtung (und, wie noch zu sehen sein wird, sogar die Errichtung einer Republik) selbst einem Volk von Teufeln gelingen kann, insofern jene mit Verstand begabt sind. Die republikanische Verfassung ist somit nicht allein durch das Handeln eines moralischen Politikers zu erwarten, sondern kann durch Teufel selbst errichtet werden. Kants Erläuterung diesbezüglich verdienen ausführlich zitiert zu werden: „Eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesammt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegen streben, diese einander doch so aufhalten, daß in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg eben derselbe ist, als ob sie keine solche böse Gesinnungen hätten“.750 Im Folgenden soll auf diese gedrängte, häufig nicht besonders ernst genommene Argumentation näher eingegangen werden. Ehe die Argumentation selbst dargestellt und erläutert wird, ist es erforderlich die Garantieerklärung kurz im Rahmen der Friedensschrift einzuordnen. Im Anschluss daran soll erläutert werden, was Kant unter dem Ausdruck „Volk von Teufeln“ versteht. Kant hat die zuvor zitierte Argumentation im ersten Zusatz des ewigen Friedens unter der Überschrift »Von der Garantie des ewigen Friedens« durchgeführt.751 Dieser erste Zusatz gliedert sich in drei Teile: Nach den einleitenden Bemerkungen zeigt Kant die Weisheit der Vorsehung im Hinblick auf die Menschengattung und die Gewähr, dass der Mensch von der Natur dazu genötigt wird, letztlich das zu machen, was er nach Freiheitsgesetzen tun sollte, und zwar in den Bereichen des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts. In den folgenden Ausführungen werden wir uns vornehmlich auf den dritten Teil des ersten Zusatzes konzentrieren. Die Garantieerklärung bezieht sich auf eine Situation, in welcher die Natur dem Mensch als Gattung zu etwas zwingt, was er vernunftrechtlich tun soll, jedoch nicht von sich aus tut. In der Friedensschrift schreibt Kant folgendes dazu: „Wenn ich von der Natur sage: sie will, daß dieses oder jenes geschehe, so heißt das nicht soviel, als: sie legt uns eine Pflicht auf, es zu thun (denn das kann nur die zwangsfreie praktische Vernunft), sondern sie thut es selbst, wir mögen wollen oder nicht“.752 Die Behauptung, dass die Natur die Menschen zu etwas zwingt, gleichwohl ob sie es wollen oder nicht, wiederholt Kant zweimal im weiteren Verlauf des Textes („Die Natur will unwiderstehlich“753; „Die Natur will es anders“754). Die Garantie der Natur betrifft eine Situation, in welcher der Mensch nicht von sich aus seine Rechtspflicht erfüllt. Die Natur wird ihn dazu nötigen sich an das allgemeine Rechtsgesetz zu halten, wenn nicht aus moralischer Gesinnung, dann zumindest aus wohlverstandenem Eigeninteresse. 749 Frieden: VIII, 366 Frieden: VIII, 366 751 Vgl. Frieden: VIII, 360ff. 752 Frieden: VIII, 365 (meine Hervorhebungen) 753 Frieden: VIII, 367 754 Frieden: VIII, 367 750 - 130 - Das im ersten Zusatz vorgetragene Gedankenexperiment bezüglich des Volks von Teufeln knüpft an das Problem an, welches Kant im fünften Satz der Schrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht aufgeworfen hat. Dort heißt es: „Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft“.755 Erklärungsbedürftig ist im hier diskutierten Zusammenhang von wem und wozu der hier erwähnte Zwang ausgeübt wird. In den anschließenden Ausführungen Kants lassen sich erste Antwortansätze finden. Bezüglich der ersten Frage schreibt Kant in der Schrift von 1784, dass es die Not ist und deren zugrunde liegenden Neigungen, welche den Menschen zwingen, in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand zu treten. Die Stiftung eines derartigen Zustandes ist das Ergebnis der menschlichen Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren und so die Naturanlage im Menschen vollständig und zweckmäßig zu entwickeln. Diesbezüglich spricht Reinhard Brandt zu Recht vom „natürlichen Zwang zum rechtlichen Zwang“.756 In Bezug auf die Frage nach dem „wozu“ bleibt es zunächst offen, ob Kant unter der „allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft“757 allgemein jede beliebige Staatsform oder spezifisch die republikanische Verfassung im Sinne hat. Auch in der Friedensschrift ist zunächst nur vom „Problem der Staatserrichtung“758 die Rede. Im Kontext der vorherigen Ausführungen Kants in der Friedensschrift lässt sich die Antwort jedoch relativ leicht finden. Es kann sich lediglich um die republikanische Verfassung handeln, denn es versteht sich von selbst, dass die Teufel zur machtgestützten Errichtung einer despotischen Verfassung fähig sind. 1.3 Die mit Verstand begabten selbstsüchtigen Teufel und der Mechanismus der Natur a) Die Gegenüberstellung vom „Staat von Engeln“ und „Volk von Teufeln“ In der zuvor zitierten Argumentation stellt Kant dem „Staat von Engeln“ das „Volk von Teufeln“ gegenüber.759 Was unter den Ersteren zu verstehen ist, bereitet keine großen Schwierigkeiten: Engel sind vollkommen vernünftige Wesen, die als solche immer und von sich aus moralisch handeln.760 Es handelt sich somit um heilige Wesen, deren Willen unausbleiblich durch die reine praktische Vernunft bestimmt sind. Was dagegen unter den erwähnten Teufeln genau zu verstehen ist, und inwiefern sich jene von den Menschen unterscheiden, ist zunächst unklar. Mit Sicherheit kann in Bezug auf die Teufel das gesagt werden, was auch für die Menschen gilt, nämlich dass ihre Handlungen von „selbstsüchtigen Neigungen“761 bestimmt werden und sogar dass sie „unfriedliche[] Gesinnungen“762 haben. Der Wille des Teufels ist somit durch egoistische Neigungen bestimmt, und seine Handlungsmaximen haben bloß den wohlverstandenen eigenen Vorteil zum Zweck. Teufel sind Wesen, deren Willen nicht (oder nicht hinlänglich) durch die reine praktische Vernunft 755 Idee: VIII, 22 Brandt, Reinhard: Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 72 (meine Hervorhebung). 757 Idee: VIII, 22 (die von Kant durch kursive Kennzeichnung hervorgehobenen Wörter wurden aufgehoben) 758 Frieden: VIII, 366 (meine Hervorhebung) 759 Vgl. Frieden: VIII, 366 760 Vgl. GMS: IV, 412 761 Frieden: VIII, 366 762 Frieden: VIII, 366 756 - 131 - bestimmt sind. Die neigungsbestimmten Teufel sind zugleich mit Verstand begabt.763 Gemeint ist das Vermögen, sich selbst willkürliche Zwecke zu setzen und auf Basis dieser Zwecke sein Handeln zu bestimmen.764 Sie können jedoch mit ihren Neigungen rational umgehen, das will heißen, sie können Präferenzen ausdrücken und widerstreitende Interessen in eine hierarchische Ordnung bringen. Auf dieser Grundlage können sie rational handeln, um ihren wie auch immer definierten eigenen Nutzen zu maximieren. Kant schreibt sogar, dass die Teufel „vernünftige[] Wesen“765 sind. Erklärungsbedürftig ist an dieser Stelle, um was für eine Vernunft es sich dabei handelt. Unter der Vernunft im weiteren Sinne versteht Kant „das ganze obere Erkenntnisvermögen“.766 Jene umfasst Verstand, Urteilskraft und Vernunft im engeren Sinne. Letztere ist „das Vermögen der Prinzipien“767, oder genauer „das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien“.768 Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, soll hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kants Bestimmung der Teufel als vernünftige Wesen mitnichten zu bedeuten hat, dass deren Willen durch reine praktische Vernunft bestimmt sind. Kant schreibt nämlich, dass die Teufel vernünftige, und nicht bloß mit Vernunft begabte Wesen sind. Wenn aber der Wille der Teufel tatsächlich durch die reine praktische Vernunft bestimmt ist, dann würden sie von sich aus moralisch handeln. In der Folge würde es auch keinen Unterschied mehr zwischen Teufeln und Engeln geben, so dass das gesamte Gedankenexperiment bezüglich des Volks von Teufeln keinen Sinn mehr machen würde. Die Teufel haben keine moralisch-praktische Vernunft, sondern lediglich eine technisch-praktische. Die technischpraktische Vernunft gibt wiederum sowohl Regeln der Geschicklichkeit als auch Ratschläge der Klugheit.769 Es zeigt sich, dass Kants Verständnis der selbstsüchtigen Teufel sich grundsätzlich von der christlichen Darstellung des Teufels als Personifizierung des Bösen unterscheidet. In der christlichen Theologie wird nämlich der Teufel als ein aus dem Himmel gefallener Engel angesehen, welcher sich gegen Gott auflehnte und seitdem die Welt heimsucht. Der Teufel tritt als Versucher und Verführer auf. Es wird angenommen, dass die Schlange, welche Eva zur Erbsünde verführte, vom Teufel benutzt wurde bzw. eine Erscheinungsform des Teufels war (Offenbarung 12, 9 und 20, 2). Kants Verständnis der selbstsüchtigen Teufel unterscheidet sich aber auch von der Figur des Mephistopheles, in Johann Wolfgang Goethes Faust-Tragödie (Urfaust, Faust I, Faust II). Dort erscheint der Teufel wiederum als Prinzip der Negation alles Bestehenden: „Ich bin der Geist, der stets verneint! / Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, / ist wert, daß es zugrunde geht“.770 In Abgrenzung zu diesen herkömmlichen Figuren des Teufels sind Kants Teufel nachhaltig selbstinteressierte Wesen, welche ihr langfristiges Eigeninteresse zu maximieren suchen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Behauptung, welcher zufolge die Staatserrichtung selbst einem Volk von Teufeln gelingen könne, wenn sie nur Verstand haben, mitnichten zu bedeuten hat, dass die erwähnten Teufel aus Achtung vor dem moralischen Gesetz den rechtlosen Naturzustand verlassen werden. Diese bösen Wesen würden die Rechtsgesetze keinesfalls aus Pflicht beachten, da die Moral für sie irrelevant ist. Das Problem der Staatserrichtung interessiert sie bloß aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen stellt sich die Frage, inwiefern sich die soeben definierten Teufel von den Menschen unterscheiden. Diesbezüglich liegt zunächst die 763 Vgl. Frieden: VIII, 366 Vgl. KUK: V, 432 765 Frieden: VIII, 366 766 KrV: III, B 169 767 KrV: IV, A 405 768 KrV: III, B 359 769 Vgl. KUK: V, 172 770 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie. Erster Teil, München 1996 [1808], S. 47 (V. 1338). 764 - 132 - Vermutung nahe, dass es sich bei den Teufeln um Wesen handelt, deren Willen, im Gegensatz zum Menschen, gar nicht durch reine praktische Vernunft bestimmbar ist. Wenn dies zutrifft, dann wären die Teufel überhaupt unfähig je moralisch zu handeln. Im Grunde genommen ist es jedoch irrelevant, ob man darunter Wesen versteht, deren Willen durch reine praktische Vernunft zwar bestimmbar sind, jedoch sich dadurch nicht bestimmen lassen, oder ob es sich um Wesen handelt, die überhaupt nicht durch reine praktische Vernunft bestimmbar sind. Es reicht festzuhalten, dass Kant zufolge die selbstsüchtigen Teufel geneigt sind, insoweit es für sie vorteilhaft ist, sich vom allgemeinen Gesetz insgeheim auszunehmen und sich auch tatsächlich davon ausnehmen werden. Diesbezüglich unterscheiden sich die Teufel nicht grundsätzlich von den Menschen. Vielleicht ist es sogar nicht übertrieben zu sagen, dass man hinter der Maske des Teufels die Menschen erkennen kann, die beständig ihren Neigungen folgen. Diese Auslegung wird dadurch bekräftigt, dass Kant den Teufeln einen nur mäßigen teuflischen Charakter verleiht und außerdem nach der einmaligen Erwähnung von Teufeln im Text weiterhin ausschließlich Menschen erwähnt. Um nicht als bloß chimärisch abgewiesen zu werden, soll die Kantische Rechts- und Friedenstheorie, wie Reinhard Brandt unter Berufung auf David Hume schreibt, den „badmen-Test“771 aushalten. Auf diesen Punkt soll im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden. b) Der natürliche Zwang zum rechtlichen Zwang Kant vertritt die These, dass selbst die mit Verstand und technisch-pragmatischer Vernunft begabten Teufel, die sich von den Menschen nicht grundsätzlich unterscheiden, allmählich lernen werden sich unter den Zwang öffentlicher Gesetze zu begeben. Diese These hat Kant in den folgenden Zeilen besonders deutlich zum Ausdruck gebracht: „Denn es sind Menschen, […] welche die Übel, die sie sich unter einander selbstsüchtig anthun, bei Zunahme der Cultur nur immer desto stärker fühlen und, indem sie kein anderes Mittel dagegen vor sich sehen, als den Privatsinn (Einzelner) dem Gemeinsinn (aller vereinigt), obzwar ungern, einer Disciplin (des bürgerlichen Zwanges) zu unterwerfen, der sie sich aber nur nach von ihnen selbst gegebenen Gesetzen unterwerfen, […] die der Bestimmung des Menschen, so wie die Vernunft sie ihm im Ideal vorstellt, angemessen ist“.772 Fraglich bleibt dabei, wie dies überhaupt geschehen soll. Im Folgenden soll also auf die Frage eingegangen werden, wie die Natur von der Zwietracht der Menschen, selbst wider ihren Willen letztlich Eintracht erzeugen kann.773 Für Kant werden allmählich selbst die selbstsüchtigen Teufel einsehen müssen, dass sie ihre Zwecke am besten unter Bedingung gesicherter Rechtsverhältnisse erreichen können. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: Jeder Versuch eines Teufels, aufgrund seiner selbstsüchtigen Neigungen sich insgeheim Ausnahmen vom allgemeinen Rechtsgesetz zu verschaffen, wird ebenso und unvermeidlich durch andere Teufel versucht. In diesem Fall kann ein Handlungskonflikt nicht ausgeschlossen werden, da die eigenen Zwecke mehrerer Wesen nicht notwendigerweise miteinander übereinstimmen. Im Fall eines Handlungskonflikts kann im rechtlosen Naturzustand kein Teufel jemals vor den Gewalttätigkeiten anderer Teufel sicher sein. Die Erreichung der je eigenen Zwecke ist somit für jeden Teufel letztlich vom Willen anderer Teufeln abhängig. Wie Otfried Höffe in seiner anregenden Auslegung zeigt, ist im rechtlosen Naturzustand jeder Teufel als gewaltfähiges, 771 Brandt, Reinhard: Antwort auf Bernd Ludwig: Will die Natur unwiderstehlich die Republik?, in: Kantstudien 88, 1997, S. 231. 772 Anthropologie: VII, 329f. 773 Vgl. Frieden: VIII, 360 - 133 - jedoch zugleich sterbliches Wesen sowohl möglicher Täter als auch möglicher Opfer von Gewalt.774 Selbst die Stärksten unter ihnen können grundsätzlich nicht ausschließen, dass sie nicht einmal fremder Gewalt zum Opfer fallen werden. Mit der Zeit werden alle Teufel bemerken, dass sie mehr zu verlieren haben, wenn sie im rechtlosen Naturzustand bleiben, als wenn sie das allgemeine Rechtsgesetz befolgen. Jeder Teufel würde selbstverständlich eine Situation vorziehen, in welcher er Täter wäre ohne zugleich Opfer zu sein. Eine derartige Konstellation ist jedoch unmöglich. In Abwesenheit einer obersten Zwangsgewalt wird ein Teufel niemals seine Zwecke unabhängig von der nötigenden Willkür anderer Teufel verfolgen können. Da jeder Teufel aber vorrangig an seinem eigenen Überleben interessiert ist, wird jeder Teufel die Alternative „weder Opfer noch Täter“ der anderen „sowohl Opfer als auch Täter“ vorziehen. Kant zufolge sehen sich somit die Teufel durch den Krieg letztlich dazu genötigt „in mehr oder weniger gesetzliche Verhältnisse zu treten“.775 Sie werden nämlich verstehen, dass die Befriedigung ihrer selbstsüchtigen Neigungen unter der Bedingung gesicherter Rechtsverhältnisse maximiert wird. Erklärungsbedürftig ist lediglich, worauf sich der zuvor erwähnte Ausdruck „mehr oder weniger“ beruft. Insofern Kants Teufel mit Verstand begabt sind, sind sie dazu fähig mit anderen Teufeln einen öffentlichen Rechtszustand zu stiften, damit jeder Teufel seine eigenen wie auch immer definierten Zwecke unabhängig von einer anderen nötigenden Willkür verfolgen können. Der von den Teufeln gestiftete öffentliche Rechtszustand kann sich jedoch sowohl hinsichtlich der Herrschaftsform als auch hinsichtlich der Regierungsart stark unterscheiden. Wichtig ist lediglich festzuhalten, dass die Teufel sich verweigern werden, freiwillig auf ihre zügellose Freiheit zu verzichten, und sich einer obersten Zwangsgewalt zu beugen, wenn diese Gewalt allein in der Hand eines einzelnen Teufels steht, von deren Gebrauch sie nicht sicher sein können. Die Lösung dieses Problems ist die Stiftung einer republikanischen Verfassung, welche die Gewaltenteilung und die Mitgesetzgebung aller Teufel sichert.776 Die Menschen schließen sich allerwärts auf begrenzten Territorien zusammen und stiften mehr oder weniger republikanisch verfasste Staaten, die wiederum zunächst gegeneinander Krieg führen. Der Frieden kann erst unter der Bedingung einer sich weltweit erstreckenden Rechtsordnung erreicht werden. Die Teufel müssen somit konsequent sein. Derselbe Mechanismus, welcher sie dazu veranlasst hat die rechtsgesetzlich gesicherte Befriedigung ihrer Neigungen innerhalb einer republikanischen Verfassung zu suchen, soll sie ebenfalls dazu bringen einen Völkerstaat als Weltrepublik zu stiften und ein Weltgastrecht zu schaffen. Es ist also das Entgegenwirken ihrer selbstsüchtigen Neigungen, welches die Teufel letztlich dazu nötigt sich dem allgemeinen Rechtsgesetz zu unterwerfen. In der Friedensschrift heißt es dazu: „Das moralisch Böse hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, daß es in seinen Absichten (vornehmlich in Verhältniß gegen andere Gleichgesinnte) sich selbst zuwider und zerstörend ist und so dem (moralischen) Princip des Guten, wenn gleich durch langsame Fortschritte, Platz macht“.777 Das Problem der Errichtung und Erhaltung einer republikanischen Verfassung ist selbst für ein Volk von Teufeln, die sowohl mit Verstand als auch technisch-praktischer Vernunft begabt sind, auflösbar, weil es nicht notwendig ist, dass jene sich aus Pflicht an das allgemeine Rechtsgesetz halten. Es reicht völlig aus, dass sie sich aus wohlverstandenem Eigeninteresse an das allgemeine Rechtsgesetz halten. 774 Vgl. Höffe, Otfried: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, 2. Aufl. 2002, S. 67f.. Siehe bereits: Ders.: Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln: ein Dilemma der natürlichen Gerechtigkeit, in: Ders.: Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln: philosophische Versuche zur Rechts- und Staatsethik, Stuttgart 1988, S. 56-77. 775 Frieden: VIII, 363 776 Vgl. Laberge, Pierre: Von der Garantie des ewigen Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 163. 777 Frieden: VIII, 379 - 134 - Es zeigt sich, dass die Menschen auf zweierlei Wege zum Weltfrieden gelangen können. Sie können den ersten, sanften Weg benutzen, indem sie die Rechtspflicht von sich aus durchführen. Wenn die Menschen aufgrund ihrer selbstsüchtigen Neigungen jedoch zunächst nicht das machen, was sie machen sollen, dann wird sie die Natur letztlich dazu nötigen. Mit Kants eigenen Worten heißt es: „Die Natur will unwiderstehlich, daß das Recht zuletzt die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu thun, das macht sich zuletzt selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit“.778 Dies ist auch der Sinne der von Kant zitierten Stelle von Seneca: „Den Willigen führt, den Unwilligen treibt das Schicksal“ (fata volentem ducunt, nolentem trahunt). Die juridische Notwendigkeit der Errichtung einer republikanischen Verfassung stimmt somit mit der natürlichen Notwendigkeit zu derselben überein. Die Gebote der Vernunft und der Mechanismus der Natur konvergieren zum selben Ziel. Wenn es dem Politiker nicht gelingt, die kategorisch gebotene Stiftung einer Republik durchzuführen, wird die Natur den Menschen dazu nötigen, jedoch mit viel Verzögerung. Der zweite Weg wird am Ende zwar zum selben Ergebnis führen, allerdings wird er länger und schmerzlicher sein. Dieser Auslegung steht Bernd Ludwigs These entgegen, dass die Staats- bzw. Republikerrichtung zwar selbst für ein Volk von Teufeln auflösbar ist, jedoch nicht durch ein solches Volk von Teufeln für sich selbst.779 Ludwigs Interpretation zufolge bietet der Mechanismus der Natur allein keinen Automatismus der Staats- bzw. Republikerrichtung. Die Republikanisierung wird sich also nicht allein aus dem wohlverstandenen Eigeninteresse der Teufel ergeben, sondern erfordert, dass der moralische Politiker für die Teufel eine Republik errichtet. Ludwigs These kann jedoch nicht gänzlich überzeugen. Kants geschichtsphilosophische These, dass die Hoffnung durchaus berechtigt ist, dass das Problem der Republikerrichtung durch ein Volk von Teufeln selbst gelöst werden kann, und die rechtsphilosophische These, dass die Republikanisierung für den Staatsbürger durch den moralischen Politiker errichtet werden soll, sind genauso voneinander unabhängig wie miteinander verträglich. Wie es dem guten Bürger gelingen soll, politisch tätig zu werden, um die republikanische Verfassung zu errichten und zu erhalten, wird allerdings von Kant nicht thematisiert. Kant setzt sich nicht an die Stelle der Menschen, welche in den jeweils einzelnen Fällen zu entscheiden haben werden, wie die republikanische Verfassung am ehesten gestiftet werden kann. Dieses Problem zu lösen überlässt Kant den Menschen einer jeden Epoche. Jene werden in ihrer jeweils partikularen Situation zu entscheiden haben, wie sie ihre Verfassung einrichten wollen und können. Wichtig ist für Kant lediglich, dass dieses Problem prinzipiell auflösbar ist. Kant betont mehrmals, dass die Menschen selbst eine Lösung zum Problem der Staatserrichtung finden können.780 c) Die Unterscheidung von Legitimität und Effektivität des öffentlichen Rechts Das Gedankenexperiment bezüglich des Volkes von Teufeln erinnert uns daran, dass die Frage der Legitimität des öffentlichen Rechts von jener der Effektivität zu unterscheiden ist. Legitimatorisch beruht die Staatserrichtung, mithin die Stiftung des öffentlichen Rechts, nicht auf den hypothetischen Imperativen der Klugheit, sondern auf den kategorischen Imperativen der Sittlichkeit. Die Menschen sind kategorisch aufgefordert den rechtlosen 778 Frieden: VIII, 367 Vgl. Ludwig, Bernd: Will die Natur unwiderstehlich die Republik? Einige Reflexionen anlässlich einer rätselhaften Textpassage in Kants Friedensschrift, in: Kant-Studien 88, 1997, S. 218-228. Kritisch dazu u.a.: Brandt, Reinhard: Antwort auf Bernd Ludwig: Will die Natur unwiderstehlich die Republik?, in: Kant-Studien 88, 1997, S. 229-237. 780 Vgl. Frieden: VIII, 366 779 - 135 - Naturzustand zu verlassen und in einen bürgerlichen Zustand einzutreten, weil nur auf diesem Weg die äußere Freiheit von jedermann in Bezug auf alle anderen a priori gesichert werden kann. Zugleich wird von Kant jedoch nicht bestritten, dass die Staatserrichtung sowie seine Wahrung historisch auf Gewalt und Klugheit zurückzuführen sind. Exemplarisch hierfür schreibt Kant, dass die Menschen in der Praxis „auf keinen andern Anfang des rechtlichen Zustandes […] rechnen [können], als den durch Gewalt“.781 In der empirischen Wirklichkeit ist es ohne Bedeutung, warum sich die Menschen an das allgemeine Rechtsgesetz halten. Wichtig (und sogar unerlässlich) ist lediglich, dass sie sich überhaupt an das allgemeine Rechtsgesetz halten. Die Effektivität des öffentlichen Rechts kann also sehr wohl ohne jede Annahme über die Gutartigkeit der Menschen auskommen. Die Stiftung und Wahrung des öffentlichen Rechts kann sich allein auf das Selbstinteresse der Bürger stützten. Hinzu kommt, dass Kant das Argument, wonach die Menschen mit ihren selbstsüchtigen Neigungen einer republikanischen Verfassung unfähig wären, umdreht. Ihm zufolge darf man nicht erst die Stiftung einer republikanischen Staatsverfassung von moralisch-guten Menschen erwarten, sondern umgekehrt von einer guten Staatsverfassung die „moralische Bildung eines Volkes“.782 Die Moralisierung des Volks ist somit allein als Wirkung (und nicht als Ursache) der republikanischen Staatsverfassung zu erwarten. Der Mensch braucht gar nicht moralisch gut zu sein. Es ist notwendig und reicht auch völlig aus, dass der Mensch ein guter Bürger ist, das heißt, dass er sich an das allgemeine Rechtsgesetz hält (gleichwohl aus welchem Bewegungsgrund). Zugleich war sich Kant der Wechselwirkung von der juridischen Verfasstheit des Staates und dem moralischen Charakter der Menschen bewusst. Ihm zufolge ist das Verhältnis zwischen juridischer Staatsverfassung und moralischem Charakter der Menschen ein auf Wechselwirkung beruhendes Verhältnis. Die moralische Besserung der Menschen ist durch die Errichtung und Ausbreitung der republikanischen Verfassung erreichbar. Eine derartige Staatsverfassung ermöglicht wiederum die volle Entfaltung der moralischen Anlage im Menschen. In Kants eigenen Worten heißt es: „Die Staatsverfassung stützt sich am Ende auf die Moralität des Volkes und diese wiederum kann ohne gute Staatsverfassung nicht gehörig Wurzel fassen“.783 Es hat sich bisher herausgestellt, dass die vernunftnotwendige Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens keinesfalls davon abhängig ist, dass die Menschen einen sittlichen Gebrauch ihres freien Willens machen. Die Stiftung und Erhaltung einer republikanischen Verfassung kann vielmehr selbst selbstsüchtigen Teufeln gelingen, wenn sie nur Verstand haben. Dies ist möglich weil es völlig ausreicht, dass sie sich aus ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse an das allgemeine Rechtsgesetz halten. Kants selbstsüchtige Teufel sind jedoch bloße „Modellwesen“.784 Aus diesem Grund soll noch die Frage gestellt werden, ob ihre Modellisierung genügend der Erfahrung entspricht. Vor diesem Hintergrund wird Kant gelegentlich vorgeworfen, dass seine selbstsüchtigen Teufel noch allzu engelhafte Züge aufweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass Kant es nicht wahrhaben wollte, dass das Böse im Menschen nicht bloß auf Selbstliebe, mithin auf Egoismus beschränkt bleibt. Im Anschluss daran wird die Frage aufgeworfen, ob die Stiftung eines Zustandes des ewigen Friedens tatsächlich möglich bleibt, wenn das Böse in vollem Umfang anerkannt wird. 781 Frieden: VIII, 371 Frieden: VIII, 366; Vgl. Idee: VIII, 26 783 Vorarbeit: XXIII, 162; Vgl. auch Religion: VI, 94 784 Brandt, Reinhard: Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 74. 782 - 136 - 2. Über das Böse in Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden 2.1 Kants Lehre vom radikalen Bösen Um diese Frage überhaupt beantworten zu können, muss man sich näher für den Zusammenhang von Kants Lehre vom radikalen Bösen und seiner Rechtstheorie vom Weltfrieden interessieren. Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um ein Thema handelt, welcher über eine lange Zeit hinweg nur wenig Aufmerksamkeit nach sich gezogen hat. Dies ist insofern überraschend, als Kant den Begriff des Bösen vielfach, sowohl in seiner allgemeinen Ethik als auch in seiner Friedenstheorie, verwendet. Am ausführlichsten widmet sich Kant jedoch dem Bösen in der 1793 erschienenen Schrift Über die Religion innerhalb der bloßen Vernunft. Im Ersten Stück unter der Überschrift »Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem guten: oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur« geht Kant insbesondere auf die Frage ein, ob der Mensch als Gattung von Natur aus böse sei. Seit ihrer Veröffentlichung und bis heute ist die Religionsschrift jedoch überwiegend als Schrift zur Religionsphilosophie gedeutet worden.785 Eine andere verbreitete Art und Weise mit der Religionsschrift umzugehen besteht darin, einzelne Aspekte aus dem Kontext der Schrift zu entnehmen, um sie im Gesamtzusammenhang mit Kants früheren Werken zur praktischen Philosophie zu interpretieren. Dies gilt insbesondere für Kants Lehre vom radikalen Bösen.786 Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob Kants Lehre vom radikalen Bösen in der Religionsschrift mit seiner Bestimmung der Freiheit als Autonomie in der Grundlegung und der zweiten Kritik verträglich sind. Während die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Bösem heftige philosophische Kontroversen ausgelöst hat, wurde Kants Lehre vom radikalen Bösen lange kaum Beachtung bezüglich ihrer Bedeutung für seine Rechtstheorie vom Weltfrieden sowie seine Lehre von der Politik geschenkt. Erst in jüngerer Vergangenheit haben sich verschiedene Autoren systematisch dem politischen Gehalt der Religionsschrift gewidmet.787 In Auseinandersetzung mit dieser umfangreichen Literatur soll in einem ersten Schritt der Frage nachgegangen werden, was unter dem Ausdruck des „radikalen Bösen in der menschlichen Natur“ genau zu verstehen ist. 785 Siehe zum Beispiel: Baum, Hermann: Kant. Moral und Religion, Sankt Augustin 1998; Habermas, Jürgen: Die Grenze zwischen Glauben und Wissen. Zur Wirkungsgeschichte und aktuellen Bedeutung von Kants Religionsphilosophie, in: Recht - Geschichte - Religion. Die Bedeutung Kants für die Gegenwart, hrsg. v. Herta Nagl-Docekal und Rudolf Langthaler, Berlin 2004, S. 141-160; Palmquist, Stephen R: Kant’s critical religion, Aldershot/Burlington USA/Singapore/Sydney 2000; Ricken, Friedo/Marly, François (Hrsg.): Kant über Religion, Stuttgart 1992; Rossi, Philip J./Wreen, Michael W. (Hrsg.): Kant’s philosophy of religion reconsidered, Bloomington/Indianapolis 1991; Wimmer, Reiner: Kants kritische Religionsphilosophie, Berlin/New York 1990; Wood, Allen W.: Kant‘s rational theology, Ithaca 1978. Einen einführenden und zugleich informativen Überblick über diese umfangreiche Literatur bietet: Cavallar, Georg: Kants Religionsphilosophie im Spiegel neuerer Arbeiten, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 52, 1998, S. 460-470. 786 Vgl. Fackenheim, Emil L: The God Within. Kant, Shelling, and Historicity, (insbesondere das zweite Kapitel: „Kant and radical evil”), Toronto 1996; Klemme, Heiner F.: Die Freiheit der Willkür und die Herrschaft des Bösen. Kants Lehre vom radikalen Bösen zwischen Moral, Religion und Recht, in: Aufklärung und Interpretation. Studien zu Kants Philosophie und ihrem Umkreis, hrsg. v. Heiner F. Klemme, Bernd Ludwig, Michael Pauen und Werner Stark, Würzburg 1999, S. 124-151; Schulte, Christoph: Radikal böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche, München 1988. 787 Vgl. Städtler, Michael (Hrsg.): Kants „Ethisches Gemeinwesen“. Die Religionsschrift zwischen Vernunftkritik und praktischer Philosophie, Berlin 2005; Klar, Samuel: Moral und Politik bei Kant: eine Untersuchung zu Kants praktischer und politischer Philosophie im Ausgang der Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft, Würzburg 2007. - 137 - a) Das radikale Böse als ein in der menschlichen Natur verwurzelter Hang Dieser Ausdruck des radikalen Bösen meint erstens, dass für Kant das Böse nicht nur bei einzelnen Menschen zu finden ist, sondern in der gesamten Gattung. Dies ist auch der Grund, warum Kant vom radikalen Bösen „in der menschlichen Natur“ spricht. Unter dem Adjektiv „radikal“ wird zweitens nicht gemeint, dass der Mensch ganz und gar böse ist. Kant verwendet den Begriff des radikalen Bösen vielmehr im etymologischen Sinn von „Wurzel“ oder „Ursprung“ (lat. radix). Dementsprechend ist das Böse deshalb radikal, weil es in der menschlichen Natur verwurzelt ist. Um leicht auftretende Missverständnisse zu vermeiden, soll gleich an dieser Stelle noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kant jegliche Erklärungsversuche des Bösen als „Erbkrankheit, oder Erbschuld, oder Erbsünde“788 entschieden zurückweist. Was Kant unter dem Begriff des Bösen meint, lässt sich vielleicht am besten im Vergleich zum kontradiktorisch entgegengesetzten Begriff des Guten verstehen. Kant versteht das Böse ebenso wie das Gute als einen absoluten Begriff. Damit grenzt er zunächst das gegensätzliche Begriffspaar des Guten und Bösen von jenem des Wohl und Übel ab. Unser Wohl und Weh (Übel) ist auf die Empfindung der „Annehmlichkeit“ und „Unannehmlichkeit“ bzw. des „Vergnügens“ und „Schmerzens“ zurückzuführen.789 Woran die Menschen Lust und Unlust empfinden, variiert jedoch von Mensch zu Mensch, so dass man immer nur von einer relativen, niemals aber von einer absoluten Annehmlichkeit bzw. Unannehmlichkeit sprechen kann. Das unbedingt Gute ist dagegen bei Kant lediglich der gute Wille selbst, dies will heißen der Wille zur Pflicht um dieser selbst willen. Entsprechendes muss auch für den gegensätzlichen Begriff des Bösen gelten. Während das Wohl oder Übel immer nur „eine Beziehung auf unseren Zustand der Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit“ hat, schreibt Kant in der zweiten Kritik, dass „das Gute oder das Böse […] jederzeit eine Beziehung auf den Willen [hat] so fern dieser durchs Vernunftgesetz bestimmt wird“.790 Sowohl das Gute als auch das Böse sind, um es anders zu formulieren, eigentlich auf den Willen bezogen. Der subjektive Grund des Bösen im Menschen ist somit kein bloßer „Naturtrieb“, sondern nur eine „Maxime“, das heißt „eine Regel, die die Willkür sich selbst für den Gebrauch ihrer Freiheit macht“.791 Dies hat wiederum zu bedeuten, dass das Böse zwar in der menschlichen Natur verankert ist, aber dass es nicht die Natur ist, die daran schuld ist, wenn der Mensch böse handelt. Das Böse kann vielmehr der menschlichen Freiheit zugerechnet werden. Kants Begriff der Freiheit als Autonomie, wie er in der Grundlegung und in der Kritik der praktischen Vernunft vorgetragen wurde, impliziert die Möglichkeit der moralisch bösen Handlungen: Als frei handelndes Wesen hat der Mensch stets die Möglichkeit sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden.792 Der Mensch ist somit als Urheber des Bösen immer selbst schuld.793 Kant zufolge ist alles Böse immer selbstverschuldet. Jeder Mensch hat zwar einen Hang zum Bösen, aber nicht jeder wird diesem Hang nachgeben.794 An dieser Stelle bleibt es offen, warum sich der Mensch dafür entscheidet sein Handeln entweder durch die reine praktische Vernunft oder durch seine Neigung bestimmen zu lassen. Wichtig ist hier 788 Religion: VI, 40 Vgl. KpV: V, 105 790 KpV: V, 105 791 Religion: VI, 21 792 Dies hat Jochen Bojanowski überzeugend bewiesen. Siehe: Ders.: Kants Theorie der Freiheit: Rekonstruktion und Rehabilitierung, Göttingen 2006, S. 229ff. 793 Vgl. Religion: VI, 19f. 794 Vgl. Religion: VI, 32 789 - 138 - lediglich festzuhalten, dass es sich um eine Entscheidung der freien Willkür handeln muss, und dass der Mensch die volle Verantwortung für seinen Tun und Lassen zu ziehen hat. Für Kant kann die bloße Unterlassung einer moralisch-guten Handlung noch nicht als böse bezeichnet werden.795 Das Böse besteht erst im Widerspruch des Guten, oder mit Kants eigenen Worten in einer „Widerstrebung“796 gegen das Sittengesetz. In diesem Sinne bezeichnet Kant bereits die mit dem allgemeinen Sittengesetz widerstreitenden Handlungen als „böse“.797 Dadurch scheint Kant jedoch seine eigene Bestimmung des Bösen rückgängig zu machen, indem er sich lediglich auf die Handlungen konzentriert und die Beziehung auf den Willen unbeachtet lässt. Wie noch ausführlicher zu sehen sein wird, meint er jedoch damit, dass man von gesetzwidrigen Handlungen auf ihre zugrundeliegende böse Maxime schließen kann. Kant führt allerdings diese erste Bestimmung des Bösen als bloße juridische Gesetzwidrigkeit zunächst nicht weiter aus. Ob eine Handlung als böse bezeichnet werden kann, hängt bei ihm nicht davon ab, ob objektiv eine besonders erschütternde Gesetzwidrigkeit vorliegt, sondern ob subjektiv jene Gesetzwidrigkeit als solche gewollt wurde. b) Die Anlage zum Guten und der Hang zum Bösen Entscheidend für Kants Lehre vom radikalen Bösen ist die Unterscheidung von Anlage zum Guten und Hang zum Bösen. Was genau unter diesen beiden Begriffen zu verstehen ist, wird nicht nur in der Religionsschrift angeführt, sondern bereits in Kants früheren Werken zur praktischen Philosophie. Daran zeigt sich bereits, dass Kants Lehre vom radikalen Bösen von seiner allgemeinen Ethik nicht getrennt ist. Wie noch zu sehen sein wird, ist sie vielmehr mit seiner Lehre der Menschen als endliche Vernunftwesen in vielerlei Hinsicht verbunden. Mit dem Begriff des radikalen Bösen führt Kant seine allgemeine Ethik fort. Unter der Anlage eines Wesens versteht Kant sowohl die Bestandstücke, welche dazu erforderlich sind, als auch die Formen ihrer Verbindung, um ein solches Wesen zu sein.798 Für Kant kann sich die Anlage zum Guten nur in der Gattung, jedoch nicht im Individuum vollständig entwickeln. Die Anlage des Menschen ist dreifach. Sie ist erstens die „Anlage für die Thierheit des Menschen, als eines lebenden“.799 Gemeint ist hier die „bloß mechanische[] Selbstliebe“800 des Menschen, welche seine Erhaltung, Fortpflanzung und seinen Trieb zur Gesellschaft betrifft. Die zweite Anlage zum Guten ist jene für die „Menschheit desselben, als eines lebenden und zugleich vernünftigen“.801 Darunter ist diesmal eine „vergleichende[] Selbstliebe“802 zu verstehen. Jene dient dem Menschen dazu sich mit Seinesgleichen als glücklich oder unglücklich zu vergleichen. Dieser Vergleich treibt den Menschen anschließend zur Tätigkeit, welche die Grundlage der Kultur darstellt. Die dritte und letzte Anlage zum Guten ist jene „für seine Persönlichkeit, als eines vernünftigen und zugleich der Zurechnung fähigen Wesens“.803 Diese Anlage besteht in der „Empfänglichkeit der Achtung für das moralisch Gesetz, als einer für sich hinreichenden Triebfeder der Willkür“.804 Das bedeutet an dieser Stelle das Vermögen des Menschen 795 Vgl. Religion: VI, 22f. Religion: VI, 22 797 Vgl. GMS: IV, 404; Religion: VI, 20ff. 798 Vgl. Religion: VI, 28 799 Religion: VI, 26 800 Religion: VI, 26 801 Religion: VI, 26 802 Religion: VI, 27 803 Religion: VI, 26 804 Religion: VI, 27 796 - 139 - unabhängig von sinnlichen Triebfedern sein Handeln allein aus Achtung für das Sittengesetz zu bestimmen. Neben diesen drei ursprünglichen Anlagen zum Guten besitzt der Mensch ebenfalls einen unerforschlichen Hang zum Bösen. Ein Hang (propensio) ist der „subjective[] Grund der Möglichkeit einer Neigung […], sofern sie für die Menschheit überhaupt zufällig ist“.805 Im Gegensatz zur Neigung setzt der Hang nicht voraus, dass der Mensch bereits einen bestimmten Gegenstand begehrt. Der Hang ist eigentlich nur eine „Prädisposition“806 zum Begehren eines Gegenstandes. Es handelt sich hierbei um einen in jedem Menschen wurzelnden Hang von der Maxime der Sittlichkeit abzuweichen, obzwar er sich ihrer bewusst ist. Bereits in der Grundlegung kann man lesen, dass der Mensch in seinem Streben nach Glückseligkeit ein „mächtiges Gegengewicht“ gegen den kategorischen Imperativ hat. Daraus entspringe eine „natürliche Dialektik“, welche Kant als „Hang“ des Menschen bezeichnet, „wider jene strenge Gesetze der Pflicht zu vernünfteln und ihre Gültigkeit […] in Zweifel zu ziehen“.807 In der zweiten Kritik definiert Kant diesen selbstsüchtigen Hang entweder als Selbstliebe, mithin als ein über alles gehende Wohlwollen gegen sich selbst, oder als Eigendünkel, mithin als das Wohlgefallen an sich selbst.808 Darunter versteht er den Hang „sich selbst nach den subjectiven Bestimmungsgründen seiner Willkür zum objectiven Bestimmungsgrunde des Willens überhaupt zu machen“.809 In der Rechtslehre erläutert Kant eingehender, was unter dem Hang zum Bösen zu verstehen ist. Bezüglich der wissentlich und willentlich begangenen gesetzwidrigen Handlung trifft Kant eine weitere Unterscheidung. Dort heißt es, dass „ein Verbrecher seine Unthat entweder nach der Maxime einer angenommenen objectiven Regel […], oder nur als Ausnahme von der Regel […] begehen“810 kann. Der Mensch ist sich des moralischen Gesetzes immer unmittelbar bewusst. Dies bedeutet, dass die Übertretung des Sittengesetzes in beiden erwähnten Fällen vorsätzlich, also mit Bewusstsein, erfolgt. Während im zweiten, schwächeren Fall die Maxime „bloß ermangelungsweise (negative)“ vom moralischen Gesetz abweicht, tritt sie im ersten, schlimmeren Fall „sogar abbruchsweise (contrarie)“811 dem Gesetz entgegen. Selbst wenn Kant die letzte Art des Verbrechens für einen mit Verstand ausgestatteten Wesen für unmöglich hält (worauf noch näher eingegangen wird), können insgesamt drei Stufen zunehmender Bösartigkeit identifiziert werden. Es handelt sich um (i.) die dem Sittengesetz bloß widersprechenden Handlungen, (ii.) die zwar vorsätzliche, jedoch bloß gelegentliche Gesetzwidrigkeit, sowie letztlich (iii.) die systematische Verwerfung der Autorität des Sittengesetzes und dessen Übertretung aus böser Gesinnung. Diese drei Stufen der Bösartigkeit werden von Otfried Höffe zusammenfassend als „Kontra-Legalität“, „Kontra-Moralität“ und „Regelfall-Böse“ bezeichnet.812 c) Die drei Stufen zunehmender Bösartigkeit bezüglich der Nichtanerkennung des Sittengesetzes Bereits in der Grundlegung hatte sich Kant dem Problem der bloß pflichtwidrigen Handlungen nur beiläufig gewidmet. Ihm geht es vor allem um das Böse im strengen Sinne, das heißt um den bösen Willen. Im Ersten Stück der Religionsschrift über das radikale Böse in 805 Religion: VI, 28 Religion: VI, 28 807 GMS: IV, 405 808 Vgl. KpV: V, 73 809 KpV: V, 74 810 RL: VI, 320 811 RL: VI, 320f. 812 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 93. 806 - 140 - der menschlichen Natur führt Kant aus, dass die Nichtanerkennung des Sittengesetzes in drei verschiedenen Stufen erfolgt. Diese drei Stufen fasst er folgendermaßen zusammen: „Erstlich ist es die Schwäche des menschlichen Herzens in Befolgung genommener Maximen überhaupt, oder die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur; zweitens der Hang zur Vermischung unmoralischer Triebfedern mit den moralischen […], d. i. die Unlauterkeit; drittens der Hang zur Annehmung böser Maximen, d. i. die Bösartigkeit der menschlichen Natur, oder des menschlichen Herzens“.813 Die im Anschluss von Kant näher erläuterten Stufen lassen sich wie folgt charakterisieren. Die erste, niedrige Stufe ist jene der Gebrechlichkeit (fragilitas). Kant zufolge kommt diese Gebrechlichkeit am besten im berühmten Wort des Apostels Paulus zum Ausdruck: „Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt“ (Römer 7, 18). Die Fragilitas humanas zeigt sich, wenn der Mensch das moralisch Gute, das er tun soll und auch will, doch nicht tue. Diese Diskrepanz zwischen dem (angeblichen) Wollen und dem (tatsächlichen) Vollbringen ist darauf zurückzuführen, dass der Mensch nachdem er sich dafür entschieden hat, nach einer verallgemeinerbaren Maxime zu handeln, sich dennoch letztlich dafür entscheidet seinen Neigungen zu folgen. Die in der Idee (in thesi) unüberwindliche Triebfeder des Gesetzes erweist sich in der Befolgung (in hypothesi) als die Schwächere im Vergleich zu der Neigung.814 Die zweite, bösere Stufe ist jene der Unlauterkeit (impuritas, improbitas). Diese besteht darin, dass die Maxime der Handlung zwar gut und vielleicht auch zur Ausübung genügend kräftig, jedoch nicht rein moralisch ist, weil außer dem Gesetze noch eine andere Triebfeder in die Maxime aufgenommen worden ist. In der Folge werden bloß pflichtmäßige Handlungen nicht rein aus Pflicht getan. Wichtig ist hier zu sehen, dass das Sittengesetz nicht vollumfänglich, das heißt nicht unbedingt und ausnahmslos, anerkannt ist. Wenn aber das Gesetz keine hinreichende Triebfeder des Handelns ist, also wenn andere Triebfedern als das Gesetz selbst nötig sind, um die Willkür zu gesetzmäßigen Handlungen zu bestimmen, wird der Mensch das Sittengesetz nur dann befolgen, wenn Pflicht und Neigung zufälligerweise übereinstimmen.815 Die dritte und zugleich böseste Stufe kennzeichnet Kant als Bösartigkeit (vitiositas, pravitas). Die Bösartigkeit oder „Verderbtheit (corruptio)“ ist „der Hang der Willkür zu Maximen, die Triebfeder aus dem moralischen Gesetz andern (nicht moralischen) nachzusetzen“.816 Die Bösartigkeit geht über die bloße Gebrechlichkeit und Unlauterkeit hinaus. Der Mensch nimmt sich vor die Beförderung der eigenen Glückseligkeit des Sittengesetzes vorzuziehen. Deshalb spricht Kant auch von „Verkehrtheit (perversitas) des menschlichen Herzens […], weil sie die sittliche Ordnung in Ansehung der Triebfedern einer freien Willkür umkehrt, und obzwar damit noch immer gesetzlich gute (legale) Handlungen bestehen können, so wird doch die Denkungsart dadurch in ihrer Wurzel (was die moralische Gesinnung betrifft) verderbt und der Mensch darum als böse bezeichnet“.817 Der Mensch ist insofern als böse zu bezeichnen als er die „sittliche Ordnung“818 von Moral und Glückseligkeit verkehrt. Das Böse ist in seinen ersten zwei Stufen (der Gebrechlichkeit und der Unlauterkeit) unvorsätzliche (culpa), in der dritten (der Bösartigkeit) aber vorsätzliche Schuld (dolus).819 Mit anderen Worten könnte man sagen, dass der Mensch auf den zwei ersten Stufen bloße 813 Religion: VI, 29 (meine Hervorhebungen) Vgl. Religion: VI, 29 815 Vgl. Religion: VI, 30f. 816 Religion: VI, 30 817 Religion: VI, 30 818 Religion: VI, 36 819 Vgl. Religion: VI, 38 814 - 141 - Willensschwäche zeigt, während er auf der dritten Stufe einen schlechthin bösen Willen zeigt. Um Missverständnisse zu vermeiden soll hier noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass es verfehlt wäre, der Sinnlichkeit und den Neigungen die Schuld am Bösen zu geben. Der Grund des Bösen liegt weder in der Sinnlichkeit und den Neigungen an sich, noch in der Selbstliebe. All diese sind natürlich und als solche vor-moralisch, das heißt weder gut noch böse. Das Böse ergibt sich vielmehr aus dem Vorzug der Selbstliebe vor der Moral. Für Kant besteht das „eigentliche Böse“ darin, dass „man jenen Neigungen, wenn sie zur Übertretung anreizen, nicht widerstehen will, und diese Gesinnung ist eigentlich der wahre Feind“.820 Im folgenden Abschnitt soll nun der Frage nachgegangen werden, ob Kants Verständnis des Bösen prinzipientheoretisch begründet und empirisch bestätigt ist. 2.2 Die durch Erfahrung bestätigte Universalität des Bösen a) Der in der Erfahrung zu beobachtende Hang zum Bösen in der menschlichen Natur Kant wiederholt und betont immerzu, dass sich die Moralität der Gesinnung nicht feststellen lässt.821 Für ihn kann man nicht wissen, ob jemals von einem Mensch eine pflichtmäßige Handlung tatsächlich aus Pflicht begangen wurde. Entsprechendes sollte auch für das Böse gelten. Auch hier gilt, dass man zwar gesetzwidrige Handlungen empirisch beobachten kann, jedoch niemals ganz sicher sein kann, ob jene aus böser Gesinnung begangen wurden und somit moralische Verkehrtheit vorliegt. In der Religionsschrift schreibt Kant diesbezüglich, dass man „gesetzwidrige Handlungen durch Erfahrung bemerken“822 kann. Im unmittelbaren Anschluss daran fügt Kant jedoch hinzu, dass man „die Maximen […] nicht beobachten [kann], sogar nicht allemal in sich selbst, mithin das Urtheil, daß der Thäter ein böser Mensch sei, nicht mit Sicherheit auf Erfahrung gründen [kann]“.823 Vorsicht wäre also angebracht, weil der letzte Bestimmungsgrund der Willkür sich bestenfalls erschließen, jedoch nicht mit Sicherheit feststellen lässt. Vor diesem Hintergrund mag es ein wenig überraschen, dass Kant sich als Beweis für den bösen Hang in der menschlichen Natur auf eine „Menge schreiender Beispiele“824 beruft, die einen förmlichen Beweis überflüssig machen sollten. In der Tat kann eine allgemeine Erkenntnis der menschlichen Natur nicht auf Beobachtungen einzelner historischer Geschehnisse beruhen. Wenn Kant im dritten Abschnitt des Ersten Stück der Religionsschrift zu zeigen versucht, dass der Mensch als Gattung von Natur aus böse ist, beansprucht er nicht nur bloße Allgemeingültigkeit, sondern strenge Allgemeinheit. Dies hat zu bedeuten, dass für Kant jeder einzelne Mensch einen Hang zum Bösen hat. Das Problem besteht nun darin, dass einzelne historische Beispiele unmöglich die von Kant in Anspruch genommene strenge (absolute) Allgemeinheit begründen können. Bloße Beispiele können die Rede vom Bösen nur in einem generellen, nicht jedoch universellen Sinn rechtfertigen. Weil Kant für die Behauptung, dass der Mensch von Natur aus böse sei, strenge Allgemeinheit beansprucht, kann der Beweis nicht auf Erfahrung gründen, sondern muss a priori gelten. Da Kants Behauptung, wie noch zu sehen sein wird, offenbar nicht analytisch ist, müsste sie synthetisch sein. Ein synthetisches Urteil a priori kann wiederum nicht auf einer empirischen Deduktion begründet werden, sondern erfordert eine transzendentale Deduktion. Problematisch ist allerdings, dass eine derartige transzendentale Deduktion von Kant selbst nicht durchgeführt 820 Religion: VI, 58 Vgl. GMS: IV, 408; KpV: V, 47; TL: VI, 221, 226 822 Religion: VI, 20 823 Religion: VI, 20 824 Religion: VI, 32 821 - 142 - wird.825 Hat dies also notwendigerweise zu bedeuten, dass es Kant an diesem entscheidenden Punkt nicht gelungen ist, seine These, dass jeder einzelne Mensch ein Hang zum Bösen hat, konsistent zu begründen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass die Aussage, dass der Mensch als Gattung von Natur aus böse ist, mitnichten zu bedeuten hat, dass man der Begriff des Bösen analytisch aus jenem der menschlichen Gattung ableiten kann. Wenn der Begriff des Bösen sich analytisch aus jenem der menschlichen Gattung ergeben würde, dann würde das Böse jedem Menschen mit Notwendigkeit zukommen. In diesem Fall würde es sich aber nicht um einen Hang, sondern um eine Anlage handeln.826 Des Weiteren soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kants Lehre vom radikalen Bösen in der Religionsschrift gegenüber der Grundlegung und der Kritik der praktischen Vernunft auf einem erweiterten Begriff der Maxime beruht. In der Grundlegung und in der zweiten Kritik muss sich der Mensch in jeder einzelnen moralisch relevanten Situation die Frage stellen, ob die Maxime seiner Handlung zu einem allgemeinen Gesetz taugt. In der Religionsschrift erweitert Kant diese Auffassung. Ihm zufolge treffen die Menschen in einer „obersten Maxime“827, das heißt in einer Maxime zweiter Stufe, eine grundsätzliche Entscheidung darüber, ob sie dem moralischen Gesetz den absoluten Vorrang vor der Selbstliebe einräumen oder umgekehrt verfahren wollen. Diese oberste, allgemeine Maxime kommt anschließend in den menschlichen besonderen Maximen zum Ausdruck. Diese besonderen Maximen finden ihren Ausdruck wiederum in den einzelnen menschlichen Handlungen. Wenn die besonderen Maximen eines Menschen gesetzwidrig sind, kann die oberste Maxime nicht so beschaffen sein, dass der handelnde Mensch die bedingungslose und allgemeine Gültigkeit des moralischen Gesetzes anerkannt hätte. Hinzu kommt, dass wenn seine Handlungen pflichtwidrig sind, können die ihnen zugrundeliegenden Maximen nicht moralisch gut sein. Die in der Erfahrung zu beobachtenden pflichtwidrigen Handlungen können nicht anders gedacht werden, als dass der handelnde Mensch die Selbstliebe über die Moral gestellt hat. Es handelt sich dabei keinesfalls um Erfahrung, sondern es ergibt sich notwendigerweise aus Kants moraltheoretischen Überlegungen. Zu Recht schreibt Jochen Bojanowski diesbezüglich, dass es eine „epistemische Asymmetrie zwischen moralisch guten und moralisch bösen Handlungen“828 gibt. Von einem pflichtmäßigen Handeln kann man nicht auf eine moralisch gute Maxime schließen. Dies liegt darin begründet, dass die Legalität der Handlungen eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung der Moralität der Gesinnung ist. Da jede moralische Handlung notwendigerweise auch eine pflichtmäßige Handlung ist, jedoch nicht jede pflichtmäßige Handlung auch eine moralische Handlung ist, kann nicht von einer pflichtmäßigen Handlung auf eine moralisch gute Maxime geschlossen werden. Wenn dagegen eine Pflichtwidrigkeit vorliegt, dann kann man problemlos auf eine moralisch böse Maxime schließen. Zusammenfassend kann man also festhalten, dass man aus prinzipientheoretischen Gründen von pflichtwidrigen Handlungen auf eine moralisch böse Maxime schließen kann, aber nicht von pflichtmäßigen auf eine moralisch gute. Die Behauptung: „Der Mensch ist von Natur aus böse“ bedeutet also nur, dass er „nach dem, wie man ihn durch Erfahrung kennt, nicht anders beurteilt werden“829 kann. Als Beweis für den bösen Hang in der menschlichen Natur führt Kant einzelne historische 825 Henry Allison ist zum Beispiel der Meinung, dass Kants Argumentation einen synthetischen Satz a priori enthält und legt seine Deduktion in der folgenden Schrift vor: Allison, Henry E.: Kant’s Theory of Freedom, Cambridge 1990, S. 64ff. Kritisch dazu u.a.: Bojanowski, Jochen: Kants Theorie der Freiheit: Rekonstruktion und Rehabilitierung, Göttingen 2006, S. 276f., Timmons, Mark: Evil and Imputation in Kant‘s Ethics, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 2, 1994, S. 113-142. 826 Vgl. Religion: VI, 32 827 Vgl. Religion: VI, 31, 32, 36 828 Bojanowski, Jochen: Kants Theorie der Freiheit: Rekonstruktion und Rehabilitierung, Göttingen 2006, S. 276. 829 Religion: VI, 32 (meine Hervorhebung) - 143 - Beispiele an. Solche Beispiele finden sich sowohl im natürlichen als auch im gesitteten Zustand. Am besten zeigt sich jedoch der böse Hang im Menschen im „äußeren Völkerzustand“, welcher aus einer merkwürdigen Zusammensetzung des natürlichen und gesitteten Zustandes besteht.830 Kants Beispiele richten sich im ersten Fall gegen die „gutmütige Voraussetzung der Moralisten von Seneca bis zu Rousseau“, wonach der Mensch von Natur aus gut sei. Dagegen führt Kant die „Auftritte von ungereizter Grausamkeit in den Mordscenen auf Tofoa, Neuseeland“831 an. Als Beweis für die „Laster[] der Cultur und Civilisirung“ führt Kant die „geheime Falschheit selbst bei der innigsten Freundschaft“ sowie den Hang an, „denjenigen zu hassen, dem man verbindlich ist, worauf ein Wohlthäter jederzeit gefaßt sein müsse“.832 In Bezug auf den äußeren Völkerzustand führt Kant aus, dass „civilisirte Völkerschaften gegen einander im Verhältnisse des rohen Naturstandes (eines Standes der beständigen Kriegsverfassung) stehen und sich auch fest in den Kopf gesetzt haben, nie daraus zu gehen“.833 Weitere Beispiele für das Böse im Verhältnis der Völker zueinander führt Kant in der Friedensschrift aus. Abgesehen von einigen weniger bedeutenden Stellen führt Kant dort den Begriff des Bösen an vier gewichtigen Stellen der Friedensschrift aus. Gleich im Ersten Präliminarartikel wird vom „bösen Willen“834 gesprochen, welcher die erstbeste Gelegenheit benutzt, um den Krieg fortzusetzen. Im Zweiten Definitivartikel schreibt Kant, dass die Bösartigkeit der menschlichen Natur sich „im freien Verhältniß der Völker unverhohlen blicken läßt“.835 Im Anschluss hofft Kant, dass der Mensch „über das böse Princip in ihm […] einmal Meister“836 wird. Letztlich schreibt er im Ersten Anhang, dass die „in der menschlichen Natur gewurzelte Bösartigkeit von Menschen […] äußeren Verhältniß der Staaten gegen einander ganz unverdeckt und unwidersprechlich in die Augen“837 fällt. An einer anderen Stelle verwendet Kant zwar nicht unmittelbar den Begriff des Bösen, führt jedoch aus, dass die Kriegslust zur Natur des Menschen gehört. Er hebt sogar hervor, dass der Krieg keines besonderen Bewegungsgrundes bedarf. Jener scheint vielmehr „auf die menschliche Natur gepfropft zu sein und sogar als etwas Edles, wozu der Mensch durch den Ehrtrieb ohne eigennützige Triebfedern beseelt wird, zu gelten“.838 In der Rechtslehre ändert Kant nichts an seiner früheren Ansicht, wenn er schreibt, dass die „menschliche Natur […] nirgend weniger liebenswürdig, als im Verhältnisse ganzer Völker gegen einander“839 erscheint. Ferner ist sogar zu lesen, dass der „Wille, einander zu unterjochen, oder an dem Seinen zu schmälern, […] jederzeit da“840 ist. Insofern es unabhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen (also sowohl im natürlichen oder im gesitteten als auch im völkerrechtlichen Zustand) überall und immer schon einzelne Menschen gab, welche böse Handlungen durchgeführt haben, ist es berechtigt, das Böse als eine Konstante des Menschen anzunehmen. Nachdem einmal gesehen wurde, dass Kants These bezüglich der Universalität des Bösen durchaus konsistent ist, stellt sich die weitere Frage, ob seine Bestimmung des Bösen auch empirisch bestätigt ist, oder zumindest eine Entsprechung in der Erfahrung findet. 830 Vgl. Religion: VI, 34 Religion: VI, 33 832 Religion: VI, 33 833 Religion: VI, 34 834 Frieden: VIII, 344 835 Frieden: VIII, 355 836 Frieden: VIII, 355 837 Frieden: VIII, 375 838 Frieden: VIII, 365 (meine Hervorhebung) 839 Gemeinspruch: VIII, 312 840 Gemeinspruch: VIII, 312 831 - 144 - b) Über die Möglichkeit und Wirklichkeit der Bosheit In seinen moralphilosophischen Schriften der 1780er Jahren bezeichnet Kant die Gebrechlichkeit und die Unlauterkeit als die zwei Stufen der Unfähigkeit der Willkür, das moralische Gesetz in seine Maxime aufzunehmen. In der späteren Religionsschrift fügt er diesen zwei ersten Stufen eine dritte hinzu. Gemeint ist die Bösartigkeit (vitiositas, pravitas). Die Bösartigkeit unterscheidet sich von der Bosheit (auch „Äußert-Böse“ genannt). Von Bosheit könnte erst dann gesprochen werden, wenn der Mensch das Böse als Böses zur Triebfeder in seine Maxime aufnimmt. Kant bestreitet dagegen, dass der Mensch tatsächlich aus Bosheit handelt. Für ihn ist der Mensch nicht schlechthin böse.841 Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob und warum der Hang zum Bösen in der menschlichen Natur tatsächlich auf Gebrechlichkeit, Unlauterkeit und Bösartigkeit beschränkt bleibt. Als erster Antwortansatz hierzu kann zunächst festgehalten werden, dass in prinzipientheoretischer Absicht die Möglichkeit der moralischen Bosheit nicht ausgeschlossen werden kann und von Kant auch nicht ausgeschlossen wird. In der Rechtslehre schreibt Kant beispielsweise, dass die „Idee des Äußerst-Bösen […] in einem System der Moral nicht zu übergehen“842 ist. Dies liegt darin begründet, dass das Böse sowie das Gute ihren Ursprung in der menschlichen Freiheit haben. Wenn die Menschen tatsächlich als frei handelnde Wesen gedacht werden, kann prinzipiell nicht ausgeschlossen werden, dass jene sich vornehmen gesetzwidrig zu handeln und das Böse als Böses zur Triebfeder in ihrer Maxime aufnehmen. Das radikale Böse ist als kontradiktorisch Entgegengesetztes des unbedingt Guten eine notwendige Möglichkeit der menschlichen Freiheit.843 Kants These, dass es von den Menschen nicht zu erwarten sei, dass sie nach Maximen handeln, welche dem moralischen Gesetz absichtlich widersprechen, ist also nicht moraltheoretisch, sondern nur empirisch zu verstehen. Kant meint darunter, dass die Bosheit zwar eine notwendige Möglichkeit menschlicher Freiheit darstellt, jedoch keine Wirklichkeit hat. Die Bosheit ist zwar als möglich gedacht (potentialis), jedoch als unwirklich hingestellt (irrealis). Warum aber, so würde man entgegnen, sollte die Bosheit als unwirklich gelten? Kant gibt hierauf keine direkte Antwort. Er führt allerdings aus, dass es sich dabei um eine „förmliche[], ganz nutzlose[] Bosheit“844 handeln würde. Was ist darunter zu verstehen? Es wurde bereits gesehen, dass sich das Böse aus dem Vorzug der Eigenliebe vor der Moral ergibt. Nun wird der Mensch der Moral keinen Abbruch tun wollen, wenn seine Neigungen mit der Moral übereinstimmen, weil dies sonst seinen Neigungen widersprechen würde. Wenn Eigenliebe und Moral übereinstimmen, kann der Mensch kein Interesse daran haben, die Gesetzlichkeit als solche zu verwerfen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Gesetzwidrigkeit als solche gewollt wird, da kein Mensch den mindesten Vorteil davon haben kann. Der Verstoß gegen das Sittengesetz ist für den Menschen kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel um seinen Eigennutz zu maximieren. Kants These scheint zunächst plausibel zu sein. Es bleibt jedoch noch zu fragen, ob diese Bestimmung des Bösen der Erfahrung genügend entspricht. Anders formuliert: Erschöpft sich der böse Hang tatsächlich in den drei Stufen der Gebrechlichkeit, Unlauterkeit und Bösartigkeit? Über die Gebrechlichkeit, Unlauterkeit und Bösartigkeit hinaus, ist es empirisch wirklich nicht zu erwarten, dass die Menschen aus Bosheit handeln? Diese Frage führt uns zum Gedankenexperiment bezüglich der selbstsüchtigen Teufel zurück. Diesbezüglich soll auf eine interessante, wenn auch allzu häufig übersehene 841 Vgl. Religion: VI, 37; RL: VI, 321f.; Anthropologie: VII, 293f. RL: VI, 322 843 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 93. 844 RL: VI, 322 842 - 145 - Unterscheidung zwischen „Teufeln“ und „Teuflischem“ aufmerksam gemacht werden.845 Die Teufel sind vernünftige Wesen, die sich durch die reine praktische Vernunft nicht bestimmen lassen, sondern allein ihren Neigungen folgen. Die teuflischen Wesen dagegen billigen das Böse in sich und erheben den Widerstreit gegen das moralische Gesetz selbst zur Triebfeder.846 Es stellt sich also die Frage, ob die Menschen nicht teuflisch sein können. Diesbezüglich wird in der Sekundärliteratur gelegentlich gegen Kant der Einwand geltend gemacht, dass es ihm nicht gelungen sei, „die nur egoistischen Potentiale der Mehrung des eigenen Vorteils von den sadistischen der Herstellung externer Unglücks zu unterscheiden“.847 In der Tat lässt es sich kaum bestreiten, dass es Menschen gibt (und auch immer gab), die aus bloßer Grausamkeit und Lust an Aggression töten. Des Weiteren ist es eine traurige Erkenntnis der menschlichen Geschichte, dass die Lust auf Fremdvernichtung sowie die Bereitschaft der Selbstvernichtung stärker sein können als der Wille der Selbsterhaltung. Es wäre jedoch verfehlt zu behaupten, dass Kant dies völlig übersehen hat, und dass er nicht wahrhaben wollte, dass das böse Prinzip im Menschen über die bloße Gebrechlichkeit und Unlauterkeit hinaus gehen kann.848 Es wurde bereits gesehen, dass Kant in der Religionsschrift über die „Auftritte von ungereizter Grausamkeit in den Mordscenen auf Tofoa, Neuseeland“849 referiert. Das Entscheidende an diesem Zitat ist nicht, dass Kant sich auf eine vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen (mithin auf einen Mord) beruft. Entscheidend ist auch nicht, dass es sich hierbei um einen besonders erschütternden und grausamen Mord handelt. Die Pointe besteht vielmehr darin, dass es sich dabei um eine mit grundloser Grausamkeit geschehene Tötung handelt, bei welcher offenbar keine Notwehr vorliegt. Es handelt sich, um es anders auszudrücken, um eine Tötung, die keinen anderen Anlass hat als die sadistische Lust an Aggression und Zerstörung. Wichtig ist hier zu sehen, dass einige Menschen offenbar Lust dadurch erleben, anderen Menschen Schmerzen hinzuzufügen. Es lässt sich leicht einsehen, dass diese Tötung nicht aus Willensschwäche begangen wurde. Hier scheint ein Widerspruch in Kants Ausführungen aufzutreten. Auf der einen Seite scheint er dem Menschen einen nur mäßigen teuflischen Charakter zuschreiben zu wollen. Auf der anderen Seite führt er Beispiele von bösen Handlungen aus, welche offensichtlich über die Gebrechlichkeit, Unlauterkeit und Bösartigkeit hinaus gehen. Ein möglicher Erklärungsversuch kann darin gesehen werden, dass für Kant die teuflischen Wesen schlechthin bösartig sind. In Abgrenzung dazu mag der Mensch zwar „teuflische Laster“850 wie etwa Neid, Undankbarkeit oder Schadenfreude haben, doch macht dies aus ihm noch kein „teuflische[s] Wesen“.851 Der Mensch ist böse, aber nicht schlechthin bösartig. 845 Vgl. Brandt, Reinhard: Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 74. 846 Vgl. TL: VI, 461; Religion: VI, 35; Anthropologie: VII, 293 847 Ebeling, Hans: Kants „Volk von Teufeln“, der Mechanismus der Natur und die Zukunft des Unfriedens. Über den Mythos der kommunikativen Vernunft, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 89. 848 Diesbezüglich reicht es nicht anzuführen, dass wahrhaft „teuflische Wesen mit nicht nur bösen Gesinnungen, sondern boshafter Vernunft, die den Widerstreit gegen das Gesetz zur Triebfeder erheben, […] weder selbst in der Lage [sind], ihren Erhaltungswillen gesetzlich zu organisieren, noch […] sich dem gesetzlichen Zwang eines moralischen Politikers fügen [würden], weil die Triebfeder ihres Handelns nicht die Selbsterhaltung, sondern der Widerstreit gegen das Gesetz als solches ist. Also interessieren sie hier nicht“. Vgl. Brandt, Reinhard: Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 74 (meine Hervorhebung). 849 Religion: VI, 33 850 Religion: VI, 27 (meine Hervorhebung) 851 Religion: VI, 35 (meine Hervorhebung) - 146 - Nun ist der Mensch verpflichtet moralisch zu handeln. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob und inwiefern der böse Mensch wieder gut werden kann. Gemeint ist die von Kant in der Religionsschrift aufgeworfene Frage: „[W]ie kann ein böser Baum gute Früchte bringen?“852 2.3 Das Böse im Verhältnis der Völker und die weiterbestehende Möglichkeit des Friedens Weil das Böse radikal, angeboren ist, können die Menschen niemals das Böse ein für allemal entfernen. Vor diesem Hintergrund stellen sich die zwei folgenden Fragen, ob eine moralische Besserung der Menschen (als Individuen und als Gattung) unter dieser Bedingung überhaupt möglich ist, und ob Kants Lehre vom radikalen Bösen seine Rechtstheorie vom Weltfrieden nicht untergräbt. a) Möglichkeit und Grenzen moralischer Besserung der Menschen Vielfältige historische Beispiele beweisen, dass der Mensch seine ursprüngliche Anlage zum Guten selbst verdorben hat, indem er dem Hang zum Bösen nachgegeben und aus Freiheit die sittliche Ordnung der Triebfeder grundsätzlich verkehrt hat. Dies hat allerdings nicht zu bedeuten, dass eine moralische Besserung unmöglich ist. Einige interessante Überlegungen zu diesem Thema finden sich in der kleinen, weniger bekannten geschichtsphilosophischen Schrift Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte aus dem Jahre 1786. Dort schildert Kant die „Geschichte der ersten Entwickelung der Freiheit aus ihrer ursprünglichen Anlage in der Natur des Menschen“.853 Kant will seine Mutmaßungen keineswegs „für ein ernsthaftes Geschäft ankündigen“.854 Er betrachtet sie vielmehr als eine „bloße Luftreise“855, bei welcher er sich der alttestamentlichen Erzählung des Sündenfalles als „Karte“ bedient, um eine ganz freie Darstellung der sittlichen Entwicklung der Menschengeschichte aufzuzeigen. Kant unterscheidet dabei drei aufeinander folgenden hypothetischen Stufen der Kultivierung (Jägerleben, Hirtenleben, Ackerbau) bis zur Epoche des Anfangs der Kultur, der Kunst, der bürgerlichen Verfassung und der öffentlichen Gerechtigkeit.856 Am Anfang dieser hypothetischen Geschichte des Menschengeschlechts steht der Mensch allein unter der Herrschaft des Instinkts, während er am Ende seiner Entwicklung unter der Herrschaft der Vernunft steht. Kants zufolge war der erste Schritt aus dem Stand der Unwissenheit und der Unschuld, das heißt aus dem Stand, in welchem die Menschen allein durch ihren tierischen Instinkt geleitet wurden, (sittlich gesehen) ein „Fall“ und (physisch gesehen) aufgrund der damit einhergehenden Not eine „Strafe“.857 Wichtig sind des Weiteren die folgenden Erläuterungen Kants: „Die Geschichte der Natur fängt also vom Guten an, denn sie ist das Werk Gottes; die Geschichte der Freiheit vom Bösen, denn sie ist Menschenwerk“.858 852 Religion: VI, 45 Anfang: VIII, 109 854 Anfang: VIII, 109 855 Anfang: VIII, 109. Hier ist ein im originalen Schriftbild und anschließend in sämtlichen Kant-Ausgaben vorhandener Lesefehler zu korrigieren: statt „Lustreise“ heißt es „Luftreise“. Denn die üblicherweise für ein „s“ gehaltene Buchstabe kann auch als ein „f“ gelesen werden. Für diese Korrektur spricht Kants Rede von „Karte“ und „Flügeln“ der Einbildungskraft. Vgl. Höffe, Otfried: Einleitung, in: Immanuel Kant: Schriften zur Geschichtsphilosophie, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2011, S. 7. 856 Vgl. Anfang: VIII, 119f. 857 Anfang: VIII, 115 858 Anfang: VIII, 115 853 - 147 - Ursprünglich wurde der Mensch allein von seinem tierischen Instinkt geleitet. Solange er diesem „Rufe der Natur gehorchte, so befand er sich gut dabei“.859 Aber die „Vernunft fing bald an sich zu regen“ und der Mensch „entdeckte in sich ein Vermögen, sich selbst eine Lebensweise auszuwählen und nicht gleich anderen Thieren an eine einzige gebunden zu sein“.860 Durch die Befreiung von der unbedingten Herrschaft der Instinkte öffnen sich dem Menschen neue Handlungsmöglichkeiten, die aber zugleich auch der Ursprung allen Übels und aller Unordnung sind. Dazu zählt vor allem der Krieg. Kant zeigt, dass wir die Schuld des Übels in der Welt auf das Schicksal schieben anstatt sie als selbstverursacht anzuerkennen.861 Die Menschen müssen jedoch erkennen, dass sie an allem Übel größtenteils selbst schuld sind. Im Umkehrschluss ergibt sich, dass der Ausweg aus allem selbstverschuldeten Übel in der Selbstbesserung liegt. Durch die Beobachtung der Geschichte der ersten Entwicklung der Freiheit wird sich der Mensch dessen bewusst, dass alles Übel wie alles Gutes sein eigenes Werk ist. Sobald aber der Mensch seinen Anteil am Weltgeschehen einsieht, wird er auch erkennen, dass die Geschichte der Menschheit nicht „vom Guten anhebend zum Bösen“ fortgeht, sondern sich allmählich vom „Schlechtern zum Besseren“ entwickelt, und dass zu diesem Fortschritt „ein jeder an seinem Theile, so viel in seinen Kräften steht, beizutragen durch die Natur selbst berufen ist“.862 Auch in der späteren Religionsschrift führt Kant aus, dass es für jeden Mensch prinzipiell möglich bleibt, jederzeit ein moralisch guter Mensch zu werden. Auch hier gilt, dass eine moralische Besserung lediglich selbstbewirkt werden kann. Auf der einen Seite bleibt es immer möglich, dass der Mensch seinen moralischen Charakter durch eine allmähliche Reform seines Verhaltens und eine Festigung seiner Maximen verbessert. Der böse Mensch kann zunächst nach und nach lernen sich aus welchem Grund aus immer an das moralische Gesetz zu halten. In diesem Fall kehrt zum Beispiel „der Unmäßige […] zur Mäßigkeit um der Gesundheit, der Lügenhafte zur Wahrheit um der Ehre, der Ungerechte zur bürgerlichen Ehrlichkeit um der Ruhe oder des Erwerbs willen, u. s. w. zurück“.863 Wenngleich der Mensch nach außen als ein neuer Mensch auftritt, hat er innerlich immer noch ein böses Herz. Solange der Mensch sich aber nicht grundsätzlich dafür entschieden hat, der Moral den absoluten Vorrang vor der Selbstliebe anzuerkennen, kann er zwar ein gesetzlich guter Mensch sein, jedoch kein moralisch guter Mensch.864 Während er im ersten Fall bloß legale Handlungen durchführt, handelt er im zweiten Fall moralisch. Damit aus einem „Mensch von guten Sitten“ ein „sittlich guter Mensch“ wird, muss die Autorität des Sittengesetzes vollumfänglich anerkennt und die „ursprüngliche sittliche Ordnung unter den Triebfedern“865 wiederhergestellt werden. Dies hat zu bedeuten, dass das Sittengesetz als oberster Grund aller unserer Maxime widerhergestellt werden muss. Anstelle der Selbstliebe das Sittengesetz vorzuziehen, soll letzteres „in seiner ganzen Reinigkeit als für sich zureichende Triebfeder der Bestimmung der Willkür in dieselbe aufgenommen“866 werden. Mit anderen Worten hat dies zu bedeuten, dass der Mensch wieder moralisch gut wird, wenn er die Verkehrtheit der Triebfedern in seiner Willkür wieder rückgängig macht. Das will heißen, wenn er die Achtung für das moralische Gesetz als oberste Triebfeder in seine Willkür aufnimmt, und somit das Streben nach Glückseligkeit dem allgemeinen Sittengesetz systematisch unterordnet. Weil die moralische Verkehrtheit sich auf den obersten Grund aller Maximen bezieht, kann ihre Aufhebung nicht einfach durch eine „Änderung der 859 Anfang: VIII, 111 Anfang: VIII, 112 861 Vgl. Anfang: VIII, 116 862 Anfang: VIII, 123 863 Religion: VI, 47 864 Vgl. Religion: VI, 30 865 Religion: VI, 50 866 Religion: VI, 46 860 - 148 - Sitten“867, das heißt durch eine allmähliche Reform seines äußeren Verhaltens bewirkt werden. Um ein moralisch guter Mensch zu werden, ist vielmehr eine „wahre Reform der Denkungsart“868, eine „Herzenänderung“869 bzw. eine „Revolution in der Gesinnung im Menschen“870 erforderlich. Erst wenn sich eine derartige Revolution vollzogen hat, das heißt, wenn der Mensch sich grundsätzlich dafür entschieden hat pflichtmäßige Handlungen rein aus Pflicht durchzuführen, sind nicht nur legale, sondern außerdem moralische Handlungen möglich. Selbst dadurch wäre jedoch das Böse im Menschen nicht endgültig und vollständig überwunden. Dies liegt darin begründet, dass die Menschen über ihre doppelte Gestalt als mit praktischer Vernunft begabten endlichen Naturwesen nicht entscheiden können. Es handelt sich dabei um eine anthropologische Gegebenheit. Selbst wenn die Menschen es wollen, können sie also weder dem moralischen Gesetz ganz entsagen und sich zu teuflischen Wesen machen, noch können sie sich zu engelhaften Wesen machen, deren Wille immer und unausbleiblich durch die reine praktische Vernunft bestimmt ist. Als Sinnenwesen unterliegen die Menschen ständig Trieben und Bedürfnissen. Sie sind sich außerdem als mit praktischer Vernunft begabte Wesen dem moralischen Gesetz (dessen Gültigkeit apodiktisch gewiss ist) immer unmittelbar bewusst. Nun kann nicht versichert werden, dass der Mensch immer der Moral den absoluten Vorrang vor der Selbstliebe anerkennen wird. Der Kampf des guten Prinzips mit dem Bösen um die Herrschaft über den Menschen kann niemals als endgültig abgeschlossen betrachtet werden. Es wurde gesehen, dass die Bösartigkeit nicht davon abhängt, ob eine besonders erschütternde oder grausame Gesetzwidrigkeit vorliegt, sondern lediglich, ob die Beförderung der eigenen Glückseligkeit des Sittengesetzes vorgezogen wurde. Die Bösartigkeit kann somit eben dort bestehen, wo die Handlungen mit dem Sittengesetz übereinstimmen.871 Die Bösartigkeit schließt pflichtmäßige Handlungen, mithin juridische Legalität, nicht aus. Aus diesem Grund scheint zunächst Kants Lehre vom radikalen Bösen für seine Rechtstheorie vom Weltfrieden ohne Bedeutung zu sein, da diese vom Menschen lediglich die juridische Legalität fordert. Vor diesem Hintergrund mag es zunächst ein wenig überraschen, dass unter den von Kant angeführten Beispielen des bösen Hanges in der menschlichen Natur doch ein Rechtsproblem in der von Kant mehrmals wiederholten Kriegsbereitschaft der Staaten auftritt.872 Während Kant in der Religionsschrift den Kampf des guten Prinzips mit dem bösen als ein allein im Innern des Menschen stattfindenden Kampf bestimmt, heißt es in der Friedensschrift, dass das böse Prinzip auch für die Staaten gilt. Nach der bereits erwähnten Analogie von Staaten mit Individuen soll nämlich alles das, was für die einzelnen Menschen gilt, ebenfalls und in gleicher Weise für die Staaten gelten. Der Begriff der moralischen Verkehrtheit bezieht sich somit auch auf den Staat. Nun scheint aber die Übertragung des bösen Prinzips im Menschen auf die Staaten die Möglichkeit des Weltfriedens infrage zu stellen. 867 Religion: VI, 47 Aufklärung: VIII, 36 869 Religion: VI, 47 870 Religion: VI, 47 871 Vgl. Religion: VI, 30 872 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 95. 868 - 149 - b) Über die Zukunft des Unfriedens und das absolute Primat der Selbsterhaltung Vor diesem Hintergrund stellt sich die gewichtige Frage, ob Kants Begriff des Bösen im Grunde genommen kein Argument gegen die Möglichkeit des ewigen Friedens darstellt. Ist es nicht so, dass Kant ungewollt mit seiner Lehre vom radikalen Bösen seine Lehre vom Weltfrieden untergräbt? Dies ist jedenfalls die Ansicht bestimmter Kommentatoren, welche sich auf Kants Verständnis der Bösartigkeit berufen, um zusammen mit Hans Ebeling die „Zukunft des Unfriedens“873 zu prognostizieren. Dieser These ist insofern zuzustimmen, als dass die Stiftung eines bürgerlich-gesetzlichen Zustands die Konflikte zwischen Menschen sowie zwischen Staaten nicht ein für allemal komplett verschwinden lässt. In der Tat besteht weiterhin die Möglichkeit, dass solche Konflikte auch nach Eintritt in einen sich weltweit erstreckenden Rechtszustand bestehen. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem rechtlosen Naturzustand und dem bürgerlich-gesetzlichen Zustand besteht lediglich darin, dass die auftretenden Konflikte im letzten Fall nicht länger mit Gewalt ausgetragen werden, sondern vielmehr prinzipiell mit Recht gelöst werden können. An dieser Stelle darf nicht aus den Augen verloren gehen, dass Kant lediglich die Bedingungen einer friedensfähigen, nicht notwendigerweise friedlichen Weltordnung hervorhebt. Mit anderen Worten kann man sagen, dass Kant mitnichten die Bedingungen des Friedens, sondern allein die Bedingungen der Möglichkeit des Friedens aufstellt und begründet. Diese Sichtweise mag zunächst als pessimistisch erscheinen. Einerseits widerspricht sie nämlich der gutmütigen Hoffnung derjenigen, die glauben, dass das Böse im Menschen sich ein für allemal beseitigen lässt. Im Gegensatz dazu glaubt Kant weder an das Idealbild des von der Vergesellschaftung unverdorbenen edlen Wilden, noch an die Schaffung eines im Zuge des Zivilisationsprozess vollkommen vernünftigen Menschen, der immer von sich aus moralisch handeln würde. Andererseits widerspricht Kants Sichtweise dem allzu starken Pessimismus derjenigen, die glauben, dass der Mensch eine Anlage zum Bösen hat. Wie bereits gesehen wurde, vertritt Kant die im Rahmen seiner prinzipientheoretischen Überlegungen einzig konsequente und zugleich nüchterne These, wonach die Menschen keine Anlage, sondern lediglich einen Hang zum Bösen haben. Wer glaubt, dass das Böse im Menschen sich in der Zukunft vollständig bewältigen lässt, kann sich mit guten Gründen von Kant dem Vorwurf der Träumerei ausgesetzt sehen. Wer wiederum glaubt, dass der Mensch eine böse Anlage hat, kann sich dem Vorwurf eines unbegründeten, freiheitsvernichtenden Pessimismus ausgesetzt sehen. Diese gegensätzlichen Positionen widersprechen Kants Definition des Menschen als ein frei handelndes Wesen sowie der damit einhergehenden Möglichkeit sich für das Gute oder Böse zu entscheiden.874 Kant stellt hier erneut seine politische Urteilskraft unter Beweis. Erst wenn einmal erkannt wurde, dass die Menschen ein in ihrer Natur wurzelnden und somit niemals komplett aufzuhebenden Hang zum Bösen haben, können geeignete Maßnahmen zur Stiftung und Erhaltung einer republikanischen Verfassung getroffen werden. Der böse Hang im Menschen führt jedoch dazu, dass selbst 873 Ebeling, Hans: Vom Einen des Friedens: über Krieg und Gerechtigkeit, Würzburg 1997, S. 35ff.; Ders.: Kants „Volk von Teufeln“, der Mechanismus der Natur und die Zukunft des Unfriedens. Über den Mythos der kommunikativen Vernunft, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 87ff. In Anlehnung an die Deutung des Marburger Neukantianers Paul Natorp in seinem Essay Kant über Krieg und Frieden (1924) schreibt ebenfalls Denis Dumas: „là où Kant n’a pas été suffisamment pessimiste, c'est lorsqu’il a présupposé que les démons sauraient à tout le moins se servir de leur entendement pour se conformer adéquatement à la logique de l'intérêt égoïste“. Vgl. Dumas, Denis: La réception néo-kantienne du projet de paix perpétuelle, in: L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 372. 874 Vgl. Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Leben - Werk - Wirkung, München 1983, 7. Aufl. 2007, S. 255. - 150 - nach der Stiftung des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts ein kompletter und immerwährender Friede empirisch niemals garantiert werden kann. Innerhalb eines Staates fällt der Hang zum Bösen nicht im gleichen Maß auf wie im zwischenmenschlichen oder zwischenstaatlichen Naturzustand. Dies liegt darin begründet, dass es im bürgerlich-gesetzlichen Zustand eine übergeordnete Zwangsgewalt gibt, welche den Menschen zu pflichtmäßigen Handlungen zwingen kann. Im Naturzustand der Staaten ist dies jedoch nicht der Fall: Es gibt keine überstaatliche Zwangsgewalt, welche über die zwischenstaatlichen Streitigkeiten rechtsverbindlich entscheiden kann und die Staaten zu einem pflichtmäßigen Verhalten zwingen kann. Unter diesen Bedingungen kann die menschliche Natur ihren freien Lauf nehmen. Die vielen Kriege, welche zwischen den Staaten geführt werden, belegen genug das radikale Böse in der menschlichen Natur. A contrario hat dies zu bedeuten, dass eine oberste Zwangsgewalt notwendig und auch hinreichend ist, um das radikale Böse im natürlichen Verhältnis der Staaten in Schranken zu halten, in derselben Art und Weise wie dies auch der Fall für das natürliche Verhältnis der Menschen ist. Eine überstaatliche Zwangsgewalt kann das Böse in der menschlichen Natur zwar nicht komplett beseitigen (und ist übrigens nicht dazu berechtigt), aber dafür sorgen, dass das Böse nicht unverhohlen auftritt, und dass die Staaten pflichtmäßige Handlungen durchführen. Kants Gedankenexperiment bezüglich der mit Verstand ausgestatteten Teufel liegt die Auffassung zugrunde, dass es jenen möglich ist, trotz einander entgegengesetzter Privatgesinnungen sich im Interesse ihrer Selbsterhaltung unter ein allgemeines Rechtsgesetz zu stellen. Die Stiftung einer republikanischen Verfassung beruht somit letztlich auf dem Willen zur Selbsterhaltung. Kant schreibt diesbezüglich, dass die Teufel „insgesammt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen“.875 Dies deutet darauf hin, dass die Teufel ein ihren Neigungen vorhergehendes, grundsätzlicheres Interesse am Fortkommen ihrer eigenen Existenz haben. Das absolute Primat der Selbsterhaltung liegt wiederum darin begründet, dass die eigene Existenz die notwendige Bedingung der Möglichkeit der Befriedigung aller anderen Neigungen (Glückseligkeit) ist. Allein aus diesem Grund sind die Teufel bereit sich unter ein allgemeines Rechtsgesetz zu stellen und somit ihre äußere Freiheit wechselseitig einzuschränken. Kants Teufel wollen somit nicht die Vernichtung der Gesetzlichkeit überhaupt. Wenn sie das Fortkommen ihrer eigenen Existenz wirklich wollen, dann müssen sie das hierzu notwendige Mittel, das in ihrem Vermögen ist, auch wollen. Diese Einstimmigkeit des Denkens der Teufel mit sich selbst ist im Ausdruck „wenn sie nur Verstand haben“876 enthalten. Wenn also a priori feststeht, dass auch Teufel ebenso wie die Menschen ihre je eigenen wie auch immer definierte Zwecke unabhängig von der nötigenden Willkür anderer Teufel lediglich in einem republikanischen Staat verfolgen können, dann müssen sie auch die Stiftung einer derartigen Verfassung wollen. Es ist nämlich in sich widersprüchlich, sich einen Zweck zu setzten ohne die dafür erforderlichen Mittel zu wollen. Wenn die Teufel nun tatsächlich mit Verstand und technisch-praktischer Vernunft begabt sind, müssen sie einstimmig mit sich selbst denken und einsehen, dass nur die Stiftung einer republikanischen Verfassung ihre Selbsterhaltung und das rechtsgesetzlich gesicherte Streben nach ihrer eigenen Glückseligkeit ermöglichen kann. Der hypothetische Imperativ besagt den Teufeln folgendes: Wenn du wirklich eine von der Willkür anderer Teufeln gesicherte Existenz führen willst, um deine beliebige Zwecke überhaupt verfolgen zu können, dann sollst du eine republikanische Verfassung stiften, als das notwendige Mittel, welches in deiner Gewalt steht, um deinen Ziel zu erreichen. 875 876 Frieden: VIII, 366 (meine Hervorhebung) Frieden: VIII, 366 - 151 - Kants Friedenstheorie ist also keine Utopie, sondern eine „gegründete Hoffnung“877. Der Friede ist für Kant nicht nur moralisch notwendig sondern auch empirisch möglich. Diesbezüglich schreibt Otfried Höffe zu Recht, dass man bezüglich des Frieden statt von einer „Utopie“ eher von einem „Ideal“ sprechen sollte. Während die erste ein „beständiges Nirgendwo und Niemals“ bedeutet, handelt es sich im zweiten Fall um ein „realisierbare[s] Noch-Nicht“.878 Als regulative Idee muss der Frieden das Ziel der Menschheit sein, wenn jene nicht den ewigen Frieden in einem „weiten Grabe“879 finden will. Nachdem im ersten Hauptteil Kants vernunftrechtliche Begründung einer friedensfähigen Weltordnung dargestellt wurde, soll nun im zweiten Hauptteil der bislang zwar nicht vollständig, aber doch weithin vernachlässigte Aspekt der Anwendung derselben Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle untersucht werden. 877 Frieden: VIII, 386 Höffe, Otfried: Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 17. Hermann Klenner schließt sich Otfried Höffe an, wenn er schreibt, dass der Frieden für Kant kein „Nichtort“, sondern ein „Nochnichtort“ sei. Des Weiteren schreibt er, dass für Kant der Gedanke eines ewigen Friedens „keine leere Idee“ sei, sondern „das Erdenken einer möglichen Wirklichkeit, die antizipatorische Substanz einer künftigen Weltgesellschaft, wie sie jetzt schon auf dem Wege ist“. Vgl. Klenner, Hermann: Kants Entwurf „Zum ewigen Frieden“ – Illusion oder Utopie?, in: 200 Jahre Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Idee einer globalen Friedensordnung, Würzburg 1996, hrsg. v. Volker Bialas und Hans-Jürgen Häßler, S. 21. 879 Frieden: VIII, 357 878 - 152 - HAUPTTEIL B KANTS LEHRE VON DER POLITIK UND DAS PROBLEM DER ANWENDUNG DER VERNUNFTPRINZIPIEN AUF DIE ERFAHRUNGSFÄLLE - 153 - 1. KAPITEL: ZUM VERHÄLTNIS VON MORAL, RECHT RECHTSTHEORIE VOM WELTFRIEDEN UND KLUGHEIT IN KANTS In den zwei ersten Teilen der Friedensschrift führt Kant die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit des friedlichen Zusammenlebens der Menschen auf Erden aus. Dort zeigt er, dass Frieden lediglich durch die Stiftung eines mit Hilfe öffentlicher Gesetze endgültig gesicherten Rechtszustandes für alle Menschen und alle Völker der Welt erreicht werden kann. Der Kerngedanke der Friedensschrift ist somit der einer universalen Rechtsordnung. Die Frage nach dessen Realisierungsbedingungen tritt dabei zunächst in den Hintergrund. Dies ist einer der Gründe, weshalb Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden so vielfach kritisiert wurde. Aus der ebenso einfachen wie unbestrittenen Feststellung, dass in Kants politischen Schriften ausgesprochen wenige Aussagen bezüglich der Realisierungsbedingungen der apriorischen Prinzipien des Rechts in der geschichtlich bewegten Lebenswelt zu finden sind, wurde häufig geschlossen, dass Kant ein weltfremder Rechtsphilosoph sei, welcher die Erfahrung missachte und kein Interesse für die konkreten Probleme der Menschen zeige. In diesem Zusammenhang wurde Kant insbesondere wegen seiner vermeintlichen Abwertung der Klugheit als die tradierte pragmatische Kompetenz kritisiert. Dabei wird zumeist gefordert, dass der Klugheit im Bereich der Politik eine gewichtigere Rolle zukommen sollte, als dies den Fall bei Kant ist. Auf der einen Seite ist die Politik eine öffentliche Tätigkeit, was unter anderem zu bedeuten hat, dass viele Menschen von den politischen Entscheidungen betroffen werden können. Allein die Tatsache, dass die Kosten und der Nutzen einer selbst auf das Erlangen des Gemeinwohls ausgerichteten Entscheidung oftmals ungleich verteilt sind, erklärt, dass Politiker sich häufig mit öffentlichen Widerständen seitens der negativ Betroffenen konfrontiert sehen. Vor diesem Hintergrund ergibt es sich, dass die Politiker klug handeln sollen, wenn sie den immer möglichen Widerstand der anderen Menschen entschärfen bzw. überwinden möchten. Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, dass die unkluge Erfüllung einer aus der Vernunft hergeleiteten Rechtspflicht zu einem Selbstwiderspruch führen kann, wenn dadurch gegen Recht verstoßen wird, welches selbst Ausdruck der Vernunft ist. Während beispielsweise eine überstürzte Reform die bestehenden und bewährten Staatseinrichtungen aufs Spiel setzt, bringt eine Verzögerung die Bürger gegen den Staat auf. Daraus folgt, dass die Kenntnis der „Grundsätze des öffentlichen Rechts“880 sowie der moralische Wille sie umzusetzen, nicht ausreichen, um den vernunftnotwendigen Zustand des Weltfriedens zu stiften. Für die KantKritiker scheint es somit nahe zu liegen, der Klugheit eine gewichtige Rolle bei der Anwendung der apriorischen Prinzipien des Rechts in der politischen Realität zuzuschreiben. Dieser Forderung entgegen, behaupten die Kritiker, dass der Klugheit bei Kant diese Anwendungsfunktion nicht oder nur unzureichend zukommt. Erstaunlicherweise hat Kants Klugheitslehre über einen langen Zeitraum hinweg keine große Beachtung seitens der Sekundärliteratur gefunden.881 Diese Zurückhaltung lässt sich plausibel auf mehrere Gründe zurückführen. Ein erster Grund liegt sicherlich in dem mangelnden Interesse für Kants politische Philosophie in ihrer Gesamtheit. Weil die Politik zu denjenigen Bereichen gehört, mit welchen die Klugheit gern assoziiert wird, ist es nicht verwunderlich, dass das mangelnde Interesse für Kants politische Schriften im Allgemeinen sich in einem ebenso mangelnden Interesse für Kants Klugheitslehre im Speziellen 880 Frieden: VIII, 378 Unter verschiedenen Beiträgen, welche sich den hypothetischen Imperativen der Klugheit im Speziellen widmen, sind vor allem die folgenden Beiträge erwähnenswert: Cramer, Konrad: Hypothetische Imperative? in: Rehabilitierung der praktischen Philosophie, hrsg. v. Manfred Riedel, Bd. 1, Freiburg 1972, S. 159-212; Hill, Thomas E: The hypothetical Imperativ, in: Philosophical Review 82, 1973, S. 429-450; Patzig, Günther: Die logischen Formen praktischer Sätze in Kants Ethik, in: Kant-Studien 56, 1966, S. 237-252. 881 - 154 - widerspiegelte. Weil Kants gesamte politische Philosophie im Hintergrund stand, schien auch seine Klugheitslehre nicht imstande zu sein, eine ernsthafte sowie fruchtbare Alternative zu der sittlichkeitsorientierten Klugheitslehre eines Aristoteles oder der amoralischen, machtfunktionalen Klugheitslehre eines Machiavelli anbieten zu können. Ein weiterer Grund für die lange nur zurückhaltende Auseinandersetzung mit Kants Klugheitslehre liegt sicher auch in dem Umstand begründet, dass Kant in seinen Schriften zur praktischen Philosophie häufig erst dann auf die hypothetischen Imperative der Klugheit eingeht, wenn er zeigen möchte, dass jene sich vom kategorischen Imperativ der Sittlichkeit grundsätzlich unterscheiden und streng genommen gar nicht zur praktischen Philosophie gehören.882 Dadurch ergibt sich die etwa kontraintuitive systematische Gestalt, dass die Regeln des klugen Handelns von der Moralphilosophie ausgeschlossen werden und zur theoretischen Philosophie gezählt werden. Letztlich kommt noch hinzu, dass Kants Erläuterungen zur Klugheit manchmal als unklar und schwankend angesehen wurden, was sicherlich damit verbunden ist, dass Kant selbst nur allmählich Klarheit über den systematischen Stellenwert der Klugheitsregeln gewonnen hat. Seit den späten 1970er Jahren haben sich verschiedene Kant-Interpreten jedoch wieder dem Klugheitsbegriff intensiver zugewandt.883 Besonderer Verdienst gilt hier dem Aristoteles‘-Experten Pierre Aubenque, welcher in einem zum Klassiker gewordenen Aufsatz aus dem Jahre 1975 den systematischen Stellenwert der Klugheit bei Kant erhellt hat und auf dessen Unterschiede zur Aristotelischen phronesis aufmerksam gemacht hat.884 Dieser Aufsatz war der Anlass einer bis heute anhaltenden, verstärkten Auseinandersetzung mit Kants Lehre von den hypothetischen Imperativen der Klugheit. Nach wie vor wird dennoch in der Sekundärliteratur zumeist davon ausgegangen, dass Kant Moral und Klugheit getrennt oder sogar als Gegensatz begreift. Ein namhafter Autor wie Wolfgang Kersting kam beispielsweise zu dem Urteil, dass bei Kant „die autonomiestolze Vernunft des Moralgesetzes die Klugheit [inferiorisiert], und in ihr nur die verächtliche Interessenverwalterin eines heteronomen Lebens [erblickt]“.885 Daher plädiert Wolfgang Kersting, gemeinsam mit anderen Autoren, für eine „Rehabilitierung der Klugheit“. Dieser Auffassung kann jedoch entgegengehalten werden, dass Kant insbesondere im ersten Anhang der Friedensschrift, um eine Vermittlung zwischen apriorischer Ausgangslage und pragmatischer Fragestellungen bemüht ist. Dort wirft er die Frage auf, ob die Politiker sich allein oder vorrangig an Klugheit und Erfahrung orientieren sollen, um die staatliche Macht auf welchem Weg auch immer auszubauen, oder ob sie sich strikt an das allgemeine Sittengesetz halten sollen, um Rechtsverhältnisse zu etablieren ohne ihren eigenen Vorteil zu suchen. Im ersten Falle würde es sich um eine bloße Kunstaufgabe handeln, während es sich im zweiten Falle um eine sittliche Aufgabe handeln würde. Kants Antwort auf diese Frage fällt erwartungsgemäß eindeutig aus: In der Politik als ausübende Rechtslehre hat nicht die 882 Dies bemerkte bereits Herbert J. Paton in seiner immer noch lesenswerten Darstellung der Kantischen Moralphilosophie, in welcher er den hypothetischen Imperativen allein zwei Kapitel widmet. Vgl. Paton, Herbert James: The categorical imperative: a study in Kant’s moral philosophy, Philadelphia 1971, S.113-120. 883 Vgl. Brandt, Reinhard: Klugheit bei Kant, in: Klugheit, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerswist-Metternich 2005, S. 98-133; Hinske, Norbert: Die „Ratschläge der Klugheit“ im Ganzen der Grundlegung. Kant und die Ethik der Griechen, 3. Abschnitt: Xenophon, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 1989, 3. Aufl. 2000, S. 131-147; Marshall, John: Hypothetical Imperatives, in: American Philosophical Quarterly 19/1, 1982, S. 105-114; Schwaiger, Clemens: Klugheit bei Kant. Metamorphosen eines Schlüsselbegriffs der praktischen Philosophie, in: Aufklärung 14, 2002, S. 147-159; Seel, Gerhard: Sind hypothetische Imperative analytische praktische Sätze?, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2000, S. 148-170. 884 Vgl. Aubenque, Pierre: La prudence chez Kant, in: Revue de Métaphysique et de Morale LXXX/3, 1975, S. 156-182. 885 Kersting, Wolfgang: Einleitung: Rehabilitierung der Klugheit, in: Klugheit, hrsg. v. Ders.: WeilerswistMetternich 2005, S. 7f. - 155 - Klugheit den Vorrang, sondern die Weisheit, verstanden als „die Zusammenstimmung des Willens zum Endzweck“886, das heißt hier als das innere Prinzip des Willens der Befolgung des Rechtsgesetzes. Es wird sich zwar zeigen, dass Kant auf dem absoluten Vorrang des formalen Rechtsprinzips beharrt, aber den hypothetischen Imperativen der Klugheit einen größeren Freiraum einräumt, als in der Sekundärliteratur häufig angenommen wird. Auf den folgenden Seiten soll der Frage nach dem systematischen Stellenwert der Klugheit ausführlich nachgegangen werden. Diesbezüglich ergibt sich eine ganze Anzahl an Fragen, von denen sich aber nur einige primär auf den hier behandelten politischen Bereich beziehen und daher näher erläutert werden. Einige dieser Fragen sollen schon einmal vorweg genommen werden: Was ist überhaupt unter Klugheit zu verstehen? Inwiefern kann sie für das politische Handeln dienlich sein? Und nicht zuletzt: In welchem systematischen Zusammenhang steht die Klugheit zu Moral und Recht? 1. Kants Definition der Klugheit Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, ist die, was Kant unter dem Begriff der Klugheit überhaupt versteht. Näheren Aufschluss darüber erfahren wir im zweiten Abschnitt der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo Kant den Begriff der Klugheit zunächst allgemein als „die Geschicklichkeit in der Wahl der Mittel zu seinem eigenen größten Wohlsein“887 definiert. In der hieran direkt anschließenden Anmerkung unterscheidet er zwischen zwei Aspekten der Klugheit: die Weltklugheit und die Privatklugheit. Unter der ersten ist die Geschicklichkeit eines jeden Menschen zu verstehen, auf andere Menschen Einfluss auszuüben, um jene zu seinen Absichten zu gebrauchen. Unter der zweiten ist dagegen jene Geschicklichkeit gemeint, alle diese Absichten zu seinem eigenen andauernden Vorteil zu vereinigen. Die Privatklugheit, das heißt der kluge Umgang mit den eigenen Bestrebungen, ist also der Weltklugheit in dem Sinne systematisch vorgeordnet, dass nur derjenige weltklug sein kann, der ebenfalls privatklug ist.888 Die Privatklugheit ist somit eine notwendige Bedingung der Weltklugheit. Dass Kant unter ein und demselben Oberbegriff zwei Aspekte der Klugheit vereinigt, weist darauf hin, dass für ihn der Umgang mit der Welt und der Umgang mit den eigenen Bestrebungen zusammen gehören. Es handelt sich um zwei Seiten einer und derselben Fähigkeit. Kant spricht von Welt- oder Privatklugheit je nachdem aus welcher Perspektive er das Problem nach der Wahl der Mittel zu seinem eigenen größten Wohlergehen betrachtet. Es kann allerdings vorweggenommen werden, dass sich Kants Verständnis der Klugheit mit der Zeit ändern wird. In der sogenannten »Ersten Einleitung in die Kritik der Urteilskraft« war Kant noch bemüht, den zwei eben angeführten Bedeutungsweisen in einer einzigen Definition gerecht zu werden, indem er die Klugheit als die Geschicklichkeit definierte „freie Menschen und unter diesen so gar die Naturanlagen und Neigungen in sich selbst, zu seinen Absichten brauchen zu können“.889 Bemerkenswert ist allerdings schon an dieser zweiten Definition, dass Kant hier die hierarchische Ordnung zwischen den zwei Bedeutungen der Klugheit, wie sie in der Grundlegung ausgeführt wurden, völlig umkehrt. Die Geschicklichkeit im Umgang mit den eigenen Bestrebungen (Privatklugheit) ist nur noch ein bloßer Unterfall des Umgangs mit den Menschen (Weltklugheit). Die Weltklugheit ist also von nun an der Privatklugheit systematisch vorgeordnet. Vor diesem Hintergrund mag es dann nicht allzu überraschend erscheinen, dass Kant in der veröffentlichen Fassung seiner Kritik der Urtheilskraft den Begriff der Klugheit nur noch im Sinne der Weltklugheit verwendet, denn die Klugheit wird 886 Verkündigung: VIII, 418; Vgl. TL: VI, 441 GMS: IV, 416; Vgl. Frieden: VIII, 370 888 Vgl. GMS: IV, 416 889 KUK: XX, 200 (meine Hervorhebung) 887 - 156 - dort schlicht als die „Geschicklichkeit, auf Menschen und ihren Willen Einfluß zu haben“890 definiert. Diese Bedeutungsweise ist auch diejenige, die in Kants späteren Werken vorherrschen wird, sei es explizit wie in der Vorlesung Über die Pädagogik891 oder implizit wie in der Schrift Zum ewigen Frieden.892 Auf den folgenden Seiten wird sich zeigen, dass die zuvor erwähnte Verschiebung bezüglich Kants Verständnis der Klugheit auf einer grundsätzlicheren Verschiebung in seinem Gedanken zurückgeht. An dieser Stelle reicht es aus festzuhalten, dass Kant im ersten Teil des Anhangs der Friedensschrift unter der Überschrift »Über die Mißhelligkeit zwischen der Moral und der Politik, in Absicht auf den ewigen Frieden« die Behauptung aufstellt, dass Klugheit und Moral grundsätzlich zusammen bestehen können. Es muss nicht notwendigerweise eine Dichotomie von Politik und Moral geben. Dieser Behauptung gibt Kant die folgende Fassung: „Die Politik sagt: »Seid klug wie die Schlangen«; die Moral setzt (als einschränkende Bedingung) hinzu: »und ohne Falsch wie die Tauben«“.893 Festzuhalten ist an dieser knappen Formel zweierlei. Zunächst erkennt Kant indirekterweise die Bedeutung der Klugheit für das politische Handeln an. Im zweiten Satzteil fügt er aber restriktiv hinzu, dass selbst der Politiker sein Handeln nicht ausschließlich auf Klugheit gründen darf, sondern auch und sogar vorrangig die Gebote der Sittlichkeit zu beachten hat. Das Feld der Klugheit findet somit seine Grenzen in der Moral, die hier bloß als „einschränkende Bedingung“ bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang schreibt Reinhard Brandt zu Recht, dass die Klugheit dem „Veto“ der Moral unterliegt.894 Zwischen Klugheit als Mittel der Politik und Moral gibt es also bei Kant keinen grundsätzlich unüberwindbaren Gegensatz, sondern schlicht entweder „Mißhelligkeit“ oder „Einhelligkeit“, das heißt entweder Disharmonie (Mangel an Übereinstimmung) oder Harmonie (Übereinstimmung). Dass Kant die Bedeutung der Klugheit im oben definierten Sinn für das politische Handeln überhaupt anerkennt, liegt im Hinblick auf seine Moralphilosophie nicht nahe und bedarf der Erklärung. Es wurde bereits gesehen, dass Kant im zweiten Abschnitt der Grundlegung neben der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs drei besondere Formeln anführt: Die Formel des Naturgesetzes, die Formel der Menschheit als Zweck an sich selbst sowie letztlich die Formel des Reiches der Zwecke als ein Reich der Natur. Obwohl sie jeweils unterschiedliche Aspekte betonen, sind diese drei Formeln Ausdruck des ein und selben Grundgesetzes: der allgemeine kategorische Imperativs.895 Die Selbst-Zweck-Formel des kategorischen Imperativs, auf welche nun näher eingegangen wird, lautet ihrerseits folgendermaßen: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“.896 Anhand dieser Formel des kategorischen Imperativs können die Willens- und Handlungsmaxime der Menschen auf ihre Moralität hin geprüft werden. Vor diesem Hintergrund drängt sich allerdings die Frage auf, was unter dieser Formel überhaupt zu verstehen ist und wie jene sich begründen lässt. Für Kant nimmt der Mensch als ein mit praktischer Vernunft begabtes Wesen eine Sonderstellung in der Natur ein. Dies liegt darin begründet, dass er einen Willen hat. Diesen 890 KUK: V, 172 In der Vorlesung über die Pädagogik zum Beispiel wird die Klugheit stets im Sinne von Weltklugheit als die Fähigkeit definiert, „der zufolge man alle Menschen zu seinen Endzwecken gebrauchen kann“ (IX, 450). 892 Auch in den späteren Vorarbeiten zur Rechtslehre definiert Kant die Klugheit in diesem Sinne als die „Geschicklichkeit […] Menschen (freye Wesen) als Mittel zu seinen Absichten zu brauchen“ (XXIII, 346). 893 Frieden: VIII, 370 894 Vgl. Brand, Reinhard: Klugheit bei Kant, in: Klugheit, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerswist-Metternich, 2005, S. 99. 895 Vgl. GMS: IV, 436 896 GMS: IV, 429 891 - 157 - Willen definiert Kant wiederum als das „Vermögen der Zwecke“.897 Es handelt sich genauer gesagt um das Vermögen eines jeden vernünftigen Wesens sich selbst beliebige Zwecke zu setzen und seine Handlungen als Mittel zu Erreichung dieser Zwecke anzupassen. An dieser Stelle besteht aber Erklärungsbedarf darüber, was unter dem Begriff des Zweckes zu verstehen ist. Als erste Annäherung an diesen Begriff, könnte man zunächst versucht sein darunter einen jeden Gegenstand der Neigungen zu verstehen, welcher noch nicht erreicht ist, allerdings angestrebt wird. Wenn dies die einzige Bedeutung des Begriffs des Zweckes wäre, dann würde der Begriff des „Zweckes an sich“ schlechterdings keinen Sinn machen. Wenn alle Handlungen nur als Mittel zu einem neigungsbestimmten, mithin subjektiven Zweck zu denken wären, dann würde es außerdem keinen kategorischen Imperativ geben. Der Begriff des Zweckes hat aber auch eine weitere Bedeutung. Kant schreibt nämlich, dass der Zweck auch das ist, was „dem Willen zum objectiven Grunde seiner Selbstbestimmung dient“.898 In diesem engeren Sinne lassen sich wohl Zwecke denken, welche nicht als Gegenstände der Neigungen zu betrachten wären. Wenn es nämlich einen kategorischen Imperativ gibt, welcher bestimmte Handlungen als praktisch notwendig gebietet, und wenn alle Handlungen einen Zweck verfolgen, dann muss es Zwecke geben, welche von allen Menschen notwendig in ihren Handlungen berücksichtigt werden müssen. Gemeint sind jene Zwecke, welche unabhängig von allen Neigungen, aus der eigenen Gesetzgebung der Vernunft, durch apriorische Prinzipien, welche die bloße Form des Wollens betreffen, bestimmt sind. Solche Zwecke sind „Zwecke an sich“, also Zwecke, die ohne Bezug auf materiale Zwecke gut sind. In der Grundlegung verwendet Kant eine je nach Zusammenhang abwechslungsreiche Terminologie, um diesen Unterschied deutlich zu machen. Auf der einen Seite werden „relative Zwecke“899 von Kant ebenfalls „subjektive Zwecke“900, „materielle Zwecke“901 oder auch „willkürliche Zwecke“902 genannt. Diese Zwecke sind neigungsbestimmt und haben somit lediglich für die einzelnen Menschen einen Wert. Auf der anderen Seite werden „objective Zwecke“903, von Kant auch „Zwecke an sich selbst“904 genannt. Es handelt sich also um diejenigen Zwecke, deren Dasein an sich, also unabhängig von den menschlichen Neigungen einen Wert haben. Entsprechend unterscheidet Kant auch zwischen „dem relativen Wert“ der relativen Zwecke, und dem „absoluten Wert“ objektiver Zwecke. Was nur einen relativen Wert und keinen absoluten hat, hat einen Preis. Was dagegen einen absoluten Wert hat, besitzt eine Würde.905 Desweiteren schreibt Kant, dass was einen Preis hat, nur eine Sache ist, während nur Personen eine Würde haben können.906 Da nur ein vernünftiges Wesen eine Person sein kann, sind die Menschen als vernünftige Wesen Personen, die als solche eine Würde haben und somit auch einen absoluten Wert. Aus der These der Würde vernünftiger Wesen folgt unmittelbar, dass der Wert aller Menschen gleich und absolut ist. Gleichwohl, ob die Menschen moralisch handeln oder nicht, besitzen und behalten sie als vernünftige Wesen eine Würde und somit einen absoluten Wert. So kommt Kant zu dem für uns entscheidenden Schluss, dass der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen nur als Zweck an sich selbst existieren. Dies beinhaltet, 897 Vgl. KpV: V, 58f.; KUK: V, 280, 370, 431 GMS: IV, 427 899 GMS: IV, 427, 428, 436 900 GMS: IV, 427, 428, 431 901 GMS: IV, 427 902 GMS: IV, 436 903 GMS: IV, 427, 428, 431 904 GMS: IV, 428 905 Vgl. GMS: IV, 434 906 Vgl. GMS: IV, 429 898 - 158 - dass sie nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauch für diesen oder jenen Willen existieren können, sondern jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden müssen.907 Ein vernunftbegabtes Wesen soll somit als Zweck an sich selbst betrachtet werden, weil es Zwecke für sich selbst bestimmen und verfolgen kann. Den anderen Menschen als Zweck an sich selbst zu behandeln, bedeutet demnach nur nach jenen Maximen zu handeln, von denen allen Menschen wollen können, dass sie zu allgemeinen Gesetzen dienen sollen. Um ein vernünftiges Wesen als Zweck an sich selbst behandeln zu können, muss also dieses jederzeit zugleich als gesetzgebend betrachtet werden.908 Die Menschen sollen nur nach objektiven Bewegungsgründen handeln, welche nicht subjektiv bedingt sind (auf Neigungen beruhen), sondern für jedes vernünftige Wesen gelten. Die Formel der Menschheit als Zweck an sich selbst scheint oberflächlich gesehen die Klugheit im zuvor definierten Sinn auszuschließen. Wer nämlich versucht, die anderen lediglich zum eigenen Zweck zu instrumentalisieren, macht aus diesen ein bloßes Mittel zum beliebigen Gebrauch, was der Selbst-Zweck-Formel des kategorischen Imperativs offensichtlich widerspricht. Es hat den Anschein, dass es für die Klugheit hier kein Platz gibt. Bei näherer Betrachtung kann dennoch festgehalten werden, dass die Selbst-Zweck-Formel des kategorischen Imperativs durchaus zulässt, andere als Mittel zu benutzen, allerdings unter der strengen Bedingung, dass diese eben nicht „bloß“, also ausschließlich, als Mittel gebraucht werden. Auf politischem Gebiet kann also folgendes festgehalten werden: Wenn der politische Handelnde sich zum Grundsatz macht, dem Recht gemäß zu handeln, und die Anderen zu seinem Zweck beeinflusst, dann ist Klugheit nichts anderes als die Geschicklichkeit, die Anderen zwecks der moralisch gebotenen Verwirklichung der Prinzipien des Rechts zu beeinflussen. Unter dieser Bedingung werden die Menschen nicht bloß als Mittel, sondern zugleich als Zweck betrachtet. In diesem Fall stimmen Klugheit, Recht und Moral durchaus überein. Moral und Klugheit schließen sich somit nicht notwendigerweise wechselseitig aus. Klugheit an sich ist nicht moralisch verwerflich, sondern ist vielmehr eine „sittlich neutrale Kompetenz“.909 Bereits an dieser Stelle ist zu sehen, dass Kant die Klugheit der Sittlichkeit unterordnet. Dies entspricht der Unterscheidung von hypothetischen und kategorischen Imperativen, welche wir im Folgenden näher betrachten werden. 2. Kants Lehre von den hypothetischen Imperativen 2.1 Die Unterscheidung zwischen kategorischem und hypothetischem Imperativen Kant führt seine Lehre von den hypothetischen Imperativen hauptsächlich im zweiten Abschnitt der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten aus. Dort wird zunächst kurz erläutert, was unter einem Imperativ überhaupt zu verstehen ist. Diesbezüglich soll folgendes festgehalten werden: Während alles in der Natur Naturgesetzen unterliegt (sei es biologische Gesetze wie bei Tieren oder physische Mechanismen wie bei lebloser Materie), können die Menschen als mit praktischer Vernunft begabte Wesen nach der Vorstellung von Gesetzen, mithin nach objektiven Vernunftgründen, handeln. Wenn die Vorstellung eines Gesetzes für einen Willen nötigend ist, wird von einem Gebot der Vernunft gesprochen. Die Formel des Gebots heißt wiederum Imperativ. Imperative sind somit normative Sätze, die als solche ein Sollen, das will heißen eine praktische Notwendigkeit aussprechen. Als praktische Sätze fordern sie die Menschen auf, in einer bestimmten Weise zu handeln oder sich einer 907 Vgl. GMS: IV, 428 Vgl. GMS: IV, 434 909 Höffe, Otfried: Politische Gerechtigkeit: Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt a. M. 1989, S. 475. 908 - 159 - bestimmten Handlung zu enthalten. Kurzum: Sie sagen, dass „etwas zu thun oder zu unterlassen gut sein würde“.910 Den Imperativen kommt die Funktion zu den Willen der Menschen zu nötigen, weil jene nicht von allein und notwendigerweise gut handeln. Imperative zeigen dadurch „das Verhältniß objectiver Gesetze des Wollens überhaupt zu der subjectiven Unvollkommenheit des Willens dieses oder jenes vernünftigen Wesens“.911 Die Imperative betreffen lediglich die Menschen als endliche Vernunftwesen, weil deren Willen im Unterschied zu den göttlichen und überhaupt zu den heiligen Wesen immer auch durch Sinnlichkeit bestimmt ist und deshalb nicht vollkommen gut ist. Weil die Menschen keinen vollkommen guten Willen haben, handeln sie nicht notwendigerweise moralisch. Dies ist der Grund, weshalb der Imperativ den Menschen überhaupt ein Sollen auferlegt, denn für einen vollkommen guten Willen sind Imperative überflüssig, weil „das Wollen schon von selbst mit dem Gesetz nothwendig einstimmig ist“.912 Des Weiteren führt Kant aus, dass Imperative Sätze sind, welche objektive Prinzipien der Willensbestimmung zum Ausdruck bringen. In der Grundlegung wird der Terminus „objektiv“ mit dem Ausdruck „aus Gründen, die für jedes vernünftige Wesen als ein solches gültig sind“913 erläutert. Ein praktisches Prinzip kann also nur dann objektive Geltung beanspruchen, wenn jenes auf Vernunftgründen beruht, das heißt auf Gründen, die von jedem vernünftigen Wesen unwidersprechlich als gültig erkannt werden können. Imperative gibt es in zweierlei Gestalt: Als kategorische und als hypothetische Imperative.914 Der Unterschied wird von Kant in drei kurzen Abschnitten aus der Grundlegung näher herausgearbeitet. Ganz allgemein kann folgendes festgehalten werden: Während der kategorische Imperativ eine Handlung als für sich selbst, das will heißen ohne Beziehung auf einen anderen Zweck, als objektiv-notwendig vorschreibt, gebietet der hypothetische Imperativ eine Handlung lediglich als Mittel für einen möglichen oder wirklichen Zweck. In Kants eigenen Worten heißt es: „Wenn nun die Handlung bloß wozu anders als Mittel gut sein würde, so ist der Imperativ hypothetisch; wird sie als an sich gut vorgestellt, mithin als nothwendig in einem an sich der Vernunft gemäßen Willen, als Princip desselben, so ist er kategorisch“.915 Während die kategorisch gebotene Handlung unabhängig von irgendeinem Ziel als an sich gut vorgestellt wird, ist die hypothetisch gebotene Handlung nur relativ gut. Das bedeutet, dass sie in Bezug auf einen gewissen Zweck gut ist. Die hypothetischen Imperative verstehen sich lediglich im Verhältnis zu einem gesetzten Zweck. Sie stellen die praktische Notwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu einem wirklichen oder bloß möglichen Zweck vor. Im Unterschied zum kategorischen Imperativ, liegt dem hypothetischen Imperativ somit immer eine Mittel-Zweck-Kalkulation zugrunde. Aus der schematischen Gegenüberstellung der von Kant anschließend verwendeten Definitionen ergibt sich das folgende Bild: 910 GMS: IV, 413 GMS: IV, 414 912 GMS: IV, 414 913 GMS: IV, 413 914 Vgl. GMS: IV, 414 915 GMS: IV, 414 (meine Hervorhebungen) 911 - 160 - Abbildung 3: Synopsis der Imperative Hypothetische Imperative Die Handlung wir lediglich als Mittel zu einem beliebig gesetzten oder natürlichen Zweck geboten Problematisch-praktisches Assertorisch-praktisches Prinzip Prinzip Gut geeignet für eine Gut geeignet für eine mögliche Absicht wirkliche Absicht Regeln der Geschicklichkeit Ratschläge der Klugheit Technische Imperative Pragmatische Imperative Kategorische Imperative Die Handlung wird für sich selbst als objektiv-notwendig geboten Apodiktisch-praktisches Prinzip An sich gut Gebote (Gesetze) der Sittlichkeit Moralische Imperative Diese begrifflichen Gegensatzpaare sind nicht immer unmittelbar einleuchtend und bedürfen also weiterer Erläuterungen. Im Folgenden werden wir uns vornehmlich auf die hypothetischen Imperative konzentrieren. Diesbezüglich gibt es allerdings viele Probleme, von denen nur einige primär die hier behandelte Problemstellung betreffen und daher in den folgenden Seiten näher erläutert werden. Bei der Bestimmung dessen, was unter dem Begriff eines hypothetischen Imperativs zu verstehen ist, soll zunächst ex negativo vorgegangen werden. Das heißt es soll in einem ersten Schritt bestimmt werden, was ein hypothetischer Imperativ nicht ist. Es soll dabei auf drei leicht auftretende Missverständnisse eingegangen werden und des Weiteren versucht werden diese zu beseitigen. Erstes Missverständnis: Um von Anfang an konzeptionelle Klarheit zu schaffen, soll vorweg darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich die hypothetischen Imperative von den kategorischen Imperativen nicht anhand eines sprachlichen Kriteriums unterscheiden lassen. Kant schreibt mitnichten, dass die hypothetischen Imperative Sätze von hypothetischer Form und die kategorischen Imperative von kategorischer Form sind. Was Kant hingegen schreibt ist, dass die ersten hypothetisch, die letzteren kategorisch gebieten. Die hypothetischen Imperative werden somit nicht ausschließlich in Konditionalsätzen formuliert. Die sprachliche Form der jeweiligen Imperative ist für die Unterscheidung von hypothetischen und kategorischen Imperativen ohne jegliche Bedeutung. Hypothetische Imperative können genauso gut in sprachlich kategorischer Form auftreten, als kategorische Imperative in sprachlich hypothetischer Form auftreten können. Zweites Missverständnis: Ein weiteres, naheliegendes Missverständnis liegt in dem Versuch die Mittel-Zweck-Unterscheidung zur Abgrenzung der beiden Typen von Imperativen heranzuziehen. Es ist falsch davon auszugehen, dass die Mittel hypothetisch, die Zwecke aber kategorisch geboten sind. Gewisse Textstellen in der Grundlegung können auch leicht den Eindruck erwecken, dass der kategorische Imperativ sich dadurch auszeichnet, dass er die Handlung als solche und nicht als Mittel für einen anderen Zweck gebietet, während der hypothetische Imperativ genau durch diese letzte Funktion bestimmbar wäre. Dies ist nicht grundsätzlich falsch, greift aber zu kurz. Wenn man bei Kant liest, dass eine Handlung für sich selbst geboten ist, dann hat dies zu bedeuten, dass jene nicht im Dienst der Neigung steht. Im ersten Teil der vorliegenden Dissertation wurde außerdem bereits ausführlich darauf eingegangen, dass auch Mittel kategorisch geboten sein können. Dies ist für diejenigen Mittel der Fall, die notwendig sind, um einen kategorisch gebotenen Zweck zu erreichen. Die Präliminarartikel zum Beispiel bestimmen die notwendigen Mittel zur Schaffung eines Zustandes vorläufiger Kriegsabwesenheit. Die Einhaltung der Präliminarartikel ist deshalb kategorisch geboten, weil sie die Bedingungen schaffen, unter denen der Abschluss eines vernunftnotwendigen Definitivvertrags überhaupt erst möglich ist. Es darf also nicht übersehen werden, dass eine Handlung als Mittel zu einem kategorisch gebotenen Zweck sehr wohl auch vernunftnotwendig sein kann. - 161 - Drittes Missverständnis: Kants Erläuterungen in der Grundlegung können ebenfalls leicht so verstanden werden, als wollte Kant lediglich dem kategorischen Imperativ objektive Geltung zusprechen und diese zugleich den hypothetischen Imperativen absprechen. Wenn diese Auslegung zutreffen würde, dann würde sich allerdings ein Widerspruch zu der eingangs angeführten Begriffsbestimmung ergeben, nach welcher allen Imperativen, also auch den hypothetischen, objektive Geltung zukommt. Dieses Missverständnis ist darauf zurückzuführen, dass Kant den Terminus „objektiv“ in jeweils unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Im Gegensatz zu der anfangs analysierten Definition des Imperativs bezieht sich der Terminus „objektiv“ im weiteren Verlauf des Textes nicht länger auf den Imperativ selbst, sondern lediglich auf die von jenem ausgesprochene Notwendigkeit bzw. Nötigung (das Sollen). Beide Ebenen sind nicht miteinander zu verwechseln. Nur der kategorische Imperativ führt den Begriff einer objektiven und mithin allgemein gültigen Notwendigkeit bei sich. Dagegen enthalten die hypothetischen Imperative zwar Notwendigkeit, welche jedoch bloß unter der Bedingung der menschlichen Zwecksetzungen gelten kann.916 Ein wesentlicher Unterschied zwischen den kategorischen und den hypothetischen Imperativen ist also, dass die Nötigung bei den kategorischen Imperativen objektiv, allgemeingültig und unbedingt ist. Dies ist jedoch nicht der Fall bei den hypothetischen Imperativen. Die hypothetischen Imperative selbst sind dagegen ebenso objektiv und allgemeingültig wie der kategorische Imperativ. Die kategorischen und hypothetischen Imperative haben an sich beide objektive Geltung. Die Frage, welche sich vor diesem Hintergrund aufdrängt, lautet: Warum ist die Geltung der hypothetischen Imperative objektiv, ihre Nötigung jedoch nicht? Diese Frage führt zu dem eigentlichen Unterschied von kategorischem und hypothetischem Imperativ. Die hypothetischen Imperative bestimmen, welche möglichen Handlungen getan werden sollen, um entweder einen beliebig gesetzten oder einen natürlichen (und damit notwendigen) Zweck zu erreichen. Nur wenn die Menschen sich einen Zweck gesetzt haben, müssen sie im Sinne eines konsistenten Willens auch die dafür erforderlichen Mittel wollen und somit nach den Vorschriften des hypothetischen Imperativs handeln. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass die hypothetischen Imperative eine Nötigung enthalten, welche davon abhängig ist, ob bestimmte Zwecksetzungen bei den einzelnen Menschen überhaupt vorliegen. Kurzum: Die hypothetischen Imperative sind nur unter der Voraussetzung eines gesetzten Zwecks nötigend. Dies hat nun zweierlei zu bedeuten. Es bedeutet zunächst, dass so viele hypothetische Imperative gedacht werden können, als es Ziele geben kann. Ebenfalls bedeutet es, dass die hypothetischen Imperative sich nicht an jedermann richten, weil sich alle Menschen nicht notwendigerweise dieselben Ziele setzten. Hierbei wird nicht übersehen, dass die pragmatischen Imperative sich auf die wirkliche Absicht der eigenen Glückseligkeit beziehen, die für die Menschen kein beliebiges Ziel ist. Die eigene Glückseligkeit ist vielmehr ein „Zwecke, den allen Menschen natürlicher Weise haben“.917 Was Glückseligkeit konkret für jeden einzelnen bedeutet, variiert jedoch bis zu einem bestimmten Grad von Mensch zu Mensch. Die Adressaten der hypothetischen Imperative (einschließlich jene der pragmatischen Imperative) sind also nicht die Gesamtheit aller Menschen, sondern nur ein Teil davon. Die hypothetischen Imperative sind nur für die speziell Interessierten oder anders gesagt für die begrenzte Zahl ihrer jeweiligen Adressaten notwendig. Die hypothetischen Imperative unterscheiden sich dadurch vom kategorischen Imperativ, denn der kategorische Imperativ gilt als ein rein formales Prinzip unabhängig von den menschlichen Zwecksetzungen und führt allgemeine sowie objektive Notwendigkeit mit sich. Die hypothetischen Imperative verfügen jedoch auch über objektive Geltung, da alle Menschen als vernünftige Wesen erkennen können, dass jene Imperative für den begrenzten 916 917 Vgl. GMS: IV, 416 Gemeinspruch: VIII, 289 - 162 - Kreis ihrer Adressaten verbindlich sind. Selbst wenn die Menschen aufgrund ihrer Zwecksetzungen von einem hypothetischen Imperativ unberührt bleiben, können und sogar sollen sie diesen Imperativ als richtig und wirksam anerkennen. Die hypothetischen Imperative verfügen somit auch über objektive Geltung, da sie von jedem vernünftigen Wesen unwidersprechlich als gültig erkannt werden können. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die hypothetischen Imperative an eine Voraussetzung („Wenn...“) gebunden sind, aber allgemeine Geltung und unter dieser Voraussetzung (also im Rahmen des Satzes „Wenn...“) sogar Notwendigkeit beanspruchen können. Sie verfügen somit über einen internen notwendigen Charakter. Das zuvor Beachtete lässt sich vielleicht am besten an einem einfachen Beispiel festmachen. Ein hypothetischer Imperativ kann beispielsweise bestimmen, wie lange und unter welcher Temperatur ein Ei gekocht werden soll, um es weichzukochen. Die in diesem hypothetischen Imperativ ausgesprochene Nötigung ist nicht objektiv und allgemeingültig, weil nicht vorausgesetzt werden kann, dass alle Menschen weichgekochte Eier essen wollen. Alle Menschen können jedoch einsehen, dass der ausgesprochene Imperativ gültig ist, wenn der gesetzte Zweck darin besteht, weichgekochte Eier zu essen. Der hypothetische Imperativ ist also objektiv gültig. Wenn es darum geht, Eier weichzukochen, dann kann und soll sogar nach den Vorschriften des hypothetischen Imperatives gehandelt werden. Übertragen auf das Gebiet der Politik kann das Beispiel der drei berühmt-berüchtigten Maximen des politischen Moralisten, fac et excusa, si fecisti, nega und divide et impera, angeführt werden.918 Der hypothetische Imperativ, der diesen Maximen zugrunde liegt, ist nur unter der Voraussetzung nötigend, dass sich die Politiker die bloße Erhaltung und Erweiterung der eigenen Macht zum Ziel gemacht haben. Allgemein kann festgehalten werden, dass hypothetische Imperative nicht voraussetzungsfrei formuliert sein können. Kant schreibt diesbezüglich: „Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er enthalten werde: bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so weiß ich sofort, was er enthalte“.919 Die Notwendigkeit der hypothetischen Imperative ergibt sich nur im Hinblick auf einen bestimmten Zweck. Unabhängig von diesem Zweck machen sie schlechterdings keinen Sinn. Sie sind derartig zu verstehen: „Wenn du das Ziel X erreichen möchtest, dann sollst du auf das Mittel Y zurückgreifen“. Wenn dein Ziel lediglich darin besteht, deine Macht auszubauen, dann ist es nützlich den folgenden Maximen zu folgen: fac et excusa; si fecisti, nega und divide et impera. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gegenüberstellung von objektiven kategorischen Imperativen einerseits und subjektiven hypothetischen Imperativen andererseits sich nicht auf die Geltung der jeweiligen Imperative, sondern auf den Bereich ihrer Adressaten, der sich im ersten Fall auf alle Menschen erstreckt, während er im zweiten Fall nur eine Teilmenge derselben betrifft. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen stellt sich die Frage, worauf die Unterscheidung von hypothetischen und kategorischen Imperativen beruht, wenn sie weder die sprachliche Form betrifft noch die Mittel-Zweck-Unterscheidung, oder die Unterscheidung zwischen einer objektiven und einer subjektiven Geltung. Es wurde bereits ausführlich gesehen, dass der Unterschied zwischen den hypothetischen und den kategorischen Imperativen auf der Art und Weise beruht, wie sie gebieten, das heißt wie jene die praktische Notwendigkeit einer Handlung vorstellen. Mit Kants Worten würde man sagen, dass der Unterschied von hypothetischem und kategorischem Imperativ auf einer „Ungleichheit der Nöthigung des Willens“920 zurückgeht, das heißt auf einen Unterschied der Notwendigkeit, die sie ausdrücken. Im ersten Falle handelt es sich um eine bloß subjektiv 918 Vgl. Frieden: VIII, 374f. GMS: IV, 420 920 GMS: IV, 416 919 - 163 - bedingte Nötigung des Willens, während es sich im zweiten Falle um eine unbedingte und absolute Nötigung des Willens handelt. Während die hypothetischen Imperative nur ein bedingtes Sollen aussprechen, spricht der kategorische Imperativ ein unbedingtes Sollen aus. Es ist aber wichtig, einen Schritt weiter zu gehen und zu sehen, dass diese Ungleichheit der Nötigung des Willens Kants Unterscheidung zwischen dem materialem und dem formalem Prinzip des Willens entspricht. Praktische Prinzipien sind formal, wenn sie von allen neigungsbestimmten, mithin subjektiven Zwecken abstrahieren. Sie sind aber material, wenn sie auf Triebfedern beruhen. Der hypothetische Imperativ drückt, als ein materiales Prinzip, ein bedingtes Sollen aus. Er setzt den Bestimmungsgrund des Willens und des Handelns in einen beliebigen Zweck, welchen Kant als „Gegenstand der Willkür“921 bezeichnet, und welcher allemal aufgrund von Bedürfnissen und Neigungen (Furcht, Hoffnung, Berechnung, Interesse, usw.) gewählt ist. Die von den Menschen gesetzten Zwecke hängen aber immer von der Besonderheit der äußeren und inneren Umstände ihres Handelns ab. Es handelt sich somit um bloß zufällige Zwecke. Weil der hypothetische Imperativ sich auf einen neigungsbestimmten, und somit zufälligen Zweck bezieht, kann er nur unter Voraussetzung empirischer Bedingungen des vorgesetzten Zwecks nötigend sein. Der kategorische Imperativ drückt dagegen, als ein rein formales Prinzip, ein unbedingtes Sollen aus. Er setzt den Bestimmungsgrund des Willens und des Handelns in der Tauglichkeit der Maxime zu einem allgemeinen Gesetz. Der kategorische Imperativ bezieht sich also auf ein nicht-empirisch bedingtes, mithin rein formales Wollen. Der Wille wird hier gänzlich von der Vernunft bestimmt ohne Rücksicht auf einen Zweck, das heißt auf eine Materie des Willens. Entscheidend für die Unterscheidung von hypothetischem und kategorischem Imperativ ist somit letztlich der Ursprung des Wollens, auf welchen der Imperativ bezogen ist. Während der kategorische Imperativ von der Materie der Handlung abstrahiert, bezieht sich der hypothetische Imperativ auf einen neigungsbestimmten Zweck. 2.2 Die Unterscheidung zwischen technischem und pragmatischem Imperativ a) Wie unterscheiden sich die technischen von den pragmatischen Imperativen? Die Unterscheidung von kategorischem und hypothetischem Imperativ, welche die Entgegensetzung von Unbedingtem und Bedingtem zum Ausdruck bringt, entspricht dem Gesichtspunkt der Relation, welchen Kant wiederum seiner Tafel der Urteile922 sowie seiner Tafel der Kategorien923 entnimmt. Im Anschluss daran führt Kant jedoch den Gesichtspunkt der Modalität ein und dadurch gelingt ihm eine Dreiteilung der Imperative. Unter dem Gesichtspunkt der Modalität unterscheidet Kant die Grundbegriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit. Ihnen entsprechen dann auch die drei Grundsätze der Modalität. Dementsprechend können also alle praktischen Sätze nur diesen drei Typen entsprechen. Denn eine Handlung erfolgt um einer möglichen Absicht willen, sie erfolgt um einer wirklichen Absicht willen, oder sie erfolgt letztlich nicht um einer fremdbestimmten Absicht willen, sondern um ihrer selbst willen, also notwendig. Deshalb schreibt Kant, dass der hypothetische Imperativ eine Handlung entweder zu einer möglichen oder zu einer wirklichen Absicht gebietet.924 Im ersten Falle ist er ein „problematisch-praktisches Prinzip“, während er im zweiten Fall ein „assertorischpraktisches Prinzip“ ist. Der kategorische Imperativ, welcher die Handlung ohne Beziehung 921 Frieden: VIII, 377 Vgl. KrV: III, 86 923 Vgl. KrV: III, 93 924 Vgl. GMS: IV, 414 922 - 164 - auf irgendeine Absicht, also als für sich als objektiv notwendig erklärt, gilt seinerseits als ein „apodiktisch-praktisches Prinzip“.925 Kant grenzt die drei Imperativtypen auch dermaßen ab, als dass er zwischen „Regeln der Geschicklichkeit“, „Ratschlägen der Klugheit“ und „Geboten der Sittlichkeit“ unterscheidet. Schließlich nennt er diese drei Imperative technisch (zur Kunst gehörig), pragmatisch (zur Wohlfahrt gehörig), moralisch (zu den Sitten gehörig).926 Erklärungsbedürftig ist nun, was technische und pragmatische Imperative eigentlich sind. Wie lässt sich ein pragmatischer Imperativ der Klugheit von einem technischen Imperativ der Geschicklichkeit unterscheiden? Diese Frage lässt sich nicht leicht beantworten, weil Kants Erläuterungen hier manchmal die gewünschte Klarheit fehlen. Fest steht, dass die beiden hypothetischen Imperative eine Handlung nicht schlechthin, sondern nur als Mittel zu einem anderen Zweck gebieten. Dabei werden sowohl die Zwecke als auch die dafür notwendigen Mittel durch Naturbegriffe bestimmt. Während die Zwecke von Neigungen bestimmt werden, werden die dafür erforderlichen Mittel durch empirische kausale Gesetze bestimmt. Das Erste, was sich diesbezüglich aus der Grundlegung entnehmen lässt, ist, dass der technische Imperativ vom dem pragmatischen Imperativ dahingehend unterschieden ist, dass bei dem ersten der Zweck bloß möglich, bei dem zweiten aber gegeben ist.927 Mit anderen Worten könnte man sagen, dass sich die technischen Imperative von den pragmatischen Imperativen dadurch unterscheiden, dass der Begriff des Zwecks, auf dem sie beruhen, bei den ersteren unbestimmt, bei den letzteren aber bestimmt sei. Bei den pragmatischen Imperativen hat jeder Mensch denselben Zweck, während bei den technischen Imperativen nicht jeder Mensch denselben Zweck hat. Die technischen Imperative (Regeln der Geschicklichkeit) geben an, welche möglichen Handlungen ausgeübt werden sollen, um ein mögliches Ziel zu erreichen. Auf den ersten Blick liegt es nahe, den Ausdruck „mögliche Zwecke“ mit dem Ausdruck „irgendein Zweck“ gleichzusetzen. Kant spezifiziert jedoch was unter einem möglichen Zweck zu verstehen ist. In der Grundlegung definiert er einen möglichen Zweck als alles, „das, was nur durch Kräfte irgend eines vernünftigen Wesens möglich ist“.928 Wie die anderen Arten von Imperativen, beziehen sich die technischen Imperative auf Zwecke, die nicht notwendig gesetzt werden müssen und auch nicht unmöglich sind. Erstens: Als praktische Sätze können sich die technischen Imperative selbstverständlich nicht auf Handlungen beziehen, die mit Notwendigkeit geschehen müssen. Weil der Mensch kein Ding der Natur, sondern ein vernunftbegabtes Wesen ist, hat er stets die Möglichkeit, einen Imperativ zu übertreten. Zweitens: Die technischen Imperative können ebenfalls keine Handlungen gebieten, welche außerhalb des Rahmens des (logisch oder faktisch) Möglichen stehen, weil es per definitionem solche Handlungen nicht gibt. Aus dem bisher Gesagten kann folgendes festgehalten werden: Die technischen Imperative beziehen sich auf Zwecke, die erstens für den Willen kontingent sind, und zweitens im Rahmen prinzipieller Erreichbarkeit liegen.929 Die Regeln der Geschicklichkeit befassen sich mit technischen, sachorientierten Problemen und geben konkrete natürliche Zusammenhänge an. Die Formel des sich auf eine mögliche Absicht beziehenden hypothetischen Imperativs lautet: Wenn der Zweck gesetzt ist, dann soll auf eine Regel der Geschicklichkeit zurückgegriffen werden, die uns besagt, welches Mittel eingesetzt werden muss, um die gewollte Wirkung hervorzurufen. Es hat sich bisher gezeigt, dass die technischen Imperative jene Handlungen gebieten, die angewandt werden sollen, um eine 925 Vgl. GMS: IV, 414 Vgl. GMS: IV, 417 927 Vgl. GMS: IV, 419 928 GMS: IV, 415 929 Vgl. Aubenque, Pierre: Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles, Hamburg 2007, S. 183. 926 - 165 - Absicht zu erreichen, welche die Menschen bloß vernünftigerweise wollen können. Es gibt somit unendlich viele Regeln der Geschicklichkeit, da auch die Zahl möglicher Absichten unbegrenzt ist. Es muss angenommen werden, dass die Menschen sich all das zum Ziel machen können, was in ihrer Macht steht. Mit Kants eigenen Worten heißt es: „Man kann sich das, was nur durch Kräfte irgend eines vernünftigen Wesens möglich ist, auch für irgend einen Willen als mögliche Absicht denken, und daher sind der Principien der Handlung, so fern diese als nothwendig vorgestellt wird, um irgend eine dadurch zu bewirkende mögliche Absicht zu erreichen, in der That unendlich viel“.930 Aus diesem Grunde nennt Kant den hypothetischen Imperativ, welcher die praktische Notwendigkeit einer Handlung als Mittel zur Erreichung eines bloß möglichen Zwecks vorstellt, als problematisch. Wichtig ist des Weiteren zu sehen, dass die Regeln der Geschicklichkeit sittlich gleichgültig sind. Kant erläutert die technischen Imperative anhand eines doppelten Beispiels – nämlich die Handlungsanweisungen, die ein Arzt befolgen muss, um seinen Patienten zu heilen, und diejenigen, die ein Giftmischer befolgen muss, um ihn zu töten. Dieses Beispiel weist darauf hin, dass die technischen Imperative dem Zweck gegenüber völlig gleichgültig sind. Kant formuliert dies wie folgt: „Ob der Zweck vernünftig und gut sei, davon ist hier gar nicht die Frage, sondern nur was man thun müsse, um ihn zu erreichen. Die Vorschriften für den Arzt, um seinen Mann auf gründliche Art gesund zu machen, und für einen Giftmischer, um ihn sicher zu tödten, sind in so fern von gleichem Werth, als eine jede dazu dient, ihre Absicht vollkommen zu bewirken“.931 Ob der Zweck gut oder vernünftig ist, ist hier ohne Belang. Es geht nämlich nicht um die Frage nach der Bestimmung des Willens, sondern lediglich um jene nach der Wahl der geeigneten Mittel in Hinsicht auf eine bereits festgestellte Absicht. Von dem Gesichtspunkt der Geschicklichkeit aus betrachtet, gilt eine moralische Zwecksetzung im selben Maße wie eine unmoralische. Die pragmatischen Imperative (Ratschläge der Klugheit) beziehen sich dagegen auf eine Absicht, welche die Menschen nicht bloß haben können, sondern von denen man sicher und a priori voraussetzen kann, dass sie diese Absicht insgesamt von ihrer Natur her haben. Diese Absicht ist für Kant die Absicht der Glückseligkeit.932 In Abgrenzung zu den technischen Imperativen, geben somit die pragmatischen Imperative an, wie der vorgegebene bzw. wirkliche Zweck der eigenen Glückseligkeit, den Kant für ein natürliches, mithin notwendiges Streben aller Menschen hält, erreicht werden kann. Für Kant darf man das Streben nach Glückseligkeit „nicht bloß als nothwendig zu einer ungewissen, bloß möglichen Absicht vortragen, sondern zu einer Absicht, die man sicher und a priori bei jedem Menschen voraussetzen kann, weil sie zu seinem Wesen gehört“.933 Das Streben nach Glückseligkeit gehört zum Wesen des Menschen. Es ist ein anthropologisches Faktum, das bei jedem einzelnen Menschen sogar a priori also unabhängig von zeitlich-psychologischen Erfahrungen vorausgesetzt werden kann. Dieses Streben, welches dem Menschen innewohnt, wird einen jeden durchgängig sein Leben lang begleiten. So definiert Kant die Glückseligkeit in der Kritik der praktischen Vernunft als „das Bewußtsein eines vernünftigen Wesens von der Annehmlichkeit des Lebens, die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet“.934 Vor diesem Hintergrund drängt sich nun die Frage auf, was Kant unter dem Begriff der Glückseligkeit überhaupt versteht. Die Antwort auf diese Frage ist deswegen nicht so einfach zu beantworten, wie es zunächst erscheinen könnte, weil die Thematik der Glückseligkeit bei Kant zwar eine nicht zu unterschätzende Rolle einnimmt, sich jedoch durch sein gesamtes Werk hindurch zieht und 930 GMS: IV, 415 GMS: IV, 415 932 Vgl. GMS: IV, 415 933 GMS: IV, 415f. 934 KpV: V, 22 931 - 166 - immer eher beiläufig behandelt wird.935 In der Kritik der reinen Vernunft definiert Kant die Glückseligkeit als „die Befriedigung aller unserer Neigungen (sowohl extensive der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive dem Grade und auch protensive der Dauer nach)“.936 An dieser kurzen Definition ist zweierlei festzuhalten. Erstens kann festgehalten werden, dass der Begriff der Glückseligkeit sich inhärent auf „uns“, das will heißen auf alle Menschen in ihrer jeweiligen Individualität bezieht. Glückseligkeit ist anders formuliert die Befriedigung der spezifischen Neigungen eines jeden Menschen. Daraus folgt wiederum, dass, was die Menschen unter Glückseligkeit verstehen, von einem Mensch zum anderen variieren kann. Des Weiteren kann festgehalten werden, dass die Glückseligkeit für Kant ein Zustand ist, in welchem jegliche konkreten Situationen inbegriffen sind und welcher somit allumfassenden Charakter hat. Kants Begriff der Glückseligkeit geht somit weit über die bloß vorübergehende Zufriedenheit mit sich selbst in einer besonderen Situation hinaus – wie etwa wenn wir ein lang erstrebtes Ziel erreicht haben. Kant versteht die Glückseligkeit vielmehr als eine Zufriedenheit des Menschen mit seinem ganzen Dasein. Diese Zufriedenheit beschränkt sich nicht allein auf die Gegenwart, sondern umfasst die Vergangenheit und erstreckt sich bis in die Zukunft. In der Grundlegung schreibt Kant explizit, dass „zur Idee der Glückseligkeit ein absolutes Ganze, ein Maximum des Wohlbefindens, in meinem gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist“.937 Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die technischen Imperative sich von den pragmatischen Imperativen dahingehend unterscheiden, dass es bei den technischen Imperativen prinzipiell immer offen bleibt, ob sich die Menschen einen gegebenen Zweck setzten werden oder nicht. Dies ist bei den pragmatischen Imperativen nicht der Fall, weil jene auf das Glück bezogen sind, welches für Kant nicht einmal gewollt werden muss oder überhaupt nur kann, da das Streben nach Glückseligkeit eine den Menschen wesentliche Eigenschaft ist. In den bisherigen Ausführungen wurden die Regeln der Geschicklichkeit und die Ratschläge der Klugheit getrennt dargestellt. Dies hat jedoch nicht notwendigerweise immer zu bedeuten, dass sie als zwei voneinander getrennte hypothetische Imperative betrachtet werden sollen. Die technischen Imperative können sehr wohl sachbezogene Handlungsvorschriften formulieren, um ein mögliches Ziel zu erreichen, das uns wirklich glücklich machen würde. Die technischen Imperative können also unter bestimmten Bedingungen mit den pragmatischen Imperativen konvergieren. Die Imperative der Klugheit nehmen dann die Imperative der Geschicklichkeit in ihren Dienst.938 Kant hat sich jedoch bisher damit begnügt, die technischen Imperative bloß zu beschreiben. In einem zweiten Schritt versucht er ihre Möglichkeit überhaupt zu begründen. b) Wie sind die hypothetischen Imperative möglich? Es hat sich bisher gezeigt, was unter den verschiedenen hypothetischen Imperativen zu verstehen ist. Die Frage, welche sich anschließend stellt ist folgende: Wie sind alle diese Imperative möglich? Unter dieser Frage ist nicht zu verstehen, wie die hypothetisch gebotenen Handlungen vollzogen werden können. Auf diese Frage soll im nächsten Kapitel ausführlich eingegangen werden. Gefragt ist hier lediglich wie die Nötigung des Willens, die in dem Imperativ enthalten ist, gedacht werden kann. 935 Für eine Gesamtdarstellung des Kantischen Verständnisses von Glückseligkeit siehe: Himmelmann, Beatrix: Kants Begriff des Glücks, Berlin 2003. 936 KrV: III, 523 937 GMS: IV, 418 (meine Hervorhebungen) 938 Vgl. Brandt, Reinhard: Klugheit bei Kant, in: Klugheit, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerswist-Metternich 2005, S. 111. - 167 - Wie ein technischer Imperativ möglich sei, bereitet Kant zufolge keine große Schwierigkeit. Die Regel der Geschicklichkeit formuliert Handlungsvorschriften, welche insofern nötigend sind, als mit dem gesetzten Zweck auch die dazu erforderlichen Mittel gewollt werden müssen. Kants Erklärung dazu lautet: „Wer den Zweck will, will (so fern die Vernunft auf seine Handlungen entscheidenden Einfluß hat) auch das dazu unentbehrlich nothwendige Mittel, das in seiner Gewalt ist“.939 Mit anderen Worten könnte man sagen, dass das empirische Wollen eines beliebigen Zweckes das empirische Wollen der dafür notwendigen Mittel einschließt. Es ist nämlich in sich widersprüchlich, sich einen Zweck zu setzten ohne die dafür erforderlichen Mittel zu wollen. Zwar kann man sich sehr wohl einen Menschen denken, der sich einen bestimmten Zweck gesetzt hat, welchen er zu wollen meint, aber in Wirklichkeit nur wünscht.940 Es würde ihm nicht gelingen vom unverbindlichen Wünschen zum handlungsleitenden Wollen zu gelangen. Gerade in einer derartigen Situation, in welcher ein Mensch nicht einstimmig mit sich selbst denkt, stellt sich der hypothetische Imperativ als praktischer Satz entgegen. Er erinnert den Menschen an folgendes: Wenn du wirklich dieses Ziel willst, dann sollst du diese oder diese Handlung als das notwendige Mittel, welches in deiner Gewalt steht, vollziehen, um das Ziel zu erreichen. Der Wollende wird somit aufgefordert, sich konsequent an sein Ziel zu halten und die notwendigen Mittel für jenen Zweck aufzubringen. In der Grundlegung verteidigt Kant die These, dass der hypothetische Imperativ, was das Wollen betrifft, ein analytischer Satz sei. Nachdem der synthetische Zusammenhang zwischen Mittel und Zweck erkannt ist, folgt die Verbindlichkeit der technischen Regel analytisch, „denn in dem Wollen eines Objects als meiner Wirkung wird schon meine Causalität als handelnde Ursache, d. i. der Gebrauch der Mittel, gedacht, und der Imperativ zieht den Begriff nothwendiger Handlungen zu diesem Zwecke schon aus dem Begriff eines Wollens dieses Zwecks heraus“.941 In der Sekundärliteratur bleibt es jedoch bis heute umstritten, ob die technischen Imperative tatsächlich analytische Sätze sind. Eine eingehende Berücksichtigung der Diskussion zu diesem Thema würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wird deshalb unterlassen.942 Im Unterschied zu den technischen Imperativen sind die pragmatischen Imperative keine analytischen Sätze.943 Dies würde der Fall sein, wenn es möglich wäre, einen bestimmten Begriff von Glückseligkeit zu geben. Kants Ausführungen lauten in diesem Zusammenhang: „Die Imperative der Klugheit würden, wenn es nur so leicht wäre, einen bestimmten Begriff von Glückseligkeit zu geben, mit denen der Geschicklichkeit ganz und gar übereinkommen und eben sowohl analytisch sein“.944 Die Verbindlichkeit der pragmatischen Imperative würde sich ebenso wie jene der technischen Regeln aus der Synthese von Mittel und Zweck analytisch ergeben, insofern es gelingen würde einen einzigen, allgemeingültigen Begriff von Glückseligkeit zu definieren: „Denn es würde eben sowohl hier als dort heißen: wer den Zweck will, will auch (der Vernunft gemäß nothwendig) die einzigen Mittel, die dazu in seiner Gewalt sind“.945 Eine derartige Leistung übersteigt jedoch bei weitem die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen als einem endlichen 939 GMS: IV, 417 (meine Hervorhebung) Vgl. Brandt, Reinhard: Klugheit bei Kant, in: Klugheit, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerswist-Metternich 2005, S. 109. 941 GMS: IV, 417 942 In der einschlägigen Sekundärliteratur ist nach wie vor keine einheitliche Position zu finden. Während eine erste Gruppe von Autoren (Downie 1984, Ludwig 1999, Seel 2000) Kants Argumentation kritisch gegenübersteht, meint eine zweite Gruppe von Interpreten (Marshall 1982, Baumanns 2000) weiterhin, dass die hypothetischen Imperative analytische Sätze seien. 943 Vgl. GMS: IV, 417 944 GMS: IV, 417 945 GMS: IV, 417f. 940 - 168 - Vernunftwesen. Dies ist auf dreierlei Gründe zurückzuführen, welche jedoch von Kant nur teilweise in der hier vorgetragenen Form ausgeführt werden. Erstens ist der Mensch zwar ein endliches Wesen, welches jedoch unendlich viele Neigungen, Bedürfnisse, Hoffnungen und Wünsche hat. Deren qualitativ sowie quantitativ maximale Erfüllung wird von Kant als Glückseligkeit genannt. Die Glückseligkeit, als ein Zustand eines Maximums an Wohlergehen, ist niemals vollständig zu erreichen, weil jede Entscheidung bezüglich der Erfüllung einer Neigung gleichzeitig die Preisgabe einer anderen Entscheidung bezüglich der Erfüllung einer anderen Neigung zur Folge hat, die für den Handelnden vielleicht genauso wünschenswert wäre. Zweitens kann keine allgemeingültige Definition dafür gegeben werden, was Glückseligkeit für einen jeden ausmacht. Es kann weder eine persönliche noch a fortiori allgemeingültige Definition der Glückseligkeit gegeben werden, weil die Menschen niemals mit sich selbst einstimmig bestimmen können, was sie eigentlich wollen und wünschen. Es ist also unmöglich alle empirischen Elemente, welche die Glückseligkeit ausmachen können, unter einen einzigen Begriff zu subsumieren. Drittens kann keine vollständige Prognose der komplexen Folgen unserer Handlungen gemacht werden. Die Bestimmung der Mittel zur eigenen Glückseligkeit soll an der unüberwindbaren Komplexität des empirischen Lebens und der menschlichen Freiheit scheitern, weil die Menschen niemals im Voraus sicher sein können, ob ihre Handlungen dem vorausgesetzten Zweck der eigenen Glückseligkeit tatsächlich zuträglich sein werden oder nicht. Die dafür erforderliche Allwissenheit ist den Menschen jedoch niemals gegeben. Um dies zu verdeutlichen führt Kant das Beispiel eines Menschen auf, der seine Glückseligkeit im Reichtum sieht. Die Erfüllung dieser Neigung führt jedoch Probleme mit sich, weil sein Reichtum ihm den Neid seiner Mitmenschen einbringt. Der Neid der anderen Menschen verhindert ihn wiederum vollständig glücklich zu sein. Diese Nebenfolge ist zwar nicht gewollt, muss jedoch im Kauf genommen werden. Für Kant ist der Mensch „nicht vermögend nach irgend einem Grundsatze mit völliger Gewißheit zu bestimmen, was ihn wahrhaftig glücklich machen werde, darum, weil hiezu Allwissenheit erforderlich sein würde“.946 Die begriffliche Bestimmung der Glückseligkeit sowie der dafür notwendigen Mittel erfordert eine Allwissenheit, die von den Menschen als endliche Vernunftwesen nicht erreicht werden kann. Dies wäre aber für den Begriff der Glückseligkeit notwendig, denn es wurde bereits gesehen, dass „zur Idee der Glückseligkeit ein absolutes Ganze, ein Maximum des Wohlbefindens, in meinem gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist“.947 Indem Kant die Allwissenheit als die Bedingung der Möglichkeit für die analytisch folgende Notwendigkeit der pragmatischen Imperative aufdeckt, erfasst er das Grundproblem einer jeden konsequentialistischen Ethik, welche universal-gebietende Gesetze aufzustellen versucht: Eine solche Ethik stößt immer an die Grenzen der kognitiven Fähigkeiten der Menschen. Wenn dies nicht der Fall wäre, wenn man also die Glückseligkeit inhaltlich bestimmen könnte sowie die Mittel zum Glück ganz genau kennen würde, dann wären die pragmatischen Imperative auch nur analytische Sätze. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Imperative der Klugheit nicht analytische Sätze sein können, weil es weder einen a priori festgelegten Begriff von Glückseligkeit gibt noch einen solchen überhaupt geben kann. Dies ist wiederum darauf zurückzuführen, dass die Menschen nicht alle ihre Bestrebungen zeitgleich erfüllen können und vor diesem Hintergrund unfähig sind mit sich selbst einstimmig zu entscheiden, worin ihre Glückseligkeit eigentlich liegt, und weil die von den Menschen gewählten Zwecke aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Handlungsfolgen immer ambivalent sind. 946 947 GMS: IV, 418 GMS: IV, 418 (meine Hervorhebungen) - 169 - Am Ende seiner Auseinandersetzung mit dem Eudämonismus kommt Kant zum folgenden Schluss: „Man kann also nicht nach bestimmten Prinzipien handeln, um glücklich zu sein, sondern nur nach empirischen Ratschlägen, z.B. der Diät, der Sparsamkeit, der Höflichkeit, der Zurückhaltung u. s. w., von welchen die Erfahrung lehrt, daß sie das Wohlbefinden im Durchschnitt am meisten befördern“.948 Es handelt sich hier um einen gewichtigen Satz, der eine nähere Betrachtung verdient. Aus der Unmöglichkeit heraus eine Definition der Glückseligkeit zu geben sowie die komplexen Folgen unseres Handelns zu bestimmen, folgt zunächst, dass es unmöglich ist in gewisser und allgemeiner Weise zu bestimmen, welche Handlungen die Glückseligkeit der Menschen befördern. Es gibt kein verlässliches Prinzip, an dem sich die Menschen in ihrem Tun und Lassen orientieren können, um glücklich zu werden. Die Menschen können niemals sicher sein, was am Ende wirklich klug ist und die pragmatischen Imperative können ihnen niemals den Erfolg garantieren. Kant schreibt, dass die Handlungsvorschriften der pragmatischen Imperative den Menschen nur sagen können, welche Handlungen „im Durchschnitt“ ihre Ziele am besten dienen.949 Daraus folgt wiederum, dass die pragmatischen Imperative mit keinerlei Sicherheit verbunden sind. Weil sie auf einem bloß statistischen Prinzip gründen, kann ein Irrtum niemals ausgeschlossen werden. Aus der Unsicherheit der Folgenerwägungen erkennt Kant zutreffend die Gefahr des Irrtums: „In dieser Beurtheilung, ob jene Maßregel klüglich genommen sei oder nicht, kann […] der Gesetzgeber irren“.950 Damit wird nicht übersehen, dass es selbst in Abwesenheit von Sicherheit dennoch unterschiedliche Grade von Wahrscheinlichkeit gibt. Handlungsvorschriften, die jedoch auf dem Durchschnittsprinzip beruhen, können vielleicht im Allgemeinen gelten, niemals aber allgemein. Selbst Handlungsvorschriften, die sich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit annähern, können niemals als allgemein gültige und somit notwendige Gesetze auftreten. Da der Mensch nicht weiß, was er eigentlich will und daher unfähig ist einen bestimmten Begriff der Glückseligkeit zu entwickeln, können außerdem die Ratschläge der Klugheit nur sehr vage und ungenau sein. Als Beispiel führt Kant die Sparsamkeit, die Höflichkeit und die Zurückhaltung an. Den pragmatischen Imperativen fehlt also die Präzision eines technischen Imperativs. Die unaufhebbare Unsicherheit, die mit der Wahl der Mittel zur eigenen Glückseligkeit stets verbunden ist, lässt die Rede von einem Gesetz in Bezug auf die pragmatischen Imperative als fragwürdig erscheinen. In der Grundlegung kommt Kant selbst zu dem etwas verwirrenden Schluss, dass „die Imperativen der Klugheit, genau zu reden, gar nicht gebieten, d. i. Handlungen objectiv als praktisch-nothwendig darstellen, können, daß sie eher Anrathungen (consilia) als Gebote (praecepta) der Vernunft zu halten sind“.951 Im Unterschied zu den moralischen Imperativen und zu den technischen Imperativen fehlt es den pragmatischen Imperativen am strengen Gesetzescharakter, weil sie niemals mit dem Anspruch auf Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit auftreten können. Sie können daher gar nicht gebietend, sondern nur anratend sein. Deshalb spricht Kant nicht von Geboten oder Regeln der Klugheit sondern bloß von Ratschlägen der Klugheit. In der Kritik der praktischen Vernunft spricht Kant diese Ungleichheit in der Nötigung des Willens folgendermaßen aus: „Die Maxime der Selbstliebe (Klugheit) räth blos an; das Gesetz der Sittlichkeit gebietet. Es ist aber doch ein großer Unterschied zwischen dem, wozu man uns anräthig ist, und dem, wozu wir verbindlich sind“.952 Besonders auffallend an diesem Zitat ist, dass Kant nicht 948 GMS: IV, 418 Vgl. auch RL: VI, 216 950 Gemeinspruch: VIII, 299 951 GMS: IV, 418 952 KpV: V, 36 949 - 170 - länger von pragmatischen Imperativen spricht, sondern weniger fordernd von „Maxime[n] der Selbstliebe“. Auch hier ist zu lesen, dass die pragmatischen Imperative im Unterschied zum kategorischen Imperativ keine unbedingt gebietenden Regeln, sondern bloße Ratschläge sind. Die Bezeichnung der Vorschriften der Klugheit als bloße Ratschläge ist insofern folgerichtig, als allein Ratschläge per definitionem die betroffenen Menschen zu einem Handeln auffordern können, ohne ihnen jedoch die Freiheit abzusprechen über ihre eigene Glückseligkeit in letzter Instanz selbst zu entscheiden.953 Damit geht jedoch das unaufhebbare Risiko einher, dass die Menschen falsche Entscheidungen treffen. Zusammenfassend zu dem Unterschied von technischem und pragmatischem Imperativ kann demnach gesagt werden, dass die pragmatischen Imperative einen unsicheren Weg zur Erreichung eines wirklichen Zweckes zeigen, während die technischen Imperative einen sicheren Weg zur Erreichung eines bloß möglichen Zwecks weisen.954 c) Gehören die hypothetischen Imperative zur praktischen oder zur theoretischen Philosophie? Es hat sich bis hierher gezeigt, dass Kant in der Grundlegung sowie anschließend in der Kritik der praktischen Vernunft den imperativen Charakter der Ratschläge der Klugheit so stark relativiert, dass man sich mit guten Gründen die Frage stellen kann, ob sie überhaupt noch als Imperative bezeichnet werden dürfen. Diese Unsicherheit ist eng mit Kants gedanklichem Entwicklungsprozess auf dem Gebiet der praktischen Philosophie im Ganzen verbunden. Auf den folgenden Seiten wird sich zeigen, dass die zuvor erwähnte Unsicherheit in Kants Formulierungen auch eine allmähliche Verschiebung und Selbstkorrektur in seinen Gedanken bezüglich der systematischen Stelle der hypothetischen Imperative verkündet. Die sogenannte »Erste Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft« gibt hierfür nähren Aufschluss. In einer bedeutenden Anmerkung aus diesem unveröffentlichten Text, den Kant vor dem Abschluss seiner Arbeiten am Haupttext der dritten Kritik verfasst hat, hielt er es für möglich, wenn auch wohl nicht für zwingend geboten, die pragmatischen Imperativ als technische Sätze zu definieren. Dies lässt sich auf die wesentliche Gemeinsamkeit der beiden hypothetischen Imperative zurückführen, die mögliche Handlungen zur Erreichung eines neigungsbestimmten Zieles gebieten. Alle nicht-moralischen, mithin den Freiheitsbegriff nicht voraussetzenden Sätze, so schreibt er dort, „können, wenn man etwa Zweydeutigkeit besorgt, statt practischer technische Sätze heißen. Denn sie gehören zur Kunst, das zu stande zu bringen, wovon man will, daß es seyn soll, die, bey einer vollständigen Theorie, jederzeit 953 Siehe dazu schon: Hinske, Norbert: Die „Ratschläge der Klugheit“ im Ganzen der Grundlegung, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 1989, 3. Aufl. 2000, S. 141. 954 In seinem klassischen Werk zur Kants Moralphilosophie macht Paton die folgende Bermerkung: „Yet in spite of their uncertainty the counsels of prudence are more binding that the rules of skill, since it is mere folly to wreck one’s happiness, an end which is very far from being arbitrarily chosen” (Paton, Herbert J.: The categorical imperative: a study in Kant’s moral philosophy, Philadelphia 1971, S. 116). Auf den ersten Blick scheint es nicht einfach zu verstehen, wie Ratschläge verbindlicher als Regeln sein können. Die technischen Imperative schreiben sichere Handlungen als Mittel zur Erreichung eines möglichen Zieles vor, während die pragmatischen Imperative unsichere Handlungen als Mittel zur Erreichung eines wirklichen Zieles bestimmen. Die Tatsache, dass die technischen Imperative sicher in der Zuweisung der notwendigen Mittel zur Erreichung des angestrebten Zieles sind, hat nicht zu bedeuten, dass sie verbindlicher sind als die pragmatischen Imperative. Dies liegt darin begründet, dass die Mittel immer in Bezug auf ein bestimmtes Ziel zu verstehen sind. Ein Mittel für sich allein genommen führt keine Verbindlichkeit mit sich. Weil das Ziel der pragmatischen Imperative aber wirklich ist, jenes der technischen dagegen bloß möglich ist, ist die Erreichung des angestrebten Zieles im ersten Fall immer ein individuelles und partielles Ziel, während es sich im zweiten Fall um ein allgemeines und umfassendes Ziel handelt. Genau aus diesem Grunde sind die pragmatischen Imperative verbindlicher als die technischen Imperative. - 171 - eine bloße Folgerung und kein für sich bestehender Theil irgend einer Art von Anweisung ist. Auf solche Weise gehören alle Vorschriften der Geschicklichkeit zur Technik und mithin zur theoretischen Kenntnis der Natur als Folgerungen derselben“.955 In der hieran direkt anschließenden Fußnote fügt Kant hinzu, dass es jedoch berechtigt sei, weiterhin an dem Terminus des pragmatischen Imperativs festzuhalten, obwohl er - wie zuvor gesehen hervorhob, dass diese Imperative ebenfalls den technischen Imperativen untergeordnet sind: „Allein daß der Zweck, den wir uns und andern unterlegen, nämlich eigene Glückseeligkeit, nicht unter die blos beliebigen Zwecke gehöret, berechtigt zu einer besondern Benennung dieser technischen Imperativen, weil die Aufgabe nicht blos, wie bey technischen, die Art der Ausführung eines Zwecks, sondern auch die Bestimmung dessen, was diesen Zweck selbst (die Glückseeligkeit) ausmacht, fordert, welches bey allgemeinen technischen Imperativen als bekannt vorausgesetzt werden muß“.956 In derselben Fußnote räumt Kant außerdem ein, dass es ein Fehler war, die Imperative der Geschicklichkeit in der Grundlegung als problematische Imperative bezeichnet zu haben, weil die Zusammenstellung von „Imperativ“ und „problematisch“ widersprüchlich sei.957 Ausschließlich der kategorische Imperativ sei durch keine Bedingung eingeschränkt und somit bei striktem Wortgebrauch ein eigentlicher, unbedingter Imperativ. Der problematische Imperativ wiederum gebietet bedingterweise, das heißt lediglich unter der Bedingung eines bloß möglichen Zweckes. Nimmt man den Begriff der Nötigung, welcher zur Definition eines Imperativs gehört, an, so lässt sich einsehen, dass die problematischen Imperative bei striktem Wortgebrauch gar nicht als Imperative bezeichnet werden dürften. Es wäre demnach zutreffender die Imperative der Geschicklichkeit als technische Imperative, das heißt als Imperative der Kunst, zu bezeichnen.958 In der veröffentlichten Fassung der Kritik der Urtheilskraft zieht Kant aus seinen vorherigen Überlegungen radikale Konsequenzen. Von nun an verweigert er erstens den beiden hypothetischen Imperativen explizit jeglichen imperativen Charakter und zählt sie zweitens zur theoretischen Philosophie. Kants Erläuterung diesbezüglich verdienen ausführlich zitiert zu werden: „Alle technisch-praktische Regeln [...], so fern ihre Principien auf Begriffen beruhen, müssen nur als Corollarien zur theoretischen Philosophie gezählt werden. Denn sie betreffen nur die Möglichkeit der Dinge nach Naturbegriffen, wozu nicht allein die Mittel, die in der Natur dazu anzutreffen sind, sondern selbst der Wille (als Begehrungs-, mithin als Naturvermögen) gehört, sofern er durch Triebfedern der Natur jenen Regeln gemäß bestimmt werden kann. Doch heißen dergleichen praktische Regeln nicht Gesetze (etwa so wie physische), sondern nur Vorschriften: und zwar darum, weil der Wille nicht bloß unter dem Naturbegriffe, sondern auch unter dem Freiheitsbegriffe steht, in Beziehung auf welchen die Principien desselben Gesetze heißen und mit ihren Folgerungen den zweiten Theil der Philosophie, nämlich den praktischen, allein ausmachen“.959 Diese gewichtigen, häufig zitierten Absätze bedürfen weiterer Erläuterungen, weil sie vor dem Hintergrund früheren Ausführungen Kants insbesondere in der Grundlegung ein wenig irritierend sind. Einiges spricht dafür, dass Kant nur allmählich Klarheit über die systematische Stellung der hypothetischen Imperative gewonnen hat. Ausschlaggebend ist in diesem Zusammenhang offensichtlich sein Versuch in der Kritik der praktischen Vernunft eindeutig zwischen einem theoretischen und einem praktischen Gebrauch der Vernunft zu unterscheiden. 955 KUK: XX, 199f. KUK: XX, 200 957 Vgl. KUK: XX, 200 958 Vgl. KUK: XX, 200 959 KUK: V, 172 (meine Hervorhebung) 956 - 172 - In der Grundlegung beschränkt sich Kant noch gänzlich darauf zu zeigen, dass die hypothetischen Imperative sich auf einen heteronomen Willen beziehen und demnach nicht als das angestrebte oberste Prinzip der Sittlichkeit fungieren können. Die Frage, ob die Regeln der Geschicklichkeit sowie die Ratschläge der Klugheit zu praktischer oder theoretischer Philosophie zählen, wird hier so gut wie nicht erörtert. In der Grundlegung scheint es demnach wohl berechtigt zu sein, davon auszugehen, dass Kant die hypothetischen Imperative zur praktischen Philosophie zählt. Die Dreiteilung der Imperative erlaubt uns anzunehmen, dass die Ratschläge der Klugheit innerhalb Kants Ethik eine Mittelstellung zwischen Geschicklichkeit und Sittlichkeit einnehmen. In der fünf Jahre später erschienenen Kritik der Urtheilskraft wird diese Unsicherheit bezüglich der systematischen Stelle der Klugheit endgültig aufgehoben. Wie Pierre Aubenque zurecht bemerkt, verliert die Klugheit „ihren Platz an der Seite der Geschicklichkeit und wird dieser als bloßer Einzelfall untergeordnet“.960 Grundsätzlicher noch heißt es dort, dass die hypothetischen Imperative im Grunde genommen gar nicht zur praktischen Philosophie gehören, sondern zur theoretischen zählen. Die Frage, welche sich hier unmittelbar aufdrängt, ist, wie sich diese Verschiebung in Kants Gedanken begründen lässt. Der erste Abschnitt der Einleitung in der Kritik der Urtheilskraft (sowohl in ihrer ersten als auch in ihrer zweiten Fassung) gibt hierzu näheren Aufschluss. Dort erläutert Kant, inwiefern sich die Philosophie in einen theoretischen und einen praktischen Teil gliedert.961 Für Kant ist die tradierte Einteilung in theoretische und praktische Philosophie nur dann berechtigt, wenn es einen spezifischen Unterschied zwischen beiden Teilen gibt. Da die Philosophie für Kant ein System der Vernunfterkenntnisse aus Begriffen ist, so muss sich dieser Unterschied auch auf Ebene der Begriffe finden lassen. Für Kant gibt es aber nur zwei Arten von Begriffen, welche die Erkenntnis ihres Gegenstandes ermöglichen, nämlich die Naturbegriffe sowie der Freiheitsbegriff. Die ersteren Begriffe machen die theoretische Erkenntnis möglich, während der zweite die praktische Erkenntnis möglich macht. Nur wenn die Aufteilung der Philosophie in theoretische und praktische auf dem Naturbegriff sowie dem Freiheitsbegriff gründet, sind beide Teile der Philosophie tatsächlich spezifisch verschieden. Den theoretischen Teil der Philosophie nennt Kant auch „Naturphilosophie“ und den praktischen Teil „Moralphilosophie“.962 Festzuhalten ist hier, dass Kant die praktische Philosophie mit der Moralphilosophie identifiziert. Die Gleichsetzung von Freiheit als Autonomie der reinen praktischen Vernunft mit dem Handeln bloß aus Achtung für das Sittengesetz ist folgenschwer. Diese Gleichsetzung macht die Rede von sittlich-gleichgültigen Handlungen innerhalb der praktischen Philosophie unmöglich. Für die technisch-praktischen Regeln der Geschicklichkeit und der Klugheit gibt es innerhalb der Kantischen praktischen Philosophie somit keinen Platz. Dies erklärt, dass Kant im weiteren Verlauf des Textes darauf aufmerksam macht, dass man das „Praktische nach Naturbegriffen“ nicht mit dem „Praktischen nach dem Freiheitsbegriffe“963 für einerlei nehmen darf. Wenn dies geschehen würde, dann würde man durch die Benennung einer theoretischen und einer praktischen Philosophie eine Einteilung treffen, durch welche eigentlich nichts eingeteilt wäre, und welche somit unbegründet wäre. Die Nichtbeachtung dieser begrifflichen Unterscheidung erklärt, dass die Regeln der Geschicklichkeit und die Ratschläge der Klugheit fälschlicherweise zusammen mit den Gesetzen der Sittlichkeit im Bereich der praktischen Philosophie eingeordnet wurden. An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass damit nicht bestritten wird, dass es sich bei den Regeln der Geschicklichkeit und den Ratschläge der Klugheit auch um praktische Prinzipien 960 Aubenque, Pierre: Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles, Hamburg 2007, S. 186. Vgl. KUK: V, 171ff. 962 KUK: V, 171 963 KUK: V, 171 961 - 173 - handelt, sofern man unter „praktisch“ alles das versteht, „was durch Freiheit möglich ist“964, oder wenn man unter „praktisch-möglich (oder nothwendig)“ alles das versteht, was „als durch einen Willen möglich (oder nothwendig) vorgestellt wird“.965 Im Anschluss hieran stellt sich aber noch die entscheidende Frage, ob es sich bei dem Begriff, welcher der Kausalität des Willens die Regel gibt, um einen Naturbegriff oder um einen Freiheitsbegriff handelt. Handelt es sich um einen Naturbegriff, so sind die Prinzipien technisch-praktisch. Handelt es sich dagegen um einen Freiheitsbegriff, so sind die Prinzipien moralisch-praktisch.966 In beiden Fällen handelt es sich jedoch um praktische Prinzipien in einem allgemeinen Sinne. Weil die Einteilung der Philosophie in theoretische und praktische Philosophie auf einer Gegenüberstellung der Prinzipien der Vernunfterkenntnis gründet, werden die ersteren zur theoretischen Philosophie (als Naturlehre) gezählt, während die zweiten allein der praktischen Philosophie (als Freiheitslehre) zugeordnet werden. Sowohl die pragmatischen Imperative als auch die technischen Imperative dürfen nicht zur praktischen Philosophie gezählt werden, weil sie Handlungen als Mittel zu einem Zweck gebieten, welche durch Naturbegriffe bestimmt sind. Während die Zwecke durch Neigungen bestimmt werden, werden die dafür erforderlichen Mittel durch empirische Kausalgesetze bestimmt. Aus diesem Grunde gehören die technisch-praktischen Imperative zur theoretischen Philosophie. In Abgrenzung dazu machen die moralisch-praktischen Vorschriften, welche gänzlich auf dem Freiheitsbegriff gründen, die moralischen Gesetze aus. Ausschließlich jene zählen zur praktischen Philosophie. Technisch-praktische Regeln sind dagegen nur Korollarien der Naturwissenschaft. Wie in der »Erste Einleitung in die Kritik der Urtheilskraft« zu lesen ist, handelt es sich bei jenen um die „Anwendungen einer vollständigen theoretischen Erkenntniß“967 auf dieselbe Art und Weise wie auch die Lösung eines mechanischen Problems nur die Anwendung von Lehrsätzen der betreffenden Wissenschaft darstellt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kant den hypothetischen Imperativen nicht den Charakter praktischer Sätze genommen hat. Kant nennt die hypothetischen Imperative „praktisch“, weil das in ihnen beinhaltete theoretische Wissen bezüglich eines Kausalnexus in eine Regel eingebettet ist, die lediglich durch Freiheit in einem allgemeinen Sinne möglich ist. Selbst wenn die technisch-praktischen Regeln nicht zu jenem Teil der Philosophie, der als praktisch bezeichnet wird, gezählt werden dürfen, weil sie nicht aus der reinen praktischen Vernunft entspringen, so handelt es sich dennoch um praktischen Regeln. Dies erklärt sich dadurch, dass sie sich auf den menschlichen Willen als ein begriffliches Kausalvermögen beziehen.968 3. Kants Ablehnung des Anspruches der Politik auf Autonomie 3.1 Der Anspruch der Politik auf Unabhängigkeit von Moral und Recht Die vorangegangenen Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, dass Klugheit aus einer moraltheoretischen Perspektive bei Kant nicht an sich verwerflich ist und aus diesem Grund als Mittel der Politik prinzipiell zulässig ist.969 Was Kant dagegen mit aller Entschlossenheit verwirft, ist eine Politik, die ausschließlich auf Klugheit gegründet ist. 964 KrV: III, 520 KUK: V, 172 966 Vgl. KUK: V, 172 967 KUK: XX, 198 968 Vgl. Bojanowski, Jochen: Kant über das Prinzip der Einheit von theoretischer und praktischer Philosophie (Einleitung I – V), in: Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2008, S. 28. 969 Es kann somit Peter Koslowski nicht zugestimmt werden, wenn er schreibt, dass die strengen Regeln des Rechts die Klugheitsregeln ersetzen. Vgl. Koslowski, Peter: Staat und Gesellschaft bei Kant, Tübingen 1985, S. 36f. 965 - 174 - Gemeint ist hier eine Politik, die seit dem frühen 19. Jahrhundert in der Literatur gerne als „Realpolitik“ bezeichnet wird und zu deren wichtigsten Vorläufern und Verfechtern Thukydides und Machiavelli gezählt werden. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser sogenannten Realpolitik gehören die enge Orientierung an die existierenden politischen Kräfteverhältnisse und die daraus entstehenden Möglichkeiten des staatlichen Machtausbaus. In der Friedensschrift führt Kant seine Argumentation gegen die vermeintlichen Realpolitiker in zwei Etappen durch. Er stellt zunächst jene Argumente vor, die für den vermeintlichen realpolitischen Standpunkt (das will heißen für eine Autonomie der Politik) sprechen könnten, um in einem zweiten Schritt diese Argumente zu widerlegen. Als oberstes Prinzip der Sittlichkeit hat der kategorische Imperativ allgemeine und absolute Gültigkeit. Er gilt unbedingt für alle Menschen ungeachtet deren empirischen Bedingungen. Im ersten Teil des Anhangs der Friedensschrift wendet sich Kant entschieden gegen den „Praktiker“, welcher sich unter dem Hinweis auf empirische Bedingungen den Geboten der Sittlichkeit entzieht. Dort ist folgendes zu lesen: „Nun gründet […] der Praktiker (dem die Moral bloße Theorie ist) seine trostlose Absprechung unserer gutmüthigen Hoffnung (selbst bei eingeräumten Sollen und Können) eigentlich darauf: daß er aus der Natur des Menschen vorher zu sehen vorgiebt, er werde dasjenige nie wollen, was erfordert wird, um jenen zum ewigen Frieden hinführenden Zweck zu Stande zu bringen“.970 Der welterfahrene Praktiker leugnet die Existenz der Moral als solche zwar nicht, spricht ihr dennoch jede objektiv-praktische Realität, also Notwendigkeit, ab. Für ihn gilt: Die Gebote der Sittlichkeit mögen zwar in der Theorie richtig sein, taugen jedoch nicht für die politische Praxis. Diese Zurückweisung des unbedingten Charakters der Moral für das politische Handeln begründet der Praktiker auf seiner Kenntnis der menschlichen Natur. Für ihn gilt, dass der Mensch zwar kann, was er soll, dennoch nicht unbedingt will, was er soll. Insofern sich die Politiker den Frieden zum materiellen Ziel gesetzt haben, wäre dieses Ziel dementsprechend gänzlich unabhängig von der Moral zu verfolgen. Im unmittelbaren Anschluss an das oben angeführte Zitat lässt Kant den Praktiker sagen: „[W]er einmal die Gewalt in Händen hat, wird sich vom Volk nicht Gesetze vorschreiben lassen. Ein Staat, der einmal im Besitz ist, unter keinen äußeren Gesetzen zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er gegen andere Staaten sein Recht suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen, und selbst ein Welttheil, wenn er sich einem andern, der ihm übrigens nicht im Wege ist, überlegen fühlt, wird das Mittel der Verstärkung seiner Macht, durch Beraubung oder gar Beherrschung desselben nicht unbenutzt lassen“.971 Abschließend kommt der Praktiker zu der für ihn ausschlaggebenden Schlussfolgerung, welche das von ihm behauptete Recht des Stärkeren legitimeren soll: „[S]o zerrinnen nun alle Plane der Theorie für das Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht, in sachleere unausführbare Ideale, dagegen eine Praxis, die auf empirische Principien der menschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht für zu niedrig hält, aus der Art, wie es in der Welt zugeht, Belehrung für ihre Maximen zu ziehen, einen sicheren Grund für ihr Gebäude der Staatsklugheit zu finden allein hoffen könne“.972 Festzuhalten ist an den eben zitierten Textstellen, dass der Praktiker sich gänzlich auf bloße Erfahrung beschränkt, das bedeutet, dass er die Maxime seines Handelns allein aus der empirischen Kenntnis der menschlichen Natur ableitet. Aus seiner vermeintlichen Menschenkenntnis folgert er, dass Politik, insofern sie erfolgreich sein möchte, sich allein an den Ratschlägen der Klugheit zu orientieren hat. Der Praktiker beansprucht die tauglichen Mittel zu kennen, anhand von welchen das friedliche Nebeneinander der Menschen allein gesichert werden kann. Das elementare (aus Erfahrung abgeleitete) Mittel ist in dieser Hinsicht der Ausbau der staatlichen 970 Frieden: VIII, 371 Frieden: VIII, 371 972 Frieden: VIII, 371 971 - 175 - Macht. Kants zufolge zielen die Praktiker auf die „Vergrößerung ihrer Macht, auf welchem Wege sie auch erworben sein mag“.973 3.2 Kants Zurückweisung des Anspruches der Politik auf Autonomie Kant weist die Argumentation des Praktikers über die Notwendigkeit des staatlichen Machtausbaus entschieden zurück. Für ihn handelt es sich dabei allein um Rhetorik, die nur einen „Privatvortheil“974 zu verheimlichen sucht. Gegen die Argumentation des Praktikers zugunsten einer allein „der Erfahrung folgsamen Praxis“975 macht Kant drei Einwände geltend. Wie bereits angeführt wurde, leitet der Praktiker die Maxime seines Handelns aus seiner vermeintlichen Kenntnis der menschlichen Natur ab. Der Verweis auf die ohne weiteres postulierte Bösartigkeit der menschlichen Natur wird immer wieder herangezogen, um die Zulässigkeit pflichtwidriger Handlungen im Namen der Staatsräson zu rechtfertigen. Dagegen macht Kant den Einwand geltend, dass der Praktiker aufgrund seiner Position zweifellos viele Menschen kennt, dies aber längst noch nicht bedeutet, dass er den Mensch an sich kennt, „wozu ein höherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird“.976 Im weiteren Verlauf versucht Kant nachzuweisen, dass der Hauptmangel einer sich allein auf Klugheit beruhenden Politik in der prinzipiellen Unberechenbarkeit der Mittel zu Erlangung deren Endziels liegt. Dies liegt darin begründet, dass die menschliche Vernunft nicht in der Lage ist den positiven oder negativen Erfolg des Handelns mit Sicherheit vorherzusagen. Es gibt eine permanente und unaufhebbare Ungewissheit bezüglich der Folgen unseres Handelns. Dieser These gibt Kant in der Friedensschrift die folgende Fassung: „Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott der Gewalt); denn dieser steht noch unter dem Schicksal, d. i. die Vernunft ist nicht erleuchtet genug, die Reihe der vorherbestimmenden Ursachen zu übersehen, die den glücklichen oder schlimmen Erfolg aus dem Thun und Lassen der Menschen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit vorher verkündigen […] lassen“.977 Wenige Seiten weiter weist Kant darauf hin, dass sich die ausschließlich an Klugheit orientierende und „alle reine Vernunftprincipien vorbeigehende Praxis“978 stets „ungewiß in Ansehung ihres Resultats“979 befindet. Die Legitimitätsbegründung des bloß nach Klugheitsregeln verfahrenden Politikers ist schon deshalb gänzlich zu verwerfen, weil die von ihm in Anspruch genommenen Methoden an der unüberwindbaren Komplexität der Wirklichkeit scheitern müssen. Aus Erfahrung kann lediglich gesagt werden, wie die Menschen bisher gehandelt haben. Es kann weder gesagt werden, dass die Menschen notwendigerweise so handeln müssten, noch dass sie zukünftig auch tatsächlich weiterhin so handeln werden. Die Erfahrungserkenntnis ist somit kontingent und gilt lediglich für die Vergangenheit. Dies liegt darin begründet, dass der Mensch als ein Naturwesen den Naturgesetzen zwar vollständig unterliegt, jedoch als ein mit praktischer Vernunft begabtes Naturwesen stets die Möglichkeit hat sich diesen Naturgesetzten zu entziehen. Selbst wenn es ein „böse[s] Prinzip“980 im Menschen gibt, können sich die Menschen immer durch den Gebrauch ihrer praktischen Vernunft für das Gute entscheiden. Für Kant beruht somit jede Politik, die sich auf empirische 973 Frieden: VIII, 375 Frieden: VIII, 373 975 Gemeinspruch: VIII, 306 976 Frieden: VIII, 374 977 Frieden: VIII, 370 978 Gemeinspruch: VIII, 305 979 Frieden: VIII, 377 980 Frieden: VIII, 355 974 - 176 - Prinzipien der menschlichen Natur stützt, auf einem unsicheren Grund. Aus der Unmöglichkeit die komplexen Folgen unseres Handelns zu bestimmen, folgt, dass die Klugheit selbst nicht weiß, was am Ende am klügsten ist. Der Erfolg ist die einzige Berechtigung, die der Praktiker als Grund für seine Handlungen angibt. Aus der Erfahrung können jedoch keine allgemeinen Regeln der Klugheit hergeleitet werden, die den Menschen mit Sicherheit zum Erfolg führen könnten.981 Zusammenfassend bezüglich dieser zwei ersten Argumente kann gesagt werden, dass sowohl aus der Anthropologie noch aus der Geschichte weder die Unmöglichkeit moralischer Politik noch das vermeintliche Recht des Stärkeren abgeleitet werden können. Kants Ablehnung der Rhetorik der vermeintlichen Realpolitiker bezüglich der Unmöglichkeit der Friedensstiftung ist deshalb von zentraler Bedeutung, weil diese Rhetorik leicht den Charakter einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung bekommt. In den Vorarbeiten zur Friedensschrift schreibt Kant diesbezüglich: „Die Politische Praktiker schließen daraus wie es bisher gegangen ist wie es künftig gehen wird ohne zu bedenken daß gerade diese Voraussetzung wenn sie allgemein angenommen wird Ursache ist daß es nie besser wird“.982 Die Behauptung, dass Frieden unmöglich ist, weil es bisher keinen Frieden gegeben hat, wird somit zur Wirklichkeit, weil diejenigen, die an diese Behauptung glauben, sich auch auf eine Art und Weise verhalten, die schließlich dazu führt, dass die ursprüngliche Behauptung sich tatsächlich als wahr erweisen wird. Das dritte Argument gegen eine Autonomie der Politik formuliert Kant bereits im Gemeinspruch. Dort heißt es, dass „alles, was in der Moral für die Theorie richtig ist, auch für die Praxis gelten müsse“.983 Dasselbe Argument findet sich außerdem in leicht veränderter Form in der Friedensschrift. Dort führt Kant aus, dass jeder (also auch der Politiker) die Gebote der Sittlichkeit grundsätzlich zu beachten hat: „Die Moral ist [der] Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen, und es ist offenbare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pflichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, daß man es doch nicht könne. Denn alsdann fällt dieser Begriff aus der Moral von selbst weg (ultra posse nemo obligatur)“.984 Kant führt hier seine Argumentation in drei Schritten durch. Seine Argumentation impliziert zunächst die Prämisse, dass Moral immer gegeben ist, und dass niemand ihre Existenz als solche grundsätzlich verneinen kann. Die Moral in der Form des Gebotes bezeichnet Kant als Pflicht. Die Gebote der Sittlichkeit haben aber unbedingte und allgemeine Notwendigkeit. Wer also einmal die Moral anerkannt hat, kann sich konsequenterweise nicht den Geboten der Sittlichkeit entziehen. Denn wollte man den Begriff der Pflicht zurückweisen, gäbe es keine Moral mehr. In Abgrenzung zu einer Doppelmoral besitzen die Gebote der Sittlichkeit bei Kant also nicht nur in Bezug auf individuelle Moral Gültigkeit, sondern ebenfalls im Bereich der Politik.985 Auch dem Politiker hilft alle Erfahrung nichts, „um sich der Vorschrift der Theorie zu entziehen, sondern allenfalls nur zu lernen, wie sie besser und allgemeiner ins Werk gerichtet werden könne, wenn man sie in seine Grundsätze aufgenommen hat“.986 981 Vgl. Gerhardt, Volker: Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik, in: Kants in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Yasushi Kato und Gerhard Schönrich, Frankfurt a. M. 1996, S. 468f. 982 Vorarbeit: XXIII, 162 983 Gemeinspruch: VIII, 288 984 Frieden: VIII, 370 985 In Abgrenzung dazu vertritt Heinz-Gerd Schmitz die These, dass mit der transzendentalen Formel des öffentlichen Rechts die Geschicklichkeit eine so zentrale Bedeutung gewinnt, dass der Herrschaft des kategorischen Imperativs das Feld des Politischen schließlich entzogen wird. Kant würde so ganz gegen seinen Willen in eine doppelte Ethik zurückfallen. Vgl. Schmitz, Heinz-Gerd: Moral und Klugheit? Überlegungen zur Gestalt der Autonomie des Politischen im Denken Kants, in: Kant-Studien 81, 1990, S. 412-434. Kritisch dazu: Williams, Howard: Morality or Prudence?, in: Kant-Studien 83, 1992, S. 222-225. 986 Gemeinspruch: VII, 289 - 177 - Mit diesen drei Argumenten sollte die Illusion einer Autonomie der Politik aufgelöst werden. Wenn man aber aus den empirischen Bedingungen keinen sicheren Grund für die Politik herleiten kann, dann bleibt nur noch die praktische Vernunft übrig, um einen konsistenten Begriff der Politik zu bestimmen. 4. Die geltungstheoretische Abhängigkeit der Politik von der Moral sowie dem Recht Aus dem vorhergehenden Teil sollte deutlich hervorgegangen sein, dass jeder Begriff der Politik, welcher allein auf empirischen Prinzipien gründet, aufgrund seiner Widersprüchlichkeit nicht überzeugend sein kann. Die Inkonsistenz eines jeden empirischen Begriffs der Politik liegt in dessen Prinzipienlosigkeit begründet. Ein Begriff der Politik, welcher ohne Selbstwiderspruch gedacht werden kann, ist somit auf einen „sicheren Grund“987 angewiesen. In dem ersten Teil des Anhangs der Friedensschrift ist Kant um die Definition eines solchen normativ begründeten Begriffs der Politik bestrebt. Dies will heißen, um einen Begriff der Politik, dessen Grund in der reinen praktischen Vernunft liegt. 4.1 Kants Bestimmung der Politik als ausübende Rechtslehre Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Kants Bestimmung eines normativen Begriffs der Politik lange Zeit nur wenig Interesse seitens der Sekundärliteratur nach sich gezogen hat. Einleitend zu dieser Dissertation wurde auch ausführlich gesehen, dass Kant dafür kritisiert wurde, dass er angeblich gar keinen eigenständigen Begriff der Politik hat, das heißt dass er keinen Unterschied zwischen Politik, Recht und Moral macht. Diese Kritik wurde sukzessiv und mit wenigen Abweichungen von so unterschiedlichen Kant-Interpreten wie Kurt von Borries, Hannah Arendt, Ernst Vollrath oder Pierre Hassner geäußert.988 Die doppelte Frage, die sich vor diesem Hintergrund aufdrängt, ist jene, ob die Geringschätzung, unter welcher Kants Lehre von der Politik bis in die 1980er Jahren gelitten hat, sich heute verbessert hat, und vor allem ob die erwähnte Geringschätzung tatsächlich begründet ist. Die Antwort auf die erste Frage fällt offensichtlich zwiespältig aus. Einhergehend mit der umfassenden Rehabilitierung der praktischen Philosophie Kants in den frühen 1970er Jahren war auch ein erwachtes Interesse an Kants Begriff der Politik zu verzeichnen. Insbesondere in den zahlreichen Veröffentlichungen von Reinhard Brandt und Otfried Höffe wurde überzeugend gezeigt, dass Kant ein erfahrungsoffener Rechtsphilosoph ist, für welchen die Aufgabe der Politik in der Verwirklichung der Vernunftprinzipien des Rechts in der Realität besteht, wozu Erfahrung, Urteilskraft und Klugheit gehören. Diese Deutung findet ihre Zuspitzung in den Arbeiten von Ulrich Sassenbach und Volker Gerhardt, in welchen hervorgehoben wird, dass die Friedensschrift eine genuine „Theorie der Politik“ enthält, die spezifisch politische Aufgaben und Verfahren bestimmt.989 987 Frieden: VIII, 371 Vgl. Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, München/Zürich 1985, S. 46; Borries, Kurt von: Kant als Politiker. Zur Staats- und Gesellschaftslehre des Kritizismus, Aalen 1973 (Neudruck der Ausgabe Leipzig 1928), S. 145; Hassner, Pierre: Les concepts de guerre et de paix chez Kant, in: Revue française de science politique 11-3, 1961, S. 642; Vollrath, Ernst: Was ist das Politische? Eine Theorie des Politischen und seiner Wahrnehmung, Würzburg 2003, S. 65; Ders.: Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen, Würzburg 1987, S. 92. 989 Vgl. Gerhardt, Volker: Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik, in: Kant in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Gerhard Schönrich und Yasushi Kato, Frankfurt a. M. 1996, S. 464-488; Ders.: Eine kritische Theorie der Politik. Über Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 5-20; Ders.: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995; Siehe auch: Sassenbach, Ulrich: Der Begriff des Politischen bei Immanuel Kant, Würzburg 1992. 988 - 178 - Dieser interpretatorische Ansatz bleibt allerdings bis heute in der Kant-Forschung umstritten. Nach wie vor wird in der Sekundärliteratur die Kritik geäußert, dass die Politik und das Recht bei Kant zusammenfallen. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang lediglich auf wenige, exemplarische Stellungnahmen. So behauptet Jürgen Habermas, dass bei Kant „Politik grundsätzlich in Moral überführt werden kann“.990 Dieselbe Meinung wird ebenfalls von Peter Koslowski vertreten, wenn er erklärt, dass der „Politik-Begriff […] bei Kant eine erhebliche Einschränkung, sozusagen einen Funktionsverlust [erfährt], weil Politik in Recht und Ökonomie überführt wird“.991 Wir bereits gesehen wurde, ist eine ähnliche Einschätzung der Kantischen politischen Philosophie ist ebenfalls bei Georg Geismann zu finden. So schreibt er beispielsweise, dass man bei Kant von einer „Politischen Philosophie“ oder einer „Theorie der Politik” lediglich als Synonyme für eine „Philosophie oder Theorie des öffentlichen Rechts” sprechen mag.992 Auch die von Aristoteles stark geprägte amerikanische Philosophin Martha C. Nussbaum schreibt, dass Kant zuweilen dazu neigt, „durch den moralischen Imperativ den politischen außer Kraft zu setzen“993 (wobei nicht leicht einzusehen ist, was unter dem erwähnten „politischen Imperativ“ zu verstehen ist). Wie diese verschiedenen Ausführungen zu bewerten sind, darauf soll in den folgenden Seiten näher eingegangen werden. Dabei wird sich herausstellen, warum der zum Teil bis heute andauernde stiefmütterliche Umgang mit Kants Begriff der Politik unbegründet ist und warum eine gründliche Untersuchung der Kantischen Lehre von der Politik für wert erachtet werden soll. In der Friedensschrift definiert Kant den Begriff der Moral allgemein als eine „Praxis in objectiver Bedeutung, als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesetzen, nach denen wir handeln sollen“.994 Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass diese Definition alle handlungsbestimmenden Gesetze umfasst, das heißt sowohl jene der Rechtslehre als auch jene der Tugendlehre.995 Im Fortgang stellt Kant die These auf, dass wahre Politik stets mit moralischen Prinzipien übereinstimme. Dort heißt es: Es könne „keinen Streit der Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral als einer solchen, aber theoretischen (mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben“.996 Hier stellt Kant der Politik als ausübende Rechtslehre die Moral als theoretische Rechtslehre begrifflich gegenüber. Moral und Politik stehen im Verhältnis zueinander wie die Theorie zu der Praxis. Diese gewichtige dennoch lange ausgesprochen wenig beachtete Definition des Verhältnisses von Politik und Moral bedarf weiterer Erläuterungen. Wichtig ist zunächst festzuhalten, dass wahre Politik auf inhärente Art und Weise mit dem Recht in Verbindung steht. Politik ist „ausübende Rechtslehre“. Dies will heißen, dass sie die Rechtsbegriffe auf die Erfahrungsfälle anwenden soll. Es besteht allerdings Erklärungsbedarf darüber, warum Kant den Ausdruck „Rechtslehre“ und nicht schlicht jenen 990 Habermas, Jürgen: Publizität als Prinzip der Vermittlung von Politik und Moral, in: Materialen zu Kants Rechtsphilosophie, hrsg. v. Zwi Batscha, Frankfurt a. M., 1976, S. 180. 991 Koslowski, Peter: Staat und Gesellschaft bei Kant, Tübingen 1985, S. 36f. 992 Vgl. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012, S. 235. Bereits in: Ders.: Nachlese zum Jahr des „ewigen Friedens”. Ein Versuch, Kant vor seinen Freunden zu schützen, in: Logos 3, 1996, S. 321. 993 Nussbaum, Martha C.: Kant und stoisches Weltbürgertum, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 63. 994 Frieden: VIII, 370 995 Der obige Begriff der Moral weicht von der geläufigen Terminologie ab. In der Regel wird innerhalb Kants Moralphilosophie zwischen Rechtsgesetzen (Rechtslehre) und Moralgesetzen (Sittenlehre) unterschieden. Vgl. De Castillo, Monique: Moral und Politik, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 196; Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 9. 996 Frieden: VIII, 370 - 179 - des „Rechts“ verwendet, obwohl in Bezug auf die Definition der Politik nicht von einer Theorie, sondern ausschließlich von der Praxis die Rede ist. Die Einleitung der Rechtslehre gibt hierfür näheren Aufschluss.997 Zur Erinnerung: Dort wird zwischen dem positiven Recht einerseits und dem natürlichen Recht andererseits unterschieden.998 Das positive Recht ist für die positive Geltungsfrage (quaestio facti) zuständig: Es besagt, was Rechtens ist (quid sit iuris). Das natürliche Recht dagegen ist für die moralische Gültigkeitsfrage (quaestio iuris) zuständig: Es besagt, was Recht und Unrecht ist (iustum et iniustum). Der Gegenstand der Rechtslehre ist für Kant das natürliche Recht. Die Rechtslehre begründet somit ein System der Prinzipien des Rechts. Moral als theoretische Rechtslehre meint hier, dass die Prinzipien des Rechts aus der reinen praktischen Vernunft, das heißt unabhängig von aller Erfahrung, abgeleitet werden müssen. Sie verfügen somit über allgemeine und objektive Gültigkeit. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen liegt es nahe, dass Kant mit der Definition der Politik als ausübende Rechtslehre nicht die mechanische Umsetzung des bloß positiven Rechts, das heißt die Ausübung, dessen was Rechtens ist, im Sinne hat. Diese Definition bezieht sich vielmehr auf das natürliche Recht, welches in der reinen praktischen Vernunft gegründet ist. Politik bezeichnet somit die Ausübung dessen, was Recht ist, oder bei entsprechender Umformulierung, die Verwirklichung der apriorischen Prinzipien des Rechts in der politischen Realität. Das Ziel der Politik wird somit vom Recht verbindlich bestimmt.999 Gemeint ist hier die Überwindung des Naturzustandes - nämlich sowohl jener der Menschen als auch jener der Staaten - unter strikter Wahrung der Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit aller moralischen Personen. Kant löst also das Problem der Mißhelligkeit zwischen Politik und Moral, indem er der Moral eine absolute Vorrangstellung in sämtlichen Belangen einräumt. Die Klugheit steht dagegen unter der strengen Aufsicht der reinen praktischen Vernunft. Alle Handlungen, die mit dem kategorischen Imperativ nicht vereinbar sind, sind schlechterdings verboten. Was also klug erscheinen mag, jedoch nicht moralisch ist, wird bedingungslos abgelehnt. In diesem Zusammenhang ist Reinhard Brandt gänzlich zuzustimmen, wenn er diesbezüglich von einer „Präzedenzregel“1000 spricht. Es wurde gesehen, dass der Rechtsbegriff „ein reiner, jedoch auf der Praxis [...] gestellter Begriff“1001 ist. Unbeantwortet bleibt jedoch bislang, wie dieser reine Rechtsbegriff auf die „in der Erfahrung vorkommenden Fälle“ anzuwenden ist. Mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen auch immer diese apriorischen Prinzipien des Rechts in der Realität verwirklicht werden sollen, wird von Kant nur am Rande thematisiert. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe, deren Erfüllung im Ermessen des Politikers liegt. Wichtig ist dabei zu sehen, dass die bloße Erkenntnis der Prinzipien des Rechts nicht ausreicht, wenn Politik erfolgreich sein soll. Im Gemeinspruch schreibt Kant eindeutig, dass die Kenntnis der Prinzipien des Rechts und die Kompetenz diese fallgerecht (in concreto) anzuwenden nicht dasselbe sind.1002 Bei der Vermittlung der apriorischen Prinzipien des Rechts mit dem Einzelfall bedarf der Politiker also stets der Urteilskraft. Darauf soll im nächsten Kapitel der vorliegenden Dissertation noch näher eingegangen werden. 997 Eine interessante Auslegung der Einleitung in die Rechtslehre findet sich bei: Höffe, Otfried: Der kategorische Rechtsimperativ: „Einleitung in die Rechtslehre“, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 41-62. 998 Vgl. RL: VI, 229f. 999 Vgl. Gerhardt, Volker: Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik, in: Kants in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Yasushi Kato und Gerhard Schönrich, Frankfurt a. M. 1996, S. 479. 1000 Brandt, Reinhard: Zu Kants politischer Philosophie. Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe–Universität Frankfurt (Bd. XXXV, Nr. 5), Stuttgart 1997, S. 236. 1001 RL: VI, 205 1002 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 275 - 180 - Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass die Definition der Politik als ausübende Rechtslehre das Problem der Mißhelligkeit zwischen der Politik und der Moral durch die absolute und systematische Unterwerfung der ersteren unter der zweiten auflöst. 4.2 Kants Gegenüberstellung von moralischer Politik und politischem Moralismus In der Friedensschrift wird das Problem der Mißhelligkeit und Einhelligkeit zwischen der Moral und der Politik am Beispiel mehrerer Gegensatzpaare veranschaulicht, die helfen sollen zwischen einer falschen und einer richtigen Anordnung zu unterscheiden. Bei der schematischen Darstellung dieser Gegensatzpaare ergibt sich das folgende Schema: Abbildung 4: Die Gegensatzpaare von moralischer Politik und politischem Moralismus Moralische Politik Wahre Politik Staatsklugheit im Dienst der Staatsweisheit Sittliche Aufgabe (problema morale) Formales Prinzip Recht Politischer Moralismus Politik für sich selbst („Realpolitik“) bloße Staatsklugheit Kunstaufgabe (problema technicum) Materiales Prinzip Gewalt Im Gegensatz etwa zu Niccolò Machiavellis Beschreibung der virtù des Fürsten in seiner kurzgefassten Abhandlung Il Principe1003, entwickelt Kant die Figur des moralischen Politikers, welcher die einzig wahre Form von Politik betreibt, die wiederum in keinen Konflikt mit der Moral gerät. Diese wahre Form von Politik wird als ausübende Rechtslehre verstanden. Kant spricht ebenfalls von einer „a priori erkennbare[n] Politik“.1004 So verstanden löst sich die vermeintliche Mißhelligkeit von Moral und Politik in jene Einhelligkeit auf, die im zweiten Teil des Anhangs bezüglich des transzendentalen Begriffs des öffentlichen Rechts diskutiert wird. Darauf soll im weiteren Verlauf der vorliegenden Dissertation noch näher eingegangen werden. Der These der geltungstheoretischen Abhängigkeit der Politik von der Moral und dem Recht gibt Kant in der Friedensschrift die folgende Fassung: „Die wahre Politik kann also keinen Schritt thun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für sich selbst eine schwere Kunst ist, so ist doch Vereinigung derselben mit der Moral gar keine Kunst; denn diese haut den Knoten entzwei, den jene nicht aufzulösen vermag, sobald beide einander widerstreiten“.1005 In diesem gewichtigen Satz stellt Kant zwei verschiedene Begriffe der Politik gegenüber: eine „wahre Politik“ und eine „Politik für sich selbst“. Auf der einen Seite wirft sich „wahre Politik“ (und das heißt für Kant Politik als ausübende Rechtslehre) systematisch der Moral unter. Die Moral ist gesetzgebend. Die Aufgabe der Politik besteht dagegen darin, die Gebote der Moral in der politischen Realität zu verwirklichen ohne über deren Inhalt zu vernünfteln. Auf diesem Weg kann es keinen Widerstreit zwischen Moral und Politik geben. Kants drückt dies folgendermaßen aus: „Alle wahre Politik ist auf die Bedingung eingeschränkt mit der Idee des öffentlichen Rechts zusammenzustimmen (ihr nicht zu wiederstreiten).1006 1003 Machiavelli, Niccolò: Il Principe / Der Fürst, übers. u. hrsg. v. Philipp Rippel, Stuttgart 1986, insbesondere Kap. XV-XIX. Näheres dazu: Höffe, Otfried (Hrsg.): Niccolò Machiavelli: Der Fürst, Berlin 2012 (insbesondere die Beiträge von Rolf Geiger, Peter Schröder, Giovanni Panno und Otfried Höffe). 1004 Frieden: VIII, 378 1005 Frieden: VIII, 380 1006 Vorarbeit: XXIII, 346 - 181 - Nur im Rahmen der „Politik für sich selbst“ kann ein Widerstreit zwischen der Politik und der Moral auftauchen. Was Kant unter dem Begriff der „Politik für sich selbst“ versteht, ist die erfahrungsabhängige, sich auf Klugheit berufende Politik. Kant spricht ebenfalls von „empirische[r] Politik“.1007 Es handelt sich dabei um eine „schwere Kunst“, nämlich die Kunst die geeigneten Mittel zur Erreichung seiner Zwecke zu wählen, oder wie Kant schreibt, die Kunst „ein ganzes freye Volk zu seinen Absichten zu brauchen“.1008 Politik ist in diesem Sinne an sich noch nicht moralisch verwerflich. Zu Recht weist Ulrich Sassenbach darauf hin, dass „[d]er bloße Begriff der Politik […] noch nicht am Maßstab der Prinzipien von Moral und Recht geprüft und deren Priorität unterworfen worden [ist], aber deshalb auch nicht moralisch verwerfbar [ist]. Eine solche Politik ist noch ganz der Erfahrungswelt verhaftet“.1009 Unmoralisch wird die „Politik für sich selbst“ erst dann, wenn sie gegen die Gebote der Sittlichkeit verstößt. In den Vorarbeiten schreibt Kant, dass ein kluger Politiker sich nach den von ihm verwendeten Mitteln als moralisch oder unmoralisch charakterisieren lässt: „Diejenige Politik welche dazu sich solcher Mittel bedient die mit der Achtung fürs Recht der Menschen zusammenstimmen ist moralisch die hingegen welche was den Punkt der Mittel betrift nicht bedenklich ist (also die des Politikasters) ist Demagogie“.1010 Wahre Politik, das heißt Politik als ausübende Rechtslehre, stimmt mit der Moral überein. Diese Übereinstimmung von Theorie und Praxis erläutert Kant am Beispiel zweier unterschiedlicher Typen von Politik. Gemeint ist Kants Gegenüberstellung von moralischer Politik und politischen Moralismus. Im ersten Teil des Anhangs der Friedensschrift stellt Kant dem moralischen Politiker, der „die Principien der Staatsklugheit so nimmt, daß sie mit der Moral zusammen bestehen können“, den politischen Moralisten entgegen, der „sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vortheil des Staatsmanns sich zuträglich findet“.1011 Der politische Moralist ist nichts anderes als ein Opportunist, der mit der Geschicklichkeit begabt ist „für alle Sättel gerecht zu sein“.1012 Im weiteren Verlauf des Textes führt Kant aus, dass das materielle Prinzip dem des politischen Moralisten entspricht (Staatsklugheit), während das formale dem des moralischen Politikers entspricht (Staatsweisheit). Die Schaffung eines Zustandes des Friedens ist für den politischen Moralisten eine bloße Kunstaufgabe (problema technicum), während sie für den moralischen Politiker eine sittliche Aufgabe (problema morale) ist. Die Verwirklichung des formalen Prinzips bezeichnet Kant als das Staatsweisheitsproblem. Die hieran direkt anschließende, weitere Erläuterung der Aufgabe des moralischen Politikers lautet: „Der moralische Politiker wird es sich zum Grundsatz machen: wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhältniß angetroffen werden, die man nicht hat verhüten können, so sei es Pflicht, vornehmlich für Staatsoberhäupter, darin bedacht zu sein, wie sie sobald wie möglich gebessert und dem Naturrecht, so wie es in der Idee der Vernunft uns zum Muster vor Augen steht, angemessen gemacht werden könne: sollte es auch ihrer Selbstsucht Aufopferung kosten“.1013 Der moralische Politiker macht es sich zur Pflicht das Staats-, Völker- und Weltbürgerrecht gemäß den Prinzipien der reinen praktischen Vernunft nach und nach zu reformieren, auch wenn so seine kurzfristigen persönlichen Interessen der Reform zum Opfer fallen sollten. Die gebotenen Reformen wird er außerdem „sobald wie möglich“, das heißt ohne Verzögerung dennoch mit Rücksicht auf die politischen Umstände vollziehen wollen. Bereits hier zeigt sich, dass der moralische Politiker keinesfalls ein weltfremder Utopist sein 1007 Frieden: VIII, 380 Vorarbeit: XXIII, 346 1009 Sassenbach, Ulrich: Der Begriff des Politischen bei Immanuel Kant, Würzburg 1992, S. 19. 1010 Vorarbeit: XXIII, 346 1011 Frieden: VIII, 372 1012 Frieden: VIII, 374 1013 Frieden: VIII, 372 1008 - 182 - darf, sondern ein geduldiger Reformer sein muss. Der moralische Politiker ist also dazu verpflichtet das Bestehende „nach Principien a priori“ zu reformieren.1014 Es hat sich bisher gezeigt, dass der moralische Politiker sich durch langsame, aber stetig fortschreitende Reformen dem Ziel des ewigen Friedens annähern soll. In der Sekundärliteratur wird häufig darauf hingewiesen, dass Kant ein elitäres Reformkonzept hat, insofern der Fortschritt zum Besseren allein vom moralischen Politiker zu erwarten wäre. So schreibt Claudia Langer, dass es sich bei Kant um eine „Reform von Oben“1015 handelt, in welcher der Staat sowohl Subjekt als auch Objekt der Reform ist. Des Weiteren ist zu lesen, dass „[d]as Vertrauen, das dieses Modell in den guten Willen der Obrigkeit setzt, […] frappierend ist“.1016 Ulrich Sassenbach schreibt seinerseits, dass die vernunftgebotene Reform lediglich „mit Hilfe staatlicher Organe“1017 durchgeführt werden kann. Auch für Bernd Ludwig kommt der Rechtsfortschritt ausschließlich von oben herab.1018 Mehrere Textstellen in Kants Werken können als Beleg für diese Interpretation angeführt werden. Im späten Streit der Fakultäten wirft Kant die Frage auf: „In welcher Ordnung allein kann der Fortschritt zum Besseren erwartet werden?“ Seine kurze Antwort hierauf lautet: „nicht durch den Gang der Dinge von Unten hinauf, sondern den von oben herab“.1019 Im Anschluss daran schreibt er, dass ein Fortschritt zum Besseren in der Geschichte vom Volk allein kaum zu erwarten sei. Kant erwartet einen Fortschritt zum Besseren weniger von der durch öffentliche Bildung geförderten Kultivierung und letztlich Moralisierung des Volks als vielmehr vom Handeln des moralischen Politikers. Die Hoffnung auf den Fortschritt sei bei ihm durch eine „Weisheit von oben herab“1020 begründet. Gemeint ist hier ein „überlegte[r] Plane der obersten Staatsmacht“.1021 Dazu würde gehören, dass der „Staat sich von Zeit zu Zeit auch selbst reformiere und, statt Revolution Evolution versuchend, zum Besseren beständig fortschreite“.1022 Der Staat selbst soll also die Staatsverfassung schrittweise verbessern. Wenn der Fortschritt gänzlich vom Staat abhängig wäre und somit von einem moralischen Politiker, dann könnte man Kant für eine allzu große Zuversicht kritisieren, weil auch ein Staatsoberhaupt ein gebrechlicher Mensch ist, der als solche nicht immer im Sinne des vernunftnotwendigen Fortschrittes handelt. Selbst wenn es nicht primär vom Volk abhängt, ob, wie und wann die Stiftung eines andauernden Friedenszustands gelingen kann, so vermögen die Menschen doch, „das größte Hinderniß des Moralischen“1023, nämlich den Krieg, welches ihrem freien Tun und Lassen zugerechnet werden kann, allmählich abbauen. Wie bereits im ersten Hauptteil gesehen wurde, beruht Kants Hoffnung auf Frieden nicht allein auf dem Handeln des moralischen Politikers, sondern ebenfalls auf der Stärkung dieser „negative[n] Weisheit“.1024 Kant richtet seine Kritik aber nicht nur an die Politiker, die nur auf Klugheit setzen (die Realpolitiker), sondern auch an die Politiker, die glauben ganz auf Klugheit verzichten zu können (die despotisierenden Moralisten). 1014 Vgl. Frieden: VIII, 372, 375, 377; Vorarbeit: XXIII, 162f. Vgl. Langer, Claudia: Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Stuttgart 1986, insbesondere S. 81ff. 1016 Langer, Claudia: Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Stuttgart 1986, S. 84. 1017 Sassenbach, Ulrich: Der Begriff des Politischen bei Immanuel Kant, Würzburg 1992, S. 141. 1018 Vgl. Ludwig, Bernd: Will die Natur unwiderstehlich die Republik? Einige Reflexionen anlässlich einer rätselhaften Textpassage in Kants Friedensschrift, in: Kant-Studien 88, 1997, S. 218f. 1019 Streit: VII, 92 1020 Streit: VII, 93 1021 Streit: VII, 93 1022 Streit: VII, 93 1023 Streit: VII, 93 1024 Streit: VII, 93 1015 - 183 - 5. Kants Zurückweisung eines despotisierenden Moralismus in der Politik Die zuvor erwähnte Reformkonzeption steht der weit verbreiteten Kritik entgegen, dass Kants praktische Philosophie im Allgemeinen und seine Rechtslehre im Besonderen keine Rücksicht auf die jeweiligen Einzelfälle nehmen, und damit einhergehend einen folgenblinden und somit moralisch verwerflichen Rigorismus implizieren. Auf den ersten Blick scheint dieser Vorwurf berechtigt zu sein. Als Beleg für Kants vermeintliche Gleichgültigkeit gegenüber den zu erwartenden Folgen unseres Tun und Lassens können verschiedene Textstellen angeführt werden. In der Grundlegung ist beispielsweise zu lesen, dass die Menschen sich an dem moralischen Gesetz zu orientieren haben: „der Erfolg mag sein, welcher er wolle“.1025 In der Friedensschrift führt Kant zustimmend die berühmte Formel „fiat justitia, pereat mundus“ auf, welche er folgendermaßen übersetzt: „Es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesammt darüber zu Grunde gehen“1026 (anstatt: „Es geschehe Gerechtigkeit, möge die Welt zugrunde gehen“). Ferner schreibt er im selben Text, dass die politischen Maxime „nicht von der, aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückseligkeit eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht (vom Wollen) als dem obersten (aber empirischen) Princip der Staatsweisheit, sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom Sollen, dessen Princip a priori durch reine Vernunft gegeben ist) ausgehen, die physische Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen“.1027 Diesen verschiedenen Textstellen ist zu entnehmen, dass Kant nachdrücklich betont, dass die Vernunftprinzipien tatsächlich in jeder Situation ganz unabhängig von den möglichen Folgen (und das heißt sowohl für die Anderen als auch für den Handelnden selbst) beachtet werden sollen. Nichtsdestoweniger zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass der Vorwurf eines folgenblinden, moralischen Rigorismus zu kurz greift. In der Friedensschrift warnt Kant ausdrücklich davor, dass Politik nicht bloß in Moral aufgehen darf und eine eigenständige Aufgabe zu leisten hat. Der moralische Politiker darf kein sogenannter „despotisirende[r] Moralist“1028 sein. Ein solcher wäre er nämlich dann, wenn er entgegen aller Staatsklugheit die Prinzipien des Rechts ohne Rücksicht auf die politischen Umstände vollziehen würde. In den Vorarbeiten zur Friedensschrift bezeichnet Kant die despotisierenden Moralisten ebenfalls sarkastisch als „Metaphysiker“ und kritisiert ihre „sanguinistische[] Hoffnung die Welt zu verbessern“.1029 Als erschreckendes Beispiel hierfür hatte Kant die Französische Revolution vor Augen, welche er zwar mit großer Begeisterung begrüßte, jedoch spätestens mit der Terrorherrschaft aus den Jahren 1793/94 als einen misslungenen Moralisierungsversuch der Politik erkannte. Dass Kant ein waches Bewusstsein für das Risiko eines folgenblinden und somit letztlich der Möglichkeit nach widersprüchlichen Moralisierungsversuchs der Politik hatte, zeigt hinreichend ein kleiner Passus aus der Friedensschrift, in welchem zu lesen ist, dass die Politiker sich für die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens zwar bedingungslos an dem moralischen Prinzip zu orientieren haben, „doch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilterweise mit Gewalt herbei zu ziehen, sondern sich ihm, nach Beschaffenheit der günstigen Umstände, unablässig zu nähern“.1030 Die Politiker sollen auf dem Wege der politischen Reform und unter Berücksichtigung der Ratschläge der Klugheit, also zügig, aber behutsam die Prinzipien des Rechts in der Realität umsetzen. Der Politiker, welcher für die Verwirklichung der 1025 GMS: IV, 416 Frieden: VIII, 378 1027 Frieden: VIII, 379 1028 Frieden: VIII, 373 1029 Vorarbeit: XXIII, 155 1030 Frieden: VIII, 378 1026 - 184 - Prinzipien des Rechts in der Realität auf unzulässige Mittel zurückgreifen würde, würde nicht nur unmoralisch, sondern auch unklug handeln.1031 Vor diesem Hintergrund scheint die Frage berechtigt zu sein, ob bei Kant tatsächlich jegliche Folgenüberlegungen bei der Befolgung des moralischen Gesetzes ausgeschlossen sind. Es ist der Verdienst von Otfried Höffe, entgegen einer weit verbreiteten Ansicht gezeigt zu haben, dass die Antwort auf diese Frage negativ ausfällt, und dass Folgenüberlegungen bei Kant unter bestimmten Bedingungen wohl erlaubt sind.1032 Für ein angemessenes Verständnis von Höffes Argumentation soll zunächst daran erinnert werden, dass der allgemeine kategorische Imperativ nicht nur das oberste Prinzip der Sittlichkeit, sondern zugleich ein Kriterium ist, anhand von welchem die Willens- und Handlungsmaximen auf ihre Moralität hin überprüft werden können. Die Bedingung der Sittlichkeit von Willens- und Handlungsmaximen ist, dass beide verallgemeinerungsfähig sind. Taugen unsere Maxime zu einem allgemeinen Gesetz, dann ist es nicht nur zulässig, sondern sogar geboten, nach ihnen zu handeln. Taugen sie nicht hierzu, so sind ihnen entsprechende Handlungen unmoralisch und verboten. An dieser Stelle ist es wichtig, sich wieder bewusst zu machen, wie das Kriterium der Verallgemeinerung der Maxime zu verstehen ist. Die Frage, ob unsere Willensund Handlungsmaxime zu einem allgemeinen Gesetz taugen, also verallgemeinerungsfähig sind, impliziert keine Überlegung über die empirischen Folgen in der sinnlichen Welt, die sich möglicherweise ergeben würden, wenn jeder gemäß einer bestimmten Maxime handeln würde. Es geht vielmehr um eine Verallgemeinerung - um ein Nicht-Denken-Können bzw. Nicht-Wollen-Können - in der intelligiblen Welt, das will heißen um einen logischen Widerspruch in der Struktur der Maxime selbst. Die Überprüfung der subjektiven Willensund Handlungsmaxime durch den kategorischen Imperativ gilt somit als rein apriorisch, insofern sie auf Folgenüberlegungen verzichtet, und als empirisch bestimmt, falls sie auf Folgenüberlegungen zurückgreift. Um die Zulässigkeit von Folgenüberlegungen innerhalb der Kantischen Ethik zu beweisen, trifft Otfried Höffe eine Unterscheidung zwischen sogenannten handlungsinternen und handlungsexternen Folgenüberlegungen. Die handlungsinternen Folgenüberlegungen betreffen nicht die Wahl der Maxime, sondern nur die Frage, wie die einmal gewählten Maximen angewandt werden sollen. Sie bleiben also bloß innerhalb eines moralischen Gebots beschränkt. Derartige Folgenabwägungen gehören zu dem, was Kant in der Grundlegung als den „Begriff der Handlung an sich selbst“1033 bezeichnet. Als solche treten sie erst auf nachdem die Wahl der Maxime einmal getroffen wurde. Derartige Folgenerwägungen sind nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig für das moralische Handeln. Das Hilfsgebot zum Beispiel lässt sich ohne Überlegungen, wie man einer sich im Notfall befindende Person erfolgreich hilft, gar nicht erfüllen. Die handlungsexternen Folgenüberlegungen sind dagegen jene Folgenüberlegungen, welche die Wahl der Maxime mitbestimmen können. Sie setzten ein bevor die Wahl einer Maxime überhaupt getroffen wurde und suchen diese Wahl zu beeinflussen. Wer sich von handlungsexternen Folgenüberlegungen leiten lässt, wählt eine Handlung nicht für sich selbst, sondern nur als Mittel für einen bestimmten Zweck. Der Bestimmungsgrund des Willens 1031 Vgl. Religion: VI, 96 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 74. Siehe auch: Ders.: Kants nichtempirische Verallgemeinerung: Zum Rechtsbeispiel des falschen Versprechens, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 2000, S. 209f; Ders.: Kategorische Rechtsprinzipien: Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt a. M. 1995, S. 184f.; Ders.: Kants Kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 31, 1977, S. 368f. 1033 GMS: IV, 402 (meine Hervorhebung) 1032 - 185 - ergibt sich durch einen beliebigen Zweck (materielles Prinzip) und nicht durch die Tauglichkeit der Maxime zu einem allgemeinen Gesetz (formales Prinzip). Vor diesem Hintergrund lässt es sich leicht einsehen, warum die absolute Notwendigkeit der Vernunftprinzipien nichts mit einer Gleichgültigkeit gegenüber den Handlungsfolgen zu tun hat. Wenn der Politiker zum Beispiel sich allein aus Achtung vor dem moralischen Gesetz einmal dafür entschieden hat, die Vernunftprinzipien des Rechts zu verwirklichen, darf und sogar soll er an den Umsetzungsbedingungen dieser Prinzipien denken. Gerade an diesem Punkt wäre es sogar absurd Folgenüberlegungen auszuschließen, denn wie auch immer die Anwendung der Vernunftprinzipien geschehen soll, wird zumeist zugunsten einer unter mehreren Handlungsmöglichkeiten entschieden. Weil jede getroffene Handlung, verschiedene Folgen nach sich zieht, sollte der Politiker eine Güterabwägung vornehmen, und also die Vor- und Nachteile aller Optionen abwägen. Er soll zwischen allen ihm zustehenden möglichen Mittel abwägen, um seinen bereits festgestellten Zweck am ehesten zu verwirklichen, das heißt um die Prinzipien des Rechts umzusetzen. Gefragt sind dabei eine besonnene Berücksichtigung des Bestehenden und Einschätzung des Möglichen. Innerhalb Kants Ethik sind Folgenerwägungen nur bei der Bestimmung unserer Willens- und Handlungsmaxime ausgeschlossen. An dieser Stelle gibt es für die Klugheit endgültig keinen Platz. Kant stellt nur die Klugheit, welche die Handlungsentscheidung für sich beansprucht oder nur beeinflussen möchte, in eine Gegenposition zur Moral. Dagegen wird allerdings mit der Umsetzung der Vernunftprinzipien des Rechts in der Realität der Klugheit eine klar eingegrenzte Aufgabe gestellt. Der Klugheit kommt die Funktion zu unter den verschiedenen möglichen, moralisch-gleichgültigen Mitteln, die zu einem kategorisch gebotenen Zweck führen können, diejenigen auszuwählen, welche am wirksamsten sind. Innerhalb Kants Ethik öffnet sich somit ein Feld, in welchem die Moral und die Klugheit nicht mehr im Konflikt zueinander stehen, sondern kompatibel und sogar notwendigerweise einander brauchen und ergänzen. Wie in der Friedensschrift zu lesen ist, bedarf der moralische Politiker stets der „Erinnerung der Klugheit“.1034 Folgenerüberlegungen sind jedoch nur dort möglich und notwendig, wo das moralische Gesetz dem Menschen einen gewissen Spielraum übrig lässt, der durch pragmatische oder technische Überlegungen gefüllt werden kann und muss. Kant zufolge ist dies allerdings bei den vollkommenen Pflichten nicht der Fall. Weil die vollkommenen Pflichten, wie zum Beispiel das Lügenverbot, lediglich Einzelhandlungen verbieten, bedarf deren Befolgung keiner Folgenüberlegungen. Dass dieser Spielraum selbst bei den vollkommenen Rechtspflichten beachtlicher ist als das was zunächst angenommen werden könnte, darauf soll im nächsten Kapitel näher eingegangen werden. Die Tatsache, dass Kant die Zulässigkeit von handlungsinternen Folgenüberlegungen innerhalb seiner Moral- und Rechtsphilosophie anerkennt, sagt dennoch nichts über die Realisierbarkeit dessen, was moralisch geboten ist. Dieser Frage möchten wir uns im Folgenden widmen. Es wird sich dabei zeigen, dass für Kant die Einhaltung der Rechtspflichten nicht nur möglich, sondern auch klug ist. 6. Die Einhaltung der Rechtspflichten als Gebot der Sittlichkeit sowie als Ratschlag der Klugheit 6.1 Die Einhaltung der Rechtspflichten ist möglich Für Kant ist Frieden nur durch die Stiftung eines mit Hilfe öffentlicher Gesetze endgültig gesicherten Rechtszustandes zu erreichen. Aus diesem Grunde entspricht das Problem der Realisierung des Friedens jenem der Verwirklichung der Prinzipien des Rechts. 1034 Frieden: VIII, 378 - 186 - Bisher wurde bereits gesehen, dass es möglich ist, die Klugheit mit den unbedingt gebietenden Vorschriften der Moral zu versöhnen. Dennoch konnte Kant nicht nachweisen, dass jenes, was geboten ist, prinzipiell auch erreicht werden kann. Kant hat sich bis zum Ende geweigert, darin überhaupt eine Frage zu sehen. Wahrscheinlich fürchtete er, dass die Folgenüberlegungen und die Abschätzung der Realisierbarkeit des moralischen Gesetzes auf dessen Definition zurückwirken und seine Notwendigkeit schließlich relativieren könnten. Was die Frage nach der Realisierbarkeit des moralischen Gesetzes anbelangt, so führt Kant lediglich das Argument an, wonach die Kraft des unbedingt gebietenden Sittengesetzes dessen Ausführbarkeit impliziert. Wenn das moralische Gesetz eine Handlung gebietet, dann müssen die Menschen auch fähig sein jene umzusetzen, weil im Sollen bereits das Können beinhaltet ist.1035 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass die Menschen bei der Befolgung des moralischen Gesetzes nicht scheitern können. Es bedeutet lediglich, dass die Menschen sich nicht auf die vermeintliche Unmöglichkeit einer gebotenen Handlung berufen können, um das moralische Gesetz nicht zu verwirklichen versuchen. Dies lässt sich auf zwei Gründe zurückführen: Der Mensch kann nicht wissen, wie weit seine Fähigkeiten eigentlich reichen, was für ihn möglich und unmöglich ist und was im Endeffekt klug und unklug ist. Wie zuvor gesehen wurde, sind die Folgen unseres Tun und Lassens niemals mit Sicherheit vorherzusehen. Unsere Folgenabschätzungen sind mit einer niemals völlig aufzuhebenden Unsicherheit verbunden. Hinzu kommt, dass nicht einmal die Wahrscheinlichkeit einer Folge genau vorherzusehen ist. Der Mensch weiß dagegen mit Gewissheit, welche Handlung vom moralischen Gesetz geboten wird. Dafür bedarf man nämlich gar keiner empirischen Kenntnisse. In der Grundlegung heißt es: „Was ich also zu thun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei, dazu brauche ich gar keine weit ausholende Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig auf alle sich eräugende Vorfälle desselben gefaßt zu sein, frage ich mich nur: kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines Gesetz werde?“.1036 Kants These, dass jeder Mensch weiß, was moralisch geboten ist, findet sich ebenfalls in der zweiten Kritik: „Was nach dem Princip der Autonomie des Willens zu thun sei, ist für den gemeinsten Verstand ganz leicht und ohne Bedenken einzusehen. [Denn] was Pflicht sei, bietet sich jedermann von selbst dar“.1037 Dort führt Kant ebenfalls aus, dass man das „Bewußtsein dieses Grundgesetzes ein Factum der Vernunft nennen“ kann, weil man es nicht „aus vorhergehenden Datis der Vernunft […] herausvernünfteln kann, sondern weil es sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori auf keiner, weder reinen noch empirischen, Anschauung gegründet ist“.1038 Das Sittengesetz ist kein empirisches, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft, die sich dadurch als „ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic iubeo)“1039 ankündigt. Aus der Unsicherheit der Folgenerwägungen einerseits und der unbedingten Notwendigkeit des moralischen Gesetzes andererseits folgt, dass die Menschen sich dem kategorischen Imperativ nicht unter dem Vorwand entziehen dürfen, dass dieser sich nicht umsetzen lasse. Solange nicht mit Gewissheit bewiesen wurde, dass die Pflichterfüllung unmöglich ist (und ein derartiger, unwiderlegbarer Beweis ist nicht möglich), sollen sich also die Menschen in ihrem Verhalten strikt an dem moralischen Gesetz orientieren. In der Schrift Über den Gemeinspruch schreibt Kant folgendes dazu: „Es mögen nun auch noch so viel Zweifel gegen meine Hoffnungen aus der Geschichte gemacht werden, die, wenn sie 1035 Vgl. KpV: V, 30; Gemeinspruch: VIII, 287; TL: VI, 380, 384; Religion: VI, 50, 41, 62, 67 GMS: IV, 403 1037 KpV: V, 36 1038 KpV: V, 31 1039 KpV: V, 31 1036 - 187 - beweisend wären, mich bewegen könnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulassen; so kann ich doch, so lange dieses nur nicht ganz gewiss gemacht werden kann, die Pflicht (als das liquidum) gegen die Klugheitsregel aufs Unthunliche nicht hinzuarbeiten (als das illiquidum, weil es bloße Hypothese ist) nicht vertauschen“.1040 Mit diesem Argument, nach welchem die Menschen das machen können müssen, was das moralische Gesetz gebietet, gelingt es Kant also zu zeigen, dass die Erfüllung einer Pflicht unabhängig von der Abschätzung ihrer Realisierbarkeit erfolgen soll. 6.2 Die Einhaltung der Rechtspflichten ist klug Kant beschränkt sich nicht darauf zu zeigen, dass, was gemacht werden soll, grundsätzlich auch erreicht werden kann. Darüber hinaus versucht er zu zeigen, dass was moralisch geboten ist, auch pragmatisch angestrebt werden soll. Im ersten Teil des Anhangs der Friedensschrift heißt es dazu: „[T]rachtet allererst nach dem Reiche der reinen praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch euer Zweck (die Wohlthat des ewigen Friedens) von selbst zufallen“.1041 In diesem Satz stellt Kant der Gerechtigkeit als formales Rechtsprinzip die Wohltat des ewigen Friedens als materielles Prinzip gegenüber. Das formale sowie das materielle Prinzip schließen sich nicht wechselseitig aus. Mit dem Adverb „allererst“ zeigt Kant, dass das formale Prinzip dem materiellen hierarchisch und zeitlich vorangestellt ist. Seine These lautet wie folgt: Wenn man dem formalen Rechtsprinzip den Vorrang gäbe, so erfülle sich ebenfalls das materielle. Bevor sich der Begründung dieser These gewidmet wird, soll Kant noch kurz zu Wort kommen: „Man kann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragmatisch-bedingten Rechts (zwischen Recht und Nutzen) aussinnen, sondern alle Politik muß ihre Knie vor dem erstern beugen, kann aber dafür hoffen, obzwar langsam, zu der Stufe zu gelangen, wo sie beharrlich glänzen wird“.1042 Diese berühmte Formel, dass jede Politik ihre Knie vor dem Recht beugen muss, sollte vor dem Hintergrund der obigen Erörterungen kein Verständnisproblem mehr darstellen. Hier wird erneut die geltungstheoretische Abhängigkeit der Politik von den Prinzipien des Rechts und der Moral hervorgehoben. Erklärungsbedürftig ist dagegen der letzte Teil des obigen Zitats, in welchem Kant dem moralischen Politiker einen andauernden „Glanz“ in Aussicht stellt. Einiges spricht dafür, dass es sich hier nicht um einen moralischen Glanz handelt. Der Glanz ist nämlich von außen einzusehen. Bei einer moralischen Handlung kommt es dagegen ausschließlich auf den guten Willen an, der nach außen nicht bewiesen werden kann. Was Kant im Sinne hat, ist also vielmehr ein politischer Glanz. Dieser ergibt sich wiederum aus dem positiven Erfolg, den der moralische Politiker erreicht, indem er dem formalen Rechtprinzip den Vorrang vor dem materiellen Zweck einräumt. Für Kant gibt es also gar keinen Widerstreit zwischen Recht und Nutzen, zwischen Sittlichkeit und Sinnlichkeit sowie zwischen dem formalen und dem materiellen Prinzip. Das erste ist immer die Grundlage für jede Politik, wenn diese auf Dauer erfolgreich sein soll.1043 Diese These lässt sich folgendermaßen begründen: Die Maximen des politisch Handelnden sollen sich am formalen Rechtsprinzip orientieren, weil einzig auf diesem Weg das angeborene und erworbene Recht des Einzelnen mit dem Recht aller Anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Frieden als die Garantie der äußeren Freiheit von jedermann ist in Bezug auf alle anderen Menschen a priori ausschließlich unter Bedingung des Rechts zu erwarten. Erst, wenn Frieden wahrhaft gegeben ist, das heißt, wenn 1040 Gemeinspruch: VIII, 309 Frieden: VIII, 378 1042 Frieden: VIII, 380 1043 In einer seinen Reflexionen zur Rechtsphilosophie schreibt Kant in diesem Sinne, dass die Gerechtigkeit, mithin die Unterordnung der Klugheit unter das Recht, „der kurze weg der Staatklugheit“ ist (Reflexion 7779: XIX, 514). 1041 - 188 - die Menschen in einem weltweiten, bürgerlich-gesetzlichen Zustand leben, ist a priori gesichert, dass diese von der Wohltat des ewigen Friedens profitieren, indem sie ihre jeweiligen materiellen Zwecke unabhängig von der nötigenden Willkür der Anderen verfolgen können. Wenn also bei Kant zu lesen ist, dass aus dem Befolgen des formalen Rechtsprinzips, der materielle Zweck, nämlich die eigene Glückseligkeit, von selbst resultiert, dann darf dies nicht so verstanden werden, als ob für Kant die Glückseligkeit direkt und automatisch aus der Befolgung der Vernunftprinzipien folgt. Was Kant hiermit festhalten will, ist nämlich nicht die Idee, dass die Anwendung des formalen Rechtsprinzips die Bedingung der Glückseligkeit impliziert, sondern ausschließlich die Bedingung der Möglichkeit der Glückseligkeit. Die Tatsache, dass jeder Mensch in seinem Streben nach Glückseligkeit rechtlich von den Eingriffen der anderen Menschen geschützt ist, hat längst noch nicht zu bedeuten, dass sie jemals ihre eigene Glückseligkeit tatsächlich erreichen werden. Hierfür ist es notwendig, dass weitere Bedingungen vorliegen, welche wiederum von den inneren wie äußeren Umständen der Menschen abhängig sind. Zusammenfassend ist hier zweierlei festzuhalten. Bei der bisherigen Analyse des Kantischen Gedankengangs wurde gezeigt, dass Kant sowohl die Notwendigkeit als auch die Möglichkeit der Überwindung des inter-individuellen und inter-staatlichen Naturzustandes und des Übergangs in einem sich weltweit erstreckenden öffentlich-rechtlichen Zustand gänzlich a priori begründet. Kant fügt hier allerdings dem apriorischen Argument bezüglich der Notwendigkeit und Möglichkeit der Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens ein plausibles empirisches Argument hinzu, demzufolge dieser Zweck ebenfalls als hypothetischer Imperativ, genauer gesagt als pragmatischer Imperativ gedeutet werden kann.1044 Entsprechend handeln die Menschen klug, wenn sie sittlich handeln. Wollen die Menschen ihre materiellen Zwecke erreichen, dann ist es hypothetisch geraten, dem Recht gemäß zu handeln. Die Einhaltung der Rechtspflichten ist nicht nur an sich gut, sondern ebenfalls für eine wirkliche Absicht gut geeignet. Bei der Einhaltung der Rechtspflichten handelt es sich nicht nur um einen Gebot der Sittlichkeit, sondern auch um einen Ratschlag politischer Klugheit. Zumindest langfristig können somit die Menschen auf eine Konvergenz von Klugheit und Moral sowie von Nutzen und Gesinnung hoffen. Wie wir bereits im ersten Hauptteil gesehen haben, führt Kant in seinen kleineren, geschichtsphilosophischen Schriften zusätzlich gute Gründe an, welche diese gutmütige Hoffnung berechtigen sollen. Dort versucht er nachzuweisen, dass die Geschichte auf das hin tendiert, was die reine praktische Vernunft fordert. In diesem Kapitel hat sich herausgestellt, dass wahrhaftig kluge Politik keineswegs unmoralisch sein muss, genauso wie moralische Politik nicht weltfremd und erfolglos sein muss. Den Prinzipien des Rechts gemäß zu handeln, hat empirisch betrachtet noch niemals bedeutet, notwendigerweise scheitern zu müssen. Im Gegensatz zu einem naiven Utopismus, welcher die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens allein vom sittlichen Gebrauch des menschlichen freien Willens abhängig machen würde, stellt Kant eine nüchterne These auf, welche die Moral mit der Klugheit, die Sittlichkeit mit der Sinnlichkeit unter dem Vorrang der ersteren auszusöhnen versucht. Als Politiker benötigt man weder eine andere Welt noch einen anderen Menschen. Es reicht völlig aus – und es ist tatsächlich möglich – das Vorhandene allmählich zu reformieren. Der Politiker, welcher die Möglichkeit einer Verwirklichung der Prinzipien des Rechts in der Wirklichkeit von vornherein verleugnet und seine Machtpolitik mit Hilfe einer unfundierten Vorstellung eines unaufhebbaren, ewigen Krieges begründet, ist kein einischtiger Realpolitiker, sondern vielmehr ein unmoralischer Verführer, dessen Illegitimität mit aller möglichen Kraft denunziert werden soll. 1044 Vgl. Geismann, Georg: World Peace: Rational Idea and Reality. On the Principles of Kant’s Political Philosophy, in: Kant. Analysen - Probleme - Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Würzburg 1996, S. 265-319. - 189 - 2. KAPITEL: ÜBER DEN SYSTEMATISCHEN STELLENWERT KANTS RECHTSTHEORIE VOM WELTFRIEDEN DER URTEILSKRAFT INNERHALB Im ersten Hauptteil der vorliegenden Dissertation wurde gezeigt, dass es Kant weitgehend gelungen ist, die Notwendigkeit der Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens rein rational, also unabhängig von jeglichen Erfahrungsbedingungen, zu begründen. Genau hierin liegt seine epochale Leistung im Bereich der politischen Philosophie. Darüber hinaus darf jedoch nicht übersehen werden, dass Kant ebenfalls um eine Vermittlung von den universalen, formalen Vernunftprinzipien mit den einzelnen, konkreten Fällen bemüht war. Das Mittelglied der Verknüpfung sowie des Übergangs von den ersteren zu den letzteren sieht Kant in der Figur des moralischen Politikers. In der Friedensschrift wird moralische Politik als „ausübende Rechtslehre“ definiert. Dem moralischen Politiker kommt somit die Aufgabe zu, die apriorischen Prinzipien des Rechts auf die Erfahrungsfälle anzuwenden. Der Akzent liegt in Kants Definition ausdrücklich auf der Ausübung. Gerade hierfür ist allerdings Urteilskraft unentbehrlich. Die Urteilskraft überhaupt definiert Kant zunächst allgemein als das „Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken“.1045 Was genau unter diesem Vermögen, welches gerne als Subsumtionsleistung definiert wird, zu verstehen ist, soll im Folgenden noch ausführlich gezeigt werden. An dieser Stelle reicht es aus festzuhalten, dass es von der Urteilskraft überhaupt sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Gebrauch geben kann. Wer jedoch die Politik als angewandte Rechtslehre bestimmt, betont ausdrücklich den praktischen Gebrauch der Urteilskraft. Des Weiteren schreibt Kant in der Kritik der reinen Vernunft und vor allem dann in der Kritik der Urtheilskraft, dass es die Urteilskraft grundsätzlich in zweierlei Gestalt gibt: Als bestimmende und als reflektierende Urteilskraft. Diese Unterscheidung entspricht den zwei einzigen Vermittlungsmöglichkeiten zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen. Gemeint sind der Übergang von einem gegebenen Allgemeinen zu einem gesuchten Besonderen einerseits sowie der Übergang von einem gegebenen Besonderen zu einem gesuchten Allgemeinen andererseits. Wenn das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) durch den Verstand bereits gegeben ist, dann ist von der bestimmenden Urteilskraft die Rede. Wenn dagegen das Allgemeine erst gefunden werden muss, dann wird von der reflektierenden Urteilskraft gesprochen. Für die Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle ist die bestimmende Urteilskraft gefragt. Was den Vernunftprinzipien entspricht, ist nämlich bereits gegeben und kann selbst von dem gemeinsten Verstand jederzeit erkannt werden.1046 In seiner kleinen Abhandlung Von einem neuerdings erhobenen Ton in der Philosophie schreibt Kant diesbezüglich, dass „die Stimme der Vernunft (dictamen rationis) […] zu Jedermann deutlich spricht“.1047 Die Tatsache, dass die Vernunftprinzipien in abstracto von jedermann leicht erkannt werden können, lässt jedoch die doppelte Frage unbeantwortet, auf welche Erfahrungsfälle sowie auf welche Art und Weise jene in concreto angewandt werden sollen. Auf diese Problematik soll auf den folgenden Seiten ausführlich eingegangen werden. Dies soll in Kenntnis, aber nicht immer in Übereinstimmung mit einem Großteil der Sekundärliteratur aus den letzten zwei Jahrzehnten geschehen. Es soll hier die These vertreten werden, dass Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden die absolute Verbindlichkeit universeller Rechtsprinzipien mit einem nicht zu unterschätzenden Spielraum für die Politik bezüglich ihrer konkreten Anwendung auf die Einzelfälle verbindet. Es wird sich somit zeigen, dass Kant kein weltfremder Moralist ist, sondern vielmehr ein erfahrungsoffener und kontextsensibler Rechtsphilosoph, welcher der Urteilskraft eine erhebliche Rolle bei der 1045 KUK: V, 179 Vgl. GMS: IV, 403; KpV: V, 36 1047 VT: VIII, 402 (meine Hervorhebung) 1046 - 190 - Anwendung der Vernunftprinzipien zuweist und somit unmittelbar eine Eigenständigkeit der Politik gegenüber Recht und Moral anerkennt. Im folgenden Kapitel soll erstens der Begriff der Urteilskraft erläutert werden und auf das von Kants selbst gesehene Problem des unendlichen Regelregresses eingegangen werden (1). Im zweiten Abschnitt wird die Bedeutung der reinen praktischen Urteilskraft für die Beurteilung der Prinzipien der Moralität erörtert (2). Dabei wird insbesondere auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die Kants Unterscheidung von sinnlicher und intelligibler Welt der Urteilskraft bereitet sowie auf das Naturgesetz als Typus des Sittengesetzes eingegangen. Der dritte Abschnitt widmet sich der Bedeutung der erfahrungsgeschärften Urteilskraft bei der Anwendung der Vernunftprinzipien (3). Es wird dabei besonders hervorgehoben, dass die absolute Verbindlichkeit universeller Vernunftprinzipien sehr wohl mit individuellen Einzelfallentscheidungen vereinbar ist. 1. Das Problem des unendlichen Regelregresses und der Versuch, die Urteilskraft für Kants praktische Philosophie zu rehabilitieren 1.1 Das Problem des unendlichen Regelregresses in Kants praktischer Philosophie Es wurde bereits gesehen, dass die Vernunftgesetze als unbedingt gebietende Handlungsvorschriften ihre Anwendbarkeit begrifflich voraussetzen: Wenn ein Vernunftgesetz eine Handlung gebietet, dann müssen die Menschen auch jenes prinzipiell umsetzen können, weil nach Kant im Sollen bereits das Können beinhaltet ist.1048 Ein Vernunftgesetz ohne irgendeine Anwendungsmöglichkeit würde widersprüchlich sein. Es kann keine Verpflichtung zum Unmöglichen bestehen (impossibilium nulla obligatio est). Den Menschen ist es also prinzipiell möglich, die Vernunftgesetze in konkrete Taten zu übersetzen. Diesbezüglich warnt Kant jedoch, dass es zwischen dem Vernunftgesetz oder genauer den subjektiven Handlungsmaximen und der konkreten Tat einen großen Zwischenraum gibt.1049 Gemeint ist die Kluft, welche die Theorie von der Praxis notwendig trennt.1050 Um diese Kluft zu überwinden, das heißt um die Vernunftgesetze auf die Erfahrungsfälle anzuwenden, ist die Urteilskraft nötig. Die Frage, welche sich vor diesem Hintergrund aufdrängt, ist jene, ob sich für den Gebrauch der Urteilskraft Regeln finden lassen, die es ihr ermöglichen würden, ihre Aufgabe erfolgreich zu erledigen. Diese Problematik wird im folgenden Kapitel thematisiert. Eine Regel anwenden heißt für Kant, einen Gegenstand einem Begriff unterzuordnen. Jede Regel kann explizit in einer Proposition ausgedrückt werden. Ihr Inhalt kann somit immer von allen leicht identifiziert werden. Ganz anders verhält es sich aber mit der Frage, was unter diese Regel fällt und was nicht. Die Antwort auf diese Frage kann nicht von einer neuen Regel bestimmt werden, denn auch in Bezug auf diese Regel bleibt es offen, wie sie angewandt werden soll. An dieser Stelle tritt das bekannte Problem des unendlichen Regelregresses (regressus ad infinitum) auf. Dieses Problem besteht grundsätzlich darin, dass sich keine Regel denken lässt, welche die Anwendung einer anderen Regel lückenlos und somit endgültig regeln könnte. Jede Regel bedürfte einer weiteren Regel, um ihre Anwendung festzulegen. Wenn einmal eine klar definierte Regel vorliegt, stellt sich immer die Frage, wie und unter welchen Bedingungen sie angewandt werden soll. Die Anwendungsbedingungen dieser ersten Regel können wiederum erst von einer neuen Regel definiert werden. Aber auch in Bezug auf diese zweite Regel stellt sich erneut die anfängliche Frage, wie sie angewandt werden soll, so dass es immer weiteren Regeln bedarf, um letztlich die Anwendung der ersten 1048 Vgl. KpV: V, 30; Gemeinspruch: VIII, 287; TL: VI, 380, 384; Religion: VI, 41, 50, 62, 67 Vgl. Religion: VI, 697 1050 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 275 1049 - 191 - zu bestimmen. In der Folge ergibt sich, dass die Anwendung einer Regel niemals lückenlos und somit zweifelsfrei bestimmt werden kann. Hieraus folgt wiederum, dass es selbst für ein regelgeleitetes Handeln grundsätzlich unmöglich ist, sich ausschließlich an formulierten Regeln zu orientieren. Die Urteilskraft gelangt somit immer an einen Punkt, an welchem sie auf sich selbst gestellt sieht. Dieses Problem des unendlichen Regelregresses tritt im Bereich der Ethik ebenso gut wie in allen anderen Bereichen des Handelns auf.1051 Es gilt also genauso gut für die Anwendung des allgemeinen Sittengesetzes als auch für die Anwendung der pragmatischen Ratschläge der Klugheit oder der technischen Regeln der Geschicklichkeit. Dass Kant sich diesem Problem hinreichend bewusst ist, lässt sich bereits in dem einleitenden Abschnitt aus dem Gemeinspruch entnehmen. Dort führt Kant explizit aus, dass es für die Urteilskraft „nicht immer wiederum Regeln gegeben werden können, wonach sie sich in der Subsumption zu richten habe (weil das ins Unendliche gehen würde)“.1052 Allein diese Feststellung sollte ausreichen, um zu zeigen, dass es entschieden zu kurz greift, wenn man Kants Verständnis der Politik auf einen bloß mechanischen Prozess der Rechtsverwaltung reduziert.1053 Dieser Kritik zufolge wären die Politiker zu einem vorgegebenen und gleichförmigen Handeln ohne kritische Beurteilung und abwägende Stellungnahme, und somit auch ohne Rücksicht auf die Besonderheiten der jeweiligen Situationen aufgefordert. In diesem Zusammenhang ist es besonders interessant die folgende Reflexion aus dem Nachlass zu lesen: „Das Verfahren nach einer Regel welches keiner Urtheilskraft bedarf, ist mechanisch“.1054 Dementsprechend wäre die Politik verstanden als ausübende Rechtslehre tatsächlich nichts anderes als ein bloß mechanischer Prozess, insofern die Anwendung der Vernunftprinzipien keine Urteilskraft erfordern würde, also wenn sie immer in gleicher Weise sowie ohne Nach- und Mitdenken erfolgen würde. Dies könnte aber selbst dann nicht der Fall sein, wenn der Politiker nur ein einziges Vernunftgesetz in Bezug auf eine immer wiederkehrende Situation anwenden sollte. Selbst in einem derartigen Falle hat der Politiker zu entscheiden, ob er sich in einer Situation befindet, in welcher sein Handeln gefordert ist. Es wurde jedoch gesehen, dass die Anwendung der Vernunftgesetze anhand von Regeln niemals vollständig geregelt werden kann. Die daraus resultierende strukturelle Offenheit bezüglich der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die unendliche Mannigfaltigkeit der real existierenden Situationen erklärt, dass die Urteilskraft unverzichtbar ist, und dass der Prozess der Rechtsanwendung nicht mechanisch sein kann. Für die situationsangemessene Anwendung der Prinzipien des Rechts kann sich der Politiker nicht allein auf eine Regel stützen. Nur ein Teil des politischen Handelns kann somit explizit durch Regeln bestimmt werden. Gemeint ist hier zunächst die Bestimmung des politischen Zwecks, welcher ganz allgemein in der Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens besteht. Die pflichtmäßige Anwendung der Prinzipien des Rechts in der Realität lässt sich dagegen nie vollständig durch Regeln festlegen. Schon diese Feststellung ermöglicht es Charles Larmores Kritik zurückweisen, dass für Kant „das moralisch Richtige voll und ganz durch Regeln spezifiziert werden kann“.1055 Nicht alle menschlichen Handlungen sind von den Vernunftgesetzen bestimmt, und diejenigen, die es werden, können nicht bis in jedes Detail von den Vernunftgesetzen bestimmt werden. Diese Feststellung hat für das politische Handeln weitreichende Konsequenzen. Sie scheint nahezuliegen, dass die Kantische 1051 Vgl. Mayer, Verena: Das Paradox des Regelfolgens in Kants Moralphilosophie, in: Kant-Studien 97, 2006, S. 347f. 1052 Gemeinspruch: VIII, 275 (meine Hervorhebungen) 1053 Eine solche Deutung findet sich zum Beispiel bei Ernst Vollrath. Vgl. Vollrath, Ernst: Was ist das Politische? Eine Theorie des Politischen und seiner Wahrnehmung, Würzburg 2003, S. 65. 1054 Reflexion 924: XV, 411 1055 Larmore, Charles: Strukturen moralischer Komplexität, Stuttgart/Weimar 1995, S. 4 (meine Hervorhebung), zitiert nach: Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 64. - 192 - praktische Philosophie im Allgemeinen und die Rechtslehre im Speziellen die absolute Notwendigkeit der Vernunftgesetze sehr wohl mit einem gewissen Freiraum für die Politik bezüglich der Anwendung auf die Einzelfälle verbinden kann. Dieser Freiraum ergibt sich gerade dort, wo die Urteilskraft in ihrer Anwendungsfunktion am Werk ist. Diese Offenheit ist struktureller Natur, da die Urteilskraft im Endeffekt immer an einem Punkt gelangt, an welchem sie sich auf sich allein gestellt sieht. Gerade deswegen, weil nicht alles durch Regeln bestimmt werden kann, ist die Urteilskraft innerhalb Kants praktischer Philosophie unentbehrlich. 1.2 Das Risiko der Willkür bei der Anwendung der Vernunftprinzipien Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen soll nun auf zwei denkbare, wenngleich sich gegenseitig ausschließende Kritikpunkte näher eingegangen werden. Der ersten Kritik zufolge ist die Bestimmung der formalen Vernunftprinzipien mit einer vollständigen Unterbestimmung ihrer konkreten Anwendung verbunden. Dadurch ergibt sich das Risiko, dass die Anwendung der Vernunftprinzipien von Seiten der Politiker willkürlich erfolgt. Der zweiten Kritik zufolge lässt die absolute Notwendigkeit der universellen Rechtsprinzipien gar keinen Freiraum für Individualität und Erfahrung im politischen Bereich zu. Innerhalb Kants Rechtsphilosophie würde es somit keinen Platz für die Politik als ein eigenständiges Konzept geben. Bevor sich dem ersten Kritikpunkt ausführlicher gewidmet wird, sollen die wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem letzten Abschnitt dieses Kapitels kurz nochmal aufgegriffen werden. Es wurde gezeigt, dass zum Verstandesbegriff, welcher die Vernunftprinzipien enthält, immer ein Aktus der Urteilskraft hinzukommen muss.1056 Des Weiteren wurde gesehen, dass das Verfahren der Urteilskraft nicht lückenlos bestimmt werden kann, weil jeder Versuch die Ausübung der Vernunftprinzipien in Regeln zu fassen letztlich in einem unendlichen Regelregress mündet. Das politische Handeln kann sich also weder auf der bloß mechanischen Anwendung der Vernunftgesetze beschränken, noch kann es bis ins letzte Detail bestimmt werden. Wenn jedoch die Anwendung der Vernunftprinzipien unmöglich vollständig durch Regeln bestimmt werden kann, könnte mit gewissen Gründen befürchtet werden, dass jene willkürlich erfolgt. Es besteht somit Erklärungsbedarf darüber, wie vermieden werden kann, dass die Anwendung der Vernunftprinzipien auf bloße Willkür, mithin auf purer Beliebigkeit beruht. Die hier aufgeworfene Problematik ist von großer Tragweite: Wenn sich aus der Feststellung, dass die Anwendung der Vernunftgesetze sich gar nicht vollständig regeln lässt, ergeben würde, dass die Anwendung willkürlich erfolgen könnte, dann dürfte man ernsthafte Bedenken gegen Kants Moralphilosophie in ihrer Gesamtheit formulieren. Welchen Sinn würde die Begründung des Sittengesetzes haben, wenn jenes in seiner Anwendung umgangen werden könnte? Diese Problematik lässt sich am Beispiel des ersten Definitivartikels gut verdeutlichen. Wenn nämlich einmal erkannt wird, dass die bürgerliche Verfassung in jedem Staat republikanisch sein soll, dann stellt sich nur noch die Frage, mit welchem Mittel dieser Zustand hervorgebracht werden kann. Kann zum Beispiel die Schaffung einer bürgerlichen Verfassung im Inneren durch eine Revolution oder nach außen durch Krieg hervorgebracht werden? Es lässt sich leicht einsehen, dass das willkürliche Handeln die Bindung an die Vernunftgesetze aufhebt und somit Gefahr läuft, gegen jene zu verstoßen. Kant zufolge sollen aber die Moral und das Recht stets die Oberhand behalten. Dies bedeutet, dass der Politiker niemals nach freiem Belieben handeln darf, selbst wenn es sich um die Anwendung der Vernunftprinzipien in der Wirklichkeit handelt. 1056 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 275 - 193 - Der Politiker darf seine Entscheidungen nicht willkürlich treffen, sondern er muss jene stets im Einklang mit dem allgemeinen Sittengesetz treffen. Es sind entsprechend nicht alle Mittel für die Herbeiführung eines gebotenen Zwecks tauglich. Beliebige Mittel dürfen nicht angewendet werden, um ein Vernunftgesetz in der Realität anzuwenden. Die verwendeten Mittel müssen stets mit dem Grund für die Befolgung dieses Gesetzten, also mit dem allgemeinen Sittengesetz widerspruchsfrei übereinstimmen. Es lässt sich vor diesem Hintergrund leicht einsehen, dass die Revolution sowie der Krieg zu ächten sind, da beide die Gefahr eines gebotswidrigen Rückfalls in den zwischenmenschlichen Naturzustand in sich bergen. Die vorhergehenden Ausführungen zeigen, dass der Verweis auf das unaufhebbare Risiko der Willkür bei der Anwendung der Vernunftprinzipien nicht stichhaltig ist. Die grundsätzliche Schwäche dieser Kritik besteht darin, zwei Dinge gleichzusetzen, welche nicht gleicher Natur sind: Die längst bekannte Tatsache, dass die Anwendung der Vernunftprinzipien nicht vollständig determiniert ist (und überhaupt sein kann), wird von Seiten vieler Kritiker so verstanden, dass die Anwendung der Vernunftprinzipien vollständig undeterminiert ist. Den Kritikern zufolge impliziert diese Unterbestimmung der Anwendung der Vernunftprinzipien eine Willkür, welche mit dieser Unterdetermination einhergeht. Allerdings gibt es zwischen einer Unterbestimmung und einer vollständigen Unbestimmung einen Unterschied. Die Anwendung der Vernunftprinzipien ist bei Kant sicher unterbestimmt, jedoch nicht unbestimmt. Nachdem diese erste Kritik als wenig überzeugend abgewiesen wurde, drängt sich ein weiteres Problem auf. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen bezüglich der absoluten Notwendigkeit der Vernunftprinzipien scheint es für die Politik überhaupt keinen Freiraum mehr zu geben. Wenn nämlich die Aufgabe der Politik lediglich darin besteht die Vernunftgesetze auf die Erfahrungsfälle anzuwenden, ohne über deren Inhalt vernünfteln zu dürfen und ohne beliebige Mittel hierfür einsetzen zu dürfen, stellt sich die Frage, wie viel Spielraum der Politik tatsächlich noch übrig bleibt. Von einer Eigenständigkeit der Politik gegenüber Recht und Moral kann erst dann gesprochen werden, wenn den Politikern, trotz des Vorliegens eines Rechtgesetzes, Spielraum für eine eigene Entscheidung bleibt. Die Politik würde sich tatsächlich auf einen bloß mechanischen Prozess der Rechtsdurchsetzung beschränken, wenn in einer bestimmten Situation der Freiraum des Politikers so stark eingeengt wäre, dass nur eine einzige, vorgegebene Art und Weise der Rechtsanwendung denkbar wäre. In einem derartigen Fall könnte man von einer Reduktion des politischen Ermessensspielraums auf null sprechen. In der Sekundärliteratur wird zumeist davon ausgegangen, dass Kant dieses Problem gar nicht gesehen hätte oder zumindest, dass seine Antwort unzureichend ist. Es wird ihm aber vor allem vorgeworfen, dass er die Bedeutung der Urteilskraft für seine Moral- und Rechtsphilosophie nicht genügend thematisiert hat. Als Beleg für dieses thematische Defizit wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Urteilskraft weder zu den Kernbegriffen noch zu den zweitrangigen Konzepten der Kantischen praktischen Philosophie gehört. In der Friedensschrift beispielsweise kommt der Begriff der Urteilskraft überraschenderweise überhaupt nicht vor, obwohl diese für die fallgerechte Anwendung der Vernunftprinzipien in der Wirklichkeit unentbehrlich ist. Die Folgen dieser mangelnden Berücksichtigung scheinen beachtlich zu sein. Aus der ebenso einfachen wie unbestrittenen Feststellung, dass in Kants politischen Schriften ausgesprochen wenige Aussagen bezüglich der Anwendung der Vernunftprinzipien in der politischen Wirklichkeit zu finden sind, wurde häufig geschlossen, dass Kant ein weltfremder Rechtsphilosoph sei, welcher weder Interesse noch Gespür für die konkreten Probleme der Menschen habe. Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden wäre somit für die Beantwortung konkreter politischer Fragen gänzlich ungeeignet. In ihrem Rahmen würde es keinen Platz für flexible, politische Einzelfallentscheidungen geben. Dem pflichtbewussten Anwender universeller Vernunftprinzipien wird deshalb von einigen - 194 - Interpreten das vermeintliche Gegenmodell des aristotelischen phronimos vorgezogen.1057 Dass dieser Ansatz in die falsche Richtung geht, darauf soll in den folgenden Seiten näher eingegangen werden. 1.3 Kants scheinbare Abwertung der Urteilskraft und die Versuche, jene für seine praktische Philosophie zu rehabilitieren Ein wirkungsmächtiger Versuch Kants scheinbare mangelnde Betrachtung für politisch-konkrete Problemstellungen zu korrigieren, stammt von Hannah Arendt. Auch sie geht davon aus, dass Kants kleinere rechtsphilosophischen Schriften politiktheoretisch so gut wie bedeutungslos sind. So schreibt sie zum Beispiel, dass man bereits aus dem ironischen Ton in der Friedensschrift entnehmen kann, dass Kant seine bedeutendste politische Schrift nicht sehr ernst nahm.1058 Hannah Arendt sah allerdings darin keinen Grund sich von Kant endgültig abzuwenden, denn sie war der Überzeugung, dass die Kritik der Urtheilskraft eine eigenständige, fruchtbare politische Philosophie in sich birgt. In Anlehnung an Hannah Arendt haben verschiedenen Autoren wie zum Beispiel ihr Schüler Ernst Vollrath in Deutschland sowie Jean-François Lyotard und Alain Renault in Frankreich versucht, die Kritik der Urtheilskraft als Grundlage für Kants politische Philosophie zu erschließen, ohne jedoch Hannah Arendts Theorie wesentlich weiterzuentwickeln.1059 Diese verschiedenen Ansätze wurden in den letzten Jahrzehnten vielerlei diskutiert. Eine eingehende Darstellung dieser Diskussionen würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. An dieser Stelle reicht es aus festzuhalten, dass die reflektierende Urteilskraft sowie der Gemeinsinn auch unter politischen Gesichtspunkten von Bedeutung sein können. Das gleiche gilt ebenfalls für die von Jürgen-Eckardt Pleines vertretene These, dass auch Takt für das praktische Handeln von Bedeutung sein kann.1060 Zugleich soll jedoch daran erinnert werden, dass alle diese Ansätze bald an ihre Grenze stoßen, weil das für Kants Moral- und Rechtsphilosophie entscheidende Thema der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle in der Kritik der Urtheilskraft kaum vorkommt. Eine politische Philosophie, welche diese zentrale Thematik allzu unberücksichtigt lässt, kann allerdings schwerlich gänzlich überzeugen. Otfried Höffe zeigte sich in dieser Hinsicht durchgängig als der getreuere Kantianer. In einem bedeutenden Aufsatz aus dem Jahre 1990 ist es ihm weitgehend gelungen, den Stellenwert der Urteilskraft für Kants praktische Philosophie zu erhellen und ihr einen Platz innerhalb der universalistischen Moral zuzuweisen.1061 In Anlehnung an seine Arbeit wird hier davon ausgegangen, dass die Aufgabe der Politik in der Anwendung der allgemeinen Vernunftprinzipien auf die einzelnen Erfahrungsfälle besteht, und dass hierfür die bestimmende Urteilskraft gefragt ist. Kant hat jedoch keine Lehre von der 1057 Für eine Diskussion der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Phronesis und Urteilskraft soll auf die folgenden Beiträge verwiesen werden: Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechtsund Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 63ff; Ders.: Universalistische Ethik und Urteilskraft: ein aristotelischer Blick auf Kant, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 44, 1990, S. 537-563; Petersen, Thomas: Phronesis und Urteilskraft – antike und zeitgenössische politische Philosophie, in: Wege zur politischen Philosophie. Festschrift für Martin Sattler, hrsg. v. Gabrielle von Sivers und Ulrich Diehl, Würzburg 2005, S. 119-134. 1058 Vgl. Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, München/Zürich 1985 (besonders Lektüre 2 und 10). 1059 Vgl. Lyotard, Jean-François: L’enthousiasme. La critique kantienne de l’histoire, Paris 1986; Renault, Alain: Le système du droit. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte, Paris 1986 (insbesondere S. 99-114 und 201209); Vollrath, Ernst: Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft, Stuttgart 1977. 1060 Vgl. Pleines, Jürgen-Eckardt: Praxis und Vernunft. Zum Begriff praktischer Urteilskraft, Würzburg/ Amsterdam 1983. 1061 Vgl. Höffe, Otfried: Universalistische Ethik und Urteilskraft: ein aristotelischer Blick auf Kant, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 44, 1990, S. 537-563. - 195 - praktischen Urteilskraft entwickelt. Das Problem der Ausübung der Vernunftprinzipien hat er nur stückhaft und eher beiläufig behandelt. Mögliche Ansatzpunkte zu diesem Problem sind nicht primär in der dritten Kritik zu finden, sondern vielmehr in Kants moral- und rechtsphilosophischem Gesamtwerk. Seine Lehre von der Urteilskraft muss somit erst einmal rekonstruiert werden. Dieses Unternehmen wird jedoch dadurch erschwert, dass Kant scheinbar nur allmählich Klarheit über den systematischen Stellenwert der Urteilskraft innerhalb seiner Moral- und Rechtsphilosophie gewonnen hat. Die Tatsache, dass Kants explizite Behandlung der Urteilskraft in seinen moral- und rechtsphilosophischen Schriften eher marginal bleibt, hat lange noch nicht zu bedeuten, dass jene ganz ausgeblendet wird. Bereits in der Vorrede der Grundlegung zeigt sich, dass Kant sich dem Problem der Vermittlung von apriorischen Gesetzen und empirischer Praxis durchaus bewusst ist. Dort heißt es ausdrücklich und eindeutig, dass die moralischen Gesetze die „durch Erfahrung geschärfte Urtheilskraft erfordern“.1062 Im Anschluss daran schreibt Kant, dass der durch Erfahrung geschärften Urteilskraft eine doppelte Aufgabe zukommt. Sie wäre erforderlich, um teils zu unterscheiden, in welchen Fällen die Vernunftgesetze ihre Anwendung haben, und teils um ihnen Eingang in den Willen der Menschen und Nachdruck zur Ausübung zu verschaffen.1063 Des Weiteren führt Kant aus, dass die Urteilskraft deshalb unentbehrlich ist, weil der Wille des Menschen „der Idee einer praktischen reinen Vernunft zwar fähig, aber nicht so leicht vermögend ist, sie in seinem Lebenswandel in concreto wirksam zu machen“.1064 An dieser Stelle kann bereits festgehalten werden, dass bei Kant ausdrücklich gerade das betont wird, was man bei ihm zu vermissen glaubt, nämlich ein waches Bewusstsein für die Verknüpfung und den Übergang von seinen Vernunftprinzipien zu den Erfahrungsfällen. Für Kant scheint es selbstverständlich zu sein, dass wann immer die Ausübung der Vernunftprinzipien auf den Einzelfall gefordert wird, die Urteilskraft unentbehrlich ist. Angesichts der Tatsache, dass die Vorrede trotz ihrer Kürze so ausführlich auf die Bedeutung der Urteilskraft eingeht, mag es erstaunlich scheinen, dass die Behandlung dieser Thematik im weiteren Verlauf des Werkes sowie anschließend in den zwei Teilen der Metaphysik der Sitten so marginal ist.1065 Ein wahrscheinlicher Grund hierfür liegt darin, dass Kant in diese Werke rein apriorische Gesetze aufzustellen und zu begründen versucht, was ihn wiederum dazu bringt eindeutig zwischen empirischen und apriorischen Überlegungen zu unterscheiden.1066 Für die Urteilskraft gibt es hier keinen Platz. Der Verweis auf Kants Ansatz einer rein rational begründeten Ethik führt uns allerdings einen Schritt näher zum entscheidenden Argument. In der Grundlegung hat Kant auf der einen Seite gezeigt, dass die Entscheidung für das moralisch Gute unabhängig von jeglichen Erfahrungsbedingungen erfolgen soll. Auf der anderen Seite ist sich Kant dessen bewusst, dass das praktische Handeln eine Verknüpfung von den Vernunftprinzipien mit den Erfahrungsfällen erfordert. Dasselbe Vermögen, welches für das moralische Handeln erforderlich ist, um die Regel mit dem Einzelfall zu vermitteln, darf also nicht die Regel oder genauer die subjektiven Handlungsmaximen bestimmen. Dieses Problem wird von Kant umgegangen, indem er neben der erfahrungsgeschärften Urteilskraft ebenfalls eine erfahrungsunabhängige Urteilskraft anerkennt. Diese folgenreiche, dennoch lange wenig beachtete Unterscheidung scheint Kant selbst nur allmählich erkannt zu haben. In der 1062 GMS: IV, 389 (meine Hervorhebung) Vgl. GMS: IV, 389 1064 GMS: IV, 389 1065 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 67. 1066 Im zweiten Abschnitt der Grundlegung weist Kant beispielsweise ausdrücklich jede „vermischte Sittenlehre, die aus Triebfedern von Gefühlen und Neigungen und zugleich aus Vernunftbegriffen zusammengesetzt ist“ zurück (IV, 411). 1063 - 196 - Grundlegung ist lediglich von der erfahrungsabhängigen Form der Urteilskraft die Rede. Wie bereits gesehen wurde, wird jene als die „durch Erfahrung geschärfte Urtheilskraft“1067 bezeichnet. In der drei Jahren später erschienen Kritik der praktischen Vernunft wird aber bereits von Kant eingesehen, dass die Urteilskraft für das Gedankenexperiment der Verallgemeinerung erforderlich ist, und dass deren Verfahren ohne Widerspruch nicht erfahrungsabhängig sein kann. Dort wird die erfahrungsunabhängige Form der Urteilskraft von Kant als die „Urtheilskraft der reinen praktischen Vernunft“ oder schlicht als die „reine praktische Urtheilskraft“1068 bezeichnet. Die Konsequenz, dass nur die erfahrungsunabhängige Urteilskraft einen spezifisch moralischen Charakter besitzen kann, zieht Kant jedoch erst in der späten Religionsschrift.1069 Es bleibt der reinen praktischen Urteilskraft vorbehalten über das Moralische zu entscheiden. Durch diese Unterscheidung von der erfahrungsgeschärften und der erfahrungsunabhängigen Urteilskraft gelingt es Kant die absolute Verbindlichkeit universeller Vernunftprinzipien mit Einzelfallentscheidungen zusammen zu verknüpfen. Wie noch ausführlich zu sehen sein wird, entspricht dieser Unterscheidung eine notwendige Arbeitsteilung. Während die erfahrungsunabhängige Urteilskraft für die Beurteilung der Prinzipien der Moral zuständig ist, sorgt die erfahrungsabhängige Urteilskraft für die konkrete Erfüllung der Rechtspflichten. 2. Die Bedeutung der reinen praktischen Urteilskraft für die Beurteilung der Prinzipien der Moralität 2.1 Die Aufgabe der praktischen Urteilskraft Es wurde gesehen, dass Kant den Begriff der reinen praktischen Urteilskraft in der Kritik der praktischen Vernunft im Abschnitt »Von der Typik der reinen praktischen Urteilskraft« einführt. Erst ist der Religionsschrift wird ausdrücklich von der „moralische[n] Urtheilskraft“1070 gesprochen. Anhand der reinen praktischen Urteilskraft soll der allgemeine kategorische Imperativ auf die konkreten Handlungen angewandt werden. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich verschiedene Autoren vermehrt der Frage zugewandt, was Kant genau unter dem Begriff der „praktischen Urteilskraft“ bzw. der „moralischen Urteilskraft“ versteht.1071 In kritischer Auseinandersetzung mit der Literatur zu diesem Thema soll hier gezeigt werden, dass die Funktion der reinen praktischen, mithin moralischen Urteilskraft in der moralischen Beurteilung der Handlungsmaximen nach allgemeinen Prinzipien besteht. Kant spricht der Urteilskraft eine moralische Kompetenz zu. Es wird im Folgenden gezeigt, dass Kant in der zweiten Kritik eine Theorie der reinen praktischen Urteilskraft in ihren Grundzügen vorlegt. Er definiert zunächst die Aufgabe der praktischen Urteilskraft, dann die Schwierigkeiten, die sich bei der Erfüllung dieser Aufgabe stellen, und schließlich weist er auf eine Lösung dieser Schwierigkeiten hin. Im Folgenden soll auf diese drei Etappen des Kantischen Gedankengangs näher eingegangen werden. 1067 GMS: IV, 389 KpV: V, 68 1069 Vgl. Religion: VI, 186 1070 Religion: VI, 186 1071 Erwähnenswert sind hier vor allem die folgenden Beiträge: Höffe, Otfried: Universalistische Ethik und Urteilskraft: ein aristotelischer Blick auf Kant, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 44, 1990, S. 537563; Pleines, Jürgen-Eckardt: Praxis und Vernunft. Zum Begriff praktischer Urteilskraft, Würzburg 1983; Thurnherr, Urs: Urteilskraft und Anerkennung in der Ethik Immanuel Kants, in: Anerkennung. Eine philosophische Propädeutik. Festschrift für Annemarie Pieper, hrsg. v. Monika Hofmann- Riedinger und Urs Thurnherr, Freiburg 2001, S. 76-92. 1068 - 197 - Die Aufgabe der praktischen Urteilskraft liegt in der Unterscheidung, ob eine in der Sinnlichkeit mögliche Handlung ein Fall sei, welcher unter die praktische Regel der reinen Vernunft falle oder nicht.1072 Dies bedeutet mit anderen Worten, dass die praktische Urteilskraft für die Anwendung der allgemeinen praktischen Regel der reinen Vernunft auf konkrete empirische Handlungen zuständig ist. Mit dieser Aufgabenbestimmung ist die allgemeine Funktion der Urteilskraft, wie sie zuvor in der Kritik der reinen Vernunft als „das Vermögen unter Regeln zu subsumiren, d. i. zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel (casus datae legis) stehe, oder nicht“1073 angeführt wurde, für den Bereich der Praxis spezifiziert. Das „Etwas“, von dem zu unterscheiden ist, ob es unter einer gegebenen Regel stehe oder nicht, entspricht in der Praxis die in der Sinnlichkeit mögliche Handlung. Die „gegebene Regel“, unter die subsumiert werden soll, kann wiederum nur eine praktische Regel sein. Gemeint ist hier offenbar der allgemeine kategorische Imperativ als der oberste Grundsatz der Sittlichkeit, von welchem aus alle anderen Regeln ihren praktischen Charakter erhalten. Der grundsätzliche Unterschied zwischen der theoretischen und der praktischen Urteilskraft liegt also lediglich darin begründet, dass im Fall der praktischen Urteilskraft nicht die theoretische Ableitung von Sätzen, wie dies etwa bei einer logischen Schlussfolgerung geschieht, sondern die praktische Unterordnung einer möglichen empirischen Handlung unter eine abstrakte Regel verlangt wird. In der Aufgabenzuweisung der praktischen Urteilskraft wird die praktische Regel der reinen Vernunft, mithin der allgemeine kategorische Imperativ, mit den in der Sinnlichkeit möglichen Handlungen in Zusammenhang gesetzt. Die Anwendung der praktischen Regeln der reinen Vernunft auf die in der Erfahrung vorkommenden Fälle stößt jedoch auf besondere Schwierigkeiten, die auf den folgenden Seiten näher untersucht werden. Um diese Schwierigkeiten einerseits sowie den besonderen Stellenwert der „Typik der reinen praktischen Urteilskraft“ als Ausweg aus diesen Schwierigkeiten andererseits richtig verstehen zu können, soll zunächst kurz an Kants Überlegungen bezüglich der Dritten Antinomie in der Kritik der reinen Vernunft erinnert werden.1074 Die Dritte Antinomie der reinen Vernunft ist wie alle anderen Antinomien primär eine theoretisch-kosmologische Antinomie. Da sie sich auf den Gegensatz von Freiheits- und Naturkausalität bezieht, ist sie jedoch für die gesamte Ethik Kants von zentraler Bedeutung. Eine Antinomie besteht bekanntlich aus einem Widerstreit zwischen zwei Sätzen, die beide als wahr, richtig und beweisbar erscheinen. Im hier diskutierten Fall gibt es einen Widerspruch zwischen dem Gedanken der Kausalität aus Freiheit einerseits (Thesis) und jenem der Kausalität der Natur (Antithesis) andererseits. Die Antinomie besteht nun darin, dass sowohl die These als auch die Antithese, für sich als wahr und richtig erscheinen, was allerdings unmöglich ist, da sie sich gegenseitig widersprechen. Dem Gedanken der Kausalität aus Freiheit zufolge gibt es keine vollständige Determination, sondern die Begebenheiten in der Welt erfolgen teilweise als Wirkung einer spontanen ersten Ursache, welche selbst wiederum keine weitere sie bewirkende Ursache mehr hat. Dem Gedanken der Kausalität der Natur zufolge folgt dagegen alles was geschieht lediglich den Gesetzen der Natur. Die Kausalität nach Gesetzen der Natur zeichnet sich dadurch aus, dass jede Begebenheit in der Welt die notwendige Wirkung ihrer vorhergehenden Ursache ist. Sie ist somit als eine unendliche Abfolge von Ursachen und Wirkungen zu verstehen, in deren Rahmen es keine spontane erste Ursache geben kann, ohne damit die Gesetzmäßigkeit selbst aufzuheben. Die dritte Antinomie besteht somit aus einem frontalen Gegensatz zweier, sich scheinbar ausschließender Gesetzmäßigkeiten. In der Kritik der reinen Vernunft versucht Kant 1072 Vgl. KpV: V, 67 KrV: III, 131 (meine Hervorhebungen) 1074 Vgl. KrV: III, 308ff. 1073 - 198 - jedoch zu zeigen, dass es sich dabei lediglich um eine scheinbare Antinomie handelt, welche nur so lange besteht, als man dogmatisch spekuliert. Dementsprechend versucht er die „Möglichkeit der Causalität durch Freiheit in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der Naturnothwendigkeit“1075 zu beweisen. Um dies zu erreichen, trifft er eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen „Ding an sich“ und „Erscheinung“.1076 Mit dem Begriff des „Dinges an sich“ bezeichnet Kant die Wirklichkeit überhaupt, das heißt die Wirklichkeit wie sie unabhängig von aller Erfahrungsmöglichkeit an sich selbst besteht. Der Begriff der „Erscheinung“ bezeichnet dagegen die Wirklichkeit, wie sie sich in den Formen der Anschauung (Raum und Zeit) und des Verstandes (Kategorien) darstellt. An dieser Stelle ist dreierlei zu beachten. - Erstens: Diese Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung impliziert zunächst, dass die Art und Weise, wie die Menschen die Wirklichkeit anschauen, nicht dem Wesen der Wirklichkeit selbst entspricht. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Wirklichkeit, wie sie an sich besteht, und wie jene von den Menschen wahrgenommen wird. Mit anderen Worten könnte man sagen, dass die Art und Weise wie die Menschen die Wirklichkeit wahrnehmen von ihrer Beschaffenheit an sich selbst unterschieden ist. - Zweitens: Daraus folgt wiederum, dass die Dinge an sich in theoretischer Hinsicht unerkennbar sind. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass es von den Dingen an sich schlechterdings keine positive Erkenntnis der spekulativen Vernunft geben kann. Die Menschen können nicht erkennen, wie die Dinge an sich beschaffen sind, sondern lediglich wie jene ihre Sinne affizieren, also erscheinen. - Drittens: Die Erscheinungen sind allerdings bloße Vorstellungen, welche Ursachen haben müssen, die selbst nicht Erscheinungen sind. Wenn die Gegenstände der Sinne als Erscheinungen, mithin als bloße Vorstellungen definiert werden, so bedeutet dies, dass ihnen ein Ding an sich zugrunde liegt. Die Dinge an sich müssen somit als Grund der Erscheinungen angenommen werden können, obwohl es unmöglich ist ihr Wesen positiv zu bestimmen. Daraus ergibt sich, dass die Dinge an sich wenngleich theoretisch unerkennbar, doch ohne Widerspruch denkbar sind. Die Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung beschränkt sich nicht auf äußere Gegenstände. Kant unterscheidet auch an den menschlichen Handlungen einen empirischen und einen intelligiblen Charakter oder anders gesagt einen Charakter in der Erscheinung und einen Charakter des Ding an sich.1077 Der empirische Charakter zeichnet den Menschen als ein Naturwesen aus, während der intelligible Charakter den Menschen als ein mit praktischer Vernunft begabtes Wesen auszeichnet. Der empirische Charakter menschlicher Handlungen zeichnet sich genauer genommen dadurch aus, dass deren Wirkungen in ihrer sinnlichen Erscheinungsform als Teil der Natur durchgängig unter den Naturgesetzen stehen. Wie bereits gesehen wurde sind die Erscheinungen allerdings bloße Vorstellungen, welche Ursachen haben müssen, die selbst nicht Erscheinungen sind. Aus diesem Grund muss dem empirischen Charakter menschlicher Handlungen ebenfalls ein intelligibler Charakter zugrunde liegen. Dieser intelligible Charakter muss zumindest als denkbar eingeräumt werden. Der intelligible Charakter des Menschen entspricht dem Charakter des Menschen als Ding an sich, mithin als Verstandewesen. Dem intelligiblen Charakter der Handlung entsprechend ist es möglich die Wirkungen menschlicher Handlungen nicht bloß als determinierte Folge bloßer Naturkausalität, sondern ebenfalls als Wirkung einer Kausalität durch Freiheit, das heißt als Wirkung einer spontanen ersten Ursache, welche wiederum selbst keine Ursache mehr hat zu denken. Der intelligible Charakter ist nicht zu erkennen. Kant 1075 KrV: III, 366 Vgl. KrV: III, 202ff. 1077 Vgl. KrV: III, 366f. 1076 - 199 - betont wiederholt, dass es unmöglich ist, an sinnlich erscheinenden Handlungswirkungen die eigene Freiheit und die der anderen unmittelbar zu erkennen. Wichtig ist allerdings hier zu sehen, dass die erscheinenden Handlungswirkungen ohne Widerspruch als sinnliches Zeichen einer freien Ursache begriffen und anerkannt werden können. Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung zwischen einem intelligiblen und einem empirischen Charakter wird es möglich, Freiheits- und Naturkausalität als vereinbar zu denken: Durch seinen intelligiblen Charakter, als Ding an sich betrachtet, kann dem Mensch Freiheit zugesprochen werden, während alle seine Handlungen als Erscheinungen durchgängig den Naturgesetzen unterstehen. In diesem Sinne gibt es keinen Widerspruch zwischen dem Gedanken der Kausalität der Freiheit und dem Gedanken der Kausalität der Natur. Es kann widerspruchsfrei behauptet werden, dass der Mensch in sinnlicher Hinsicht dem Naturgesetz durchgängig unterworfen ist, dagegen in intelligibler Hinsicht frei ist. 2.2 Der Widersinn der praktischen Urteilskraft Die Unterscheidung von sinnlicher Welt (mundus sensibilis) und intelligibler Welt (mundus intelligibilis) ist eine große Schwierigkeit für die Urteilskraft. Das Problem der Vermittlung vom Intelligiblen zum Sinnlichen stellt sich für die Urteilskraft sowohl aus einer erkenntnistheoretischen Perspektive als auch aus einer praktischen Perspektive. In beiden Fällen ist die Urteilskraft gefragt: Einmal als Urteilskraft der reinen theoretischen Vernunft und einmal als Urteilskraft der reinen praktischen Vernunft. Für die Urteilskraft der reinen theoretischen Vernunft besteht das Problem darin, wie „reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen überhaupt angewandt werden können“.1078 In der ersten Kritik zeigt Kant, dass die Urteilskraft der reinen theoretischen Vernunft einer vermittelnden Vorstellung bedarf, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Das heißt, um die reinen Verstandesbegriffe mit den sinnlichen Anschauungen fallgerecht verknüpfen zu können, bedarf es einer vermittelnden Vorstellung. Diese reine vermittelnde Vorstellung, die einerseits intellektuell, andererseits sinnlich sein muss, wird von Kant als transzendentales Schema bezeichnet.1079 Eine eingehende Erörterung des transzendentalen Schemas würde von der hier diskutierten Problematik ablenken.1080 An dieser Stelle reicht es aus festzuhalten, dass das transzendentale Schema ein Verfahren ist, welches die fallgerechte Anwendung der reinen Verstandesbegriffe, also der Kategorien auf die Erscheinungen ermöglicht. Die angestrebte Vermittlung vom Sinnlichen und Intelligiblen kann jedoch im Falle der reinen praktischen Urteilskraft nicht in Form eines Schematismus erfolgen. Dies liegt darin begründet, dass die Bedingungen unter denen die reine praktische Urteilskraft ihre Aufgabe erfüllen muss, von jenen der reinen theoretischen Urteilskraft grundsätzlich unterschieden sind. Dies erklärt sich wiederum dadurch, dass das „sittlich Gute etwas dem Objecte nach Übersinnliches [ist], für das also in keiner sinnlichen Anschauung etwas Correspondirendes gefunden werden kann“.1081 Für Kant ist also das Sittlich-Gute ein Noumenon, mithin ein Übersinnliches. Es hat sich bereits gezeigt, dass es eine theoretische Erkenntnis vom Übersinnlichen nicht geben kann. Im Unterschied dazu gibt es jedoch eine praktische Erkenntnis vom Übersinnlichen. Gemeint ist der allgemeine kategorische Imperativ als der oberste Grundsatz der Kantischen Moralphilosophie. Jener fordert nur nach derjenigen Maxime zu handeln, durch welche die Menschen zugleich wollen können, dass sie 1078 KrV: III, 134 Vgl. KrV: III, 134 1080 Dazu siehe: Höffe, Otfried: Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie, München 2004, Kapitel 13. 1081 KpV: V, 68 1079 - 200 - ein allgemeines Gesetz werde.1082 In der Kritik der praktischen Vernunft führt Kant diesbezüglich aus, dass der allgemeine kategorische Imperativ ein Faktum der reinen Vernunft ist, welches „auf eine reine Verstandeswelt Anzeige giebt, ja diese sogar positiv bestimmt und uns etwas von ihr, nämlich ein Gesetz, erkennen läßt“.1083 In praktischer Hinsicht wird somit das Übersinnliche von einer denkmöglichen Idee zu einem notwendigen Postulat, weil die Möglichkeit des Sittlich-Guten bereits in der praktischen Regel der reinen Vernunft enthalten ist, deren Realität für Kant rational gar nicht bezweifelt werden kann.1084 Die Befolgung des allgemeinen kategorischen Imperativs lässt sich allerdings nicht unmittelbar in der phänomenalen Welt erkennen. Dort treten lediglich die Handlungen, nicht aber die Güte des Willens in Erscheinung. Der gute Wille, welcher allein ohne Einschränkung für sittlich gut gehalten werden kann, tritt niemals in Erscheinung. Er gehört ausschließlich der intelligiblen Welt an und ist damit für uns Menschen kein Gegenstand möglicher Erkenntnis. Nur die Legalität der Handlungen, nicht aber die Moralität der Gesinnung tritt in Erscheinung. Daraus folgt, dass keine sinnliche Anschauung das Sittlich-Gute in der phänomenalen Welt festhalten kann. Da sich der gute Wille nicht festhalten lässt, kann es ergo keine direkte Darstellung desselben geben. Die Schwierigkeit der praktischen Urteilskraft ergibt sich somit daraus, dass das Sittlich-Gute der intelligiblen Welt angehört, wogegen die Handlungen, welche dem allgemeinen Sittengesetz entspringen zur sinnlichen Welt gehören, ohne dass es möglich ist, jene auf ihre Moralität hin zu prüfen. Dies erklärt letztlich, weshalb die reine praktische Urteilskraft auf größere Schwierigkeiten stößt als es der Fall ist für die reine theoretische Urteilskraft. Die Aufgabe der reinen praktischen Urteilskraft besteht nämlich darin, den allgemeinen kategorischen Imperativ (mithin ein Gesetz der Freiheit) auf eine mögliche empirische Handlung (mithin ein Ereignis in der Natur) anzuwenden. Die reine praktische Urteilskraft muss, um es anders zu formulieren, den allgemeinen kategorischen Imperativ, welcher den Willen unabhängig von jeglichen empirischen Bedingungen zum Handeln bestimmt, auf die in der Erfahrung vorkommenden Fälle anwenden, welche wiederum den Naturgesetzen unterstehen. Auf den ersten Blick scheint es widersprüchlich menschliche Handlungen als empirische Vorkommnisse, die unter dem Naturgesetz stehen, als mögliche Fälle des allgemeinen kategorischen Imperativs anzusehen. Wie kann nämlich eine Handlung, welche in einem natürlichen Kausalnexus steht, als Fall der Selbstbestimmung durch apriorische Prinzipien, welche die bloße Form des Wollens betreffen, gelten? Die Aufgabe der praktischen Urteilskraft scheint außerhalb des Rahmens des Möglichen zu liegen, weil dabei zwei Welten, nämlich die phänomenale sowie die noumenale Welt, ins Verhältnis gesetzt werden sollen, in welchen zwei verschiedene, sich scheinbar ausschließende Gesetzmäßigkeiten am Werk sind. Kant erinnert in der Kritik der praktischen Vernunft an diese Schwierigkeit, als er zum folgenden Schluss kommt: „[S]o scheint es widersinnisch, in der Sinnenwelt einen Fall antreffen zu wollen, der, da er immer so fern nur unter dem Naturgesetze steht, doch die Anwendung eines Gesetzes der Freiheit auf sich verstattete, und auf welchen die übersinnliche Idee des sittlich Guten, das darin in concreto dargestellt werden soll, angewandt werden könne“.1085 Nichtsdestotrotz muss eine Überprüfung unserer Maxime möglich sein, denn sonst könnte die praktische Regel der reinen Vernunft nicht auf die konkreten Handlungen angewendet werden. 1082 Vgl. GMS: IV, 421 KpV: V, 43 (meine Hervorhebung) 1084 Vgl. KpV: V, 132 1085 KpV: V, 68 1083 - 201 - 2.3 Das Naturgesetz als Typus des Sittengesetzes Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen stellt sich die Frage, wie eine Vermittlung zwischen Freiheits- und Naturgesetz möglich ist. In der Kritik der praktischen Vernunft im Kapitel »Von der Typik der reinen praktischen Urteilskraft« zeigt Kant, dass die Idee des Sittlich-Guten und die empirisch vorkommenden Handlungen jeweils einen Gesetz unterstehen. Gemeint sind das Naturgesetz einerseits und das Freiheitsgesetz andererseits. Beide Gesetze sind zwar grundsätzlich unterschiedlich, haben jedoch eines gemeinsam: Die „Form der Gesetzmäßigkeit überhaupt“.1086 Mit anderen Worten hat dies zu bedeuten, dass das Naturgesetz und das Freiheitsgesetz die Form eines Gesetzes besitzen und in dieser Hinsicht vergleichbar sind. Sie sind zwar nicht inhaltlich, sondern bloß formal, mithin als Gesetze überhaupt, vergleichbar. Vor diesem Hintergrund spielt es keine Rolle woher die Gesetze ihre Bestimmungsgründe hernehmen.1087 Aus diesem Grunde ist es erlaubt, „die Natur der Sinnenwelt als Typus einer intelligibelen Natur zu brauchen“.1088 Mit Ernst Cassirers Worten könnte man sagen, dass das Naturgesetz in seiner gesetzmäßigen Form als „Vorbild“ für die Beurteilung des moralischen Handelns gilt.1089 Die Möglichkeit die phänomenale Natur als Typus der intelligiblen Natur zu benutzen ist allerdings an eine strikte Bedingung gebunden: Man darf die Anschauungen (und was davon abhängig ist) nicht auf die intelligible Welt übertragen, sondern allein die Form der Gesetzmäßigkeit überhaupt. Das Sittengesetz ist seiner Form nach ein Naturgesetz (jedoch nur der Form nach). Als solches kann das Sittengesetz der Urteilskraft unterliegen. Dieses der Form nach entsprechende Naturgesetz wird deswegen „Typus des Sittengesetzes“ genannt. Der Typus der reinen praktischen Urteilskraft wird von Kant folgendermaßen ausgedrückt: „Frage dich selbst, ob die Handlung, die du vorhast, wenn sie nach einem Gesetze der Natur, von der du selbst ein Theil wärest, geschehen sollte, sie du wohl, als durch deinen Willen möglich, ansehen könntest?“1090 Unmittelbar anschließend versichert Kant, dass diese Regel der Urteilskraft es einem jedem zu beurteilen erlaubt, ob eine Handlung sittlich-gut oder böse ist.1091 Der Typus bietet somit ein Verfahren zur moralischen Qualifikation der Handlungsmaximen und somit zur Erfüllung der Aufgabe der praktischen Urteilskraft an. Jenes lässt sich in zwei Schritte unterteilen. Der Mensch soll sich zunächst vorstellen, dass die Handlung, welche er vorhat, nach einem Gesetze der Natur geschieht. Entscheidend ist, wie es ferner im Text heißt: Diese „Vergleichung der Maxime seiner Handlungen mit einem Naturgesetzte“.1092 Was es heißen soll die Maximen seiner Handlungen mit einem Naturgesetze zu vergleichen, bedarf jedoch einer Erklärung, da Kant dies offen lässt. Wenn ein Naturgesetz als eine Abfolge von Ursachen und Wirkungen zu verstehen ist, dann hat dies zu bedeuten, dass beim Vorliegen gewisser Bedingungen, die als Ursache zu betrachten sind, eine bestimmte Wirkung notwendig folgen muss. Sind die Bedingungen strikt erfüllt, dann muss dieselbe Wirkung immer und überall zu beobachten sein. Wenn also ein Mensch eine beliebige Handlung vorhat, ist er zunächst dazu angehalten sich vorzustellen, dass alle anderen Menschen in der gleichen Situation wie er immer notwendig in derselben Art und Weise handeln werden, wie er sich selbst verhalten würde. Er muss annehmen, dass „ein jeder“1093 nach denselben Maximen wie den seinen handeln wird. 1086 KpV: V, 70 Vgl. KpV: V, 70 1088 KpV: V, 70 1089 Vgl. Cassirer, Ernst: Kants Leben und Lehre, Berlin, 1921, S. 276ff. 1090 KpV: V, 69 1091 Vgl. KpV: V, 69 1092 KpV: V, 69 1093 KpV: V, 69 1087 - 202 - In einem weiteren Schritt muss der handelnde Mensch auch wollen können, dass alle anderen Menschen sich so verhalten, wie er sich selbst verhalten würde. Er muss sich beispielsweise die Frage stellen, ob er mit jemand einverstanden sein könnte, wenn dieser betrügt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sich sein Leben nimmt, weil er dessen überdrüssig ist oder die Not anderer als gleichgültig ansähe. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der handelnde Mensch sich hier nicht mehr als isoliertes Individuum versteht, sondern sich selbst aus dem höheren Standpunkt der Gattung betrachtet. Dies hat unter anderem zu bedeuten, dass die Frage, ob der handelnde Mensch auch wollen kann, dass alle anderen Menschen nach denselben Maximen handeln wie den seinen, nicht nur aus der Ersten Person Perspektive beantwortet wird, sondern ebenfalls aus einer Perspektive, in welcher er nicht Akteur, sondern möglicher Betroffener ist. Dieser Perspektivenwechsel erlaubt es leicht festzustellen, ob man in Einstimmung mit einer Handlungsmaxime ist oder nicht. Der handelnde Mensch muss sich nur fragen, ob er damit einverstanden ist, betrogen zu werden oder wenn er sich im Notfall befindet von den Anderen mit Gleichgültigkeit behandelt zu werden. Es lässt sich leicht einsehen, dass kein Mensch eine Natur wollen kann, die nach diesen Gesetzen aufgestellt wäre. Der Typus der reinen praktischen Urteilskraft bietet somit ein Verfahren, welches es ermöglicht die Willens- und Handlungsmaxime der Menschen in der phänomenalen Welt auf ihre Moralität hin zu überprüfen. Der Typus darf allerdings nicht so verstanden werden, als würde ein jeder Mensch in dergleichen Situation tatsächlich nach derselben Maxime handeln. Er darf nicht als vorausgesetzte Tatsache gedeutet werden. Positiv formuliert hat dies zu bedeuten, dass der Typus als bloßes Gedankenexperiment oder als bloße Vorstellung zu verstehen ist. Jeder weiß nämlich, dass selbst wenn er heimlich betrügt, deswegen nicht jedermann betrügt, oder wenn er lieblos ist, ihn die Anderen deswegen auch lieblos behandeln. Die Menschen sehen sich hier dazu aufgefordert, die Maximen ihrer Handlungen mit einem allgemeinen Naturgesetz zu vergleichen. Vergleichen heißt in diesem Zusammenhang sich vorzustellen, ob die Maximen in Übereinstimmung mit einem Naturgesetz sein könnten. Übereinstimmung darf jedoch nicht mit Identität verwechselt werden. Der Typus und das Sittengesetz sind das gleiche (der Form der Gesetzmäßigkeit nach), jedoch nicht dasselbe. Der Unterschied vom Typus und Sittengesetz ist bereits an den von Kant verwendeten Verben festzuhalten. Während die Formulierungen des Sittengesetzes einen handlungsbestimmenden Charakter haben („handle so, daß...“), besitzt die Typik einen bloß interrogativen Charakter („frage Dich, ob...“). Mit der Formulierung „Frage dich, ob ...“ anstatt „Handle so, daß ...“ weist Kant deutlich darauf hin, dass das Freiheitsgesetz und das Naturgesetz grundsätzlich unterschiedlich sind, und dass beide nur in Bezug auf die Form ihrer Gesetzmäßigkeit überhaupt verglichen werden können.1094 In der Kritik der praktischen Vernunft schreibt Kant, dass das Naturgesetz als ein Typus der Beurteilung der Handlungsmaxime nach sittlichen Prinzipien gilt.1095 Dieser Typus kann jedoch keine endgültige Antwort in einem positiven Sinne auf die Frage nach dem moralischen Charakter der Handlungsmaximen bieten. In Kants eigenen Worten heißt es diesbezüglich: „Wenn die Maxime der Handlung nicht so beschaffen ist, daß sie an der Form eines Naturgesetzes überhaupt die Probe hält, so ist sie sittlich unmöglich“.1096 Dies bedeutet mit anderen Worten, dass nicht alle Handlungen, deren Maximen ohne Widerspruch mit einem Naturgesetz verglichen werden können, schon notwendig als sittlich-gut betrachtet werden können. Es gilt genau umgekehrt, dass alle Maximen, welche sich nicht als Naturgesetz vorstellen lassen, sittlich-unmöglich sind. Der 1094 Vgl. Pieper, Annemarie: Handlung, Freiheit und Entscheidung – Zur Dialektik der praktischen Urteilskraft, in: Pragmatik – Handbuch pragmatischen Denkens, hrsg. v. Herbert Stachowiak, Hamburg 1989, S. 90f. 1095 Vgl. KpV: V, 69 1096 KpV: V, 69f. (meine Hervorhebungen) - 203 - Typus ermöglicht es also nicht positiv zu bestimmen, was sittlich-gut ist. Er ermöglicht es nur jene Maximen auszuschließen, welche nicht zu einem allgemeinen Gesetz taugen. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Typus eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung der Sittlichkeit bereitstellt. Dies hat wiederum zu bedeuten, dass auch die Interpretation des Typus das Vermögen der Urteilskraft verlangt. Die Urteilskraft ist nämlich dann von Nöten, um jene Maxime zu identifizieren, die dem Typus zufolge zwar zulässig sind, dennoch aber nicht moralisch sind. Hierfür gibt es jedoch keine weitere Regel der Urteilskraft, welche die richtige moralische Qualifikation einer Maxime garantieren könnte. Daraus ergibt sich eine weitere wichtige Folge. In der Kritik der praktischen Vernunft schreibt Kant, dass selbst der gemeinste Verstand dem Typus nach urteilen kann, da das Naturgesetz jeglichen gewöhnlichen Urteilen und selbst den Erfahrungsurteilen zu Grunde liegt. Für Kant ist also jeder Mensch jederzeit in der Lage, die Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung einer beliebigen Maxime mit dem allgemeinen Sittengesetz zu erkennen: „Welche Form in der Maxime sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicke, welche nicht, das kann der gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterscheiden“.1097 Selbst dieser gemeinste Verstand hat die Möglichkeit das Naturgesetz bloß zum Typus eines Gesetzes der Freiheit zu machen. Dies bedeutet also, dass selbst dieser gemeinste Verstand urteilen kann, ob eine Maxime sittlich-unmöglich ist (negativ). Vor dem Hintergrund der obigen Erläuterungen muss jedoch festgehalten werden, dass dies noch nicht zu bedeuten hat, dass dieser gemeinste Verstand richtig urteilen kann, ob eine Maxime sittlich-gut ist (positiv) oder nicht. Dies liegt daran, dass dafür die Urteilskraft erforderlich ist, und jene sich hierfür nicht weiter an Regeln orientieren kann. Es hat sich bisher gezeigt, dass Kant im Abschnitt »Von der Typik der reinen praktischen Urteilskraft« die Bedingungen der Möglichkeit einer Vermittlung von intelligibler und sinnlicher Sphäre auf dem Feld der Praxis hervorgehoben hat. Jene sind insofern von zentraler Bedeutung, als sie den Aufgabenbereich der erfahrungsgeschärften Urteilskraft überhaupt erst konstituieren. Erst wenn in einer besonderen Situation einmal feststeht, worin die moralische Aufgabe besteht, stellt sich die weiterführende Frage nach der konkreten Erfüllung dieser Aufgabe. Die erfahrungsabhängige und erfahrungsunabhängige Urteilskraft stehen somit in einem Zusammenhang wechselseitiger Abhängigkeit: Es ist die erfahrungsunabhängige Urteilskraft, welche den Aufgabenbereich der erfahrungsabhängigen Urteilskraft erst konstituiert, aber es ist die erfahrungsabhängige Urteilskraft, welche für die konkrete Erfüllung der Rechtspflichten sorgt. Wie dies geschehen kann und wie viel Spielraum es dabei für Individualität gibt, soll nun in den folgenden Seiten näher erläutert werden. 3. Die Bedeutung der erfahrungsgeschärften Urteilskraft bei der Anwendung der Vernunftprinzipien Wie Otfried Höffe zu zeigen vermochte, vertritt Kant – freilich ohne es vollständig zu explizieren – eine Handlungstheorie, die sich in einen dreistufigen Beurteilungsprozess gliedern lässt. Aus der bildhaften Darstellung dieser drei Stufen ergibt sich das folgende Schema: 1097 KpV: V, 27 - 204 - Abbildung 5: Die drei Problemstufen einer fallgerechten Anwendung der Prinzipien des Rechts in der Wirklichkeit1098 Erste Stufe Zweite Stufe Dritte Stufe Das Problem der Identifikation einer moralischen Aufgabe Das Problem der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten - Das Problem der Art und Weise der Erfüllung - Das Problem des Maßes der Erfüllung - Das Problem der Prioritätssetzung - Das Problem des Adressatenkonflikts Das Problem der Abwägung einander entgegengesetzter Prinzipien 3.1 Das Problem der Identifikation einer moralischen Aufgabe Die erste Stufe ist jene der Identifikation einer moralischen Aufgabe. Es wurde bereits gesehen, dass die erste Funktion der Urteilskraft darin besteht zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel oder Gesetz stehe oder nicht. Ihr kommt also die Aufgabe zu eine konkrete Situation als individuellen Fall eines allgemeinen Situationstyps aufzufassen. So wird zum Beispiel die Situation einer Person, die sich ertränkt, als Notlage identifiziert. Wenn eine vorgegebene Situation als individueller Fall eines allgemeinen Situationstyps aufgefasst werden wird, dann muss zunächst eine Interpretationsleistung erbracht werden. Soll nämlich eine konkrete Situation unter eine Norm subsumiert werden, so bedarf diese Situation selbst in jedem Falle zunächst einer vorhergehenden Auslegung. Diese Identifikation ist weder zwingend noch eindeutig. Dies liegt unter anderem daran, dass es sich gelegentlich mehrere konkurrierende Regeln für die Regulierung eines Einzelfalls denken lassen. Das vorgeordnete und grundsätzlichere Problem besteht aber vielmehr darin, dass die Regelauswahl in einer besonderen Situation selbst nicht von einer anderen Regel bestimmt werden kann. Es gibt somit eine permanente Offenheit und damit verbunden eine unaufhebbare Unsicherheit bezüglich der im Einzelfall anwendbaren Regel. Weil niemals lückenlos demonstriert werden kann, dass eine besondere Situation unter eine allgemeine Regel fällt, ist selbst der gute Willen des Politikers im konkreten Fall nicht ausreichend, wenn er von seiner Urteilskraft einen schlechten Gebrauch macht. Dass diese Identifikation einer moralischen Aufgabe gar nicht so einfach ist, wie es zunächst erscheinen mag, lässt sich am Beispiel des fünften Präliminarartikels feststellen. Dort heißt es eindeutig und unmissverständlich: „Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern gewaltthätig einmischen“.1099 Im weiteren Verlauf des Textes führt Kant folgendermaßen fort: „Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete, deren jeder für sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze Anspruch macht; wo einem derselben Beistand zu leisten einem äußern Staat nicht für Einmischung in die Verfassung des andern (denn es ist alsdann Anarchie) angerechnet werden könnte“.1100 Ohne sich erneut diesem Artikel länger widmen zu wollen, muss jedoch festgehalten werden, dass allein die Identifikation einer gebotenen Handlung unter der Bedingung unvollständiger Information sowie unklarer räumlicher und zeitlicher Begrenzung eines Konflikts höchst kompliziert werden kann. Ein solches Beispiel zeigt uns den Spielraum für Interpretation, der sich bei der Identifikation einer moralischen Aufgabe ergibt. 1098 Systematische Skizze nach: Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 75ff. 1099 Frieden: VIII, 346 1100 Frieden: VIII, 346 - 205 - 3.2 Das Problem der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten Nachdem in einem ersten Schritt identifiziert wurde, zu welchem Oberbegriff eine Situation zählt, so müssen nun in einem zweiten Schritt die verschiedenen Handlungsoptionen dieser Lage identifiziert werden. Diese zweite Stufe ist jene der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten. Im zuvor erwähnten Beispiel eines hilfsbedürftigen Menschen sieht man sich mit einer einfachen Alternative konfrontiert: Entweder reagiert man auf die Notlage und versucht zu helfen, oder man geht nicht auf die Situation ein und lässt den Mann in der Notlage auf sich alleine gestellt. Wenn einmal die verschiedenen Handlungsoptionen in einer Lage identifiziert sind, so soll anschließend die Frage beantwortet werden, welche der zugrundeliegenden Handlungsmaximen der Rang des Moralischen gebührt. Für die letztgenannte Frage ist jedoch nicht länger die erfahrungsgeschärfte Urteilskraft zuständig, sondern allein die reine praktische Urteilskraft. Im zuvor erwähnten Beispiel der Notlage wurde das Problem der konkreten Erfüllung der Pflichten auf eine einfache Alternative (helfen oder nicht helfen) reduziert. In Wirklichkeit handelt es sich dabei jedoch um eine viel komplexe Frage. Wenn einmal identifiziert ist, worin die moralische Aufgabe besteht, dann stellen sich noch vier weitere Fragen. Die erste Frage ist jene nach der Art der Realisierung der moralischen Aufgaben. Wenn beispielsweise einmal identifiziert ist, dass im Nachbarstaat Anarchie herrscht und dass Menschen dort in humanitärer Not sind und dass somit unsere Hilfe geboten ist, dann bleibt noch zu entscheiden, mit welchen konkreten Mitteln die Hilfe geleistet werden kann. Dass dies in der Realität gar nicht so unproblematisch ist, lässt sich deutlich am Beispiel der zahlreichen Fehlentscheidungen erkennen, die man seit Ende des Zweiten Weltkrieges im Rahmen der Entwicklungshilfe1101 oder der sogenannten Peace-Keeping und Peace-BuildingMissionen in Kriegsregionen begangen hat.1102 Unter der Bedingung der Endlichkeit der vorhandenen Ressourcen steht der Politiker außerdem häufig vor der schmerzlichen Frage nach dem Maß der Realisierung. Die hier aufgeworfene Frage ist jene nach dem Umfang der Pflichterfüllung. Dieser Frage wurde sowohl von Kant selbst als auch von seinen vielen Kommentatoren erstaunlicherweise nur wenig Beachtung geschenkt. Erstere Ansätze zur Beantwortung dieser Frage lassen sich allerdings in der Tugendlehre finden, wo Kant die kasuistische Frage, wie weit man den Aufwand seines Vermögens im Wohltun treiben soll folgendermaßen antwortet: „Doch wohl nicht bis dahin, daß man zuletzt selbst Anderer Wohlthätigkeit bedürftig würde“.1103 Weil die eigenen Fähigkeiten sowie die moralisch gebotenen Handlungen stets variieren, lässt es sich leicht einsehen, dass nur die Urteilskraft in situ über den angemessenen Umfang der Pflichterfüllung entscheiden kann. Wichtig ist lediglich hier zu sehen, dass der Umfang der Pflichterfüllung nicht als uneingeschränkt gedacht werden kann. Eine uneingeschränkte Hilfeleistung im Zusammenhang mit einer humanitären Krise zum Beispiel würde jede zur Hilfeleistung fähige Person auf Dauer in einen Zustand versetzen, in welchem sie selbst auf die Hilfeleistung anderer Personen angewiesen wäre. Die Schaffung eines derartigen Zustandes, in welchem eine jede Person auf die Hilfe Anderer angewiesen ist, ist jedoch mit dem Prinzip der Selbstständigkeit einer jeden Person nicht vereinbar und sollte deshalb vermieden werden. Selbst wenn die Tugendpflichten verbindlich sind, ist die konkrete 1101 Eine gute Darstellung und kritische Würdigung von den Möglichkeiten und Grenzen der bisherigen entwicklungspolitischen Strategien bietet der folgende Band: Rauch, Theo: Entwicklungspolitik: Theorien, Strategien, Instrumente, Braunschweig 2009. 1102 Eine statistisch fundierte Darstellung der hemmenden wie fördernden Faktoren der Friedenssicherung und konsolidierung bietet der folgende Band: Doyle, Michael W. / Sambanis, Nicholas: Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations, Princeton 2006. 1103 TL: VI, 454 - 206 - Erfüllung dieser Pflichten nicht unbedingt uneingeschränkt. Bei der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Realität soll also der Politiker stets auf die Verhältnismäßigkeit seines Handelns achten. Diese Aufgabe liegt allein im Ermessen des Politikers, der sich dabei nicht an formulierten Regeln orientieren kann. Dies gilt zum Beispiel für die Sozialpolitik, die den Staat zu betreiben berechtigt ist, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft andauernd zu sichern. Im Gemeinspruch heißt es diesbezüglich: „Wenn die oberste Macht Gesetze giebt, die zunächst auf die Glückseligkeit […] gerichtet sind: so geschieht dieses […] bloß als Mittel, den rechtlichen Zustand vornehmlich gegen äußere Feinde des Volks zu sichern. Hierüber muß das Staatsoberhaupt befugt sein, selbst und allein zu urtheilen, ob dergleichen zum Flor des gemeinen Wesens gehöre, welcher erforderlich ist, um seine Stärke und Festigkeit sowohl innerlich, als wider äußere Feinde, zu sichern“.1104 Die zwei letzten Fragen, welche die Urteilskraft zu beantworten hat, beziehen sich auf den Fall eines Adressatenkonflikts und auf die Prioritätensetzung. Die hier aufgeworfene, umfassendere Frage ist jene nach der Vorrangigkeit und Dringlichkeit. In der interrogativen Form heißt es etwa: Gegenüber welchen Personengruppen und in welcher Rangfolge ist das Hilfsgebot zu erfüllen? Der erfahrungsabhängigen Urteilskraft kommt hier die Rolle zu darüber zu entscheiden, welche Zielgruppe unter mehreren möglichen vorzuziehen sei. Es sei hier festgehalten, dass dem moralischen Politiker ein nicht zu unterschätzender Spielraum bei der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten zukommt, ohne allerdings den Vernunftprinzipien Abbruch zu tun. 3.3 Das Problem der Abwägung einander entgegengesetzter Prinzipien Auf der dritten Stufe kommt der Urteilskraft die Rolle zu, einander entgegengesetzte Prinzipien abzuwägen und Prinzipienkonflikte aufzulösen. Zwei Möglichkeiten sind hier grundsätzlich denkbar: Das Problem der Prinzipienabwägung ergibt sich entweder, wenn es einen Konflikt zwischen verschiedenen Rechtspflichten oder zwischen verschiedenen Tugendpflichten gibt (interner-Pflichtenkonflikt), oder wenn es einen Konflikt zwischen einer Rechtspflicht und einer Tugendpflicht gibt (intra-Pflichtenkonflikt). In einer gegebenen Situation kann es nämlich vorkommen, dass einander entgegengesetzte Rechts- und Tugendpflichten einzuhalten sind, oder dass innerhalb einer Rechtspflicht mehrere Prinzipien gefragt sind, die in jeweils unterschiedliche Richtungen weisen. Die Frage, die sich vor diesem Hintergrund stellt, ist wie die Prinzipienabwägung geschehen kann und wie viel Freiraum dem moralischen Politiker dabei zukommt. Abbildung 6: Pflichtenkonflikte InternerPflichtenkonflikt Intra-Pflichtenkonflikt Konflikt zwischen verschiedenen Rechtspflichten Konflikt zwischen verschiedenen Tugendpflichten Konflikt zwischen einer Rechtspflicht und einer Tugendpflicht Wie im nächsten Kapitel noch ausführlicher zu sehen sein wird, argumentiert Kant, dass es keinen Widerstreit der Pflichten geben kann. Um einen Widerstreit der Pflichten zu vermeiden, ist die Urteilskraft aber auf Prioritätsregeln angewiesen. Eine erste Prioritätsregel, um einen intra-Pflichtenkonflikt zu vermeiden, besteht in dem Vorrang der vollkommenen Rechtspflichten vor den unvollkommenen Tugendpflichten. Ein zweites Instrumentarium, auf welches die Urteilskraft zurückgreifen kann, um eine Pflichtkollision zu vermeiden, sind die 1104 Gemeinspruch: VIII, 298 - 207 - sogenannten „Erlaubnißgesetze der Vernunft“1105, die einen provisorischen Aufschub bezüglich der Ausübung einer Pflicht erlauben. Auf diesen Punkt soll im weiteren Verlauf der vorliegenden Dissertation noch näher eingegangen werden. Ein weiterer Fall, in welchem die erfahrungsgeschärfte Urteilskraft gefragt ist, um einander entgegengesetzte Rechtsprinzipien abzuwägen, ist die Notlage. Kant widmet sich dem Problem der Notlage und des sogenannten Notrechts im »Anhang zur Einleitung in die Rechtslehre«. Die Tatsache, dass Kant sich diesem Problem im Anhang und nicht in der Einleitung selbst widmet, ist an sich bereits aussagekräftig: Während er im Haupttext der Einleitung auf den Rechtsbegriff eingeht, behandelt er im Anhang zwei von ihm als zweideutig bezeichnete Rechte. Gemeint sind die Billigkeit einerseits und das Notrecht andererseits, „von denen die erste ein Recht ohne Zwang, das zweite einen Zwang ohne Recht annimmt“.1106 Erklärungsbedürftig ist nun, was unter dem Begriff des Notrechts zu verstehen ist und warum es sich dabei für Kant nicht um ein eigentliches Recht handelt. Unter dem Begriff des Notrechts verstehen viele Autoren ganz allgemein eine durch die Not bedingte und somit berechtigte Rechtsverletzung. Es lässt sich jedoch leicht einsehen, dass die Rechtslehre widersprüchlich wäre, wenn es ein Recht gäbe, das im Fall der Gefahr des Verlustes seines eigenen Lebens einem Anderen, der uns nichts zuleide täte, das Leben zu nehmen. Für Kant ist kein Mensch berechtigt in die Freiheitssphäre eines anderen Menschen einzugreifen, um einer bloß vermuteten, zukünftigen Gefahr zuvorzukommen. Es ist dagegen erlaubt einem „ungerechten Angreifer auf mein Leben [...] durch Beraubung des seinen zuvor[zu]kommen“.1107 Erlaubt ist also eine Reaktion auf einen ungerechten, unmittelbar bevorstehenden Eingriff in die eigene Freiheitssphäre. In seinen Reflexionen aus dem Nachlass schreibt Kant sogar, dass das Notwehrrecht das „heiligste[ ] Recht“1108 des Menschen ist. Das Notwehrrecht ist jedoch kein eigentliches Recht, weil es sich auf Situationen bezieht, in welchen kein Richter aufgestellt werden kann. Nun kommen wir zu dem für uns entscheidenden Punkt: In seiner Reaktion auf einen fremden Eingriff in die eigene Freiheitssphäre ist jeder Mensch zu einer gewissen „Mäßigung“ aufgefordert. Zur Mäßigung der Ausübung des Notwehrrechts kann mich aber kein juridisches, sondern allein ein ethisches Gesetz anhalten. Dieses ethische Gesetz spricht überdies keine „Verpflichtung“ sondern bloß eine „Anempfehlung“1109 aus. Kants Ausführungen lassen außerdem die Frage weitgehend unbeantwortet, was unter dem Ausdruck der „Mäßigung“ überhaupt zu verstehen sei. Es wurde bereits gesehen, dass für Kant der Rückgriff auf Zwang nur zur Sicherung und Wiederherstellung der Freiheitssphäre eines jeden Menschen zulässig ist. Der Zwang darf deshalb nicht weiter ausgeübt werden, als dies zur Wiederherstellung der verletzten Freiheitssphäre notwendig ist. Damit wird jedoch noch nicht bestimmt, welche Form die ethisch empfohlene Mäßigung annehmen soll. Wichtig ist hier zu sehen, dass lediglich die Urteilskraft über die gewünschte Mäßigung entscheiden kann. Auch im Falle des Notrechts bedarf es also einer komplexen Urteilkompetenz. Zunächst einmal muss die Lage als Notlage identifiziert werden. Nach diesem ersten Schritt stellt sich die Frage, ob die eingesetzten Mittel geeignet und erforderlich sind, um den Zweck der Selbstverteidigung zu erfüllen. Gefragt ist somit, ob es alternative, mildere Mittel gibt, welche denselben Erfolg mit derselben Sicherheit erbringen könnten. Unter der Bedingung der ethisch anempfohlenen Mäßigung der Verteidigungsmaßnahmen stellt sich außerdem die Frage, ob der Zweck und die eingesetzten Mittel in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. 1105 Frieden: VIII, 373 RL: VI, 234 1107 RL: VI, 235 (meine Hervorhebung) 1108 Reflexion 7195: XIX, 269 1109 RL: VI, 235 1106 - 208 - Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es Kant weitgehend gelungen ist, universale Rechtsprinzipien zu begründen, die trotzdem für die Urteilskraft offen bleiben. Nun soll im folgenden Abschnitt gezeigt werden, dass die absolute Verbindlichkeit universeller Vernunftprinzipien sehr wohl mit individuellen Einzelfallentscheidungen aufgrund pragmatischer Überlegungen vereinbar ist. 4. Die Vereinbarkeit von absoluter Verbindlichkeit universeller Vernunftprinzipien und individuellen Einzelfallentscheidungen 4.1 Die fallgerechte Anwendung der Vernunftprinzipien als eine kontextabhängige und kreative Kompetenz In der Sekundärliteratur wird die Aufgabe der bestimmenden Urteilskraft vereinfachend als Subsumtionsleistung definiert. In der Tat besteht ihre Funktion darin, zu unterscheiden, ob eine besondere Handlung unter einer gegebenen Regel stehe oder nicht. Im vorherigen Teil wurde allerdings angedeutet, dass es sich dabei um eine viel komplexere und ergebnisoffene Aufgabe handelt als häufig angenommen. Ganz allgemein kann behauptet werden, dass die Anwendung der Vernunftprinzipien zunächst eine Kontextualisierung der Sicht- und Vorgehensweise erfordert. Darunter ist zu verstehen, dass der moralische Politiker sein Handeln stets vor dem Hintergrund eines vorgegebenen Kontexts einschätzen soll. Er darf die vorgegebene Lage, in welcher er sich befindet, nicht schlichtweg ignorieren und die Vernunftprinzipien blind anwenden. Der moralische Politiker soll sich vielmehr mit der Umwelt in Verbindung setzten. Zur erfolgreichen Anwendung der Vernunftgesetze in der Wirklichkeit muss er in hohem Maße die Fähigkeit zur Kontextualisierung erwerben und sein Verhalten an die besonderen Aspekte des Einzelfalls anpassen können. Der moralische Politiker muss die Vernunftprinzipien in Zusammenhang mit den konkreten, jeweils unterschiedlichen Lebenssituationen stellen können. Wie soll dies aber genau geschehen? Der Politiker muss zunächst eine vorsichtige Situationsanalyse durchführen. Das heißt er muss sorgfältig die Lage analysieren, in welcher er sich befindet, und in welcher er die Vernunftprinzipien anwenden soll. Diese Situationsanalyse lässt sich in verschiedene Unterstufen gliedern. Der Politiker muss zunächst die verschiedenen Hindernisse, welche sich auftun könnten, identifizieren und nach ihrer Wahrscheinlichkeit und Gefährlichkeit einordnen. Im Anschluss daran muss er verschiedene Handlungsoptionen im Einklang mit dem allgemeinen Sittengesetz entwickeln und gewichten. Die lang- sowie kurzfristigen Vor- und Nachteile einer jeden Handlungsoption müssen mit Blick auf den gesetzten Zweck und unter Berücksichtigung der identifizierten Hindernisse geprüft und ausbalanciert werden. Eine solche Abwägung ermöglicht die differenzierende Berücksichtigung der Besonderheiten jeder konkreten Situation sowie ein zielgerichtetes Handeln. Die Anwendung der Vernunftgesetze beinhaltet somit auch die Vergegenwärtigung der Folgen des Handelns. Dieser Feststellung steht der beliebte Vorwurf entgegen, dass es innerhalb Kants praktischer Philosophie keinen Platz für Folgenüberlegungen gäbe. Der Spielraum für Erfahrung und Individualität ist auch deshalb größer als zunächst angenommen werden könnte, weil der politisch Handelnde in vielen Fällen nicht einfach die relativ beste Lösung unter mehreren bereits vorgegebenen Handlungsoptionen wählen muss, sondern vielmehr selber neue Mittel und Wege finden muss.1110 Der politisch Handelnde hat die für seine Ziele in Betracht kommenden Handlungsentwürfe zunächst erst selbst zu entwickeln. Insofern ist das Problem der Anwendung der Vernunftgesetze eine kreative Leistung. Weil die Mittel und Wege zur konkreten Erfüllung der Rechtspflichten nicht 1110 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 79. - 209 - bestimmt werden können, enthält die Urteilskraft einen Platz für Kreativität, da sie im Urteil Neues und Unvorhersehbares hervorbringt. An dieser Stelle soll noch kurz darauf aufmerksam gemacht werden, dass der eben skizzierte Spielraum bei der Anwendung der Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle sowohl für die unvollkommenen Tugendpflichten als auch für die vollkommenen Rechtspflichten gilt. Damit wird nicht bestritten, dass der Spielraum bei der Anwendung der unvollkommenen Tugendpflichten größer ist als jener der vollkommenen Rechtspflichten. Dies liegt darin begründet, dass die unvollkommenen Pflichten sich nicht direkt auf einzelne Handlungen beziehen, sondern lediglich die Maxime der Handlung betreffen. Auf diese Art und Weise lassen sie einen größeren Spielraum bei deren Befolgung zu. Dieser Spielraum darf allerdings nicht als „eine Erlaubniß zu Ausnahmen von der Maxime der Handlung“ verstanden werden, sondern nur als die „der Einschränkung einer Pflichtmaxime durch die andere (z. B. die allgemeine Nächstenliebe durch die Elternliebe) […], wodurch in der That das Feld für die Tugendpraxis erweitert“1111 werde. Damit soll allerdings nicht übersehen werden, dass selbst bei den vollkommenen Rechtspflichten nicht immer bestimmt werden kann, wie jene konkret erfüllt werden sollen. Auch – und vielleicht vor allem – die Erfüllung der Rechtspflichten benötigt eine vorsichtige Situationsanalyse, eine Kontextualisierung der Sicht- und Vorgehensweise sowie der handlungsinternen Folgenüberlegungen. Es ist Otfried Höffe zuzustimmen, wenn er schreibt, dass „selbst die vollkommenen Pflichten insoweit unvollkommen [sind], als sie die Art und Weise, sie zu erfüllen, nicht mitdefinieren“.1112 Es ist zum Beispiel eine vollkommene Rechtspflicht für den Politiker die Staatsverfassung nach den Prinzipien der Freiheit, der Abhängigkeit und der Gleichheit zu gestalten. Die Art und Weise wie diese Prinzipien im Einzelnen zu bewahren sind, kann dagegen nicht mitbestimmt werden. Der Spielraum betrifft etwa den gewählten Augenblick der möglichen Reformen, ihre Geschwindigkeit sowie ihren Umfang (etwa schrittweise und beschränkte Reformen oder umfassende Reformen) als auch ihren konkreten Inhalt (etwa Mehrheitswahlsysteme oder Verhältniswahlsysteme). Die fallgerechte Anwendung der Vernunftprinzipien erfordert vom moralischen Politiker die besonnene Rücksicht auf das Gegebene und Mögliche, wobei ein sicheres Gespür für Macht und das Machtbare unerlässlich ist. Es zeigt sich hier, dass Kants Moral- und Rechtsphilosophie dem Mensch nicht von seinem Ermessen bezüglich des moralischen Handelns zu befreien versucht. Dies führt wiederum dazu, dass die Legalität und Moralität menschlicher Handlungen bei der Anwendung der Vernunftprinzipien immer gefährdet ist, weil sie nicht von einem falschen Gebrauch der Urteilskraft sicher sein kann. 4.2 Die zwei Fallklassen möglich auftretender Anwendungsfehler Es hat sich gezeigt, dass dem moralischen Politiker bei der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten systembedingt ein nicht zu unterschätzender Ermessensspielraum zukommt. Dieser Ermessensspielraum kann jedoch zu ungewünschten Ergebnissen führen. Für die konkrete Erfüllung der Rechtspflichten lassen sich zwei Fallklassen von möglich auftretenden Fehlern unterscheiden. Gemeint sind einerseits eine Ermessensfehlgewichtgung sowie ein Nichtgebrauch des zustehenden Ermessenspielraums andererseits. Was unter diesen beiden Begriffen zu verstehen ist, darauf soll im Folgenden näher eingegangen werden. 1111 TL: VI, 390 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 80. 1112 - 210 - a) Das Risiko der Ermessensfehlgewichtung Es wurde bereits gesehen, dass sich der Politiker für die konkrete Erfüllung der Rechtspflichten nicht gänzlich auf Regeln beruhen kann, sondern eine vor- und umsichtige Situationsanalyse durchführen muss. Dies bedeutet, dass er immer erst die Lage analysieren muss, in welcher er sich befindet, und in welcher er die Vernunftprinzipien anwenden soll. Das Verfahren der Urteilskraft muss dabei nicht unbedingt willkürlich sein, sondern kann sich an verschiedenen Kriterien orientieren. Gemeint wären im Beispiel des Hilfsgebotes etwa die Anzahl der Hilfsbedürftigen, die Größe ihrer Not, die eigenen Hilfskapazitäten, die Zugänglichkeit zu den Hilfsbedürftigen, oder die Ersetzbarkeit der Hilfeleistung.1113 Es kann allerdings vorkommen, dass wesentliche Umstände von dem Politiker nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. Bestimmte Umstände können entweder über- oder unterbewertet (etwa die Not einer bestimmten Menschengruppe im Vergleich zu einer anderen) oder schlicht nicht berücksichtigt werden. Wenn bestimmte Situationsmerkmale gegenüber anderen zu stark gewichtet werden, dann kann dies zu suboptimalen Ergebnissen führen. Das erste Problem, welches sich also für den Politiker ergibt, wenn es um die Frage nach dem Maß der Realisierung, der Prioritätensetzung und des Adressatenkonflikts geht, besteht in einer Ermessensfehlgewichtung. Dieses Problem ist für die Politik besonders ernst zu nehmen. Wie bereits gesehen wurde, besteht ihre Aufgabe darin, die allgemeinen Rechtsprinzipien auf die Erfahrungsfälle anzuwenden. Die Politik ist somit per definitionem eine Sphäre des praktischen Handelns. Der Politiker kann sich die Situation niemals auswählen, in welcher sein Handeln erforderlich ist, da er sich bereits in der Situation befindet. Er kann sich der Notwendigkeit des Handelns nicht entziehen, weil selbst die Entscheidung sich nicht zu entscheiden, dem Wesen nach, eine Entscheidung ist. Das Entscheiden und das Handeln verfügen somit über einen unausweichlichen Charakter. Der Politiker muss Entscheidungen treffen und seinen Entscheidungen entsprechend handeln. Durch seine Entscheidungen gestaltet er wiederum die Wirklichkeit. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die positiven sowie negativen Folgen seines Tuns und Lassens sich nicht auf seine eigene Person beschränken, sondern auch für eine Vielzahl von Menschen Folgen haben. Das Risiko einer Ermessensfehlgewichtung wird dadurch erhöht, dass der Politiker unter einem unaufhebbaren Zeitdruck steht. Aus diesem Grund kann er die Situation, in welcher sein Handeln gefordert wird, niemals ganz durchschauen und muss daher seine Entscheidungen zumeist unter Unsicherheit treffen. Diese Merkmale zusammen genommen unterscheiden die Politik als Sphäre des Handelns grundsätzlich von der Philosophie als Sphäre des Erkennens. Die Politik steht unter anderen Bedingungen als die Philosophie. Anders als der Handelnde kann sich der Erkennende die Situation auswählen, welche er zum Gegenstand seiner Reflexionen machen möchte. Diese Situation kann er nachträglich und im Besitz aller dafür notwendigen Informationen beurteilen. Vor diesem Hintergrund lässt sich leicht einsehen, dass die Urteilskraft für den politisch Handelnden vielmehr von Nöten und daher von viel größerer Bedeutung ist als für den Erkennenden. b) Das Risiko unberücksichtigter Ermessensspielräume Das zweite Problem, welches bei der konkreten Erfüllung der Rechtspflichten auftreten kann, ist jenes eines Nichtgebrauchs des zustehenden Ermessenspielraums. Von einem Nichtgebrauch des zustehenden Ermessenspielraums kann erst dann die Rede sein, wenn der Politiker das ihm zustehende Ermessen bei der Anwendung der Vernunftprinzipien 1113 Vgl. Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 79. - 211 - auf die Erfahrungsfälle gar nicht ausübt. Es handelt sich dabei um eine Form selbstverschuldeter Situationsblindheit, weil der Politiker von sich aus dem ihm tatsächlich zustehenden Freiraum gar nicht nützt und die Vernunftprinzipien undifferenziert anwendet. Der Nichtgebrauch des zustehenden Ermessenspielraums ist von einer unverschuldeten Reduktion des Ermessenspielraums auf null (zum Beispiel aufgrund fehlender bzw. verspäteter Informationen) zu unterscheiden. Im letzterwähnten Fall kann der Politiker aufgrund externer Faktoren von dem Ermessenspielraum, welcher ihm anderweitig zugestanden wäre, keinen kompletten Gebrauch machen. In der Friedensschrift betont Kant die zentrale Rolle der Klugheit und der erfahrungsgeschärften Urteilskraft und erkennt sogar mittelbar eine Eigenständigkeit der Politik an, wenn er schreibt, dass Politik nicht bloß in Moral aufgehen darf. In Kants eigenen Worten heißt es, dass der moralische Politiker kein sogenannter „despotisierende[r] Moralist[]“1114 sein darf. Ein solcher wäre er nämlich dann, wenn er wider aller Staatsklugheit die Prinzipien des Rechts ohne Rücksicht auf die politischen Umstände und unbeachtet der möglichen Folgen vollziehen würde. In diesem Fall könnte man von einem Nichtgebrauch des zustehenden Ermessenspielraums sprechen, da der Politiker das ihm zustehende Ermessen gar nicht nutzt. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass er in einer bestimmten Situation (wie etwa bei der Abschaffung des stehenden Herres) gar nicht erkennt, dass ihm überhaupt ein Ermessen zusteht. Es kann aber auch darauf zurückzuführen sein, dass der Politiker sich folgenblind dafür entscheidet, die Vernunftprinzipien anzuwenden, gleichwohl, wie die Folgen sein könnten. Diese Form von moralischer Situationsblindheit wird von Kant verworfen. In der Friedensschrift richtet Kant seine Kritik vornehmlich gegen den politischen Moralisten. Er erwähnt den despotisierenden Moralisten dagegen nur beiläufig. Dies liegt darin begründet, dass Kant davon ausgeht, dass nach wiederholten Misserfolgen der despotisierende Moralist allmählich von selbst lernen wird und klüger wird. Im Wortlaut Kants heißt es: „Es mag also immer sein, daß die despotisirende (in der Ausübung fehlende) Moralisten wider die Staatsklugheit (durch übereilt genommene oder angepriesene Maßregeln) mannigfaltig verstoßen, so muß sie doch die Erfahrung, bei diesem ihrem Verstoß wider die Natur nach und nach in ein besseres Gleis bringen“.1115 Der politische Moralist stellt dagegen eine verschleierte und somit vergleichsweise viel ernstzunehmendere Gefahr dar, weil sie „durch Beschönigung rechtswidriger Staatsprincipien unter dem Vorwande einer des Guten nach der Idee, wie sie die Vernunft vorschreibt, nicht fähigen menschlichen Natur, so viel an ihnen ist, das Besserwerden unmöglich machen und die Rechtsverletzung verewigen“.1116 Der politische Moralist ist nichts anderes als ein unmoralischer Opportunist, welcher durch sein Handeln den Fortschritt zum Besseren blockiert, der ansonsten Wirklichkeit werden könnte. 4.3 Die Urteilskraft als ein nicht lehrbares, jedoch durch Erfahrung zu verbesserndes Vermögen Weil die konkrete Anwendung der Vernunftgesetze sich nicht vollständig in Regeln fassen lässt, gibt es eine permanente und unaufhebbare Offenheit bezüglich der einzusetzenden Mittel. Selbst für einen welterfahrenen Politiker sind allerdings die zu erwartenden Vor- und Nachteile seiner Handlungen schwer einzuschätzen, denn „es erfordert einen guten Kopf, um sich aus dem Gedränge von Gründen und Gegengründen herauszuwickeln und sich in der Zusammenrechnung nicht zu betrügen“.1117 Aus der 1114 Frieden: VIII, 373 Frieden: VIII, 373 1116 Frieden: VIII, 373 1117 Gemeinspruch: VIII, 287 1115 - 212 - strukturellen Offenheit bei der Anwendung der Vernunftgesetze ergibt sich also die Gefahr des Irrtums: Selbst eine geübte und erfahrene Urteilskraft kann dem Politiker niemals garantieren, keine Irrtümer zu begehen. Die Güte des Willens reicht nicht aus, um moralisch zu handeln, weil jede Regel falsch angewandt werden kann, wenn die Menschen einen schlechten Gebrauch ihrer Urteilskraft machen. Die Frage, die es vor diesem Hintergrund zu beantworten gilt, besteht darin, ob die Urteilskraft wenigsten lehrbar und erlernbar ist. Mit anderen Worten könnte es heißen: Kann die Urteilskraft überhaupt kultiviert werden? In der Kritik der reinen Vernunft führt Kant ernsthafte Bedenken diesbezüglich an: „Der Mangel an Urtheilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt, und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen. Ein stumpfer oder eingeschränkter Kopf, dem es an nichts, als an gehörigem Grade des Verstandes und eigenen Begriffen desselben mangelt, ist durch Erlernung sehr wohl, sogar bis zur Gelehrsamkeit auszurüsten. Da es aber gemeiniglich alsdann auch an jener […] zu fehlen pflegt, so ist es nichts Ungewöhnliches, sehr gelehrte Männer anzutreffen, die im Gebrauche ihrer Wissenschaft jenen nie zu bessernden Mangel häufig blicken lassen”.1118 Kant stellt hier ernüchternd fest, dass der Mangel an Urteilskraft, den er als „Dummheit“ bezeichnet, angeboren ist und nicht ausgebessert werden kann. Ferner im Text schreibt er, dass die Urteilskraft „ein besonderes Talent sei, welches gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will. Daher ist diese auch das Specifische des so genannten Mutterwitzes, dessen Mangel keine Schule ersetzen kann“.1119 Für Kant ist die Urteilskraft eine besondere „Naturgabe“1120, also ein besonders Talent, welches von Natur aus gegeben ist und also nicht erworben werden kann. Diese pessimistische Sichtweise nuanciert er jedoch in seinen späteren moralphilosophischen Werken. Insbesondere in der Grundlegung führt Kant eindeutig aus, dass die Urteilskraft durch Erfahrung geschärft werden kann.1121 Die Urteilskraft ist für ihn eine besondere Tauglichkeit, welche prinzipiell nicht erlernt, sondern nur durch praktische Erfahrungen geübt werden kann.1122 Es handelt sich nicht um ein Wissen, das sich vermitteln lässt, das heißt, das man durch eine gelehrte Person ein für allemal erlernen könnte, sondern eher um ein Können. Dieses Können kann man wiederum lediglich durch eigene Erfahrung und Übung erwerben und nur allmählich ausbauen. Unbeantwortet bleibt weiterhin die Frage, warum die Urteilskraft nicht lehrbar ist und sich lediglich durch eigene Erfahrung erwerben lässt. Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Eine Lehre der Urteilskraft könnte nur Regeln lehren, welche wiederum notwendig an dem Problem ihrer Anwendung ihre Grenze finden würden. Eine Lehre der Urteilskraft würde somit an dem Problem des unendlichen Regelregresses scheitern. Dieses Problem wird von Kant klar gesehen. In der Anthropologie heißt es diesbezüglich: „Sollte es [...] Lehren für die Urtheilskraft geben, so müßte es allgemeine Regeln geben, nach welchen man unterscheiden könnte, ob etwas der Fall der Regel sein oder nicht: welches eine Rückfrage ins Unendliche abgiebt“.1123 An dieser Stelle ist es wichtig sich klar zu machen, dass die Funktion der Urteilskraft darin besteht zu unterscheiden, in welchen jeweils unterschiedlichen Fällen die Vernunftgesetze anzuwenden sind. Die Urteilskraft bezieht sich somit auf Situationen, die niemals gleich sind und weder notwendig noch unmöglich sind. Ihr Gegenstand ist somit jener der Kontingenz und des Unvorhersehbaren. Weil die Situationen, über welche die Urteilskraft zu entscheiden hat, immer variieren und auch anders sein könnten, wie sie tatsächlich sind, kann das Verfahren und das Ergebnis der Urteilskraft nicht von vornherein festgelegt sein. Im Unterschied zu einer jeden Wissenschaft, die ihr Wissen explizit in 1118 KrV: III, 132 KrV: III, 131 1120 KrV: III, 132 1121 Vgl. GMS: IV, 389 1122 Vgl. GMS: IV, 389; Gemeinspruch: VIII, 275; Anthropologie: VII, 199 1123 Anthropologie: VII, 120; Vgl. auch KUK: V, 169 1119 - 213 - Propositionen ausdrücken kann, kann das Verfahren und das Ergebnis der Urteilskraft nicht ein für allemal stringent demonstriert werden. Die Erkenntnisse der Urteilskraft lassen sich nicht durch Propositionen ausdrücken. Der Versuch die Urteilskraft in Propositionen zu fassen, ist zum Scheitern verurteilt, weil ihr Gegenstand jener der Zufälligkeit und des Unabsehbaren ist. Eine interessante Konsequenz, welche sich daraus ergibt, ist, dass ein spezifisches Fachwissen nicht ausreicht, um zu wissen, ob eine Situation als Fall eines allgemeinen Situationstyps aufgefasst werden kann. So schreibt Kant folgendes dazu: „Ein Arzt daher, ein Richter, oder ein Staatskundiger kann viel schöne pathologische, juristische oder politische Regeln im Kopfe haben in dem Grade, daß er selbst darin gründlicher Lehrer werden kann, und wird dennoch in der Anwendung derselben leicht verstoßen, entweder, weil es ihm an natürlicher Urtheilskraft (obgleich nicht am Verstande) mangelt, und er zwar das Allgemeine in abstracto einsehen, aber ob ein Fall in concreto darunter gehöre, nicht unterscheiden kann, oder auch darum weil er nicht genug durch Beispiele und wirkliche Geschäfte zu diesem Urtheile abgerichtet worden“.1124 Auch für die Politik ist somit Erfahrung wichtiger als Fachwissen allein. Selbst wer einen guten Verstand und gute Fachkenntnisse hat, verfügt nicht notwendigerweise über die Fähigkeit von ihnen auf angemessene Weise Gebrauch zu machen. In der Idee schreibt Kant dazu, dass zu der richtigen Erkenntnis der Vernunftprinzipien und zum erforderlichen guten Willen vor allem noch eine „durch viel Weltläufe geübte Erfahrenheit“1125 erforderlich ist. Die Tatsache, dass die Urteilskraft nicht lehrbar, sondern kontextgebunden ist, reicht aus, um den Vorwurf zu entkräften, dass Kants Ethik im Allgemeinen und seiner Rechtslehre im Speziellen individualitätsfeindlich und kontextblind sei. Das individuelle Vermögen fallgerecht die Anwendung des moralischen Gesetzes zu beurteilen ist im Gegenteil für die Kantische Ethik von ganz zentraler Bedeutung. Abschließend zu diesem Kapitel kann festgehalten werden, dass Kant in der Friedensschrift der Urteilskraft eine weitaus wichtigere Rolle einräumt, als man durch eine zu flüchtige Lektüre annehmen könnte. Diese bestimmt weder das Material noch die Form, sorgt jedoch für die fallgerechte Anwendung der Prinzipien des Rechts. Die wichtige Funktion, welche die Urteilskraft innerhalb Kants Friedenstheorie einnimmt, zeigt nicht nur exemplarisch, dass Kant ein reiches Bewusstsein für den Übergang zwischen den apriorischen Prinzipien des Rechts und der empirischen Realität hatte, sondern zeigt zugleich, wie ungereimt es ist, Kant vorzuwerfen, er unterscheide nicht zwischen Recht und Politik oder reduziere die Politik auf einen bloßen Verwaltungsprozess, ohne Rücksicht auf konkrete Situationen und auf die Individualität des politisch Handelnden. Die Politik bewegt sich in einem Rahmen, welcher verbindlich von der Moral und dem Recht vorgeschrieben wird. Innerhalb dieses verbindlichen Rahmens steht aber der Politik die Entscheidung über Mittel und Wege frei. Im etymologischen Sinne des Wortes kann man somit nicht von einer Autonomie der Politik sprechen. Autonomie bedeutet Selbstgesetzgebung. Davon kann aber nicht die Rede sein. Die Politik ist kein autonomes Handlungsfeld, welches sich seine Regeln selber geben kann, wohl aber ein Feld, innerhalb welches dem Politiker ein Freiraum für eigenständige Entscheidungen bleibt. Deshalb kann in diesem Zusammenhang von Eigenständigkeit der Politik gesprochen werden. Diese These steht der lang verbreiteten Geringschätzung der Friedensschrift durch die Sekundärliteratur entgegen. Sie berichtigt die allgemeine Ansicht, dass die Friedensschrift lediglich für seine vernunftrechtliche Konzeption einer Weltfriedensordnung von Bedeutung ist. In Anlehnung an die Arbeiten von Volker Gerhardt und Otfried Höffe wurde hier gezeigt, dass es einerseits abwegig ist, wenn man wie Hannah Arendt behauptet, dass die 1124 1125 KrV: III, 132 Idee: VIII, 23 - 214 - Friedensschrift politiktheoretisch unerheblich ist, weil sie so viel Ironie enthalte, und andererseits dass es entschieden zu wenig ist, wenn man wie Georg Geismann die Friedensschrift lediglich als Rechtstheorie vom Weltfrieden begreife. 5. Über das Verhältnis von Philosophie und Politik bei Kant Kant fügt in die zweite Auflage der Friedensschrift von 1796 einen zweiten Zusatz unter der Überschrift »Geheimer Artikel zum ewigen Frieden« ein. Gegen die nicht nur damals vorherrschende Geheimdiplomatie stellt Kant zwei Forderungen auf, welche die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens förderlich sein sollen. Die erste Forderung besteht darin, dass man den Philosophen ein Recht auf freie und öffentliche Meinungsäußerung gewähren soll. Für Kant soll der Staat den Philosophen „frei und öffentlich über die allgemeine Maximen der Kriegsführung und Friedensstiftung reden lassen“.1126 Eine staatliche Ermutigung dazu ist gar nicht nötig, da die Philosophen, dies schon von selbst tun werden, wenn man es ihnen nur nicht verbietet.1127 Es reicht also aus, dass es keine staatliche Aufsicht oder Zensur gibt, also dass man die „Freiheit der Feder“1128 garantiert, damit die Philosophen von selbst ihrer „Verpflichtung durch allgemeine (moralisch gesetzgebende) Menschenvernunft“1129 nachkommen. Was Kant hier fordert, ist nichts anderes als seine bereits in der Aufklärungsschrift von 1784 formulierte Forderung, „von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen“.1130 Die zweite Forderung des geheimen Artikels zum ewigen Frieden lautet: „Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rathe gezogen werden“.1131 Das hier von Kant vorgetragene Argument lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Wenn man den Frieden wirklich will, dann ist es pragmatisch geboten (Kant selbst schreibt: „sehr ratsam“) auf das zu hören, was die Philosophen bezüglich der Grundsätze des Staats-, Völker- und Weltbürgerrechts zu sagen haben. Die zweite Forderung geht also weiter als die erste. Was Kant hier fordert, ist nicht mehr nur, dass man die Philosophen uneingeschränkt „sprechen“ lässt, sondern sogar, dass man auf sie „höre“. Mit diesen beiden Forderungen trägt Kant zu einer neuen Bestimmung des Verhältnisses von Politik und Philosophie bei. Der (zunächst unerwähnte) Bezugspunkt der Diskussion ist dabei Platons sogenannte Philosophen-König-Satz, wonach Philosophen regieren müssen, wenn der Staat wohlgeordnet und glücklich sein soll: „Wenn nicht [...] entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten oder die jetzt so genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren und also dieses beides zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, […] eher gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten“.1132 Selbst wenn das platonische Ideal einer Philosophen-Herrschaft über Jahrhunderte hinweg breite Zustimmung unter den Philosophen fand, ist es nicht alternativlos geblieben. Im Unterschied zu Platon z. B. schreibt bereits Aristoteles, dass der Philosoph nicht selbst die Herrschaft ausüben soll und dass der Politiker auf den Philosophen hören soll: „Philosophie zu treiben ist für einen König nicht nur nicht notwendig, sondern sogar hinderlich; dagegen soll er auf wirkliche Philosophen hören und ihnen folgen“.1133 1126 Frieden: VIII, 369 Vgl. Frieden: VIII, 369 1128 Gemeinspruch: VIII, 304 1129 Frieden: VIII, 369 1130 Aufklärung: VIII, 36 (meine Hervorhebungen) 1131 Frieden: VIII, 368 1132 Platon: Der Staat, übersetzt von Friedrich Schleiermacher, Berlin 1828, 473 1133 Aristoteles: Das Königtum, übersetzt von Wilhelm Nestle, Stuttgart 1977, S. 76. 1127 - 215 - Im zweiten Zusatz schließt sich Kant also Aristoteles an. Er lehnt nämlich sowohl eine sich in der Person des Philosophenkönigs ergebende Einheit von Philosophie und Politik, als auch eine komplette Trennung der beiden Bereiche ab. Kant spricht sich viel mehr für eine Arbeitsteilung von Philosophie und Politik unter dem Primat der ersteren aus. Er beschränkt dabei die philosophische Tätigkeit auf die Bestimmung der Vernunftprinzipien des Rechts und überlässt die Anwendung derselben auf vorkommende Erfahrungsfälle vollständig dem Politiker. Es gibt somit eine Eigenständigkeit der beiden Bereiche. Politik und Philosophie dürfen nicht (wie bei Platon) zusammenfallen, sondern haben jeweils eine eigenständige Leistung zu erbringen. Zu Recht schreibt Volker Gerhardt, dass Kant „jeder Personalunion zwischen Philosophie und Politik eine kompromißlose Absage erteilt“.1134 Eine solche Personalunion wird von Kant nicht nur als unwahrscheinlich, sondern auch als unerwünscht abgelehnt. Kants Antwort auf den Philosophen-König-Satz heißt dementsprechend: „Daß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen: weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernunft unvermeidlich verdirbt“.1135 Im Unterschied zu Platon, für den die Philosophenkönige sich nicht korrumpieren lassen1136, würde Kants zufolge eine zu enge Verwicklung der Philosophen in den konkreten politischen Tätigkeiten ihre Unabhängigkeit und Objektivität beeinträchtigen.1137 Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass Kant Zweifel nicht nur an der Möglichkeit des platonischen Ideals einer Identität von Politik und Philosophie sondern auch an ihrer Wünschbarkeit erhebt. Für Kant verdirbt der Besitz der Gewalt das freie Urteil der Vernunft. Nur weil sie von der Macht unabhängig bleiben, können die Philosophen als die „natürlichen Verkündiger und Ausleger“1138 der Vernunftprinzipien des Rechts bezeichnet werden. Dies erklärt auch warum Kant darauf verzichtet, den Philosophen Sonderrechte und eine Sonderstellung im Staat zuzuerkennen. Es kommt nicht einmal in Frage, dass der „Staat den Grundsätzen des Philosophen vor den Aussprüchen des Juristen (des Stellvertreters der Staatsmacht) den Vorzug einräumen müsse“.1139 Philosophen sind (der Idee nach) nur Anwälte der allgemeinen Menschenvernunft. Ihr Vorteil ist, so Kants weitere Erläuterung, dass sie „ihrer Natur nach der Rottirung und Clubbenverbündung unfähig“1140 sind. Die Tatsache, dass Philosophie und Politik zwei eigenständige Bereiche sind, hat nicht zu bedeuten, dass sie getrennt voneinander bestehen müssen. Es gibt für Kant nicht nur eine Vereinbarkeit von Philosophie und Politik, sondern vor allem eine Komplementarität. Politik und Philosophie sind sowohl im Hinblick 1134 Gerhardt, Volker: Der Thronverzicht der Philosophie: Über das moderne Verhältnis von Philosophie und Politik bei Kant, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 180. 1135 Frieden: VIII, 369 1136 Platon: Der Staat, 484a ff. 1137 Weil die Nähe zur Macht das freie Urteil verdirbt, sollen sich die „Gelehrten“ bzw. Philosophen, wie Kant an Kiesewetter in Oktober 1795 schreibt, nicht „mit den Politikern vom Handwerk verbrüdern“ (Briefe: XII, 45). 1138 Streit: VII, 89 1139 Frieden: VIII, 369 1140 Frieden: VIII, 369; Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die scharfen Kritiken, die Kant gegen die Juristen ausübt. Im zweiten Zusatz der Friedensschrift spricht Kant den Juristen die Fähigkeit ab wahrhaft unabhängig zu urteilen: „Der [Jurist], der die Wage des Rechts und nebenbei auch das Schwert der Gerechtigkeit sich zum Symbol gemacht hat, bedient sich gemeiniglich des letzteren, nicht um etwa blos alle fremde Einflüsse von dem ersteren abzuhalten, sondern wenn die eine Schale nicht sinken will, das Schwert mit hinein zu legen (vae victis), wozu der Jurist, der nicht zugleich (auch der Moralität nach) Philosoph ist, die größte Versuchung hat“ (369). Wenige Seiten danach erklärt Kant: „Statt der Praxis, deren sich diese staatskluge Männer rühmen, gehen sie mit Praktiken um, indem sie blos darauf bedacht sind, dadurch, daß sie der jetzt herrschenden Gewalt zum Munde reden (um ihren Privatvortheil nicht zu verfehlen), das Volk und womöglich die ganze Welt preis zu geben“ (373). Kant spricht hier den Juristen die Fähigkeit ab, wahrhaft unabhängig zu urteilen. Ihnen fehlt die dafür notwendige Urteilsfreiheit. - 216 - auf ihre jeweiligen Aufgaben als auch im Hinblick auf die dafür erforderlichen Kompetenzen unterschieden und komplementär. Politik und Philosophie sind aufeinander angewiesen. Kant grenzt den Aufgabenbereich der Philosophen ein. Ihre Kompetenz erstreckt sich lediglich auf den begrenzten, aber grundlegenden Anteil. Gemeint ist die Bestimmung der Vernunftprinzipien des Rechts. Die Kompetenz der Philosophen erstreckt sich jedoch nicht auf das komplementäre Problem der Anwendung jener Vernunftprinzipien auf die Erfahrungsfälle. Die Kompetenz, die von den Philosophen für die Bestimmung der Vernunftprinzipien gefordert ist, ist das „freie Urtheil der Vernunft“.1141 Die Kompetenz, die von den Politikern für die Anwendung der Vernunftprinzipien erforderlich ist, ist wiederum die Urteilskraft. Weil von den Philosophen und Politikern jeweils andere Kompetenzen gefragt sind, kann nicht angenommen werden, dass gute Philosophen auch gute Politiker sind. Entgegen einer „lichtscheuen Politik“1142 versucht Kant zu zeigen, dass es im wohlverstandenen Eigeninteresse der Politik ist, die Philosophen uneingeschränkt reden zu lassen. Es ist sowohl der Philosophie als auch der Politik von Nutzen, wenn man den Philosophen frei und öffentlich sprechen lässt. Das geforderte Recht auf freie Meinungsäußerung ist „beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrlich“.1143 Das Recht auf freie Meinungsäußerung soll nämlich kontradiktorische Debatten ermöglichen und somit helfen allmählich größere Klarheit bezüglich der wahren Grundsätze der Kriegführung und Friedensstiftung zu gewinnen. Dies lässt wiederum auch eine Annäherung an das angestrebte Ziel des allgemeinen Friedens hoffen, wenn sich die friedenswilligen Politiker in ihren Verhalten an diesen Grundsätze orientieren. In der ersten Kritik heißt es in diesem Sinne: „Zu dieser Freiheit [des Vernunftgebrauchs; F. R.] gehört denn auch die, seine Gedanken, seine Zweifel, die man sich nicht selbst auflösen kann, öffentlich zur Beurtheilung auszustellen […] Dies liegt schon in dem ursprünglichen Rechte der menschlichen Vernunft, welche keinen anderen Richter erkennt, als selbst wiederum die allgemeine Menschenvernunft, worin ein jeder seine Stimme hat; und da von dieser alle Besserung, deren unser Zustand fähig ist, herkommen muß, so ist ein solches Recht heilig und darf nicht geschmälert werden“.1144 Es ist dem Denken über den Frieden sowie dem Fortschritt zu demselben förderlich, wenn dieses Denken öffentlich und ohne Einschränkung geschieht. Abschließend soll noch die Frage beantwortet werden, was genau unter den von Kant erwähnten Philosophen zu verstehen ist. Im zweiten Zusatz scheint Kant zunächst das Recht auf freie Meinungsäußerung nur für die Philosophen zu fordern. Diese Forderung lässt sich allerdings nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe einschränken. Sie bezieht sich viel mehr auf alle Menschen, die fähig sind an den philosophischen Debatten teilzunehmen. Während für Platon nur sehr wenige Menschen zur Philosophie fähig sind, genügt bei Kant die „allgemeine Menschenvernunft, worin ein jeder seine Stimme hat“.1145 Otfried Höffe fasst dies folgendermaßen zusammen: „An die Stelle von Platons Aristokratie des Geistes […] tritt also eine Demokratie der Vernunft“.1146 Hier bestätigt sich, das was bereits zuvor gesehen wurde: Kant erwartet die Schaffung eines Zustandes des Weltfriedens nicht allein vom Handeln des moralischen Politikers sondern auch von unten hinauf durch die Aufklärung des Volks. Kant erwartet den Frieden nicht von einem „philosophierenden König“, sondern aus den „königliche[n] Völker[n]“.1147 Zu Recht stellt Volker Gerhardt folgendes fest: „Dass nicht die 1141 Frieden: VIII, 369 Frieden: VIII, 386 1143 Frieden: VIII, 369 1144 KrV: III, 492 (meine Hervorhebungen) 1145 KrV: III, 492 (meine Hervorhebung) 1146 Höffe, Otfried: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001, S. 176. 1147 Vgl. Frieden: VIII, 369 1142 - 217 - Philosophen, sondern die Volker selbst zu Königen werden – das ist die unüberbietbare Hoffnung, die Kant Platon entgegensetzt“.1148 1148 Gerhardt, Volker: Der Thronverzicht der Philosophie: Über das moderne Verhältnis von Philosophie und Politik bei Kant, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 191. Vgl. auch: Schneiders, Werner: Philosophenkönige und königliche Völker. Modelle philosophischer Politik bei Platon und Kant, in: Filosofia Oggi 2, 1981, S. 165-175. - 218 - 3. KAPITEL: DAS PROBLEM DER WIDERSPRUCHSFREIEN ANWENDUNG RECHTSPRINZIPIEN IN DER POLITISCHEN WIRKLICHKEIT DER APRIORISCHEN Im vorherigen Kapitel wurde der systematische Stellenwert der Urteilskraft innerhalb Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden ausgiebig diskutiert. Es hat sich dabei gezeigt, dass Kant nebst der rein rationalen Begründung der Rechtsprinzipien sich ebenfalls dem komplementären Problem der Anwendung derselben Prinzipien auf die Erfahrungsfälle widmet. Es wurde außerdem gesehen, dass Kant eine Handlungstheorie vertritt, die sich in einen dreistufigen Beurteilungsprozess gliedern lässt. Zur Erinnerung seien hier die drei Problemstufen einer fallgerechten Anwendung der Prinzipien des Rechts in der Wirklichkeit kurz wieder aufgeführt. Gemeint sind erstens die Identifikation einer moralischen Aufgabe, dann die konkrete Pflichterfüllung und letztlich die Abwägung einander entgegengesetzter Prinzipien. Die ersten beiden Problemstufen wurden im letzten Kapitel ausführlich erläutert und diskutiert. Es hat sich dabei herausgestellt, dass Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden die absolute Verbindlichkeit universeller Rechtsprinzipien mit einem nicht zu unterschätzenden Spielraum für Politik bezüglich ihrer konkreten Anwendung auf die Einzelfälle verbindet. Auf die dritte Stufe wurde dagegen nur flüchtig eingegangen. Die zuvor vorgetragenen Ausführungen beschränkten sich dabei vornehmlich auf das Problem des Notrechts. In der Sekundärliteratur wird zumeist davon ausgegangen, dass Kants Antwort auf das Problem des Pflichtenkonflikts und jenes der Abwägung zwischen den widerstreitenden Pflichten unzureichend ist. Es wurde bereits kurz darauf hingewiesen, dass Kant die Möglichkeit einer Kollision von Pflichten ausdrücklich ausschließt. Kants Argumentation bezüglich der Unmöglichkeit von Pflichtenkonflikten hat vor allem in der angelsächsischen Sekundärliteratur viele Diskussionen ausgelöst aber nur wenig Zustimmung gefunden.1149 In den gegenwärtigen Diskussionen wird zumeist davon ausgegangen, dass Pflichtenkonflikte unvermeidbar sind. Nicht selten wird die Unvermeidbarkeit von Pflichtenkonflikten sogar als die Grenze einer jeden deontologischen Ethik angesehen. Pflichtenkonflikte beziehen sich auf Situationen, in welchen die Menschen zu Handlungen verpflichtet sind, welche für sich selbst möglich, jedoch nicht zugleich durchführbar sind. Dies bedeutet, dass die Erfüllung der einen Pflicht notwendig mit der Unterlassung oder sogar der Verletzung einer anderen Pflicht einhergeht. Es wurde bereits gesehen, dass solche Pflichtenkonflikte vorliegen können, wenn in einer gegebenen Situation einander entgegengesetzte Rechts- und Tugendpflichten einzuhalten sind (intraPflichtenkonflikt) oder wenn für die Erfüllung einer besonderen Rechtspflicht mehrere Handlungen gefragt sind, die in jeweils unterschiedliche Richtungen weisen (internerPflichtenkonflikt). Im Gegensatz zu einem großen Teil der Literatur soll im Folgen gezeigt werden, dass Kant zwei stichhaltige theoretische Instrumente entwickelt hat, auf welche die Urteilskraft zurückgreifen kann, um mögliche Prinzipienkonflikte zu vermeiden. In diesem Kapitel geht es darum, die zwei zuvor erwähnten Möglichkeiten von Prinzipienkonflikten und die Auswege davon exemplarisch zu erläutern und kritisch zu diskutieren. Entsprechend gliedert sich dieses Kapitel in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt behandelt das viel diskutierte Problem der intra-Pflichtenkollision am Beispiel Kants 1149 Um nur einige Beispiele zu erwähnen: Donagan, Alan: Consistency in Rationalist Moral Systems, in: Moral Dilemmas, hrsg. v. Christopher W. Gowans, Oxford 1987, S. 271-290; Gowans, Christopher W.: Innocence Lost: An Examination of Inescapable Moral Wrongdoing, Oxford 1994, insbesondere S. 187ff.; Guyer, Paul: Kant‘s System of Nature and Freedom. Selected Essays, Oxford 2005; Hill, Thomas E.: Moral Dilemmas, Gaps and Residues: A Kantian Perspective’, in: Moral Dilemmas and Moral Theory, hrsg. v. H. E. Mason, Oxford 1996, S. 167-198; Nussbaum, Martha C.: The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Part II, Cambridge 2001, S. 31 ff.; O’Neill, Onora: Instituting Principles: Between Duty and Action, in: Kant’s Metaphysics of Morals: Interpretative Essays, hrsg. v. Mark Timmons, Oxford 2002, S. 331-347; Sullivan, Roger J.: Immanuel Kant's Moral Theory, Cambridge 1989, insbesondere S. 73ff. - 219 - rechtsphilosophischer Erörterung der Lüge (1). Diesbezüglich wird häufig behauptet, dass hier offenbar einen Widerstreit der Pflichten vorliegt, da eine Rechtspflicht (das Lügenverbot) und eine Tugendpflicht (das Hilfsgebot) sich gegenseitig ausschließen, obwohl beiden Notwendigkeit zukommt. Es soll dabei insbesondere auf Kants Begründung der absoluten Vorrangstellung der vollkommenen Rechtspflichten vor den unvollkommenen Tugendpflichten eingegangen werden. Der zweite und abschließende Abschnitt behandelt seinerseits das ebenso viel diskutierte Problem des internen-Pflichtenkonflikts (2). Er untersucht Kants Begründung der Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft am Beispiel des dritten Präliminarartikels, wobei sich zeigen wird, dass Kant in der Friedensschrift der Politik einen Freiraum zugesteht, der selbst auf einen vernunftrechtlichen Grund zurückgeht. 1. Das Problem der Pflichtenkollision am Beispiel Kants rechtsphilosophischer Erörterung der Lüge Kaum eine andere moral- und rechtsphilosophische These Kants hat eine derart verbreitete Ablehnung hervorgerufen wie die mehrmals wiederholte Behauptung man müsse in seinen Aussagen immer und unter allen Umständen wahrhaftig sein. Für Kant gibt es eine absolute Pflicht zur Wahrhaftigkeit, die keine Ausnahme zulässt, selbst dann nicht, wenn man durch eine Lüge die Absicht verfolgt, ein mögliches Verbrechen zu verhindern. Diese umstrittene These wird von manchen Kommentatoren gerne als Beleg dafür angeführt, dass Kants Versuch rein apriorische Gesetze aufzustellen und zu begründen letztlich in einem weltfremden Rigorismus mündet.1150 Neben der immer noch gängigen Kritik an der inneren Konsistenz und damit Gültigkeit der Kantischen Argumentation, wird ebenfalls behauptet, dass diese Argumentation zu einem ausweglosen Widerstreit der Pflichten führt. Gemeint ist etwa der Konflikt zwischen dem rechtlichen Gebot der Wahrhaftigkeit und dem moralischen Gebot der Hilfe bedürftiger Menschen.1151 Dieser Widerstreit wäre in dem Sinne nicht lösbar, als der Handelnde (gleichwohl welche Entscheidung er auch trifft) gezwungen wäre, eine bestehende Pflicht zu verletzen und damit etwas zu tun, was er vernünftigerweise nicht tun sollte. Die Kritik richtet sich dabei vornehmlich an Kants Ausführungen in dem kleinen, gegen Benjamin Constant gerichteten Aufsatz Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen aus dem Jahre 1797.1152 Selbst wenn die philosophische Debatte sich allzu häufig auf Kants Erörterungen im sogenannten Lügenaufsatz beschränkt, darf nicht übersehen werden, 1150 Im Gegensatz dazu versuchen verschiedene Autoren zu zeigen, dass Kants These durchaus konsistent und ernst zu nehmen ist. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang vor allem auf die Beiträge von Georg Geismann, in welchen die bisher stärkste Argumentation von Julius Ebbinghaus präzisiert wird. Vgl. Ebbinghaus, Julius: Kants Ableitung des Verbotes der Lüge aus dem Rechte der Menschheit, in: Gesammelte Schriften, Bd. 1: Sittlichkeit und Recht. Praktische Philosophie 1929-1954, hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Bonn 1986, S. 407-420; Geismann, Georg: Kant und kein Ende. Studien zur Rechtsphilosophie, Band 2, Würzburg 2010, S. 229-248; Ders.: Versuch über Kants rechtliches Verbot der Lüge, in: Kant. Analysen - Probleme Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer und Gerhard Seel, Würzburg 1988, S. 293-316. Erwähnenswert sind des Weiteren die Beiträge von Otfried Höffe und Hans Wagner. Vgl. Höffe, Otfried: Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt a. M. 1990, 3. Aufl. 1995, Kapitel 7 (Das Verbot des falschen Versprechens); Wagner, Hans: Kant gegen „ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen“, in: KantStudien 69, 1978, S. 90-96. 1151 Um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen: “In the refugee example, the person is faced with what is clearly a conflict of duties, for he has a duty to help the refugee and a duty to tell the truth. In this case, it should be easy to resolve the conflict, but Kant’s theory cannot handle it […] Kant’s theory cannot handle conflicts of duty” (Cornman, James W. / Lehrer, Keith: Philosophical Problems and Arguments: An Introduction, Indianapolis 1992, S. 340). 1152 Einen guten Überblick über diese Debatte einschließlich der Vorgeschichte der Kontroverse zwischen Constant und Kant bietet der Band: Geismann, Georg/Oberer, Hariolf (Hrsg.): Kant und das Recht der Lüge, Würzburg 1986. - 220 - dass Kant der Lüge eine erhebliche Aufmerksamkeit in seinem Gesamtwerk beimisst.1153 Wichtige Textstellen zur Lüge sind zunächst in Kants reifen Hauptwerken zur Moral- und Rechtsphilosophie zu finden. Dazu gehören etwa die Grundlegung1154 sowie die Rechts-1155 und Tugendlehre1156 der Metaphysik der Sitten. Einige interessante Textstellen lassen sich ebenfalls in den kleineren Schriften Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee1157 aus dem Jahre 1791 sowie in der Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie1158 aus dem Jahre 1796 finden. Im hier diskutierten Zusammenhang soll außerdem auf die Friedensschrift hingewiesen werden, selbst wenn der Begriff der Lüge dort gar nicht ausdrücklich vorkommt.1159 Weitere wichtige Textquellen für eine möglichst umfassende Auseinandersetzung mit Kants Behandlung der Lüge finden sich letztlich in seinen Briefen1160 wie auch in seinem handschriftlichen Nachlass1161 oder in den Nachschriften seiner Vorlesungen über Moralphilosophie. Diesen verschiedenen Textquellen kommt wohlgemerkt nicht dieselbe Bedeutung zu. Unter den kleinen, meist populäreren Schriften nimmt der Lügenaufsatz einen besonderen Stellenwert ein, da sich Kant dort spezifisch und vor allem am ausführlichsten dem rechtsphilosophischen Problem der Lüge widmet. Auf den folgenden Seiten soll deshalb ausführlich auf Kants Argumentation im Lügenaufsatz eingegangen werden. Zugleich soll jedoch versucht werden eine möglichst breite Textgrundlage heranzuziehen, um mögliche Verschiebungen oder Selbstkorrekturen bezüglich des Kantischen Gedankens zum Problem der Lüge und des Pflichtenkonflikts deutlich zu machen. Dies erklärt, dass neben den noch zu Kants Lebzeiten veröffentlichten Werken auch der handschriftliche Nachlass und die Vorlesungsnachschriften herangezogen werden. Auf der Grundlage dieser breiten, heterogenen Textgrundlage soll die (nicht immer einheitliche) Einstellung Kants zum Problem der Lüge erläutert werden. In Anlehnung an die Arbeit von Julius Ebbinghaus und Georg Geismann soll in einem ersten Schritt gezeigt werden, dass Kants Ablehnung eines bedingten Rechts zu lügen keinesfalls auf ein rigoristisches Vorurteil gegen die Lüge zurückzuführen ist, sondern konsistent rechtsphilosophisch begründet ist. In einem zweiten Schritt soll entgegen einer weit verbreiteten Kritik gezeigt werden, dass Kant sich sehr wohl dem Problem der Pflichtenkollision bewusst war und dass seine notorisch ignorierte Antwort hierauf alles anderes als abwegig ist. Abschließend soll gezeigt werden, dass Kant mit der Begründung der Vorrangigkeit der vollkommenen Rechtspflichten vor den unvollkommenen Tugendpflichten ein stichhaltiges theoretisches Instrument entwickelt, um einen möglichen Widerstreit der Pflichten zu vermeiden. 1.1 Kants Definition „Wahrhaftigkeit“ der Lüge: Die Unterscheidung von „Wahrheit“ und Es besteht zunächst Erklärungsbedarf darüber, was genau unter dem Begriff der Lüge überhaupt zu verstehen ist. Die erste Frage, die es vor diesem Hintergrund zu beantworten gilt, ist die, ob die Lüge bloß mit einer unwahren Aussage gleichzusetzen ist. Anders 1153 Dies bestätigt ein flüchtiger Blick auf die von Andreas Roser und Thomas Mohrs herausgegebene KantKonkordanz: Unter dem Stichwort „lügen“ werden dort nicht weniger als 109 Einträge verzeichnet. 1154 Vgl. GMS: IV, 389, 402f., 422, 429f., 441 1155 Vgl. RL: VI, 238 1156 Vgl. TL: VI, 428ff. 1157 Vgl. Theodizee: XXII, 238f. 1158 Vgl. Verkündigung: VIII, 421f. 1159 Vgl. Frieden: VIII, 355, 374f. 1160 Vgl. Der Brief an Fräulein Maria von Herbert im Frühjahr 1792 (XI, 331ff.) 1161 Vgl. Kants Reflexionen zur Moral- (XIX, 92-317) und Rechtsphilosophie (XIX, 442-613). - 221 - formuliert heißt es: Kann der Begriff der Lüge anhand von dem gegensätzlichen Begriffspaar Wahrheit und Unwahrheit überhaupt verstanden werden? Gleich zu Beginn seiner Entgegnung auf Benjamin Constant in der Schrift Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen schreibt Kant diesbezüglich: „Zuerst ist anzumerken, daß der Ausdruck: ein Recht auf die Wahrheit haben, ein Wort ohne Sinn ist“.1162 Im unmittelbaren Anschluss daran führt Kant folgendermaßen fort: „Man muß vielmehr sagen: der Mensch habe ein Recht auf seine eigene Wahrhaftigkeit (veracitas), d. i. auf die subjective Wahrheit in seiner Person. Denn objectiv auf eine Wahrheit ein Recht haben, würde so viel sagen als: es komme [...] auf seinen Willen an, ob ein gegebener Satz wahr oder falsch sein solle; welches dann eine seltsame Logik abgeben würde“.1163 Kant trifft hier eine grundsätzliche, begriffliche Unterscheidung zwischen „Wahrheit“ und „Wahrhaftigkeit“. Unter formaler Wahrheit ist die Übereinstimmung der Gedanken mit den Gesetzen des Verstandes zu verstehen. Im Unterschied dazu bezeichnet die Wahrhaftigkeit die Übereinstimmung des Geäußerten mit dem Denken oder, um es anders zu formulieren, die Übereinstimmung dessen, was (äußerlich) gesagt wird mit dem was (innerlich) gedacht wird. Die Frage, ob das Gesagte auch der Gesetzmäßigkeit des Verstandes entspricht, ist hier ohne Belang. Um wahrhaft zu sein, reicht es aus, wenn das Gesagte dem Denken entspricht. Erklärungsbedürftig ist hier, warum Kant den Ausdruck eines „Rechts auf die Wahrheit haben“ für sinnlos hält. Hierzu gibt Kant folgende Antwort: Der Mensch kann nur ein Recht auf Wahrhaftigkeit, jedoch nicht auf Wahrheit haben, weil er ein endliches Vernunftwesen ist, welches sich immer irren kann. Da der Mensch begrenzt und fehlbar ist, kann von ihm nicht erwartet werden, dass er immer die Wahrheit sagt. Die Menschen können etwas Falsches sagen und dennoch der Überzeugung sein, dass sie die Wahrheit sagen. Den Menschen ein Gesetz aufzuerlegen, jederzeit die Wahrheit zu sagen, hieße somit, ihnen etwas Unmögliches abzuverlangen. Es zeigt sich, dass die Menschen kein Recht auf Wahrheit haben können, weil es keine korrespondierende Pflicht geben kann. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen lässt sich die Lüge allgemein als eine vorsätzlich unwahre Deklaration definieren. Eine genauere Definition der Lüge gibt Kant in der kleinen Schrift Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie. Dort heißt es: „Eine Lüge […] ist zwiefacher Art: 1) wenn man das für wahr ausgiebt, dessen man sich doch als unwahr bewußt ist, 2) wenn man etwas für gewiß ausgiebt, wovon man sich doch bewußt ist, subjectiv ungewiß zu sein“.1164 Die Lüge im zuvor definierten Sinne kann sowohl innerlich als auch äußerlich sein.1165 Eine innerliche Lüge liegt dann vor, wenn man sich selbst, aus welchem Grund auch immer, belog. Eine äußerliche Lüge dagegen liegt vor, wenn eine unwahrhaftige Aussage vor mindestens einer dritten Person ausgesprochen ist. Die Lüge im zuvor definierten Sinne unterscheidet sich von der Täuschung dadurch, dass letztere keine Aussage voraussetzt. Die Lüge ist spezifisch auf Sprache angewiesen, nicht aber die Täuschung. Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel festhalten: Man täuscht, wenn man vorgibt zu schlafen, um die Anderen heimlich zu beobachten. Man lügt wiederum, wenn man anschließend sagt, man habe geschlafen. Die Lüge setzt also immer eine Aussage voraus. Dies hat wiederum zu bedeuten, dass die Enthaltung bei der Kommunikation nicht als Lüge betrachtet werden kann. Bisher wurde gesehen, dass es kein Recht auf Wahrheit geben kann, weil der Mensch als ein endliches Vernunftwesen niemals sicher sein kann, keine Unwahrheit aus Irrtum zu sagen. Wenn eine Unwahrheit immer irrtümlich ausgesprochen werden kann, kann dies jedoch nicht der Fall für eine Lüge sein. Eine Lüge erfolgt immer wissentlich und willentlich. 1162 Vermeintes Recht: VIII, 426 Vermeintes Recht: VIII, 426 1164 Verkündigung: VIII, 421f. 1165 Vgl. Verkündigung: VIII, 421f. 1163 - 222 - Die Tatsache, dass man den Menschen die Verantwortung für irrtümliche Aussagen nicht übertragen kann, hat längst noch nicht zu bedeuten, dass sie verantwortungslose Aussagen machen dürfen. Die Menschen sind dazu verpflichtet, wenn sie eine Aussage machen möchten, vor ihrem Gewissen zu prüfen, ob das, was sie sagen möchten tatsächlich dem entspricht, was sie für die Wahrheit halten. Es liegt in ihrer Verantwortung nur das zu sagen, was sie ehrlich für wahr halten. Kant nennt diese Gewissensbefragung die „formale Gewissenhaftigkeit“.1166 Jene besteht in der Sorgfalt, „kein Fürwahrhalten vorzugeben, dessen man sich nicht bewußt ist“.1167 In der Theodizee führt Kant zusammenfassend aus: „Daß das, was Jemand sich selbst oder einem Andern sagt, wahr sei: dafür kann er nicht jederzeit stehen (denn er kann irren); dafür aber kann und muß er stehen, daß sein Bekenntniß oder Geständnis wahrhaft sei: denn dessen ist er sich unmittelbar bewußt. Er vergleicht nämlich im erstern Falle seine Aussage mit dem Object im logischen Urtheile (durch den Verstand); im zweiten Fall aber, da er sein Fürwahrhalten bekennt, mit dem Subject (vor dem Gewissen)“.1168 Im Folgenden soll kurz auf die Problematik der äußerlichen (besser: öffentlichen) Lüge eingegangen werden. Dabei wird der Blick auf die berühmte Kontroverse zwischen Benjamin Constant und Immanuel Kant gerichtet. 1.2 Kants Antwort auf Benjamin Constant in der Schrift Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen Kants Schrift Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen hat eine philosophische Diskussion ausgelöst, die bis heute kontrovers geführt wird. Für manche Kommentatoren war dabei die Versuchung offenbar zu groß, Kants These mit Argumenten zu diskreditieren, welche dem Reflexionsniveau seiner dortigen Argumentation nicht gerecht wird. Gemeint sind etwa jene Versuche, die Kants These auf seine vermeintliche Altersschwäche zurückführen möchten.1169 Als zweifelhaften Beleg hierfür wird auf Kants anfängliche Anmerkung im Lügenaufsatz hingewiesen, er könne sich erinnern, dass er an irgend einer Stelle die Lüge gegenüber einem Mörder als Verbrechen bezeichnet habe, ohne sich jedoch darauf besinnen zu können, wo er dies getan hat.1170 Nach dieser allzu einfachen Interpretation wird Kants These als Ergebnis seines fortgeschrittenen Alters erklärt. Gleichermaßen greift jene Kritik zu kurz, die Kants Ablehnung der Lüge als Ergebnis seiner Erziehung auffasst. Abgesehen von diesen wenig überzeugenden Kritiken, sieht sich Kants These dennoch schwerwiegender Kritik ausgesetzt. Darauf soll im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden. a) Constants Begründung einer bedingten Pflicht auf Wahrheit Die Veröffentlichung des Aufsatzes Über ein vermeintes Recht wurde bekanntlich unmittelbar von Benjamin Constants Abhandlung Des réactions politiques hervorgerufen. Im Kapitel VII dieser im März 1797 veröffentlichten Schrift unter der Überschrift Des principes stellt Constant die These einer bedingten Pflicht auf Wahrheit auf. In dieser Schrift widmet sich Constant jedoch nicht dem Problem der Lüge im Speziellen. Das Problem der Lüge wird dort lediglich im Rahmen einer viel weitreichenderen Diskussion zum Verhältnis von 1166 Theodizee: VIII, 268 Theodizee: VIII, 268 1168 Theodizee: VIII, 267 1169 Dieser Erklärungsversuch ist selbst bei Herbert J. Paton zu finden. Vgl. Paton, Herbert J.: An alleged right to lie. A problem in Kantian ethics, in: Kant und das Recht der Lüge, hrsg. v. Georg Geismann und Hariolf Oberer, Würzburg 1986, S. 58f. 1170 Vgl. Vermeintes Recht: VIII, 425 1167 - 223 - allgemeinen Grundsätzen und empirischer Wirklichkeit erörtert. Um Kants These besser verstehen zu können, scheint es zunächst angebracht Constants Argumentation in seinen Grundzügen darzustellen. In seiner Schrift Des réactions politiques zeigt sich Benjamin Constant als ein entschlossener Verteidiger des aufklärerischen Projekts einer prinzipiengeleiteten Politik. Dabei geht es Constant allerdings nicht um die Begründung der abstrakten Prinzipien der Moral und Politik, sondern vielmehr um die Frage nach deren konkreten Anwendung auf vorkommende Fälle. Constants Hauptanliegen besteht somit in einer Vermittlung von Normativität und Faktizität. Dieses Vorhaben lässt sich vor dem historischen Hintergrund der Wende der französischen Revolution erklären: Nach der Terrorherrschaft aus dem Jahre 1793 hatten sich viele Zeitgenossen von der zunächst euphorisch gefeierten Revolution abgewendet und das aufklärerische Projekt einer Politik nach Prinzipien der Vernunft aufgegeben. Auch Constant teilt die Ansicht, dass die folgenblinde Anwendung von abstrakten Prinzipien zur Terrorherrschaft der Jakobiner geführt hat. Constant verwirft jeden legalistischen Rigorismus, der den Vernunftprinzipien widerspricht und letztlich in einem blanken Despotismus zu münden droht. Ihm zufolge würde die bedingungslose Anwendung der abstrakten Prinzipien der Moral und Politik das Zusammenleben der Menschen unmöglich machen. Zugleich sieht er jedoch ein, dass eine bedingungslose Verwerfung derselben Prinzipien ebenso das Zusammenleben der Menschen unmöglich machen würde. Aus diesem Grund verwirft Constant die damals weit verbreitete Auffassung, wonach die als wahr erwiesenen, abstrakten Prinzipien der Moral und der Politik verlassen werden sollen, weil sie unanwendbar scheinen. Wenn man die abstrakten Prinzipien der Moral und Politik verwirft, weil es sich dabei um weltfremde Theorien handelt, die aufgrund ihrer möglichen Folgen nicht für die Praxis gelten können, dann stellt man alles der Willkür anheim. Man sollte also kein als wahr anerkanntes Prinzip deshalb verwerfen, weil dessen möglichen Folgen für inakzeptabel gehalten werden. Weiterhin unternimmt Constant den Versuch zwischen den abstrakten Prinzipien und der konkreten menschlichen Wirklichkeit, durch „Zwischenprinzipien“ (principes intermédiaires) zu vermitteln. Es geht also Constant nicht darum zu leugnen, dass es abstrakte Prinzipien der Moral überhaupt gibt. Es geht ihm auch nicht darum zu zeigen, dass die abstrakten Prinzipien der Moral nicht anwendbar sind. Constant geht vielmehr davon aus, dass die Prinzipien der Moral die Möglichkeit ihrer Anwendung in sich tragen. Im Wortlaut Constants heißt es: „[T]out principe renferme, soit en lui-même, soit dans son rapport avec un autre principe, son moyen d’application. Un principe, reconnu vrai, ne doit donc jamais être abandonné, quels que soient ses dangers apparents. […] La doctrine opposée est absurde dans son essence et désastreuse dans ses effets“.1171 Für Constant besteht der scheinbare Widerspruch, welcher in jedem Prinzip liegt, das sich als wahr erwiesen hat und gleichzeitig unanwendbar scheint, nur so lange bis ein mittlerer Grundsatz gefunden ist, der definiert wie das Prinzip auf den einzelnen Fall anzuwenden sei. Diesbezüglich schreibt Constant folgendes: „Toutes les fois qu’un principe, démontré vrai, paraît inapplicable, c’est que nous ignorons le principe intermédiaire qui contient le moyen d’application“.1172 Constant gibt allerdings nur wenige Hinweise, wie diese mittleren Grundsätze zu finden sind. Constant zufolge sollte das abstrakte Prinzip zunächst definiert werden. In dieser Definition sollte man den Verweis auf ein anderes Prinzip finden. Die Verbindung zwischen beiden Prinzipien sollte dann das Mittel zur Anwendung enthalten. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte man diese Vorgehensweise mit einem weiteren Prinzip wiederholen. Das Zwischenprinzip sollte früher oder später gefunden werden, wenn man das neugefundene Prinzip seinerseits definiert und in Zusammenhang zu anderen Prinzipien stellt. 1171 1172 Constant, Benjamin: Des réactions politiques, Paris 2002, S. 95 Constant, Benjamin: Des réactions politiques, Paris 2002, S. 96 - 224 - Im Rahmen seiner Erörterung zum Verhältnis von abstrakten Prinzipien und empirischer Wirklichkeit kommt Constant dazu die Problematik der Lüge zu diskutieren. Dort vertritt er die These, dass ein absolutes Lügenverbot das gesellschaftliche Zusammenleben unmöglich machen würde. Er spricht sich demnach für eine bedingte Wahrheitspflicht aus. An dieser Stelle besteht Erklärungsbedarf darüber, wie Constant seiner These einer bedingten Wahrheitspflicht begründet. In seiner Abhandlung führt Constant seine Argumentation folgendermaßen aus: „Dire la vérité est un devoir. Qu’est-ce qu’un devoir? L’idée de devoir est inséparable de celle de droits : un devoir est ce qui, dans un être, correspond aux droits d’un autre. Là où il n’y a pas de droits, il n’y a pas de devoirs. Dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité. Or nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui“.1173 Dieser prägnante Argumentationsgang lässt sich folgendermaßen erläutern: Constant zufolge gibt es grundsätzlich eine Pflicht zur Wahrheit. Auf die Frage, was eine Pflicht ist, antwortet Constant, dass der Pflichtbegriff nur im Zusammenhang mit dem Rechtsbegriff verstanden werden kann. Dies liegt darin begründet, dass es immer eine Korrespondenz von Recht und Pflicht gibt: Die Pflicht des Einen entspricht dem Recht des Anderen. Daraus folgt wiederum, dass es keine Pflicht gibt, wo es kein korrespondierendes Recht gibt. Man kann allerdings kein Recht beanspruchen, wenn dadurch die Rechte eines Anderen verletzt werden. Folglich hat man auch keine Pflicht gegenüber jemanden, wenn die Erfüllung dieser Pflicht zur Verletzung der Rechte einer dritten Person führt. In Bezug auf die Wahrheit bedeutet dies, dass jeder Pflicht, die Wahrheit zu sagen, ein korrespondierendes Recht, die Wahrheit zu hören, entsprechen muss. Ohne Recht auf Wahrheit gibt es auch keine entsprechende Pflicht zur Wahrheit. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, nur für diejenigen gilt, die ein Recht darauf haben. Kein Mensch aber habe das Recht auf Wahrheit, wenn er diese benutzt, um anderen zu schaden. Es gibt also keine Pflicht jemanden die Wahrheit zu sagen, wenn er die Wahrheit verwendet um einer dritten Person Schaden zuzufügen. Um zu beurteilen, ob in einem bestimmten Fall ein Mensch A die Pflicht hat, die Wahrheit zu sagen, muss erst geprüft werden, ob der Mensch B das Recht hat, die Wahrheit zu verlangen. Ist dies nicht der Fall, zum Beispiel weil der Mensch B einem anderen schaden möchte, so ist der Mensch A nicht verpflichtet die Wahrheit zu sagen. Hiermit glaubt Constant das Bindeglied gefunden zu haben, welches den zuvor unakzeptablen Grundsatz der Wahrheitspflicht anwendbar macht. Dies wird jedoch von Kant entschieden bestritten. Kant zufolge liegt der grundsätzliche Irrtum, aus welchem sich im weiteren Verlaufe des Beweises andere falsche Aussagen ergeben, in dem Satz: „Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht, aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat“. Der mittlere Grundsatz darf mit dem allgemeinen Grundsatz, im hier diskutierten Fall, jener der Wahrhaftigkeit, nicht konkurrieren, sondern lediglich die Bedingungen seiner Anwendung bestimmen. Andernfalls würde die gesamte innersystematische Kohärenz der Rechtslehre verloren gehen. Der mittlere Grundsatz sollte keine Ausnahme des oberen Grundsatzes schaffen. Für Kant ist jedoch dies bei Constants Argumentation gerade der Fall. Im folgenden Abschnitt soll nun auf Kants Kritik an Constants Argumentation näher eingegangen werden. b) Kants Begründung einer unbedingten Pflicht auf Wahrhaftigkeit In der Schrift Des réactions politiques stellt Constant die These auf, dass der Grundsatz der Gleichheit, nach welchem kein Menschen anders als durch solche Gesetze 1173 Constant, Benjamin: Des réactions politiques, Paris 2002, S. 95 - 225 - gebunden werden kann, zu deren Bildung er mit beigetragen hat, allgemeine Gültigkeit hat. Dieser Grundsatz kann jedoch nur auf kleine Gesellschaften unmittelbar angewendet werden. Um den Grundsatz der Gleichheit auf größere Gesellschaften anwendbar zu machen, stellt ihm Constant einen mittleren Grundsatz an die Seite. Nach diesem Zwischenprinzip können die Menschen zur Bildung der Gesetze entweder in eigener Person oder durch Stellvertreter beitragen. Im Lügenaufsatz schreibt Kant diesbezüglich, dass er das Bemühen Constants für „[w]ohldenkend und zugleich richtig“1174 hält. Im Falle des Grundsatzes der Gleichheit ist die Bestimmung eines mittleren Prinzips möglich. Hier kann problemlos aus einer Metaphysik des Rechts (welche von allen Erfahrungsbedingungen abstrahiert) ein Grundsatz der Politik (welcher die Begriffe der Metaphysik des Rechts auf die Erfahrungsfälle anwendet) entwickelt werden.1175 Kant könnte Constants Schlussfolgerung durchaus zustimmen, dass ein als wahr anerkannter Grundsatz niemals verlassen werden darf, auch wenn er Gefahren in sich birgt.1176 Dennoch verwirft Kant Constants Argumentation, wonach es ein bedingtes Recht zu lügen gibt. Was Kant an Constant kritisiert, ist, dass er gerade den unbedingten Grundsatz der Wahrhaftigkeit wegen der Gefahr, die er für die Gesellschaft mit sich führe, verlassen habe.1177 Was Kant also kritisiert ist Constants Inkonsistenz. Für Kant dient ein mittlerer Grundsatz für die nähere Bestimmung der Anwendung eines ersten Grundsatzes auf vorkommende Fälle. Dabei darf der mittlere Grundsatz niemals Ausnahmen vom ersten Grundsatz enthalten. Kant wirft Constant vor den unbedingten Grundsatz der Wahrhaftigkeit verlassen zu haben. Constant hätte dies im Widerspruch zu seinen eigenen Absichtserklärungen gemacht, „weil er keinen mittleren Grundsatz entdecken konnte, der diese Gefahr zu verhüten diente, und hier auch wirklich keiner einzuschieben ist“.1178 Mit dem Grundsatz der bedingten Wahrhaftigkeit entwickelt Constant keinen mittleren Grundsatz für die Anwendung auf vorkommende Fälle, sondern schafft eine Ausnahme vom ersten Grundsatz. Eine derartige Absicht widerspricht jedoch dem Anspruch des Grundsatzes auf Allgemeingültigkeit und bedeutet somit die Vernichtung des Grundsatzes als solches. Für Kant zeigt Constant dadurch, dass „er die Wahrhaftigkeit nicht für Pflicht an sich selbst anerkenne, sondern sich Ausnahmen vorbehält von einer Regel, die ihrem Wesen nach keiner Ausnahme fähig ist, weil sie sich in dieser geradezu selbst widerspricht“.1179 Nachdem die Kritik an Constants Argumentation kurz erläutert wurde, stellt sich die weitere Frage, wie Kant die unbedingte Pflicht auf Wahrhaftigkeit begründet. Die Kontroverse zwischen Constant und Kant dreht sich um das konkrete Beispiel einer möglichen Rettung eines Menschen vor einem Mörder durch eine Lüge. Es ist nicht das erste Mal, dass Kant in seinen Werken wichtige Gedanken anhand von konkreten Beispielen diskutiert. Bereits in der Grundlegung hatte er so wichtige Gedanken, wie etwa das Handeln aus Pflicht1180 oder das Verfahren des kategorischen Imperativs in seinen verschiedenen Formen1181 anhand von Beispielen verdeutlicht. Bereits die Tatsache, dass Kant Beispiele verwendet, um die praktischen Regeln anschaulich zu machen, spricht gegen den verbreiteten 1174 Vermeintes Recht: VIII, 427 Vgl. Vermeintes Recht: VIII, 429 1176 Vgl. Constant, Benjamin: Des réactions politiques, Paris 2002, S. 97 1177 Vgl. Vermeintes Recht: VIII, 428 1178 Vermeintes Recht: VIII, 428 1179 Vermeintes Recht: VIII, 430 1180 Vgl. GMS: IV, 397 1181 Vgl. GMS: IV, 421ff. 1175 - 226 - Vorwurf, dass seine praktische Philosophie kein Bezug zu den konkreten Problemen der Menschen hat.1182 An den Geschehnissen sind drei Personen beteiligt: Ein Mensch A kommt an die Tür von einem anderen Menschen B, in dessen Wohnung sich sein Freund C verbirgt, weil er vom Menschen A verfolgt wird. Der Mensch A fragt den Menschen B, ob der Mensch C, den er offenbar ermorden will, im Hause sei. Vor dem Hintergrund dieser klaren Ausgangssituation stellt Kant zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob der Mensch A, wenn er einer Antwort mit Ja oder Nein nicht ausweichen kann, das Recht habe (aus Menschenliebe gegenüber C) zu lügen. Die zweite Frage ist, ob der Mensch A nicht sogar die Pflicht zu lügen hat, wenn er dadurch vielleicht eine Missetat verhindern könnte. Diese extreme Ausgangssituation wird dadurch zugespitzt, dass der Gefragte weder schweigen noch dilatorisch antworten kann. Über diese beiden Auswegmöglichkeiten äußert sich Kant weder negativ noch positiv. Diese Einschränkung trägt erheblich zur Klarheit der Debatte bei. Im weiteren Verlauf der Schrift Über ein vermeintes Recht werden beide Fragen von Kant kompromisslos verneint. Es wird die These vertreten, dass sofern man eine Aussage zu einem bestimmten Sachverhalt nicht umgehen kann, es eine unbedingte Pflicht zur Wahrhaftigkeit beim Aussagen gibt. Für ein angemessenes Verständnis von Kants Argumentation soll gleich an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kant hier ausschließlich auf einer rechtlichen und nicht moralischen Ebene argumentiert. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Kant auch ein bedingungsloses moralisches Verbot der Lüge vertritt. Neben einschlägigen Stellen in der Grundlegung bezeichnet er die Lüge in der Tugendlehre unmissverständlich als „die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich selbst“.1183 Im Lügenaufsatz geht es allerdings nicht um die Erörterung der Lüge als Tugendpflicht. Wie es in der zweiten Fußnote der Schrift unmissverständlich zu lesen ist, ist hier lediglich von einer Rechtspflicht die Rede. Gemäß der systematischen Gliederung der Metaphysik der Sitten in Tugend- und Rechtslehre, sei darauf aufmerksam gemacht diese beiden Ebenen nicht zu vermischen.1184 Im Folgenden soll gezeigt werden, dass Kants absolute Ablehnung eines Rechts zu lügen auf dem Begriff des Rechts der Menschheit beruht. Im Lügenaufsatz schreibt er diesbezüglich, dass ich durch eine Lüge „im wesentlichsten Stücke der Pflicht überhaupt Unrecht [tue]: d. i. ich mache, so viel an mir ist, daß Aussagen (Declarationen) überhaupt keinen Glauben finden, mithin auch alle Rechte, die auf Verträgen gegründet werden, wegfallen und ihre Kraft einbüßen; welches ein Unrecht ist, das der Menschheit überhaupt zugefügt wird“.1185 Im Anschluss daran führt Kant aus, dass das hier angesprochene Unrecht, welches der Menschheit zugefügt wird, darauf zurückzuführen ist, dass die Lüge „die Rechtsquelle unbrauchbar macht“.1186 Ferner führt Kant im Text aus, dass „Wahrhaftigkeit eine Pflicht ist, die als die Basis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten angesehen werden muß, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einräumt, schwankend und unnütz gemacht wird“.1187 Erklärungsbedürftig ist an dieser Stelle, wie Kant sein Argument begründet, dass alle Lügen – somit auch die Notlüge – alle auf Vertrag gegründeten Pflichten aufhebt und somit der Menschheit überhaupt ein Unrecht zufügt. 1182 Einen guten Überblick über die Funktion von Beispielen in Kants praktischer Philosophie bietet die folgende Lektüre: Höffe, Otfried: „Königliche Völker“. Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M 2001, S. 68ff. 1183 TL: VI, 429 1184 Vgl. Geismann, Georg: Versuch über Kants rechtliches Verbot der Lüge, in: Kant. Analysen - Probleme Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer und Gerhard Seel, Würzburg 1988, S. 297; Höffe, Otfried, Kant, München 2004, S. 195. 1185 Vermeintes Recht: VIII, 426 (meine Hervorhebungen) 1186 Vermeintes Recht: VIII, 426 1187 Vermeintes Recht: VIII, 427 - 227 - Um diese Frage beantworten zu können, soll zunächst an dem von Kant erhobenen Einwand erinnert werden, nach welchem Constant die Lüge nur insofern erwägt, als sie einem anderen Schaden zufügt. Constant sieht sich von Kant dem Vorwurf ausgesetzt, er mache keinen Unterschied zwischen einer Handlung, wodurch jemand einem anderen schadet (nocet) und einer Handlung, wodurch er diesem Unrecht tut (laedit).1188 Kant lehnt diese Vorgehensweise deshalb ab, weil die positiven oder negativen Folgen, welche sich aus der strikten Erfüllung der absoluten Rechtspflicht zur Wahrhaftigkeit ergeben können reiner Zufall sind. Wenn die Rechtspflichten absolute Notwendigkeit haben, dann hat dies zu bedeuten, dass die Menschen ihre Pflichten in jeder Situation ganz unabhängig von den möglichen Folgen (und das heißt sowohl für die Anderen als auch für den Handelnden selbst) beachten sollen. Die Frage, ob aus der Befolgung einer Rechtspflicht möglichen Schäden (zum Beispiel eine Ermordung) oder Nutzen (zum Beispiel die Rettung eines hilfsbedürftigen Menschen) zu erwarten sind, ist hier gänzlich irrelevant. Es handelt sich dabei um bloß zufällige, empirische Sachverhalte, die als solche bei der Wahl der Handlungsmaximen nicht in Betracht gezogen werden dürfen. Wenn es nun eine Rechtspflicht auf Wahrhaftigkeit gibt, dann ist die Lüge (als Verletzung dieser Rechtspflicht) pflichtwidrig und deshalb schlechterdings verboten. Der sich daraus ergebende Schaden ist ein rechtlicher Schaden (praeiudicium). Kant scheint sich jedoch selbst zu widersprechen und den Fehler zu begehen, Schaden und Unrecht miteinander zu verwechseln, wenn er anschließend schreibt: „Die Lüge […] bedarf nicht des Zusatzes, daß sie einem Anderen schaden müsse […] Denn sie schadet jederzeit einem Anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der Menschheit überhaupt“.1189 Ein näherer Blick auf die zitierte Textstelle lässt jedoch erkennen, dass der Schaden, von dem hier geredet wird, kein empirisch feststellbarer, materialer Schaden ist, welcher von einer bestimmten Lüge verursacht wäre. Es handelt sich vielmehr um einen rechtlichen, mithin formalen Schaden, welcher der Lüge überhaupt innewohnt und sich daraus ergibt, dass jede Lüge notwendig eine Verletzung des Rechts der Menschheit zur Folge hat. An dieser Stelle kann festgestellt werden, dass Kants Bestimmung der Lüge als ein juridisches Unrecht von der Bestimmung der Juristen grundsätzlich abweicht. Für diese wird die Lüge erst dann zu einem Problem des Rechts, wenn aus dieser Lüge einem anderen Schaden geschieht. Im Gegensatz dazu ist es Kant zufolge nicht nötig, dass empirisch festgestellt wird, dass eine bestimmte Lüge jemand anderem Schaden zugefügt hat, um diese Lüge als Unrecht zu bezeichnen. Unrecht ist für Kant nicht ein bestimmter Gebrauch der Lüge, sondern die Lüge per se oder anders ausgedrückt die Lüge überhaupt. Die Lüge stellt also selbst dann ein Unrecht dar, wenn sie dem Angelogenen keinen unmittelbaren Schaden zugefügt hat. Die Lüge überhaupt stellt ein Unrecht dar, weil sie dem Recht der Menschheit Abbruch tut. Wenn Kant schreibt, dass jede Lüge immer der Menschheit in ihrer Gesamtheit ein Unrecht zufügt, dann ist es klar, dass es sich nicht um einen empirisch feststellbaren Schaden handelt, sondern um eine Verletzung des apriorischen Rechts der Menschheit. Es besteht hier Erklärungsbedarf darüber, wie Kant seine These begründet, dass die Lüge alle auf Vertrag gegründeten Pflichten schwankend macht und somit immer eine Verletzung des Rechts der Menschheit darstellt. Die hier vorgetragene Argumentation stützt sich im Wesentlichen auf die Arbeit von Georg Geismann, in welcher die von Julius Ebbinghaus vorgeschlagene Interpretation der Kantischen Argumentation präzisiert wird.1190 1188 Vgl. Vermeintes Recht: VIII, 427 Vermeintes Recht: VIII, 426 1190 Vgl. Ebbinghaus, Julius: Kants Ableitung des Verbotes der Lüge aus dem Rechte der Menschheit, in: Gesammelte Schriften, Bd. 1: Sittlichkeit und Recht. Praktische Philosophie 1929-1954, hrsg. v. Hariolf Oberer / Georg Geismann, Bonn 1986, S. 407-420; Geismann, Georg: Kant und kein Ende. Studien zur Rechtsphilosophie, Band 2, Würzburg 2010, S. 229-248. 1189 - 228 - Es soll in einem ersten Schritt darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kants These sich keinesfalls auf irgendeinen positiven Vertrag bezieht. Dies lässt sich an zweierlei Gründen festhalten. Erstens: Das oben diskutierte Beispiel wäre damit gar nicht betroffen, da der Mensch A in keinem besonderen Vertragsverhältnis zu dem Mensch B steht. Zweitens: Kant spricht hier von „Rechtsquelle“ und nicht von „Vertragsrecht“. Es zeigt sich also, dass Kant hier keinesfalls ein durch einen positiven Vertrag begründetes, spezifisches Recht im Sinne hat. Hier geht es vielmehr um das Recht überhaupt und um die Lüge überhaupt. Der Kantische Argumentationsgang erfolgt im Wesentlichen in vier Schritten: Wie bereits im ersten Hauptteil der vorliegenden Dissertation angeführt wurde, kommt jedem Menschen kraft seines Menschseins ein Recht auf den rechtsgesetzlichen Gebrauch seiner äußeren Freiheit zu. Dieses Recht der Menschheit in der Person jedes einzelnen Menschen ist, um es mit anderen Worten zu formulieren, das Recht auf den beliebigen Gebrauch seiner freien Willkür, insofern (und nur insofern) dieser mit der Freiheit von allen anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann.1191 Dieses Recht ist das einzige Recht, welches jedem Menschen ursprünglich zukommt. Die Einschränkung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen auf die Bedingung ihrer Übereinstimmung mit der äußeren Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz setzt notwendigerweise die Idee des Vertrages voraus. Wenn die Einschränkung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen nicht freiwillig durch Vertrag geschieht, dann bleibt nur noch die Möglichkeit einer erzwungenen Freiheitseinschränkung durch Gewalt übrig. Die Maxime einer solchen erzwungenen Einschränkung der äußeren Freiheitssphären taugt jedoch nicht zu einem allgemeinen Gesetz, weil der Gewaltanwender notwendig aus ihr ausgenommen bleibt. Die Anerkennung eines bedingten Rechts zu lügen würde den Abschluss von Verträgen unter Menschen unmöglich machen. Wenn man die Maxime der bedingten Lüge als allgemeines Gesetz denkt, dann kann aus rechtlichen Gründen niemand jemals sicher sein, dass die anderen Vertragsparteien keinen (notwendig geheim gehaltenen) Rechtsgrund zu lügen haben. Damit Verträge überhaupt zustande kommen können, bedarf es an einem Mindestmaß an Vertrauen bezüglich der Absichtserklärung aller Vertragsparteien. Das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Aussagen aller Vertragsparteien ist die notwendige Bedingung dafür, dass jene überhaupt untereinander Verträge schließen. Nun würde das in Verträge gesetzte Vertrauen keine Grundlage mehr besitzen, wenn man beim Abschluss eines Vertrages mit anderen Menschen, einen immer möglichen geheimen Rechtsgrund zu lügen einrechnen müsste. Um Missverständnisse zu vermeiden, soll an dieser Stelle betont werden, dass Kant nicht auf einer empirischen Ebene argumentiert. Seine Ablehnung eines bedingten Rechts zu lügen ergibt sich nicht aus der empirisch möglichen Konsequenz, dass keine Verträge mehr geschlossen werden. Kant hat keine empirisch bedingte Unsicherheit im Sinne. Gemeint ist vielmehr eine apriorische Rechtsunsicherheit, welche den Abschluss von Verträgen zu einer rein empirisch-zufälligen Möglichkeit werden lässt. Es besteht zwar weiterhin die empirische Möglichkeit Verträge abzuschließen, aber diese bieten keine grundsätzliche rechtliche Verlässlichkeit mehr. Kant-Kritiker könnten an dieser Stelle den Einwand gelten machen, dass es Constant nur darum ging, das Recht zu lügen auf bestimmte Notlagen, denen der Mensch nur mittels einer Unwahrheit entgehen kann, einzuschränken. Der Fehler dieses Ansatzes liegt jedoch darin, dass es dem Belogenen in jedem Fall das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Rechtsgrundes zu einer Lüge unbekannt bleibt. Ein bedingtes Recht auf Lüge würde die gesetzliche Übereinstimmung der äußeren Freiheit aller Menschen unmöglich machen und ist somit eine Verletzung des Rechts der Menschheit. Aus der unaufhebbaren Rechtsunsicherheit, welche sich notwendigerweise aus 1191 Vgl. RL: VI, 237 - 229 - einem bedingten Recht zu lügen ergibt, folgt dass die Menschen aus einem rechtlichen Grund (und nicht aus empirischen, mithin bloß zufälligen Gründen) ebenso notwendigerweise den Absichten der anderen Menschen immer misstrauen müssen, was hingegen den Vertrag (der Idee nach) unbrauchbar macht. Das Vertrauen in die Absichtserklärung der anderen ist die notwendige Bedingung, unter welcher die Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, Verträge abzuschließen und somit überhaupt Rechte zu haben. Insofern die bedingte Lüge den Abschluss von Verträgen und somit die Möglichkeit von Rechten überhaupt unmöglich macht, fügt sie nicht notwendigerweise dem Angelogenen im Speziellen Schaden zu, wohl aber der Menschheit im Allgemeinen, zu welcher auch der Angelogene zählt. Bisher wurde Kants Argumentation ausschließlich als Antwort auf Benjamin Constant im Lügenaufsatz erörtert. In philosophiegeschichtlicher Perspektive stellt sich anschließend die Frage nach der Stellung des Lügenaufsatzes in Kants Gesamtwerk, insbesondere im Vergleich zu früheren Stellungnahmen Kants zum selben Thema. 1.3 Kants Argumentation zum rechtsphilosophischen Problem der Lüge in den weiteren Schriften Kants Argumentation im Lügenaufsatz hat äußerst wenig Zustimmung von den KantKommentatoren gefunden. Die Frage, welche sich vor diesem Hintergrund aufdrängt, ist zu wissen, ob Kants Argumentation im Lügenaufsatz als isolierte These betrachtet werden kann, welche sich nur als Reaktion auf die von Constant ausgeübte Kritik erklären lässt. Um diese Frage zu beantworten, soll im Folgenden auf Kants Erörterungen in der Rechtslehre, in Zum ewigen Frieden und in der Vorlesungsnachschrift Moralphilosophie Collins eingegangen werden. a) Die Argumentation in der Rechtslehre: Wahrhaftigkeit als Rechtspflicht gegen die Menschheit Nebst der Erörterung der Lüge als moralphilosophisches Problem in der Tugendlehre1192 findet sich auch in der Rechtslehre1193 eine Erörterung der Lüge als rechtsphilosophisches Problem. Die Rechtslehre wurde im Januar 1797 also noch vor dem Lügenaufsatz veröffentlicht. Eine aufmerksame Analyse des von Kant vorgetragenen Arguments in Über ein vermeintes Recht und in der Rechtslehre kommt zu dem Schluss, dass es zwischen den beiden Schriften keine erhebliche Meinungsänderung gibt.1194 In der Rechtslehre lassen sich Stellen finden, wo Kant die These einer bedingten Pflicht zur Wahrhaftigkeit zu verteidigen scheint. Dies ist zum Beispiel dort der Fall, wo zu lesen ist, dass das angeborene Recht der Menschheit auf dem allgemeinen gesetzlichen Gebrauch der äußeren Freiheit, auch das Recht enthält, anderen seine Gedanken mitzuteilen, unabhängig davon, ob sie wahr und aufrichtig oder unwahr und unaufrichtig sind, weil die Entscheidung darüber, ob dem Sprecher zu glauben ist, stets dem Hörer vorbehalten bleibt.1195 Ferner ist im Text ebenfalls zu lesen, dass im rechtlichen Sinne nur diejenige Unwahrheit Lüge genannt wird, welche dem Recht des Belogenen unmittelbar Abbruch tut.1196 Kant 1192 Vgl. TL: VI, 428ff. Vgl. RL: VI, 238 1194 Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch Annen und Geismann. Vgl. Annen, Martin: Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der deutschen Aufklärung. Ein Beitrag zur Ethik und Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Würzburg 1997, S. 116; Geismann, Georg: Versuch über Kants rechtliches Verbot der Lüge, in: Kant. Analysen - Probleme - Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer und Gerhard Seel, Würzburg 1988, S. 298f. 1195 Vgl. RL: VI, 238 1196 Vgl. RL: VI, 238 1193 - 230 - scheint sich zunächst zu widersprechen, wenn er schreibt, dass die Lüge schlechterdings verboten ist, und dass das angeborene Recht erlaubt, etwas unaufrichtig zu versprechen. Eine nähere Prüfung der Argumentation in der Rechtslehre lässt allerdings erkennen, dass Kant dort (freilich nur andeutungsweise) jene Argumente kritisiert, die er wenige Monate später ausdrücklich im Lügenaufsatz verwerfen wird. Den rechtlichen Unterschied zwischen Unwahrheit und Lüge hält Kant deshalb für „nicht unbegründet“, weil es „bei der bloßen Erklärung seiner Gedanken immer dem andern frei bleibt, sie anzunehmen wofür er will, obgleich die gegründete Nachrede, daß dieser ein Mensch sei, dessen Reden man nicht glauben kann, so nahe an den Vorwurf, ihn einen Lügner zu nennen, streift, daß die Grenzlinie, die hier das, was zum Ius gehört, von dem, was der Ethik anheim fällt, nur so eben zu unterscheiden ist“.1197 Eine klare Unterscheidung von Recht und Ethik könne den Unterschied von Unwahrheit und Lüge nicht rechtfertigen, da auch die moralisch verwerfliche Unwahrhaftigkeit dem Vorwurf der Lügenhaftigkeit ausgesetzt ist. Kants Ausführungen zur Lüge in der Rechtslehre haben für einige Missverständnisse gesorgt. Auf der Grundlage dieser Ausführungen sowie einiger Stellen zur Höflichkeitslüge versuchte zum Beispiel Herbert J. Paton seine These zu begründen, dass Kant nur diejenigen Unwahrheiten für Lügen hält, die einem anderen schaden, fruchtbar zu machen.1198 b) Die Argumentation in der Friedensschrift: Kants Zurückweisung der Lüge als berechtigtes Mittel der Politik In der im Jahre 1795 erschienen Friedensschrift weist Kant die Lüge als berechtigtes Mittel der Politik ebenso bedingungslos zurück wie zwei Jahre später im Lügenaufsatz. Kant fügt hier allerdings dem apriorischen Argument bezüglich der absoluten Rechtswidrigkeit der Lüge ein überzeugendes, empirisches Argument hinzu, demzufolge der Rückgriff auf die Lüge als Mittel der Politik nicht einmal als hypothetischer Imperativ gedeutet werden kann. Entsprechend handeln Politiker unklug, wenn sie lügen. Kant widmet sich gleich im ersten Präliminarartikel der Friedensschrift indirekt dem Problem der Lüge. Dieser Artikel verbietet den Abschluss eines Friedensvertrages mit dem geheimen Vorbehalt einer künftigen Revision, geschweige eines Bruches desselben.1199 In diesem Artikel wird das Substantiv „Lüge“ nicht verwendet. Kant spricht lediglich von „Vorbehalt (reservatio mentalis)“.1200 Dabei handelt es sich aber um eine besondere Art der Lüge: Der Politiker gibt seinen Friedenswillen für wahr aus, obwohl er sich dessen bewusst ist, dass es sich dabei um eine bloße Täuschung handelt, und dass er bei der erstbesten Gelegenheit versuchen wird, den abgeschlossenen Vertrag zu revidieren. Es wurde bereits gesehen, dass für Kant das Zustandekommen eines definitiven Friedensvertrages zwischen den Staaten von dem vorbehaltlosen, also ehrlichen Willen aller Vertragspartner abhängt, allen Feindseligkeiten ein tatsächliches Ende zu setzen. Es wird also ein Mindestmaß an Vertrauen und Zuverlässigkeit unter den Staaten vorausgesetzt. Sollte es bei einem Vertragspartner geheim gehaltene Vorbehalte geben, welche anschließend zur Nichteinhaltung der einmal zugestimmten Verpflichtungen führen sollten, so wird das notwendige Vertrauen in die Denkungsart des Gegenübers unmöglich. Die Lüge als Mittel der Politik macht somit den Vertrag als Instrument wechselseitiger Rechtsbestimmung prinzipiell unmöglich. 1197 RL: VI, 238 Vgl. Paton, Herbert J.: An alleged right to lie. A problem in Kantian ethics, in: Kant und das Recht der Lüge, hrsg. v. Georg Geismann und Hariolf Oberer, Würzburg 1986, S. 55. 1199 Vgl. Frieden: VIII, 343 1200 Frieden: VIII, 344 1198 - 231 - Kants Auseinandersetzung mit dem Problem der Lüge in der Friedensschrift beschränkt sich allerdings nicht auf den ersten Präliminarartikel. Auch im weiteren Verlauf des Textes lassen sich interessante Überlegungen zu diesem Thema finden. Im zweiten Definitivartiel zum ewigen Frieden stellt Kant die Behauptung auf, dass der Bezug auf die Idee des Rechts immer gegeben ist und zwar selbst für denjenigen Politiker, welcher der Moral jede objektiv praktische Realität, also ihre Ausführbarkeit entzieht. Dort schreibt er, dass es „sehr zu verwundern [ist], daß das Wort Recht aus der Kriegspolitik noch nicht als pedantisch ganz hat verwiesen werden können, und sich noch kein Staat erkühnt hat, sich für die letztere Meinung öffentlich zu erklären“.1201 Ferner weist er auf die „Huldigung, die jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenigstens den Worten nach) leistet“.1202 Letztlich ist im ersten Teil des Anhangs zu lesen, dass „die Menschen, eben so wenig in ihren Privatverhältnissen als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgehen können und sich nicht getrauen, die Politik öffentlich bloß auf Handgriffe der Klugheit zu gründen, mithin dem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorsam aufzukündigen […], sondern ihm an sich alle gebührende Ehre widerfahren lassen, wenn sie auch hundert Ausflüchte und Bemäntelungen aussinnen sollten, um ihm in der Praxis auszuweichen“.1203 Die hier vorgetragene Kritik richtet sich vornehmlich gegen das Handeln des sogenannten politischen Moralisten. Ein Politiker wird zu einem politischen Moralisten, wenn er gegenüber der Öffentlichkeit seine Handlungen moralisch zu rechtfertigen versucht, obwohl er sich ausschließlich an den Ratschlägen der Klugheit orientiert. Die Politiker können nicht riskieren die Existenz der Moral als solche öffentlich zu leugnen, sondern müssen stets Bezug auf den Rechtsbegriff nehmen. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der Bezug auf die Idee des Rechts bei dem politischen Moralisten ausschließlich rhetorischer Natur ist. Tatsächlich wird er gegen die moralischen Prinzipien verstoßen, die er bei der Begründung seines Handelns in Anspruch genommen hatte. Zu hinterfragen ist hier, warum für Kant der Bezug auf die Idee des Rechts - sei er bloß rhetorisch - selbst für den politischen Moralisten notwendig ist, obwohl dieser das Recht aller objektiven Realität abstreitet. Die Gründe hierfür werden von Kant nicht thematisiert, lassen sich jedoch leicht finden. Erstens: Der sich allein an Klugheit orientierende Politiker kann öffentlich nicht von seinen Maximen sprechen, da dies seinem Ziel widersprechen würde. Würde er öffentlich von der Machtpolitik sprechen, die er tatsächlich betreiben möchte, dann würde er auf den Widerstand seines Gegenübers stoßen. Wenn er also Erfolg haben will, muss der politische Moralist seine Absichten geheim halten. Zweitens: Unter den Bedingungen der Öffentlichkeit ist das politische Handeln stets auf Begründung und Zustimmung angewiesen (freilich nicht notwendigerweise auf Unterstützung, die eine aktive Dimension enthält). Es fällt auf, dass Zustimmung für das eigene Tun allein in Bezug auf Klugheit nur schwer zu erlangen ist. Um sein Handeln zu begründen und somit Zustimmung zu erhalten, muss der politische Moralist deshalb stets den Rechtsbegriff in Anspruch nehmen, obwohl er diesen insgeheim für ein sachleeres und unausführbares Ideal hält. Für Kant gerät aber der politische Moralist notwendigerweise in Widerspruch, wenn er bloß rhetorisch Bezug auf die Idee des Rechts nimmt. Kant unterstellt nämlich dem Handeln des politischen Moralisten die drei Maximen: fac et excusa; si fecisti, nega und divide et impera.1204 Die Kommentare Kants zu diesen drei „sophistischen Maximen“ sind vor allem für ihre polemische Brillanz von Wert. Vor dem Hintergrund des obigen Zitates verdient 1201 Frieden: VIII, 355 Frieden: VIII, 355 (meine Hervorhebung) 1203 Frieden: VIII, 376 1204 Vgl. Frieden: VIII, 374f. 1202 - 232 - dagegen folgende Pointe besondere Aufmerksamkeit. Für Kant gilt nämlich: „Durch diese politische Maximen wird nun zwar niemand hintergangen; denn sie sind insgesammt schon allgemein bekannt“.1205 In diesem Satz wird nicht nur die Popularität und die Banalität dieser Maximen hervorgehoben wie es gelegentlich zu lesen ist.1206 Entscheidend ist vielmehr, dass Kant hier die Lüge als Mittel der Politik diskreditiert. Hierfür führt er nicht länger apriorische, sondern pragmatische Argumente an. Seine Begründung lautet wie folgt: Da die Maximen, die dem Handeln des politischen Moralisten zugrunde liegen, allgemein bekannt sind, macht der bloße rhetorische Bezug auf die Idee des Rechts die Politik in zweierlei Hinsicht selbstwidersprüchlich. Der erste Widerspruch besteht darin, dass der politische Moralist niemals wirklich einlöst, was er in seiner Rhetorik bezüglich Moral und Recht angibt. Darüber hinaus gerät der sich allein an Klugheit orientierende Politiker in Widerspruch, weil jeder weiß, dass der Bezug auf Moral und Recht in der Begründung seines Handelns bloß vorgetäuscht ist. Jeder weiß, dass das wahrhafte Ziel der politischen Moralisten in der „Vergrößerung ihrer Macht, auf welchem Wege sie auch erworben sein mag“1207 besteht. Der politische Moralist gerät somit letztlich in die Position eines öffentlichen Lügners. Zu Recht schreibt Volker Gerhardt dazu: „Das Handeln des „politischen Moralisten“ widerspricht dem Wesen eines sowohl auf personale Glaubwürdigkeit wie auf öffentliche Konsequenz angewiesenen politischen Handelns und führt somit zur Selbstaufhebung der Politik“.1208 Die negativen Folgen der Lüge sind allerdings nicht nur für den betroffenen Politiker spürbar, sondern fallen auf die gesamte Gesellschaft zurück. c) Die Argumentation in der Moralphilosophie Collins: Kants ausdrückliche Anerkennung eines bedingten Rechts zu lügen Viele Verwirrungen über Kants Position zur Lüge sind darauf zurückzuführen, dass Kant in seiner Ethikvorlesung jene Lüge ausdrücklich für erlaubt hält, welche er im Lügenaufsatz ebenso ausdrücklich verwirft. In der sogenannten Moralphilosophie Collins spricht er sich ausdrücklich für ein bedingtes Recht auf Lüge im Notfall aus. Dort ist folgendes zu lesen, „z. E. es fragt mich jemand, der da weiß dass ich Geld habe, hast du denn Geld bei dir? – Schweige ich still, so schließt der andre daraus, dass ich es habe, sage ich ja, so nimmt er mir es ab, sage ich nein, so lüge ich, was ist hiebei zu tun? So ferne ich gezwungen werde durch Gewalt, die gegen mich ausgeübt wird, ein Geständnis von mir zu geben und von meiner Aussage ein unrechtmäßiger Gebrauch gemacht wird, und ich mich durch Stillschweigen nicht retten kann, so ist die Lüge eine Gegenwehr“.1209 Im unmittelbaren Anschluss daran schreibt Kant, dass „die abgenötigte Deklaration, die gemissbraucht wird, erlaubt mir mich zu verteidigen, denn ob er mir mein Geständnis aber mein Geld ablockt, ist einerlei. Also ist kein Fall, wo eine Notlüge stattfinden soll, als wenn die Deklaration abgezwungen wird und ich auch überzeugt bin, daß der andere einen unrechtmäßigen Gebrauch machen will“.1210 Hinzu kommt, dass Kant die tradierte Unterscheidung von „mendacium“ und „falsiloquium“ übernimmt.1211 Auf Grundlage dieser Unterscheidung vertritt Kant die These, dass „nicht jede Unwahrheit [...] 1205 Frieden: VIII, 375 Siehe zum Beispiel: De Castillo, Monique: Moral und Politik, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 204. 1207 Frieden: VIII, 375 1208 Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 171. 1209 Moralphilosophie Collins: XXVII, 448f. 1210 Moralphilosophie Collins: XXVII, 448f. 1211 Vgl. Moralphilosophie Collins: XXVII, 446f. 1206 - 233 - Lüge [ist], sondern wenn man sich äußerlich declariert, daß man dem andern seinen Sinn wolle zu verstehen geben“.1212 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kant zwei Situationen identifiziert, in welchen einem Menschen erlaubt ist unwahrhaftig zu sein. Erstens: Ein Befragter soll lediglich dann die Wahrheit sagen, wenn er einem anderen gegenüber deutlich erklärt, dass er seine Meinung äußern will. Falls er jedoch nicht angibt, dass er sich äußern will, dann handelt es sich bei der Falschaussage zwar um ein „falsiloquium“, nicht aber um ein „mendacium“.1213 Zweitens: Ein Befragter darf ebenfalls eine Falschaussage machen, wenn der Fragende offensichtlich die Wahrheit missbrauchen wird. In einem derartigen Fall, in welchem dem Fragenden kein Recht zukommt, die Wahrhaftigkeit zu fordern, kann der Fragende die Unwahrhaftigkeit des Befragten voraussetzen. Der Fragende weiß, dass der Befragte seine Gedanken zurückhalten wird und dass er kein Recht hat die Wahrheit zu fordern.1214 Wenn man diese Unterschiede einen kurzen Moment beiseitelässt, lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Lügenaufsatz und der Moralphilosophie Collins finden. In den beiden Texten ist ausdrücklich zu lesen, dass eine Lüge dem Belogenen kein Unrecht im Speziellen tut. In den beiden Texten wird die Lüge ebenfalls als eine Verletzung des „Rechts der Menschheit“1215 bezeichnet. Man sollte also jede strikte Entgegensetzung der Moralphilosophie Collins und des Lügenaufsatzes ein wenig relativieren. Es darf außerdem nicht übersehen werden, dass an unterschiedlichen Stellen seiner Vorlesung Kant das Gebot der Wahrhaftigkeit als eine absolute Verpflichtung darstellt. Auch dort ist unmissverständlich zu lesen, dass das Lügenverbot „kein problematischer Imperativus [ist], denn sonst müsste es heißen: Wenn es dir keinen Schaden bringt, denn sollst du nicht lügen, sondern es imperiert categorisch und schlechthin: du sollst nicht lügen“.1216 Ferner im Text heißt es, dass „wahrhaft zu seyn an sich selbst gut [ist], und in aller Absicht gut, und die Unwahrheit ist an sich selbst schändlich“.1217 Es besteht jedoch Erklärungsbedarf darüber, wie diese erheblichen Unterschiede zu deuten sind. Diesbezüglich weist Julius Ebbinghaus zu Recht darauf hin, dass in der Argumentation der Moralphilosophie Collins der Zusammenhang von Pflicht zur Wahrhaftigkeit und Möglichkeit von Vertragsabschluss noch nicht vorkommt.1218 An dieser Stelle soll daran erinnert werden, dass die Nachschrift von Collins aus dem Wintersemester 1784/85 stammt, also mehr als zehn Jahre vor der Veröffentlichung des Lügenaufsatzes und der Rechtslehre. Vor diesem Hintergrund mag es dagegen sehr verwundern, wie Herbert J. Paton dazu kommt, der von Kant in der Moralphilosophie Collins vertretenen These, den Vorrang vor seiner These im Lügenaufsatz einzuräumen. Und dies selbst, wenn er selber einräumt, dass man den Nachschriften nicht dieselbe Autorität geben kann, wie seinen veröffentlichten Werken.1219 Kants These, dass die Pflicht zur Wahrhaftigkeit selbst dann keine Ausnahme zulässt, wenn man durch eine Lüge ein mögliches Verbrechen verhindern könnte, wird in der 1212 Moralphilosophie Collins: XXVII, 448 Vgl. Moralphilosophie Collins: XXVII, 447 1214 Vgl. Moralphilosophie Collins: XXVII, 447 1215 Moralphilosophie Collins: XXVII, 447 1216 Moralphilosophie Collins: XXVII, 246f. 1217 Moralphilosophie Collins: XXVII, 257 1218 Vgl. Paton/Ebbinghaus, Briefwechsel, in: Kant und das Recht der Lüge, hrsg. v. Georg Geismann und Hariolf Oberer, Würzburg 1986, S. 70. 1219 Patons These ist nur ein Beispiel unter zahlreichen für die Versuchung die Texte aus dem Nachlass und aus den Vorlesungsnachschriften zu benützen, um sie als Gegenargument zu den von Kant veröffentlichen Werken anzuführen. Vgl. Paton, Herbert J.: An alleged right to lie. A problem in Kantian ethics, in: Kant und das Recht der Lüge, hrsg. v. Georg Geismann und Hariolf Oberer, Würzburg 1986, S. 57. 1213 - 234 - Sekundärliteratur gerne als Beispiel für die Widersprüchlichkeit der Kantischen Rechtslehre und ihre fehlende Antwort auf das Problem der Pflichtenkonflikte angeführt. 1.4 Das Problem der Pflichtenkollision am Beispiel des Lügenverbotes und des Hilfsgebotes Auf den folgenden Seiten soll einleitend kurz erläutert werden, was unter einem Pflichtenkonflikt überhaupt zu verstehen ist. Im Anschluss daran soll auf die nicht besonders ernst genommene Argumentation Kants eingegangen werden, wonach Pflichtenkonflikte undenkbar sind. Letztlich soll gezeigt werden, dass Kant mit der Anerkennung des Vorrangs der Rechtspflichten vor den Tugendpflichten ein stichhaltiges theoretisches Instrument entwickelt hat, um jeden intra-Pflichtenkonflikt zu vermeiden. a) Die Kritik an Kants mangelnder Beachtung der Pflichtenkonflikte Um die Kritik an Kants mangelnder Beachtung der Pflichtenkonflikte verstehen zu können, soll zunächst geklärt werden, was unter dem Begriff eines Pflichtenkonflikts überhaupt zu verstehen ist. Pflichtenkonflikte (Kant spricht eher von einem „Widerstreit der Pflichten“1220) beziehen sich auf Situationen, in welchen die Menschen zu zwei oder mehreren Handlungen verpflichtet sind, welche für sich selbst möglich, jedoch nicht zugleich durchführbar sind und sich somit wechselseitig ausschließen. Dies bedeutet, dass die Erfüllung der einen Pflicht notwendig mit der Verletzung einer anderen Pflicht einhergeht. Es handelt sich also um eine Situation, in der gilt: (i.) Ich soll X tun (ii.) Ich soll Y tun (iii.) Ich kann nicht zugleich X und Y tun. Das Bestehen eines Pflichtenkonflikts setzt voraus, dass die gebotenen Handlungen X und Y (insofern sie wirkliche Pflichten sind) nicht alternativ, sondern kumulativ gelten. Dies ergibt sich aus der Definition einer Pflicht als die objektive praktische Notwendigkeit gewisser Handlungen. Ein Pflichtenkonflikt liegt somit dann vor, wenn in einer bestimmten Situation der Handelnde sowohl die kategorisch gebotene Handlung X als auch die ebenso kategorisch gebotene Handlung Y tun soll. Der Konflikt liegt darin, dass der Handelnde in dieser Situation nicht zugleich X und Y tun kann und sich daher für eine der beiden Optionen X oder Y entscheiden muss. Nach einer weit verbreiteten Lesart gibt es im oben diskutierten Beispiel einen klaren Widerstreit zwischen einer Rechtspflicht und einer Tugendpflicht. Die gemeinte Rechtspflicht ist die absolute Pflicht auf Wahrhaftigkeit. Der im vorliegenden Fall als Tugendpflicht gebotene Zweck ist die Förderung der Glückseligkeit anderer Menschen, hier durch die Rettung des hilfsbedürftigen Menschen. Dieser Widerstreit wäre in dem Sinne nicht lösbar, als der Handelnde gezwungen wäre, eine bestehende Pflicht zu verletzen und damit etwas zu tun, was er vernünftigerweise nicht tun sollte. Pflichtenkonflikte zeichnen sich somit dadurch aus, dass es keine moralisch richtige Lösung bezüglich des Entscheidungskonflikts zwischen X und Y gibt. In der gegenwärtigen Philosophie wird die Möglichkeit von Pflichtenkonflikte häufig für unvermeidbar gehalten. Im Gegensatz dazu schließt Kant ausdrücklich die Möglichkeit von Pflichtenkonflikten aus. Bis heute findet seine These jedoch wenig Zustimmung. Auf seine These soll im folgenden Abschnitt nun näher eingegangen werden. 1220 RL: VI, 224 - 235 - b) Kants Argumentation bezüglich der Unmöglichkeit von Pflichtenkonflikten Für Kant sind Pflichtenkonflikte prinzipiell ausgeschlossen. Seine einfache wie überzeugende Begründung dieser These beruht auf der Annahme, dass die absolute Notwendigkeit des Sittengesetzes dessen Ausführbarkeit impliziert.1221 Wenn das moralische Gesetz eine Handlung gebietet, dann müssen die Menschen auch fähig sein, jene umzusetzen, weil im Sollen bereits das Können beinhaltet ist. In der Religionsschrift schreibt Kant explizit dazu: „[W]enn das moralische Gesetz gebietet: wir sollen jetzt bessere Menschen sein, so folgt unumgänglich: wir müssen es auch können“.1222 Kategorisch gebotene Handlungen sind nur jene Handlungen, welche die Menschen auch zu leisten imstande sind. Niemand kann die Pflicht haben etwas (logisch oder faktisch) Unmögliches zu tun. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass dieses Argument der Möglichkeit von Pflichtenkonflikten widerspricht. Denn, wenn erstens der Handelnde die Handlungen X und Y tun soll, und wenn zweitens jedes Sollen ein Können impliziert, dann folgt drittens daraus, dass er X und Y tun kann. Dies steht jedoch in Widerspruch zu den Voraussetzungen des Pflichtenkonflikts als eine Situation, in welcher der Handelnde die moralisch gebotenen Handlungen X und Y nicht zugleich tun kann. Es lassen sich zwei Auswegmöglichkeiten aus diesem Widerspruch denken: Man kann zunächst an der Behauptung festhalten, dass Pflichtenkonflikte durchaus möglich sind. In diesem Fall muss man allerdings (nach dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit) entweder auf die Annahme verzichten, dass jedes Sollen ein Können voraussetzt, oder muss man sich damit einverstanden erklären, dass zwei gegensätzliche Pflichten nicht kumulativ, sondern alternativ gelten. Wenn man jedoch die beiden zuvor erwähnten Auswegmöglichkeiten für irreführend hält, dann muss man der Auffassung sein, dass Pflichtenkonflikte weder tatsächlich noch möglich sein können. Wenn also zwei (scheinbare) Pflichten in Konflikt geraten, dann ist eine davon keine Pflicht. Dies entspricht gerade der von Kant vertretenen Position. In der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« vertritt Kant die These, dass eine Kollision von Pflichten überhaupt nicht denkbar ist. Gegen die Möglichkeit einer Kollision zwischen mehreren Pflichten führt Kant folgendes Argument an: „Ein Widerstreit der Pflichten (collisio officiorum s. obligationum) würde das Verhältniß derselben sein, durch welches eine derselben die andere [...] aufhöbe. – Da aber Pflicht und Verbindlichkeit überhaupt Begriffe sind, welche die objective praktische Nothwendigkeit gewisser Handlungen ausdrücken, und zwei einander entgegengesetzte Regeln nicht zugleich nothwendig sein können, sondern, wenn nach einer derselben zu handeln es Pflicht ist, so ist nach der entgegengesetzten zu handeln nicht allein keine Pflicht, sondern sogar pflichtwidrig: so ist eine Collision von Pflichten und Verbindlichkeiten gar nicht denkbar (obligationes non colliduntur)“.1223 Im unmittelbaren Anschluss daran unterscheidet er die „Verbindlichkeit“ vom „Grund der Verbindlichkeit“. Ein Konflikt von zwei Verbindlichkeiten kann es nicht geben. Wenn dagegen zwei Gründe der Verbindlichkeit einander widerstreiten, so erklärt Kant, dass der stärkere Verbindlichkeitsgrund den Vorrang verdiene. Im Wortlaut Kants heißt es: „Es können aber gar wohl zwei Gründe der Verbindlichkeit (rationes obligandi), deren einer aber 1221 W. A. Hart bezeichnet dies zutreffend als den „ought-implies-can principle“ und kommt zu dem folgenden Schluss: „A moral agent cannot think of himself as having incompatible duties, because he would have to think of himself as at one and the same time able to carry them out (because they are duties) and not able to carry them out (because they are incompatible)“ (Hart, W. A.: Nussbaum, Kant and Conflicts between Duties, in: Philosophy 73, 1998, S. 611). 1222 Religion: VI, 50 1223 RL: VI, 224 (meine Hervorhebungen) - 236 - oder der andere zur Verpflichtung nicht zureichend ist (rationes obligandi non obligantes), in einem Subject und der Regel, die es sich vorschreibt, verbunden sein, da dann der eine nicht Pflicht ist. – Wenn zwei solcher Gründe einander widerstreiten, so sagt die praktische Philosophie nicht: daß die stärkere Verbindlichkeit die Oberhand behalte (fortior obligatio vincit), sondern der stärkere Verpflichtungsgrund behält den Platz (fortior obligandi ratio vincit)“.1224 Kant schließt somit ausdrücklich die Möglichkeit einer Kollision zwischen mehreren Pflichten aus. Die Kantische Argumentation, deren Stringenz unbestreitbar ist, wird vielerlei abgelehnt, weil sie angeblich der Komplexität des konkreten Handelns und der menschlichen Entscheidungsprobleme nicht gerecht wird.1225 Im Folgenden soll kurz auf die gedrängte Argumentation Kants eingegangen werden. Die oben zitierte Argumentation aus der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten« beruht auf der Unterscheidung von rationes obligandi und rationes obligans. Ein rationes obligandi ist ein Verpflichtungsgrund, aus dem erst nach Abwägung mit anderen Verpflichtungsgründen eine verbindliche Pflicht, mithin ein rationes obligans, werden kann. Einer sich im Notfall befindlichen Person zu helfen, ist zunächst nichts weiter als ein Verpflichtungsgrund. Pflicht wird daraus erst dann, wenn ich die Mittel, die mir zugänglich sind, um den hilfsbedürftigen Menschen zu retten, einsetzen kann ohne damit einem stärkeren Verpflichtungsgrund entgegenzutreten.1226 Ein rationes obligandi kann somit zur Verpflichtung unzureichend sein (rationes obligandi non obligantes). Ein rationes obligans ist dagegen zur Verpflichtung stets ausreichend.1227 Kant zufolge kann es nur einen Widerstreit zwischen rationes obligandi geben, nicht zwischen rationes obligantes.1228 Wichtig ist an dieser Stelle zu bemerken, dass der Ausschluss einer Kollision von Pflichten an zwei wichtige Voraussetzungen gebunden ist: Nur die Verpflichtung mit dem jeweils stärksten Grund wird zur Pflicht. Im Falle widerstreitenden rationes obligandi kann es ausschließlich einen Grund geben, der stärker als alle anderen ist. Vor diesem Grund stellt sich die gewichtige Frage, ob es theoretische Instrumente gibt, um die widerstreitenden rationes obligandi in eine hierarchische Rangfolge zu bringen, die es ermöglicht, jene gegeneinander abzuwägen und letztlich einen Pflichtenkonflikt zu vermeiden. c) Der Vorrang der Rechtspflichten vor den Tugendpflichten Es wurde gesehen, dass es der Urteilskraft die Rolle zukommt, einander entgegengesetzte rationes obligandi abzuwägen und dadurch Pflichtenkonflikte zu vermeiden. Um die erforderliche Abwägung vornehmen zu können, ist die Urteilskraft auf Prioritätsregeln angewiesen. Eine erste Prioritätsregel, um einander entgegengesetzte Verbindlichkeitsgründe abzuwägen, übernimmt Kant aus der Tradition, indem er zwischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten unterscheidet. 1224 RL: VI, 224 Hingewiesen sei lediglich auf die exemplarische Stellungnahme von Alen W. Wood: „Kant clearly says too little here about a highly controversial issue. He makes things too easy for himself by considering duty only under the aspect of the necessity of an action – thus making a conflict of duties look like merely a modal (or rather a deontic) contradiction. [...] He also does not say how he proposes to deal with cases (which plainly can come up on any plausible theory of obligation) in which, through the commission of an action (which may itself be transgression), I put myself in a situation where I cannot act in any way that is not contrary to an obligation (for example, by contracting to sell the same piece of property to two different buyers). And if such cases can occur as a result of my action, why may they not also occur as a result of someone else’s action, or of other circumstances I did not create?” Vgl. Wood, Alen W: Kant’s Doctrine of Rights: Introduction, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 32. 1226 Vgl. Reflexion 6720: XIX, 140 1227 Vgl. Moralphilosophie Collins: XXVII, 259 1228 Vgl. Moralphilosophie Collins: XXVII, 280 1225 - 237 - Die Unterscheidung von vollkommenen Rechtspflichten und unvollkommenen Tugendpflichten in der »Einleitung zur Tugendlehre«1229 darf nicht mit der Einteilung in juridische und ethische Gesetze in der »Einleitung in die Metaphysik der Sitten«1230 verwechselt werden. Um Klarheit zu gewinnen, soll kurz auf diese ersten begrifflichen Unterscheidungen eingegangen werden. An dieser Stelle soll zunächst daran erinnert werden, dass das allgemeine Rechtsgesetz ein negatives Prinzip ist, anhand von welchem die menschlichen Handlungen auf ihre Rechtsmäßigkeit hin geprüft werden können. Entsprechend sind nur jene Handlungen rechtmäßig, welche der negativen Bedingung „einem Gesetz überhaupt nicht zu widerstreiten“1231 genügen. Dies hat zweierlei zu bedeuten. Es bedeutet zunächst, dass nur solche Handlungen rechtmäßig sind, die mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können. Es bedeutet ebenfalls, dass nur solche Handlungen rechtswidrig sind, die mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz nicht zusammen bestehen können. Die Rechtmäßigkeit einer Handlung ist jedoch nicht mit dem Pflichtcharakter einer Handlung gleichzusetzen. Wenn nämlich eine Handlung rechtswidrig ist, dann sind die Menschen dazu verpflichtet, diese Handlung zu unterlassen. Wenn jedoch eine Handlung rechtsmäßig ist, dann hat dies noch nicht zu bedeuten, dass die Menschen dazu verpflichtet sind, diese Handlung zu begehen. Wenn eine Handlung als rechtmäßig identifiziert wurde, dann stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage, ob diese Handlung bloß freigestellt oder auch geboten (also Pflicht) ist. Um festzustellen, ob eine rechtmäßige Handlung auch Rechtspflicht ist, muss ich mich fragen, ob das praktische Gegenteil derselben Handlung rechtswidrig ist.1232 Der Unterschied zwischen einer bloß freigestellten und einer gebotenen Handlung besteht darin, dass bei der bloß freigestellten Handlung auch deren praktisches Gegenteil rechtmäßig (erlaubt) ist, während das praktische Gegenteil der gebotenen Handlung rechtswidrig (verboten) ist.1233 Im Gegensatz zu den Tugendpflichten sind somit die Rechtspflichten keine positiven Begehungspflichten, sondern negative Unterlassungspflichten. Dies bedeutet, dass der Gegenstand jeder Rechtspflicht immer eine Unrechtsunterlassung ist. Kants erste Einteilung der Pflichten findet sich in der Grundlegung. Dort übernimmt er die herkömmliche Unterscheidung zwischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. Dies tut er allerdings nur vorläufig, um die Anwendungsbeispiele des kategorischen Imperativs zu ordnen. Er führt ausdrücklich aus, dass eine systematische Einteilung der Pflichten für eine künftige Metaphysik der Sitten vorbehalten werden muss.1234 Wichtig ist dabei zu sehen, dass Kant die Erzwingbarkeit als das herkömmliche definitorische Merkmal der vollkommenen Rechtspflichten nicht übernimmt. In der natürlichen Pflichtenlehre des 18. Jahrhunderts wurden nämlich die vollkommenen Rechtspflichten als solche genannt, weil die Pflicht des Einen immer dem Recht eines Anderen entspricht, wobei die Erfüllung dieser Pflicht gesetzlich erzwungen werden kann. Unvollkommene Pflichten sind dagegen solche, die nicht erzwungen werden dürfen (und können), das heißt deren Erfüllung allein von der Bereitschaft des Verpflichteten abhängt. Aus diesem Grund wird auch von geschuldeten (vollkommenen) Rechtspflichten und verdienstlichen (unvollkommenen) Tugendpflichten geredet. In dieser naturrechtlichen Tradition sind die geschuldeten Rechtspflichten den verdienstlichen Tugendpflichten hierarchisch übergeordnet, weil nur den Rechtspflichten absolute Notwendigkeit zukommt. In Abgrenzung dazu führt Kant in der Grundlegung aus, 1229 Vgl. TL: VI, 379ff. Vgl. RL: VI, 214ff. 1231 TL: VI, 389 1232 Vgl. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 144f. 1233 Vgl. Ebert, Theodor: Kants kategorischer Imperativ und die Kriterien gebotener, verbotener und freigestellter Handlungen, in: Kant-Studien 67, 1976, S. 570-583. 1234 Vgl. GMS: IV, 421 1230 - 238 - dass er unter einer vollkommenen Pflicht diejenige Pflicht versteht, die „keine Ausnahme zum Vortheil der Neigung verstatte“.1235 Diese Bestimmung der vollkommenen Pflichten bringt allerdings ernsthafte Probleme mit sich. Wenn man nämlich dieses definitorische Kriterium der vollkommenen Pflichten übernehmen würde, dann würde die Abgrenzung von vollkommenen und unvollkommenen Pflichten unbestimmt bleiben, da eine Pflicht (sei sie vollkommen oder unvollkommen) per definitionem die objektive praktische Notwendigkeit gewisser Handlungen ausdrückt. Es ist widersprüchlich sich eine Pflicht zu denken, die eine Ausnahme zum Vorteil der Neigung billigt und somit unterschiedliche Grade der Notwendigkeit zulässt. Dass Kant sich diesem Problem hinreichend bewusst war, zeigt sich in der Selbstkorrektur, die er in der Metaphysik der Sitten vornimmt. In der »Einleitung zur Tugendlehre«1236 bietet Kant ein ganz anderes Kriterium zur Unterscheidung der vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. Dieses Kriterium geht auf seine weitere Unterscheidung vom formalen und materiellen Prinzip zurück. So hat die Rechtslehre bloß mit der formalen Bedingung der äußeren Freiheit zu tun. Im Gegensatz dazu liegt der Tugendlehre ein materiales Prinzip zugrunde, welches den Menschen verpflichtet objektive-notwendige Zwecke zu verfolgen.1237 Kant unterscheidet zwei Zwecke, die zugleich Pflichten sind. Gemeint sind die eigene Vollkommenheit und die fremde Glückseligkeit.1238 Es ist jedoch unmöglich a priori zu bestimmen, welche genauen Handlungen die eigene Vollkommenheit und die fremde Glückseligkeit befördern. Aus diesem Grund kann die Tugendlehre keine Gesetze für die Handlungen geben, sondern nur für die Maximen der Handlungen. Dies bedeutet, dass die Tugendgesetze einen gewissen Spielraum bezüglich ihrer Befolgung zulassen. Diesbezüglich führt Kant folgendes aus: „[W]enn das Gesetz nur die Maxime der Handlungen, nicht die Handlungen selbst gebieten kann, so ist’s ein Zeichnen, daß es der Befolgung (Observanz) einen Spielraum (latitudo) für die freie Willkür überlasse, d.i. nicht bestimmt angeben könne, wie und wie viel durch die Handlung zu dem Zweck, der zugleich Pflicht ist, gewirkt werden solle“.1239 Aus dem erwähnten Spielraum bei der Befolgung der Tugendpflichten ergibt sich wiederum die Gefahr des Irrtums, weil die Menschen niemals vor einem falschen Gebrauch ihrer Urteilskraft sicher sein können. Wie die Tugendpflichten zu erfüllen sind, steht weitgehend offen und hängt von empirischen, mithin zufälligen Bedingungen ab. Dies trifft jedoch nur für die unvollkommenen Tugendpflichten zu. Die vollkommenen Rechtspflichten fordern dagegen unmittelbar, also ohne Bezugnahme auf einen bestimmten Zweck, bestimmte Handlungen. Sie lassen somit für ihre Erfüllung deutlich weniger Spielraum zu. Der wesentliche Unterschied von Tugendpflicht und Rechtspflicht liegt somit in ihrer verschiedenen Reichweite und ihrem Grad der Bestimmtheit. Auf die Frage „Was soll ich tun?“ gebietet das Rechtsgesetz unmittelbar präzise Handlungen, welche wenig Spielraum für den Grad und die Art der Befolgung zulassen (wie etwa: „Du sollst nicht lügen“). Das Tugendgesetz bestimmt dagegen materiale Zwecke, die zugleich Pflicht sind, und dessen Befolgung sich an die jeweilige Situation anpassen muss (wie etwa: „Du sollst einem sich im Notfall befindlichen Menschen helfen“). Für Kant sind die Rechtspflichten deshalb vollkommen, weil sie sich bestimmt und unmittelbar auf Handlungen beziehen. Ihre Befolgung ist somit von keiner Bedingung abhängig. Die Tugendpflichten sind dagegen unvollkommen, weil sie sich nicht auf die Handlungen selbst, sondern auf die ihnen zugrunde liegenden Maximen beziehen. Daraus folgt wiederum, dass die Tugendpflichten nur unter der Bedingung ihrer Konformität mit dem Rechtsgesetz zu erfüllen sind. Die Verwirklichung 1235 GMS: IV, 421 Vgl. TL: VI, 379ff. 1237 Vgl. TL: VI, 380 1238 Vgl. TL: VI, 385ff. 1239 TL: VI, 390 1236 - 239 - einer Tugendpflicht ist an die Bedingung ihrer Rechtmäßigkeit gebunden. Mit anderen Worten heißt es, dass die Rechtmäßigkeit eine notwendige Bedingung jeder Tugendhandlung ist. Dies erklärt, dass die vollkommenen Rechtspflichten von enger Verbindlichkeit sind, während die unvollkommenen Tugendpflichten von weiter Verbindlichkeit sind. In den Vorarbeiten zu der Metaphysik der Sitten ist folgendes zu lesen: „Alle Verbindlichkeit setzt nämlich ein Gesetz voraus. Geht dieses Gesetz bestimmt und unmittelbar auf die Handlung so daß die Art wie? und der Grad wie viel? in ihr ausgeübt werden soll im Gesetz bestimmt ist so ist die Verbindlichkeit vollkommen (obligatio perfecta) und das Gesetz ist stricte obligans“.1240 Im unmittelbaren Anschluss daran führt Kant folgendermaßen fort: „Gebietet aber das Gesetz nur nicht unmittelbar die Handlung sondern nur die M a x i m e der Handlung läßt es dem Urteil des Subjekts frei die Art wie und das Mass in welchem Grad das Gebotene ausgeübt werden solle nur daß so viel als uns unter den gegebenen Bedingungen möglich ist davon zu tun notwendig sei so ist die Verbindlichkeit unvollkommen und das Gesetz nicht von enger sondern nur weiter Verbindlichkeit late obligans“.1241 Festzuhalten ist hier, dass der absolute Vorrang der Rechtspflichten vor den Tugendpflichten jeden Konflikt zwischen beiden Pflichtarten vermeidet. Eine solche ist nur denkbar, wenn die Rechtsgesetze und die Tugendgesetze gleichermaßen bestimmt sein würden und sich unmittelbar auf die Handlungen beziehen würden. Dies entsprach mit Sicherheit der Ansicht Kants in seinen früheren Werken. In der Grundlegung scheint Kant davon auszugehen, dass der Tugendlehre sowie der Rechtslehre ein einziges formales Prinzip zugrunde liegen. In der Metaphysik der Sitten dagegen geht Kant davon aus, dass der Rechtslehre einerseits und der Tugendlehre andererseits zwei verschiedenen Prinzipien zugrunde liegen. Gemeint sind einerseits das formale Prinzip sowie andererseits das materiale Prinzip. Dieser Dualismus von formalem und materialem Prinzip, welcher erst in der Friedensschrift Erwähnung findet1242, ermöglicht es Pflichtenkonflikte zu vermeiden. Um Missverständnisse zu vermeiden soll allerdings gleich darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich in beiden Fällen um Pflichten handelt. Die Tugendpflicht ist in keiner Weise weniger Pflicht als die Rechtspflicht. Sowohl dem allgemeinen Tugendgesetz als auch dem allgemeinen Rechtsgesetz kommt (als Vernunftgesetz) absolute Notwendigkeit, strenge Allgemeinheit und die sich daraus ergebende objektive Geltung zu. Kants Einteilung der Pflichten wehrt sich somit gegen die Gefahr ihrer Abstufung. Für Kant kann es nicht verschiedene Grade der Verbindlichkeit von Pflichten geben. Die Gefahr einer Pflichtenkollision ist ausgeschlossen, aber nicht aufgrund einer dem Rechtspflicht allein zukommenden absoluten Notwendigkeit, sondern weil es sich jene unmittelbar auf Handlungen bezieht und nicht auf die ihr zugrunde liegende Maxime. Kants Argumentation in der Schrift Über ein vermeintes Rechts, aus Menschenliebe zu lügen hat eine philosophische Debatte ausgelöst, die bis heute kontrovers geführt wird. Die überwiegende Mehrheit der Kant-Kommentatoren steht dabei Kants These distanziert gegenüber. Die einsichtigen Kommentatoren müssen jedoch einräumen, dass Kants These ernst zu nehmen ist. Es ist unter anderem der Verdienst von Julius Ebbinghaus und Georg Geismann entgegen einer weit verbreiteten Ansicht gezeigt zu haben, dass Kants Ablehnung eines bedingten Rechts zu lügen keinesfalls auf ein rigoristisches Vorurteil gegen die Lüge zurückzuführen ist, sondern konsistent rechtsphilosophisch begründet ist. Des Weiteren wird Kants Position zur Lüge vielerlei vorgeworfen, dass sie zu einer ausweglosen Pflichtenkollision zwischen dem rechtlichen Gebot der Wahrhaftigkeit und dem moralischen Gebot der Hilfe zur bedürftigen Menschen führt. Es wurde jedoch gesehen, dass die Vorrangstellung der Rechtspflichten vor den Tugendpflichten die Möglichkeit von intra1240 Vorarbeit: XXIII, 394 Vorarbeit: XXIII, 394 1242 Vgl. Frieden: VIII, 376f. 1241 - 240 - Pflichtenkonflikte ausschließt. Konkret ergibt sich in Bezug auf das rechtliche Verbot der Lüge folgendes: Anderen wohlzutun ist eine weite Tugendpflicht, die wir verpflichtet sind in unsere Maxime aufzunehmen. Dieser weiten Tugendpflicht sollen wir jedoch nur soweit nachkommen, als deren Befolgung nicht mit einer engeren Rechtspflicht kollidiert. Wenn die weite Tugendpflicht zum Schutz des Leben anderer in Widerspruch mit der engeren Rechtspflicht zur Wahrhaftigkeit steht, dann behält allein die Rechtspflicht die Oberhand. Des Weiteren wurde gesehen, dass ein bedingtes Recht zu lügen die Gesellschaft eben nicht aufrecht erhält, sondern sie vielmehr unmöglich machen würde und somit das Recht der Menschheit verletzen würde. Damit hat Kant mitnichten einen weltfremden, folgenblinden Rigorismus vertreten, sondern vielmehr die konsequente These der absoluten und ausnahmslosen Notwendigkeit des Rechts. Kants wohlbegründete These, dass die Verletzung einer Rechtspflicht unter keinen Umständen zu erlauben sei, vor allem eben auch nicht aus einem gutartigen Motiv heraus, wie es das Gefühl des Mitleides darstellt, trägt erheblich zur Rechtssicherheit und Rechtsgewissheit bei. Das Recht darf keine Ausnahme zugunsten des Mitleids zulassen. Für Kant ist das Gefühl des Mitleids eine gutartige Leidenschaft, die jedoch jederzeit „blind“, d. h. unvernünftig ist. In ihr erblickt er eine Gefahr, welche dazu verleiten kann, wider der Pflicht zu verstoßen. In der Kritik der praktischen Vernunft führt Kant folgendes aus: „Neigung ist blind und knechtisch, sie mag nun gutartig sein oder nicht, und die Vernunft, wo es auf Sittlichkeit ankommt, muß nicht blos den Vormund derselben vorstellen, sondern, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, als reine praktische Vernunft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen. Selbst dies Gefühl des Mitleids und der weichherzigen Theilnehmung, wenn es vor der Überlegung, was Pflicht sei, vorhergeht und Bestimmungsgrund wird, ist wohldenkenden Personen selbst lästig, bringt ihre überlegte Maximen in Verwirrung und bewirkt den Wunsch, ihrer entledigt und allein der gesetzgebenden Vernunft unterworfen zu sein“.1243 Der Mensch hat also eine unbedingte Rechtspflicht zur Wahrhaftigkeit. Im Falle einer Lüge ist der Mensch „für alle Folgen, die daraus entspringen möchten, auf rechtliche Art verantwortlich“.1244 Er kann sich keinesfalls auf ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen berufen, um sein Handeln zu rechtfertigen. Worauf sich der Lügner jedoch sehr wohl berufen kann ist das uns schon bekannte Notrecht (ius necessitatis), welches freilich kein Recht ist. Einige Autoren wie Hans Wagner argumentieren plausibel, dass die Argumentation aus der Rechtslehre sich auf den Notfall des Lügenden übertragen lässt.1245 Es wird argumentiert, dass es auch in einem derartigen Fall prinzipiell keine richterliche Entscheidung geben kann, weder zugunsten des Angelogenen (der kein Recht auf die Wahrhaftigkeit hat) noch zugunsten des Lügners (der seinerseits kein Recht zu lügen hat). Nichts spricht dagegen die hier anzutreffende rechtliche Offenheit voll zugunsten des Lügners zu nutzen, insofern dieser sich in der zuvor beschriebenen Zwangslage befunden hat. Die subjektive Straflosigkeit des Lügners würde mitnichten ein objektives Recht zu lügen begründen. Die absolute Pflicht zu Wahrhaftigkeit in Aussagen würde somit nach wie vor bestehen bleiben. Diese These scheint außerdem durch Kants Ausführungen in der Praktische Philosophie Powalski bekräftigt zu werden. Dort ist zu lesen, dass im Notfall die Lüge „nicht gerechtfertigt obgleich verziehen werden kann, obgleich sie an und vor sich nicht gerechtfertigt werden kann“.1246 Der Notfall wäre zwar vor dem Höchsten Wesen jederzeit unverzeihlich, jedoch vor dem 1243 KpV: V, 118 Vermeintes Recht: VIII, 427 1245 Vgl. Wagner, Hans: Kant gegen ein vermeintes Rechts, aus Menschenliebe zu lügen, in: Kant-Studien 69, 1978, S. 90-96. 1246 Praktische Philosophie Powalski: XXVII, 231ff. 1244 - 241 - „Menschlichen Richter Stuhle“ könne die Gültigkeit durch die Not überwogen werden, so dass „in Ansehung mancher Lüge [...] es oft der fragilitati humanae zu verzeihen“1247 ist. Die vorherigen Ausführungen beziehen sich auf den Fall eines Konflikts zwischen einer unvollkommenen Tugendpflicht und einer vollkommenen Rechtspflicht. Schwieriger zu beantworten, ist die Frage, an welchen weiteren Kriterien sich die Urteilskraft orientieren kann, um zu wissen, welcher Verpflichtungsgrund den Platz behalten soll (fortior obligandi ratio vincit), wenn zwei Gründe der Verbindlichkeit prima facie gleich stark scheinen. Die Urteilskraft kann sich hierfür an verschiedenen empirischen Kriterien orientieren. Solche Kriterien sind uns bereits aus dem vorhergehenden Kapitel bekannt. Gemeint sind zum Beispiel die Anzahl der Betroffenen1248, die Dringlichkeit der gebotenen Handlungen, die Einsetzbarkeit der eigenen Kapazitäten, usw. 2. Kants Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft vor dem Hintergrund seiner Theorie der Politik Kant verwendet an einigen bedeutenden Stellen seiner rechtsphilosophischen Schriften den Begriff eines Erlaubnisgesetzes (lex permissiva). Dies ist zunächst der Fall in zwei Fußnoten am Ende des ersten Abschnittes sowie im ersten Anhang der Friedensschrift.1249 In der zwei Jahre später erschienenen Rechtslehre benutzt Kant den Begriff des Erlaubnisgesetzes wiederum an drei Stellen. Eine erste Stelle findet sich im § 2 bezüglich des Postulats der praktischen Vernunft.1250 Außerdem findet sich eine andere Stelle im § 16 bezüglich des Sachenrechts1251 sowie letztlich im § 22 bezüglich des Eherechts.1252 Bemerkenswert ist dagegen die Tatsache, dass die Verwendung des Begriffs des Erlaubnisgesetzes nicht in Kants früheren geschichts- und moralphilosophischen Werken vorkommt. Außerdem geht Kant in der Friedensschrift mit diesem Begriff noch ausgesprochen vorsichtig um. Dies deutet darauf hin, dass Kant bis noch zu Beginn der 1790er Jahren sich hinsichtlich der Möglichkeit und dem Inhalt eines Erlaubnisgesetzes unsicher war. Dies erklärt vielleicht, weshalb über einen langen Zeitraum hinweg den Erlaubnisgesetzen in der Kant-Forschung ausgesprochen wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es ist schließlich der Verdienst von Reinhard Brandt auf die gewichtige Rolle der lex permissiva hingewiesen zu haben.1253 In einem einflussreichen Aufsatz vertrat er die These, dass Kants Umgang mit dem Begriff eines Erlaubnisgesetzes, wie jener in der Friedensschrift angeführt ist, auch maßgeblich für das rechtliche Postulat der praktischen Vernunft gilt, welches auf diese Weise zu einer provisorischen Bestätigung des faktischen Besitzes im Hinblick auf künftige gerechte Zustände darstelle. Diese Interpretation der Erlaubnisgesetze war der Anlass einer bis einschließlich heute anhaltenden Auseinandersetzung mit dem 1247 Praktische Philosophie Powalski: XXVII, 231ff. Vgl. Cummiskey, David: Kantian Consequentialism, New-York 1996, Kapitel 8, insbesondere S. 141-143. 1249 Vgl. Frieden: VIII, 347f., 373f. 1250 Vgl. RL: VI, 247 1251 Vgl. RL: VI, 267f. 1252 Vgl. RL: VI, 276f. 1253 Vgl. Brandt, Reinhard: Das Erlaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants Rechtslehre, in: Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel, hrsg. v. Reinhardt Brandt, Berlin – New York 1982, S. 233-285. Eine stark gekürzte Version findet sich in: Ders.: Das Problem der Erlaubnisgesetz im Spätwerk Kants, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 69-86. 1248 - 242 - Begriff des Erlaubnisgesetzes.1254 Die teilweise heftige Debatte, welche sich über die Deutung durch Reinhard Brandt entflammte, kann hier nicht im Einzelnen wiedergeben werden. Es ist jedoch festzuhalten, dass die Debatte sich vornehmlich auf die Erlaubnisgesetze im Zusammenhang mit dem Privatrecht konzentriert hat, wobei der genauen Funktion der Erlaubnisgesetze innerhalb Kants Rechtstheorie vom Weltfrieden weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Mit Sicherheit handelt es sich hier um ein bislang zu wenig beachtetes Thema, das häufig missverstanden wird und schon deshalb eine nähere Betrachtung verdient. Das Thema, welches im Folgenden behandelt wird, soll genauer gesagt auf die Frage nach den Erlaubnisgesetzen vor dem Hintergrund des politischen Handelns beschränkt sein. Es handelt sich dabei um jenen Zusammenhang, in welchem Kant diesen Begriff in der Friedensschrift eingeführt hat. Kants Erörterungen in der Rechtslehre bezüglich des Privatrechts werden dahingegen weitgehend außer Acht gelassen. In den folgenden Ausführungen soll die These vertreten werden, dass Kant in der Friedensschrift einen Freiraum für die Politik anerkennt, welcher selbst einen vernunftrechtlichen Grund hat. 2.1 Die Widersprüchlichkeit eines Gesetzes in Bezug auf bloß erlaubte Handlungen In einem zu wenig beachteten Aufsatz aus den 1970er Jahren macht Theodor Ebert darauf aufmerksam, dass Kant in der Einleitung der Rechtslehre zwischen zwei Bedeutungen des Erlaubtseins unterscheidet.1255 In einem allgemeinen Sinne ist eine Handlung erlaubt, wenn sie nicht verboten ist. Mit Kants eigenen Worten heißt es: „Erlaubt ist eine Handlung (licitum), die der Verbindlichkeit nicht entgegen ist“.1256 In diesem allgemeinen Sinne gehören auch gebotene Handlungen zu den erlaubten Handlungen. In einem spezifischeren Sinne ist eine Handlung ebenfalls erlaubt, wenn sie weder geboten noch verboten ist. Kant spricht dann von bloß erlaubten Handlungen. In Kants eigenen Worten: „Eine Handlung, die weder geboten noch verboten ist, ist bloß erlaubt, weil es in Ansehung ihrer gar kein die Freiheit (Befugniß) einschränkendes Gesetz und also auch keine Pflicht giebt. Eine solche Handlung heißt sittlich-gleichgültig (indifferens, adiaphoron, res merae facultatis)“.1257 Im Gegensatz zu diesen sittlich-gleichgültigen, also bloß erlaubten Handlungen können erlaubte Handlungen auch Pflicht sein. Zu hinterfragen ist hier, in welchem systematischen Zusammenhang praktische Gesetze zu Handlung stehen können, die weder geboten noch verboten sind und deren Begehung oder Unterlassung also keine Pflicht ist. In der Friedensschrift führt Kant aus, dass der Begriff einer lex permissiva „sich einer systematisch-eintheilenden Vernunft von selbst darbietet“.1258 Wie diese Einteilung genau aussehen soll, wird von Kant in der Friedensschrift allerdings nicht direkt erörtert. Wenn aber alle menschlichen Handlungen entweder geboten, verboten oder sittlich-gleichgültig sind und wenn alle diese Handlungen jeweils unter einem Gesetz stehen müssen, dann scheint es für jede Art von Handlungen auch ein entsprechendes Gesetz geben zu müssen, welches den Menschen eine entsprechende Pflicht auferlegt. Gemeint sind hier Gebotsgesetze, Verbotsgesetze und Erlaubnisgesetze. Nun soll in Erinnerung behalten werden, dass im 1254 Vgl. Oberer, Hariolf: Sittengesetz und Rechtsgesetz a priori, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Bd. III, Würzburg 1997, S. 157-200. In jüngerer Vergangenheit wurde diese Thematik wieder intensiver diskutiert. Vgl. Hruschka, Joachim: The permissive law of practical reason in Kant’s “Metaphysics of Morals”, in: Law and Philosophy 23, 2004, S. 45-72; Kaufmann, Matthias: Was erlaubt das Erlaubnisgesetz und wozu braucht es Kant?, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 13, 2005, S. 195-219. 1255 Vgl. Ebert, Theodor: Kants kategorischer Imperativ und die Kriterien gebotener, verbotener und freigestellter Handlungen, in: Kant-Studien 67, 1976, S. 571ff. 1256 RL: VI, 222 1257 RL: VI, 223 1258 Frieden: VIII, 348 - 243 - zweiten Abschnitt der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Kant eine allgemeine Formel sowie drei besondere Formeln des kategorischen Imperativs anführt – die Formel des Naturgesetzes, die Formel der Menschheit als Zweck an sich selbst und die Formel des Reichs der Zwecke als ein Reich der Natur. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass alle diese Formeln ausschließlich strikte Gebote oder Verbote aussprechen. Diese haben wiederum praktischobjektive Notwendigkeit, das heißt sie schreiben allen Menschen verbindlich vor etwas zu tun oder zu unterlassen. Alle Maximen, welche unserem Handeln zugrunde liegen, sollen nämlich den Charakter der Vernunftnotwendigkeit besitzen, wenn sie moralisch gelten sollen. Aus diesen Ausführungen scheint die Schlussfolgerung hervorzugehen, dass es innerhalb der Kantischen Rechtslehre widerspruchsfrei kein Erlaubnisgesetz geben kann. Eine bestimmte Handlung ist nämlich bloß erlaubt, wenn es jemandem freisteht, diese Handlung nach seinem Belieben zu tun oder zu unterlassen. Wie bereits gesehen gibt es in Bezug auf bloß erlaubte Handlungen „gar kein die Freiheit […] einschränkendes Gesetz und also auch keine Pflicht“1259 und somit auch keine Nötigung. Aus diesem Grunde wäre ein Gesetz in Bezug auf solche bloß erlaubte Handlungen – also ein Erlaubnisgesetz – widersprüchlich, da dieses Gesetz eine Nötigung zu einer Handlung enthalten würde, wozu jemand nicht genötigt werden kann.1260 In den Vorarbeiten zur Friedensschrift bringt Kant dies folgendermaßen auf den Punkt: „Sonst überall braucht man kein Gesetz um sagen zu können, dass etwas erlaubt sei“.1261 Kant ist sich diesem Einwand durchaus bewusst. In der Friedensschrift schreibt er folgendes dazu: „Ob es außer dem Gebot (leges praeceptivae) und Verbot (leges prohibitivae) noch Erlaubnißgesetze (leges permissivae) der reinen Vernunft geben könne, ist bisher nicht ohne Grund bezweifelt worden“.1262 Nichtsdestoweniger benutzt Kant den Begriff eines Erlaubnisgesetzes an zwei Stellen in der Friedensschrift. Aus den vorhergehenden Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass das Erlaubnisgesetz sich nicht auf sittlich-gleichgültige Handlungen beziehen kann. Tatsächlich benutzt Kant den Begriff eines Erlaubnisgesetzes in Bezug auf sittlich nicht gleichgültige Handlungen, das heißt auf verbotenen Handlungen. In einem weiteren Schritt soll also auf die Frage eingegangen werden, was Erlaubnisgesetze überhaupt sind, worauf sich diese genau beziehen und wie Kant die Zulässigkeit solcher Gesetze begründet. 2.2 Kants Bestimmung und Begründung der Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft Kant führt den Begriff eines Erlaubnisgesetzes in einer langen Fußnote am Ende des ersten Abschnitts der Friedensschrift ein. An dieser Stelle weist er zunächst darauf hin, dass alle sechs Präliminarartikel „lauter Verbotsgesetzte (leges prohibitivae)“1263 sind, welche bestimmte kriegsverursachende oder friedensverhindernde staatliche Handlungen und Institutionen untersagen. Zur Erinnerung seien die sechs Verbote, die in den Präliminarartikeln enthalten sind, kurz aufgeführt: (1) Das Verbot des geheimen Vorbehalts bei Friedensschlüssen, (2) das Verbot der Erwerbung eines für sich bestehenden Staates, (3) das Verbot des Wettrüstens, (4) das Verbot der Staatsverschuldung in Beziehungen auf äußere Konflikte, (5) das Verbot gewaltsamer Intervention in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates, und (6) das Verbot ehrloser Kriegshandlungen. Alle diese sechs Verbote haben objektiv-praktische Notwendigkeit, das heißt sie binden unbedingt und ausnahmslos jeden Machthabenden. Es ist also eine unbedingte Rechtspflicht diesen normativen Sätzen 1259 RL: VI, 223 Vgl. Frieden: VIII, 348 1261 Vorarbeit: XXIII, 157 1262 Frieden: VIII, 347f. 1263 Frieden: VIII, 347 1260 - 244 - gemäß zu handeln. Jene bestimmen nämlich die notwendigen Bedingungen, unter denen der Abschluss eines definitiven Friedensvertrages zur Überwindung des Naturzustandes überhaupt erst möglich ist. Letzterer lässt sich wiederum erst auf Grundlage der drei Definitivartikel erreichen, welche die positiven Rechtsbedingungen der Möglichkeit des ewigen Friedens enthalten. Anschließend teilt Kant dennoch die Präliminarartikel in zwei Gruppen ein. Er unterscheidet zwischen leges strictae (Artikel Nr. 1, 5, 6) und leges latae (Artikel Nr. 2, 3, 4). Während die ersteren unter allen Umständen und sofort zu erfüllen sind, hängt die Befolgung der zweiten von den Umständen ab und kann somit zeitweilig aufgeschoben bzw. allmählich geleistet werden. Derartige Rechtsgesetze sind Erlaubnisgesetze (leges permissivae) der reinen Vernunft. Unter dem Begriffe eines Erlaubnisgesetzes sind hier also jene Gesetze zu verstehen, die zwar objektiv-praktische Notwendigkeit haben, aber dennoch keinen unverzüglichen Vollzug vorschreiben. Entsprechend erlauben sie die vorläufige Weiterführung eines an sich unrechtmäßigen faktischen Zustandes. Wie aber begründet Kant diese Verzögerung bei der Anwendung unbedingt gebotener Gesetze? Denn die Vernunftgesetze sind in der Regel hier und sofort zu befolgen. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Kant sich hier mit einer spezifisch rechtsphilosophischen Problematik auseinandersetzt. Mit Kants eigenen Worten könnte man sagen, dass die Erlaubnisgesetze nicht generell ethische (d.h. zur Tugendlehre gehörige), sondern spezifisch juridische (d.h. das Recht der Menschen und Staaten in ihren äußeren Verhältnissen betreffende) Gesetze sind. Deshalb werden ausschließlich Rechtsgründe angeführt, um die Verzögerung bei der Anwendung der unbedingt gebotenen Gesetze zu begründen. Kant schreibt zunächst nur, dass die Verzögerung bei der Einhaltung der leges latae erlaubt sein soll „damit sie nicht übereilt und so der Absicht selbst zuwider geschehe“.1264 Weiteren Aufschluss gibt uns der folgende Passus: „Dies sind Erlaubnißgesetze der Vernunft, den Stand eines mit Ungerechtigkeit behafteten öffentlichen Rechts noch so lange beharren zu lassen, bis zur völligen Umwälzung alles entweder von selbst gereift, oder durch friedliche Mittel der Reife nahe gebracht worden: weil doch irgend eine rechtliche, obzwar nur in geringem Grade rechtmäßige, Verfassung besser ist als gar keine, welches letztere Schicksal (der Anarchie) eine übereilte Reform treffen würde“.1265 Die provisorische Duldung des im Naturzustand unter den Staaten bereits Gegebenen ist nur in jenen Fällen begründet, wo die sofortige Erfüllung einer aus der Vernunft hergeleiteten Rechtspflicht zu einem Selbstwiderspruch führen würde, weil dadurch gegen Recht verstoßen würde, welches selbst Ausdruck der Vernunft ist. Das Erlaubnisgesetz gestattet also, dass unter bestimmten historischen Bedingungen, welche der Durchführung eines Gesetzes derart entgegenstehen, dass jeder Versuch seiner sofortigen Befolgung notwendigerweise ein Rechtsverstoß zur Folge hat, man sich der Befolgung enthalten muss. Dies ist insofern folgerichtig, dass die unmittelbare Begehung eines Unrechts durch die sofortige Durchführung einer gebotenen Handlung, um dadurch wiederum mittelbar einen gebotenen Zustand zu erzeugen, selbstwidersprüchlich und somit unvernünftig ist.1266 Das Erlaubnisgesetz ist letztlich das vernunftrechtliche Instrument, anhand von welchem eine Pflichtkollision (freilich nicht eine Pflichtenkollision) vermieden wird. Es geht nicht darum, eine Kollision zwischen zwei einander entgegengesetzter Pflichten zu vermeiden, sondern es geht vielmehr darum zu vermeiden, dass eine besondere Pflicht selbstwidersprüchlich wird, das heißt, dass ihre Erfüllung aufgrund der empirischen Gegebenheiten zu einem umgekehrten Ergebnis führt. 1264 Frieden: VIII, 347 Frieden: VIII, 373 1266 Vgl. Oberer, Hariolf: Sittengesetz und Rechtsgesetz a priori, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Bd. III, Würzburg 1997, S. 199. 1265 - 245 - An dieser Stelle soll daran erinnert werden, dass es das Postulat der reinen praktischen Vernunft ist, welches mit apodiktischer Gewissheit besagt, dass die Staaten sowie die Menschen den rechtlosen Naturzustand verlassen und in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand eintreten sollen. Einerseits sind die Staaten dazu verpflichtet etwa ihr stehendes Heer oder ihre Staatsschulden zur Kriegsführung abzuschaffen. Andererseits sind aber die Staaten dem unbedingten Gebot der Selbsterhaltung verpflichtet. Genauer gesagt, sind sie an die strenge Rechtspflicht gebunden, weiterhin ihre innere Rechtssicherheit und damit die Freiheit ihrer Bürger zu garantieren. Genau gesehen stellen die zwei letztgenannten Pflichten die zwei Seiten einer und derselben Pflicht dar. Es handelt sich dabei um die unbedingte Rechtspflicht aus dem rechtlosen Naturzustand herauszutreten. Es würde ein Widerspruch entstehen, wenn die überstürzte Erfüllung eines Präliminarartikels die eigene Existenz als Staat und das mit ihr im Inneren bereits erreichte Maß an Rechtssicherheit und somit an bürgerlicher Freiheit gefährden würde.1267 Die überstürzte Erfüllung der Rechtspflichten durch die Staaten, um den Naturzustand zu verlassen, würde sich selbst widersprechen, wenn die Staaten gerade aus diesem Grund ihre eigene Existenz gefährden müssten. Aus rechtlichen Gründen ist es also den Staaten verboten die aus der reinen praktischen Vernunft entspringenden Rechtsprinzipien bedingungslos in die Wirklichkeit umzusetzen. Obwohl die Staaten unbedingten Rechtspflichten unterliegen, können sie – und dürfen sie – diesen jedoch nicht immer sofort nachkommen. 2.3 Kants Ablehnung von Ausnahmen von den praktischen Gesetzen Kants Forderung nach einer bedingungslosen Regelbefolgung hat ein gewisses Unbehagen, wenn nicht sogar eine starke Ablehnung auf der Seite vieler Kommentatoren hervorgerufen. Mit seiner strikten Beharrung auf die absolute Verbindlichkeit der Vernunftgesetze erhebt Kant eine Gegenstimme zum vorherrschenden, empirischpragmatischen Denken in der gegenwärtigen Moral- und Rechtsphilosophie. Entgegen Kants Beharrung auf die absolute Verbindlichkeit der Vernunftgesetze sprechen sich viele Autoren für flexible Einzelfallentscheidungen aufgrund pragmatischer Erwägungen aus. Kant wird unter anderem für seinen (vermeintlichen) legalistischen Rigorismus sowie für seine Unfähigkeit die Ausnahme zu denken kritisiert. Dagegen würde Kant den Einspruch erheben, dass die Zulassung von Ausnahmen den sanften Tod der Moral verursachen würde. In der Kritik der reinen Vernunft unterscheidet Kant zwischen „komparativer“ (relativer) und „strenger“ (absoluter) Allgemeinheit.1268 Die erste lässt Ausnahmen zu, die zweite jedoch nicht. Das Unterscheidungskriterium besteht für Kant in der Abhängigkeit von der Erfahrung. Wenn eine Regel von der Erfahrung abgeleitet ist, dann lässt sie nur komparative, mithin relative Allgemeinheit zu. Diesbezüglich ist in der ersten Kritik folgendes zu lesen: Die Erfahrung gibt ihren Urteilen nie „wahre oder strenge, sondern nur angenommene und komparative Allgemeinheit (durch Induction), so daß es eigentlich heißen muß: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme“.1269 Eine Regel muss somit gänzlich von den empirischen Bedingungen abstrahieren, um strenge, mithin absolute Allgemeinheit beanspruchen zu können. In Kants eigenen Worten heißt es: „Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit gedacht, d. i. so, daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig“.1270 Um diesen Unterschied deutlich zu machen unterscheidet Kant ebenfalls die strenge Allgemeinheit (universalitas) einer Regel 1267 Vgl. Frieden: VIII, 373; Streit: VII, 93 Vgl. KrV: III, 29 1269 KrV: III, 29 1270 KrV: III, 29 1268 - 246 - von ihrer bloßen Allgemeingültigkeit (generalitas).1271 Im ersten Fall ist die Geltung der Regel universell, im zweiten nur generell. In der empirischen Naturwissenschaft kommt man nicht ohne Ausnahmen aus. Dies ist im Wesentlichen auf zweierlei Gründe zurückzuführen. Ein erster Grund besteht schließlich darin, dass ihre Erkenntnisse aus unvollständigen Induktionen gewonnen wurden. Ein weiterer Grund besteht darin, dass die Erfahrung uns vielleicht lehren kann, wie etwas beschaffen ist, jedoch nicht, dass es nicht anders sein könnte. In der empirischen Naturwissenschaft sind somit Ausnahmen unvermeidlich. Sie müssen jedoch selten bleiben, weil sie sonst den Charakter der Regel als solche untergraben würden. Was dagegen die Moral betrifft, so wurde bereits gesehen, dass sie nicht auf bloßer Allgemeingültigkeit (generalitas), sondern nur auf strenger Allgemeinheit (universalitas) begründet werden kann. Umso größer ist jedoch dabei die Versuchung vom „Gesetz [...] zum Vortheil unserer Neigung [...] eine Ausnahme zu machen“1272 und dadurch die strenge Allgemeinheit des Gesetzes in eine bloße Allgemeingültigkeit herabstufen. Insbesondere glauben die Politiker sich sehr wohl dazu berechtigt Ausnahmen von den Vernunftgesetzen zu schaffen. Aufgrund ihrer besonderen Stellung beanspruchen sie die Anwendungsbedingungen der Vernunftgesetze besser zu kennen als alle anderen Menschen. Deshalb glauben sie auch besser zu wissen, ob die Anwendung der Gesetze von Fall zu Fall angemessen sei oder nicht. In seinen Werken hat sich Kant wiederholt dagegen ausgesprochen, weil dies die Allgemeinheit des Gesetzes aufheben würde. Jeder hätte dann nur sein eigenes Wohlbefinden im Auge und jeder würde sich Ausnahmen erfinden, „weil die Ausnahmen, die man gelegentlich zu machen befugt ist, endlos sind und gar nicht bestimmt in eine allgemeine Regel befaßt werden können“.1273 Im Lügenaufsatz schreibt Kant unmissverständlich, dass die Erlaubnis von Ausnahmen die Regel „schwankend und unnütz“1274 machen würde. Ferner heißt es noch, dass man die Allgemeinheit der sittlichen Grundsätze vernichten würde, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einräumt, derentwegen allein sie den Namen der Grundsätze führen.1275 Ausnahmen werden jedoch von Kants praktischer Philosophie nicht vollständig verbannt. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen mag es zunächst überraschen, dass Kant ausdrücklich zugesteht, dass man im Feld der Tugendpraxis „einen gewissen Raum zu Ausnahmen (latitudinen) nicht verweigern“1276 kann. In der Tugendlehre schreibt Kant ebenfalls folgendes: „[W]enn das Gesetz nur die Maxime der Handlungen, nicht die Handlungen selbst gebieten kann, so ist‘s ein Zeichnen, daß es der Befolgung (Observanz) einen Spielraum (latitudo) für die freie Willkür überlasse, d. i. nicht bestimmt angeben könne, wie und wie viel durch die Handlung zu dem Zweck, der zugleich Pflicht ist, gewirkt werden solle“.1277 Der erwähnte Spielraum darf jedoch nicht als eine „Erlaubniß zu Ausnahmen von der Maxime der Handlungen, sondern nur die der Einschränkung einer Pflichtmaxime durch die andere“1278 verstanden werden. Weitere Einsichten gewinnen wir aus der Tafel der Kategorien der Freiheit. Dort werden unter der Kategorie der Qualität die „praktische[n] Regeln der Ausnahmen (exceptivae)“1279 erwähnt. Solche Regeln zu formulieren ist jedoch, Kant zufolge, schwer und erfordert Weltkenntnis: „Was [...] wahren, dauerhaften Vortheil bringe, ist allemal, wenn 1271 Vgl. GMS: IV, 424 GMS: IV, 424 1273 KpV: V, 28 1274 Vermeintes Recht: VIII, 427 1275 Vgl. Vermeintes Recht: VIII, 430 1276 RL: VI, 233 1277 TL: VI, 390 1278 TL: VI, 390 1279 KpV: V, 66 1272 - 247 - dieser auf das ganze Dasein erstreckt werden soll, in undurchdringliches Dunkel eingehüllt und erfordert viel Klugheit, um die praktische darauf gestimmte Regel durch geschickte Ausnahmen auch nur auf erträgliche Art den Zwecken des Lebens anzupassen“.1280 Im Gegensatz zur Weltklugheit, die nicht von jedermann zu erwarten ist, kann die Befolgung des Sittengesetzes selbst vom gemeinsten Verstand ohne Schwierigkeiten erwartet werden.1281 Es darf also der Weltklugheit keine Ausnahme eingeräumt werden, es sei denn, wenn sie praktische Regeln der Ausnahmen (exceptivae) formulieren kann. Mit anderen Worten heißt dies, dass Ausnahmen nur insoweit berechtigt sind, als sie selbst zu Regeln werden. Die Ausnahme ist also nur dann einzuhalten, wenn sie zur Regel wird. 2.4 Die Erlaubnisgesetze der reinen Vernunft und die Gefahr der Willkür Es sei nun zweierlei festzuhalten. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Lesart stellen die Erlaubnisgesetze keine Ausnahme zu einem Verbotsgesetz dar, mithin keine Abweichung von einer Rechtsregel.1282 Sie sind somit universale Gesetze (die allgemein gelten) und nicht bloß generelle Gesetze (die im Allgemeinen gelten).1283 Dies mag zunächst widersprüchlich erscheinen aber die Erlaubnisgesetze bleiben Verbotsgesetze, die als solche für jeden unbedingt und ausnahmslos verbindlich sind. Es handelt sich also nicht um Gesetze von loser Verbindlichkeit. Es kann auch nicht Wolfgang Kersting zugestimmt werden, wenn er behauptet, dass die Erlaubnisgesetze „als die Gültigkeit vorausgesetzter Gesetze einschränkende Normen auftreten“.1284 Die Erlaubnisgesetze sind unbedingt geltende Gesetze, deren Durchführung ebenso verbindlich ist wie für alle anderen Vernunftgesetze. Es geht somit nicht um die Frage, ob die Politiker die Gesetze anwenden wollen oder nicht (schließlich handelt es sich um eine Pflicht), sondern wie und wann jene angewandt werden sollen. Mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen auch immer die Vernunftgesetze in der Realität verwirklicht werden sollen, wird von Kant nicht ausführlich thematisiert. Dies liegt im freien Ermessen der Politiker. Im Gegensatz zu dem was in der Sekundärliteratur noch häufig zu lesen ist, räumt Kant der Politik einen gewissen Spielraum ein, welcher jedoch nicht zu einem Raum der Willkür werden darf. Unter dem Begriff der Willkür sind hier die Entscheidung und das Handeln bloß nach Gutdünken zu verstehen. Das willkürliche Handeln hebt die Bindung an die Vernunftgesetze auf. Es läuft somit Gefahr gegen die Vernunftgesetze zu verstoßen. Für Kant soll dagegen die Moral und das Recht stets die Oberhand behalten. Dies hat wiederum zu bedeuten, dass selbst bei der Anwendung der Rechtsgesetze in der Wirklichkeit der Politiker nicht bloß nach freiem Wunsch, also willkürlich, handeln darf. Der Politiker darf seine Entscheidungen nicht willkürlich, sondern stets im Einklang mit dem allgemeinen Sittengesetz treffen. Selbst für die Herbeiführung eines gebotenen Zwecks sind also nicht alle Mittel tauglich. Es dürfen nicht beliebige Mittel verwendet werden, um ein Vernunftgesetz in der Wirklichkeit anzuwenden. Die eingesetzten Mittel müssen vielmehr mit dem Grund für die Befolgung dieses Gesetzten, also mit dem allgemeinen Sittengesetz widerspruchsfrei 1280 KpV: V, 36 Vgl. GMS: IV, 403; KpV: V, 36; VT: VIII, 402 1282 Siehe zum Beispiel die Deutung durch Joachim Hruschka in: Ders.: The permissive law of practical reason in Kant’s “Metaphysics of Morals”, in: Law and Philosophy 23, 2004, S. 46 und noch S. 51. 1283 Vgl. Frieden: VIII, 348. Eine abweichende Interpretation findet sich bei Reinhard Brandt für den die Erlaubnisgesetze „eine provisorische Duldung von etwas in eine lex generalis – nicht universalis – Verbotenem“ darstellen. Vgl. Brandt, Reinhardt: Das Erlaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants Rechtslehre, in: Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel, hrsg. v. Reinhardt Brandt, Berlin – New York 1982, S. 248. 1284 Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007, S. 195. 1281 - 248 - zusammenstimmen. Vor diesem Hintergrund lässt es sich leicht einsehen, dass die Revolution ebenso wie der Krieg zu ächten sind, insofern beide Mittel die Gefahr eines gebotswidrigen Rückfalls in den zwischenmenschlichen Naturzustand enthalten. Der moralische Politiker darf somit keinesfalls ein weltfremder Utopist sein, sondern muss umgekehrt ein geduldiger Reformer sein. Es ist ebenfalls wichtig zu sehen, dass Kant keine empirischen, sondern lediglich vernunftrechtlichen Gründe anführt, um die Erlaubnis einer Verzögerung bei der Durchführung unbedingt gebotener Gesetze zu begründen. Andersfalls würde Kants Rechtsphilosophie vom Weltfrieden in den Empirismus übergehen. Die Erlaubnis ergibt sich nicht zufällig aus den in der Erfahrung vorkommenden Fällen, sondern ist ein folgerichtiger Bestandteil Kants prinzipientheoretischer Überlegungen. Die Erlaubnis ist als eine a priori determinierbare einschränkende Bedingung der Verbotsgesetze zu verstehen.1285 Das Erlaubnisgesetz enthält somit eine Befugnis je nach historischen Bedingungen ein Verbotsgesetz einschränkend, das will heißen vernünftig anzuwenden. Die einschränkende Bedingung muss in „die Formel des Verbotsgesetzes mit hineingebracht werden [...], wodurch es dann zugleich ein Erlaubnißgesetze [wird]“.1286 Der Grund der Erlaubnis liegt also nicht in den empirischen Gegebenheiten, sondern allein in der reinen praktischen Vernunft. Es ist deshalb ungereimt zu behaupten, dass Kant hier die vernunftrechtliche Ebene seiner Argumentation verlässt und sich für einen Mittelweg zwischen apriorischer Ausgangslage und pragmatischen Überlegungen ausspricht. Zu erinnern sei hier, dass es bei Kant gar kein Erlaubnisgesetz in Abgrenzung zum Sittengesetz gibt – und überhaupt geben kann. Die Erlaubnis der Verzögerung wird durch das Sittengesetz selbst gegeben. Anders formuliert: Es ist die reine praktische Vernunft selbst, welche die Verzögerung bei der Vollführung ihrer Gebote und Verbote erlaubt. Die Staatswirklichkeit wird unter bestimmten zeitlichen Bedingungen von der reinen praktischen Vernunft selbst – also a priori – in den Rechtsgesetzen berücksichtigt und einbezogen. Die unvernünftige materiale Wirklichkeit und die aus der reinen praktischen Vernunft entspringenden Rechtsprinzipien stehen sich somit nicht starr gegenüber. Die Vernunftgesetze sind per definitionem Gesetze, die zeitlos formuliert sind. Darunter soll verstanden werden, dass sie nicht aus den empirischen Gegebenheiten einer bestimmten Epoche abgeleitet sind, und dass sie nicht nur für eine besondere Epoche gelten. Ein Problem der Politik ergibt sich erst dann, wenn diese Vernunftgesetze in eine Zeitperspektive gesetzt werden. Ein großer Beitrag von Kant besteht somit vielleicht darin, dass er die Zeitperspektive in seiner Rechtstheorie vom Weltfrieden einbringt. Im Gegensatz zu dem was manchmal zu lesen ist, verliert Kants Rechtsphilosophie dadurch noch nicht ihren apriorischen Charakter. Wie bereits gesehen wurde, stellt der Gebrauch der äußeren Freiheit eines jeden Menschen überhaupt ein juridisches Problem dar, weil der Mensch nicht vermeiden kann in raum-zeitlichen Gemeinschaften mit Seinesgleichen zusammenzuleben. Die räumliche Begrenztheit der Erde und die zeitliche Begrenztheit des Lebens auf derselben gehören zu den grundlegenden Prämissen, die das Problem überhaupt erst konstituieren, welches Kant in der Rechtslehre zu lösen versucht. Wichtig ist an dieser Stelle zu beachten, dass bei der Lösung des Problems Kant dagegen jegliche empirische Bedingung wie etwa anthropologische Annahmen außer Acht lässt. In Bezug auf die Erlaubnisgesetze fügt Kant zwei einschränkende Bedingungen hinzu. Zum einen darf der Zweck des ewigen Friedens nicht aus den Augen verloren werden. Die Durchführung der Verbotsgesetze, z.B. durch die Wiedererstattung der gewissen Staaten entzogenen Freiheit oder durch den Abbau der Institution des stehenden Heeres, darf „nicht 1285 1286 Vgl. Frieden: VIII, 347 Frieden: VIII, 347 - 249 - auf den Nimmertag (wie August zu versprechen pflegte, ad calendas graecas)“1287 ausgesetzt werden. Ganz im Gegenteil steht das provisorisch Erlaubte stets unter der Bedingung einer zukünftigen Stiftung eines Zustandes des Weltfriedens. Die Erlaubnisgesetze enthalten weiterhin die unbedingte Rechtspflicht der Durchführung des Verbots. Dies bedeutet dass, die leges latae die Erlaubnis eines bloßen Aufschubes ihrer Durchführung enthalten und zwar nur bis sich die erste Möglichkeit einer friedlichen Änderung ergibt. Es soll daher ein kontinuierliches Bestreben zur allmählichen Veränderung des widerrechtlichen Bestehenden vorhanden sein. Zum anderen bezieht sich die Erlaubnis ausschließlich auf das Ergebnis bereits vollzogener Handlungen oder bereits vorhandener Institutionen. Sie erstreckt sich allerdings keinesfalls auf zukünftige Handlungen, die im Rechtszustand schlechterdings Unrecht wären. Die temporäre Beibehaltung etwa eines stehenden Heeres lässt sich keinesfalls völkerrechtlich legitimieren, sondern bloß provisorisch dulden, und zwar nur bis sich ohne Rechtsverstoß eine Möglichkeit der Abschaffung finden lässt. Die Institution des stehenden Heeres ist nicht mehr als ein erlaubtes Provisorium zu betrachten. Dieser bloß provisorische Moment der Erlaubnis wird von Kant hervorgehoben, indem er zwischen dem Besitzstand und der Erwerbungsart unterscheidet. Kant erläutert dazu: „[D]as Verbot betrifft hier nur die Erwerbungsart, die fernerhin nicht gelten soll, aber nicht den Besitzstand, der, ob er zwar nicht den erforderlichen Rechtstitel hat, doch zu seiner Zeit (der putativen Erwerbung) nach der damaligen öffentlichen Meinung von allen Staaten für rechtmäßig gehalten wurde“.1288 Die Erlaubnis bezieht sich somit ausschließlich auf den gegenwärtigen Besitzstand, das heißt auf den unrechtmäßigen aber bereits vollzogenen Erwerb eines äußeren Gegenstandes. Sie erstreckt sich aber nicht auf die zukünftige Erwerbungsart desselben. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der gegenwärtige Besitzstand das Ergebnis vergangener Handlungen ist, die zu jenem Zeitpunkt allgemein akzeptiert wurden und sich nicht sofort Rückgängig machen lassen. Die zukünftige Erwerbungsart bezieht sich dagegen auf Handlungen, die noch nicht stattgefunden haben und auf welche man heute ein Einfluss hat. In diesem Zusammengang ist Volker Gerhardt zuzustimmen, wenn er auf folgendes aufmerksam macht: „Sieht man genau hin, was Kant mit dem ‚Erlaubnisgesetz’ eigentlich anerkennt, dann sind es die befristete Geltung alten Rechts und der die Zukunft eröffnende Handlungsspielraum. Damit respektiert er die Geschichtlichkeit gegebener Tatbestände in eins mit der Zukunftsorientierung des politischen Tuns“.1289 2.5 Die Erlaubnisgesetze im Zusammenhang mit Kants Reformkonzept Das Erlaubnisgesetz steht in einem engen Zusammenhang mit Kants Reformkonzept.1290 Seine Rechtstheorie vom Weltfrieden zeichnet sich nämlich durch ein Spannungsverhältnis zwischen der Zeitlosigkeit der rein rationalen Rechtsgesetze einerseits und der Zeitbedingtheit ihrer unbedingt gebotenen Anwendung in der geschichtlichen Wirklichkeit andererseits aus. Obwohl die jeweiligen Staaten ihre Existenz als solche unbedingt bewahren sollen, um einen gebotswidrigen Rückfall in den zwischenmenschlichen Naturzustand zu vermeiden, ist der zwischenstaatliche Naturzustand gleichzeitig so zu gestalten, dass am Ende die Freiheit eines jeden Staates mit der Freiheit eines jeden anderen unter einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Einerseits ist es also den Staaten 1287 Frieden: VIII, 347 Frieden: VIII, 347 1289 Gerhardt, Volker: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995, S. 72. 1290 Dazu siehe u.a.: Langer, Claudia: Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Stuttgart 1986. 1288 - 250 - verboten, selbst einen unrechtmäßigen Zustand überhastet überwinden zu suchen, wenn sie dadurch ihre eigene staatliche Existenz gefährden würden. Andererseits sind die gebotenen Reformen trotzdem unbedingt durchzuführen, um den rechtlosen Naturzustand zu verlassen und in einen bürgerlich-gesetzlichen Zustand einzutreten. Das Erlaubnisgesetz ist das vernunftrechtliche Mittel, anhand von welchem dieses Spannungsverhältnis aufgehoben wird. Das Erlaubnisgesetz öffnet nämlich einen zeitlichen Spielraum für die Befolgung der Vernunftgesetze, indem es den Machthabenden die Befugnis verleiht sich je nach Umständen der sofortigen Anwendung der Rechtsprinzipien zu enthalten. Es ermöglicht somit eine langsame und unablässige, das heißt in Reformprozessen voranschreitende friedliche Entwicklung vom Naturzustand in den Rechtszustand. In diesem Zusammenhang ist somit Reinhard Brandt uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er schreibt: „Das Erlaubnisgesetz Kants ermöglicht die Anwendung natur- oder vernunftrechtlicher Normen auf die Wirklichkeit im Modus einer allmählichen Reform“.1291 Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die von Kant insbesondere in der Friedensschrift mehrmalige Verwendung der Begriffe „allmählich“1292, „langsam“1293 und „nach und nach“.1294 Ganz in diesem Sinne führt Kant auch in der Rechtslehre aus, dass das Staatsoberhaupt dazu verpflichtet ist, die Regierungsart in Einklang mit der Idee des ursprünglichen Vertrages zu bringen, und so sie, „wenn es nicht auf einmal geschehen kann, allmählich und continuirlich dahin zu verändern, daß sie mit der einzig rechtmäßigen Verfassung, nämlich der einer reinen Republik, ihrer Wirkung nach zusammenstimme“.1295 Wenn die republikanische Verfassung „nicht revolutionsmäßig, durch einen Sprung […], sondern durch allmähliche Reform nach festen Grundsätzen versucht und durchgeführt wird“, so kann jene „in continuirlicher Annäherung zum höchsten politischen Gut, zum ewigen Frieden“1296 führen. Durch die Verwendung der Begriffe „allmählich“, „kontinuierlich“, „langsam“ und „nach und nach“ betont Kant, dass die gebotenen Reformen in einer langsam fortschreitenden und ununterbrochenen Zeitfolge geschehen sollen. Der moralische Politiker soll die gebotenen Reformen allgemach und unablässig durchführen. Die konkrete Anwendung der Vernunftgesetze in der Wirklichkeit bedeutet aber nicht ihre Anpassung an die geschichtliche Wirklichkeit: „Das Recht muß nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepaßt werden“.1297 Das Gebotene ist schlechterdings unantastbar. Überdies sei daran erinnert, dass die bloße Erkenntnis der Vernunftgesetze nicht ausreicht, damit Politik erfolgreich sein kann. Wie bereits ausführlich angeführt wurde, liegt dies darin begründet, dass die Kenntnis der Vernunftgesetze sowie die Kompetenz jene in concreto anzuwenden nicht dasselbe sind.1298 Aus diesem Grunde kann eine als ausübende Rechtslehre konzipierte Politik nicht auf Urteilskraft und Klugheit verzichten, wenn es darum geht diese Vernunftgesetze in der Wirklichkeit umzusetzen. Im hier diskutierten Zusammenhang besteht die wesentliche Funktion der Urteilskraft darin zu unterscheiden, in welchen Fällen die Erlaubnisgesetze anzuwenden sind und in welchem nicht. Im Anschluss stellt sich noch die Frage, wie diese Erlaubnisgesetze am ehesten erfüllt werden können. Der moralische Politiker soll unter Berücksichtigung der günstigen Umstände (und durch die Schaffung derselben) entscheiden, wann und wie die Vernunftprinzipien am besten umzusetzen sind. Er soll den richtigen Moment und den richtigen Rhythmus für die gebotenen 1291 Brandt, Reinhard: Das Problem der Erlaubnisgesetz im Spätwerk Kants, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 85. 1292 Vgl. Frieden: VIII, 353, 356, 367, 373 1293 Vgl. Frieden: VIII, 379, 380 1294 Vgl. Frieden: VIII, 373, 386 1295 RL: VI, 340 1296 RL: VI, 355 1297 Vermeintes Recht: VIII, 429 1298 Vgl. Gemeinspruch: VIII, 275 - 251 - Reformen finden. Es zeigt sich, dass der Politiker nicht den Inhalt der Rechtsgesetze bestimmt, jedoch für ihre fallgerechte Anwendung in der geschichtlichen Wirklichkeit sorgt. Die Moral und das Recht geben den Rahmen verbindlich vor, in welchem sich die Politik zu bewegen hat. Innerhalb dieses verbindlichen Rahmens steht es aber der Politik frei über Mittel und Wege zu entscheiden. Es muss hier ausdrücklich festgehalten werden, dass es keine Autonomie der Politik im etymologischen Sinne des Wortes, das heißt keine Selbstgesetzgebung gibt, wohl aber eine Eigenständigkeit. Die entscheidende Funktion der Erlaubnisgesetze lässt sich am Beispiel des drittens Präliminarartikels deutlich festhalten. Wie bereits im ersten Hauptteil gesehen wurde, fordert Kant dort die vollständige Auflösung der Institution des stehenden Heeres. Dies heißt im Wortlaut: „Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören“.1299 Unbestritten ist also, dass das stehende Heer abgeschafft werden soll. Zugleich soll in Erinnerung behalten werden, dass das politische Handeln am Gebot der Staatserhaltung auszurichten ist. Kant ist sich dessen bewusst, dass unter der Bedingungen internationaler Anarchie die überstürzte und vollständige Abschaffung des stehenden Heeres in einem einzigen Staat gegen das Gebot der Staatserhaltung stoßen würde. Außerdem könnte eine allgemeine Abrüstung nur recht langsam geschehen. Aus diesem Grunde gibt Kant dem dritten Präliminarartikel die Form eines Erlaubnisgesetzes. Eine zeitliche Verschiebung bei der Ausführung des Verbots ist somit erlaubt. Die Redewendung „mit der Zeit“ deutet schon allein darauf hin, dass die Abschaffung des stehenden Heeres ein mittelfristiges Ziel darstellt. Mit welchen Mitteln und unter welchen Umständen auch immer diese Gebote in der Realität verwirklicht werden sollen, wird von Kant nicht thematisiert. Er plädiert lediglich für den korrespondierenden Aufbau von Bürgermilizen1300, welche den partikularen Sicherheitsinteressen der jeweiligen Staaten und dem Ziel des universellen Friedens gleichermaßen dienen. Erneut zeigt sich hier, dass Kant in der Friedensschrift stets um eine Vermittlung zwischen apriorischer Ausgangslage und den historisch-faktischen Bedingungen bemüht ist und dass er dabei einen ausgeprägten politischen Realitätssinn aufweist. 1299 1300 Frieden: VIII, 345 Vgl. Frieden: VIII, 345 - 252 - SCHLUSSFOLGERNDE BETRACHTUNG: DIE PUBLIZITÄT ALS PRÜFSTEIN MORALISCHER POLITIK Es wurde gesehen, dass im ersten Teil des Anhangs der Friedensschrift Kant das Problem der Misshelligkeit zwischen Politik und Moral durch die systematische Unterwerfung der Politik unter der Moral löst. Im zweiten Teil des Anhangs unter der Überschrift »Von der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transscendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts« widmet sich Kant der Frage, wie geprüft werden kann, ob die Handlungsmaximen der politisch Handelnden mit den Prinzipien der Moral und des Rechts übereinstimmen. Als Kriterium hierfür nennt er die „Publizität“.1301 Gemeint ist die Tauglichkeit zur öffentlichen Kundgabe einer Handlungsmaxime. Mit Hilfe dieses Kriteriums können die Handlungsmaximen der politisch Handelnden auf ihre Rechtsmäßigkeit (juridische Legalität) hin überprüft werden. Zugleich kann auf diesem Weg das Handeln des moralischen Politikers von jenem des politischen Moralisten unterschieden werden. Kant gelangt zu diesem Kriterium, indem er die gesamte Materie vom öffentlichen Recht (also vom empirischen und somit kontingenten Inhalt des positiven Rechts) abstrahiert. Übrig bleibt dann nur dessen bloße Form, nämlich die Publizität. Im Wortlaut heißt es: „Wenn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach den verschiedenen empirischgegebenen Verhältnissen der Menschen im Staat oder auch der Staaten unter einander), so wie es sich die Rechtslehrer gewöhnlich denken, abstrahire, so bleibt mir noch die Form der Publicität übrig, deren Möglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in sich enthält, weil ohne jene es keine Gerechtigkeit (die nur als öffentlich kundbar gedacht werden kann), mithin auch kein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geben würde“.1302 Das Kriterium der Publizität bezieht sich ausschließlich auf das öffentliche Recht. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Kant in der Rechtslehre das Privatrecht (als der „Inbegriff derjenigen Gesetze, die keiner äußeren Bekanntmachung bedürfen“), dem öffentlichen Recht (als den „Inbegriff derjenigen Gesetze, die einer öffentlichen Bekanntmachung bedürfen“) begrifflich gegenüber stellt.1303 Das erste ist ein bloß provisorisches Recht. Es handelt sich um ein gültiges, jedoch im Streitfall durch keine öffentliche Zwangsgewalt gesichertes Recht. Aus ihm leitet Kant die absolute Pflicht ab, in den bürgerlichen Zustand einzutreten. Das Recht erlangt seine volle Wirksamkeit, erst wenn die Gesetze öffentlich bekannt sind und ihre Einhaltung durch eine öffentliche Zwangsgewalt gesichert ist. Das öffentliche Recht soll (der Idee nach) allen Individuen bekannt sein, die von ihm betroffen sind. Ein Individuum kann nämlich nicht zur Einhaltung eines Rechtsgesetzes gezwungen werden, welches nicht veröffentlicht wurde. Publizität ist somit eine notwendige Bedingung des öffentlichen Rechts. Kant entwickelt das Prinzip der Publizität in zwei sogenannten transzendentalen Formeln des öffentlichen Rechts. Die erste transzendentale Formel des öffentlichen Rechts lautet: »Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publicität verträgt, sind Unrecht«.1304 Kant bezeichnet dieses erste Prinzip der Publizität als bloß negativ. Die negative Formel des öffentlichen Rechts gibt lediglich Auskunft darüber, dass gewisse politische Handlungsmaximen mit der Moral und dem Recht unvereinbar sind. In Kants eigenen Worten heißt es: „[E]s dient nur, um vermittelst desselben, was gegen Andere nicht 1301 Frieden: VIII, 381 Frieden: VIII, 381 1303 Vgl. RL: VI, 210 1304 Frieden: VIII, 381 1302 - 253 - recht ist, zu erkennen“.1305 Kant spricht in diesem Zusammenhang von einem „Experiment der reinen Vernunft“.1306 Es geht darum sich vorzustellen, was geschehen würde, wenn die Maximen meines Handelns zuvor öffentlich bekannt wären. Eine Handlung ist unrecht, wenn mit guten Gründen angenommen werden kann, dass ihre vorhergehende allgemeine Bekanntmachung auf Widerstand stoßen würde. Um es einfach auszudrücken: Jede Handlungsmaxime, die nicht eine öffentliche Bekanntmachung vertragen würde, also „verheimlicht werden muß, wenn sie gelingen soll“1307, ist unrecht. Im Wortlaut heißt es: „Denn eine Maxime, die ich nicht darf lautwerden lassen, ohne dadurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln, […] kann diese nothwendige und allgemeine, mithin a priori einzusehende Gegenbearbeitung Aller gegen mich nirgend wovon anders, als von der Ungerechtigkeit her haben, womit sie jedermann bedroht“.1308 Nach einer Handlungsmaxime zu handeln, die dem Test der allgemeinen Bekanntmachung nicht standhält, mithin geheim gehalten werden muss, um ihr Ziel zu erreichen, ist somit rechtswidrig. Dies hat wiederum nicht zu bedeuten, dass jede Handlungsmaxime, welche die Publizität verträgt, gerecht sei. Der Grund hierfür ist, dass derjenige, welcher „die entschiedene Obermacht hat, seiner Maximen, nicht hehl haben darf“.1309 Wenn ein Staat beispielsweise eine hegemoniale Stellung hat, also allen übrigen Staaten zusammen militärisch und wirtschaftlich überlegen ist, dann kann er öffentlich die Missachtung des Völkerrechts ankündigen. Das negative Prinzip der Publizität ist somit zwar eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedingung der Rechtmäßigkeit. Bevor sich dem positiven Prinzip der Publizität gewidmet wird, soll darauf hingewiesen werden, dass Kant für das Prinzip der Publizität apodiktische Gewissheit beansprucht. In der Friedensschrift heißt es eindeutig und unmissverständlich, dass das Prinzip der Publizität ein „a priori in der Vernunft anzutreffendes Kriterium“ sowie „ein Experiment der reinen Vernunft“1310 sei. Ferner führt Kant aus, dass dieses Prinzip „gleich einem Axiom unerweislich-gewiß“1311 ist. Dies hat wiederum zu bedeuten, dass es nicht unbedingt einer tatsächlichen, empirischen Öffentlichkeit bedarf. Denn eine tatsächliche Öffentlichkeit ist manipulierbar und kann von dem Diskurs kontingenter Interessengruppen beeinflusst werden, welcher gerade nicht mit den Geboten der Vernunft übereinstimmt. Georg Cavallar stellt zutreffend fest, dass die politisch Handelnden dieses „Experiment der reinen Vernunft […] schon dort durchführen [können], wo sich eine faktische Öffentlichkeit noch nicht gebildet hat“.1312 Die zweite, nun positive transzendentale Formel des öffentlichen Rechts lautet entsprechend: »Alle Maximen, die der Publicität bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen), stimmen mit Recht und Politik vereinigt zusammen«.1313 Eine Handlungsmaxime, die notwendigerweise auf Publizität angewiesen ist, um ihr Ziel zu erreichen, steht notwendigerweise in Übereinstimmung mit dem Recht und der moralischen Politik. Wichtig ist an dieser Formel festzuhalten, dass Kant hier „Recht und Politik“ schreibt und somit ausdrücklich die eigenständige Existenz der Politik anerkennt. Hier zeigt sich erneut mit aller wünschenswerten Deutlichkeit, dass Recht und Politik nicht identisch sind: Es gibt bei Kant keine Identität von Recht und Politik. Hier geht es nicht mehr allein um die Frage der 1305 Frieden: VIII, 381 (meine Hervorhebung) Frieden: VIII, 381 1307 Frieden: VIII, 381 1308 Frieden: VIII, 381 1309 Frieden: VIII, 385 1310 Frieden: VIII, 381 1311 Frieden: VIII, 382 1312 Cavallar, Georg: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992, S. 364. 1313 Frieden: VIII, 386 1306 - 254 - Einschränkung der äußeren Freiheit eines jeden Menschen auf die Bedingungen ihrer Übereinstimmung mit der äußeren Freiheit aller anderen nach einem allgemeinen Gesetz, also um die Frage des Rechts. Es geht nun, um das, was Kant in dem direkt anschließenden Satz als die „eigentliche Aufgabe der Politik“ bezeichnet: „Denn, wenn sie [die Maximen; F.R.] nur durch die Publizität ihren Zweck erreichen können, so müssen sie dem allgemeinen Zweck des Publicums (der Glückseligkeit) gemäß sein, womit zusammen zu stimmen (es mit seinem Zustande zufrieden zu machen), die eigentliche Aufgabe der Politik ist“.1314 In seinen Vorarbeiten zum Öffentlichen Recht definiert Kant die Politik (als Wissenschaft) ganz in diesem Sinne als „das System der Gesetze zur Sicherung der Rechte und Zufriedenheit des Volks mit seinem inneren und äußeren Zustande“.1315 Kant bietet hier eine entscheidende, dennoch bislang ausgesprochen wenig beachtete Definition der genuinen Aufgabe der Politik. Mit seiner Behauptung, dass die „eigentliche Aufgabe der Politik“ darin bestehen soll, die Menschen „zufrieden zu machen“, scheint Kant alles, was er zuvor bezüglich der Vorrangstellung des formalen Rechtsprinzips vor dem materiellen sowie bezüglich der Kontingenz des Glückseligkeitsbegriffs geschrieben hat, rückgängig zu machen. Dieser Auslegung liegt aber ein grundsätzliches Missverständnis zugrunde. Kant würde sich tatsächlich widersprechen, wenn materielle und formale Prinzipien sich gegenüberstehen würden. Davon kann aber bei Kant schlechterdings nicht die Rede sein. Um Kants Definition der eigentlichen Aufgabe der Politik zu verstehen, ist es erforderlich auf die zu Beginn der vorliegenden Arbeit angeführte Definition des Menschen als ein mit praktischer Vernunft begabten Naturwesen zurückzugreifen.1316 Dabei soll nicht übersehen werden, dass der Mensch als Naturwesen, dies will heißen als Sinnenwesen, bezeichnet wird. Als solches strebt er unerlässlich und unaufhörlich nach der Befriedung seiner Bedürfnisse, das heißt nach seiner wie auch immer definierten Glückseligkeit. Ein Problem des Rechts und der Politik tritt überhaupt nur dort auf, wo das Streben nach Glückseligkeit mindestens zweier Menschen in Konflikt miteinander steht und den Forderungen des allgemeinen Rechtsgesetzes zuwider läuft. Erst im Streitfall soll das formale Prinzip Vorrang vor dem materiellen haben. Die Vorrangstellung des formalen Prinzips vor dem materiellen bedeutet jedoch keinesfalls eine Entgegensetzung der beiden Prinzipien oder eine Unterdrückung des naturbedingten Strebens nach Glückseligkeit. Anders formuliert: Die Vorrangstellung des formalen Prinzips hat nicht zu bedeuten, dass das materielle Prinzip aufgegeben werden soll. Im ersten Abschnitt vom Gemeinspruch unter dem Titel »Von dem Verhältniß der Theorie zur Praxis in der Moral überhaupt« schreibt Kant, dass er „nicht verabsäumt anzumerken [hatte], daß dadurch [durch die Moral; F. R.] dem Menschen nicht angenommen werde, er solle, wenn es auf Pflichtbefolgung ankommt, seinem natürlichen Zwecke, der Glückseligkeit, entsagen; denn das kann er nicht, so wie kein endliches vernünftiges Wesen überhaupt“.1317 Das formale Prinzip bestimmt lediglich den Rahmen, in dem dieses Streben sich der Vernunft gemäß zu vollziehen hat. Das allgemeine Rechtsgesetz bestimmt nichts anderes als die Bedingungen unter denen der Mensch seine Glückseligkeit verfolgen kann. Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen lässt es sich leicht einsehen, von welcher Tragweite die positive Formel des öffentlichen Rechts ist. Das positive Prinzip der Publizität dient nämlich der Prüfung, ob die Handlungsmaximen des politischen Handelnden dem Recht gemäß sind (formale Prinzip). Im ersten Hauptteil der vorliegenden Arbeit wurde ausführlich 1314 Frieden: VIII, 386 Vorarbeit: XXIII, 346 (meine Hervorhebung). An den zitierten Textstellen ist festzuhalten, dass Kant nicht von „glücklich machen“ und „Glückseligkeit“ spricht, sondern (weniger anspruchsvoll) von „zufrieden machen“ und „Zufriedenheit“ spricht. 1316 Vgl. Anthropologie: VII, 322 1317 Gemeinspruch: VIII, 278; Vgl. Anfang: VIII, 116 1315 - 255 - gezeigt, dass die bloße Erfüllung der Rechtspflichten, unangesehen der Bewegungsgründe derselben, die notwendige und hinreichende Bedingung der Möglichkeit des ewigen Friedens ist. Erst wenn Frieden wahrhaft gegeben ist, das heißt wenn die Menschen in einer sich weltweit erstreckenden öffentlichen Rechtsordnung leben, ist a priori gesichert, dass sie ihre jeweiligen Zwecke (materiale Prinzip) unabhängig von der nötigenden Willkür der anderen verfolgen können. Diese Menschen können jeweils beliebige Zwecke verfolgen: Ob diese moralisch oder unmoralisch sind, ist rechtlich ohne jede Bedeutung, solange (und nur solange) die für die Erreichung dieser Zwecke jeweils erforderliche Handlungen mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können. Die Politik als ausübende Rechtslehre sorgt dafür, dass alle Menschen ihre je eigene wie auch immer definierte Glückseligkeit unabhängig von der nötigenden Willkür anderer verfolgen können.1318 In diesem ganz präzisen Sinne ist es Volker Gerhardt zuzustimmen, dass die Politik dem Glück der Menschen verpflichtet bleibt.1319 Die eigentliche Aufgabe der Politik als ausübende Rechtslehre besteht also letztlich darin, die Bedingungen zu schaffen, unter denen die Staatsbürger nach ihrer je eigene Glückseligkeit frei nach Belieben streben können, solange ihre Handlungen nur mit der Freiheit aller anderen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen können. 1318 Gemeinspruch: VIII, 291 Vgl. Gerhardt, Volker: Das Recht in weltbürgerlicher Absicht. Kants Zweifel am föderalen Weg zum Frieden, in: Kant im Streit der Fakultäten, hrsg. v. Volker Gerhardt und Thomas Meyer, Berlin/New York 2005, S. 288. 1319 - 256 - LITERATURVERZEICHNIS Primärliteratur Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (VII 117-334) Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (VIII 33-42) Der Streit der Fakultäten (VII 1-116) Die Metaphysik der Sitten, I. Teil: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (VI 203372) Die Metaphysik der Sitten, II. Teil: Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre (VI 373492) Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (VI 1-202) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (IV 385-464) Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (VIII 15-31) Kritik der praktischen Vernunft (V 1-163) Kritik der reinen Vernunft (A: IV 1-252; B: III 1-552) Kritik der Urtheilskraft (V 165-485) Moralphilosophie Collins (XXVIII 237-473) Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (VIII 107-123) Praktische Philosophie Powalski (XXVII 91-236) Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (IV 253-384) Reflexionen (XIX ff.) Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee (XXIII 255-271) Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (VIII 273-313) Über die Pädagogik (IX 437-500) Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (VIII 423-430) Verkündigung des nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie (VIII 411-422) Von einem neuerdings erhobenen Ton in der Philosophie (VIII 387-406) Zum ewigen Frieden (VIII 341-386) Hilfsmittel Eisler, Rudolf: Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften / Briefen und handschriftlichen Nachlass, Hildesheim 1961 (Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1930). Roser, Andreas/Mors, Thomas (Hrsg.): Kant-Konkordanz, in zehn Bänden, Hildesheim/ Zürich/New York 1992-1995. Sekundärliteratur Albrecht, Ulrich: Kants Entwurf einer Weltfriedensordnung und die Reform der Vereinigten Nationen, in: Friedenswarte 71, 1995, S. 195-210. Allison, Henry E.: Kant’s Theory of Freedom, Cambridge 1990. - 257 - Annen, Martin: Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der deutschen Aufklärung. Ein Beitrag zur Ethik und Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Würzburg 1997. Archibugi, Daniele: From the United Nations to Cosmopolitan Democracy, in: Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order, hrsg. v. Daniele Archibugi und David Held, Cambridge 1995, S. 121-162. Arendt, Hannah: Das Urteilen. Texte zu Kants Politischer Philosophie, hrsg. v. Ronald Beiner, München/Zürich 1985. Aristoteles: Politik, übers. u. hrsg. v. Olof Gigon, München 2003. Aubenque, Pierre: Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles, Anhang 3: Die Klugheit bei Kant, Hamburg 2007, S. 179-207. Ders.: La prudence chez Kant, in: Revue de Métaphysique et de Morale LXXX/3, 1975, S. 156-182. Baum, Hermann: Kant. Moral und Religion, Sankt Augustin 1998. Baum, Manfred: Politik und Moral in Kants praktischer Philosophie, in: Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung, hrsg. v. Heiner F. Klemme, Berlin/New York 2009, S. 386-399. Bialas, Volker/Häßler, Hans-Jürgen (Hrsg.): 200 Jahre Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Idee einer globalen Friedensordnung, Würzburg 1996. Bojanowski, Jochen: Kant über das Prinzip der Einheit von theoretischer und praktischer Philosophie (Einleitung I – V), in: Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2008, S. 23-40. Ders.: Kants Theorie der Freiheit: Rekonstruktion und Rehabilitierung, Göttingen 2006. Brandt, Reinhard: Immanuel Kant. Was bleibt?, Hamburg 2010. Ders.: Klugheit bei Kant, in: Klugheit, hrsg. v. Wolfgang Kersting, Weilerswist-Metternich 2005, S. 98-133. Ders.: Vom Weltbürgerrecht, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 133-148. Ders.: Das Problem der Erlaubnisgesetze im Spätwerk Kants, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 69-86. Ders. (Hrsg.): Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Hamburg 2000. Ders.: Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Hamburg 1999. Ders.: Vernunftrecht und Zeit bei Kant, in: Recht zwischen Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire. Deutsch-französisches Symposion, hrsg. v. Jean-François Kervégan und Heinz Mohnhaupt, Frankfurt a. M. 1997, S. 45-72. Ders.: Antwort auf Bernd Ludwig: Will die Natur unwiderstehlich die Republik?, in: KantStudien 88, 1997, S. 229-237. Ders.: Zu Kants politischer Philosophie, Stuttgart 1997. Ders.: Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 61-86. Ders.: Das Erlaubnisgesetz, oder: Vernunft und Geschichte in Kants Rechtslehre, in: Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel, hrsg. v. Reinhardt Brandt, Berlin – New York 1982, S. 233-285. Ders.: Eigentumstheorien von Grotius bis Kant, Stuttgart - Bad Cannstatt 1974. Brunkhorst, Hauke (Hrsg.): Einmischung erwünscht? Menschenrechte und bewaffnete Intervention, Frankfurt a. M. 1998. Carson, Thomas: Perpetual Peace: What Kant Should Have Said, in: Social Theory and Practice 14, 1988, S. 173-214. - 258 - Cassirer, Ernst: Kants Leben und Lehre, Berlin, 1921. Castillo, Monique de: Moral und Politik, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 195-220. Cavallar, Georg: Kantian perspectives on democratic peace: alternatives to Doyle, in: Review of International Studies 27, 2011, S. 229-248. Ders.: Cosmopolis. Supranationales und kosmopolitisches Denken von Vitoria bis Smith, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 53, 2005, S. 49-67. Ders.: Kants Religionsphilosophie im Spiegel neuerer Arbeiten, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 52, 1998, S. 460-470. Ders.: Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant, Wien/Köln/Weimar 1992. Cecchinato, Giorgia: Die praktische Urteilskraft und das Gesetz der Freiheit, in: Recht und Frieden in der Philosophie Kants. Akten des X. Internationalen Kant-Kongresses, Nr. 335, Bd. 3, 2008, S. 71-81. Cheneval, Francis: Das Problem der supranationalen Zwangsgewalt am Beispiel Kants, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 83, 1997, S. 175-192. Cramer, Konrad: Hypothetische Imperative? in: Rehabilitierung der praktischen Philosophie, hrsg. v. Manfred Riedel, Bd. 1, Freiburg 1972, S. 159-212. Czempiel, Ernst-Otto: Friedensstrategien. Eine systematische Darstellung außenpolitischer Theorien von Machiavelli bis Madariaga, Opladen/Wiesbaden, 1998. Ders.: Kants Theorem und die zeitgenössische Theorie der internationalen Beziehungen, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 300323. Debiel, Tobias/Nuscheler, Franz (Hrsg.): Der neue Interventionismus. Humanitäre Einmischung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Bonn 1996. Detjen, Joachim: Pluralismus und klassische politische Philosophie, in: Jahrbuch für Politik 2, 1991, S. 151-189. Donagan, Alan: Consistency in Rationalist Moral Systems, in: Moral Dilemmas, hrsg. v. Christopher W. Gowans, Oxford 1987, S. 271-290. Doyle, Michael W. / Sambanis, Nicholas: Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations, Princeton 2006. Doyle, Michael W.: Die Stimme der Völker. Politische Denker über die internationalen Auswirkungen der Demokratie, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 221-243. Ders.: Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, Part I, in: Philosophy and Public Affairs 12(3), 1983a, S. 205-235. Ders.: Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, Part II, in: Philosophy and Public Affairs 12(4), 1983b, S. 323-353. Dumas, Denis: La réception néo-kantienne du projet de paix perpétuelle, in: L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 368-376. Ebbinghaus, Julius: Kants Lehre vom ewigen Frieden und die Kriegsschuldfrage, in: Gesammelte Schriften, Bd. I, Sittlichkeit und Recht. Praktische Philosophie 1929 – 1954, hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Bonn 1986, S. 1-34. Ders.: Sozialismus der Wohlfahrt und Sozialismus des Rechts, in: Gesammelte Schriften, Bd. I, Sittlichkeit und Recht. Praktische Philosophie 1929 – 1954, hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Bonn 1986, S. 231-264. - 259 - Ders.: Kants Ableitung des Verbotes der Lüge aus dem Rechte der Menschheit, in: Gesammelte Schriften, Bd. I, Sittlichkeit und Recht. Praktische Philosophie 1929 – 1954, hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Bonn 1986, S. 407-420. Ders.: Briefwechsel Paton-Ebbinghaus, in: Kant und das Recht der Lüge. hrsg. v. Hariolf Oberer und Georg Geismann, Würzburg 1986, S. 70-71. Ebeling, Hans: Vom Einen des Friedens: über Krieg und Gerechtigkeit, Würzburg 1997. Ders.: Kants „Volk von Teufeln“, der Mechanismus der Natur und die Zukunft des Unfriedens. Über den Mythos der kommunikativen Vernunft, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 8794. Ebert, Theodor: Kants kategorischer Imperativ und die Kriterien gebotener, verbotener und freigestellter Handlungen, in: Kant-Studien 67, 1976, S. 570-583. Fackenheim, Emil L.: The God Within. Kant, Shelling, and Historicity, Toronto 1996. Ferrari, Jean/Simone, Goyard-Fabre (Hrsg.): L’année 1796: sur la paix perpétuelle de Leibniz aux héritiers de Kant, Paris 1998. Fleischer, Margot: Schopenhauer als Kritiker der Kantischen Ethik. Eine kritische Dokumentation, Würzburg 2003. Fröhlich, Manuel: Mit Kant, gegen ihn und über ihn hinaus: Die Diskussion 200 Jahre nach Erscheinen des Entwurfs »Zum ewigen Frieden«, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 7, 1997, S. 483-517. Fulda, Hans Friedrich: Erkenntnis der Art, etwas Äußeres als das Seine zu haben, in: Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 87-115. Funke, Gerhard: Achtung fürs moralische Gesetz und Rigorismus/Impersonalismus-Problem, in: Kant-Studien 65, 1974, S. 45-67. Gawlina, Manfred: Der Ansatz von Kants Politischer Philosophie, betrachtet in seiner Gegenstellung zu Fichte und Hegel, in: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses, hrsg. v. Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann und Ralph Schumacher, 2001, S. 262-270. Geis, Anna/Müller, Harald/Wagner, Wolfgang (Hrsg.): Schattenseiten des Demokratischen Friedens. Zur Kritik einer Theorie liberaler Außen- und Sicherheitspolitik, Frankfurt a. M. 2007. Geismann, Georg/Oberer, Hariolf (Hrsg.): Kant und das Recht der Lüge, Würzburg 1986. Geismann, Georg: Kant und kein Ende, Pax Kantiana oder Der Rechtsweg zum Weltfrieden, Bd. 3, Würzburg 2012. Ders.: Kant und kein Ende, Studien zur Rechtsphilosophie, Bd. 2, Würzburg 2010. Ders.: Kant und kein Ende, Studien zur Moral-, und Religions- und Geschichtsphilosophie, Bd. 1, Würzburg 2009. Ders.: World Peace: Rational Idea and Reality. On the Principles of Kant’s Political Philosophy, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Würzburg 1996, S. 265-319. Ders.: Nachlese zum Jahr des „ewigen Friedens”. Ein Versuch, Kant vor seinen Freunden zu schützen, in: Logos 3, 1996, S. 317-345. Ders.: Versuch über Kants rechtliches Verbot der Lüge, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer und Gerhard Seel, Würzburg 1988, S. 293-316. Ders.: Kants Rechtslehre vom Weltfrieden, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 37, 1983, S. 363-388. Gerhardt, Volker/Meyer, Thomas (Hrsg.): Kant im Streit der Fakultäten, Berlin/New York 2005. - 260 - Gerhardt, Volker: Das Recht in weltbürgerlicher Absicht. Kants Zweifel am föderalen Weg zum Frieden, in: Kant im Streit der Fakultäten, hrsg. v. Volker Gerhardt und Thomas Meyer, Berlin/New York 2005, S. 286-306. Ders.: Der Thronverzicht der Philosophie: Über das moderne Verhältnis von Philosophie und Politik bei Kant, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 171-193. Ders.: Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik, in: Kant in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Gerhard Schönrich und Yasushi Kato, Frankfurt a. M. 1996, S. 464488. Ders.: Eine kritische Theorie der Politik. Über Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«, in: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, hrsg. v. Klaus-Michael Kodalle, Würzburg 1996, S. 5-20. Ders.: Immanuel Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Eine Theorie der Politik, Darmstadt 1995. Ders.: Vernunft und Urteilskraft. Politische Philosophie und Anthropologie im Anschluß an Immanuel Kant und Hannah Arendt, in: John Locke und Immanuel Kant. Historische Rezeption und gegenwärtige Relevanz, hrsg. v. Martyn P. Thompson, Berlin 1991, S. 316-333. Glasner, Charles L.: The Security Dilemma Revisited, in: World Politics 50, 1997, S. 171201. Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie. Erster Teil, München 1996 [1808]. Gowans, Christopher W.: Innocence Lost: An Examination of Inescapable Moral Wrongdoing, Oxford 1994. Goyard-Fabre, Simone: Les articles préliminaires, in: L’année 1795. Kant. Essai sur la paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 41-59. Grieco, Joseph M.: Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism, in: International Organization 42, 1988, S. 485-506. Grünewald, Bernward: Wahrhaftigkeit, Recht und Lüge, in: Rechts und Frieden in der Philosophie Kants. Akten des X. Internationalen Kant-Kongresses, Bd. 3, hrsg. v. Valerio Rohden, Ricardo R. Terra, Guido A. de Almeida u. Margit Ruffing, Berlin / New-York 2008, S. 149-160. Guyer, Paul: Kant's System of Nature and Freedom. Selected Essays, Oxford 2005. Habermas, Jürgen: Die Grenze zwischen Glauben und Wissen. Zur Wirkungsgeschichte und aktuellen Bedeutung von Kants Religionsphilosophie, in: Recht - Geschichte - Religion. Die Bedeutung Kants für die Gegenwart, hrsg. v. Herta Nagl-Docekal und Rudolf Langthaler, Berlin 2004, S. 141–160. Ders.: Kants Idee des ewigen Friedens – aus dem historischen Abstand von zweihundert Jahren, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 7-24. Ders.: Publizität als Prinzip der Vermittlung von Politik und Moral, in: Materialen zu Kants Rechtsphilosophie, hrsg. v. Zwi Batscha, Frankfurt a. M. 1976, S. 175-190. Hammacher, Klaus: Über Erlaubnisgesetze und die Idee sozialer Gerechtigkeit im Anschluss an Kant, Fichte, Jakobi und einige Zeitgenossen, in: Transzendentale Theorie und Praxis: Zugänge zu Fichte, Amsterdam – Atlanta 1996, S. 117-138. Hart, W. A.: Nussbaum, Kant and Conflicts between Duties, in: Philosophy 73, 1998, S. 609618. Hasenclever, Andreas: Liberale Ansätze zum Demokratischen Frieden, in: Theorien der Internationalen Beziehungen, hrsg. v. Siegfried Schieder und Manuela Spindler, Opladen 2003, S. 199-226. - 261 - Hassner, Pierre: Situation de la philosophie politique chez Kant, in: Annales de philosophie politique 4, 1962, S. 76- 103. Ders.: Les concepts de guerre et de paix chez Kant, in: Revue française de science politique 11-3, 1961, S. 642-670. Hennigfeld, Jochen: Der Friede als philosophisches Problem. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 8, 1983, S. 24-28. Herz, John H.: Idealist Internationalism and the Security Dilemma, in: World Politics 2, 1950, S. 157-180. Hill, Thomas E.: Moral Dilemmas, Gaps and Residues: A Kantian Perspective, in: Moral Dilemmas and Moral Theory, hrsg. v. Homer Eugene Mason, Oxford 1996, S. 167-198. Ders.: The Hypothetical Imperativ, in: Philosophical Review 82, 1973, S. 429-450. Himmelmann, Beatrix: Kants Begriff des Glücks, Berlin 2003. Hinsch, Wilfried: Kant, die humanitäre Intervention und der moralische Exzeptionalismus, in: Kant im Streit der Fakultäten, Berlin/New York 2005, hrsg. v. Volker Gerhardt, S. 205228. Hinske, Norbert: Die „Ratschläge der Klugheit“ im Ganzen der Grundlegung. Kant und die Ethik der Griechen, 3. Abschnitt: Xenophon, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 1989, 3. Aufl. 2000, S. 131-147. Höffe, Otfried (Hrsg.): Immanuel Kant: Schriften zur Geschichtsphilosophie, Berlin 2011. Höffe, Otfried: Einleitung, in: Immanuel Kant: Schriften zur Geschichtsphilosophie, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2011, S. 1-28. Ders. (Hrsg.): Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, Berlin 2008. Ders.: Der Mensch als Endzweck (§§ 82–84), in: Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2008, S. 289-308. Ders.: Urteilskraft und Sittlichkeit. Ein moralischer Rückblick auf die dritte Kritik, in: Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2008, S. 351-366. Ders.: Lebenskunst und Moral. Oder: Macht Tugend glücklich?, München 2007. Ders.: Immanuel Kant. Leben - Werk - Wirkung, München 1983, 7. Aufl. 2007. Ders.: Kants universaler Kosmopolitismus, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 55, 2007, S. 179-191. Ders.: Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie, München 2004. Ders. (Hrsg.): Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004. Ders.: Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 5-29. Ders.: Völkerbund oder Weltrepublik?, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 109-132. Ders.: Ausblick: die Vereinten Nationen im Lichte Kant, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 245-272. Ders.: Politische Gerechtigkeit: Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt a. M. 2002. Ders.: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, 2. Aufl. 2002. Ders.: "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie, Frankfurt a. M. 2001. Ders.: (Hrsg.): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, Frankfurt a. M. 1989, 3. Aufl. 2000. Ders.: Kants nicht empirische Verallgemeinerung: Zum Rechtsbeispiel des falschen Versprechens, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 1989, 3. Aufl. 2000, S. 206-233. - 262 - Ders. (Hrsg.): Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Berlin 1999. Ders.: Der kategorische Rechtsimperativ: „Einleitung in die Rechtslehre“, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 41-62. Ders.: Ist Kants Rechtsphilosophie noch aktuell?, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 279-292. Ders.: Eine republikanische Vernunft. Zur Kritik des Solipsismus-Vorwurfs, in: Kants in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Yasushi Kato und Gerhard Schönrich, Frankfurt a. M. 1996, S. 396-407. Ders.: Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne, Frankfurt a. M. 1990, 3. Aufl. 1995. Ders.: Universalistische Ethik und Urteilskraft: ein aristotelischer Blick auf Kant, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 44, 1990, S. 537-563. Ders.: Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln: philosophische Versuche zur Rechtsund Staatsethik, Stuttgart 1988. Ders.: Kants Kategorischer Imperativ als Kriterium des Sittlichen, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 31, 1977, S. 354-384. Hoffmann, Stanley (Hrsg.): The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, NotreDame 1996; Hoffmann, Stanley: Duties Beyond Borders. On the Limits and Possibilities of Ethical International Politics, New York 1981. Hruschka, Joachim: The permissive law of practical reason in Kant’s “Metaphysics of Morals”, in: Law and Philosophy 23, 2004, S. 45-72. Huntley, Wade: Kant’s Third Image: Systemic Sources of the Liberal Peace, in: International Studies Quarterly 40, 1996, S. 45-76. Hurrel, Andrew: Kant and the Kantian Paradigm in International Relations, in: Review of International Studies 16, 1990, S. 183-205. Jasper, Karl: Kants »Zum ewigen Frieden«. Wiederabgedruckt in Ders.: Aneignung und Polemik, hrsg. v. Hans Saner, München 1968, S. 205-232. Jervis, Robert: Cooperation under the security dilemma, in: World Politics 30, 1978, S. 167214. Kater, Thomas: Politik, Recht, Geschichte: zur Einheit der politischen Philosophie Immanuel Kants, Würzburg 1999. Kaufmann, Matthias: Was erlaubt das Erlaubnisgesetz - und wozu braucht es Kant?, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 13, 2005, S. 195-219. Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Frankfurt a. M. 1984, Paderborn 3. Aufl. 2007. Ders.: Kant. Über Recht, Paderborn 2004. Ders.: Weltfriedensordnung und globale Verteilungsgerechtigkeit. Kants Konzeption eines vollständigen Rechtsfriedens und die gegenwärtige politische Philosophie der internationalen Beziehungen, in: Zum ewigen Frieden. Grundlage, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, hrsg. v. Reinhard Merkel und Roland Wittmann, Frankfurt a. M. 1996, S. 172-212. Ders.: Globale Rechtsordnung oder weltweite Verteilungsgerechtigkeit? Über den systematischen Grundriss einer politischen Philosophie der internationalen Beziehungen; in: Politisches Denken, Jahrbuch 1995/96, S. 197-246. Ders.: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein“, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 87108. - 263 - Klar, Samuel: Moral und Politik bei Kant: eine Untersuchung zu Kants praktischer und politischer Philosophie im Ausgang der Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft, Würzburg 2007. Kleingeld, Pauline: Kants Argumente für den Völkerbund, in: Recht-Geschichte-Religion. Kants Bedeutung für die Gegenwart, hrsg. v. Herta Nagl-Docakal und Rudolf Langthaler, Berlin 2004, S. 99-111. Ders.: Approaching Perpetual Peace: Kant’s Defence of a League of States and His Ideal of a World Federation, in: The European Journal of Philosophy 12, 2004, S. 304-325. Ders.: Kantian Patriotism, in: Philosophy & Public Affairs 29, 2000, S. 313-341. Ders.: Kants politischer Kosmopolitismus, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 5, 1997, S. 333348. Klemme, Heiner F.: Die Freiheit der Willkür und die Herrschaft des Bösen. Kants Lehre vom radikalen Bösen zwischen Moral, Religion und Recht, in: Aufklärung und Interpretation. Studien zu Kants Philosophie und ihrem Umkreis, hrsg. v. Heiner F. Klemme, Bernd Ludwig, Michael Pauen und Werner Stark, Würzburg 1999, S. 124151. Ders.: Einleitung, in: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis / Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Heiner Klemme, Hamburg 1992, S. VII-LIII. Klenner, Hermann: Kants Entwurf „Zum ewigen Frieden“ – Illusion oder Utopie?, in: 200 Jahre Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Idee einer globalen Friedensordnung, Würzburg 1996, hrsg. v. Volker Bialas und Hans-Jürgen Häßler, S. 15-25. Kodalle, Klaus-Michael (Hrsg.): Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, Würzburg 1996. Koslowski, Peter: Staat und Gesellschaft bei Kant, Tübingen 1985. Kühl, Kristian: Von der Art, etwas Äußeres zu erwerben, insbesondere vom Sachenrecht, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 117-133. Ders.: Rehabilitierung und Aktualisierung des kantischen Vernunftrechts, in: Rechts- und Sozialphilosophie in Deutschland heute, hrsg. v. Robert Alexy, Ralf Dreier, Ulfrid Neumann, Stuttgart 1991, S. 212-221. Ders.: Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur Aktualität der Kantischen Rechts- und Eigentumslehre, Freiburg München 1984. Kyora, Stefan: Kants Argumente für einen schwachen Völkerbund heute, in: 200 Jahre Kants Entwurf »Zum ewigen Frieden«. Idee einer globalen Friedensordnung, hrsg. v. Volker Bialas und Hans-Jürgen Häßler, Würzburg 1996, S. 96-107. Laberge, Pierre/Lafrance, Guy/Dumas, Denis (Hrsg.): L’Année 1795: Kant, Essais sur la Paix, Paris 1997. Laberge, Pierre: Von der Garantie des ewigen Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 149-169. Langer, Claudia: Reform nach Prinzipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kants, Stuttgart 1986. Lequan, Mai: Existe-t-il un droit de mentir? Actualités de la controverse Kant / Constant, in: Etudes 2, 2004, S. 189-199. Ludwig, Bernd: Politik als „ausübende Rechtslehre“. Zur Staatstheorie Immanuel Kants, in: Klassische Politik. Politikverständnisse von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, hrsg. v. Hans J. Lietzmann und Peter Nitschke, Opladen 2000, S. 175-220. Ders.: Warum es keine >hypothetischen Imperativen< gibt, und warum Kants hypothetischgebietende Imperative keine analytischen Sätze sind, in: Aufklärung und Interpretation, - 264 - hrsg. v. Heiner F. Klemme, Bernd Ludwig, Michael Pauen und Werner Stark, Würzburg 1999, S. 105-124. Ders.: Einleitung, in: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Metaphysik der Sitten. Erster Teil, hrsg. v. Bernd Ludwig, Hamburg 1988, 2. Aufl. 1998, S. XIII-XL. Ders.: Will die Natur unwiderstehlich die Republik? Einige Reflexionen anlässlich einer rätselhaften Textpassage in Kants Friedensschrift, in: Kant-Studien 88, 1997, S. 218-228. Ders.: Postulat, Deduktion und Abstraktion in Kants Lehre vom intelligiblen Besitz. Einige Reflexionen im Anschluss an den vorstehenden Aufsatz von Y. Saito, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 82, 1996, S. 250-259. Ders.: Der Platz des rechtlichen Postulats der praktischen Vernunft innerhalb der Paragraphen 1 – 6 der kantischen Rechtslehre, in: Rechtsphilosophie der Aufklärung, Berlin 1982, S. 218-232. Luf, Gerhard: Die Typik der reinen praktischen Urteilskraft und ihre Anwendung auf Kants Rechtslehre, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie 8, 1975, S. 54-71. Lutz-Bachmann, Matthias/Bohman, James (Hrsg.): Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung. Frankfurt a. M. 1996. Lutz-Bachmann, Matthias: Kants Friedensidee und das rechtsphilosophische Konzept einer Republik, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 25-44. Lyotard, Jean-François: L’enthousiasme. La critique kantienne de l’histoire, Paris 1986. Machiavelli, Niccolò: Il Principe / Der Fürst, übers. u. hrsg. v. Philipp Rippel, Stuttgart 1986. Marcuzzi, Max: Vers la paix perpétuelle. De Emmanuel Kant, Paris 2007. Marshall, John: Hypothetical Imperatives, in: American Philosophical Quarterly 19/1, 1982, S. 105-114. Matthies, Volker (Hrsg.): Frieden durch Einmischung?, Bonn 1993. Mayer, Verena: Das Paradox des Regelfolgens in Kants Moralphilosophie, in: Kant-Studien 97, 2006, S. 343-368. Merkel, Reinhard/Wittmann, Roland (Hrsg.): »Zum ewigen Frieden«. Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant, Frankfurt a. M. 1996. Moravcsik, Andrew: Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, in: International Organization 51:4, 1997, S. 513-553. Müller, Harald: Demokratien im Krieg – Antinomien des demokratischen Friedens, in: Demokratien im Krieg, hrsg. v. Christine Schweitzer, Björn Aust und Peter Schlotter, Baden-Baden, S. 35-52. Müller, Jörg Paul: Das Weltbürgerrecht (§ 62) und Beschluss, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 257-279. Nowosadtko, Jutta: Krieg, Gewalt und Ordnung. Einführung in die Militärgeschichte, Tübingen 2002. Nussbaum, Martha C.: The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Part II, Cambridge 2001 Ders.: Kant und stoisches Weltbürgertum, in: Frieden durch Recht. Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, hrsg. v. Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman, Frankfurt a. M. 1996, S. 45-75. Oberer, Hariolf: Sittengesetz und Rechtsgesetze a priori, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer, Bd. III, Würzburg 1997, S. 157-200. O’Neill, Onora: Instituting Principles: Between Duty and Action, in: Kant’s Metaphysics of Morals: Interpretative Essays, hrsg. v. Mark Timmons, Oxford 2002, S. 331-347. - 265 - Palmquist, Stephen R: Kant’s critical religion, Aldershot/Burlington USA/Singapore/Sydney 2000. Papke, Gerhard: Von der Miliz zum Stehenden Heer. Wehrwesen im Absolutismus, in: Deutsche Militärgesichte in sechs Bänden 1648-1939, hrsg. v. militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 1, Abschnitt I, München 1983, S. 154-199. Paton, Herbert J.: An alleged right to lie. A problem in Kantian ethics, in: Kant und das Recht der Lüge, hrsg. v. Georg Geismann und Hariolf Oberer, Würzburg 1986, S. 46-60. Ders.: The categorical imperative: a study in Kant’s moral philosophy, Philadelphia, 1971. Patzig, Günther: Die logischen Formen praktischer Sätze in Kants Ethik, in: Kant-Studien 56, 1966, S. 237-252. Petersen, Thomas: Phronesis und Urteilskraft – antike und zeitgenössische politische Philosophie, in: Wege zur politischen Philosophie. Festschrift für Martin Sattler, hrsg. v. Gabrielle von Sivers und Ulrich Diehl, Würzburg 2005, S. 119-134. Philonenko, Alexis: Métaphysique et Politique chez Kant et Fichte, Paris 1997. Ders.: Kant et le problème de la paix, in: Essais sur la philosophie de la guerre, hrsg. v. Alexis Philonenko, Paris 1976, S. 26-42. Pieper, Annemarie: Praktische Urteilskraft. Zur Frage der Anwendung moralischer Normen, in: Prinzip und Applikation in der praktischen Philosophie, hrsg. v. Thomas M. Seebohm, Stuttgart 1990, S. 153-167. Ders.: Handlung, Freiheit und Entscheidung – Zur Dialektik der praktischen Urteilskraft, in: Pragmatik – Handbuch pragmatischen Denkens, hrsg. v. Herbert Stachowiak, Hamburg 1989, S. 86-108. Pinzani, Alessandro: Der systematische Stellenwert der pseudo-ulpianischen Regeln in Kants Rechtslehre, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 59, 2005, S. 71-94. Ders.: Das Völkerrecht §§ 53-61, in: Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 235-256. Pleines, Jürgen-Eckardt: Praxis und Vernunft. Zum Begriff praktischer Urteilskraft, Würzburg/ Amsterdam 1983. Prauss, Gerold: Für sich selber praktische Vernunft, in: Kants in der Diskussion der Moderne, hrsg. v. Yasushi Kato und Gerhard Schönrich, Frankfurt a. M. 1996, S. 268-279. Rainer, Friedrich: Eigentum und Staatsbegründung in Kants Metaphysik der Sitten (KantStudien-Ergänzungshefte), Berlin - New York 2004. Raumer, Kurt von: Ewiger Friede, Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, München 1953. Rawls, John: The Law of Peoples (with “The Idea of Public Reason revisited“), Cambridge, (Massachusetts)/London 1999. Ders.: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1975. Renaut, Alain: Le système du droit. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte, Paris 1986. Richli, Urs: Transzendentale Reflexion und sittliche Entscheidung – Zum Problem der Selbsterkenntnis der Metaphysik bei Kant und Jaspers, in: Kant-Studien 92, 1967, S. 210-215. Ricken, Friedo: Homo Noumenon und homo phaenomenon, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ein kooperativer Kommentar, hrsg. v. Otfried Höffe, Frankfurt a. M. 1989, 3. Aufl. 2000, S. 234-252. Ricken, Friedo/Marly, François (Hrsg.): Kant über Religion, Stuttgart 1992. Ritzel, Wolfgang: Kant und das Problem der Individualität, in: Kant-Studien, Sonderheft 1 – Akten des 4. Internationalen Kant-Kongress, 1974, S. 229-246. Rossi, Philip J./Wreen, Michael W. (Hrsg.): Kant’s philosophy of religion reconsidered, Bloomington/ Indianapolis 1991. - 266 - Russett, Bruce / Starr, Harvey: From Democratic Peace to Kantian Peace. Democracy and Conflict in the International System, in: Handbook of War Studies, hrsg. v. Manus Midlarsky, Ann Arbor 2000, S. 93-128. Russett, Bruce: Why Democratic Peace?, in: Debating the Democratic Peace, hrsg. v. Michael Brown, Sean Lynn-Jones, und Steven Miller, Cambridge 1996, S. 82-115. Saner, Hans: Die negativen Bedingungen des Friedens, in: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1995, 2. Aufl. 2004, S. 43-67. Sassenbach, Ulrich: Der Begriff des Politischen bei Immanuel Kant, Würzburg 1992. Saito, Yumi: Die Debatte weitet sich aus – zu Bernd Ludwigs vorstehender Replik, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 82, 1996, S. 259-265. Ders.: War die Umstellung von § 2 der Kantischen ‚Rechtslehre‘ zwingend?, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 82, 1996, S. 238-250. Savidan, Patrick: Le républicanisme de Kant, in: Kant et les kantismes dans la philosophie contemporaine 1804-2004, hrsg. v. Christian Berner und Fabien Capeillères, Villeneuve d’Ascq 2007, S. 43-65. Schattenmann, Marc: Wohlgeordnete Welt. Immanuel Kants politische Philosophie in ihren systematischen Grundzügen, München 2006. Schneiders, Werner: Philosophenkönige und königliche Völker. Modelle philosophischer Politik bei Platon und Kant, in: Filosofia Oggi 2, 1981, S. 165-175. Schmidt, Hajo: Durch Reform zu Republik und Frieden? Zur politischen Philosophie Immanuel Kants, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 71, 1985, S. 297-317. Schmidt, Hans: Staat und Armee im Zeitalter des „miles perpetuus“, in: Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit, hrsg. v. Johannes Kunisch, Berlin 1986, S. 213-248. Schmitz, Heinz-Gerd: Moral und Klugheit? Überlegungen zur Gestalt der Autonomie des Politischen im Denken Kants, in: Kant-Studien 81, 1990, S. 412-434. Schönrich, Gerhard/ Kato, Yasushi (Hrsg.): Kants in der Diskussion der Moderne, Frankfurt a. M. 1996. Schopenhauer, Arthur: Die Beiden Grundprobleme der Ethik, in: Arthur Schopenhauer. Kleinere Schriften, Frankfurt a. M. 1994. Ders.: Die Welt als Wille und Vorstellung, Frankfurt a. M. 1986. Schulte, Christoph: Radikal böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche, München 1988. Schwaiger, Clemens: Klugheit bei Kant. Metamorphosen eines Schlüsselbegriffs der praktischen Philosophie, in: Aufklärung 14, 2002, S. 147-159. Seel, Gerhard: Sind hypothetische Imperative analytische praktische Sätze?, in: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 2000, S. 148-170. Ders.: « Mais il y aurait là contradiction ». Une nouvelle lecture du deuxième article définitif, in: L’Année 1795: Kant, Essais sur la Paix, hrsg. v. Pierre Laberge, Guy Lafrance und Denis Dumas, Paris 1997, S. 160-182. Sullivan, Roger J.: Immanuel Kant’s Moral Theory, Cambridge 1989. Städtler, Michael (Hrsg.): Kants „Ethisches Gemeinwesen“. Die Religionsschrift zwischen Vernunftkritik und praktischer Philosophie, Berlin 2005. Thiele, Ulrich: Demokratischer Pazifismus. Aktuelle Interpretationen des ersten Definitivartikels der Kantischen Friedensschrift, in: Kant-Studien 99, 2008, S. 180-199. Thurnherr, Urs: Urteilskraft und Anerkennung in der Ethik Immanuel Kants, in: Anerkennung. Eine philosophische Propädeutik. Festschrift für Annemarie Pieper, hrsg. v. Monika Hofmann- Riedinger und Urs Thurnherr, Freiburg 2001, S. 76-92. - 267 - Timmermann, Jens: The Dutiful lie: Kantian Approaches to Moral Dilemmas, in: Kant und die Berliner Aufklärung, hrsg. v. Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann und Ralph Schumacher, Berlin 2001, S. 345-354. Timmons, Mark: Evil and Imputation in Kant's Ethics, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 2, 1994, S. 113-142. Tuschling, Burkhard: Das ‚rechtliche Postulat der praktischen Vernunft‘: seine Stellung und Bedeutung in Kants ‚Rechtslehre‘, in: Kant. Analysen – Probleme – Kritik, hrsg. v. Hariolf Oberer und Gerhard Seel, Würzburg 1988, S. 273-292. Väyrynen, Kari: Weltbürgerrecht und Kolonialismuskritik bei Kant, in: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses, hrsg. v. Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann und Ralph Schumacher, 2001, S. 302-309. Villey, Michel: Préface à la Métaphysique des mœurs: Doctrine du droit, Paris 1993, S.7-27. Ders.: Kant dans l’histoire du droit, in: La philosophie politique de Kant. Annales de philosophie politique 4, 1962, S. 53-76. Vollrath, Ernst: Was ist das Politische? Eine Theorie des Politischen und seiner Wahrnehmung, Würzburg 2003. Ders.: Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen, Würzburg 1987. Ders.: Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft, Stuttgart 1977. Ders.: Kants Kritik der Urteilskraft als Grundlegung einer Theorie des Politischen, in: KantStudien-Sonderheft. 65. Jahrgang. Akten des 4. Internationalen Kant-Kongress, hrsg. v. Gerhard Funke und Joachim Kopper, Berlin/ New York, 1974, S. 692-705. Vorländer, Karl: Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Wiesbaden 1924, Nachdruck 2004. Wagner, Hans: Kant gegen „ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen“, in: KantStudien 69, 1978, S. 90-96. Weil, Eric: Kant et le problème de la politique, in: La philosophie politique de Kant. Annales de philosophie politique 4, 1962, S. 1-32. Wieland, Wolfgang: Urteil und Gefühl. Kants Theorie der Urteilskraft, Göttingen 2002. Williams, Howard: Morality or Prudence?, in: Kant-Studien 83, 1992, S. 222-225. Wimmer, Reiner: Kants kritische Religionsphilosophie, Berlin/New York 1990. Wood, Allen W.: Kant’s Doctrine of Rights: Introduction, in: Immanuel Kant. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. v. Otfried Höffe, Berlin 1999, S. 19-40. Ders.: Kant’s rational theology, Ithaca 1978. - 268 -