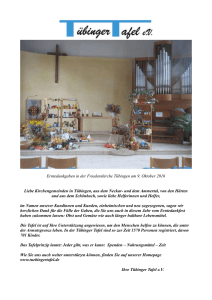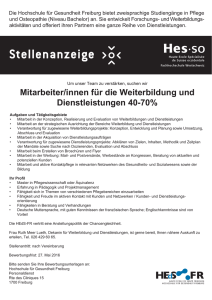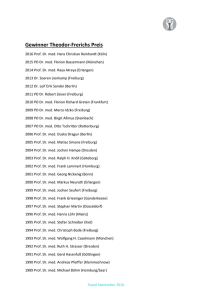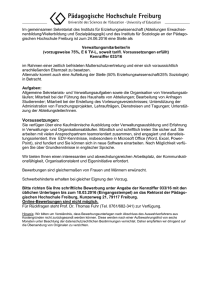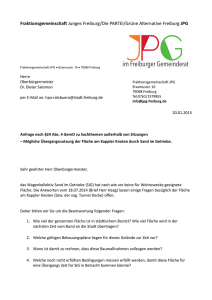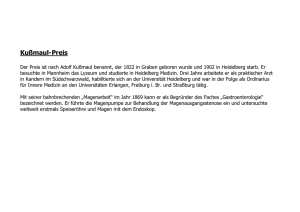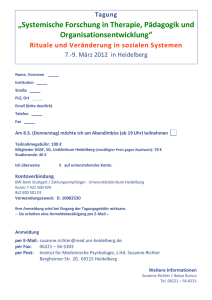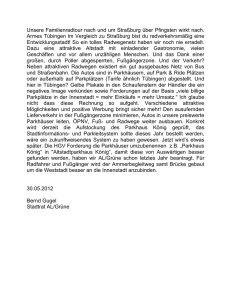Universität und Krieg. : Die Auswirkungen des Dreißigjährigen
Werbung
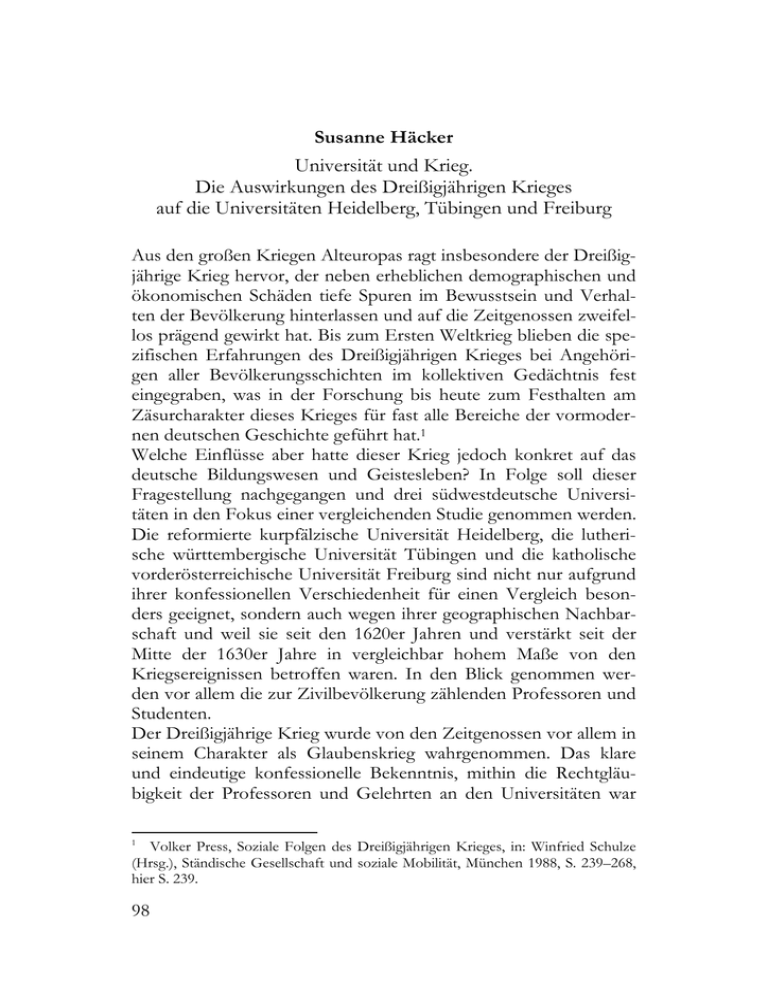
Susanne Häcker Universität und Krieg. Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf die Universitäten Heidelberg, Tübingen und Freiburg Aus den großen Kriegen Alteuropas ragt insbesondere der Dreißigjährige Krieg hervor, der neben erheblichen demographischen und ökonomischen Schäden tiefe Spuren im Bewusstsein und Verhalten der Bevölkerung hinterlassen und auf die Zeitgenossen zweifellos prägend gewirkt hat. Bis zum Ersten Weltkrieg blieben die spezifischen Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges bei Angehörigen aller Bevölkerungsschichten im kollektiven Gedächtnis fest eingegraben, was in der Forschung bis heute zum Festhalten am Zäsurcharakter dieses Krieges für fast alle Bereiche der vormodernen deutschen Geschichte geführt hat.1 Welche Einflüsse aber hatte dieser Krieg jedoch konkret auf das deutsche Bildungswesen und Geistesleben? In Folge soll dieser Fragestellung nachgegangen und drei südwestdeutsche Universitäten in den Fokus einer vergleichenden Studie genommen werden. Die reformierte kurpfälzische Universität Heidelberg, die lutherische württembergische Universität Tübingen und die katholische vorderösterreichische Universität Freiburg sind nicht nur aufgrund ihrer konfessionellen Verschiedenheit für einen Vergleich besonders geeignet, sondern auch wegen ihrer geographischen Nachbarschaft und weil sie seit den 1620er Jahren und verstärkt seit der Mitte der 1630er Jahre in vergleichbar hohem Maße von den Kriegsereignissen betroffen waren. In den Blick genommen werden vor allem die zur Zivilbevölkerung zählenden Professoren und Studenten. Der Dreißigjährige Krieg wurde von den Zeitgenossen vor allem in seinem Charakter als Glaubenskrieg wahrgenommen. Das klare und eindeutige konfessionelle Bekenntnis, mithin die Rechtgläubigkeit der Professoren und Gelehrten an den Universitäten war 1 Volker Press, Soziale Folgen des Dreißigjährigen Krieges, in: Winfried Schulze (Hrsg.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, München 1988, S. 239–268, hier S. 239. 98 Universität und Krieg schon vor dem Dreißigjährigen Krieg im so genannten Konfessionellen Zeitalter von herausragender Bedeutung. Inwiefern war daher die personelle und konfessionelle Struktur in den Kriegsjahren Veränderungen unterworfen? In der Literatur wurden angesichts der zeitweise enormen Präsenz fremder Soldaten in den Universitätsstädten die zahlreichen Konflikte zwischen Studenten und einfachen Soldaten in besonderer Weise hervorgehoben und als ein Grund dafür genannt, dass die studentischen Sitten während des Dreißigjährigen Krieges verrohten. Mit den teilweise erheblichen, kriegsbedingten Frequenzschwankungen der drei untersuchten Hochschulen ist die Problematik des akademischen, gelehrten Nachwuchses, welcher am Beispiel der Theologiestudenten am besten rekonstruierbar ist, weiterhin am Engsten verbunden. Der zeitweise für die Hochschulen existenziell bedrohliche Rückgang der Immatrikulationszahlen und die zum Teil gravierenden Einschränkungen des akademischen Lehrbetriebes an den Landesuniversitäten wirkten sich unausweichlich auf die soziale Rekrutierung der territorialen Bildungseliten – namentlich auf die Pfarrer- und Beamtenschaft – aus. Aus all dem stellt sich die Gesamtfrage, ob und in welcher Form der akademische Lehrbetrieb in Kriegszeiten aufrechterhalten werden konnte, was unmittelbar die in der Literatur vertretene These des generellen Niedergangs von Lehre und Forschung berührt. Konfessionelle Ausgangssituation zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges Als reformierte Hochschule spielte die Universität Heidelberg für das deutsche Geistesleben eine große Rolle und zeichnete sich zudem durch ihre überterritoriale Bedeutung aus. Die Universität Heidelberg wirkte über den Heidelberger Katechismus und durch die Prägung ihrer Studenten als Vermittlerin der reformierten Theologie im Reich sowie darüber hinaus und kann daher um 1600 neben Genf und Leiden als ein bedeutendes Zentrum des reformierten Protestantismus in Europa bezeichnet werden.2 Die 2 Armin Kohnle, Die Universität Heidelberg als Zentrum des reformierten Protestantismus im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Márta Font/Lászlo Szögi (Hrsg.), Die ungarische Universitätsbildung und Europa, Pécs 2001, S. 141–161, hier S. 148. 99 Susanne Häcker reformierten Heidelberger Theologen, vor allem David Pareus, Franz Junius und Abraham Scultetus, waren Vertreter einer Irenik, die auf eine Lehreinigung aller Protestanten bei zugleich klarer Abgrenzung zum Katholizismus abzielten.3 Theologieprofessoren aus Heidelberg beteiligten sich für die reformierte Pfälzer Landeskirche an der Synode von Dordrecht in den Jahren 1618/19.4 Pareus erkannte aber durchaus auch, dass theologische Klärungsgespräche an der mangelnden Konzessionsbereitschaft auf beiden Seiten litten.5 Die Theologen der Tübinger Universität vertraten eine streng lutherisch-orthodoxe Linie, allen voran der Polemiker Theodor Thumm.6 In einem Briefwechsel mit dem württembergischen Ratsmitglied Benjamin Bouwinghausen von Wallmerode, in dem dieser die Truppendurchzüge durch den Schwäbischen Kreis ansprach, äußerte sich der Kaiser folgendermaßen: Kann doch ewer fürst seine pfaffen nicht ziehen, wie sollten dann wir unsere soldaten ziehen?7 Verschiedene Pasquillen des streitbaren Tübinger Theologieprofessors Theodor Thumm waren am Kaiserhof auf Missbilligung gestoßen.8 Die Einstellung Tübinger Theologen gegenüber den Reformierten war aber nicht weniger kampfeslustig, in deren Theologie wurde eine Deformation des Glaubens gesehen.9 Als einzig lutherische Uni3 Günter Brinkmann, Die Irenik des David Pareus. Frieden und Einheit in ihrer Relevanz zur Wahrheitsfrage, Hildesheim 1972, S. 12f.; Wilhelm Holtmann, Die Pfälzische Irenik im Zeitalter der Gegenreformation, Göttingen 1960, S. 282f.; Volker Press, Kurfürst Maximilian I. von Bayern, die Jesuiten und die Universität Heidelberg im Dreißigjährigen Krieg 1622–1649, in: Wilhelm Doerr (Hrsg.), Semper Apertus. Sechshundert Jahre Universität Heidelberg 1386–1986. Festschrift in sechs Bänden, Bd. 1, Berlin u.a. 1985, S. 314–370, hier S. 316; Anton Schindling/Walter Ziegler, Kurpfalz, Rheinische Pfalz und Oberpfalz, in: Dies. (Hrsg.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500–1650, Bd. 5, Münster 1993, S. 8–49, hier S. 38. 4 Ebd., S. 38. 5 Holtmann, Die Pfälzische Irenik (wie Anm. 3), S. 241. 6 Ludwig Timotheus von Spittler, Ueber Christoph Besold’s Religionsveränderung. Mit Zusätzen von Gottlieb Christian Friedrich Mohnike, Greifswald 1822, S. 25–27. 7 Zitiert nach Axel Gotthard, Konfession und Staatsräson. Die Außenpolitik Württembergs unter Herzog Johann Friedrich (1608–1628), Stuttgart 1992, S. 417. 8 Ebd., S. 417. 9 Zitiert nach Ludwig Timotheus von Spittler, Geschichte Wirtembergs unter der Regierung der Grafen und Herzoge, Göttingen 1783, S. 4 f. 100 Universität und Krieg versität im süddeutschen Raum hatte die Eberhardina zu Beginn des 17. Jahrhunderts nichtsdestotrotz eine besondere Ausstrahlungskraft auf die ostmitteleuropäischen Länder, wie etwa Böhmen, Mähren, Schlesien und Ungarn sowie auf die evangelische Bevölkerung der Habsburgischen Erblande.10 Nach fast fünfzigjährigen Bemühungen der österreichischen Erzherzöge wurden im November 1620 an der Albertina in Freiburg die Jesuiten eingesetzt, um den wahren Glauben zu lehren. Diese übernahmen die Lehrstühle an der Philosophischen und zum Teil auch der Theologischen Fakultät.11 Das Einzugsgebiet der Albertina erstreckte sich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges in erster Linie auf die katholischen Gebiete in Südwestdeutschland, der Schweiz und des Elsasses.12 Mit der festen Etablierung der Jesuiten im Jahr 1620 stiegen hier die Studentenzahlen stark an.13 Der Kriegsverlauf im Südwesten des Reiches Die Kurpfalz und damit auch Heidelberg, die Residenzstadt der pfälzischen Kurfürsten, waren bereits ab 1620 unmittelbar vom Kriegsgeschehen betroffen und wurden bis zum Kriegsende immer wieder von den Kriegsereignissen heimgesucht.14 Freiburg und Tübingen hingegen – in den 1620er Jahren zunächst nur von den Randerscheinungen des Krieges, wie der Inflation im 10 Matthias Asche, Bildungsbeziehungen zwischen Ungarn, Siebenbürgen und den deutschen Universitäten im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Wilhelm Kühlmann/Anton Schindling (Hrsg.), Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Stuttgart 2004, S. 27–52. 11 Otto Krammer, Bildungswesen und Gegenreformation. Die Hohen Schulen der Jesuiten im katholischen Teil Deutschlands vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Würzburg 1988, S. 93; Friedrich Schaub, Die vorderösterreichische Universität Freiburg, in: Friedrich Metz (Hrsg.), Vorderösterreich. Eine geschichtliche Landeskunde, Bd. 1, 1. Aufl., Freiburg im Breisgau 1959, S. 228–244, hier S. 231; Anton Schindling, Die katholische Bildungsreform zwischen Humanismus und Barock. Dillingen, Dole, Freiburg, Molsheim und Salzburg. Die Vorlande und die benachbarten Universitäten, in: Hans Maier/Volker Press (Hrsg.), Vorderösterreich in der frühen Neuzeit, Sigmaringen 1989, S. 137–176. 12 Hermann Mayer (Bearb.), Die Matrikel der Universität Freiburg i. Br. von 1460– 1656, Bd. 2, Freiburg/Br. 1907, S. 790–814. 13 Theodor Kurrus, Die Jesuiten an der Universität Freiburg i. Br. 1620–1773, Bd. 1, Freiburg/Br. 1963, S. 18. 14 Schindling/Ziegler, Kurpfalz, Rheinische Pfalz und Oberpfalz (wie Anm. 3). 101 Susanne Häcker Gefolge der der Kipper und Wipper oder der Truppendurchzüge, tangiert – wurden von direkten Kriegsauswirkungen erst in der zweiten Kriegshälfte berührt. Für die vorderösterreichische Stadt Freiburg begannen die schweren Kriegsjahre mit dem Vordringen der Schweden in den süddeutschen Raum im Jahre 1632.15 In Tübingen hielten die drückenden Kriegszeiten erst nach der Niederlage Schwedens und seiner Verbündeten, zu denen auch der Herzog von Württemberg gehörte, nach der Schlacht von Nördlingen (1634) Einzug.16 Sowohl in Tübingen als auch in Freiburg waren die üblichen Begleiterscheinungen des Krieges bis zum Westfälischen Frieden präsent, wobei Freiburg als umkämpfte Festungsstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zur französischen Grenze im Vergleich doch stärker von direkten Kriegshandlungen betroffen war als Tübingen. An einen planmäßigen Wiederaufbau des Landes war aber in allen drei Städten vor dem Kriegsende nicht zu denken. Die Begleiterscheinungen des Krieges, wie Seuchen, Hunger und Teuerungen, machten der Bevölkerung schwer zu schaffen, und die Bevölkerungsverluste aller drei Städte lagen bei über 70 Prozent.17 Auswirkungen auf die Professorenschaft Drei Gesichtspunkte werden im Zentrum dieses Kapitels stehen: Zunächst wird die Neuberufungspolitik der Besatzungsmächte, nach Flucht, Vertreibung oder dem Tod der bisherigen Lehrstuhlinhaber behandelt. Da das eindeutige konfessionelle Bekenntnis und die Rechtgläubigkeit der Professoren und Gelehrten von großer Wichtigkeit waren, fällt der Blick weiterhin auf Konvertiten innerhalb des Lehrkörpers. Abschließend wird die Rolle der aka15 Horst Buszello/Hans Schadek, Alltag der Stadt – Alltag der Bürger. Wirtschaftskrisen, soziale Not und neue Aufgaben der Verwaltung zwischen Bauernkrieg und Westfälischem Frieden, in: Heiko Haumann/Hans Schadek (Hrsg.), Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau, Bd. 2, Stuttgart 1994, S. 69–161, hier S. 125. 16 Hermann Ehmer, Württemberg, in: Schindling/Ziegler, Die Territorien des Reichs (wie Anm. 3), S. 168–192, hier S. 188. 17 Günther Franz, Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk, 4. Aufl., Stuttgart 1979; dazu John Theibault, The Demography of the Thirty Years War Revisited. Günther Franz and his Critics, in: German History 15 (1997), S. 1–21; Manfred Vasold, Die deutschen Bevölkerungsverluste während des Dreißigjährigen Krieges, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 56 (1993), S. 147–164. 102 Universität und Krieg demischen Medizin für die medizinpoliceyliche Versorgung der Stadtbevölkerung während der Kriegs- und Pestzeiten dargestellt. Unter den Kriegseinwirkungen wurde der Professorenbestand an allen drei Universitäten stark dezimiert. Am härtesten traf dieser Rückgang die Rupertina in Heidelberg, dort sank die Zahl der Lehrenden bis 1622 von vormals 16 auf sieben; diese Professoren, die mit Ausnahme eines Konvertiten, der bereits zum katholischen Glauben gewechselt war, dem reformierten Glauben angehörten, wurden im Jahre 1626 durch Kurfürst Maximilian I. von Bayern entlassen, und die Hochschule blieb bis 1629 ohne Lehrkräfte. In den Jahren 1629 bis 1631 kam wieder ein Lehrbetrieb mit einer Minimalbesetzung von jeweils einem katholischen Professor an der Theologischen, Juristischen und Philosophischen Fakultät bzw. zwei an der Medizinischen Fakultät zustande.18 Während der schwedischen Besatzungszeit waren zwar protestantische Professoren berufen worden, diese konnten ihre Tätigkeit aufgrund des schwedischen Rückzugs nach der Schlacht von Nördlingen allerdings nicht mehr aufnehmen. Für die Jahre 1635 bis 1649 sind katholische Professoren für die Theologische, Philosophische und Medizinische Fakultät nachgewiesen worden, Spuren eines Lehrbetriebs finden sich aber nicht.19 Die Lehrstühle der Albertina in Freiburg waren während der gesamten Kriegsjahre mit katholischen Professoren besetzt, obwohl auch hier im Verlauf der ersten schwedischen Besatzungszeit (1633– 1635) der Versuch unternommen wurde, protestantische Gelehrte zu berufen. Das wechselnde Kriegsglück vereitelte jedoch dieses Vorhaben.20 Auch in Freiburg lag der Lehrbetrieb zeitweise still. Allerdings scheinen hier nie weniger als drei Professoren vor Ort präsent gewesen zu sein. Durch die Arbeiten von Theodor Kurrus oder auch von Hermann Mayer kann leicht der Eindruck entstehen, dass die jesuitischen Lehrkräfte während der Kriegsjahre im Vergleich zu ihren weltlichen Kollegen besonders mutig und standhaft den Lehrbetrieb aufrechterhalten haben. Bemerkenswert ist auch, dass die schwedischen Besatzer 1632/33 die jesuitischen 18 Eike Wolgast, Die Universität Heidelberg 1386–1986, Berlin/Heidelberg 1986, S. 51–54. 19 Hermann Weisert, Geschichte der Universität Heidelberg, Heidelberg 1983, S. 45. 20 Kurrus, Die Jesuiten an der Universität Freiburg (wie Anm. 13), S. 27. 103 Susanne Häcker Professoren geduldet hatten, obwohl diese ihr konfessionelles Feindbild schlechthin verkörperten. Solch ein Verhalten beschränkt sich nicht nur auf Freiburg, sondern kann auch bei der Besetzung Erfurts durch die Schweden im Jahr 1631 beobachtet werden. Gustav Adolf selbst sorgte hier dafür, dass die Katholiken in Erfurt vor Übergriffen geschützt wurden.21 Seit 1635 bis zum Kriegsende stand eine konfessionelle Umstrukturierung der Hochschule nicht mehr zur Disposition, da Frankreich nun der Hauptgegner der Habsburger war. Die Professorenschaft der Tübinger Eberhardina bestand während des gesamten Krieges aus Lutheranern, wenn man von Christoph Besold absieht, bei dem das genaue Datum seiner Konversion zum katholischen Glauben nicht bekannt ist. Es wurden keine Versuche unternommen, andersgläubige Gelehrte zu berufen, was sicherlich damit zusammenhängt, dass sich Kaiser Ferdinand II. 1635 im Prager Frieden dazu verpflichtet hatte, Württemberg beim lutherischen Glauben zu belassen.22 Die geringste Zahl der Tübinger Professorenschaft war im Jahr 1639/40 mit acht Professoren erreicht. Abgesehen vom Höhepunkt der Kriegswirren direkt nach der Schlacht bei Nördlingen und wohl auch während der Pest wurde hier der Lehrbetrieb nie komplett eingestellt.23 Insgesamt lässt sich unter anderem anhand der Neuberufungen erkennen, dass die jeweiligen Besatzungsmächte durchaus ein Interesse an der Fortführung der Universitäten hatten und eine vollständige Auflösung dieser Bildungsanstalten nicht in ihrem Sinne war. Das eindeutige konfessionelle Bekenntnis und die Rechtgläubigkeit der Professoren und Gelehrten waren an den Universitäten im 16. und 17. Jahrhundert naturgemäß von herausragender Bedeutung. Da konfessionelle Gesichtspunkte bei Berufungen von Professoren bestimmend waren, gab es an vielen Universitäten regelrechte 21 Erich Kleineidam, Universitas Studii Erffordensis. Überblick über die Geschichte der Universität Erfurt, Bd. 3, Leipzig 1983 (ND Erfurt 1997), S. 132 f. 22 Klaus Schreiner, Die Katastrophe von Nördlingen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Folgen einer Schlacht für Land und Leute des Herzogtums Württemberg, in: Jahrbuch des Historischen Vereins für Nördlingen und das Ries 27 (1985), S. 29–90, hier S. 53. 23 Bernhard Zaschka, Die Lehrstühle der Universität Tübingen im Dreißigjährigen Krieg. Zur sozialen Wirklichkeit im vorklassischen Zeitalter, Tübingen 1993, S. 155. 104 Universität und Krieg Konfessionseide als Voraussetzung für die Lehrtätigkeit.24 Über die Ausbildung einer geistlichen (Pfarrer) und weltlichen Führungselite (Beamte) an der konfessionell gebundenen Landesuniversität sollten immerhin nicht weniger als die vom Landesherrn bestimmten Glaubensvorstellungen verbreitet werden. Dem rechten Glauben anzugehören war in dieser unruhigen Kriegszeit von existenzieller Bedeutung. Materielle Gesichtspunkte und das Ziel, die Kriegszeiten möglichst unbeschadet zu überstehen, hatten neben Gewissens- und Glaubensgründen große Bedeutung für so manchen Konvertiten innerhalb der Professorenschaft. Der Konfessionsübertritt bedeutender Männer darf insbesondere in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges als ein bedeutendes, Aufsehen erregendes Ereignis gewertet werden. Die Regierung bzw. die oftmals konfessionsfremden Besatzungsmächte erhofften sich von solchen öffentlichen Konfessionswechseln zweifellos einen Nachahmungseffekt in der Studentenschaft und in der Bevölkerung. Unter den Heidelberger und Tübinger Professoren konnten für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges insgesamt fünf Konvertiten nachgewiesen werden. Ein erster spektakulärer Konfessionsübertritt während des Dreißigjährigen Krieges wurde am 23. November 1621 in der Tübinger Stiftskirche öffentlich zelebriert, und zwar derjenige des Jesuiten Jacob Reihing zum lutherischen Glauben. Reihing, der als profilierter Gegner des Protestantismus galt, hatte zuvor an den Jesuitenkollegs in Innsbruck und München sowie an der Universität Ingolstadt gelehrt und fungierte seit 1613 als Hofprediger des Pfalzgrafen von Neuburg, wo er maßgeblich an der Rekatholisierung des Landes beteiligt gewesen war. Anfang 1621 floh er recht überraschend ins lutherische Württemberg. Für Reihings Übertritt zum evangelischen Glauben scheinen trotz aller polemischen Schriften im Nachhinein, die darauf verwiesen, er habe Unzucht mit einer ledigen Frau betrieben und Angst vor der Strafe 24 Volker Schäfer, Die Universität Tübingen zur Zeit Schickards, in: Ders., Aus dem Brunnen des Lebens. Gesammelte Beiträge zur Geschichte der Universität Tübingen. Festgabe zum 70. Geburtstag, hrsg. v. Sönke Lorenz/Wilfried Setzler, Ostfildern 2005, S. 99–112, hier S. 103. 105 Susanne Häcker des Provinzials gehabt,25 keine äußeren Gründe vorgelegen zu haben. Er habe am Neuburger Hof wohl stets als integrer Mann gegolten.26 Reihings Übertritt scheint auch nicht aus materiellen Gründen erfolgt zu sein, er verließ eine gesicherte Stelle als Hofprediger und angesehener Ordensmann für eine zunächst ungewisse Zukunft als Protestant.27 In seiner Konversionsrede gab er selbst als Hauptgrund an, dass er die Autorität der Heiligen Schrift erkannt habe.28 Reihing wurde in einem viertägigen Examen durch Lucas Osiander und Theodor Thumm auf seinen rechten Glauben geprüft. Die Tübinger Theologen bestätigten daraufhin, dass es sich um keine Scheinbekehrung, sondern eine Bekehrung aus Glaubensgründen handle.29 Der Glaubenswechsler durfte sogar an der streng lutherischen Tübinger Theologischen Fakultät lehren. 1622 berief der Herzog Reihing zunächst zum außerordentlichen Professor der Theologie. In dieser Funktion hatte er zunächst seine eigenen antilutherischen Schriften publizistisch zu widerlegen. 1625 rückte er in eine ordentliche Theologieprofessur ein, verstarb aber bereits drei Jahre später im Alter von 49 Jahren.30 In Tübingen sorgte es für ebenso großes Aufsehen, als Christoph Besold, Professor an der Juristischen Fakultät, 1635 vom lutherischen zum katholischen Glauben übertrat. Bereits in früheren Jahren war aufgrund verschiedener Schriften Besolds, wie etwa Heraclites, oder Spiegel der weltlichen Eitelkeit und des Elends menschlichen Lebens (1617) und Nachfolgung des armen Lebens Christi (1621) ihm gegenüber der Verdacht aufgekommen, dass er mit der katholischen Kirche sympathisierte.31 Die ‚Rechtgläubigkeit’ Besolds wurde im Jahre 1626 von den Theologen Thumm und Lucas Osiander untersucht und anerkannt.32 1627 hatte Besold den Besitz des württem25 Kurt Schwindel, D. Jakob Reihing. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation, München 1931, S. 88. 26 Ulrich Sieber, Professor Johann Martin Rauscher (1592–1655). Studien zur Geschichte der Universität Tübingen im Dreißigjährigen Krieg, Köln 1968, S. 56. 27 Schwindel, Jakob Reihing (wie Anm. 25), S. 103. 28 Ebd., S. 103–121. 29 Ebd., S. 78 f. 30 Schäfer, Universität Tübingen zur Zeit Schickards (wie Anm. 24), S. 99. 31 Spittler, Religionsveränderung (wie Anm. 6), S. 31; Barbara Zeller-Lorenz, Christoph Besold (1577–1638) und die Klosterfrage, Tübingen 1986, S. 19. 32 Spittler, Religionsveränderung (wie Anm. 6), S. 34–36. 106 Universität und Krieg bergischen Herzogs an einigen Klöstern gegenüber dem Bischof von Augsburg und dem Abt von Kaisheim verteidigt.33 1628 bekannte er sich nochmals anlässlich des Amtsantritts des HerzogAdminatrators Ludwig Friedrichs feierlich zur Konkordienformel.34 Ebenso besuchte Besold nach wie vor den Gottesdienst und das Abendmahl.35 Aber bereits 1630 soll er in Heilbronn heimlich zum katholischen Glauben übergetreten sein; doch lässt sich das Konversionsdatum nicht mit letzter Bestimmtheit nachweisen.36 Erst nach der Schlacht von Nördlingen (1634) gab er diesen Schritt bekannt.37 Besold wurde nach seinem öffentlichen Bekenntnis zum katholischen Glauben im August 1635 als Regimentsrat in Stuttgart Mitglied der durch Ferdinand II. eingesetzten württembergischen Räteregierung. Der Konvertit setzte sich allerdings auch weiterhin leidenschaftlich für die Sache der Klöster ein und machte sich aufgrund dessen bei den Habsburgern unbeliebt, denen bei einem Aussterben der württembergischen Herzogsfamilie im Mannesstamm die Erbfolge vorbehalten war, und es lag nicht in ihrem Interesse, das Land durch die Restitution von Klöstern und Stiften zu dezimieren.38 Einer Stelle als Reichshofrat nach Wien zog Besold die Annahme einer Professur in Ingolstadt vor. 1636 siedelte er nach Ingolstadt über, fungierte dort als kurbayerischer Rat und lehrte an der Juristischen Fakultät der dortigen Universität. 1638 verstarb Besold in Ingolstadt.39 Er soll noch auf dem Sterbebett vor den versammelten Kollegen den Wunsch geäußert haben, dass 33 Ebd., S. 35. Ebd., S. 35; Zeller-Lorenz, Christoph Besold (wie Anm. 31), S. 19. 35 Spittler, Religionsveränderung (wie Anm. 6), S. 36. 36 Ebd., S. 39; Zeller-Lorenz: Christoph Besold (wie Anm. 31), S. 20. 37 Spittler, Religionsveränderung (wie Anm. 6), S. 44. 38 Gudrun Emberger, Christoph Besold, in: Universitätsbibliothek Tübingen (Hrsg.), „…helfen zu graben den Brunnen des Lebens.“ 500 Jahre Eberhard-KarlsUniversität Tübingen 1477–1977. Historische Ausstellung des Universitätsarchivs Tübingen, Tübingen 1977, S. 97–100, hier S. 99; Spittler, Religionsveränderung (wie Anm. 6), S. 48; Zeller-Lorenz, Christoph Besold (wie Anm. 31), S. 23 f. 39 Emberger, Christoph Besold (wie Anm. 38), S. 99; Klaus Schreiner, Beutegut aus Rüst- und Waffenkammern des Geistes. Tübinger Bibliotheksverluste im Dreißigjährigen Krieg, in: Eine Stadt des Buches. Tübingen 1498–1998. Ausstellungskatalog, Tübingen 1998, S. 77–130, hier S. 102. 34 107 Susanne Häcker seine Tochter Dorothea im katholischen Glauben erzogen würde und seine Frau Barbara ebenso konvertiere.40 Auf die drei anderen Konvertiten wird hier nicht im Detail eingegangen. Es handelt sich um den Mehrfachkonvertiten Richard Bachoven, der sich als Heidelberger Rechtsprofessor bis 1635 nacheinander zu allen drei großen Konfessionen bekannte, den Heidelberger Mediziner Balthasar Reid und den ebenfalls aus Heidelberg stammenden Philosophen Christoph Jungnitz, die beide zum katholischen Glauben übergingen. Um Scheinbekehrungen zu entlarven und den wahren Glauben der Konvertiten zu testen, wurden diese stets kritischen Prüfungen unterzogen. Doch selbst nach bestandener Examination blieb ihnen gegenüber immer ein Rest Argwohn bestehen.41 Da der Tod im Dreißigjährigen Krieg allgegenwärtig war und wie viele andere Infektionskrankheiten – etwa Ruhr, Typhus, Diphtherie, Pocken – auch die Pest untrennbar zur Realität des Dreißigjährigen Krieges gehörte, ist es naheliegend, die Rolle der akademisch gebildeten Mediziner beziehungsweise die der Medizinprofessoren kritisch zu beleuchten.42 Die Bedeutung der Medizinischen Fakultät an den Universitäten des Alten Reiches war in aller Regel gering; meist lehrten nur ein oder zwei Professoren in dieser Fakultät, die zudem wenig Studenten hatte. Die in erster Linie theoretische Ausbildung der Mediziner war den großen Autoritäten der Antike wie Galen, Avicenna und Hippokrates gewidmet. Empirische Forschung gab es kaum, und Anschauungsunterricht bei anatomischen Sektionen war selten.43 Während sich die italienischen und niederländischen Universitäten im 16. und 17. Jahrhundert neuen physiologischen und anatomischen Erkenntnissen geöffnet hatten, verlief der medizinische 40 Zeller-Lorenz, Christoph Besold (wie Anm. 31), S. 26. Schwindel, Jakob Reihing (wie Anm. 25), S. 78 f. 42 Manfred Vasold, Pest, Not und schwere Plagen. Seuchen und Epidemien vom Mittelalter bis heute, München 1991, S. 139; Susanne Häcker, Mediziner auf der Flucht? Die Rolle der akademischen Medizin während der Pestzüge des Dreißigjährigen Krieges am Beispiel der vorderösterreichischen Universität Freiburg, in: Virus. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin 7 (2008), S. 185–194. 43 Ebd. S. 102. 41 108 Universität und Krieg Unterricht im Reich weitestgehend in traditionellen Bahnen.44 Zwar wurde von den Heidelberger, Tübinger und Freiburger Medizinprofessoren gewünscht, die fortgeschrittenen Studenten zur Urinuntersuchung und zum Pulsmessen ans Krankenbett mitzunehmen, aber dies konnte wohl durchaus nicht als obligatorischer Lehrinhalt angesehen werden. Zu den Aufgaben der Medizinprofessoren gehörten eigentlich die medizinische und hygienische Versorgung der Stadtbevölkerung sowie die Überwachung des Heilpersonals und der Apotheken, die Medicinalpolicey. Während der Pestwellen 1627/28 verpflichtete der städtische Rat Freiburgs die Absolventen der Medizinischen Fakultät Johann Jakob Federer und Dieterich Meyl als Pestärzte und trug diesen auf, sowohl die Armen als auch die Reichen der Stadt zu behandeln.45 Doch trotz allem spielte die Medizinische Fakultät bis ins frühe 18. Jahrhundert keine erhebliche Rolle in der medizinischen Versorgung der Freiburger Bevölkerung. Im Alltag waren handwerklich und zünftisch organisierte Ärzte, wie Bader, Barbiere und Chirurgen, bedeutender. Die diagnostischen Möglichkeiten der akademisch gebildeten Ärzte waren begrenzt. Ihre wichtigsten Hilfsmittel Harnschau und Pulsmessung wurden gleichsam zum Symbol des Arztberufes. Durch akademisch gebildete Ärzte wurden zwar immer wieder Pestschriften mit Behandlungsmethoden und Verhaltensmaßregeln zu Pestzeiten veröffentlicht, doch wirklich sichere Methoden zur Vorbeugung oder Heilung gab es nicht, und sowohl Ärzte, als auch Patienten standen der Pest hilflos gegenüber. Das wirksamste Mittel, sich der Ansteckung durch Pest und Seuchen zu entziehen, war im 17. Jahrhundert für diejenigen, die es sich leisten konnten, die Flucht. Viele Medizinprofessoren und ihre Studenten beherzigten zu Pestzeiten ihren eigenen Rat und flohen.46 44 Wolfgang Uwe Eckart, Geschichte der Medizin, 2. Aufl., Berlin/Heidelberg 1994, S. 167 f. 45 Buszello/Schadek, Alltag der Stadt (wie Anm. 15), S. 124. 46 Ulrich Knefelkamp, Das Verhalten von Ärzten in Zeiten der Pest (14.–18. Jahrhundert), in: Jan Cornelius Joerden (Hrsg.), Der Mensch und seine Behandlung in der Medizin – bloß ein Mittel zum Zweck?, Berlin/Heidelberg 1999, S. 13–39, hier S. 39. 109 Susanne Häcker Auswirkungen des Krieges auf die Studentenschaft und die Immatrikulationszahlen Die Immatrikulationszahlen können als wichtiger Indikator für die Attraktivität einer Hochschule gewertet werden. Es ist aber problematisch, von den in einem Semester an einer Hochschule eingeschriebenen Studenten auf eine tatsächliche Studentenzahl rückzuschließen, auch wenn es hierzu bereits Berechnungsversuche gibt.47 Eine solche Berechnung wird, wenn überhaupt, nur einen Annäherungswert bringen, da in der frühneuzeitlichen Hochschulmatrikel, der wichtigsten seriellen Quelle zur Untersuchung von Studentenzahlen, nur Immatrikulations-, jedoch keine Exmatrikulationsdaten verzeichnet sind.48 Die reformierte Universität Heidelberg war als erste und wohl auch am längsten bzw. am härtesten von den Kriegsereignissen betroffen. Das reformierte Hochschulwesen im Reich wurde insgesamt durch den Dreißigjährigen Krieg erheblich beeinträchtigt. Studenten reformierten Glaubens wichen in erster Linie auf die reformierten Universitäten in den Niederlanden und der Schweiz aus. Einige Heidelberger Studenten wechselten kurz vor oder nach der Belagerung Heidelbergs an die lutherischen Universitäten in Straßburg und Tübingen (vgl. Abb. 1). Aufgrund des militärischen Erfolges der katholischen Liga und der kaiserlichen Truppen Ende der 1620er Jahre waren die katholischen Universitäten und damit auch Freiburg erst ab den 1630er Jahren, mithin nach dem Kriegseintritt Schwedens und einer Kräfteverschiebung zugunsten der Protestanten, direkt von den Kriegsereignissen betroffen (vgl. Abb. 2). Tübingen als lutherische Universität bekam die massiven Kriegslasten und -folgen als letzte der drei angesprochenen Universitäten zu spüren. Insgesamt scheint das lutherische Bildungswesen den 47 Franz Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäten von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Leipzig 1904 (ND Berlin 1994), S. 29–42; dazu kritisch Willem Frijhoff, Grandeur des nombres et misères des réalités. La courbe de Franz Eulenburg et la débat sur le nombre d’intellectuels en Allemagne, 1576–1815, in: Dominique Julia u.a. (Hrsg.), Les Universités Européennes du XVIe au XVIIIe siècle. Histoire sociale des populations étudiantes, Bd. 1, Paris 1986, S. 23–63. 48 Susanne Häcker/Florian Lang, [Art.] Hochschulmatrikel, in: Enzyklopädie der Neuzeit 5 (2007), Sp. 549–551. 110 Universität und Krieg Krieg am glimpflichsten überstanden zu haben. Die Frequenz an lutherischen Hochschulen hatte im Vergleich zu derjenigen der katholischen oder gar der reformierten Hochschulen während des Krieges den geringsten Einbruch erlebt.49 Als Ausweichuniversität für Tübinger Studenten diente vermutlich die lutherische Hochschule in Straßburg, wobei hierzu allerdings abgesehen von der Arbeit von Alexander Persijn zu den pfälzischen Studenten Forschungen bislang fehlen (vgl. Abb. 3).50 Unmittelbare Kriegseinwirkungen, wie Belagerungen und Einquartierungen, sowie Pestzüge, brachten einen direkten Rückgang der Immatrikulationszahlen. Zwar stieg die Zahl der Einschreibungen meist nach der Wiederherstellung einigermaßen geregelter und stabiler Verhältnisse rasch wieder an, doch der Zuzug auswärtiger Studenten ließ danach häufig über längere Zeit hinweg auf sich warten. Bei den Neuimmatrikulationen während der Kriegsjahre handelte es sich meist um Landeskinder oder Studenten aus nahe gelegenen Territorien ohne eigene Hochschulen, wie etwa im Fall der Universität Tübingen aus den lutherischen Reichsstädten Oberdeutschlands. Neben dem Anteil an auswärtigen Studenten sank auch der Anteil adeliger Studenten. Gründe hierfür könnten sein, dass sich vielen Adeligen während der Kriegsjahre die Möglichkeit einer militärischen Karriere auftat oder aber auch, dass diese eher die Mittel und Möglichkeiten hatten, an eine entfernter gelegene Universität auszuweichen. Durch ihre zeitweilige Schließung waren die Frequenzeinbußen der Universitäten Heidelberg und in Freiburg, deren Studentenzufluss teilweise über Jahre hinweg auf vereinzelte Immatrikulationen absank oder vollständig erlag, schwerwiegender als diejenigen an der Universität Tübingen. Hier unterschritt die Zahl der jährlichen Immatrikulationen nie dreizehn Studenten und blieb im Vergleich zu den beiden anderen Hochschulen – freilich auf geringem Niveau – verhältnismäßig stabil. 49 Howard Hotson, A dark Golden Age. The Thirty Years War and the Universities of Northern Europe, in: Allan I. Macinnes u.a. (Hrsg.), Ships, Guns and Bibles in the North Sea and Baltic States, c. 1350–c. 1700, East Linton 2000, S. 235–270, hier S. 247. 50 Alexander Persijn, Pfälzische Studenten und ihre Ausweichuniversitäten während des Dreißigjährigen Krieges. Studien zu einem pfälzischen Akademikerbuch, Mainz 1959. 111 Susanne Häcker Sinkende Studentenzahlen und die hohen Mortalitätsraten in Kriegszeiten konnten in der Nachkriegszeit zu einem erheblichen Mangel an Beamten und Pfarrern führen. Für die Rekrutierung sowohl einer geistlichen, als auch einer weltlichen Beamtenschaft spielten diejenigen eine wichtige Rolle, die während der Kriegszeiten oftmals an Ausweichuniversitäten studiert hatten. Dies gilt in besonderem Maße für die Kurpfalz, aber auch für Württemberg und Freiburg.51 Es ist zu vermuten, daß die Anforderungen an ein Theologiestudium am Ende des Krieges bezüglich Dauer und Lehrinhalten reduziert wurden, um möglichst rasch Pfarrernachwuchs zu erhalten. So wurden im Jahre 1649 zwanzigjährigen Magistern Pfarrstellen im Herzogtum Württemberg anvertraut. Die Pfarrer waren teilweise vier bis fünf Jahre zuvor noch an Lateinschulen gewesen und hatten das Theologiestudium noch nicht abgeschlossen.52 Zweifellos ist jedoch davon auszugehen, daß der Pfarrermangel in der Kriegs- und Nachkriegszeit gerade für traditionell bildungsferne Schichten eine in der Altständischen Gesellschaft sehr seltene Phase erhöhter sozialer Mobilität markierte. Gemäß ihren Privilegien waren die Universitäten und ihre Angehörigen vom Militärwesen befreit. Nichtsdestotrotz wurden immer wieder Studenten und andere Universitätsangehörige im Notfall zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen.53 In Heidelberg wurden die Studenten angehalten, in ihren Häusern zu bleiben, da es häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Studenten kam.54 Trotzdem waren auch sie häufig dazu bereit, an der Defension Heidelbergs mitzuwirken,55 wie etwa gegen die Truppen Tillys im 51 Joachim Köhler, Die Universität zwischen Landesherr und Bischof. Recht, Anspruch und Praxis an der vorderösterreichischen Landesuniversität Freiburg (1550– 1752), Wiesbaden 1980, S. 162.; Persijn, Ausweichuniversitäten (wie Anm. 51), S. 53. 52 Ebd., S. 23. 53 Susanne Häcker, „... sogar Kriegskameraden trifft man unter euch an.“ Die Verteidigung von Stadt, Lehre und Glauben durch Heidelberger, Tübinger und Freiburger Universitätstheologen im Dreißigjährigen Krieg, in: Franz Brendle/Anton Schindling (Hrsg.), Geistliche im Krieg, Münster 2008, S. 89–100. 54 Eduard Winkelmann (Bearb.), Urkundenbuch der Universität Heidelberg. Regesten, Bd. 2, Heidelberg 1886, S. 186. 55 Eike Wolgast, Die kurpfälzische Universität 1386–1803, in: Doerr, Semper Apertus (wie Anm. 3), S. 1–70, hier S. 43. 112 Universität und Krieg Jahr 1622. Dabei hatten sich auch zwei Kohorten der Studenten beteiligt.56 Zur Beteiligung von Universitätsangehörigen an der Verteidigung der Stadt Tübingen und der Landesfestung Hohentübingen finden sich in den Quellen und der Literatur keine Hinweise. Dies mag damit zusammengehangen haben, dass die Stadt Tübingen selbst 1634 an die bayerischen und nochmals 1647 an die französischen Besatzer kampflos übergeben wurde. 1634 wurde neben der Stadt auch das Schloss Hohentübingen kampflos ausgeliefert. 1647 wurde das Schloss zwar mehrere Wochen von der bayerischen Besatzung gegen die französischen Belagerer gehalten, doch über eine Beteiligung akademischer Bürger finden sich auch hier keine Hinweise. In Freiburg wurde bereits 1622, als sich die Kriegsgefahr von der Pfalz und vom Oberrhein her zu nähern schien, eine Anfrage an die über siebzehnjährigen Studenten gestellt, welche von ihnen sich bereit erklären würden, der Stadt im Verteidigungsfall unter eigenem akademischen Feldzeichen zu dienen. Darauf meldeten sich 300 Studenten freiwillig.57 Im Dezember 1632 waren etwa 190 Studenten an der Stadtverteidigung gegen die schwedischen Belagerer beteiligt.58 Ebenso sollen zwei Jesuiten-Patres die Kanonen auf der Burg bedient haben.59 Dieser Beteiligung von Studenten an der Stadtverteidigung war ein langer Schriftverkehr zwischen Stadtkommandant und Universität vorausgegangen.60 Ebenso hatten die Studenten Bedingungen an ihre Beteiligung geknüpft. Sie würden nicht unter der Bürgerschaft wachen, sondern wollten eigene Posten haben, die nicht einem beliebigen Hauptmann unterstellt sein sollten, sondern einem aus dem akademischen Senat, etwa dem Rechtsprofessor Adam Meister. Weiterhin forderten sie, dass die Korporation Universität in den Vertrag bei Übergabe der Stadt 56 Wolgast, Die Universität Heidelberg (wie Anm. 18), S. 52. Hermann Mayer, Freiburg i. Br. und seine Universität im Dreißigjährigen Krieg (1. Teil), in: Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften 26 (1910), S. 121–188, hier S. 123. 58 Heinrich Schreiber, Freiburg im Breisgau mit seinen Umgebungen. Geschichte und Beschreibung, Freiburg/Br. 1825, S. 31. 59 Leo Alexander Ricker, Freiburg. Aus der Geschichte einer Stadt, Karlsruhe 1964, S. 66. 60 Mayer, Freiburg Teil 1 (wie Anm. 58), S. 128–137. 57 113 Susanne Häcker eingeschlossen werden würde.61 Dies waren die Bedingungen, die Universität und Studenten in jedem Verteidigungsfall gegenüber dem Magistrat stellten. Sie resultierten aus einem spezifischen Standesverhalten, dessen rechtliche Grundlage der privilegierte Status der Professoren und Studenten als Universitätsverwandte bildete. Ebenso zeigen sich besonders deutlich das Standesbewusstsein und das Selbstverständnis der akademischen Bürgerschaft innerhalb des Stadtverbundes. Während der schwedischen Belagerung im Frühjahr 1638 hatten sich wiederum fünfzig Studenten an der Stadtverteidigung beteiligt.62 Danach kam es erst wieder im Jahr 1648 aufgrund der französischen Belagerung zu einer Beteiligung von Studenten an den Wachdiensten.63 In der Geschichtsschreibung wird immer wieder der allgemeine Verfall studentischer Sitten und der Disziplin während des Dreißigjährigen Krieges erwähnt. Dies kann durchaus eine Folge der Wechselwirkungen zwischen Studenten- und Soldatenleben sowie des allgemein rauer werdenden sozialen Klimas in Kriegszeiten sein. Möglich ist, dass die ständige Anwesenheit von Kriegsvolk bei den Studenten ein roheres Benehmen, wie etwa Fluchen, Spielen und Schlaghändel, aufkommen ließ.64 Der ‚abgebrannte’ oder relegierte Student wurde manchmal Landsknecht oder Reiter und kehrte dann später wieder an die Universität zurück. Auf diese Weise konnten durchaus die Unsitten der militärischen Lagergesellschaft an die Universitäten gelangen.65 Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass den Studenten sowohl vor als auch nach dem Krieg hoher Alkoholkonsum, Duellunwesen, Spielsucht und an- 61 Ebd., S. 134. Hermann Mayer, Zur Geschichte der Frequenz der Universität Freiburg im 16. und 17. Jahrhundert, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften 27 (1911), S. 119–134, hier S. 126. 63 Hermann Mayer, Freiburg i. Br. und seine Universität im Dreißigjährigen Krieg (2. Teil), in: Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften 27 (1911), S. 35–90, hier S. 85. 64 Martin Leube, Die Geschichte des Tübinger Stifts im 16. und 17. Jahrhundert, Stuttgart 1921, S. 44. 65 Johannes Scherr, Deutsche Kultur- und Sittengeschichte, Leipzig 1897, S. 364. 62 114 Universität und Krieg dere moralische Verfehlungen vorgeworfen wurden,66 diese Vorwürfe mithin keineswegs als ein Spezifikum von Kriegszeiten angesehen werden können. Neu waren die Händel der Studenten mit fremden Söldnern. Ob sich jedoch die Konflikte der Studenten mit den Soldaten von den auch vor dem Krieg üblichen studentischen Händeln mit den Bürgersöhnen und Handwerkergesellen strukturell so gravierend unterschieden, erscheint fraglich, zumal neueste kulturhistorische Studien nahe legen, dass es sich hierbei im Kern um ritualisierte Ehrkonflikte handelte, welche die sich erst allmählich zu einer eigenen sozialen Gruppe konstituierenden Studentenschaften mit konkurrierenden Sozialgruppen austrugen.67 Wirtschaftliche Auswirkungen Ebenso vielfältig waren die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges. Die Folgen des kaiserlichen Restitutionsedikts von 1629 führte im Falle der Universität Tübingen zum Ausbleiben erheblicher Mittel aus Klostergütern, die bislang zur Finanzierung und Unterstützung des Klosterschul- und Stipendienwesens, aber auch zur Besoldung der Professoren bereitstanden.68 In Württemberg hatten die zeitweise Schließung der Klosterschulen und die schlechte Lage des Tübinger Stifts gravierende Auswirkungen auf das Bildungswesen. Einquartierungen, Kontributionen und sonstige Kriegszahlungen lasteten schwer auf den Universitäten und ihren Angehörigen, da auf deren akademische Privilegien zu Kriegszeiten kaum Rücksicht genommen wurde. Durch die Unsicherheit der Wege war die Verwaltung entfernt liegender Güter schwierig geworden, und die ohnehin durch die Kriegseinflüsse verringerten Einkünfte konnten nicht mehr eingeholt werden. Infolge der Geldknappheit und des Mangels an Naturalien wurden auch bei der Universität liegende Privatstipendien angegriffen und zuweilen auch Sachvermögen, wie etwa Tafelsilber, kostbare Bücher oder sonstiges wertvolles Inven66 Max Bauer, Sittengeschichte des deutschen Studententums, Dresden 1926, S. 53. Marian Füssel, Devianz als Norm? Studentische Gewalt und akademische Freiheit in Köln im 17. und 18. Jahrhundert, in: Westfälische Forschungen 54 (2004), S. 45–166. 68 Zeller-Lorenz, Christoph Besold (wie Anm. 31), S. 123. 67 115 Susanne Häcker tar, veräußert.69 Zusätzlich nahmen die Universitäten Darlehen auf und waren nach dem Krieg entsprechend hoch verschuldet. In einigen Fällen erwirkten die Hochschulen für sich gesonderte Schutzbriefe, die sie vor Kontributionen und Einquartierungen bewahren sollten.70 Nach der Schlacht von Nördlingen im September 1634 erwirkten Stadt und Universität einen gemeinsamen Schutzbrief des Herzogs von Lothringen, wodurch sie vor den schlimmsten Verwüstungen bewahrt werden konnten.71 Trotz der dennoch folgenden hohen Kontributionen, Quartierlasten und Plünderungen kam Tübingen im Vergleich zu manch anderer württembergischen Stadt noch einigermaßen glimpflich davon.72 Neben Tübingen blieben im Herzogtum Württemberg lediglich Stuttgart und Marbach ungeplündert.73 Die kampflose Übergabe von Stadt und Festung war somit der Preis für eine relativ gute Behandlung durch die Besatzer.74 Während der Besatzungszeit 1647/48 bat die Universität Tübingen im Einvernehmen mit der Stadt den französischen General Turenne um einen Schutzbrief. In diesem verbot jener eigenmächtige Einquartierungen und Plünderungen bei den Universitätsverwandten.75 Da die städtische Bürgerschaft hingegen häufig der Meinung war, dass bei der akademischen Bürgerschaft noch mehr Vermögen vorhanden sei als diese vorgaben und sie zudem nicht die ganzen Kriegslasten alleine tragen wollten und konnten, war es für die Universitätsverwandten nicht immer einfach, diese Schutzbriefe auch tatsächlich durchzusetzen. Dies war etwa der Fall, als die Universität Freiburg vom Herzog von Lothringen im Februar 1635 einen Schutzbrief zusammen mit einem dekret und ihr f. durchl. Sigill und namen ahn die statt Freyburg, die universitetische von einquartierungen zu 69 Wilfried Setzler u.a., Kleine Tübinger Stadtgeschichte, Tübingen 2006, S. 79. Mayer, Freiburg Teil 1 (wie Anm. 58), S. 179. 71 Rudolf von Roth, Die fürstliche Librerei auf Hohentübingen und ihre Entführung im Jahr 1635, Tübingen 1888, S. 9. 72 Setzler u.a., Kleine Tübinger Stadtgeschichte (wie Anm. 70), S. 78. 73 Gebhard Mehring, Wirtschaftliche Schäden durch den Dreißigjährigen Krieg im Herzogtum Württemberg, in: Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte 30 (1921), S. 58–89, hier S. 79. 74 Roth, Die fürstliche Librerei (wie Anm. 72), S. 10. 75 Schreiner, Die Katastrophe von Nördlingen (wie Anm. 22), S. 52. 70 116 Universität und Krieg befreyen und die berait belegten personen zue delogieren erhielt.76 Nach längeren Auseinandersetzungen musste die Stadt den Schutzbrief anerkennen und versprach am 2. Juni 1635, die Universität nur im äußersten Notfall mit Einquartierungen zu belegen. So ein Notfall wurde bereits am 4. Juni angekündigt.77 Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Universitäten zum Kriegsende wirtschaftlich ruiniert waren. Diese finanzielle Not der Universitäten während und direkt nach dem Krieg hatte allerdings auch Rückwirkungen auf die Gesamtfinanzlage der Stadt, da stark frequentierte Universitäten einen erheblichen Wirtschaftsfaktor darstellten. Münzverschlechterungen, Kapitalverluste durch Konkurse, uneinbringliche Zinsrückstände und Zinskürzungen lagen als schwere Last auf den Privatstiftungen.78 Die katholische Besatzungszeit hatte in Heidelberg die Auswirkung, dass die von Thomas Erast gestifteten Stipendien eingezogen wurden, da ihre Vergabe an die konfessionelle Zugehörigkeit zum reformierten Glauben gebunden war.79 Für das Tübinger Stift gingen durch das Restitutionsedikt wichtige Einnahmequellen verloren. Aufgrund der Kriegswirren und der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage in Württemberg nach der Schlacht bei Nördlingen mussten die ursprünglich 150 Stipendienplätze zeitweise auf 30 verringert werden (vgl. Abb. 4). Für die Freiburger Rupertina bedeutete der Verlust des Elsass an Frankreich, dass 26 Stipendien völlig erloschen, da deren Fonds bei der elsässischen Landeskammer angelegt waren und vom französischen König in seiner Funktion als Landvogt des Elsaß nach dem Krieg nicht mehr ausgezahlt wurden.80 Zu den Selbstverständlichkeiten des Kriegsalltages gehörte es, Beute zu machen. Dabei war der Raub von Kunstschätzen durch das Kriegsrecht durchaus legitimiert.81 In diesem Zusammenhang dokumentieren Bücher als Beutegut die Ohnmacht und die kulturel76 Zitiert nach Mayer, Freiburg Teil 1 (wie Anm. 58), S. 179. Mayer, Freiburg Teil 1 (wie Anm. 58), S. 181. 78 Schäfer, Universität Tübingen zur Zeit Schickards (wie Anm. 24), S. 48. 79 Press, Kurfürst Maximilian I. von Bayern (wie Anm. 3), S. 325. 80 Adolf Weisbrod, Die Freiburger Sapienz und ihr Stifter Johannes Kerer von Wertheim, Freiburg/Br. 1966, S. 123. 81 Schreiner, Beutegut (wie Anm. 39), S. 128. 77 117 Susanne Häcker len Verluste der Unterlegenen, aber auch das Machtstreben und den Geltungsdrang der Sieger. Vor dem Hintergrund eines humanistischen Bildungsideals galt es als Zeichen der Überlegenheit und als Gebot der Staatsräson, unterworfenen Gegnern ihre geistigen Waffen und damit auch ihre kulturelle Identität abzuringen.82 Bibliotheken galten als Zentren des Wissens, als Symbole herrschaftlichen Daseins und als Repräsentationsorte kirchlicher Rechtgläubigkeit. Frühneuzeitliche Fürsten und Herren waren darauf bedacht, dem Bildungsideal des Reformzeitalters gerecht zu werden und Ruhm und Rang ihrer Dynastie durch wertvolle Bibliotheksschätze zu vermehren.83 Insbesondere in symbolischer Hinsicht wogen der Verlust der Bibliotheca Palatina, die 1623 von Kurfürst Maximilian I. von Bayern an Papst Urban VIII. übergeben wurde, aber auch der Abtransport der Tübinger Schlossbibliothek im Jahr 1635 nach München schwer. Die Heidelberger Palatina und auch die Tübinger Schlossbibliothek stellten aufgrund ihres ausgesuchten Sortiments und der Bedeutung ihrer Bücher und Schriften erstrebenswerte Beuteobjekte dar. Der Freiburger Universitätsbibliothek, die dem damaligen Standard an den Universitäten entsprochen haben dürfte, wurde hingegen wenig Beachtung geschenkt. Zwar wurde in aller Regel an Schutzvorkehrungen für die Bibliotheken gedacht, ein Abtransport der Bücher konnte allerdings oft aufgrund der Büchermenge und des Zeitmangels nicht mehr veranlasst werden. Fazit Abschließend lässt sich für alle drei untersuchten Universitäten festhalten, dass der Dreißigjährige Krieg einen Niedergang aus wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Blüte bedeutete, von dem sie sich nur schwer erholen konnten. Lange Jahre führten die Universitäten nur eine Art Scheinleben, wie es in der ausgeprägtesten Form wohl an der Universität Heidelberg zu Tage trat. Der Professorenbestand war an allen drei behandelten Universitäten zeitweise stark dezimiert; phasenweise waren kaum Lehrkräfte zugegen. 82 Ebd., S. 126. Klaus Schreiner, Württembergische Bibliotheksverluste im Dreißigjährigen Krieg, Frankfurt/M. 1974, S. 658. 83 118 Universität und Krieg Gegen die kriegsbedingt fast schon regelmäßig auftauchenden Seuchenepidemien waren die damaligen Medizinprofessoren weitgehend machtlos. So kam es, dass viele Medizinprofessoren, statt die Pest aktiv zu bekämpfen, lieber wie andere Angehörige der Zivilbevölkerung vor der raubenden und plündernden Soldateska sowie den ihnen folgenden Seuchen aus den Städten flohen. Von den durch die Zeitgenossen grundsätzlich als Bedrückung wahrgenommenen Einquartierungen fremder Kriegsvölker waren nicht nur die städtischen Bürger, sondern auch die Professorenhaushalte betroffen. Kontributionen, Einquartierungen und sonstige Kriegsfolgekosten führten gleichermaßen an den Universitäten als Institutionen wie auch bei den Universitätsangehörigen zu finanziellen Bedrückungen. Die Frequenzentwicklung einer Universität sowie die regionale und soziale Zusammensetzung der Studenten unterlagen während der Kriegszeiten starken Veränderungen. Zeitweise kam es zu einer Verlagerung der Studentenströme an kriegsverschonte Ausweichuniversitäten. Als unmittelbare Kriegsfolgeerscheinung verfiel jedoch nicht nur vielerorts die Bausubstanz der Universitätsgebäude, sondern auch die Häuser in akademischem Besitz wurden von den fremden Besatzungstruppen verschiedentlich – manchmal sogar dauerhaft – der Hochschule entfremdet, was sich zu einer zusätzlichen Behinderung für die akademische Lehre entwickeln konnte. Die Folgen der – modern gesprochen – ‚psychologischen Kriegsführung’ konnten dazu führen, daß die Besatzungstruppen sich häufig nicht nur damit begnügten, den materiellen Besitz der Stadtbevölkerung zu plündern, sondern gelegentlich auch dazu übergingen, sich gewissermaßen den geistigen und kulturellen Besitz einer Universität anzueignen, wie das Beispiel des Raubs der berühmten Palatina in Heidelberg zeigt. Der Raub der Heidelberger Universitätsbibliothek durch Kurfürst Maximilian I. von Bayern und deren Verbringung nach Rom kann nicht nur als symbolische Bestrafung des von ihm vertriebenen reformierten Kurfürsten, sondern – nach Kategorien Pierre Bourdieus – auch als Verlust objektivierten kulturellen Kapitals der Universität Heidelberg, mithin als geistige Degradierung der ‚ketzerischen’ kurpfälzischen Hochschule, gedeutet werden. 119 Susanne Häcker Abbildung 1: Diagramm der Gesamtimmatrikulationszahlen und des Adelsanteils innerhalb dieser Neuinskriptionen an der Universität Heidelberg von 1618 bis 1653. Erstellt nach Gustav Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg, Bd. 2, Heidelberg 1886, S. 287–318. 120 Universität und Krieg Abbildung 2: Diagramm der Gesamtimmatrikulationszahlen sowie des darin enthaltenen Anteils Adeliger und Freiburger an der Universität Freiburg (Eintragungen mit Herkunftsort Freiburg, die nicht näher erläutert sind, werden der Stadt Freiburg im Breisgau zugeordnet.) von 1618 bis 1653. Erstellt nach Mayer, Matrikel Freiburg (wie Anm. 12), S. 794–932. 121 Susanne Häcker Abbildung 3: Diagramm der Gesamtimmatrikulationszahlen sowie des darin enthaltenen Anteils adeliger Studenten und Klosterschulabsolventen an der Universität Tübingen von 1618 bis 1653. Erstellt nach Albert Bürk/Wilhelm Wille (Hrsg.), Die Matrikeln der Universität Tübingen, Tübingen 1953, S. 109–260. 122 Universität und Krieg Abbildung 4: Diagramm über die Anzahl der am Tübinger Stift anwesenden Studenten zwischen 1618 und 1660. Erstellt nach: Leube: Die Geschichte des Tübinger Stifts (wie Anm. 65). 123