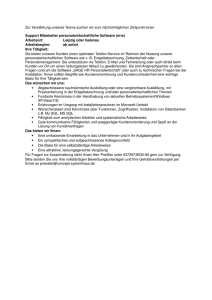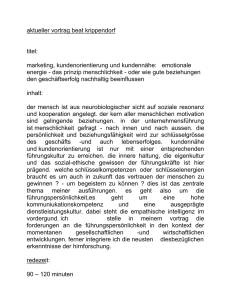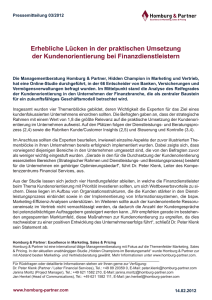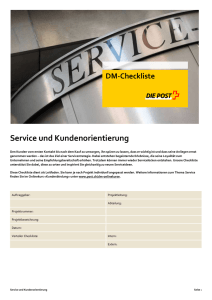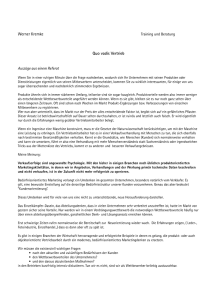- Uni Bielefeld
Werbung

Reinhold Hedtke Kundenorientierung Eine betriebswirtschaftliche Lösung sucht ihr (politik-)didaktisches Problem Dieser Text ist ursprünglich erschienen in: In: Politisches Lernen 20 (1998) 3-4, S. 1-23. © 2003 Reinhold Hedtke, Bielefeld Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch im Internet. In der Nachhut des Siegeszuges ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Denkens und der ökonomistischen Restrukturierung vieler gesellschaftlicher Bereiche und Organisationen hat die betriebswirtschaftliche und unternehmerische, gelegentlich auch wirtschaftspolitische Diskussion über Qualitätsmanagement und Kundenorientierung auch Dienstleistungsorganisationen erreicht. Etwa seit Anfang der 1990er Jahre wird die Diskussion um Qualitätsmanagement, Total Quality Management (TQM) und Kundenorientierung auch auf Hochschulen und Schulen bezogen, dringt damit in den Bildungsbereich ein und wird dort gezielt hineingetragen, rezipiert und kontrovers diskutiert (z. B. Bertelsmann Stiftung 1996; Bezirksregierung Köln 1996; Bühner 1997; Fuchs 1994; Göndör 1996; Gruschka 1997; Hepting/Rückert 1997; Lütje 1997; Osswald 1995; Reuther/Weiss/Winkels 1996; Weiss 1996). Im Mittelpunkt der Diskussion über das Management der Bildungsqualität standen und stehen noch vor allem berufliche Bildung und Weiterbildung. Das verwundert kaum, da dieser Bereich ideologisch, inhaltlich, personell und bildungspolitisch eng mit dem Unternehmenssektor verbunden ist. Dort und in der Betriebswirtschaftslehre werden seit etwa Mitte der 1980er Jahre umfassende Qualitätskonzeptionen im Rahmen eines Qualitätsmanagements diskutiert und praktiziert, das auch auf eine entsprechende Qualifizierung des Personals angewiesen ist. Die Grundidee des Total Quality Managements (TQM) ist schlicht und einfach: Der Kunde definiert die Qualitätsanforderungen an das Unternehmen, seine Produkte und den Produktionsprozess. Das Unternehmen soll alle für den Kunden wesentlichen Anforderungen hinsichtlich der Leistungsqualität des Angebotes und der Kontaktqualität der Kommunikation erfüllen; das lässt sich nur realisieren, so die Betriebswirtschaftslehre, wenn Qualitätssicherung zur Führungsphilosophie für das ganze Unternehmen wird (1) (Hopfenbeck 1998, 570 f.). Zu Themen des Qualitätsmanagements wurde in den letzten Jahren eine unüberschaubare Flut von Literatur veröffentlicht. Anfang 1999 wirft das Verzeichnis lieferbarer Bücher über 600 Titel dazu aus; hinzu kommen über 100 Buchtitel, die sich im engeren Sinne mit Kundenorientierung beschäftigen. Da Managementkonzeptionen sich äußerst zyklisch entwickeln, kann mit einer baldigen Ablösung des TQM durch neue konzeptionelle Trendsetter gerechnet werden (2). 2 Qualitätsmanagement und Kundenorientierung sind also mächtige ökonomischbetriebswirtschaftliche Diskurse. Im Zuge der vielfältigen schulpolitischen Programme und Projekte, Schulen und ihre „Produkte“ durch die Einführung von Managementdenken und unternehmensähnlichen Managementstrukturen qualitativ zu verbessern, liegt natürlich nichts näher, als auch die passenden Managementphilosophien aus Ökonomie und Ökonomik zu übernehmen. Qualitätssicherung und Kundenorientierung sind ein Ergebnis solcher Übernahmen. Qualitätssicherung scheint sich zu einem einflussreichen schul- und bildungspolitischen Thema zu etablieren; das deuten hunderte von Veröffentlichungen dazu in den 1990er Jahren an. Bisher blieben ökonomisch-betriebswirtschaftlich inspirierte Diskussionen über Qualitätssicherung und Kundenorientierung vor allem auf die Ebene der Schulorganisation und des Schulmanagements konzentriert. Nun haben sie auch die Ebenen von Didaktik und Fachdidaktik erreicht: diskutiert wird beispielsweise über Schülerinnen und Schüler als Kunden der Lehrer (Lorbeer 1998) (3) und über „Kundenorientierung in der politischen Bildung“ (Hufer 1998; Sander 1998). Wenn Bildungs- und Schulpolitik, Didaktik und Fachdidaktik gedanklich konzeptionelle Anleihen in Ökonomie und Ökonomik machen, ist das an sich weder gut noch verwerflich. Kritisch zu prüfen ist allein die Frage, ob solche Übernahmen im Einzelfall, d. h. bezogen auf ein abgrenzbares Problem, eine angemessene und weiterführende Lösung bieten. Dazu ist allerdings zunächst zu diskutieren, ob das zur Übernahme vorgeschlagene Konzept grundsätzlich in den Zielbereich übertragbar ist. Im folgenden Beitrag geht deshalb darum, ob Kundenorientierung als regulative Idee und Handlungsmaxime geeignet ist, auf den Bereich der politischen Bildung angewendet zu werden. Zu fragen ist dabei auch, ob und inwiefern eine Umstellung von Schülerorientierung oder Teilnehmerorientierung auf Ku ndenorientierung die Prozesse und Ergebnisse von (politischer) Bildung verbessern könnte. Was aber ist das Problem der politischen Bildung, auf das Kundenorientierung die richtige Antwort sein könnte? Eine grundlegende Neuorientierung auf Kunden (statt Teilnehmer oder Schüler) könnte als Lösung mehrerer Probleme sinnvoll erscheinen. Erstens könnte die durchschnittliche Qualität der Bildungsangebote in den Augen der Teilnehmer unve rtretbar schlecht (geworden) sein (Problem subjektiven Qualitätsmangels). Zweitens könnte es ein strukturelles Missverhältnis zwischen den durchschnittlichen Bildungsergebnissen und den Qualifikationsanforderungen der Abnehmerinstitutionen oder der Gesellschaft insgesamt geben (Problem objektivierten Qualitätsmangels). Drittens könnte die Wirtschaftlichkeit der Bildungsproduktion aus Sicht der Geldgeber (Träger, Teilnehmer) oder allgemein der Steuerzahler nicht (mehr) zufriedenstellend und eine allgemeine ökonomische Rationalisierung notwendig machen (Problem mangelnder Effizienz). Damit eventuell zusammenhängend könnten viertens Angebote politischer Bildung zu (stärkerer) Marktorientierung gezwungen sein oder werden, weil Formen hierarchisch (4) organisierter Produktion und öffentliche bzw. meritorische Güter im Vergleich zu privaten, erwerbswirtschaftlich produzierten und marktförmig koordinierten Angeboten ganz grundsätzlich in Misskredit geraten sind (Problem defizitärer politischer Legitimation). Grundsätzlich müsste erst einmal geklärt werden, ob man dem Konzept „Kundenorientierung“ überhaupt spezifisch politikdidaktische Aspekte zuschreiben kann, oder ob es sich genau betrachtet um ein allgemeindidaktisches oder gar schulpolitisches Konzept (eng verbunden mit der Qualitätsdiskussion) handelt. Damit stehen wir gleich zu Anfang vor einem gravierenden Problem, das wir fortan aber weitgehend ignorieren werden. Auf den ersten Blick allerdings kann man kaum erkennen, wo ein fachspezifisch-inhaltlicher Unterschied bei Kundenorientierung in Fächern wie Politik, Deutsch, Religion, Sport, Physik oder Englisch bestehen sollte. Zu analysieren wäre, ob und inwieweit die „Kunden“ fachspezifisch 3 ausgeprägte Bedürfnisse haben, die zu fachlich differenzierten „Nachfragen“ führen würden, die mit entsprechend unterschiedlichen Angeboten zu befriedigen wären. Die folgenden Überlegungen werden zeigen, dass, unabhängig davon, auf welches Problem die Lösung Kundenorientierung vorrangig bezogen werden soll, eine Übertragung von Kundenorientierung auf politische Bildung nur unter sehr restriktiven Bedingungen und nur für recht begrenzte Bereiche möglich und sinnvoll erscheint – und das sind besonders die Bereiche, die bereits heute unter Marktbedingungen und kundenorientiert arbeiten. Diese Einsicht lässt sich (vorsichtig und vorläufig) zumindest auf öffentliche schulische Bildung insgesamt verallgemeinern. Zu einem positiveren Befund käme man, würde man die öffentliche schulische Bildung in wesentlichen Zügen marktförmig organisieren. Nach einer solchen fundamentalen, ökonomistischen Strukturreform des Bildungssystems würde sich eine Kundenorientierung der Bildungsunternehmen voraussichtlich aber von selbst einstellen. Die weitere Argumentation gliedert sich in drei Hauptschritte. Erstens wird geklärt, was sozialwissenschaftlich den Kunden (1.1) und das Kundenverhältnis (1.2) typischerweise charakterisiert und was man gemeinhin unter Kundenorientierung versteht (1.3). Zweitens werden die Grundlagen von Kundenorientierung in der (politischen) Bildung diskutiert, indem zunächst geprüft wird, wer Anbieter/Verkäufer politischer Bildung, wer deren Kunden sind (2.1) und wodurch sie sich unterscheiden (2.2). Danach können einige mögliche Folgen von Kundenorientierung in der politischen Bildung skizz iert werden (2.3), was zu einer Reihe offener Fragen führen wird. Drittens wird ein Fazit gezogen, das davon abrät, Parolen zu verkünden, für deren Umsetzung die strukturellen Voraussetzungen fehlen. In einem Anhang wird schließlich versucht, die Organisat ionsverhältnisse politischer Bildung etwas zu systematisieren. 1. Kunde und Verkäufer 1.1 Der Kunde Der Begriff Kunde scheint so selbstverständlich und so klar zu sein, dass sich Betriebswirtschaftslehre und Marketing eine Definition weitestgehend sparen (5). So verzichten beispielsweise das Gabler Wirtschafts-Lexikon (1988) ebenso wie Hopfenbecks gut tausendseitige Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre (1998) ganz auf eine Begriffsklärung. Nur Komposita wie Kundenorientierung, Kundenbindung, Kundenmanagement oder Kundenlaufstudien erfreuen sich betriebs- oder marketingwissenschaftlicher Definitionsversuche (vgl. z. B. Diller 1995; Meyer/Oevermann 1995). Im Konversationslexikon findet man immerhin, dass ein Kunde ein Käufer oder potenzieller Käufer von Waren oder Dienstleistungen ist, die er entweder gewerblich weiter verwendet oder selbst verbraucht. Als Selbstverbraucher wird er Konsument genannt. Etymologisch betrachtet ist der Kunde jemand, der kundig oder eingeweiht ist, der sich also in einem Bereich auskennt. Er betritt die wirtschaftliche Bühne ungefähr seit der Barockzeit als ein Käufer, der regelmäßig bei einem Kaufmann einkauft oder bei einem Handwerker arbeiten lässt. Unterscheiden muss man zwischen einem engen, eher traditionellen, einem weiten, eher aktuellen, und einem totalen Kundenbegriff. Der enge Begriff entspricht etwa den eben genannten Inhalten. Der weite Begriff fasst unter „Kunden“ auch andere externe Anspruchsgruppen einer Organisation, z. B. die lokale Öffentlichkeit. In totalen Begriffsvar ianten wird auch von „internen“ Kunden gesprochen; danach ist z. B. in einem Betrieb die 4 Produktion der „Kunde“ der Arbeitsvorbereitung und der Materialwirtschaft. In der schulpolitischen und didaktischen Diskussion, in der die Betrachtung von Bildung als Produktionsprozess um sich greift (z. B. Timmermann 1996), wird meist mit weiten Kundenbegriffen argumentiert. Versuchen wir mit Mitteln des sozialwissenschaftlich aufgeklärten Denkens den Kundenbegriff weiter zu erhellen. Dabei soll vor allem das Typische aus realen Kundenverhältnissen herausgearbeitet und nicht eine ideale Kundenbeziehung normativ entwickelt werden. Was lässt sich über Kunden in sachlicher, sozialer und zeitlicher Perspektive sagen? In sachlicher Hinsicht sind Kunden tatsächliche oder potenzielle Käufer von Produkten oder Dienstleistungen, die ein einzelnes Unternehmen anbietet. Sie haben bestimmte Ansprüche an Angebote von Unternehmen; das Unternehmen verspricht, diese Ansprüche ganz oder teilweise zu erfüllen. Es kann sich über die Ansprüche persönlich beim individuellen Ku nden informieren oder Ansprüche von anonymen Kundengruppen auf dem Wege der Marktforschung feststellen. Sozial gesehen treten Kunden in ein vorübergehendes, vor allem ökonomisch und rechtlich definiertes Verhältnis zum Anbieterunternehmen, das meist mittelbar durch Repräsentanten vertreten wird. Aus Sicht des Unternehmens verfügen Kunden über Zahlungsmittel, die es erwerben möchte, indem es die Kunden dazu motiviert, sie gegen ein unternehmenseigenes Angebot einzutauschen und sich damit gegen alle alternativen Verwendungsmö glichkeiten der Zahlungsmittel zu entscheiden. Aus der Sicht des Kunden verfügt das Unternehmen über Güter oder Dienstleistungen, die er gegen seine Zahlungsmittel getauscht hat, tauscht, tauschen will oder zumindest zu tauschen erwägt. Durch Zufriedenheit, Gewohnheit, Ignoranz oder andere Gründe auf der Kundenseite, durch Marktmacht und/oder Bearbeitung des Kunden mit Marketingstrategien von der Unternehmensseite kann aus dem vorübergehenden Kontakt ein mehr oder weniger dauerhaftes Bindungsverhältnis entstehen. Individuen sind als Kunden von anderen Kunden tendenziell sozial isoliert. Die Kundenbeziehung ist formal eine individuelle, ja atomistische Geschäftsbeziehung beliebigen Inhalts zwischen einzelnem Kunden und einzelnem Unternehmen. Sie gründet auf beliebigen i ndividuellen Präferenzen hinsichtlich der Ausgabe von Geld für irgendwelche Güter. Wie diese Präferenzen entstanden sind, spielt keine Rolle. Ob und wie sich die individuellen Präferenzen des Kunden mit Normen und Werten vertragen, ist nur hinsichtlich der Legalität der Präferenzen, also nur formal relevant. Seinen theoretischen Ausdruck und seine Legitimation findet dieser Atomismus, der grundsätzlich hinter der Kundenbeziehung steckt, im methodologischen Individualismus der Ökonomik, besonders in ihrem neoklassischen Mainstream. Individuen sind als Konsumenten mit anderen Konsumenten-Kunden nur auf einer allgemeinen kulturellen Ebene verbunden. Im Bereich des alltäglichen Massenkonsums kaufen sie vielfach aus gleichen Gründen und Motiven die gleichen Waren, die sie in gleichen oder ähnlichen Formen konsumieren. Sie teilen mit anderen Konsumenten gleiche oder ähnliche konsumkulturelle Orientierungen und unterscheiden sich kollektiv von anderen Konsumentenkulturen. Konsumenten-Kunden sind aus strukturellen Gründen eher mäßig bis schlecht über Angebot und Anbieter informiert, können außerhalb des privaten Haushalts und seiner Beziehungen kaum miteinander kommunizieren, sind eher sc hlecht organisiert und deshalb kollektiv eher wenig durchsetzungsfähig. Die mangelnde Organisationsfähigkeit von Konsumenten-Kundeninteressen begründet bekanntlich staatliche Regulation und Protektion von Verbraucherinteressen sowie die Subventionierung von Verbraucherorganisationen. Zu- 5 mindest im politischen Raum bleiben Verbraucherinteressen dennoch strukturell unterrepräsentiert. Zwischen privaten Kunden (Letztverbrauchern) und gewerblichen Kunden, die an der ökonomischen Weiterverwertung der Angebote interessiert sind, gibt es einen grundsätzlichen Unterschied. Weiterverwerter-Kunden agieren im Prinzip professionell und sind eher in der Lage, ihre Interessen gegenüber dem Anbieterunternehmen zu organisieren und durchzusetzen. Selbstverständlich hängt das im einzelnen von den jeweiligen Markt- und Machtverhältnissen ab. Im übrigen haben Weiterverwerter-Kunden und Anbieter strukturell gemeinsame Interessen gegenüber Konsumenten-Kunden, z. B. hinsichtlich der Produkthaftung oder der Informationsrechte der Verbraucher. Diese potenzielle politische Koalition stärkt die Anbieterseite weiter gegenüber den Konsumenten. Zeitlich betrachtet sind Kunden schließlich ehemalige, gegenwärtige oder zukünftige Käufer. (Und sie sind, wie eingangs erwähnt, ein historisches Phänomen). In einem erweiterten Sinne sind Kunden nicht nur Käufer, sondern auch „Konsumenten“ der Unternehmensangebote, da sie diese nicht nur kaufen, sondern in der Regel auch in irgendeiner Form nutzen, für die Weiterverarbeitung, den Weiterverkauf oder für ihre eigenen Bedürfnisse. Diese Nutzungsperspektive verlängert den Zeitraum der Kundenbeziehung auf die Nutzungsdauer des Produkts oder der Dienstleistung. 1.2 Das Kundenverhältnis Wir haben bisher noch nicht geklärt, was den Kunden und das Kundenverhältnis sozial konstituiert. Ich sehe zwei konstitutive Merkmale des Kunden in kapitalistischen Marktwirtschaften. Das erste, allgemeinste und zugleich folgenreichste Konstitutionsmerkmal des Kunden ist die Kaufkraft, das ihm für den Kauf frei zur Verfügung stehende Geld. Kaufkraft ist bekanntlich ein Ergebnis der Einkommens- und Vermögensverhältnisse und ziemlich bis äußerst ungleich verteilt. Sie bildet für Kunden das zentrale Mittel zur Durc hsetzung ihrer Interessen über den Markt. Für Unternehmen ist die Kaufkraft das Entscheidungskriterium dafür, ob es sich lohnt, sich um die Interessen eines Kunden zu kümmern oder nicht. Aus Sicht des Unternehmens interessiert verständlicherweise nur der Kunde, der über die nötige Kaufkraft für das eigene Angebot verfügt. Aus Sicht des Kunden kommt nur das Angebot in Frage, das er finanzieren kann. Die Kaufkraft ist auf der individuellen Ebene der Kunden das entscheidende Mittel der Macht. Kundenmacht ist deshalb grundsätzlich ungleich verteilt wie die Kaufkraft. Ihr stehen auf der Seite des Unternehmens die Markt- und Marketingmacht gegenüber, die ebenfalls wesentlich von den verfügbaren Geldmitteln abhängen. Auch Markt- und Marketingmacht sind ungleich verteilt. Das zweite konstitutive Charakteristikum des Kunden ist die Möglichkeit und die Freiheit der Wahl. Die Möglichkeit der Wahl setzt mindestens zwei Anbieter und mindestens zwei Güter voraus, also Wettbewerb und ein Sortiment. Die Freiheit der Wahl bedeutet, ohne Zwang und streng genommen auch ohne Druck zwischen Anbietern und zwischen Gütern wählen zu können. Wer nichts zu wählen hat, ist kein Kunde, sondern ein Abnehmer oder ein Verbraucher. Wer nichts wählen will, verweigert seine Kundenrolle. Sinnvollerweise sollte also nur der als Kunde bezeichnet werden, der Alternativen hat und sieht, über die er entscheiden und die er finanzieren kann. Vor allem die Wahlmöglichkeit der Kaufkrafthi ngabe ist die Grundlage der Macht des Kunden, sofern sie dem Anbieter Ressourcen vorenthält oder entzieht, die der haben will oder benötigt. Des Kunden Freiheit der Wahl zwingt den Anbieter zur Kundenorientierung, vorausgesetzt, das Unternehmen hat einen entsprechenden Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Auch die Möglichkeit, nicht zu wählen, also seine Kaufkraft nicht gegen Angebote einzutauschen, sondern zu behalten, ist eine 6 Wahlmöglichkeit des Kunden. Wo sie gegeben ist, haben auch Angebotsmonopole nur beschränkte Macht. Im Massenmarkt der täglich-alltäglichen Produkte ist der einzelne Kunde trotz Kaufkraft und Wahl allerdings faktisc h völlig einflusslos (6). Bei zehntausend, hunderttausend oder Millionen Käufern eines Produktes kann individueller Einfluss nur in kollektiver Form über die additive Wirkung hinreichend vieler Wahlentscheidungen anderer Käufer erreicht werden. Im Massengeschäft zählt weder die einzelne Kaufentscheidung, noch der einzelne Kunde. Kundenorientierung kann hier nur Orientierung am statistisch durchschnittlichen Käufer, genauer am Mediankäufer, bedeuten. Insofern hängt die Wirkung individueller Entscheidungen von einem blinden Kollektivmechanismus ab, vom Massenmarkt. Diese atomistische Abhängigkeit kann der Kunde nur kollektiv sprengen, wenn er politisch handelt, also seine Kundenrolle verlässt und mit anderen zusammen z. B. protestiert oder boykottiert. Verglichen mit den Konstitutiva Kaufkraft und Wahlmöglichkeit spielen konsumkulturelle Merkmale und soziale Merkmale wie Alter, Geschlecht und Ethnie der KonsumentenKunden, die oft im Mittelpunkt des öffentlichen und wissenschaftlichen Interesses stehen, eine nachgeordnete, nur ausformende und differenzierende Rolle im Kundenverhältnis. Deshalb bilden Kaufkraft und Wahl die soziale Basis des Kundenverhältnisses. Soziales Charakteristikum des Kundenverhältnisses ist die Tauschbeziehung. Die Tauschbeziehung zwische n Kunden und Unternehmen ist grundsätzlich unpersönlich, instrumentell, geldvermittelt und asymmetrisch. Anbieter und Kunde sind wechselseitig an den sachlichen oder monetären Ressourcen interessiert, die der andere besitzt. Der Anbieter oder Anbieter-Agent, weil er sich einen ökonomischen Vorteil vom Kauf verspricht (Tauschwert), der Konsumenten-Kunde, weil er sich vom jeweiligen Angebot irgendeine Verbesserung seiner Lebenssituation erwartet (Gebrauchswert). Der Weiterverwerter-Kunde ist wie der Anbieter am Tauschwert interessiert. Grundsätzlich wollen beide Seiten den Tausch im eigenen Interesse dominieren und den Tauschgewinn für sich optimieren, indem sie möglichst wenig Gegenleistung für Gut oder Geld hergeben. Wieviel man hergeben muss, ist eine Frage der Marktmachtverhältnisse. Z. B. erhalten Anbieter auf Käufermärkten, die durch einen strukturellen Angebotsüberhang gekennzeichnet sind, im Prinzip weniger Gegenleistung für ihr Angebot als auf Verkäufermärkten, auf denen ein Nachfrageüberhang herrscht. Anders formuliert: je mächtiger die Kunden sind, desto stärker wenden sich Anbieter der Kundenorientierung zu. 1.3 Kundenorientierung Spätestens seit Adam Smith wissen wir, dass Kundenorientierung eine Funktion des Eigeninteresses des Anbieters ist. Nur unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, d. h. vor allem bei Existenz von Wettbewerb und bei eigennützig-rationalem Verhalten der Käufer und der Anbieter, können Kunden ihre Interessen gegenüber Anbietern potenziell durchsetzen. Voraussetzung dafür ist auch, dass Anbieter auf die Kaufkraft ihrer Kunden angewiesen sind. Wer nicht gezwungen ist, sein Angebot zu verkaufen, ist nicht zur Kundenorientierung motiviert. Kundenorientierung ist lästig und anstrengend, deshalb neigen Unternehmen grundsätzlich inhaltlich z ur Produktions- oder Produktorientierung und formal zur Gewinnorientierung. Ohne Markt, Wettbewerb und Käufermärkte bleibt Kundenorientierung ein Konzept und Verhaltensmuster im autonomen Belieben des Unternehmens. Unter diesen Bedingungen wäre Kundenorientierung einfach nicht rational. Dominantes Interesse des Anbieters ist es, bei seinen Kunden für sein Angebot einen Preis zu erzielen, der möglichst weit über seinen Kosten liegt. Nur unter Bedingungen der voll- 7 kommenen Konkurrenz sind Preis und Kosten identisch. Auf realen Märkten ist der Anbieter daran interessiert, seine Kunden über die Preiswürdigkeit, insbesondere über die Selbstkosten seiner Ware, möglichst weitgehend im Dunkeln zu lassen. Transparenz hinsichtlich Kosten, Qualität, Preisen und Wettbewerbern versucht er zu verhindern, solange die negativen Folgen dieser Strategie nicht zur Abwanderung von Kunden führen. Wie erscheint das hier beschriebene allgemeine Kundenverhältnis in der Marketingwissenschaft? (7) Seit etwa Mitte der 1980er Jahre beginnt Kundenorientierung als ein neues strategisches Konzept von Unternehmen eine steile Karriere im theoretischen und praktischen Marketing. Fast einhellig wird Kundenorientierung zum Haupttrend auf den Absatzmärkten ausgerufen. Sie wird erklärt als Reaktion auf veränderte Marktlagen mit stärkerem Wettbewerb, wachsender Individualisierung und sinkender Kundenloyalität. Auf Käufermärkten wird der Absatz zum entscheidenden Engpassfaktor des Unternehmens. Deshalb gilt Kundenorientierung, die eine Ausrichtung all er Unternehmensaktivitäten an den Problemen der Kunden fordert, im Extremfall sogar an denen des einzelnen Kunden, als eine Art von Investition. Die Grundlage bildet ein Kalkül, ob und in welcher Form in Pflege und Ausbau von Kundenbeziehungen investiert werden soll. Da Kundenorientierung betriebswirtschaftlich recht teuer ist, setzt sie im Sinne ökonomischer Rationalität eine Bewertung und Selektion der Kunden nach den möglichen Erträgen für das Unternehmen voraus. Ziel ist eine ökonomische Rangordnung der Kunden, die es erlaubt, unrentable Kundenbeziehungen auszusondern und sich mit der Kundenorientierung auf die besonders rentablen zu konzentrieren. In allen Bereichen, wo sich Kundenorientierung nicht lohnt, bleibt es weiter bei den einschlägigen Formen des Massenmarketing, wie wir sie aus Werbung, Verkaufsaktionen oder Directmailings kennen. Grundsätzlich gilt, dass das anbietende Unternehmen selbst wählt, wen oder welche Gruppen es als Kunden haben will und welche nicht. Das Recht, Kunden und Aufträge abzulehnen, hat eine fundamentale Bedeutung. Die Marketingwissenschaft beschäftigt sich sehr ausführlich und differenziert mit Kunde norientierung, lässt dabei allerdings einige wichtige Fragen unbeantwortet. Ist Kundenorientierung eine normative Strategie, die die Marketingwissenschaft den Unternehmen zur Anwendung empfiehlt, oder ein empirischer Befund, der die typischen Strategien von Unternehmen charakterisiert? Aus welcher Perspektive wird beurteilt, ob eine Strategie und das ihr entsprechende Handeln kundenorientiert ist, aus der Sicht des agierenden Unternehmens oder aus der Sicht der Zielobjekte seines Handelns, der Kunden? Mehrheitlich hat die Marketingwissenschaft faktisch eine eindeutige Position: sie beobachtet und empfiehlt aus der Sicht der Unternehmen (8). Zum Erfolgskriterium wird die Durchsetzungsf ähigkeit am Markt; wer dort besser als andere agiert, ist offensichtlich kundenorientierter. Nicht zuletzt bleibt zu fragen: Ist Kundenorientierung Entscheidungs- und Handlungsmaxime oder Ideologie? Für unsere Fragestellung lässt sich das Kundenverhältnis zusammenfassend wie folgt charakterisieren. Das Kundenverhältnis ist ein instrumentelles Objekt-Geld-Tauschverhältnis zwischen Käufern und Anbietern. Seine konstitutiven Merkmale auf der Kundenseite sind Wahl und Kaufkraft, die das Machtmittel der Kunden bilden. Kundenorientierung auf der Unternehmensseite ist eine Funktion der ökonomischen Rahmenbedingungen Markt, Wettbewerb und Käufermärkte sowie des Zwangs zur Kapitalverwertung. Typisch ist die monetäre Ungleichheit und damit die ungleiche Machtverteilung zwischen den Kunden, die ungleiche Verteilung von Markt- und Marketingmacht zwischen den Unternehmen sowie die ungleiche Machtverteilung zwischen Unternehmen und (Konsumenten-)Kunden. Im Konsumenten-Kundenverhältnis sind Unternehmen tendenziell kommunikationsmäc h- 8 tiger als ihre Kunden. Kurz: Kundenverhältnis, Macht und Ungleichheit hängen in einer kapitalistischen Marktwirtschaft unauflöslich zusammen. 2. Kundenorientierung in der politischen Bildung Soll der Begriff Kundenorientierung im Bereich der politischen Bildung angewendet werden, muss man in irgendeiner Form an die wichtigsten Merkmale des Kundenverhältnisses anknüpfen können. Ergeben sich keine geeigneten Anschlusspunkte, kann der Begriff nur als Metapher für ähnliche oder beliebige Zielvorstellungen genutzt werden. Dann wäre aber zu prüfen, was Kundenorientierung in der politischen Bildung bedeuten soll, welche Konnotationen der Begriff Bildung transportiert, wie diese kontrolliert werden können, und ob der Begriff insgesamt angemessen ist. Betrachten wir zunächst die Anschlussfähigkeit des Begriffs Kundenorientierung in der politischen Bildung. Dazu müssen wir die Strukt uren des Felds der Akteure in der politischen Bildung beschreiben und prüfen, ob die Rede von Anbietern, Verkäufern und Kunden politischer Bildung angemessen ist. 2.1 Bildungsverkäufer und Bildungskunden Welche Art von Anbietern politischer Bildung gibt es eigentlich? Grundsätzlich findet man das ganze Spektrum möglicher Organisationsformen von rechtlich, wirtschaftlich und inhaltlich selbständigen erwerbswirtschaftlichen Unternehmen über teilsubventionierte und teilautonome gemeinwirtschaftliche Einrichtungen mit oder ohne Kostendeckungszwang, Rundfunk- und Fernsehanstalten, Schulen in privater Trägerschaft, Volkshochschulen als öffentlich-rechtliche Betriebe, öffentliche Schulen in kommunaler oder staatlicher Trägerschaft mit Lernenden im Alter zwischen 6 und 25 Jahren, Behörden wie die Landeszentralen für politische Bildung oder Bunde swehrkommandos, Stab- oder Linienabteilungen oder einzelne Beauftragte für Bildung bei gesellschaftlichen Organisationen wie Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Umweltverbänden. Die Beispiele zeigen, wie breit und unterschiedlich strukturiert das Spektrum der Organisationen ist, die für sich beanspruchen, (auch) politische Bildung zu betreiben. Um für all diese Organisationsformen der politischen Bildung Kundenorientierung als eine gemeinsame Leitidee zu legitimieren, bedarf es schon ziemlich überzeugender Argumente dafür, dass es ein gemeinsames und charakteristisches Merkmal all dieser Einrichtungen ist (oder werden soll), dass sie es mit Kunden und nicht mit Teilnehmern, Schülern, Wehrpflichtigen, Zuschauern, Mitgliedern oder Bürgern zu tun haben. Auf der Anbieterseite politischer Bildung haben wir es offensichtlich (gemessen an Anbi eter- und Teilnehmerzahlen) nur mit einer Minderheit von Bildungseinrichtungen zu tun, die man sinnvollerweise als Unternehmen bezeichnen kann. Denn ein Bildungsunternehmen sollte drei konstitutive Merkmale aufweisen: Produktionsautonomie, Finanzautonomie und Kontraktautonomie. Wesentliche Elemente der Produktionsautonomie sind freie Positionierung im Markt, freie Gestaltung des Bildungsangebots und selbständige Personalpolitik. Zur Finanzautonomie gehört die freie Preisgestaltung sowie die freie Verfügung über die liquiden Mittel. Die Kontraktautonomie zeichnet sich dadurch aus, dass der Anbieter frei entscheiden kann, mit welchen Individuen oder Organisationen er punktuelle oder dauerhafte vertragliche Bindungen eingeht und mit welchen nicht. Für selbständige Bildungsunternehmen leuchtet es unmittelbar ein, dass sie Kunden haben und auf ihren Märkten im Wettbewerb kundenorientiert sein müssen – was immer das auch im einzelnen bedeuten mag. Geht es dagegen um Organisationen, die in irgendeiner Form von Dritten abhängig sind, erscheint die Identifizierung der Kunden schon schwieriger. 9 Wenn Bildungsorganisationen von ihren staatlichen, halbstaatlichen, gesellschaftlichen oder privaten Finanziers einen inhaltlichen Bildungsauftrag erhalten, den sie in Bildungsangebote umsetzen sollen, sind vor allem diese Finanziers ihre Kunden. Sie bestellen und bezahlen Bildungsprogramme und Bildungsveranstaltungen, von denen sie sich erhoffen, dass die Teilnehmer in ihrem Sinne beeinflusst werden, z. B. indem sie mit Wissen, Wissensstrukturen und Kompetenzen ausgestattet oder mit interessenspezifischen Perspektiven vertraut gemacht werden. Aus Sicht dieser Auftraggeber-Kunden (die zugleich auch Abnehmer-Kunden sein können) sind die Teilnehmer der Veranstaltungen zumindest auch Bildungsobjekte, das gekaufte Produkt ist die Dienstleistung Information, Qualifikation und/oder Beeinflussung. Man kann dieses Kundenverhältnis vielleicht mit dem zwischen einem Herstellerunternehmen als Auftraggeber und einer Werbeagentur als Auftragnehmer vergleichen. Selbstverständlich sind nicht die Personen, die die Werbezielgruppe bilden, die Kunden der Agentur, sondern der Auftraggeber. Die in irgendeiner Form auftragne hmenden Bildungseinrichtungen erfüllen dagegen nicht die Funktion eines Maklers oder Mediators, da sie nur von einer Seite beauftragt (und finanziert) sind. Viele Bildungsorganisationen sind im übrigen insofern kundenorientiert, als sie aus ökonomischen und anderen Gründen permanent auf der Suche nach (zusätzlichen) Einnahmequellen in Form von Fördermitteln sind, und sich zu den jeweiligen und wechselnden Förderinteressen und Förderprogrammen ihrer Auftraggeber-Kunden passende Bildungsprodukte ausdenken. Wie ist das an öffentlichen Schulen, die mit 12-13 Millionen die mit Abstand größten realen und potenziellen Teilnehmerzahlen an politischer Bildung haben? Auch öffentliche Schulen haben bekanntlich einen Auftraggeber und Finanzier, der auch das Management und das Personal stellt: staatliche Institutionen (oder ganz allgemein die Gesellschaft). Der Auftraggeber erteilt Schulen vereinfacht gesprochen einen politischen Bildungs- und Erziehungsauftrag, den diese – nach gehöriger Interpretation, Transformation, Reduktion und Obstruktion, d. h. keineswegs bruchlos – gegenüber und/oder zusammen mit den Schülerinnen und Schülern einzulösen versuchen. Die Auftraggeber statten die Organisation mehr oder weniger mit den für den Auftrag erforderlichen personellen, finanziellen und sachl ichen Mitteln aus. Kunde der Schulen wäre danach der Staat (oder die Gesellschaft). Der Auftraggeber-Kunde erwartet von der Organisation Schule z. B. die Dienstleistung, dass aus Schülerinnen und Schülern mündige Bürgerinnen und Bürger werden – oder wie auch immer die Zielvorstellungen im einzelnen formuliert werden mögen. Anders als in der richtigen Wirtschaft hat die Schule natürlich nicht die formelle Möglichkeit, den Auftrag wegen Kostenträchtigkeit, Kapazitätsüberlastung oder Aussichtslosigkeit abzulehnen; insofern ist sie eine Behörde in einem hierarchischen System. Andererseits ist sie auch eine Organisation, deren Teilsysteme eher lose gekoppelt und relativ selbständig sind; insofern können sich ihre Teile der Steuerung in beträchtlichem Umfang entziehen. Im Zuge der modernen Marktorthodoxie und Managementeuphorie soll sich das bekanntlich ändern. Schulen sollen den Strukturmerkmalen von Unternehmen angenähert werden und entsprechend autonomer über Mittel, Personal und Programme entscheiden können. Eine ganze Reihe von zentralen Unterschieden zwischen Schule und Unternehmen bleiben aber vorläufig erhalten; sie können selbstverständlich zukünftig politisch eingeebnet we rden. Erstens können die Auftraggeber-Kunden einer zu ihrer Unzufriedenheit arbeitenden Schule (bisher) nicht die finanziellen Mittel soweit entziehen, dass diese Schule schließen und ihr Personal entlassen muss. Zweitens kann sich die betroffene Schule keinen anderen Staat, eine Partei, eine Großbank oder die Nachbargemeinde als neuen Auftraggeber für ihr Dienstleistungsangebot suchen, sie befindet sich insoweit in der Regel in einem Nachfragemonopol. Drittens hat die Schule nur eine begrenzte Autonomie über die Gestaltung des Produktionsprozesses, z. B. hinsichtlich des Verhältnisses von Kapital- und Arbeitseinsatz 10 oder der Qualitätskontrollen wie Klassenarbeiten oder Abschlussprüfungen. Viertens kann sie sich nicht ihre Kunden frei auswählen und nicht genehme Kunden ablehnen. Fünftens kann sie die Preise für ihr Angebot nicht frei festlegen. Sechstens kann die Organisation Schule nicht – im Rahmen der jeweiligen Nachfragesituation – frei über die von ihr anzubietenden Lehr-Lern-Dienstleistungen und deren Organisationsform entscheiden. Siebtens kann sie nicht beliebige Organisationsziele verfolgen, z. B. in ihrem Eigeninteresse rational die Erzielung eines angemessenen oder möglichst hohen Gewinns oder die Minimierung der eingesetzten Arbeitszeit anstreben. 2.2 Auftraggeber-Kunden und Teilnehmer-Kunden Wer sind nun die „eigentlichen“ „Kunden“ politischer Bildung? Auf der „Endverbraucherseite“ (9) ist die Unterscheidung in Schüler/innen und Teilnehmer/innen gebräuchlich, deren innere und äußere Grenzen allerdings fließend sind. Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass man zumindest Auftraggeber-Kunden von Teilnehmer-Kunden unterscheiden muss. Für Auftraggeber-Kunden gelten grundsätzlich alle Merkmale des Kundenverhältnisses, auch wenn sie die darin enthaltenen Optionen nicht vollständig nutzen, wie z. B. der Staat gegenüber seinen Schulen. Auftraggeber-Kunden verfügen über Kaufkraft (oder Haushaltsmittel), mit der sie Bildungsdienstleistungen einkaufen (oder finanzieren) können, sie können prinzipiell wählen, sowohl zwischen Bildungsanbietern als auch zwischen verschiedenen Bildungsprogrammen und Bildungsangeboten, und sie können das Tauschverhältnis Kunde-Unternehmen auf seine ökonomisch-instrumentellen Aspekte reduzieren oder auch nicht. Wenn in der aktuellen Debatte Kundenorientierung in der politischen Bildung gefordert wird, ist allerdings ganz offensichtlich nicht gemeint, die Interessen der AuftraggeberKunden sollten besser berücksichtigt werden. Das ist aus Sicht des Konzepts Kundenorientierung recht erstaunlich, da den zahlenden und auswählenden Auftraggeber-Kunden damit der Einfluss auf Produktion und Produkt politischer Bildung entzogen oder abgesprochen wird zugunsten des dominanten Einflusses der Abnehmer-Kundenseite (10), die aber nicht, kaum oder nur beschränkt auswählt und nicht oder wenig zahlt. Die Teilnehmer-Kunden sollen also in den Mittelpunkt aller Bemühungen rücken. Die Seite der Teilnehmer-Kunden erscheint allerdings recht komplex und unübersichtlich. Hinsichtlich des konstitutiven Merkmals Wahl kann man grob zwei Kategorien unterscheiden: Zwangs-„Kunden“, denen der Erwerb oder Konsum politischer Bildung über die Schulpflicht, über die Wehrpflicht oder über die Mitgliedschaft in Organisationen auferlegt wird, und Wahl-„Kunden“, die sich freiwillig für ein politisches Bildungsangebot en tschieden haben. Zwangs-„Kunden“ stellen nach Personen die mit Abstand größte Gruppe. Der überwiegende Teil von ihnen, die Schülerschaft, verfügt übrigens nur über geringe finanzielle Mittel und ist mehrheitlich nicht einmal voll geschäftsfähig. Selbstverständlic h gibt es im richtigen Leben vielfältige Abstufungen zwischen den Extremen Zwangs„Kunde“ und Wahl-„Kunde“. So ist z. B. die Teilnahme an einem gewerkschaftspolitischen Lehrgang nicht ganz freiwillig, wenn man Betriebsrat oder Funktionär werden möchte. Ähnliches gilt für die politische Bildung innerhalb von Parteien oder anderen gesellschaftlichen Großorganisationen oder für die Fortbildung karrierebewusster Politiklehrer/innen. Nimmt man die konstitutiven Merkmale des Kundenbegriffs, wie wir ihn oben definiert haben, ernst, macht es keinen Sinn, bei Vorliegen von Teilnahmezwang von „Kunden“ zu sprechen. Die Minimalanforderung dafür, die Adressaten von politischer Bildung in Schulen als Kunden in unserem Sinne bezeichnen zu können, bestünde wohl darin, dass sie sich frei für verschiedene Angebote und unterschiedliche Anbieter politischer Bildung oder gegen Politikthemen und für Alternativen aus anderen Bereichen entscheiden 11 können, z. B. Interneteinführungen, Rechtschreibtrainings, Analysislehrgänge oder Fussballkurse. Diese Art von Kundenorientierung steht aber derzeit bildungspolitisch (noch) nicht auf der Agenda. Hinzu kommt, dass man die allermeisten Angebote politischer Bildung bisher (noch) nicht in individualisierter Form wahrnehmen kann. Vielmehr „konsumiert“ man in der Regel in Gruppen, bleibt also an Formen der Vergemeinschaftung gebunden. Besonders in Schulen nimmt dieser „Konsum“ die Form teilweise jahrelang bestehender Gemeinschaften an. Klassen oder Lerngruppen bilden die Orte politischer Bildung, deren „Konsum“ ist damit wesentlich kollektiv und eingebettet in eine Art öffentliche Zwangsgemeinschaft. Schon deshalb kann nur bedingt von „Kunden“ gesprochen werden. Noch einmal kompliziert wird das Wahlkriterium im Schulbereich dadurch, dass die meisten Schüler/innen nicht volljährig sind, man es also mit zwei Konsumenten-„Kunden“Gruppen zu tun hat, die durchaus unterschiedliche Ansprüche an die Dienstleistungsprodukte haben können: die Schüler/innen als unmittelbare Teilnehmer/innen und ihre Erziehun gsberechtigten als interessierte und einflussberechtigte Beobachter der Angebote und der mitgeteilten Beobachtungen der Teilnehmer/innen. Wie sieht es beim zweiten Hauptmerkmal des Kundenverhältnisses, der Kaufkraft, aus? Die wenigsten Konsumenten-„Kunden“ politischer Bildung verfügen über hinreichend freie Kaufkraft, um die ihnen vorgesetzten oder von ihnen gewählten Bildungsangebote wenigstens kostendeckend zu finanzieren. Das ist in soweit kein Problem, als die meisten Angebote politischer Bildung kostenlos oder zu auf ein sozial tragbares Niveau herunter subventionierten Preisen angeboten werden. Vermutlich wären aber auch nicht sehr viele dazu bereit, kostendeckende Kurspreise zu zahlen, denn sonst könnte man ohne wesentliche Wirkungen für die Teilnahmequote auf die verbreitete Subventionierung verzichten. Würden politische Bildungsangebote kostendeckend kalkuliert und den Teilnehmern entsprechend berechnet, würde die Nachfrage in vielen Bereichen wahrscheinlich zunächst einmal drastisch zurückgehen. Nun könnte man das natürlich politisch ändern, indem man z. B. geldwerte Gutscheine für politische Bildung verteilt, die bei allen Anbietern politischer Bildung eingelöst werden können. Im ersten Fall würden die Adressaten von Bildungsangeboten insoweit zu Kunden, als sie mit dem Einlösen, Verschenken oder Verfallenlassen der Gutscheine bestim mte Angebote und Anbieter auszeichnen und andere abwählen könnten. Im Extremfall könnten sie die Gutscheine horten und sich gar nicht an Nachfrage und Konsum des Produkts politische Bildung beteiligen. Andererseits bleibt ein nicht unerhebliches Zwangsmoment solange bestehen, wie die Gutscheine nicht gegen andere Bildungsgüter oder gar beliebige Konsumgüter eintauschbar sind. Würde man dagegen nicht die Nachfrage nach politischer Bildung durch Gutscheine, sondern das Angebot so weit subventionieren, dass es kostenlos angeboten werden könnte, würde ein strukturelles Überangebot und im Durchschnitt das exakte Gegenteil von Kundenorientierung entstehen. Als Ergebnis können wir festhalten, dass die konstitutiven Kundenmerkmale auf der Auftraggeber-Kundenseite der politischen Bildung real oder zumindest als Option gegeben sind. Auf der Konsumenten-Kundenseite sieht das ganz anders aus. Hier haben wir eine sehr große Gruppe, die weder über Kaufkraft verfügt, noch in wesentlicher Hinsicht wählen kann, die Schüler/innen an öffentlichen Schulen. Wehrpflichtige finden sich in einer vergleichbaren Situation. Die Angebote politischer Bildung sind für beide Gruppen kostenlos und im Prinzip Zwangskonsum oder Zwangsteilnahme. Trotz gewisser Einflussmöglichkeiten, z. B. hinsichtlich des Grades an Kooperationsbereitschaft, macht der Kundenbegriff hier keinen Sinn. Es gibt eine zweite Gruppe, die potenziellen und tatsächlichen 12 Teilnehmer offe ner Veranstaltungen, die aus den politischen Bildungsangeboten wählen kann und über Kaufkraft verfügt, diese aber nur begrenzt zum Kauf von Kursangeboten hergeben will. Beispiele sind Teilnehmer von Kursen an kommunalen Volkshochschulen. Ob die Teilsubventionierung dieser Angebote Ursache oder Folge der begrenzten Zahlungsbereitschaft ist, sei hier dahingestellt. Diese Gruppe kann man sinnvollerweise als Kunden bezeichnen. Eine dritte Gruppe ist dadurch charakterisiert, dass sie zwar formal freiwillig, aber aus dem spezifischen sozialen Kontext heraus betrachtet doch eher obligatorisch an Bildungsangeboten teilnimmt; Beispiele dafür sind Partei- und Gewerkschaftsschulungen sowie karriererelevante Lehrerfortbildungen. Für sie macht der Kundenbegriff wenig Sin n. 2.3 Voraussetzungen und Folgen der Kundenorientierung Von einem Kundenverhältnis kann man m. E. nur dann sprechen, wenn einem Unternehmen Kunden gegenüberstehen. Das trifft in der politischen Bildung nur für einen sehr begrenzten Bereich zu. Selbstverständlich kann man es mit guten Gründen politisch für sin nvoll halten, möglichst viele Anbieter-Abnehmer-Verhältnisse im Bildungsbereich wie Unternehmen-Kunden-Verhältnisse zu gestalten. Dann darf man sich aber nicht darauf beschränken, diese fundamentale Umgestaltung der politischen und sonstigen Bildung nur durch Parolen wie „Mehr Kundenorientierung“ zu fordern oder mental vorzubereiten. Weitgehend folgenlose Forderungen dieser Art kennt die politische Bildung mehr als genug. Diese Folgenlosigkeit wird von Befürwortern der Kundenorientierung der Parole der „Schüler- oder Teilnehmerorientierung“ unausgesprochen unterstellt, da Kundenorientierung andernfalls wohl überflüssig wäre. Wollte man Kundenorientierung realisieren, statt sie nur zu fordern, käme es darauf an, die strukturellen Voraussetzungen für eine Transformation von Schüler-, Teilnehmer- und Mitgliederverhältnissen in Kundenverhältnisse zu schaffen. Anbieter politischer Bildung müssten zu Unternehmen mit Produktgestaltungs- und Finanzautonomie werden, Abnehmer zu Kunden mit Wahlfreiheit und Kaufkraft. Angebot und Nachfrage nach politischer Bildung wären marktförmig zu organisieren, politische Bildung würde dann zum privaten Gut, zur Ware. Staatliche Subventionen bedürften einer besonderen Begründung, staatliche Eingriffe in die Produktion und die Produkte wären weitgehend tabu. Möglich bliebe allein eine Rahmengesetzgebung, die vielleicht gewisse Mindeststandards für die Ausbildung des Personals und die Haftung der Anbieter vorgeben würde. Dann würden echte Kundenverhältnisse entstehen. Unternehmensberater und Werbeagenturen fänden neue Betätigungsfelder. Aus der imaginativen Idee Kundenorientierung, gedacht zur Modernisierung alter Verhältnisse, wüchsen neue Verhältnisse, Marktverhältnisse eben. Dann erst bekäme Kundenorientierung in der politischen Bildung einen Sinn, denn ohne Kunden, ohne Unternehmen und ohne Markt ist die Rede von Kundenorientierung absurd oder purer moralischer Appell. Bei den gegenwärtigen AngebotsNachfrage-Verhältnissen politischer Bildung dürfte es sehr plausibel sein, dass sich dann extreme Käufermärkte bilden würden, die ein hohes Maß an Kundenorientierung garantieren. Damit wäre aber nur sichergestellt, dass es mehr Kundenorientierung als heute gäbe, weil es mehr Markt und eben auch mehr Kundenverhältnisse gäbe. Ob aber Kundenorientierung in der politischen Bildung – nach welchen Kriterien auch immer beurteilt – besser ist als Schülerorientierung oder Teilnehmerorientierung, ist damit noch nicht bewiesen. Wie Bildungsmärkte funktionieren, kann man z. B. an der beruflichen Weiterbildung studieren. Welche Folgen die Privatisierung in bestimmten Bereichen haben kann, zeigen auch die Ergebnisse des freien Auswählens zwischen Angeboten des kommerziellen Fernsehens, die meist mit Zwangsaufmerksamkeit für Werbung bezahlt werden müssen. Solche 13 Angebots- und Nachfragestrukturen erscheinen aus Bildungssicht weniger als attraktive Vision denn als Schreckensszenario. Mit dem geforderten Paradigmenwechsel zur Kundenorientierung (auf der Grundlage von Kundenverhältnissen) stellt sich eine Reihe offener Fragen. Nur einige davon seien hier angeführt. Sollen Anbieter in der politischen Bildung die Kundenorientierung wie andere Unternehmen als ein abgeleitetes Ziel mit instrumenteller Funktion für i rgendwelche Oberziele verfolgen oder soll politische Bildung (im Gegensatz zur realen Praxis in der Wirtschaft) im Bildungsbereich Selbstzweck sein? Wozu dann der Begriff Kundenorientierung? Was spricht dafür, von einer Umstellung auf Kundenorientierung ei nen höheren Grad an Bedürfnisbefriedigung für die Bildungssubjekte zu erwarten als von der Teilnehmerorientierung? (11) Sind marktförmig organisierte Angebote prinzipiell bedürfnisgerechter als andere Formen? Können sich Staat und Gesellschaft mit politischer Bildung als Bedürfnisbefriedigung nach den Regeln von Angebot und Nachfrage begnügen? Oder müssen allgemeine, von individuellen Kundenbedürfnissen unabhängige Qualitätsstandards definiert und durchgesetzt werden? Wie wird verfahren, wenn Kunden unvereinbare Bedürfnisse äußern oder wenn die Interessen verschiedener Kundengruppen miteinander konfligieren? Was dürfen die neuen Kunden frei wählen? Nur den Anbieter, oder auch die Inhalte, die Form, die Dauer, das Personal? (12) Sollen potentielle Kunden politischer Bildung und ihre Bedürfnisse ähnlich intensiv mit Marketingtechniken aller Art bearbeitet werden wie es Praxis in der real existierenden kapitalistischen Marktwirtschaft ist? Soll in diesem Sinne strategische Kommunikation zum neuen Kommunikations muster über die und innerhalb der politischen Bildung werden? Wie wird die Kaufkraft für politische Bildung erworben oder verteilt? Soll es Bildungsgutscheine oder Geld geben? Sollen Schulen und Bildungsträger massiv in die künstliche Differenzierung ihre r Angebote investieren, wie dies für die Anbieter nahezu austauschbarer Produkte auf gesättigten Märkten typisch ist (ausbaufähige Ansätze dazu gibt es schon in Form von Schulprofilen und schulspezifischen Bildungsgängen)? Ist eine solche Differenzierung i m Interesse einer besseren Bedürfnisbefriedigung der Kunden oder dient sie nur einer Profilierung der Anbieter? Wer kommt für die zusätzlichen Kosten auf, die die Kundenorientierung unvermeidlich verursacht, allerdings ohne dass ihr auch höhere Erlöse gegenüberstehen? Sollen die Bildungskunden dafür höhere Preise bezahlen? Gibt es Subventionen? Sollen die Anbieter die Kundenorientierung finanzieren, z. B. durch längere Arbeitszeiten, eine höhere Arbeitsintensität oder niedrigere Löhne der Beschäftigten oder durch Einsparungen bei der Ausstattung der Lernstätten oder der Gehälter der Leiter? Sollen Sponsoren motiviert oder Werbung zugelassen werden? Wem werden nach welchen Regeln und Maßstäben und mit welchen Konsequenzen Erfolge und Misserfolge bei der Kundenorientierung zugerechnet? Wie verträgt sich eine – jedenfalls in der ökonomischen Realität typischen – extrinsische Motivation des Bildungsverkäufers mit einer – jedenfalls bisher in der pädagogischen Theorie beanspruchten – intrinsischen Motivation der Teilnehmer-Kunden? Oder war das mit der Kundenorientierung eigentlich alles gar nicht so gemein gemeint ... ? 3. Fazit: Verabschiedung einer Lösung ohne Problem Hinter der Rede von der Kundenorientierung lauert eigentlich eine ganz andere, eine grundsätzliche Diskussion über die politischen, ökonomischen, pädagogischen und didaktischen Vorteile und Nachteile einer marktförmigen Organisation von (politischer) Bildung 14 im Vergleich zu hierarchisch oder netzwerkartig koordinierter Bildung. Diskussionsthemen wären dann politische Fragen, z. B. ob politische Bildung entstaatlicht und vom bisher überwiegend meritorischen Gut ganz zum privaten Gut transformiert werden soll, wie es z. B. Kinofilme, Tantra-Wochenenden oder Surfkurse sind, oder ob man nach Bildungsbereichen oder Inhalten differenzieren soll, ob nur die Organisationsform oder auch die Inhalte und Ziele von Bildungsangeboten ökonomisiert, d. h. einem gewinnorientierten Kosten-Ertrags-Kalkül unterworfen werden sollen, ob und wie man unter diesen Bedingungen den öffentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen kann, ob die mit der Marktförmigkeit verbundenen Ungleichheiten im Niveau politischer Bildung in Kauf genommen werden sollen, ob eine Umverteilung von Nutzen und Kosten politischer Bildung erwünscht ist, wer die entstehenden negativen externen Effekte, z. B. in Form von verbreitetem politischem Unwissen und sinkender Beteiligungsbereitschaft, tragen soll, usw. usw. Ich wüsste allerdings nicht, aus welchem Motiv und mit welcher Begründung dies alles heute ausgerechnet von der politischen Bildung selbst und freiwillig thematisiert werden sollte. Welche ungelösten Probleme hätte politische Bildung, auf die Privatisierung und Vermarktlichung die richtige Antwort wären? Die Gründe, die dafür angeführt werden können, dass man heute eine Debatte über die Privatisierung politischer Bildung führen sollte – und wie gezeigt läuft Kundenorientierung aus strukturellen Gründen in letzter Konsequenz darauf hinaus –, liegen wesentlich außerhalb der politischen Bildung. Sie liegen z. B. im allgemein verbreiteten ökonomischen I mperialismus unserer Zeit, der sich anschickt, alle Lebensbereiche zu kolonisieren, oder in einem Gefühl von Modernisierungsrückstand im Bildungsbereich angesichts des gefeierten Siegeszuges der Ökonomisierung, vielleicht auch einem gewissen Minderwertigkeitsko mplex von Beamten und Hierarchen gegenüber Markt und Management. Damit wäre Kundenorientierung vor allem eine Lösung für das eingangs erwähnte Problem mangelnder politischer Legitimation hierarchischer Organisation – und zugleich vor allem aus pol itisch-ideologischem Interesse von außen an den Bildungsbereich herangetragen. Damit aber sucht sich eine externe Lösung in einem neuen Anwendungsbereich ein weiteres Problem zur Bearbeitung. Innerhalb der politischen Bildung selbst sehe ich nur eine wesentliche Ursache für die Diskussion über die Lösung Kundenorientierung: eine sozialwissenschaftlich unzureichende Selbstreflexion, vor allem über die strukturellen Voraussetzungen von Kundenorientierung, aber auch über die hohe Affinität der Konzepte Teilnehmerorientierung und Kundenorientierung als Parole, und nicht zuletzt hinsichtlich der instrumentellen Funktion, die Deba tten wie die um die Kundenorientierung für eine weitere Ökonomisierung des Bildungswesens erfüllen (können). Ohne eine gründliche Selbstreflexion läuft politische Bildung Gefahr, dass sie ihre eigene Begriffe ohne Not durch „fremde“ Parolen ersetzt und (politik)didaktische Probleme zu externen Lösungen sucht, die sich derzeit eines hohen Grades an ideologischer Akzeptanz erfreuen. Von den Vorstellungen einer Kundenorientierung sollten sich die politische Bildung und ihre Didaktik deshalb schnellstmöglich verabschieden. Eine theoretische und vor allem praktische Weiterentwicklung von Konzepten der Teilnehmer- oder Schülerorientierung sowie eine Diskussion darüber, ob und wie begründete Erwartungen gesellschaftlicher Anspruchsgruppen an politische Bildung aufgenommen und umgesetzt werden können, erscheint weitaus erfolgversprechender. Die unterschiedlichen, an politischer Bildung interessierten Gruppen entdifferenzierend im schwammig-trendigen Begriff des Kunden aufzulösen, erschwert Erkenntnis, Diskussion und Innovation. 15 Eine weitere wichtige Frage, über die sich zu diskutieren lohnt, ist die, warum Politikdidaktik mit ihren Vorschlägen und Modellen nicht so alltagswirksam wird, wie man es sich wünschen würde. Denn bei aller Diskussion um Kundenorientierung und Qualitätsmanagement schwingt unterschwellig auch die Hoffnung mit, man habe nun endlich eine praxiswirksame Formel gefunden. Eine Ursache für die bisher mangelnde Wirksamkeit von Politikdidaktik könnte darin liegen, dass neue Konzeptionen generiert werden, entsprechende Umsetzungsstrategien aber sträflich vernachlässigt werden. Immer wieder neue Konzeptionen (13) verdrängen und ersetzen die Implementation vorhandener Konzeptionen. Damit hängt die Frage eng zusammen, warum Politikunterricht an Schulen kein Prozess kontinuierlicher Verbesserung ist, sondern eine Veranstaltung multipler Parallelarbeiten mehr oder weniger isoliert vor sich hin arbeitender Professioneller. Parallel dazu vollzieht sich – marktlich-anarchisch gesteuert – ein kontinuierlicher Produktionsprozess von Bildungsmaterialien aller Art. Das Hauptproblem scheint vor allem darin zu liegen, dass es bisher nicht gelungen ist, Schule institutionell als eine lernende Organisation zu konstruieren, die organisierte Wissensarbeit (14) sichert, und dass die Umsetzung einer tragfähigen Lösung dafür bisher nicht absehbar ist. Zu dem vielversprechenden Projekt „lernende Organisation“ könnte die sozialwissenschaftliche Didaktik ihre Fachkompetenz ganz wesentlich einbringen. Denn die Vorbilder, von denen Schule hier lernen könnte, stammen aus der ökonomischen und soziologischen Organisationstheorie und aus der Managementwissenschaft. Bei aller berechtigten Skepsis gegenüber diesen Quellen könnte die Fachdidaktik ihre fachwissenschaftlichen Bezüge für eine organisatorische Reform von Schule fruchtbar machen, die durch Strukturwandel die Voraussetzungen für eine verbesserte Leistung im Kernbereich von Schule: im Unterricht, institutionell sichern könnte. Dazu braucht man vor allem institutionell verankertes Wissensmanagement in der professionellen Organisation Schule, nicht aber die Verkündung von Kundenorientierung ohne Kunden und ohne Markt. Anhang: Heuristische Typologie von Bildungsverhältnissen In der bisherigen Argumentation sollte deutlich geworden sein, wie komplex schon die strukturellen Verhältnisse zwischen Anbietern und Abnehmern von (politischer) Bildung sind, von deren materialer Ausgestaltung mit vielen Kombinationsmöglichkeiten und Zwischenformen ganz zu schweigen. Der Anhang will versuchen, etwas Ordnung in die Vielfalt zu bringen. Vielleicht können Diskussionen wie die u m Kundenorientierung mit dieser Strukturierungshilfe etwas differenzierter geführt werden. Die nachfolgend abgedruckten Vierfeldertafeln beziehen jeweils zwei Merkmale, z. B. Teilnahme und Entgelt, aufeinander, und reduzieren die ganze Palette möglicher Ausprägungen auf zwei Extreme, z. B. Wahl (Autonomie) und Zwang (Heteronomie) (15). Abb. 1 Akteure: Koordination: Anbieter Abnehmer Markt Unternehmen Kunde Netzwerk Mitglied Institution Mitglied Hierarchie Mitglied (intern) Teilnehmer (extern) 16 Abbildung 1 enthält zunächst einen Vorschlag zur Terminologie für Anbieter und Abnehmer von Bildungsprodukten differenziert nach der jeweils dominanten Koordinationsform Markt, Hierarchie oder Netzwerk. Beispiele für Netzwerkangebote sind umweltpolitische Fortbildungen von Umweltverbänden wie der ANU (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung). Hierarchische Anbieter sind Fortbildungsabteilungen der Bezirksregierungen, Landeszentralen für politische Bildung oder Weiterbildungsabteilungen in Großorganisationen wie Gewerkschaften oder Unternehmen. Abb. 2 Produktion: Koordination: Autonomie Heteronomie Markt Unternehmen Hierarchie öffentlicher Bildungsträ- öffentliche Schule, Geger mit allgemeinem Au f- werkschafts-, Parteischule trag Abb. 3 Produktion: Finanzierung: Autonomie Heteronomie Autonomie freier Markt gelenkter Markt Heteronomie gestützter Markt Hierarchie Abbildung 2 und 3 veranschaulichen einen Vorschlag zur Strukturierung der Produktionsseite. Beide unterscheiden die Produktion des Angebotes an politischer Bildung danach, ob der Produzent autonom darüber entscheiden kann oder ob er in sich einem Zwangsverhältnis befindet. Während Abbildung 2 Autonomie und Heteronomie nach Koordinationsformen unterscheidet, differenziert Abbildung 3 nach der finanziellen Selbstständigkeit der Produzenten. Abb. 4 Teilnahme: Koordination: Autonomie Heteronomie Markt Kunde Verpflichteter z. B. Käufer einer politi- z. B. Fortbildungspflicht schen Bildungsreise von Ärzten Hierarchie Teilnehmer Mitglied z. B. an einer Lehrerfort- z. B. Schüler, Beschäftigbildung der Bezirksregie- te, Studenten rung Die Abbildungen 4 und 5 unterscheiden die Teilnahmesituation nach den Extremen freie Wahl (Autonomie) und Zwang (Heteronomie) und bilden diese Unterscheidung einmal auf die Koordinationsformen, zum anderen (eng damit verknüpft) auf die Finanzierung durch die Abnehmer ab. 17 Abb. 5 Teilnahme: Entgelt: Autonomie Heteronomie entgeltpflichtig z. B. Weiterbildungsmarkt z. B. Schulpflicht Schulgeld mit entgeltfrei z. B. offene Jugendbil- z. B. Schulpflicht, Fortdung bildungspflicht Alle Übersichten zusammen machen noch einmal deutlich, wie eng der Bereich ist, in dem man uneingeschränkt von Kundenverhältnissen sprechen sollte, und wo überall nichtmarktliche Koordinierungsprinzipien ersetzt sowie institutionelle Einflussmöglichkeiten abgeschnitten werden müssten, wenn man Kundenorientierung zu einem material fundierten Prinzip politischer Bildung machen wollte. Dass in der Realität der Anbieter und Abnehmer politischer Bildung zahlreiche Zwischenformen und Kombinationen existieren, sei noch einmal betont; ein Beispiel wäre ein für externe Teilnehmer frei vermarktetes Weiterbildungsangebot (Markt) einer Schule (Hierarchie), deren Entgelt frei ausgehandelt werden kann. Literatur Berg, Hans Christoph; Schulze, Theodor (1995): Ein anderer Blick. In: dies. (Hg.): Lehrkunst und Schulvielfalt, Bd. 2: Lehrkunst. Lehrbuch der Didaktik. Neuwied, Kriftel, Berlin, 11-19. Bertelsmann Stiftung; Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW (Hg.) (1996): Führungs- und Organisationsstrukturen in berufsbildenden Schulen. Gütersloh. Bezirksregierung Köln (1996): Materialien zur Schulentwicklung: Qualitätsmanagement. Teil 1: Schule macht Qualitätsmanagement (1996). Teil 2: Prozessdokumentation (1995). Köln. Bühner, Rolf (1997): Studenten als Kunden. Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. In: Forschung & Lehre, 4 (1997) 11, 580-582. Dietz, Sylvia (1996): Qualitätsmanagement in Weiterbildungseinrichtungen Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 für Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung (Personal und Organisation, 00014). Münster. Diller, Hermann (1995): Kundenmanagement. In: Tietz/Köhler/Zentes, 1363-1376 Fuchs, Willi (1994): Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9000-9004. In: Die Berufsbildende Schule 46 (1994) 12, 395-399. Gabler Wirtschafts-Lexikon (1998). Wiesbaden, CD-ROM Grammes, Tilman (1998): Kommunikative Fachdidaktik. Politik, Geschichte, Recht, Wirtschaft. Opladen. Gruschka, Andreas (1997): Keine Angst vor dem Neuen. Es ist das Alte! Zur Diskussion über Management in der Sozialpädagogik. In: Welt des Kindes (1997) 2, 6-11. 18 Hepting, Roland; Rückert, Gabriele (1997): Welche Erwartungen haben Eltern an die /ihre Schule? Ergebnisse einer Elternbefragung an der Realschule im Bildungszentrum Marktdorf. In: Lehren und lernen 23 (1997) 6, 31-39. Hilgermann, Norbert; Laufenberg, Hans; Pfeifer, Tilo (1997): Qualitätsmanagement. Ein Konzept zur Verbesserung der Bildungs- und Erziehungsprozesse in berufsbildenden Schulen. In: Die Berufsbildende Schule 49 (1997) 1, 8-11. Hopfenbeck, Waldemar (1998): Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre. Das Unternehmen im Spannungsfeld zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen. Landsberg/Lech, 12. Aufl. Hufer, Klaus-Peter (1998): Vom Bildungsziel zum Kostendeckungsgrad. Politische Bildung auf dem „Weiterbildungsmarkt“. In: Kursiv 2 (1998) 1, 28-32. Langowski, Gabriele (1989): Kundenorientierter Deutschunterricht. In: Wirtschaft und Erziehung 41 (1989) 7-8, 247-249. Lorbeer. Dietrich Andreas (1998): Wenn Schülerinnen und Schüler zu „Kunden“ werden. Kann ein betriebswirtschaftliches Konzept Impulse zur Unterrichtsverbesserung geben? In: Didaktik der Berufs- und Arbeitswelt – Gießener Hefte zur Arbeitslehre 17 (1998) 2-3, 5866. Lütje, Gudrun (1997): Die Bedeutung des ISO 9000 als Instrument der Qualitätssicherung in der Weiterbildung unter fachdidaktischer Perspektive. In: Wirtschaft und Erziehung 49 (1997) 7/8, 228-232. Meffert, Heribert (1995): Marketing-Wissenschaft. In: Tietz/Köhler/Zentes, 1668-1682. Meyer, Anton; Oevermann, Dirk (1995): Kundenbindung. In: Tietz/Köhler/Zentes, 13401351. Osswald, Elmar (1995): Stilwandel. Weg zur Schule der Zukunft. Basel. Qualitätsmanagement in Berufsbildenden Schulen (QuiBS) (1997): 2. Zwischenbericht zum Projekt “Untersuchung von Ansätzen zur Optimierung und Flexibilisierung des Systems Berufsschule vor dem Hintergrund strukturellen Wandels“. Aachen, Geilenkirchen, Köln. Reuther, Ursula; Weiss, Reinhold; Winkels, Sylvia (1996): Kundenorientierung in der Weiterbildung. Neue Formen der Kooperation zwischen Betrieben und Bildungsanbietern (Kölner Texte und Thesen; 30). Köln. Sander, Wolfgang (1998): Von der Teilnehmer- zur Kundenorientierung? In: Kursiv 2 (1998) 1, 33-35. Tietz, Bruno; Köhler, Richard; Zentes, Joachim (Hg.) (1995): Handwörterbuch des Marketing (Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre; IV). Stuttgart: 2. Aufl. Timmermann, Dieter (1996): Qualitätsmanagement an Schulen. In: Wirtschaft und Erzi ehung 48 (1996) 10, 327-333. Weiss, Reinhold (1996): Kundenorientierung in der beruflichen Weiterbildung. In: Info rmationen zur beruflichen Bildung 1996, Reg. 6, Bl. 42. Willke, Helmut(1998): Organisierte Wissensarbeit. In: Zeitschrift für Soziologie 27 (1998) 3, 161-177. 19 Anmerkungen (1) Unternehmen und andere Organisationen können ihre Qualitätssicherungssysteme als den Anforderungen der DIN ISO 9000, einer internationalen Norm für Qualitätsmanagementsysteme, entsprechend zertifizieren lassen. In manchen Industriebranchen wurde die Zertifizierung faktisch obligatorisch, weil mächtige Einkäufer sie von ihren Lieferanten verlangten (Hopfenbeck 1998, 534). (2) Dafür wird schon das ökonomische Interesse der Konzeptionsanbieter an Hochschulen und in Beratungsunternehmen sorgen. (3) „Da ähnlich wie in der Privatwirtschaft aber nur solche Unternehmen erfolgreich sein können, die den Nutzen ihrer Kunden in den Blick nehmen, ist es auch für Lehrer unabdingbar, den Unterricht auf ihre ‚Kunden‘ auszurichten. ‚Primäre Kunden‘ des Lehrers sind dabei die Schüler.“ (Lorbeer 1998, 66). (4) Hier wäre allerdings genau zu prüfen, ob dies Merkmal für Schulen uneingeschränkt und wesentlich zutrifft; schließlich sind sie zumindest auf der Ebene von Unterricht sehr stark von kollegialen Elementen und professioneller Tätigkeit geprägt. (5) Ganz anders ist die Lage im Einzelhandelsmarketing und seinen Vulgärformen. Hier wird eine schier unüberschaubare Vielfalt von Kundentypologisierungen angeboten, allerdings ebenfalls ohne eine grundsätzliche Klärung des Kundenbegriffes und des Kundenverhältnisses. (6) Jedenfalls gegenüber dem Herstellerunternehmen, vielleicht weniger gegenüber dem Einzelhandelsunternehmen. Interessanterweise ist gerade die individualistische Isolierung der Kunden die Voraussetzung dieser Machtlosigkeit, die sie brechen könnten, (könnten und) würden sie kollektiv politisch handeln. (7) [entfällt] (8) Das verwundert kaum, sind doch die Unternehmen – zumindest in der Drittmittelforschung – die dominierenden Kunden der Marketingwissenschaft; insofern ist diese „Unternehmensorientierung“ eine Form der Kundenorientierung in dieser Wirtschaftswissenschaft. (9) Auch hier gibt es Kontroversen, wer als „Endverbraucher“ politischer Bildung gelten soll: der Lernende selbst, weiterführende Schulen, Hochschulen, Ausbildungsbetriebe, Arbeitgeber, Staat, Gesellschaft ... (10) Wobei, wie erwähnt, noch völlig ungeklärt ist, wer genau darunter verstanden werden soll. (11) Die Ersatzprobe beweist die semantische Austauschbarkeit von Teilnehmerorientierung und Kundenorientierung in vielen Beiträgen, z. B. „Kundenorientierung heißt im Kern: von der Situation, den Bedürfnissen, Interessen und Problemen der Adressaten her zu denken“ (Sander 1998, 34), ist ohne Bedeutungsverlust ersetzbar durch „Teilnehmerorientierung heißt im Kern: von der ...“. Allerdings unterscheiden sich beide Begriffe erheblich in ihren Konnotationen. (12) Oft schwingt die, für den ökonomischen Kundenbegriff typische, individualistische Beliebigkeit der „Bedürfnisse“ mit; z. B. „Den Nutzen können letztlich nur die Adressaten für sich definieren, und politische Bildung muss die entsprechenden Bedürfnisse aufspüren.“ (Sander 1998, 34). Eine Gegenposition lautet: „Kundenforderungen müssen mit den Zielen von Schule vereinbar sein.“ (Bezirksregierung Köln 1996, 92). 20 (13) Sie verdanken sich übrigens im wesentlichen einer marktförmigen Organisation des wissenschaftlichen Publikationswesens. (14) Vgl. den einführenden Überblick zur organisierter Wissensarbeit bei Willke 1998. M. E. besteht das zentrale Problem darin, dass es nicht oder kaum gelingt, individuelles Wissen von Lehrerinnen und Lehrern über ihre Unterrichtsarbeit erstens zu artikulieren, zweitens zu verbreiten und drittens in systemisch organisierten Prozessen zu speichern und anzuwenden (vgl. Willke 1998, 165 f.). Eine Ursache dafür ist der vorherrschende professionelle Individualismus und die zwanghafte Vorstellung, Unterrichtsstunden zu „klassischen“ Themen immer wieder neu erfinden zu müssen (vgl. auch Grammes 1998, 90 f., 803 f.). Ein Beispiel für eine netzwerkartige Organisation der Konstruktion, Anwendung und Evaluation (fach-)didaktischen Wissens geben Berg/Schulze (1995) mit dem „Marburger Lehrkunstensemble und seinen Gästen“. (15) Nur die Ausprägungen Entgeltpflichtigkeit und Entgeltfreiheit sind formal binär, material aber wohl eher ordinal zu interpretieren.