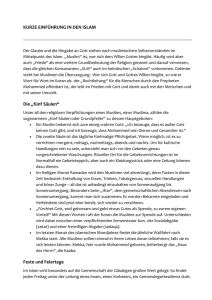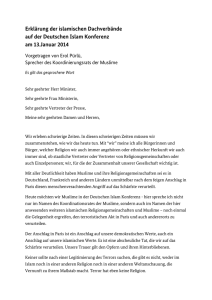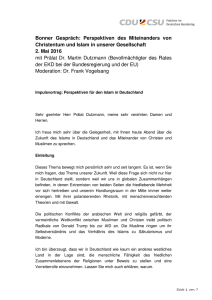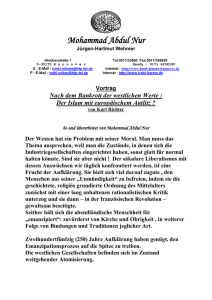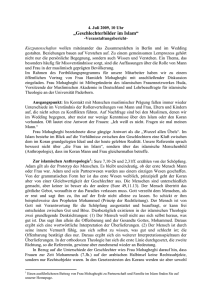ZIP
Werbung

Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ULRICH REBSTOCK Zwischen Toleranzzwang und Anpassungswillen Vortrag an der Volkshochschule Kirchheim am Neckar, 12.4.2011 Zwischen Toleranzzwang und Anpassungsunwillen Ulrich Rebstock [VHS Kirchheim/N 12/4/2011] Vor vier Wochen tönten in den Straßburger Stadtteilen Hautepierre und Cronenbourg – ausgerechnet dort, wo die berühmte gleichnamige Brauerei ihr Bier braut - am frühen Morgen lautstark die Gebetsrufe eines Muezzin. Die Moschee bzw. das Minarett, von dem herunter der Muezzin hätte rufen können, gibt es aber noch gar nicht. Sie soll – so die Planung – erst gegen Ende des Jahres eingeweiht werden. Dafür aber war da ein Lautsprecherwagen des rechtsradikalen Front National und Alsace d’abord: Mit dieser Geräuschkulisse wollten sie Wahlkampf treiben für die Wahl der elsässer Generalräte. Wir alle wissen, daß diese Straßburger Szene kein Einzelfall ist, zumindest was ihre Stoßrichtung anbelangt, die den Gebetsruf zum Lärm erklärt. Sie sagt unmißverständlich: Wir wollen diesen Lärm nicht“ und sie propagiert damit gleichzeitig und kompromißlos: „Wir wollen diejenigen nicht, die diesen Lärm verursachen und ihn dazu noch täglich 5 mal hören wollen“. Sie operiert mit der Gleichsetzung des befremdlichen Lärms mit der gesamten Religion, zu der er aufruft bzw. mit den Menschen, die sich von ihm zum Beten aufrufen lassen. In Straßburg war diese Strategie erfolgreich: 12 % wählten den Front National, der zudem noch 2 Direktmandate gewann. In dieser Inszenierung hat Toleranz keinen Platz. Toleranz, das wird an dieser Stelle klar, wird erst dann zu einem Problem, wenn man sie braucht, wenn sich also eine Situation ergibt, in der Verschiedenes nicht nur nebeneinander koexistiert, sondern wenn sich aufgrund unterschiedlichster Anlässe die Existenz eines Anderen, eines bisweilen sogar fremden Anderen, durch dieses Anderssein ins öffentliche Bewußtsein schiebt. Genauer: Wenn es dorthin geschoben wird! Denn tatsächlich koexistiert dieser Andere ja schon lange vorher. Er taucht nicht plötzlich und so massiv auf, daß man nun ganz überraschend Toleranz benötigt, um mit ihm koexistieren zu können. Vielmehr sind es recht genau beschreibbare Umstände und bestimmte Milieus, die dafür sorgen, daß der Andere überhaupt zum Toleranzproblem wird. Der Historiker Ulrich Herbert beschrieb vor kurzem in einem Zeit-Artikel [Die Zeit 10.2.11], wie sich in Deutschland alle 6 bis 7 Jahre die Integrationsdebatte wiederholte. Meist, so Herbert, geschah dies in direktem Zusammenhang mit wirtschaftlichen Krisenzeiten, so 1966-7 und 1973, während der Ölkrise, dann wieder Ende der 70er, als die Arbeitslosenzahlen zu steigen beginnen; hier liegt der Anfang der deutschen Fremdenfeindlichkeit unter dem Begriff des „Ausländerproblems.“ Max Frisch formulierte den Grund dafür so: „Wir riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen.“ In den 80er Jahren wird dies dann zum „Türkenproblem“; nach dem 11. Sept. 2001 wird dann der Türke zum Muslim, und heute ist vielerorts der Muslim wieder umgekehrt und pauschal zum Türken geworden. Von dieser paradoxen Islamisierung der Türken – wie sie der französische Soziologe Emmanuel Todd herausgearbeitet hat - habe ich ja letztes Jahr schon gesprochen. [Zitat des franz. Sozialanthropologen Emmanuel Todd aus einem Interview mit Veronika Kabis, TAZ 19.8.2002] Kurz: Wir problematisieren den muslimischen Anderen in Abhängigkeit von der Konjunkturentwicklung und je nach dem, ob, wann und wie er sich zur politischen Instrumentalisierung eignet. Dazu nur einige Stichproben, aus der jüngsten Vergangenheit: Schon im Jahre 2005 forderte Marieluise Beck, die ehemalige „Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration“, die [Zitat] „Einbürgerung des Islam“. Wolfgang Schäuble verkündete dann 2006 – und letzten Monat - erneut: „Der Islam ist ein Teil von Deutschland.“ Im Herbst 2010 wiederholte der Bundespräsident Christian Wulff exakt den gleichen Satz. Zuvor, im Juni 2010, hatte auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel gefunden, daß [Zitat] „Thilo Sarrazins Buch [ist] nicht hilfreich“ sei. Doch schon einen Monat später verkündete sie laut und unmißverständlich: [Zitat] „Multikulti ist tot“. Mehr noch: Am 15.11.10, auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe, forderte sie: [Zitat] „Keine Zuwanderung in soziale Sicherungssysteme“, und: [Zitat]„ein christliches Menschenbild“ als Integrationsziel. Peter Friedrich, der neue Bundesinnenminister, legte im Febr. 2011 und – man glaubt es kaum – bei der Eröffnung der Islamkonferenz vor 14 Tagen nach: [Zitat] „Der Islam gehört nicht zu Deutschland.“ Gleichzeitig aber spricht Maria Böhmer, die Integrationsbeauftragte derselben Bundesregierung 2011, in Bezug auf die Muslime in Deutschland von „Miteinander“ und von „Fördern und fordern“. Es hat den Anschein, als ob, zumindest im Bereich der konservativen Politik, Konfusion herrscht: Einwanderung darf es schon geben – nach BW müssten jährlich 25.000 Fremde einwandern, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten - ja muß es vielleicht sogar geben, aber bitte keine Türken. Und wenn schon Türken, dann aber bitte keine Muslime. Und was, möchte man fragen, sollen nun die 3 ½ Mio. türkischen und die halbe Mio. anderer Muslime, die schon hier sind, tun? Sich in Luft auflösen? Und wie steht es mit dem Merkel’schen „Menschenbild“ etwa bei den Atheisten, von denen es in Deutschland mindestens ebenso viele gibt wie Katholiken? Muß das Menschenbild dieser Atheisten ebenfalls christianisiert werden? Wie steht es mit der halben Mio. Aleviten, die um die Einrichtung eines TheologieLehrstuhls in Deutschland ersuchen, da – so ihr Sprecher Kaplan – ihre Verfolgung im islamischen Raum es bisher notwendig gemacht hat, die Lehre nur im Verborgenen heimlich und mündlich zu tradieren? Und warum sind, auf der anderen Seite, die Zeugen Jehovas in 2 12 Bundesländern eine Körperschaft öffentlichen Rechts, nur nicht in Rheinland-Pfalz und bei uns in BW? Bei all diesen Fragen ist Religion im Spiel, und zwar in beiden Richtungen: Religion ist zugleich ein, ja oft der Grund für die Aufforderung zur „Integration“, etwa wenn die Gefahr beschworen wird, die unserem christlich-abendländischen Welt- und Menschenbild von unseren muslimischen Mitbürgern droht. Religion ist aber auch Integrationshemmnis. Schon der Soziologe Emile Durkheim hatte erkannt, daß eine Glaubensbezeugung in und zu einem Glaubenssystem gleichzeitig auch eine Solidaritätserklärung mit einer sozialen Gruppe bedeutet. Ich habe im vergangenen Jahr hier ja ganz besonders auf diese spezifisch islamische kollektive Identität hingewiesen, die sich aus den überwiegend gemeinschaftlichen Glaubensakten ergibt. Eine Befragung in Berlin-Moabit hat aber auch gezeigt, daß dort Menschen täglich in 16 verschiedenen Sprachen 300 verschiedene Gebete beten! Und dennoch reduzieren wir die Integrationsdebatte auf die Muslime, ja mehr noch, wir blenden nicht nur die verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen aus, wir schnüren den Problemgegenstand dazu noch selektiv und mit voller Absicht als Paketlösung: in Gestalt des türkischen Muslim oder des muslimischen Türken. Halten wir hier kurz inne! Wir wissen längst, daß wir in einer Gesellschaft leben, in der der Islam – ob mit oder ohne Moschee – eine gelebte Realität ist. Wir wissen auch, daß bei einem muslimischen Anteil von etwas über 4% an der Gesamtbevölkerung Deutschlands von einer islamischen Parallelgesellschaft nur deshalb gesprochen wird, weil sich das Thema zur politischen Instrumentalisierung eignet. Wir ahnen, daß die – laut BKA im Oktober 2010 gezählten - 129 aktiv zu Anschlägen bereiten Muslimen von 4 Mio. Muslimen in Deutschland nicht ausreichen, den Islam als terrorfördernde Religion zu kategorisieren. Wir ahnen auch, daß die Erregung, mit der wir ein so harmloses Identitätsmerkmal wie das Kopftuch beurteilen und zu einem erbitterten Glaubensstreit benützen – wie vor mehr als einem halben Jahrhundert der Streit um Bikini und Minirock – daß dieser Streit die skurrilen Züge einer Hysterie um ein Stück Stoff trägt. Und wir müssen letztlich dem türkischen Botschafter in Wien Recht geben, der dort am 12.11.2010 trocken bemerkte: : „Wenn man hier nackt baden kann, dann sollte man auch ein Kopftuch aufsetzen dürfen“. Und er setzte hinzu, daß nicht die „Türken vor Wien“ stünden, sondern längst in Wien, und daß man diesen, da ihnen nur bestimmte Wohngebiete zugewiesen würden, auch noch vorhält, sich nicht zu integrieren. Damit sind wir beim „Integrationsverweigerer“, dem 2. Unwort des Jahres 2010. Das Wort wird deshalb zum Unwort, weil der so Bezeichnete alleine für seine NichtIntegration verantwortlich gemacht wird. Integration aber bedeutet Eingliederung, was heißt, daß man zur Seite rücken und Platz anbieten muß, daß Freiräume eingeräumt werden, in Form rechtlicher und sozialer Angebote an die religiöse Gastgemeinschaft. Ohne diese 3 Angebote müssen selbst „integrationswillige“ andersgläubige Migranten ihren eigenen Instanzen treu und damit denjenigen, die ihre Integration fordern, fremd bleiben. In dieser Art bewegungsloser Koexistenz regelt die sog. duldende Toleranz das Nebeneinander. Schon Goethe erkannte die Zweideutigkeit dieser Art Toleranz: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muß zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ Mit dieser duldenden Toleranz setzt der gastgebende Staat die Normen für Recht, Moral und Religion und zwingt den Zuwanderer, den Teil seiner Identität, die außerhalb dieser Normbreite liegt, abzulegen und zu verleugnen. Duldende Toleranz produziert somit die Koexistenz von kulturellen und religiösen Milieus, die sich nicht berühren, die nichts voneinander wissen und auch nichts voneinander wissen wollen, die sich folglich nur aus gegenseitiger Ignoranz tolerieren. Der Schritt, so wie Goethe ihn fordert, von der Duldung zur Anerkennung, ist jedoch größer als es scheint. Denn es geht um mehr als das Menschenrecht auf Glaubens- und Religionsfreiheit. Religiöse Toleranz wird vom Staat oder der dominierenden Religion anderen, minoritären Religionen eingeräumt. Probleme treten dann auf, wenn die so erzwungene Gemeinschaft der religiösen Milieus die Solidarität der Gemeinschaft in Frage stellt. Toleranz wird also hier zum Kompromiss zwischen widerstreitenden Positionen. Religionen sind nämlich, entgegen der von vielen vertretenen Meinung, weder friedlich noch tolerant, vielmehr mußte ihnen überall und immer wieder Toleranz abgerungen werden. Vor der Reformation etwa neigte das Christentum eher zur Intoleranz. So lautete einer der Slogans der Inquisition: „Keine Freiheit für den Irrtum!“. Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit in Glaubensfragen überlebte annähernd 2 Jahrtausende. Auch bei den Orthodoxen und den Bahai, einer Abspaltung des iranischen Islam, wird der Kirche Unfehlbarkeit zugeschrieben. Von der duldenden wird die anerkennende Toleranz unterschieden. Die anerkennende Toleranz beruht auf der prinzipiellen Ansicht, daß man sich irren und der Andere Recht haben kann. In Europa erzwangen besonders die blutigen Glaubenskriege im 16. und 17. Jh. und die sie überwindende Aufklärung die anerkennende religiöse Toleranz. Glauben kann ja kein Gegenstand von Zwangsgesetzen sein. Rechtsverbindlich machen kann man nur etwas, was man nicht glauben muß, sondern wissenschaftlich nachweisen kann. So weit, so gut. Was aber, wenn der Mensch nicht nur aus Vernunft besteht, sondern auch oder sogar vielmehr von Glauben oder Trieben gesteuert ist? Wenn er etwa an die komplizierte Dreieinigkeit und märchenhafte unbefleckte Empfängnis glaubt, oder aber an die unmittelbar göttliche und unveränderliche ewige Sprache des arabischen Korans? Dieser nichtwissenschaftliche Glaubensbereich mußte zur Privatsache erklärt und der Staat somit säkularisiert werden. Allerdings mußte der Staat dann dafür sorgen, daß auch verschiedene 4 Auffassungen toleriert wurden, daß sich der Einzelne auf Fragen wie „wie soll ich leben, was darf ich tun, was nicht?“ die individuellen Antworten geben konnte, die ihm das von seiner Religion versprochene Heil sicherten. Solange es sich bei diesen abweichenden Haltungen zu Grundsätzen und Glaubensfragen nur um Ideelles, um Fragen und Antworten handelt, ist anerkennende Toleranz unkompliziert. Was aber, wenn diese Fragen und Antworten zu unterschiedlichen Taten führen, wenn die heilsversprechende Befolgung von Glaubensgrundsätzen zu Handlungen führt, die die Glaubensgrundsätze Anderer tangieren oder gar einschränken und verletzen? Wenn etwa in der Bibel ein Satz stünde, von dem man ableiten könnte, daß kein Minarett höher als ein Kirchturm, kein Muezzin lauter als Kirchenglocken sein darf? Dann müßte auf das allgemeine Gleichheitsrecht in den allgemeinen Menschenrechten von 1948 und in unser Grundgesetz geschaut werden. Dieses Gleichheitsrecht enthält den Anspruch, jeden Einzelnen entsprechend eines konkreten und für einen bestimmten Rechtsbereich spezifischen Maßstabs der Gerechtigkeit zu behandeln. Der Anspruch versucht, auf eine zentrale Frage eine allgemeingültige, den Menschenrechten genügende Antwort zu finden: „Dürfen wir bei der Partizipation an gesellschaftlichen Vorteilen und Lasten aus unserem Sosein einen Nachteil haben?“ Und weiter, in Bezug auf unsere Handlungen : „Müssen wir für das Verantwortung tragen, was wir tun, nicht aber für das, was wir sind – vor allem aber, wenn wir nicht vermeiden können, dies zu sein, also so zu sein, wie wir sind?“ In diesen beiden Fragen wird ganz konkret davon ausgegangen, daß wir immer, zumindest ein Stück weit, auch das sind, was wir glauben. Können wir nun vermeiden, das zu glauben, was wir glauben? Um damit unser Sosein so zu ändern, daß es den Ansprüchen der Anderen genügt? Also: Muß ein Muslim in Deutschland deshalb, weil er nicht an den dreieinigen Gott, sondern an den einen Gott (allāhu wāhid und unten das Pancasila-Prinzip) glaubt, für sein Sosein bzw. Soglauben Nachteile in Kauf nehmen? Die Antwort ist ein deutliches Nein. In mehreren Urteilen zog sich das BVG auf den Grundsatz zurück, daß es untersagt ist, Gleiches ungleich – also etwa Christen nicht wie Muslime - und Ungleiches gleich – also etwa Verfassungstreue so wie Glaubensprinzipien - zu behandeln. In diesem Grundsatz ist das Konzept der komplexen Gleichheit enthalten. Komplexe Gleichheit bedeutet, daß es unter Gleichen Verschiedenheit geben kann. Das Konzept wehrt ab, daß sich der Andere gnadenlos anzupassen hat, und es stärkt zugleich die Verantwortung für das eigene Sosein. Diese Erkenntnis und Verantwortung für sich selbst ist nämlich eine Voraussetzung dafür, daß man sich auch anpassen kann. Dadurch, daß man sich des eigenen Soseins vergewissert, daß man sich klar macht, was der eigenen Identität notwendig angehört und was nicht, entstehen Spielräume der religiösen Koexistenz. Wir haben ja, zumindest was die muslimische Seite anbelangt, letztes Jahr davon gehört, was für eine islamische Identität prägend und unverzichtbar ist. 5 Wir befinden uns hier an der Nahtstelle des sog. interreligiösen Dialogs – auf den ich aber ganz bewußt nicht weiter eingehe. Dafür aber darauf, daß im Konzept der komplexen Gleichheit der Blick auf den Anderen unerläßlich ist, darauf, daß für die Befähigung zur Anpassung der Blick in beide Richtungen zu gehen hat – was oft von denen, die religiöse Kritik zum Tabu erklären, unterschlagen wird. Wenden wir uns deshalb nun der anderen Blickrichtung zu: Wie steht es denn mit der islamischen Glaubens- und Religionsfreiheit? Wie gleich ist denn Ungleiches im Koran und im islamischen Recht behandelt? Ich stelle diese Fragen aber nicht, um mit den Antworten darauf die populistische Moralmaxime „wie Du mir so ich Dir“ zu befeuern. Es geht mir vielmehr darum, das Toleranzmilieu zu skizzieren, in dem die Muslime mit innerislamischen und außerislamischen religiösen Abweichungen umgingen. Aus den Spielräumen, die sich aufbauend auf den historischen und gegenwärtigen Erfahrungen mit religiöser Toleranz gebildet haben, läßt sich nämlich ein Rahmen abstecken, innerhalb dessen eine muslimisch-christliche Koexistenz – unter welchen Mehrheitsvorzeichen auch immer – möglich ist. Beginnen wir mit dem Koran: Neben den rechtgläubigen Muslimen gibt es dort eine Vielzahl von Bezeichnungen für nicht rechtgläubige Muslime (etwa Heuchler, Frevler, Sünder), für andersgläubige Monotheisten (wie Schriftbesitzer, Nazaräer = Christen, Juden), für Polytheisten (Götzendiener, Magier) oder einfach für Ungläubige, Heiden. Ihre Behandlung und Bewertung fällt sehr unterschiedlich aus. So gibt es Verse, die durchaus Raum für duldende und darüber hinaus auch für anerkennende Toleranz zulassen. Etwa Sure (der Tisch/al-mā’ida) 5, Vers 48: „Für jeden von euch haben wir eine Richtung festgelegt. Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. (...) So eilt mit den guten Dingen um die Wette. Zu Gott werdet ihr allesamt zurückkehren, dann wird Er euch kundtun, worüber ihr euch uneins wart.“ Auch die Verschiedenheit der Menschen, ihrer Sprachen, Farben und Arten, die als Geschenk Gottes bewertet werden, wird mehrfach angesprochen (z.B. 30:22). Schon weniger entgegenkommend, bestenfalls noch duldend, lautet Vers 6 von Sure 109 (die Ungläubigen/al-kafirun): „Ihr habt eure Religion, ich die meine.“ Die Sure stammt aus der späten mekkanischen Zeit und zieht eine lapidare Trennung zwischen den Muslimen in Mekka und denen dort, die sich Muhammads Prophetie verweigerten. Andere Exegeten dagegen meinen, daß dieser brüske Vers aus den Anfängen der Zeit in Medina stammt, als Muhammad mit den Juden und Christen bricht. Als generelles Verbot von Glaubensbeschränkung wird meist die Sure 2 (die Kuh/al-baqara), Vers 256 zitiert: „Kein Zwang in der Religion“. Auf der anderen Seite lassen sich aber auch zahlreiche Verse finden, die verschiedene Grade der Intoleranz vorschreiben. So etwa Sure 9 (die Sühne/at- 6 tauba), Vers 29: „Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben und nicht der Religion der Wahrheit angehören.“ Andere Verse (3:28, 5:51/57 etc.) fordern Muslime auf, sich keine Freunde von den Juden und Christen zu nehmen. Eine differenzierte Haltung dazu nehmen die Verse 8-9 aus Sure 60 (die Prüfung/al-mumtahina) ein: „Gott verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, Pietät zu zeigen und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Gott liebt ja die, die gerecht handeln. Er verbietet euch die, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Freunden zu nehmen. Diejenigen, die sie zu Freunden nehmen, das sind die, die Unrecht tun.“ Diese Verse sind ein eindeutiges Bekenntnis zur religiösen Koexistenz mit weitreichender duldender Toleranz: Von Pietät und gerechter Behandlung ist die Rede. Aus den Versen läßt sich der Gedanke einer von Gott gewollten religiösen Pluralität ableiten. Diese tolerierte Pluralität wurde islamrechtlich früh verankert und lange praktiziert. In diesem Zusammenhang wird oft von den Jahrhunderten friedlicher Koexistenz christlicher und jüdischer Gemeinden mit den andalusischen Muslimen gesprochen. Doch auch andere, gegenteilige Beispiele lassen sich aus der reichen islamischen Geschichte interreligiöser Koexistenzen anführen. So etwa der sog. ´Umar-Pakt, der im 8. Jh. den orientalischen Christen aufgedrängt wurde: Er verbot den Christen, später auch anderen religiösen Minderheiten, die Kleidung oder Haartracht der Muslime zu tragen, Pferde zu reiten und Muslimen den Weg zu versperren. [Mark R. Cohen: “What was the Pact of ‘Umar?” In: Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23/1999/100-157] Der vollen Anerkennung anderer Religionen standen und stehen immer noch religiöse Vorbehalte entgegen. So wird in Sure 2 Vers 221 den Muslimen die Heirat von Polytheistinnen untersagt. Da nun der Hinduismus, anders als zumeist der Buddhismus, als polytheistische Religion klassifiziert wurde, konnten Muslime keine Hindufrauen heiraten – eine Vorschrift, die jedoch zumindest in der Blütezeit des Moghulreiches in Indien außer Kraft gesetzt wurde. Heute ist fast überall der Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung verankert. Da aber der Islam ebenfalls fast überall Staatsreligion ist und dazu die Scharia die, oder zumindest eine Grundlage von Gesetzgebung und Rechtsprechung ist, genießen zwar nicht-muslimische Gemeinschaften unterschiedlich weit gehende Autonomie in Familienrecht, Bildung und Erziehung, wie auch in Wohlfahrt und Sozialfürsorge. Dennoch blieb die formalrechtliche Gleichstellung von Muslimen und Nicht-Muslimen im Osmanischen Reich ab 1856, im Zuge der Tanzimatreformen, eine kurzfristige Ausnahme. Zumindest auf dem Papier garantieren dagegen alle europäischen Verfassungen die freie Religionsausübung und gleichzeitig auch 7 – was meist nicht ganz widerspruchsfrei geht – die Wahrung der menschlichen Würde, unabhängig vom Glaubensbekenntnis, also für Mann wie Frau, und (!)- ob christlich oder muslimisch. Heute beobachten wir in den sog. islamischen Ländern eine weit auseinanderklaffende Rechtspraxis. So ist in Indonesien (gemäß der Pancasila-Lehre: Glaube an den All-Einen Gott; 5 [Sanskrit: pantcha] Prinzipien [sīla], Muslime rückten 1945 dieses ursprünglich 5. an den Anfang) allen monotheistischen Religionen Gleichstellung eingeräumt. Am anderen Ende der Bandbreite befindet sich Saudi-Arabien, das sämtlichen Nicht-Muslimen und allen von der Wahhābiya, von der dort herrschenden islamischen Glaubensrichtung abweichenden Muslimen (auch Schiiten) die freie Religionsausübung verwehrt. In Libanon, Jordanien und Iran gilt ein offizielles Proporzsystem für öffentliche Ämter, in Ägypten – bisher (!) - ein inoffizielles. Bezüglich der Religionszugehörigkeit spricht man hier von einer sog. negativen Religionsfreiheit. Die Aufrechterhaltung dieser „negativen“ Religionsfreiheit, also einer Freiheit, die nicht durch Verwehrung der Gleichheit eingeschränkt wird, treibt manchmal seltsame Blüten: Ägypten, das für ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht eine nachweisliche Religionszugehörigkeit verlangt, hatte über lange Jahre hinweg 2 Außenminister – zum einen Butros Ghali, der ehemalige UN-Generalsekretär, der Christ ist und mit einer Jüdin verheiratet ist, für die nicht-islamischen Länder, und daneben einen zweiten muslimischen Außenminister für die islamischen Länder. Doch nicht nur die formalrechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung anderer Religionen muß als Indikator dafür gewertet werden, wie die islamische Geschichte mit der interreligiösen anerkennenden Toleranz umging. Es gibt auch ein weitreichendes innerislamisches Problem mit der Religionsfreiheit. Als gravierendste Einschränkung der Religionsfreiheit für die Muslime selbst gilt das sog. Apostasieverbot. Im Koran wird Apostasie, Abfall vom Islam und Übertritt zu einer anderen Religion (ridda) verurteilt, nicht aber mit weltlicher Strafe sanktioniert. [Dazu Armin Hasemann: „Zur Apostasiediskussion im modernen Ägypten.“ WdI 42/2002/73-121]. Zu dieser Rechtsfigur gehört auch die des takfīr, was bedeutet - Sie erinnern sich vielleicht ? – „jemanden zum Ungläubigen erklären“. Beide Figuren sind Zeugen der innerislamischen Intoleranz, der innerislamischen Rechtsbeschränkung der Religions- und Glaubensfreiheit. Seit dem spektakulären Fall von Salman Rushdie, der 1989 wegen seines Buches über den Propheten Muhammad durch ein Fatwā des Glaubensabfalls bezichtigt und folgerichtig zum Ungläubigen erklärt wurde, erlebten diese beiden alten islamischen Rechtsinstrument eine regelrechte Renaissance. Vier Jahre zuvor, 1985, war der sudanesische islamische Reformer Mahmūd Muhammad Tāhā nach einem Schauprozess der Apostasie für schuldig befunden und in Khartoum hingerichtet worden. Bis heute muß die Bestrafung dieses Kapitalverbrechen in vielen 8 islamischen Ländern jedoch zwischen Politik und Religion schlicht ausgehandelt werden. Denn so wie es weder für Apostasie noch für Unglauben ein koranisches weltliches Strafmaß gibt, so gibt es tatsächlich kein einziges Verbrechen, für welches im Koran explizit und alternativlos die Todesstrafe vorgesehen wäre. Dies gilt auch für die Gotteslästerung, als welche die dänischen Muhammad-Karikaturen betrachtet wurden. Auch in den Hadīthsammlungen, den als authentisch eingestuften Sammlungen der Äußerungen des Propheten Muhammad, gibt es keinen sicheren Nachweis für die Todesstrafe für diese Delikte. Man muß sogar noch weiter gehen: Es gibt nämlich ebensowenig eine präzise und einheitliche Definition dessen, was denn Apostasie und kufr (Unglauben) genau genommen ist, wo sie beginnen und wo enden. Sind sie auf Taten begrenzt, oder können sie sogar schon in Gedanken begangen werden? Wir sind hier wieder bei der nicht erzwingbaren Gläubig- oder gar Rechtgläubigkeit. Man könnte nun also schließen, daß die islamische Rechtspraxis seit Anbeginn ihrer Geschichte sich mit der Todesstrafe einer Auslegung ihrer Rechtsquellen bediente, die man durchaus als willkürlich und utilitaristisch, also letztendlich zweckdienlich bezeichnen kann. Doch auch dagegen erhoben sich immer wieder Stimmen. So erkannte schon ein iranischer Gelehrter und Mystiker aus dem 10. Jahrhundert, Abū Haiyān at-Tauhīdī, die Möglichkeit, mit diesen beiden Rechtsfiguren religiöse Intoleranz zu rechtfertigen: „Viele Theologen sind, wie ich sehe, schnell bei der Hand damit, Glaubensbrüder wegen einer nebensächlichen Abweichung in irgendeinem Detail der Offenbarung für ungläubig zu erklären. Dieses Vorgehen hat meines Erachtens gefährliche Folgen und ist schon im voraus zu tadeln. Denn wie sollte jemand den Rahmen einer Religion verlassen können, wenn diese viele verschiedene Urteile in sich faßt? Man kann sich mit vielen Dingen von ihr schmücken (...) und wenn jemand einem anderen vorhält, ein Ungläubiger zu sein, so ist er selber mit Bezug auf das Anhängen dieses Etiketts auch nicht besser dran.“ [Zitiert nach R. Badry: „Das Instrument der Verketzerung (...)“, in: Thorsten Gerald (Hrsg.): Islamverherrlichung. Wenn die Kritik zum Tabu wird. Wiesbaden 2010, S. 117-129, hier S. 118] Die Ironie der Geschichte wollte es, daß at-Tauhīdī selbst Opfer dieser selbstgerechten und zweckgebundenen Auslegung der Rechtsquellen wurde. Er wurde so heftig angegriffen, daß er am Ende seines Lebens vor den Verleumdungen seiner Gegner kapitulierte und alle seine Schriften verbrannte. at-Tauhīdīs Argument, daß ja die islamische Religion „viele verschiedene Urteile in sich faßt“ und deshalb nicht nur ein Urteil richtig sein muß, korrespondiert mit der korangestützten gottgewollten Pluralität von Religionen, Sprachen und Hautfarben. Dies ist die unbestreitbare Grundlage für eine flexible Auslegung der koranischen und rechtlichen Anweisungen für den 9 Umgang mit Andersgläubigen. Wie offen diese Grundlage für auseinanderdriftende Interpretationen sind, zeigen die jüngsten Entwicklungen im europäischen Islam. So anerkennt Sohaib Bencheikh, der 1961 in Kairo geborene und heute in Paris lebende Gelehrte die Notwendigkeit, den Islam im Lichte der Erfordernisse der französischen Gesellschaft zu reformieren. Er propagiert den Laizismus, d.h. die positive Neutralität des Staates den Gläubigen gegenüber, und die juristische Garantie der freien Glaubensentfaltung. Im Konflikt um das Kopftuch und die Laizität der Gesellschaft bezieht er deutlich Stellung:„Der Schleier der Muslimin in Frankreich ist heute die laizistische, freie und obligatorische Schule“. Daneben gibt es den Schweizer Tāriq Ramadān, den Enkel Hasan al-Bannās, des Begründers der islamistischen Muslimbrüder. Er empfiehlt den europäischen Muslimen, den Mittelweg zu gehen zwischen blinder Nachahmung westlicher Lebensart und dem Vergessen des Islam einerseits und dem ebenso blinden Rückzug auf eine rigide und formalistische Auslegung des Islam andererseits. Ersteres führe zu „Muslimen ohne Islam“, Letzteres zu einem Leben „in Europa außerhalb Europas“. Und eine weitere islamische Reformrichtung muß hier erwähnt werden: die auch in Deutschland immer stärker werdende sufistische Glaubensrichtung des Islam. Ihr Wesensmerkmal ist die Betonung der Liebe zu Gott und seiner Schöpfung. Da sie diese allen Religionen gemeinsame Haltung über die Unterschiede zwischen den einzelnen Religionen stellt, betont die sufistische islam. Glaubensrichtung auf ganz besondere Weise die interreligiöse Toleranz. Lassen Sie mich dazu den 1941 in Anatolien geborenen SufiPrediger Fethullah Gülen zitieren, der mittlerweile an der Spitze einer weltweiten Bewegung steht: „Ganz egal wie die Anhänger solch allgemein anerkannter Werte wie Liebe, Respekt, Toleranz, Vergebung, Frieden, Brüderlichkeit und Freiheit diese Werte in ihr tägliches Leben hineinnehmen – alle diese Werte sind durch Religion ausgezeichnet. Den meisten von ihnen wird in den Botschaften von Moses, Jesus und Muhammad, aber auch denen von Buddha und sogar von Zarathustra, Lao-Tse, Konfuzius und den Hindu-Propheten höchste Priorität zugesprochen.“ [Lester R. Kurtz: „Gülen’s Paradox: (...)“. In: The Muslim World 95/3/2005/333-384, hier 376] Liest man dazu die Islamische Charta, die im Febr. 2002 vom Zentralrat der deutschen Muslime mit 21 Artikeln verabschiedet wurde, so wird sogleich deutlich, wo in der Praxis die Schwierigkeiten liegen. Es gibt in der Charta deutliche Versuche, sich mit dem säkularen Grundgesetz zu arrangieren. In Art. 3 + 4 heißt es jedoch, der „Koran ist unverfälschtes Wort Gottes“. Dies führt letztlich notwendig zur Schlußfolgerung, daß in der jüdischen und christlichen Auslegung der Offenbarung eine Verfälschung der Botschaft Gottes vorliegt. Art. 13 behauptet, daß: „... zwischen den im Koran verankerten Individualrechten und dem Kernbestand der westlichen Menschenrechtserklärung (1948) kein Widerspruch“ bestehe. 10 Was aber ist der „Kernbestand“ und was ist mit den Rechten jenseits dieses „Kernbestandes“? So bejaht Art. 14 zwar den vom Koran ja – wie wir nun wissen erwünschten religiösen Pluralismus und Art. 6 sagt, daß Mann und Frau „die gleiche Lebensaufgabe“ haben, nämlich „Gott zu erkennen, Ihm zu dienen und Seinen Geboten zu folgen“. Was aber hier fehlt ist auch die positive Nennung der einzelnen gleichen Rechte sowie das sie bestimmende Prinzip der Rechtsgleichheit von Mann und Frau. [ausgeschrieben aus Rainer Brunner: „Zwischen Laizismus und Scharia: Muslime in Europa“. In ApuZ 20/2005/8-15]. Auch der Sufi Gülen [a.a.O. 465] tut sich damit schwer. So interpretiert er den Vers 2:282 – wo der Werte eines männlichen Zeugenbeweises zwei weiblichen gleichgesetzt ist – damit, daß er sich nur auf mündliches Zeugnis beziehe und nur in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten. „Ansonsten wird (ich zitiere) von einigen Gelehrten des islamischen Rechts das schriftliche Zeugnis von Frauen, wenn benötigt, als gleichwertig betrachtet.“ Der gemeinsame Nenner aller dieser ganz verschiedenen Ansätze und Bemühungen ist die beidseitige Erkenntnis, daß Toleranz unverzichtbar geworden ist. Betrachtet man diese Ansätze genauer, so fällt dazu auf, wie weit auseinander die verschiedenen Toleranzkonzepte gehen können. Es scheint so, als ob nicht nur unsere gastgebende Gesellschaft, sondern auch die islamische Gastgesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart über ein weitaus größeres und flexibleres Toleranzpotential verfügte als vermutet. Dies gilt es, mit Phantasie, die es aber nicht ohne gegenseitiges Kennenlernen gibt, auszuloten. Wie weit die Vorschläge dabei gehen können, lehrt uns – wieder einmal, nun aber gänzlich unvermutet – Thilo Sarrazin. Er stellte auf einer Tagung des Politischen Clubs vor 14 Tagen in der evangelischen Akademie von Tutzing zu der originellen Frage: „Gehört der Islam zu Deutschland?“ die endgültige Lösung des Integrationsproblems in Aussicht: Diese Probleme würden nämlich automatisch verschwinden, wenn es zu einer „physischen Vermischung“ mit der Aufnahmegesellschaft komme. Dazu paßt, daß der muslimische Tagungsteilnehmer Lale Akgün andererseits darauf bestand, daß der Koran durchaus vorehelichen Sex (und sogar Homosexualität) erlaube. Also: Die Aussichten sind rosig! 11 12