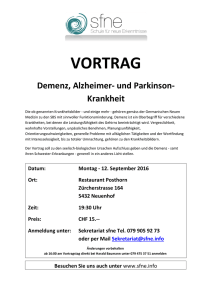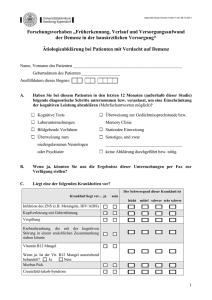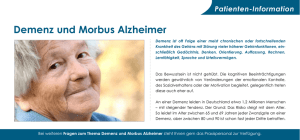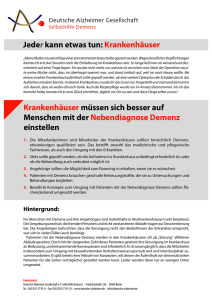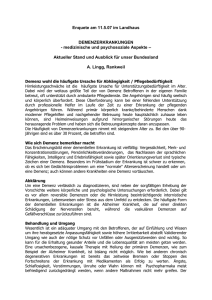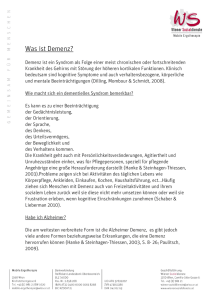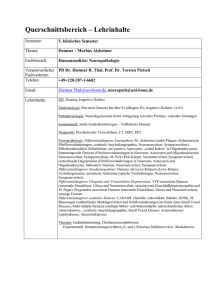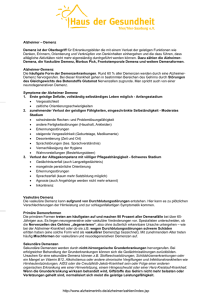Demenz und Wertekultur
Werbung

Demenz und Wertekultur Ethische und zivilgesellschaftliche Perspektiven Fachtagung TERTIANUM Bildungsinstitut ZfP Donnerstag, 28. Januar 2010, Kongresshaus Zürich Pressemitteilung Ralf Baumann 9300 Zeichen (mit Leerzeichen) Die vom Tertianum Bildungsinstitut ZfP veranstaltete Fachtagung „Demenz und Wertekultur“ im Kongresshaus Zürich stiess auf grosse Resonanz. Über 350 Teilnehmer, wollten sich aus erster Hand über ein „zivilgesellschaftliches Thema informieren, welches nicht nur den Fachexperten überlassen werden darf“, wie Tagungsleiter Carsten Niebergall formulierte. Dialog zwischen Ethikern und Praktikern stand im Mittelpunkt der Tagung, um einen nicht-diagnostischen Blickwinkel auf das Thema "Lebensfeld Demenz" zu ermöglichen. "Es geht um die Erfindung neuer Netze der Freundschaft und darum, Menschen mit Demenz vor allem als Mitbürger anzusehen“, betonte Niebergall. Alzheimer und Ich Angesichts von über 100000 Betroffenen und 300000 Angehörigen allein in der Schweiz besteht Diskussionsbedarf, wie ein Leben mit Demenz nach ethischen Gesichtspunkten gestaltet werden kann. Und dabei auf die Betroffenen zu hören. Mit Spannung wurde deshalb das Referat des Psychologen und Demenzaktivisten Richard Taylor aus Texas erwartet, dessen Buch „Alzheimer und Ich“ (Huber Verlag) auch im deutschsprachigen Raum für Aufsehen sorgt. Nachdem vor neun Jahren bei Taylor „eine Demenz, vermutlich Typ Alzheimer“ diagnostiziert wurde, erklärt der 67-Jährige in Büchern, Referaten, Interviews und auf seiner Website (www.richardtaylorphd.com), wie es sich mit „Dr. Alzheimer im Kopf“ lebt. Ohne die Unterstützung durch seine Frau Linda wären öffentliche Auftritte für Taylor nicht mehr möglich. In Zürich berichtete Taylor in seinem berührenden und fesselnden Vortrag, wie es ist, wenn man „auf sein Gedächtnis viel weniger zugreifen kann, wie Sie auf Ihr Gedächtnis“. Taylor stellte in den Mittelpunkt seiner Ausführungen nicht die Probleme, die Menschen mit Demenz ihren Angehörigen, Pflegern und Fachleuten bereiten, sondern einen moralischen Imperativ im Sinne des kategorischen Imperativs, wie er von Immanuel Kant definiert wurde (Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne). „Jeden Tag bin ich dankbar, dass ich nicht der durchschnittliche Demenzkranke bin, denn so einen durchschnittlichen Kranken gibt es gar nicht“, betonte Taylor. Menschen ohne Demenz würden solche Kategorisierungen ausdenken, „damit es einfacher wird uns zu verstehen.“ Doch viel wichtiger sei es, den Demenzkranken nicht als anormal, sondern als Mitmenschen zu sehen – bis zum Tod. „Ich bin keine Hülle, ich werde bis zum Moment meines Todes Richard sein.“ Eine humanisierende Demenzpflege stellt das Individuum nicht den „Durchschnittskranken“ in den Mittelpunkt und soll diesem ermöglichen, im Heute zu leben und sich nicht daran orientieren, „wer ich gestern war“. Der Erfolg einer Pflege bemesse sich nicht daran, wie lange Menschen mit Demenz leben, sondern an der Lebensqualität der Menschen, so Taylor. Und dies gelte nicht nur für Menschen mit Demenzsymptomen. Eine allgemeine Gesundheitsfürsorge für jeden Bürger sei ein moralischer Imperativ, sagte Taylor mit Blick auf die aktuelle Diskussion in den USA über die von Präsident Obama beabsichtige Einführung einer staatlichen Krankenversicherung. Alzheimer als Schreckbild Dass eine solidarische Gesellschaft Alzheimer-Demenz nicht weiter als ein rein medizinisches Phänomen definieren sollte, für dessen Behandlung allein Experten zuständig sind, forderte Dr. Verena Wetzstein von der Katholischen Akademie Freiburg im Breisgau. Ihre Thesen: Die vor rund 30 Jahren von der Medizin erfolgte Definition der senilen Form der Alzheimer-Demenz ist ohne grossen Widerspruch in den gesellschaftlichen Diskurs übernommen worden. Der Pathologisierung folgte die Dämonisierung. Alzheimer-Demenz wurde zu einem gesellschaftlichen Schreckbild. Politik und Gesundheitswesen bedienen sich der medizinischen Kategorien und ärztlichen Terminologie, ohne sie zu hinterfragen. Dr. Wetzstein fordert dagegen ein integratives Modell, welches die Medizin von ihrer Alleinverantwortung entlastet und die Gesellschaft in die Pflicht nimmt. Dazu bedarf es eine Ethik der Demenz, die einzig von der Grundannahme ausgeht, dass allen Menschen die Gesamtheit ihres Lebens über die gleiche Würde zukommt. Die einseitige Fixierung auf die Kognition vernachlässige die leib-seelische Einheit des Menschen, so Wetzstein. Eine fürsorgliche Gesellschaft müsse das Wohlergehen dementer Menschen in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Ausgrenzung und Ghettoisierung Prof. Dr. Helmut Bachmaier, wissenschaftlicher Direktor der TERTIANUM-Gruppe Schweiz, stellte in seinem Beitrag „Menschenwürde bei Demenz“ klar, dass aus ethischer Sicht nicht zwischen Kranken und Nicht-Kranken unterschieden werden dürfe. Dies wird oft vergessen, wie das Beispiel der „Ethischen Richtlinien für die Altersheime der Stadt Zürich“ zeigt. Darin wurde die Würde mit dem Begriff Selbstachtung gekoppelt. Letztere wurde dementen Menschen abgesprochen und somit die Menschenwürde in Frage gestellt. Auch wenn diese „fatale Gleichsetzung“ (Bachmeier) nach öffentlicher Kritik in einer zweiten Fassung der Richtlinien korrigiert wurde, ist es ein Beispiel, wie leichtfertig demente Menschen ghettoisiert werden. „Jede Ausgrenzung in Bezug auf die Menschenwürde ist ein Kainsmal“, fasste Bachmaier zusammen. „Man schützt die Würde der Menschen nicht, indem man sie einsperrt.“ An die Adresse der Pflegenden appellierte Bachmaier, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. „Sie können sich auf die Erklärung der Menschenrechte berufen, das kann kein Banker.“ Die Autonomie des Augenblicks Dr. Heinz Rüegger vom Institut Neumünster stellte die Herausforderungen für Pflege und Betreuung in den Mittelpunkt seines Referates „Zum moralischen Anspruch demenzkranker Menschen“. Es stehe niemandem zu, das Leben von Demenzkranken als „unwertes Leben“ zu bewerten, nur weil es den in unserer Gesellschaft zentralen Aspekten von Leistungsfähigkeit (Produktivität), Vernunft (Rationalität) und Selbstbestimmung (Autonomie) nicht entspricht, betonte der Theologe und Seelsorger. Wenn Demenzkranke ihre Fähigkeit verlieren, autonom zu entscheiden, ist es die Pflicht derer, die sie betreuen und pflegen, stellvertretend für sie in ihrem Sinne zu entscheiden. Patientenverfügungen werden meist von noch nicht dementen Personen verfasst, die sich kaum wirklich in die Lebenswelt einer demenzkranken Person einfühlen können, gab Rüegger zu bedenken. Doch wer will beurteilen, ob sich die Meinung eines Patienten nicht geändert hat? Die Pflege und Betreuung von demenzkranken Personen sollte nicht auf Vorausverfügung für eine pauschal als unerwünschte Lebensform aufbauen, sondern von einer „Autonomie des Augenblickes“ ausgehen und sich an den aktuellen Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen und Impulsen des demenzkranken Menschen auszurichten. „Wir als Profis stehen vor einer anspruchsvollen Aufgabe, wenn wir das ernst nehmen wollen“, betonte Rüegger. Ekel und Skandale Doch wie sieht es im Pflegealltag aus? Diese Frage thematisierte Michael Schmieder, Leiter des Krankenheim Sonnweid in Wetzikon, anhand eines TabuThemas: Über den Umgang mit Ekel in der Pflege und Betreuung. Schmieder erinnerte an den Skandal in einem Zürcher Pflegeheim, als Pflegepersonal Patienten nackt filmte und demütigte. Vor einem Jahr erregte das Thema kurzfristig die Medien, inzwischen ist es aus den Schlagzeilen verschwunden. „Die Politik hat nicht reagiert“, stellte Schmieder fest. Stattdessen soll in der Pflege mit weniger Geld noch mehr geleistet werden. „Wer von Ihnen kennt nicht den Geruch von Urin, Kot und des beginnenden Todes?“, fragte Schmieder die Tagungsteilnehmer. Ekel wird erzeugt durch ein Zusammenspiel aller uns zur Verfügung stehenden Sinne und durch die Unmöglichkeit, Teile der Sinne auszuschalten. Der Geruchssinn vereint alle Sinne (Ich kann dich nicht riechen), das Auge dagegen kann Distanz schaffen, Menschen werden zu Objekten degradiert, wie im Falle des zuvor erwähnten Pflegeskandals. Weil in der Pflege Ekel nicht mit Einmalhandschuhen beseitigt werden kann, können Pflegende nur den Umgang mit Situationen lernen, die Ekel erzeugen. „Die Enttabuisierung des Ekel ist das oberste Gebot“, sagte Schmider. Im Pflegealltag muss darüber gesprochen werden, wie Situationen entstehen, die Ekel auslösen. Nur so kann man sich darauf vorbereiten und daran gewöhnen. Fragen aus dem Publikum In der abschliessenden Podiumsdiskussion sagte Millie Braun, Stationsleiterin Sonnweid, dass in der praktischen Arbeit mit ethischen Dilemmata wie Ekel nur folgendes helfe: Beim Rapport darüber reden und sich weiterbilden. „Deshalb sind bei dieser Tagung auch so viele Pflegende anwesend.“ Richard Taylor forderte die Anwesenden auf, von Demenz betroffenen Menschen zu helfen, „damit wir unsere Ansprüche durchsetzen können.“ Im Publikum schilderten auch einige Angehörige von Pflegebedürftigen ihre Erfahrungen. Ihre Bitte: die Ressourcen der Angehörigen mehr zu nutzen. Und auf die Frage aus dem Publikum, wie man das Thema Demenz und Wertekultur jenseits von Pflegeskandalen auf die politische Agenda setzen kann, antwortete Dr. Heinz Rüegger, dass im Mai im Bundeshaus eine „Charta zum zivilgesellschaftlichen Umgang mit Demenz“ überreicht werde. „Wir hoffen, dass mit der Charta eine öffentliche Diskussion eröffnet wird“, so Rüegger. „Damit auch die Politik einen Druck von unten spürt.“ Download der Referate unter www.zfp.tertianum.ch