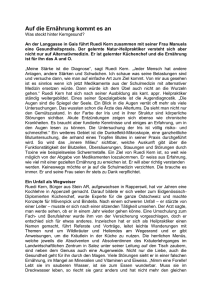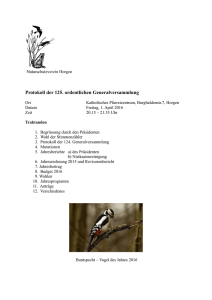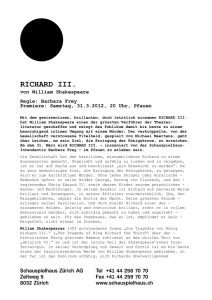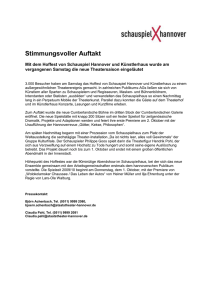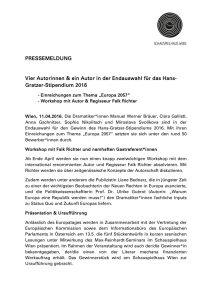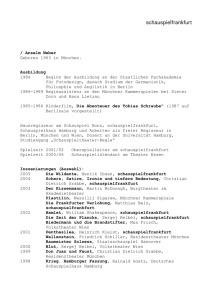Schauspielhaus Zürich Zeitung #5
Werbung

1 Schauspielhaus Zürich Zeitung #5 2 3 Barbara Frey über Traum und Offenbarung Seit dem Altertum hielten die Menschen Träume für berichtenswert. Ebenso spielen sie seit jeher eine bedeutende Rolle in der Dichtung. Das mag einerseits damit zu tun haben, dass der Mensch weder für noch gegen das Träumen etwas unternehmen kann und somit über eine Art Dauerreservoir an Visionen verfügt, aus dem er jederzeit in den verschiedensten Kunstformen schöpfen kann. Andererseits wurde den Träumen immer auch ein prognostischer Gehalt zugeschrieben, etwas Hellseherisches, Prophetisches. Dass die schönsten (Wunsch-)Träume in Erfüllung gehen mögen, steht auf jedem Geburtstagskärtchen – und man mag nicht darüber nachdenken, dass es auch eine ‚Erfüllung‘ der grauenhaftesten Alpträume geben könnte, einen Transfer von geträumten Schrecknissen in eine bittere Wirklichkeit. Wenn Träume ‚wahr‘ werden können, dann können sie es jedoch im Guten wie im Bösen. Aber wer gibt uns die Träume ein? Mit dieser Frage hat sich Shakespeare immer wieder beschäftigt und sein „Sommernachtstraum“ handelt ebenso von der peinigenden Kraft nächtlichen Phantasierens wie sein „Richard III.“. Im einen Fall wird naive erotische Romantik von der rohen Kraft sexueller Obsessionen aufgefressen, im anderen wird politische Praxis unterspült – und am Ende verschlungen – von einem permanenten Alptraumterror, in dem Schuld und Sühne, Opfer und Täter, Intrige und Mord schrecklich und possenhaft durcheinander purzeln. „... Nie schliess der Schlaf dein Todesauge dir, / nur wenn ein Schreckenstraum dich überfällt / und dich mit widerlichen Teufeln jagt ...“ (Richard III., 1/3) – dies schleudert Queen Margaret dem künftigen König Richard III. entgegen – und im 4. Akt gibt Lady Anne, Richards Frau, kurz vor ihrem gewaltsamen Tod das Echo: „... denn keine Stunde hab in seinem Bett / ich je genossen goldnen Tau des Schlafs, / sein Alptraum weckte jedesmal mich auf …“ (Richard III., 4/1). Shakespeares Interesse galt den fliessenden Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem, zwischen Schlafzimmer und politischer Machtzentrale, zwischen Fakten und Fiktion. Für ihn war alles real; folglich waren Träume für ihn nur die andere Seite einer Wirklichkeit, in der Männer und Frauen vergeblich versuchen, ihre Ängste zu besiegen, ihre Territorien von den Zumutungen ihrer nächtlichen Heimsuchungen freizuhalten. Für ihn wurde jeder zu einer bemitleidenswerten Kreatur, der versuchte, die drängenden Visionen seiner schuldbeladenen Seele auszulagern, um an irgendein politisches oder sonstiges Ziel zu gelangen. Das hat mit Psychoanalyse und modernen, therapeutischen Deutungsmustern genauso wenig zu tun wie mit christlicher Morallehre; ihm ging es um eine andere Form von Wahrheit. „Aber ist es denn wirklich nicht ganz gleich, ob es ein Traum war oder nicht, wenn dieser Traum mir die Wahrheit offenbart hat?“, fragt Dostojewski. Das Unheimliche bei Shakespeare ist die Wiederkehr der Toten, der Ermordeten als Geister. In „Hamlet“ als reale Erscheinung im Wachzustand des Protagonisten, in „Richard III.“ als Traumgestalten. Sie beschwören den Tod des Tyrannen, wortkarg und unbeirrbar. Richard stirbt. Sein Alptraum wird wahr. Die Getöteten sind mehr als eine blasse Erinnerung oder ein Phantasma des Unbewussten; sie weisen in die Zukunft. Bei Shakespeare verweist der Terror der durchträumten Nacht auf die Realität. Aus Traum wird Geschichte. Clarence wird unmittelbar vor seiner Ermordung, die sein Bruder Richard angeordnet hat, im Traum zum Propheten seines eigenen bevorstehenden Untergangs. Doch obwohl auch Clarence sich in den Wirren um die Thronfolge schuldig gemacht hat, fühlt man mit ihm, wenn er mit der Schilderung seines bösen Traums beginnt: „Ich hatte eine grauenhafte Nacht, / so voll von Träumen, Angst und Tod, / dass ich als frommer Mann und Christenmensch / nicht eine Nacht wie die noch einmal will, / könnt ich mir kaufen selbst die schönste Welt: / so voll von schlimmstem Terror war die Nacht.“ (Richard III., 1/4) Inhalt 3 Vorwort 4 Das wird Gott mir nicht glauben – Auszug aus „FaustIn and out“ von Elfriede Jelinek 8 Lukas Bärfuss über Macht und Erinnerung bei „Richard III.“ 10 Eugen Sorg über die Lust am Bösen – „Richard III.“ im Pfauen 13 Roland Koberg über die verschollene Uraufführung von Kafkas „Amerika“ 1957 15 Schon gesehen? Szenen aus dem Repertoire – Fotogalerie 20 Eine Lehre der Wahrnehmung – Judith Gerstenberg über Ruedi Häusermann 24 Wundersam verknotete Existenzen – der Schauspieler Markus Scheumann im Porträt 26 3D im Kopf – Schicht mit Konstrukteur Albert Brägger 28 Man hörte Dürrenmatt lachen – Ins Theater mit Peter Nobel 30 Mörderisches Zürich – Kolumne von Lukas Bärfuss Titel Edgar Selger, Sarah Hostettler, Frank Seppeler in „Faust 1–3“ Rücktitel Ensemble in „Geschichten aus dem Wiener Wald“ 4 5 Aus „FaustIn and out“ von Efriede Jelinek Das wird Gott mir nicht glauben Während man im Pfauen „Faust 1–3“ gibt, während zwei Männer Johann Wolfgang von Goethes Verse sprechen, einen Pakt schliessen und das Frauenideal vors innere Auge holen, läuft zeitgleich irgendwo in der Nähe in einem Keller vor 30 ZuschauerInnen die Uraufführung von Elfriede Jelineks „FaustIn and out“. Vom neuen Theatertext der österreichischen Nobelpreisträgerin – im Original länger als „Faust I“ – dringt nur wenig auf die grosse Bühne. Er wurde nach Angaben der Autorin geschrieben, um als „Sekundärdrama“ das Hauptdrama zu begleiten, um „kläffend neben dem Klassiker herzulaufen“. Die Möglichkeiten der Realisierung, so Jelinek, seien „unbegrenzt“. Im Rahmen von Dušan David Pařízeks Projekt „Faust 1–3“ heisst das: Das störende Frauenstück bleibt vorerst im Keller, im schallgeschützten Musikzimmer des Pfauen … Mit freundlicher Genehmigung der Autorin bringen wir an dieser Stelle einen Auszug aus „FaustIn and out“. Es spricht die „FaustIn“, eine Frau, die weiss, was einer Margarete von heute widerfahren kann, wenn Männer an Mädchen ihre patriarchischen, gottgleichen Allmachtsansprüche ausleben und wieder einmal der Befehl ertönt: „Mädels aller Altersstufen: Marsch in den Keller, ab mit euch!“ Die Perspektiven mischen sich und Gretchens Tragödie erfährt eine gespenstische Überschreibung. Man blickt in exemplarische (österreichische) Keller, wie etwa in jenen, in den die zehnjährige Natascha Kampusch entführt wurde oder in den die Zweitfamilie von Josef Fritzl jahrzehntelang eingesperrt war. Mit Faust-Zitaten versucht frau sich die Welt zu erklären, aber manchmal offenbaren die Zitate im neuen Kontext erst ihre ganze Abgründigkeit. Zu dumm! Bin über vierzehn Jahr doch alt. War aber einmal zehn, als ich hier runterkam. Jetzt über vierzehn, die andre Dame dort schon sechzehn. Wir sind auf alles schon vorbereitet worden. Mein schönes Fräulein, darf ichs wagen, meinen VW-Kastenwagen und meine Prügel Ihnen anzutragen? Kann ungeleitet nach Hause gehn, werde umgeleitet, komme ungelegen, nein, sehr gelegen, ich komme, ich ging just vorbei, und jetzt „Alles muss raus. Jeder Trieb muss raus.“ Frank Seppeler, Sarah Hostettler, Edgar Selge in „Faust 1–3“ bin ich da. Wer ist das? Wieso kommt das mit der Religion denn jetzt schon? Wie ich es damit halte? Ach so. Wie Sie es damit halten! Danke. Das macht schon eher Sinn. Über mich hat jeder Gewalt. Einfach jeder. Gott zuerst, dann jeder andre. Gott vielleicht sogar später. Zuerst ein anderer. Da kommt ein jeder daher. Nein, da kommt immer nur er. Da komme ich ausgerechnet an das einzige Wesen, das Gott einmal persönlich gekannt und ihn sofort imitiert hat, was gleichbedeutend ist mit: erkannt, sonst hätte Papa ihn ja nicht nachmachen können, nachäffen, nicht wahr, und was war der Erfolg? Dass es danach nicht mehr sein wollte wie er, sondern mehr als er! Bla bla bla. Das kann auch nur mir passieren, dass ich ausgerechnet so jemanden kennenlerne! Ich komme zum einzigen, der das Unverständliche verstanden hat, indem er nicht Gott sein wollte, der er doch damals gut hätte sein können. Er hatte die Wahl. Und dann das. So abstossend kann doch nicht einmal Gott sein, dass man um keinen Preis sein will wie er! Na, um diesen Preis schon. Hab vorhin nicht gesehen, dass der Preis auf dem Schild gestanden ist. Man zahlt, und dann ist man Gott. Man zahlt, und dann ist man auf Urlaub in Thailand. Man zahlt, und dann wird man massiert. Man tritt dort überhaupt in Massen auf, sagt man mir. Man muss dort kein Mass kennen. Das ist sehr lustig. Man hat Spass mit Frauen und Kindern. Man hat Spass mit anderen Frauen und fremden Kindern. Man zahlt, und dann hat man das neue Auto. Man zahlt, und dann hat man das gewünschte Gut, das man gut selber hätte sein können. Man ist sich aber nichts wert. Man ist verkauft. Man ist verraten und verkauft. Dieser unreine Geist in seinem umweltfreundlichen Hybrid-Aufschwung wäre zwar eine Imitation einer Imitation gewesen, denn Gott soll ein guter Menschenimitator sein, sagt man, allerdings kriegt er es nie ganz hin, obwohl er angeblich schon ziemlich perfekt sein soll, er kommt den Menschen schon recht nahe, wenn er sich bemüht, aber das wäre immer noch besser als ich zu sein! Gott zu sein, Alles zu sein: immer noch besser als ich. Bla bla bla. Aber das wird Gott mir nicht glauben, der wird mir nicht glauben, dass ich in einem Kellerloch lebe, das jemand sich eigens die Mühe gemacht hat zu graben, soviel wird kaum jemals für einen anderen Menschen geleistet. Trotzdem, ich lebe hier gezwungenermassen, allerdings mit einem Papa, der mir hilft, das zu geniessen und auch selbst geniessen kann. Aber er wird es wissen, Gott wird es wissen, er wird es nicht glauben können, aber er wird es schon wissen, noch bevor es ihm gesagt wird. Er ist allwissend. Glauben sollen dann die anderen. Der will Mensch sein und in der Welt aufgehen. Ich bin im Keller ausund eingegangen, nein, nicht aus, nur ein, in den Keller eingegangen und aus dem Keller nie mehr ausgegangen, als wäre der Keller schon das ewige Leben gewesen. Der ist aber nur ein Abschnitt, der zur Wohnung gehört und in der Miete inkludiert ist. Ich möchte eher, dass mir die Welt endlich aufgeht. Nicht Untergang. Aufgang! Aus meinem heimeligen Stübchen raus, ins Offene. Erkennen, dass das Sein das Nichts ist. Es lohnt sich nicht. Ach, wäre das schön, etwas zu erkennen! Ich möchte ein Studium beginnen. Aber leider ... keine Erleuchtung! Erleuchtung: noch nicht eingetroffen. Ich lasse ihr vorn beim Kellereingang ein Licht brennen, falls sie noch kommt. Ich bin womöglich eine Imitation dessen, der einen andren imitiert hat, bloss um mir zu sagen, wer ich sein soll. Gott sagt. Welcher? Ich weiss zu gut, dass solch erfahren Mann mein arm Gespräch nicht unterhalten kann. Das weiss ich schon von meinem Papa. Alles andre natürlich auch. Sie finden, das sei ganz natürlich? Na ja. Gott wird auch nicht viel anders sein. Die Männer sind doch alle gleich. Es gibt nur sie. Ich suche mir immer nur Auslegungsbedürftiges und erkenne nur meine eigene Bedürftigkeit. Also zumindest die Ähnlichkeit Gott/Geist wäre nicht zu bestreiten gewesen. Mit dem Geist rede ich ja die ganze Zeit schon. Immer will der ein andres Programm im Fernsehn sehn, um sich zu nähren. Meist Sport. Wenn der Papa da ist: Sport. Wenn der Geist über mich kommt: Sport. Mein Geist ist gut genährt. Ich bin es oft nicht. Ich kenne beides nicht, nicht Gott, nicht Geist. Nicht Gott, nicht Geist. Nur den Vater. Ich kenne nur den Vater. 6 7 „Er hat mich der Mutter vorgezogen. Ich bin dazu in den Keller verzogen.“ aus „FaustIn and out“ von Elfriede Jelinek „Ihr seid wohl viel allein“: Miriam Maertens, Frank Seppeler, Sarah Hostettler, Franziska Walser und Edgar Selge in „Faust 1–3“ Und was ist mit der Natur? Die muss ich mir nicht erklären, die ist einfach schön. Hab sie zwar lang nicht mehr gesehn, doch, doch, die Natur ist nicht Fräulein, aber schön, man will sie aber trotzdem sehn. Man sieht sie überhaupt viel zu selten, die Natur, das sagen Menschen im Fernsehn, die uns die Natur kleinschneiden, damit sie auf den Bildschirm passt, sie wird auf Bildschirmgrösse zugeschnitten, und dann wird sie vorgezeigt, ja, im Fernsehn zeigt die Natur auf wie ein Schulkind, die einzige Natur, die mir zugänglich, wenn auch nicht betretbar ist, dort kann man sie nicht übersehen. Dort kann man sie sehen und nicht: übersehen. Man kann sich an ihr nicht sattsehen. Die kommt viel zu selten vorbei, die Natur. Weiss doch, dass wir nicht bei ihr vorbeikommen können. Das Universum kommt im Fernsehn vorbei, und ich schaue es mir an. Bei mir kommt es nie vorbei, aber ich kann es mir im Fernsehn anschauen. Vielleicht kommt die Natur zu Ostern? Guter Zeitpunkt. Da haben wir sie ganz besonders vermisst. Da ist sie erwünscht. Das wäre ihre nächste Chance, sich zu zeigen. Leider kein Spaziergang. Der Spaziergang fällt heuer wie jedes Jahr ins Wasser, das in sich hineingefallen ist und einen Bach bildet, der nur noch wegwill. Die Natur steht ja nicht still. Die Natur kann man zwar erklären, wenn man nur genug studiert hat, wenn man die Naturgesetze erforscht hat, aber was soll man machen, wenn man sie kaum je sieht, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, in dem man doch die ganze Zeit schon herumgeht? Also herumgehen kann ich nicht, das steht fest. Ich sitze fest. Mein Dasein ist irgendwie festgefahren, aber fahren kann ich auch nicht. Ich kann hier unten Formeln studieren und anwenden, okay. Also ich könnte, ich kann aber nicht. Bla bla bla. Das heisst, ich könnte das einmal können, wenn ich es gelernt hätte. Und als Formeln wären sie für mich durch die Abendschule vielleicht verständlich geworden, und trotzdem bliebe dann das, wovon sie sprechen, was sie deuten, das Unverständliche. Derzeit alles unverständlich. Bla bla bla. Rhabarber Rhabarber Rhabarber. Also bin ich schon wieder bei einem Schöpfer gelandet, bei meinem Vater, der mein Schöpfer, Erhalter und Vorenthalter ist, das ist bequem, dafür muss wiederum ich nichts mehr lernen. Mein Vater und Mann lernt für mich. Ich muss mich um nichts kümmern. Er holt sogar die Windeln fürs Baby, ja, das, welches überlebt hat, Pampers aus einem fernen Supermarkt von entfernteren Bergen für nur ein Stück Baby. Gäbe es zwei davon, müsste er die doppelte Menge kaufen, ein riesiger Packen. Das fiele dann schon auf. Ach was, das fällt niemandem auf! Wohin ich auch renne, ein, zwei Meter im Quadrat, mehr geht nicht, aber diese ein, zwei Meter kann ich auch springen, nicht überspringen, aber springen, das könnte ich, wo ich auch bin, überall glotzt mich ein Schöpfer an, mein Vater, der mir dieses Leben bereitet hat und nun ernsthaft erklären will, dass er mich so wollte, wie er selber aber nie hätte sein wollen. Warum denn sonst ich? Wie er ausgerechnet mich aber haben wollte. Er hat immer den Andren geschaffen, aber wie oft kommt jemand wie ich dabei heraus! Als könnte ich über meinen Tellerrand hinausschauen und mich als einen Anderen begreifen, der es auch geschafft hat, geschaffen zu werden! Sein Abfall, des Schöpfervaters Müll, aber auch unsrer, da muss ich gerecht sein, die Kinder machen auch viel Mist, der Müll also bleibt für mich als Existenz übrig, die Erde und der Müll, die bleiben mir, die Kinder, die Erde, der Müll, kein Hund, die bleiben mir, denn der Vater hat mich nicht gewollt, jedenfalls nicht so, er hat mich als eine Andere gewollt, er hat mich gewollt, aber als Tochter, oder nein, er hat mich nicht als Tochter gewollt, er brauchte nur zu wählen, und dann hatte er mich, er hatte mich, die Mutter kam vor mir, jetzt aber komme ich vor ihr. Er hat mich der Mutter vorgezogen. Ich bin dazu in den Keller verzogen. Die Mutter durfte oben bleiben. Die Glückliche! Aber sie ist immerhin meine Mutter. Er hat mich geschaffen, und dann hat er mir sogar einen Ort zum Leben geschaffen, im Keller, im tiefen Keller sitz ich hier, mein Vater! Was rede ich da, das weisst du eh! Ich war als eine Andere gewollt, die ich zu gern selber kennengelernt hätte, aber es ist immer ich dabei herausgekommen, ohne raus zu können, ich bins!, zwar nicht immer, aber mindestens in der Hälfte aller Fälle bin es ich, die hier vorkommt, nein, es sind noch mehr Kinder da, ich habe aber keine gute Chance, deswegen übersehen zu werden. Doch der Schöpfer übersieht nichts, kein Haar fällt vom Kopf, das der Schöpfergeist übersehen würde, da nützt einem kein heisses Bemühn, er kommt über mich und haucht mich an, ich rieche, was er gegessen hat, etwas mit Zwiebel, sowas kommt immer raus, ich komme hier nicht raus, er erschafft mich, der schafft mich!, obwohl ich doch fertig bin, längst fertig, er hat mich ja fertiggemacht, echt fertig. Und jetzt ist er endlich auch fertig. Hat abgeschüttelt. Ausgetrunken und abgespritzt und abgeschüttelt das Bäumchen. Bla bla bla. Rhabarber. Die andere Hälfte wäre die schlechtere. Ich bin die bessere. Ich bin die bessere Hälfte meines Vaters geworden. War ganz leicht. Die erste Hälfte hat er nicht mehr gemocht. Es war ganz leicht. Nein, anders. Es war furchtbar schwer. Mir fehlen die Worte. Ich weiss, dass Sie das nicht bedauern würden, denn da sind sie natürlich schon wieder, die lieben Worte, waren wohl nur kurz verreist. Anders als ich. Ich bin ganz weg, dass meine Worte zu mir zurückgekehrt sind. Als auch ich wieder zu mir gekommen war und keinen andren Weg und keinen andren Ausweg mehr hatte, konnte ich es kaum glauben, wo und unter welchen Bedingungen mein Ich ich sein musste. So. Ich bin ein schlecht bestelltes Feld, das im Netz des Tores, im Aufscheinen der Flutlichter ganz anders ausgeschaut hat, man hat die Grösse aber nicht gesehen, man hat meine Grösse einfach nicht gesehen. Überhaupt hat mich keiner mehr gesehen. Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heute wieder mein Herr gewesen ist. Ach ja, weiss schon! Jetzt fällt es mir wieder ein. Viel Auswahl hab ich ja nicht. Ich fülle das Feld jetzt aus, wie von mir verlangt. Ich würde auch mehr ausfüllen, aber man gibt mir keinen Fragebogen, was ich will und was nicht. Ich wurde bestellt und habe den Käufer dann enttäuscht. Er gibt mich grade wieder zurück. Immer wieder gibt er mich zurück. Aber nur er ist da, mich zu nehmen. Und den Müll, der ich bin, muss ich auch noch runtertragen. Jeden Tag die Stiege runter. Zuerst Mann, dann Kinder, dann kein Hund. Faust 1–3 von Johann Wolfgang von Goethe mit dem Sekundärdrama „FaustIn and out“ von Elfriede Jelinek (Uraufführung) Regie und Bühne Dušan David Pařízek, Kostüme Kamila Polívková, Musik Roman Zach Mit Edgar Selge, Frank Seppeler; Sarah Hostettler, Miriam Maertens, Franziska Walser Ab 8. März im Pfauen 8 Essay 9 Macht und Erinnerung „Gibts Neues noch in unserm Wackelstaat?“ aus „Richard III.“ von Wiliam Shakespeare Louise Bourgeois, Extrême tension, 2007 Von Lukas Bärfuss Das Stück „Richard III.“ wird in Shakespeares Werk unter die Historien eingereiht und tatsächlich existierte im 15. Jahrhundert ein englischer König mit diesem Namen. Dieser Mann, Richard, Herzog von Gloucester, ein York und damit Parteigänger seines Bruders und amtierenden Königs Eduard IV., hatte seinen Vater und einen älteren Bruder in den Rosenkriegen verloren. Er musste, nachdem Heinrich VI. und damit die Lancasters auf den Thron gelangt waren, mit dem gestürzten König nach Holland ins Exil fliehen. Aber nicht allzu lange. Die Yorks kehrten zurück, erlangten die Macht wieder, aber bald starb Eduard und der Kampf um den Thron begann von Neuem. Am Ende sass Richard auf dem Thron, für kurze zwei Jahre. Seine Politik, seine Taten waren alles andere als rücksichtsvoll. Er führte Krieg, liess verhaften und ermorden – und er war mit diesem Verhalten ein ziemlich gewöhnlicher Angehöriger seiner Kaste. Was ihn allerdings aus seinesgleichen heraushebt: Er war der letzte Herrscher aus dem Hause der Plantagenets, ein ursprünglich französisches Herrschergeschlecht, das immerhin 300 Jahre Englands Geschick bestimmt hatte. Mit Richard enden die Rosenkriege, der dreissigjährige Streit der Häuser York und Lancaster, beides Seitenlinien der Plantagenets, um die Macht in England. Sein direkter Nachfolger, Heinrich VII., der Richard in der Schlacht von Bosworth besiegte und tötete, war der erste Tudor auf dem Thron, eine Dynastie, die fünf Regenten hervorbrachte – als letzte Elisabeth I., die jungfräuliche Königin, die einem ganzen Zeitalter den Namen gab und den Aufstieg Englands zu einer Weltmacht begründete und unter deren Herrschaft William Shakespeare seine Stücke schrieb. Die Ansprüche der Tudors waren von Anfang an schlecht begründet. Der erste ihrer Dynastie, Heinrich VII., war ein illegitimes Kind, seine Familie war offiziell von der Thronfolge ausgeschlossen. Weil die dynastische Legitimität fehlte, musste Heinrich seine Krone auf dem Schlachtfeld erobern. Er war der letzte englische König, dem dies gelang. Aber der Ruch der Usurpation blieb während ihrer ganzen Regentschaft von 120 Jahren an den Tudors haften. Legitimität war für die Könige alles. Nicht nur das Amt und die Würde – das physische Überleben hing davon ab, die Rechtmässigkeit der Ansprüche belegen zu können. Elisabeth I. hatte bereits als Kind Gelegenheit, diesen Kampf aus nächster Nähe zu beobachten. Ihr Vater, Heinrich VIII., hatte ihre Mutter, Anne Boleyn, durch einen Staatsmord hinrichten lassen, weil sie ihm keinen männlichen Thronfolger gebären konnte. Und sie selbst liess ihre Cousine aufs Schafott führen: Maria Stuart wurde an einem Februarmorgen des Jahres 1587 der Kopf abgeschlagen. Aber die Ansprüche der Stuarts waren damit nicht aus der Welt und tatsächlich begann nach Elisabeths Tod die Ära ihrer Regentschaft. Die Tudors hatten also jedes Interesse daran, Richard III. so schlecht wie möglich und die eigene Usurpation als Befreiung darzustellen. Die Dämonisierung des letzten Königs aus dem Hause Plantagenet war Staatsräson. Man liess die Dokumente, die Richard in einem guten Licht zeigten, wie etwa den Beschluss des englischen Parlaments zu seiner Einsetzung, den Titulus Regius, vernichten und installierte eine eigene Geschichtsschreibung. Raphael Holinshed schrieb zu Elisabeths Zeiten eine Chronik Englands, aus der Shakespeare sich oft für seine Stücke und auch für Richard III. bediente – und die selbstverständlich ganz nach dem Geschmack der Tudors war. William Shakespeare – ein Propagandist? Der Hund seiner Herrin? Er war gewiss kein Aussenseiter. Der Dichter bewegte sich in seiner Gesellschaft erfolgreich und betrieb sein Theater-Unternehmen mit Gewinn. Er trat mit seiner Truppe, den „Chamberlain’s Men“, am Hof vor der Königin auf. Shakespeare war ein Kind seiner Zeit, inhaltlich, formal, er wusste, was sein Publikum zu sehen und zu hören wünschte und erzählte ihnen die genehme Geschichte. Aber das ist nicht alles. Es gelang ihm, seine Zeit und ihre Machthaber zu feiern und gleichzeitig zu kritisieren. Er zeigt in „Richard III.“ das Gemetzel um die Macht. Er zeigt die Logik hinter dem Machtkampf: Wenn niemand mehr da ist, der seine Ansprüche anmelden kann, ist der Letzte, der übrigbleibt, der König. Natürlich vergisst und negiert dieser Machiavellismus alles, was wir christlich und menschlich nennen – die Freundschaft, das Vertrauen und das Mitgefühl, aber im Kampf um die blanke Existenz sind das vielleicht Nebensächlichkeiten. Das Ringen um das physische Überleben schildert Shakespeare in seinem Stück. Richard watet durch ein Meer aus Blut, er lässt seinen Bruder, seine Neffen, seine Frau und seinen engsten Berater umbringen, um schliesslich alleine auf dem Schlachtfeld zu stehen, verlassen von allem Lebendigen, begleitet nur von den Geistern jener, die er töten liess. Ein Verrückter, der nach einem Pferd schreit. Alleine die genaue Darstellung ist eine Kritik an den Mächtigen und ihrer Machenschaften. Aber Shakespeare geht weiter. Bei ihm ist der Kampf ums Dasein ein Kampf um und mit der Sprache. In der ersten Szene des dritten Aktes formuliert es Richard selbst ganz deutlich: „I moralize two meanings in one word.“ Und es ist die Entgegnung, die Worte des Prinzen von Wales, dass die Wahrheit, selbst ohne Aufzeichnung, erhalten und erzählt werden solle und zwar bis zum „all-ending day“, dem letzten Tag. Richard benutzt die Worte alleine als Instrumente zur Erlangung der Macht. Seine Sprache kennt keine Wahrhaftigkeit. Das Gemetzel wird durch Sprache vorbereitet und vollendet und Shakespeare hatte den Mut und die Freiheit, das Wissen über diese Praktik seinem Helden in den Mund zu legen: „I say, without characters, fame lives long.“ Ein Scheusal, das die Wahrheit spricht und dabei lügt. Ohne Buchstaben, „characters“, lebt der Ruhm tatsächlich lange. Es sind die Sieger, die die Geschichte schreiben. Die Verlierer kommen nicht vor. Und das lässt sich natürlich auch auf Elisabeth und ihre Tudors beziehen. Die Legitimität eines Königs muss immer ein fraglich Ding bleiben und ist letzlich nur durch das Gottesgnadentum zu erklären. Jeder Gedanke, jedes Wort, das diese Rechtmässigkeit bezweifelt, muss zerstört, jede Erinnerung an die wahren Umstände des Machterhalts ausgelöscht werden. Shakespeare weiss, dass der wirkliche Richard weder buckelig noch besonders hässlich war, er weiss, dass nicht er seinen Bruder Clarence im Malvasierfass ertränken liess, er weiss, dass die beiden Prinzen, die Kinder seines Bruders, von mindestens einem halben Dutzend Menschen hätten umgebracht werden können. Er weiss, dass niemand jemals wissen wird, wie Richard wirklich war. Er ahnt, mit welchen Mitteln die Tudors auf den Thron gekommen sind und er spielt mit diesen Spiegelungen. Von seiner eigenen Königin hiess es, dass sie den Namen ihrer verstossenen und geköpften Mutter niemals in den Mund genommen habe. Worüber man nicht spricht, liest oder schreibt, das existiert nicht. Die Tabuisierung der Geschichte, die Konstruktion einer Lüge als Staatsräson, das sind Konstanten des Totalitären. Shakespeare schrieb in diesen Verhältnissen und er nahm sich die Freiheit, darüber zu schreiben. Und er zeigte, dass auch das Vergessene wiederkehren kann, in den Träumen, der Kunst und in den Theaterstücken. Richard III. von William Shakespeare aus dem Englischen von Thomas Brasch Regie Barbara Frey, Raum Penelope Wehrli, Kostüme Bettina Munzer Mit Christian Baumbach, Ludwig Boettger, Ursula Doll, Fritz Fenne, Silvia Fenz, Lukas Holzhausen, Julia Kreusch, Michael Maertens, Nicolas Rosat, Susanne-Marie Wrage, Jirka Zett Ab 31. März im Pfauen 10 11 Essay Die Lust am Bösen Über die Faszination des Bösen, die Entscheidung, die eigenen Ansprüche absolut zu setzen, und den Reflex, wegzuschauen – aus Anlass der Inszenierung von William Shakespeares „Richard III.“ von Barbara Frey im Pfauen. Von Eugen Sorg „Die grösste List des Teufels war es“, schrieb Baudelaire, der Dichter der „Blumen des Bösen“, „uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt.“ Am 1. Januar 1995 erhängte sich der 51-jährige Engländer Frederick West an einem Leintuch in seiner Gefängniszelle. Er hatte die Ermordung von zwölf jungen Frauen gestanden; seiner ebenfalls verhafteten Ehefrau und Komplizin Rosemary West wurden zehn Morde nachgewiesen. Aber wahrscheinlich hatte das Ehepaar Fred und Rose weit mehr Menschen auf dem Gewissen, einige Schätzungen rechneten mit bis zu 60 Opfern. Doch es fehlten die Beweise, respektive die sterblichen Überreste der jungen Frauen, die in Südwestengland verschwanden und nie mehr auftauchten. Zu Beginn tötete der Sohn eines Landarbeiters alleine, so 1967, als er seinen mutmasslich ersten Mord beging und seine schwangere Geliebte erschlug, zerlegte und vergrub. Er hatte sie beseitigt, weil sich seine erste Frau Rena, eine Prostituierte aus Glasgow, am Verhältnis zu stören begann. Bald darauf lernte er die damals 15-jährige Rosemary kennen, mit der er bis an sein Lebensende zusammenbleiben sollte. Mit ihnen lebte auch Freds Stieftochter aus der Ehe mit Rena, die achtjährige Charmaine. Als er wegen Diebstählen und Hehlerei im Gefängnis war, misshandelte Rose die Kleine zu Tode. Fred kam wieder frei und zusammen verscharrten sie die tote Charmaine im Küchenboden ihrer Wohnung. In der Schule gaben sie an, sie sei zu ihrer leiblichen Mutter zurückgekehrt. Diese tauchte aber bald auf und wollte Charmaine zu sich holen. Fred löste das Problem, indem er Rena erwürgte, zerlegte und verscharrte. 1972 heirateten Fred und Rose und erwarben in Gloucester ein Haus. Sie hatten mittlerweile zwei gemeinsame Die Grenze zwischen humaner Ordnung und Triebanarchie ist dünn und brüchig. Kinder sowie eine weitere Tochter aus Freds erster Ehe und stellten ein 17-jähriges Kindermädchen ein, das sich aber bald unwohl fühlte. Beide Eheleute brachten sie immer wieder mit sexuell anzüglichen Bemerkungen in Verlegenheit. Die Jugendliche kündigte und wurde kurz darauf von den Wests abgefangen, als sie abends ein Pub verliess. Sie wehrte sich und begann zu schreien, worauf sie von Fred bewusstlos geschlagen und in den Keller der Cromwell Street 25 geschleppt wurde, wo sie mit einem Gürtel gezüchtigt, von Rose missbraucht und von Fred vergewaltigt wurde. Danach bereitete Rose im Obergeschoss Tee für alle zu. Das Paar liess die junge Frau wieder gehen, unter der Bedingung, dass sie für weitere Treffen zurückkehre und niemandem von der Sache erzähle. Das Mädchen willigte ein und ging zur Polizei. Die Beamten überredeten sie, auf eine Anklage zu verzichten, um sich die demütigenden Befragungen vor Gericht zu ersparen. Die Wests kamen mit einer Busse von je 25 Pfund für Körperverletzung und unzüchtige Handlungen davon. Sie zogen daraus ihre eigenen Konsequenzen, sie liessen von nun an keines der Mädchen, das in den folgenden 20 Jahren in ihrem Keller landete, am Leben. Die meisten Opfer waren junge Autostopperinnen, die bereitwillig einstiegen, als sie sahen, dass eine Frau mit im Wagen sass. Sie wurden von Fred und Rose gefesselt, gefoltert und missbraucht, einige bis zu einer Woche lang, dann erstickt und anschliessend zerstückelt und im Hof oder im Garten vergraben. Gleichzeitig betrieb das Paar ein Bordell mit Rose als einziger Prostituierten. Acht Kinder sollte Rose auf die Welt bringen, vier waren von Fred, vier von den von Rose bevorzugten dunkelhäutigen Kunden. Fred schaute seiner Frau gerne zu, wenn sie sich mit anderen Männern oder den geknebelten Frauen im Keller vergnügte. Überall im Haus waren Videokameras installiert und die Aufnahmen konnten an sieben verschiedenen Geräten angeschaut werden. Die Videos spielten sie auch den Kindern vor, so wie diese überhaupt früh Objekt der West’schen Gelüste wurden. Ihre älteste Tochter Heather war 16, als sie sich gegen den Vater auflehnte. Die Eltern fesselten sie im Keller an ein Gestell, vergewaltigten sie, töteten sie, vergruben sie im Hof und errichteten einen Barbecue-Ofen über ihrem Grab. Die Wests galten als freundliches, umgängliches, nettes Paar. Sie stammten beide aus einfachsten Kreisen, in denen Gewalt alltäglich war. Fred musste als Neunjähriger mithelfen, Tiere zu schlachten, und Rose wurde angeblich von ihrem Vater missbraucht. Aber keines ihrer Geschwister hat später Menschen aufgeschlitzt oder wurde ein Kinderquäler. Und nicht einmal ihre eigenen Töchter und Söhne wiederholten an anderen das Schreckliche, was die Eltern ihnen unablässig angetan hatten. Die älteren unter ihnen entwickelten im Gegenteil Mut und ein klares moralisches Empfinden für die Amoralität, in der Mutter und Vater lebten. Rose und Fred West waren nicht krank oder schizophren oder schuldunfähig. Sie waren keine Opfer frühkindlicher Deprivation, keine Marionetten einer unheilvollen Fatalität. Sie waren böse, abgrundtief böse. So wie sich Shakespeares Richard III. – „I am determined to prove a villain“ – dazu entschieden hatte, ein Schurke zu sein und alle Moralgesetze zu ignorieren, wenn sie ihm auf dem Weg zur Macht hinderlich waren, entschieden sich die Wests dazu, alles aus dem Weg zu schaffen, was ihren Triebwünschen entgegenstand. Warum haben sie das getan? Es gibt keine versteckten Gründe. Sie taten es, weil sie es so wollten. Sie hatten einen riesigen sexuellen Appetit und starke sadistische Neigungen und sie merzten alles aus, was die Befriedigung gefährdete – Recht, Moral, Scham, Mitgefühl, Menschen. Die Wests fuhren während Jahrzehnten auf Beutefang, planmässig, skrupellos. Fred erzählte während der Haft, dass ihn „der entsetzte Ausdruck auf den Gesichtern“ erregte. In ihrem schmuddeligen Keller errichteten sie ein De Sade’sches Universum mit Peitschen, Aufhängevorrichtungen, Masken, Bandagen und Videokameras. Das Ehepaar West setzte ihre Ansprüche absolut und reduzierte den Wert der anderen Menschen auf deren Nützlichkeit 12 13 Reportage Die verschollene Uraufführung „Ist es der Teufel, der mich so verführt?“ aus „Richard III.“ von William Shakespeare Mitmachen gezwungen worden zu sein, für den eigenen Gebrauch. Ihr Paradies des Bösen an der Cromwell Street war die erhängte er sich. Seine in Haft Hölle der unfreiwillig dorthin Verschleppten. angefangene Autobiographie trug den Titel: „Ich wurde von einem Engel geliebt“. Ebenso verstörend wie die Geschichte selbst ist der Umstand, dass dem Das Böse verletzt die Ordnung der Dinge, Alptraum so lange kein Ende gesetzt es hebt die sozialen Naturgesetze auf. wurde. Hinweise und Gerüchte, dass bei Daher ist es nicht auszurotten und hat den Wests ungewöhnliche Sachen immer wieder Erfolg: Man rechnet nicht passierten, gab es immer wieder. Neben mit ihm. Das Funktionieren des Alltags, der frühen Anklage des ehemaligen des gesellschaftlichen Verkehrs setzt Kindermädchens gab es den lokalen Vertrauen in die Verlässlichkeit der Welt Videohändler, dem Fred Filmaufnahmen voraus, in die Berechenbarkeit von von gefolterten Frauen zum Verkauf Ursache und Wirkung. Dieser Umstand angeboten hatte. Der Händler hatte auf hilft dem Bösen, das sich in der Regel gut den Deal verzichtet und war stattdessen zu tarnen weiss, sich in den Verhältnissen zur Polizei gegangen, welche aber einzunisten. Auch als immer wieder nichts unternahm. Dazu kam es wegen irritierende Hinweise auftauchten – wer der sadistischen Erziehungspraktiken zu hätte sich schon ernsthaft vorstellen insgesamt 31 Besuchen der West-Kinder mögen, dass dieses freundliche Ehepaar in der Notaufnahme des Spitals. Die im Kellergeschoss ein Folter- und Ärzte behandelten Stichwunden an den Todeskabinett betrieb? Das Böse profitierte Füssen, Verletzungen im Genitalbereich, aber auch von der gesellschaftlichen eine Eileiterschwangerschaft bei einer Lockerung der familiären Bande. Längst 15-jährigen Tochter und in der Schule nicht alle Eltern der verschwundenen tauchten die Kinder regelmässig mit Mädchen gaben eine Vermisstenanzeige blauen Flecken und Würgemalen auf. bei der Polizei auf. Und ein weiterer Faktor begünstigte Rose und Fred. Noch nie zuvor hatte eine Kultur wie die westliche 1992 wurden die Wests wegen Vergewaltigung einer 14-Jährigen verhaftet. der Nachkriegszeit existiert, die das Im Anschluss fand die Polizei haufenweise Böse als Irrtum, als fehlgeleitetes Gutes, als Reaktion auf Defizite oder als pornographisches Material, darunter 99 selbstfabrizierte Videos, die die Polizei Kinderglaube, aber nicht als eigenständige Kraft und als wesentlichen Faktor des vernichtete, ohne sie genau angesehen zu haben. Es kam auch zu keiner Anklage, menschlichen Seins beurteilte. Der vorherrschende Therapeutismus, der die weil sich das Mädchen weigerte, gegen Grenzen zwischen gut und böse relativiert ihre Peiniger auszusagen. Die Leiterin der Ermittlungen war jedoch misstrauisch und jede politische oder individuelle Schandtat als Schrei nach Hilfe verniedlicht geworden. Ihr war zu Ohren gekommen, und infantilisiert, hat nicht nur die dass sich die West-Kinder zuflüsterten, Fähigkeit zur Imagination des Abgründigen ihre Schwester Heather sei von den Eltern unter dem Küchenboden vergraben verloren. Um sein harmonistisches Weltbild zu retten, wehrt er auch worden. Es dauerte jedoch mehr als reflexartig jede Wahrnehmung des Bösen ein Jahr, bis sich ihre Vorgesetzten ab. Als Fred West seinen Keller zur durchringen konnten, das Grundstück an der Cromwell Street umgraben zu lassen. Folterkammer umrüstete, fragte ihn eine Nachbarin, was er baue. Er baue seine Sie hatten sich Sorgen um die hohen Folterkammer, antwortete West. Die Kosten gemacht. In der Zwischenzeit war Frau erschrak, zog es aber vor, an einen Fred in Halbfreiheit und sollte sich Scherz zu glauben. später damit brüsten, noch eine Frau umgebracht zu haben. Nach dem ersten Knochenfund wurde Fred sofort wieder Der Fall West ist ein Extremfall, verhaftet und er begann stückchenweise aber kein Einzelfall. Die Enzyklopädie der seine Taten zuzugeben. Als er hörte, menschlichen Grausamkeit ist dass Rose behauptete, unschuldig und unerschöpflich und schreibt sich laufend von ihm unter Todesdrohungen zum fort. Vor kurzem versetzte die sogenannte Zwickauer Terrorzelle die Öffentlichkeit in Aufregung. Über einen Zeitraum von sechs Jahren hatten in verschiedenen Städten Deutschlands zwei Männer und eine Frau mindestens zehn Menschen erschossen, ohne Anlass, ohne Vorwarnung, am helllichten Tag, offenbar einzig, weil sie Türken waren. Einige Monate vorher hatte der Norweger Breivik beinahe 80 vorwiegend jugendliche Teilnehmer eines sozialistischen Ferienlagers regelrecht exekutiert, kaltblütig und mit einem zufriedenen Lächeln. Ein Jahr zuvor war der Skandal einer Clique amerikanischer Soldaten ruchbar geworden, die sich „Kill Team“ nannte und in Afghanistan Jagd auf unschuldige Zivilisten machte. Mit den erlegten Opfern posierten die GIs stolz grinsend vor der Kamera und gaben an, aus „Lust am Töten“ gehandelt zu haben. Bei jedem dieser schockierenden Ereignisse reagiert die Öffentlichkeit, als würde sie zum ersten Mal davon hören und die psychiatrischen, ideologischen, soziologischen Erklärungen der Experten werden ebenso schnell nachgeliefert wie sie zu kurz greifen. Doch Gewalt und Grausamkeit sind weder links noch rechts noch national oder schichtspezifisch. Das Gemeinsame an den Fällen ist, dass die Pläne zu den Taten in einem regelarmen Raum ausgebrütet worden sind und vorführen, wie gross das aggressive Potential in vielen von uns ist, wie dünn und brüchig die Decke der Zivilisation und wie verletzbar die Grenze zwischen humaner Ordnung und Triebanarchie. Das Böse ist nicht heilbar, aber man kann sich besser vor ihm schützen, wenn man nicht wegschaut und wenn man auf die Rousseauschen Illusionen einer gutartigen Menschennatur verzichtet. Eugen Sorg, 1949 in Zürich geboren, arbeitete nach seiner Promotion als Psychotherapeut und Journalist. Heute ist er Textchef bei der Basler Zeitung. Für seine Reportagen reiste er vielfach in Bürgerkriegsgebiete. 2011 erschien sein Buch: „Die Lust am Bösen. Warum Gewalt nicht heilbar ist“ (Nagel & Kimche). Wann hat das eigentlich begonnen, Romane für die Bühne zu bearbeiten, speziell die von Franz Kafka? Überraschende Antwort: im Zürich der 50er-Jahre! Frank Castorfs Adaption von Franz Kafkas „Amerika“ in der Schiffbau-Halle kommt am gleichen Theater heraus, an dem schon 1957 die umstrittene Uraufführung dieses Stoffes stattgefunden hat … Von Roland Koberg Der muntere, gar nicht wie Ende 70 aussehende Mann, der mich in Bern am Bahnhof abholt, hat als Erkennungszeichen ein, wie er am Telefon sagte, AdenauerHütchen aufgesetzt und sagt, für einen Schweizer überraschend, „Grüss Gott!“. Es ist der Schauspieler Hans-Joachim Frick, kürzlich feierte er sein 55-jähriges Bühnenjubiläum, zwei Wochen nach unserem Treffen hat er schon wieder Premiere: Im Berner Theater an der Effingerstrasse spielt er einen unheilbar kranken Patienten, der im Pyjama aus dem Spital flieht. Er ist der einzige noch auffindbare Mitwirkende aus der Uraufführung von Franz Kafkas „Amerika“ vom 28. Februar 1957 am Schauspielhaus Zürich, für die Bühne bearbeitet von Max Brod. Auf dem Besetzungszettel von damals stehen 26 Namen. Sie leben nicht mehr oder sind den Datenbanken unbekannt. Verschollene der Theatergeschichte. Hans-Joachim Frick, in Zürich geboren und gelernter Kaufmann, war als „Externist“ ans Schauspielhaus gekommen, als regelmässiger Gast für kleinere Aufgaben. Die Zürcher Schauspielschule, die er damals besuchte, war dem Schauspielhaus angegliedert, seine Lehrer waren die Künstler des Ensembles, viele noch aus dem legendären Emigrantenensemble. In „Amerika“ stand er dann plötzlich mit ihnen auf der Bühne. Besser gesagt, er hielt ihnen die Tür auf. Denn HansJoachim Frick verkörperte in Max Brods Kafka-Dramatisierung den Liftboy Renell, der im geheimnisvollen Hotel Occidental Dienst tut – gemeinsam mit der Hauptfigur Karl Rossmann und weiteren Liftboys. Bei der Uraufführung von „Amerika“ 1957 dabei: Hans-Joachim Frick In der Lobby des Berner Hotels Steigenberger – früher ein gemütlicher Treffpunkt für den Schweizerischen Bühnenkünstlerverband, dem Frick jahrelang vorstand, heute mit Geld aus Katar vergoldet – kramt Hans-Joachim Frick ein altes Schwarzweissfoto hervor, auf dem auch er selbst zu sehen ist: Aus einiger Entfernung beobachtet Renell stramm die Zärtlichkeiten zwischen Karl Rossmann und Therese, der Assistentin der Oberköchin. Zwischen den gemalten Lifttüren scheint die Hoteluhr wie der Mond zu leuchten. Im Rollenbuch von Max Brod steht als Beschreibung für Renell: „trotz seiner Jugend etwas verlebt, hohlwangig, neigt zum Sarkasmus“. „Hohlwangig war ich nie“, sagt HansJoachim Frick. Renell ist Teil eines Systems, das den 17-jährigen Karl niemals ankommen lässt – in dem Land, in das ihn seine deutschen Eltern mit dem Schiff geschickt haben, nachdem das Dienstmädchen von ihm schwanger geworden war und man die Schande fürchtete. Immer dann, wenn der Leser auf den Gedanken kommen könnte, jetzt ginge es mit Karl aufwärts, jetzt dürfte eine amerikanische Vom- Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte beginnen, kommt einer wie Renell und lenkt die Geschicke zu Karls Ungunsten um. Renell lässt einen Vagabunden ins Hotel, der sich als guter Freund Karls ausgibt und diesen durch sein Verhalten desavouiert. Karl wird – wie so oft bei Kafka – ein informeller Prozess gemacht, in dessen Verlauf ihm nicht nur seine Stelle, sondern auch alle Fürsprecher verloren gehen. Karls Fazit könnte als Motto über allen Kafka-Werken stehen: „Es ist unmöglich, sich zu verteidigen, wenn nicht guter Wille da ist.“ „Wir erstarrten ja vor Ehrfurcht, das gab’s damals noch“, erinnert sich Hans-Joachim Frick an die Proben als 21-Jähriger, der gerade mal seine dritte Rolle spielen durfte (die erste war Rudenz in „Wilhelm Tell“). Regie bei „Amerika“ führte mit Leonard Steckel eine Theaterlegende, die während des Zweiten Weltkriegs als Antipode von Leopold Lindtberg am Schauspielhaus wirkte, zurück nach Deutschland ging und nun von der Zürcher Öffentlichkeit wie ein verlorener Sohn begrüsst wurde. Steckel sei ein Genauigkeitsfanatiker gewesen, der auf der ersten Probe alle Masse für Möbel, Türen und sonstige Auftrittsmöglichkeiten 14 15 Fotogalerie Schon gesehen? Szenen aus dem Repertoire „Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns! Jeder ist willkommen!“ aus „Amerika“ von Franz Kafka ansagte. „Zu spät!“ war einer der Sätze, die sich dem jungen Externisten ins Langzeitgedächtnis brannten, weil er dachte, eine bei der letzten Probe besprochene Pause von drei Sekunden zwischen Stichwort und Auftritt einhalten zu müssen. „Ich dachte …“, wollte Hans-Joachim Frick sagen – „Ein Schauspieler, der denkt!“ unterbrach ihn Steckel. Bei der Premiere stand der Regisseur dann die ganzen 2 ¾ Stunden beim Inspizientenpult und tröstete einen Liftboy-Kollegen wegen einer Panne: „Die Premiere ist nie die beste Vorstellung.“ Über alle seine Auftritte hat Hans-Joachim Frick penibel Buch geführt, einschliesslich der 32 Jahre, die er später am Stadttheater Bern engagiert war. Er hat jede einzelne Vorstellung mit Tintenfüller in ein blaues Schulheft eingetragen, 18 waren es bei „Amerika“, darunter Abstecher nach Winterthur und Schaffhausen. Unter dem Titel dieser „Tragikomödie in 16 Bildern“ steht doppelt unterstrichen das Wort „Welt-Uraufführung“. Wie es kam, dass diese Premiere ein durchschlagender Misserfolg war und ebenso in Vergessenheit geriet wie Kafkas Karl Rossmann in den Weiten Amerikas, das kann sich Hans-Joachim Frick jedoch nicht erklären. Die Kritiken hat er nicht gesammelt. Die Verrisse fast der kompletten deutschsprachigen Presse, vom „Spiegel“ bis zu den „Oberösterreichischen Nachrichten“, findet man dafür im Zürcher Stadtarchiv. „Kafka-Pleite in Zürich“ war noch eine der sachlicheren Überschriften. Und schuldig gesprochen wurde immer Max Brod. Ohne Zweifel hatte Max Brod mit seiner Fassung seinem Freund und Gott einen postumen Liebesdienst erweisen wollen. Er lebte zu diesem Zeitpunkt in Tel Aviv, war Dramaturg am Nationaltheater und weltberühmt als der Mann, der sich Kafkas Anweisung widersetzt hatte, einen Grossteil seiner Handschriften zu vernichten. Er hatte noch vor seiner Flucht nach Palästina alle drei Romane ediert, die erste Kafka-Biographie geschrieben und eine sechsbändige Werkausgabe vorgelegt. Brod hatte in Kafka schon „den grössten Dichter unserer Zeit“ gesehen, als dieser in literarischen Kreisen noch unbekannt war. 1912, als Kafka seinen „amerikanischen Roman“ zu schreiben begann, erkundigte sich Brod unentwegt nach dessen Fortgang und liess sich neue Kapitel schicken oder mündlich von Kafka vortragen. Dann schrieb er in sein Tagebuch: „Herrlich! Erstklassig! Und wie wir gelacht haben!“ Doch der Roman geriet nach dem 6. Kapitel ins Stocken, wurde beiseitegelegt, wiederaufgenommen, fallengelassen. Max Brods Hoffnungen, seinen Freund bald berühmt zu sehen, zerschlugen sich nicht zuletzt durch dessen Skrupel, Selbstverachtung, Verzweiflung. Fünf Jahre, nachdem alles so herrlich unter Gelächter begonnen hatte, meinte Brod Kafka mitteilen zu müssen: „Du bist in Deinem Unglück glücklich.“ will, melde sich! Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort!“ Im Roman sind das uneingelöste Versprechen, konterkariert von dem Satz: „Plakate gab es viele. Plakaten glaubte niemand mehr.“ In der Bühnenfassung trifft Karl beim Aufnahmeverfahren Therese aus dem Hotel wieder, die bereits engagiert ist und Karl eine glänzende Theaterzukunft verheisst: „Wir spielen auf den weiten Flächen der Vereinigten Staaten, die Räume sind fast unendlich. Jeder spielt die ihm passende Rolle.“ Und der Personalchef lobt Karl, dass dieser die Werbungen „gesehen, gelesen, verstanden“ habe: „Das ist schon ein Anfang, ein Zeichen der Gnade. Er gehört zu uns. Er ist aufgenommen.“ Viel spricht dafür, dass Brod Kafka glücklich sehen wollte und sei es glücklich im Unglück. Seine „Amerika“Bearbeitung ist ein Beispiel dafür. Ohnehin schätzte Brod diesen Roman als „hoffnungsfreudiger“ und „lichter“ ein als die anderen. Kafka, so Brod in seinem „Amerika“-Nachwort, habe ihm anvertraut, dass der Roman versöhnlich ausklingen sollte. Im gigantisch-grotesken „Naturtheater von Oklahoma“, das im fragmentarischen achten und letzten Kapitel Werbefeldzüge wie für einen Krieg unternimmt und schliesslich auch Karl Rossmann aufnimmt (als Techniker, nicht als Schauspieler), sollte dieser „wie durch paradiesischen Zauber Beruf, Freiheit, Rückhalt, ja sogar die Heimat und die Eltern“ wiederfinden. Auf dieses Stichwort begann Hans-Joachim Frick in der „Amerika“-Uraufführung zu singen, die handschriftlichen Noten von Hauskomponist Rolf Langnese besitzt er noch. Als Liftboy war er lange abgespielt, jetzt lieh er seinen ausgebildeten Tenor dem pompösen Schlusschor. Dieser intonierte, damit Karls grosses Glück zum Greifen nah werde, noch einmal die Sätze des Werbeplakats: „Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns! Jeder ist willkommen! Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann!“ Und dazwischen jubelte Karl: „Ich bin aufgenommen. Reserl, hast du’s gehört?“ Vorhang. Matter Applaus. Das Manuskript endet indes abrupt mit einer Zugreise nach Oklahoma („Jetzt erst begriff Karl die Grösse Amerikas“) und es gehört viel guter Wille dazu, sich Karls Wirken am „Naturtheater von Oklahoma“ nicht als eine nächste riesengrosse Desillusionierung vorzustellen, als eine weitere (endgültige?) Stufe treppab ins Verschollengehen. Max Brod aber wollte Karl Rossmann retten, vielleicht stellvertretend für seinen Schöpfer. So kam es, dass Max Brod das mysteriöse Werbeplakat des „Naturtheaters“ rundum positiv bewertete. „Jeder ist willkommen!“, heisst es dort, und: „Wer Künstler werden Hans-Joachim Frick aber bekam schon bald darauf sein erstes Fest-Engagement, in Dortmund, dem Oklahoma Deutschlands, wenn man so will. Amerika nach dem Roman von Franz Kafka Regie Frank Castorf, Bühne Aleksandar Denic, Kostüme Adriana Braga Peretzki, Video Andreas Deinert Mit Margit Bendokat, Gottfried Breitfuss, Patrick Güldenberg, Marc Hosemann, Robert Hunger-Bühler, Irina Kastrinidis, Sean McDonagh, Siggi Schwientek, Lilith Stangenberg u.a. Ab 14. April im Schiffbau/Halle „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von Horváth, Regie Karin Henkel 16 „Zwanzigtausend Seiten“ von Lukas Bärfuss, Regie Lars-Ole Walburg 17 18 19 „Der ideale Mann“ von Oscar Wilde/Elfriede Jelinek, Regie Tina Lanik „Der Hund mit dem gelben Herzen oder Die Geschichte vom Gegenteil“ von Jutta Richter, Regie Philippe Besson „Illusionen“ von Iwan Wyrypajew, Regie Julia Burger 20 Porträt Ruedi Häusermann Eine Lehre der Wahrnehmung Wie verhalte ich mich dem Unbekannten gegenüber? – Ein Lebensthema Ruedi Häusermanns Der Komponist und Regisseur Ruedi Häusermann, dessen „Vielzahl leiser Pfiffe. Umwege zum Konzert“ im April in der Schiffbau-Box zur Uraufführung kommt, ist am Schauspielhaus kein Unbekannter: 2010 war „Der Hodler. Eine musiktheatralische Einsicht“ in der Box zu sehen, momentan gastiert sein riskanter Unterhaltungsabend „Kapelle Eidg. Moos“ auf der Pfauenbühne. Die Dramaturgin Judith Gerstenberg begleitet Ruedi Häusermann und seine Kunst seit vielen Jahren. Der hier abgedruckte Text basiert auf der Laudatio, die sie bei der Verleihung des Zürcher Kunstpreises 2011 an Ruedi Häusermann gehalten hat. Es gibt Begegnungen, die eine Weiche im Leben stellen. Eine ganz entscheidende Weiche war meine Begegnung mit Ruedi Häusermann, nicht nur in dem konkreten Sinne, dass sie mich von Hamburg nach Zürich an das Theater Neumarkt lockte, auf dessen Probebühne ich erstmals eine Arbeit von ihm sah, seinen frühen Walser-Abend „Warum Forellen in Rapperswil essen, wenn wir im Appenzeller Land Speck haben können“, sondern auch und vor allem im Sinne einer Lebensschule, die mein Bewusstsein geprägt hat, meine Sicht der Dinge, meinen Kontakt mit der Welt, und die mir auch die Augen geöffnet hat für das, was „Künstler“ überhaupt meint. Denn es beinhaltet doch weitaus mehr als den begabten Hersteller von Werken, mehr als die Fertigkeit zum Komponieren, zum Spielen, zum Schreiben, zum Regieführen, selbst wenn sie in höchster Qualität vorliegt – es meint eine Daseinsform, die bereit ist, all das, was zu solch einem Leben dazugehört, auch wirklich auszuhalten: auszuhalten die existentielle Ungesichertheit; auszuhalten das stetige Denken ins Offene, vorher Nicht-Gewusste; auszuhalten die Irrpfade, deren verschlungene Führung womöglich in einer Lichtung endet, womöglich aber auch nicht; auszuhalten den eigenen 21 Widerstand, keinen Zwängen nachzugeben, aber auch keinen Verlockungen des Betriebes; auszuhalten, sich als einzigem Massstab zu vertrauen, da Neuland nur alleine zu betreten ist und vage Ahnungen schwer zu teilen sind; auszuhalten, das Mögliche so ernstzunehmen wie das Wirkliche; auszuhalten, sich immer wieder lösen zu müssen von Bewährtem und Gelungenem; vor allem aber ein Arbeiten auszuhalten, das sich täglich vor die Frage gestellt sieht, welche Berechtigung es hat, welchen Wert; das bedeutet auch auszuhalten jenen prekären Moment, wenn das, was die Zeit, die Wochen, Monate, ja zum Teil Jahre ausgefüllt hat, zum ersten Mal fremden Ohren und Augen preisgegeben wird, jenen Moment, in dem das Selbstverständnis und die Existenzberechtigung des Künstlers zur Disposition stehen. Jedes Mal. Denn in diesem Moment der Veröffentlichung erweist es sich: Das Erarbeitete ist alles oder nichts – es kommt darauf an, ob die Luft und das Licht diesem zum Eigenleben verhelfen oder es absterben lassen. Deshalb auch wird dieser Moment, der ein Moment der Verwandlung ist, als Schreckens- und Glücksmoment zugleich empfunden. Oft ist es ein langer Weg dahin – auch das gehört dazu: die Zeit auszuhalten, die man braucht – ein Weg, reich an Höhenflügen und Abstürzen, an Scham und Selbstüberlistungsversuchen. Das alles auszuhalten und dabei die Fröhlichkeit nicht einzubüssen. Das ist nicht zu unterschätzen. Dieser „Unterricht in der Kunst, die Fröhlichkeit nicht einzubüssen“ war nicht nur der Titel von Häusermanns zweitem WalserAbend, sondern ist ein Unterricht, den er sich selbst verordnet. Und er ist ein wahrer Meister darin, ihn zu erteilen. Jener prekäre Moment, in dem ein Werk an die Luft gelassen wird – für Häusermann gilt das im ersten Schritt meist für seine auf dem Goffersberg entwickelten Kompositionen, für die er sich in regelmässigen Abständen aus dem Lauf der Dinge zurückzieht, sein Selbstverständnis als Komponist auslotet, ohne Spekulation auf Einpassung in ein Stück. Im zweiten Schritt dann die daraus entwickelten Theaterabende, die ein eigenes Genre ausmachen, das am ehesten mit „optisiertes Konzert“ zu bezeichnen wäre, und die immer noch schön fremd in der Kulturlandschaft stehen – jenen prekären Moment also hat Häusermann mit seinem in Wien im Kasino des Burgtheaters entstandenen Abend „Die Glocken von Innsbruck läuten den Sonntag ein“ explizit thematisiert. Es war der Versuch, die Innenwelt eines Menschen erlebbar zu machen, der sich damit beschäftigt, eine Form zu finden, eine Materialisierung seiner Gedanken, damit sie les-, hör- bzw. anschaubar werden. In „Die Glocken von Innsbruck ...“ sieht man den Bedeutungsfluss der Dinge und Wörter im Theater, wie sich aus Baugerüst, Kartons, Dia- und Hellraumprojektoren, zerknülltem Packpapier, Schlagschnüren, marmorfurnierten Holzplatten, Stühlen, Tschinellen, Klavieren, präpariert mit allerlei Hausrat, plötzlich vor den Augen des Zuschauers eine Flusslandschaft auftut, saftige Wiesen mit Blumen, die zuvor noch achtlos zerknülltes Verpackungsmaterial waren, von Weitem ein Dorf mit Kirchturm, man hört fernes Geläut – oder nicht? –, atmende Akkordeons evozieren schneidenden Wind, Klaviere klingen nach Zither und Hackbrett (oder dem einen oder anderen Specht) – alles schön am Hellraumprojektor protokolliert, eine Geheimwissenschaft für Aussenstehende, minutiöser Ablaufplan für die Beteiligten, dazwischen immer wieder die schöne Stimme des Dichters Händl Klaus, leise, fast flüsternd seine „Legenden“ – feine, abgründige Prosaminiaturen – lesend, als Selbstgespräch, die einen erschrecken lassen durch ihre Aufmerksamkeit auf die Unaufmerksamkeit, dann ein Klick, Lichtwechsel und eine Grossstadt-Skyline tut sich auf, eine Schattenlandschaft, bevor klar wird, dass man die ganze Zeit nur den Aufbauarbeiten für einen Vortragssaal beigewohnt hat. Denn unterdessen wurden die marmorfurnierten Bodenplatten vollständig verlegt. Der Dichter sitzt an einem Tisch in der Mitte, Blick ins Publikum, das Manuskript vor sich. Der Moderator eröffnet den Abend, Saallicht aus. Ende. War es in dieser Arbeit das explizite Thema, möchte ich behaupten, dass dieser Moment der Verwandlung versteckt Gegenstand aller Abende Häusermanns ist. Und: der Weg dorthin. Zu begreifen, was das in seinem Wesen ist – „Kunst“ – verdanke ich Ruedi Häusermann, der beharrlich forscht, wodurch ein künstlerischer Prozess überhaupt in Gang gesetzt wird, wie diese Welten entstehen, die den Zuschauer staunen machen und verzaubern, die einen wacher hinterlassen für die Phänomene des Alltags und die Begegnungen stiften, die nicht vorzudenken waren. Aber vielleicht weiss auch keiner so gut wie er, wie schwer sie herzustellen sind. Denn sie sind nicht zu haben als blosse Ansammlung schöner Ideen, sondern es geht darum, das oft über Monate aufgelaufene Material in einen Fluss zu bringen, einen Gesamtklang zu finden, einen, den wahrzunehmen er den Zuschauer und Zuhörer in seinen Abenden lehrt. Dass Ruedi in diesem Schaffensprozess im gleichen Zuge, in dem diese Welten entstehen, Einblick in sie gibt, ist ein grosses Geschenk. Ich nehme es als Gesprächsangebot von jemandem, der sich mir öffnet, als den Versuch einer Kontaktaufnahme mit der Aussenwelt, der er mitteilt, wo er gerade steht mit seinem Verständnis. Kaum einer gibt diesen Prozess preis, vielleicht aber ist sich auch kaum einer seiner so bewusst. Jemand, der wie Ruedi Häusermann aufgewachsen ist in einer Umgebung, in der das Wort „Kunst“ die Ofenbank meint, durch die der Feuergang gelegt wird – er kommt aus einer Hafner-Familie –, weiss, dass sich die Wirklichkeit an objektiven Kriterien misst: Ist etwas schief oder gerade, wird es seine Funktion erfüllen oder muss korrigiert werden? Ist der Feuergang zu lang geraten, qualmt es in der Stube und die Kunst muss abgerissen werden, damit das Husten aufhört. Das ist bei dem anderen „Kunst“-Begriff weniger eindeutig. Daher stempelt Ruedi Häusermann auch jede seiner Arbeiten mit „Garantiert kein Schwindel“ – ein Jahrmarktsspruch, der zugleich redliche Versicherung ist, keinem Bluff ausgesetzt zu werden, zugleich aber auch als blosse Behauptung die Not des Anpreisers deutlich macht, der sich offensichtlich auf 22 23 „Muss möglich sein.“ Ruedi Häusermann angreifbarem Terrain befindet. Denn wer legt die Kriterien fest? Ein Lebensthema Häusermanns ist denn auch die Frage: Wie verhalte ich mich dem Unbekannten gegenüber, das ich nicht den Kategorien „gefällt mir, „gefällt mir nicht“ unterwerfen kann, etwas, das mich nicht automatisch in meinem gegenwärtigen Bewusstsein bestätigt? Ihn interessiert das freie Feld, das scheinbar ungeordnete Material, das erst noch seine Form sucht, seine Gestaltung, und besonders interessieren ihn die Zwischenstufen auf dem Weg von dem einen Zustand in den anderen. Die Zwischenstufen nämlich werfen einen zurück auf sich selbst: Wie betrachte ich, wie begegne ich dem, was mir entgegentritt? Und ich werde mir der Verantwortung bewusst, die mein Blick als Zutat bedeutet. Sei es auf die Kunst, aber auch auf das Leben. Wir haben es hier mit einer Lehre der Wahrnehmung zu tun. Und zwar in beide Richtungen. Da Ruedi Häusermann beiden Welten zugetan ist, sowohl der handfesten als auch der geistigen, sie beide gut genug kennt, erweist er beiden auch gleichermassen seine Referenz. Das Vertraute der einen nutzt er, um die Räume für das Unbekannte der anderen zu öffnen. Davon zeugt auch sein jüngster Abend „Kapelle Eidg. Moos“, in dem er die Ländlermusik Kasi Geisers in die Umgebung seiner eigenen Klangwelten stellt. Dieser auch am Schauspielhaus Zürich zu sehende Abend hatte im Oktober Premiere in der Tuchlaube in Aarau – da, wo vor 20 Jahren alles begann mit Häusermanns Soloprogramm „Schritt ins Jenseits“ – die Urzelle seiner musiktheatralischen Arbeit. Mit diesem ersten vollkommen eigenständigen Projekt befreite er sich 1992 tatsächlich aus früheren Kontexten, hinein ins Offene, um seinem persönlichen Interesse auf die Spur zu kommen. Er hatte nach einer Form gesucht, der Freien Musik einen Raum zu öffnen, der er sich schon früh, während seines Zürcher Musikstudiums zugewandt hatte, um sich von Harmoniestrukturen, vom Time und von gegebenen Formen zu befreien. Er hatte die Grenzen für sich sprengen müssen, um wieder neue ziehen zu können oder vielleicht auch, um die alten Grenzen als nicht belastend für sich neu entdecken zu können. In den Konzerten, die er auch heute noch manchmal, leider viel zu selten, spielt – zumeist gemeinsam mit dem Cellisten Martin Schütz, dem Percussionisten Martin Hägler und dem Soundspezialisten Philipp Läng – werden einander ohne Erwartungen Ideen zugespielt. Diese als solche zu begreifen, sie einander abzunehmen oder auch, was mitunter am schwierigsten ist, sie vorbeiziehen zu lassen, ist die Kunst dieses miteinander Spielens. So durchwandern diese vier sehr eigenen Musikerpersönlichkeiten gemeinsam Welten, von denen sie vorher nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. „Gut gelaunt! Musst Du dazu sagen!“, würde Ruedi mir jetzt zuwerfen, hätte er die Chance dazu. „Das ist wichtig, ohne gute Laune geht es nicht.“ Es ist immer wieder diese Musik, die sich permanent aus sich selbst heraus erneuert, die Häusermann in theatralische Kontexte setzt, obgleich wirklich kaum etwas theaterferner ist als eben sie. Aber Häusermann dachte: „Muss möglich sein“, dafür ein Verständnis zu stiften, sie hörbar zu machen für mehr als eine Handvoll Spezialisten. Denn das war das Los der Freien Musik, massentauglich war sie nicht. Und so wagte Häusermann – unterstützt von seinem langjährigen künstlerischen Wegbegleiter Giuseppe Reichmuth – den Schritt ins Jenseits: Er selbst stand auf der Bühne und verkörperte die Doppelrolle, die er für dieses Projekt tatsächlich innehatte. Er war zugleich Aufnahmeleiter (Regisseur) und angestellter Künstler (Darsteller) in einem kleinen Tonstudio. Der Künstler produziert nach Auftrag Geräusche und spielt auf diversen Instrumenten Musikstücke ein, doch die Stimme des Aufnahmeleiters aus dem Off unterbricht ihn ständig, demütigt, verlangt neue Versuche, bis schliesslich der so redlich bemühte Auftragskünstler Häusermann den Lautsprecher, aus dem diese Ermahnungen kommen, in einem Eimer Wasser versenkt. Endlich befreit von den Zurechtweisungen, wie etwas zu sein habe, geschieht das Wunder. Aus all den stoppelnden Versuchen und Nebengeräuschen (darunter provozierte Zuschauerreaktionen), die bar jeder Aura waren, entsteht plötzlich ein grossartiges Konzert. Die im ersten Teil live aufgenommenen Einspielungen verflechten sich zu einer überraschenden Geschichte, Häusermann improvisiert dazu virtuos auf seinen Instrumenten und dem vorherigen Chaos entwächst eine ausformulierte Biographie, eine ganze Welt. Tatsächlich hat man als zuhörender Zuschauer am Ende einem Schöpfungsakt beigewohnt. Um dieses Erlebnis zu bestätigen, aber vor allem auch, um es einzufangen und das Pathos zu brechen, lässt Häusermann als Zugabe Gott als Kasperlipuppe auftreten, die die Zuschauer mit dem Lied „Oh, wie wohl ist mir am Abend“ entlässt. Tatsächlich hat Häusermann in „Schritt ins Jenseits“ ein Prinzip angelegt, das sich auch in den anderen Abenden wieder findet: wie aus dem Nichts, der Unübersichtlichkeit, dem Zufälligen, dem Unbeachteten plötzlich etwas entsteht, von dem man erst am Ende entdeckt, dass jedes Detail vorausgedacht war und alles einem geheimnisvollen Plan unterstellt war. Garantiert kein Schwindel, alles live und Handarbeit. Wahrlich! Die Präparation der kleinen Bühne für die Vorstellung hat jeweils Tage gedauert und nur Häusermann allein wusste um ihre Gesetzmässigkeiten. Es braucht eine grosse Liebe zu den Dingen, sich ihnen so zu widmen. Es ist aber in erster Linie auch eine grosse Lust an der Zauberei, die Dinge zu verändern, zu verwandeln, optische Täuschungen hervorzurufen, das Gegenüber staunen zu machen, es zu beobachten, wie es konzentriert auf die Szene schaut und doch nicht versteht, wie es dazu kommen konnte, was sich ihm da gerade auftut. Die Herstellung offen zu zeigen, den Zauber aber zu ernten, weil der Zuschauer unterdessen vergessen hat, was er zuvor gesehen hat, ist das diebische Vergnügen des Machers. Es ist die Lust daran, das Unmögliche möglich zu machen, das Feste, die Materie zu verändern, sie in Schwingungen zu versetzen – und tatsächlich ist die Probenarbeit immer ein schweisstreibender Kampf mit dem sich viel erzählen über seine Art, Menschen um sich zu scharen, sie mitzunehmen – wirklich einzuladen – auf diese Forschungsreisen, die jeden verändert zurückkehren lassen, über die wichtigen Nachgespräche in den Beizen, die sich als Probenausklang tarnen, aber eigentlich eine Verschwörung erzeugen. Unbedingt hätte ich erzählen wollen über Ruedis Lust, jede noch so alltägliche Situation für Wert zu befinden, sie in eine kleine Inszenierung umzuwandeln, durch kleine Verrückungen – sei es auch nur für eine Person – und die einen unwillkürlich lachen machen. Eben über jenen Unterricht in der Kunst, die Fröhlichkeit nicht einzubüssen, die er einem im Kleinen täglich erteilt. Kunst lebt durch die Ausnahme und durch eine Konsequenz. Ruedi Häusermann ist ein solitäres Phänomen. Er ist der einzige, der das machen kann, was er macht – und der es wirklich macht und lebt. Denn das, was ihn dazu treibt, ist keine Brille, Ruedi Häusermann in der Box im Schiffbau die er sich nach Belieben auf- und der Satz, den wir uns während der Proben absetzen kann, sondern sein Verständnis. Material. Erstens, weil alles, scheinbar Diese Konsequenz, für die es keine lachend zuwerfen und doch eben ist absichtslos, immer penibel genau an Erfolgsgarantie gibt, ist selten und ihr gilt dahinter ein grosser Ernst. Grenzen nicht der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu anzuerkennen, sie erst einmal beiseite zu mein hoher, mein höchster Respekt. Sie sein hat und weil es partout immer ist auch mein Trost, denn in einer Welt, etwas können muss, das seine eigentliche schieben, um frei denken zu können, ist in der – hypnotisiert von der Gegenwart – die erste Lektion, die man bei ihm lernt. Funktion nicht vorsieht – zum Beispiel die Entwurfsphantasie zunehmend Sie ist eine Kampfansage (das ist ein sollen Möbel einer voll ausstaffierten verlorengeht, entwickelt das, was Ruedi Wort, das nicht zu Ruedi passt, dennoch Wohnstube selbständig den Raum Häusermann tut, eine subversive verlassen, dabei noch Klänge produzieren, sage ich es: eine Kampfansage) an die Sprengkraft. Er ist im wirklichen Sinne ein Wirklichkeit, wie sie sich uns darbietet. sich mit einem Streichquartett verbinden, Künstler. Balkone sollen hin und wieder den Man könnte noch viel ausführlicher Spielern zunicken, unmerklich natürlich, über Ruedi Häusermanns Kompositionen ohne auftrumpfend auf diesen famosen berichten, seine Musik, über Effekt zu verweisen, Klaviere sollen Mehrspurgeräte und Notationen, über die spielend Räume durchqueren und sich musikalischen Proben und die Konzerte anschliessend verbeugen, selbsttätig ... mit seinem „NichtohnemeinenSohn“Orchester in der Garage von Lenzburg, „Muss möglich sein“ ist sein Satz. über die feinsinnigen Abende, in denen er Vielzahl leiser Pfiffe. Umwege zum Konzert „Muss möglich sein“ – mit diesem Satz von Ruedi Häusermann sich auf seine Weise vor dem Werk von hält Ruedi Häusermann den irritierten Blicken technischer Direktoren, manchmal Robert Walser, Karl Valentin, Adolf Wölfli, Uraufführung Peter Bichsel, Daniil Charms, Elfriede auch verwunderter Spieler und Komposition und Regie Ruedi Häusermann, Jelinek, Paul Scheerbarth, Wilhelm Busch, Bühne Bettina Meyer, Kostüme Dramaturgen stand – unbeirrt. „Muss Ferdinand Hodler verbeugt hat, möglich sein“ habe ich von ihm gelernt ... Barbara Maier, Video Ruth Stofer gleichzeitig Auskunft gebend, welche Bis jetzt hat er immer Recht behalten. Mit Rahel Hubacher, Isabelle Menke, Begegnungen und Biographien sein Ich weiss nicht, hat Ruedi mit seinen Philipp Läng, Herwig Ursin, Bewusstsein geprägt haben, respektvolle begeisterten Reden nur die Menschen Milian Zerzawy und Annalisa Derossi, verführt oder auch die Gegenstände? Auf Abende, die darauf verzichtet haben, Panagiotis Iliopoulos, Iñigo Giner Miranda, ihren jeweiligen Gegenstand dem eigenen Daniele Pintaudi (Klavier) jeden Fall tun alle am Ende das, was er Verständnis einzugemeinden. Es liesse visioniert hatte. „Muss möglich sein“ ist Ab 20. April im Schiffbau/Box 24 25 Porträt Markus Scheumann Wundersam verknotete Existenzen Markus Scheumann war in dieser Spielzeit schon der Müssiggänger Valerio in „Leonce und Lena“, spielte den korrupten Parlamentarier Robert Chiltern in „Der ideale Mann“ sowie den unerbittlich nach der Wahrheit suchenden Matthäi in „Das Versprechen“. Demnächst wird er mit Werner Düggelin Lord Bolingbroke in Eugène Scribes Komödie „Das Glas Wasser“ proben. Von Andrea Schwieter Den Beruf des Schauspielers könne man nie, sagt Markus Scheumann. Und was im ersten Moment kokett klingen könnte aus dem Mund eines so erfahrenen Schauspielers, der so viele grosse Rollen gespielt hat, zeugt in Wahrheit von grossem Respekt gegenüber seinem Beruf. Man müsse sich zyklisch immer wieder neuerfinden und sich dabei im Auge behalten, weil man sich als Mensch verändere und als Schauspieler eben nichts anderes zur Verfügung habe als sich, seinen Körper, seine Stimme, seine Persönlichkeit. Gefragt, warum er sich entschieden habe, Schauspieler zu werden, gibt Markus Scheumann eine fast lapidare Antwort – nicht ohne vorausgeschickt zu haben, dass er mangels einer aufsehenerregenderen Geschichte alle paar Jahre einen anderen Grund für seine Berufswahl angebe: weil es ihm seit Schultheatertagen einfach Spass mache und ihm damals alles andere zu anstrengend vorkam. Insofern war es eine Instinkt-, vielleicht auch eine Luxusentscheidung – und nahezu luxuriös war auch sein Weg an die Schauspielschule. Während andere von Vorsprechen zu Vorsprechen durch die Republik reisen, um dann endlich irgendwo aufgenommen zu werden, führte ihn sein Weg geradewegs an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg (aus dem wiederum sehr lapidaren Grund, dass dort die terminlich nächstgelegenen Aufnahmeprüfungen stattfanden), wo er auf Anhieb den Sprung ins Schauspielstudium schaffte. Vielleicht auch eine Art Flucht aus seiner Heimatstadt Dortmund, der er über all die Jahre allerdings sehr verbunden geblieben ist – nicht nur familiär, sondern insbesondere auch als begeisterter Das stetige sich Neuerfinden bleibt auch mit zunehmender Erfahrung: Markus Scheumann Fussballfan von Borussia Dortmund. Das Reisen durch die Republik folgte nach der Schauspielschule: Lübeck (vier lehrreiche Anfängerjahre, die er auf keinen Fall missen möchte), Wiesbaden und dann Roberto Ciullis Theater an der Ruhr in Mülheim – eine grosse Zäsur, weil er dort ein anderes Konzept von Theater kennenlernte und lebte, ein Ensembletheater der ganz besonderen, weil familiären und vertrauten Art: In fast jeder Produktion steht das komplette Ensemble – ein knappes Dutzend Schauspieler – gemeinsam auf der Bühne, auf jeder Probe sind alle da, unabhängig davon, welche Szene gerade probiert wird. Vor allem aber verbinden ausgedehnte und ungewöhnliche Gastspielreisen, für die Ciullis Theater an der Ruhr bekannt ist: Markus Scheumann hat in europäischen Ländern gastiert und u.a. im Iran, Irak, in Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan und Turkmenistan (wo selbst begleitende Journalisten nicht einreisen durften) Theater gespielt und dabei immer wieder festgestellt, wie global die Theatersprache doch funktioniert. Reisen verbindet – und vielleicht ist Markus Scheumann nicht zuletzt durch diese Erfahrungen zu einem absoluten Ensemblespieler geworden, einem Teamplayer, der es liebt, sich auf der Bühne mit seinen Kollegen die Bälle zuzuwerfen. Er ist ein Schauspieler, der mit jeder Rolle auch Verantwortung für die gesamte Produktion übernimmt, er denkt das grosse Ganze mit. Ich werde nie vergessen, wie Markus Scheumann, nachdem wir ihm bei seinem ersten Zürichbesuch die Pfauenbühne zeigten, der erleichterte Satz entfuhr: „Wie schön, auf dieser Bühne muss ich endlich nicht mehr schreien!“ Und in der Tat: Nach den Theaterdampfern mit ihren riesigen Bühnen in Köln und Düsseldorf, seinen beiden letzten Stationen vor Zürich, erlaubt die Pfauenbühne auch eine leisere, feinere Spielweise – und genau darin liegt eine grosse Stärke in Markus Scheumanns Spiel: Er ist ein Meister der Zwischentöne, ein Schauspieler, der mit der Sprache umzugehen weiss, die ungeheuerlichsten Sätze trocken in den Raum zu setzen vermag und dabei für jede seiner Figuren nicht nur eine eigene Sprache entwickelt, sondern auch eine unverwechselbare Körperlichkeit – nicht nur, wenn sie hinter schönen Frauen her stolpern und dabei regelrecht auf die Fresse fallen wie in „Der ideale Mann“, wo eine extreme Physis gesucht wurde, sondern auch in Rollen wie dem verklemmt-aggressiven Arzt Triletzki in Barbara Freys Inszenierung von „Platonow“ oder Willy Lomans geisterhaft kuriosem Bruder Ben in „Tod eines Handlungsreisenden“. Markus Scheumanns Figuren sind meist keine Gewinnertypen, sondern grüblerische, komplizierte, wundersam verknotete Existenzen, die es sich nicht leicht machen – und genau damit unser Herz gewinnen. Leicht macht es sich auch Markus Scheumann nicht. Was spielerisch leicht und virtuos aussieht, ist sehr genau gedacht und erarbeitet. Bemerkbar macht sich dies immer wieder, wenn man in den letzten Tagen vor der Premiere auf die Zielgerade einbiegt. Oft ist das der Moment, in dem Markus Scheumann noch einmal innehält und sich und seine Figur von Grund auf hinterfragt, ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt, letzten Endes aber nur eine Vergewisserung, auf dem richtigen Weg zu sein. Obwohl ihm klar ist: Der Stress, die Anspannung, das stetige sich Neuerfinden bleibt auch mit zunehmender Erfahrung. Auf der sicheren Seite ist man in diesem Beruf nie. Das Glas Wasser von Eugène Scribe Regie Werner Düggelin, Bühne Raimund Bauer, Kostüme Francesca Merz Mit Jan Bluthardt, Lukas Holzhausen, Imogen Kogge, Franziska Machens, Markus Scheumann, Friederike Wagner Ab 5. Mai im Pfauen 26 27 Schicht mit dem Konstrukteur Albert Brägger 3D im Kopf Albert Brägger ist seit 1994 Konstrukteur am Schauspielhaus Zürich, nachdem er vorher einige Jahre als gelernter Hochbauzeichner in einem Architekturbüro gearbeitet hat. Auch wenn man sich das aus heutiger Sicht kaum mehr vorstellen kann – als er hier anfing, wurden die Konstruktionspläne für die Bühnenbilder noch von Hand gezeichnet. Derzeit arbeitet er an der Konstruktion der Bühne für „Solaris“ nach dem ScienceFiction-Roman von Stanislaw Lem, eine Bühnenadaption, die im Mai in der Regie von Antú Romero Nunes im Schiffbau/Box Premiere hat. Von Eva-Maria Krainz 10.07 Uhr Als ich Albi, wie Albert Brägger hier am Haus von allen genannt wird, im Konstruktionsbüro im Schiffbau treffe, hat er gerade einige Zeit am Telefon verbracht. 500 Quadratmeter Stahlgitterrost sind für das Bühnenbild von „Solaris“ zu bestellen – nicht gerade eine kleine Menge, weshalb er herausfinden muss, welches Unternehmen die besten Konditionen gewährt. Die Bühne von Florian Lösche soll aus zwei Ebenen Gitterrost bestehen – eine am Boden der Schiffbau-Box, die andere über den Köpfen der Zuschauer, die sich in der Inszenierung von Antú Romero Nunes mit den Schauspielern in der Raumstation auf dem Planeten Solaris befinden sollen. 10.13 Uhr Auf der Bauprobe, die etwa drei Wochen zurückliegt, wurden die Proportionen und Besonderheiten des Bühnenbildes – wie in diesem Fall die beiden Gitterrostebenen, die Anordnung der Zuschauertribünen und verschiedene Arten von Projektionsflächen für (Live-) Videobilder – im Raum markiert und vom Regieteam und der Technik überprüft, bevor der Entwurf schliesslich von den Werkstätten realisiert werden kann. Albi zeigt mir seine aktuellen Pläne, die er entsprechend der Bauprobennachbesprechung angepasst und überarbeitet hat. Nachher findet die Planabgabe statt. 10.22 Uhr Albi wirft einen Blick auf die Uhr, wir haben noch etwas Zeit. Anhand einer Skizze, die er rasch aufzeichnet, erklärt er mir, wie er die obere Spielebene An seinem Schreibtisch im Schiffbau: Albert Brägger konstruieren wird: Vereinfacht gesagt soll die Aufhängung der Gitterrostfläche so stabil und dabei so unauffällig wie möglich sein. Die Konstruktion soll nicht zu sehr schwingen, wenn sich die Schauspieler darauf bewegen, gleichzeitig soll Albis Stahlaufhängung die Spielfläche und die Ästhetik des Raumes möglichst nicht einschränken. Ich muss öfter nachfragen, kann mir das alles noch nicht so recht vorstellen. Er schmunzelt und meint, in seinem Job sei es durchaus hilfreich, „3D im Kopf“ zu haben. 10.29 Uhr Wir gehen ins Sitzungszimmer des Schiffbaus zur Planabgabe, anwesend sind der Bühnenbildner und die Leiter der technischen Abteilungen. Jeder bekommt ein Handout mit den Eckdaten der Produktion, Fotos von der Bauprobe und einigen Plänen, dann kann es losgehen. Am ursprünglichen Bühnenbildentwurf, dessen Modell im Sitzungszimmer aufgebaut ist, hat sich einiges geändert. Zum Beispiel wird das Publikum nicht, wie ursprünglich geplant, auf einer einzigen Tribüne, sondern an allen vier Seiten des Raumes Platz nehmen. Albi erläutert kurz die Unterkonstruktion der Zuschauerreihen, dann geht es weiter mit den Details zu den beiden Spielebenen. Vor der Besprechung hat Albi erzählt, dass er reduzierte Bühnenräume, in denen sich aber grosse Effekte erzielen lassen, am liebsten mag. Der „Solaris“Raum wird wohl ein solcher werden, was die Technik vor grosse Herausforderungen stellt. Einerseits gilt es, die vom Bühnenbildner vorgegebene klare Ästhetik zu erhalten, gleichzeitig muss der Raum aber auch allen Sicherheitsanforderungen entsprechen und der Technik ausreichend Möglichkeiten bieten, die Ideen des Regisseurs umzusetzen. 13.06 Uhr Kurze Pause, wir gehen gemeinsam zum Mittagessen in die Schiffbaukantine und ich kann Albi noch ein bisschen zu seiner Arbeit ausfragen, nach seinem Arbeitsaufwand für eine Produktion zum Beispiel. Das sei je nach Spielort und Bühnenbildner sehr unterschiedlich, meint er, durchschnittlich könne man von 200 bis 300 Arbeitsstunden pro Produktion ausgehen. Bei „Merlin“ seien es aber etwas mehr gewesen. Sehr wichtig ist ihm, dass die Bühnenbildner Vertrauen in die Umsetzung ihrer Ideen haben können, wobei zwei Herzen in seiner Brust schlagen, eines für die Kunst und eines für die Technik. Und der Entsorgung seiner Arbeit würde er immer mit sehr viel Wehmut beiwohnen, auch nach fast 20 Jahren am Theater ... 14.10 Uhr Es geht weiter mit den Konstruktionsdetails zur oberen Spielebene. Allein das Gewicht der Gitterrostplatten beträgt mehr als viereinhalb Tonnen. Um sie in einer Höhe von etwa drei Metern über dem Boden aufzuhängen, wird zusätzlich eine ein bis zwei Tonnen schwere Stahlkonstruktion benötigt. Dazu kommen Klappen für Auftritte und die Beleuchtung sowie eine Regenanlage. Einige Punkte müssen in den nächsten Tagen noch geklärt werden, andere werden jetzt festgelegt. Unter anderem, dass die Gitterrostplatten so aufgehängt werden, wie sie aus Sicht der Zuschauer besser aussehen, auch wenn sie dann für die Schauspieler relativ unbequem zu begehen sind. Aber auf einem Raumschiff sei es schliesslich auch nicht bequem, meint Albi. 16.03 Uhr Die Besprechung ist zu Ende, Albi scheint zuversichtlich und zufrieden mit dem Ergebnis. Nachdem er sich vom Bühnenbildner verabschiedet und seine Pläne eingesammelt hat, macht er sich auf den Weg zurück in sein Büro, in dem reichlich Arbeit auf ihn wartet. Sein nächster Termin in Sachen „Solaris“ ist die Werkstattbesprechung in etwa vier Wochen, bei der er seine Pläne an die Theaterwerkstätten übergeben wird – danach ist seine Arbeit abgeschlossen und die Herstellung der „Raumstation“ kann beginnen. Solaris nach dem Roman von Stanislaw Lem Regie Antú Romero Nunes, Bühne Florian Lösche, Kostüme Judith Hepting, Musik Johannes Hofmann, Video Sebastian Pircher Mit Yvon Jansen, Sebastian Pircher, Jirka Zett Ab 18. Mai im Schiffbau/Box 28 Ins Theater mit Peter Nobel Man hörte Dürrenmatt lachen 29 Die Aufführung hat mit meinen juristischen Tätigkeiten zu tun; man soll sich keinesfalls mit der ersten Lösung zufrieden geben. Hätten Sie Lust, das Bühnenbild zu betreten? Welchen Platz würden Sie sich darin suchen? Ich möchte einen Polizisten spielen, weil Dürrenmatt diese am meisten liebte. Wie zufrieden waren Sie mit dem Publikum? Das Publikum war mäuschenstill und hat langen und warmen Beifall gespendet. Keine Klage. Man kann ja auch nichts dafür, dass die Absicht nach Jordanien zu den Arabern zu gehen, heute wie ein Witz tönt. „Hast du wieder ein Mädchen getötet, Albert?“ Am 4. Februar 2012 ging Peter Nobel auf unsere Einladung hin in Begleitung seiner Frau in die Premiere von „Das Versprechen“ nach Friedrich Dürrenmatt. Sie sassen in der Reihe 11 Parkett auf den Plätzen 277 und 278. In den darauffolgenden Tagen beantwortete er den untenstehenden Fragebogen. Peter Nobel ist Rechtsanwalt, Universitätsprofessor, Willensvollstrecker von Friedrich Dürrenmatt und jetzt auch von dessen Frau Charlotte Kerr. Von März 2000 bis Mai 2003 war er Präsident der Schauspielhaus Zürich AG. In skeptischer Reserviertheit, da ich den Roman noch einmal gelesen und die beiden Filme „Es geschah am helllichten Tag“ und „The Pledge“ wieder angeschaut habe. Von woher kamen Sie zur Vorstellung ins Schauspielhaus? Von zu Hause. In welchem Moment haben Sie zum ersten Mal auf die Uhr geschaut? Ich habe nie auf die Uhr geschaut. Wie war der erste Eindruck, den das Haus auf Sie gemacht hat? Positiv wie immer. Entsprach die Aufführung Ihren Erwartungen? Die Aufführung entsprach nicht meinen Erwartungen; sie hat sie übertroffen. Es war eine kühne Inszenierung, genau zwischen Komödie und Tragödie. Man hörte Dürrenmatt lachen, was er immer tat, wenn er eine Geschichte erzählte. Was hatten Sie an? Sind Sie aufgefallen? Bin nicht aufgefallen, war stinknormal angezogen. In welcher Stimmung waren Sie in dem Moment, als im Zuschauerraum das Licht ausging? Haben Sie während der Vorstellung gelacht? Ich habe schon beim ersten Satz gelacht. „Sie können mit dieser Geschichte anfangen was Sie wollen.“ Hat Sie etwas an der Vorstellung berührt? Die unbändige Überzeugung von Matthäi. Finden Sie, dass die Aufführung etwas mit Ihnen zu tun hat? Haben Sie sich nach der Vorstellung über das Stück unterhalten? Oder haben Sie auf dem Heimweg noch über etwas nachgedacht, das mit der Aufführung zu tun hatte? Wir haben in einer Gruppe von mehr als zehn Leuten intensiv und lange diskutiert. Die Mehrheit war sehr zufrieden. Welche Frage würden Sie dem Regieteam dieser Aufführung gerne stellen? Warum das Bühnenbild aus Schokoladenpapier besteht? Welches Stück würden Sie gerne als nächstes sehen? „Frank V., Oper einer Privatbank“. Dürrenmatt hat mir einmal gesagt, das sei sein bestes Stück, und er war besonders angetan von einer Aufführung in Spanien, die mit Rollschuhen alles dynamisierte. Das wäre was – mit Musik – für Barbara Frey. Das Versprechen nach dem Roman von Friedrich Dürrenmatt Regie Daniela Löffner, Bühne Claudia Kalinski, Kostüme Sabine Thoss Mit Paula Blaser/Anna-Lou Caprez-Gehrig, Julia Kreusch, Isabelle Menke, Nicolas Rosat, Markus Scheumann, Milian Zerzawy, Jirka Zett Im Pfauen „Nicht zu glauben, wie unvorsichtig die Mütter ihre Kinder kleiden“: Paula Blaser, Markus Scheumann und Milian Zerzawy 30 Lukas Bärfuss: Mörderisches Zürich Gewalt, Statistik und Theater „April is the cruellest month“, schrieb der englische Dichter T.S. Eliot – und er hatte recht. Beinahe jeder fünfte Mord wird in diesem Monat verübt. Gemäss Kris Hollington besagt die Statistik weiter, dass die Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr abends bei weitem die gefährlichste des Tages ist. Und man sollte sich, wen wundert’s, vor den Freitagen hüten. Denn dann ist die Gefahr am grössten, eines gewaltsamen Todes zu sterben. An den Freitagen, zumindest im April, sollte man also abends zwischen sechs und neun besser einen sicheren Ort aufsuchen. Das wäre ein kluger Rat. Dieser Ort kann allerdings nicht das eigene Zuhause sein, wo ein Drittel der Opfer zu Tode kommen. Besser also gleich auf einen Polizeiposten. Allerdings findet sich dort eine hohe Dichte an Feuerwaffen. Mit ihnen werden die Hälfte aller Morde verübt. Die Statistik als Ratgeberin irritiert – der eigene Instinkt bietet da mehr Sicherheit. Und so bleibt man doch zu Hause. Und meidet die Menschen. Denn die beste Mordprävention ist immer noch: nicht lieben, nicht heiraten und schon gar keine Kinder zeugen. Schliesslich war schon der allererste Mord einer unter Brüdern. Und wie bei Kain und Abel ist auch heute noch jede Tötung das Ende einer Beziehung. Je mehr Beziehungen, umso grösser das Mordrisiko. Die Alternative heisst deshalb Einsamkeit. Und tatsächlich verbindet „Gated Communities“ und sichere Innenstädte ein gewisser Schauspielhaus Zürich Zeitung #5 Herausgegeben von der Schauspielhaus Zürich AG Zeltweg 5, 8032 Zürich www.schauspielhaus.ch Intendanz Barbara Frey Diese Zeitung wird ermöglicht durch Swiss Re und Credit Suisse. Mangel an menschlichem Leben. Offenbar scheint die Gesellschaft kaum Alternativen zur Vereinzelung zu kennen, wenn es um eine Erhöhung der Sicherheit geht, trotz Aufklärung und Rechtsstaat. Finden sich zwei Menschen, wird es gefährlich. Die Konstante heisst Streit. Zum Glück eskalieren die meisten Auseinandersetzungen nicht – aber manche tun es eben doch. Und warum? Manchmal, weil durch die Begegnung und ihre Bedingungen eine Dynamik entsteht. Keiner alleine ist schuldig an der Gewalt. Und keiner ist unschuldig, sondern Teil einer Bewegung, die er nicht aufhalten will oder kann. Der Erste Weltkrieg ist ein verheerendes Beispiel dafür. Manchmal gibt es einen eindeutigen Aggressor, der jemandem seinen Willen aufzwingen will. Und warum will er das? Weil er ein Interesse durchsetzen will. König werden – oder auch nur satt. Er will mehr als das, was er bereits hat, ein Prinzip, das spätestens im Sandkasten beginnt. Anfängen berichtet. Man könnte das Drama selbst als Folge der Funktion und der Folgen von Gewalt bezeichnen. Es gab wenig Versuche, konfliktfreies Theater zu machen. Die Bühne lebt, weil sie darstellt, warum Menschen anderen Menschen Leid antun. Wie sie die Gewalt rechtfertigen. Und, was wesentlich ist: was die Opfer dabei fühlen. Die Heimsuchung einer Gesellschaft durch die Ermordeten findet im Theater täglich seine Feier. Und bezeichnenderweise gibt es viele Stücke, die den Beginn, aber sehr wenige, die das Ende der Gewalt beschreiben. Denn es wäre auch das Ende des Theaters. Was aber, solange es Menschen gibt, weder zu befürchten noch zu erhoffen ist. Und es gibt den nicht seltenen Fall, dass der Aggressor Lust an der Gewalt an sich empfindet. Man hört von jenen, die getötet haben, wie bewusstseinsverändernd diese Übertretung sein soll. Und obwohl man es sich nicht vorstellen mag, scheint dieser Reiz für manche Menschen unwiderstehlich zu sein. Ganz abwegig scheint es auch dem sogenannten friedlichen Gemüt nicht zu sein. Der Widerschein der Tat, die Bilder und die Berichte über Gewalt faszinieren schliesslich beinahe jeden. Von allen Fällen, von allen Möglichkeiten des Mordes, der Vergewaltigung, der Verletzung hat das Theater seit seinen Redaktion Lukas Bärfuss, Katja Hagedorn, Thomas Jonigk, Roland Koberg, Eva-Maria Krainz, Meike Sasse (Leitung), Andrea Schwieter Fotos Roland Koberg S. 13, Oerendhard S. 10, Louise Bourgeois, Extrême tension, 2007 © 2012, ProLitteris, Zurich S. 8, Christof R. Schmidt S. 18 unten/19, Ernst Spycher S. 20/23, T+T Fotografie S. 1/4/6/15–18 oben/24/26/28/29/32 31 Als Partner stehen wir dem Schauspielhaus Zürich tatkräftig zur Seite. Gestaltung velvet.ch / Daniel Peter Druck Speck Print AG, Baar Auflage 20 000 Erscheint am 7. März 2012 Partner des Schauspielhauses Zürich Grosse Auftritte sind ohne starke Partner im Hintergrund nicht denkbar. Deshalb unterstützen wir das Schauspielhaus Zürich und andere ausgewählte Kulturinstitutionen. Erfahren Sie mehr über unser kulturelles Engagement unter www.swissre.com/sponsoring 32 „Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr –“ aus „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von Horváth