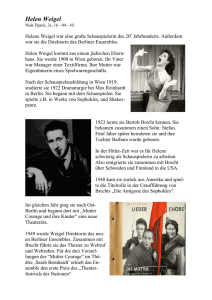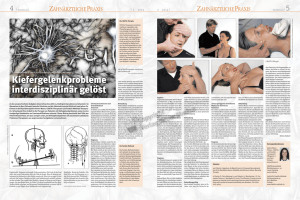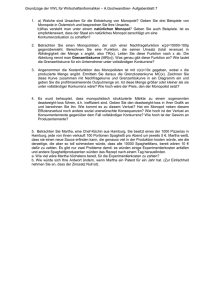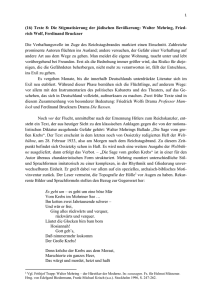Kehlmann: Die Vermessung der Welt
Werbung
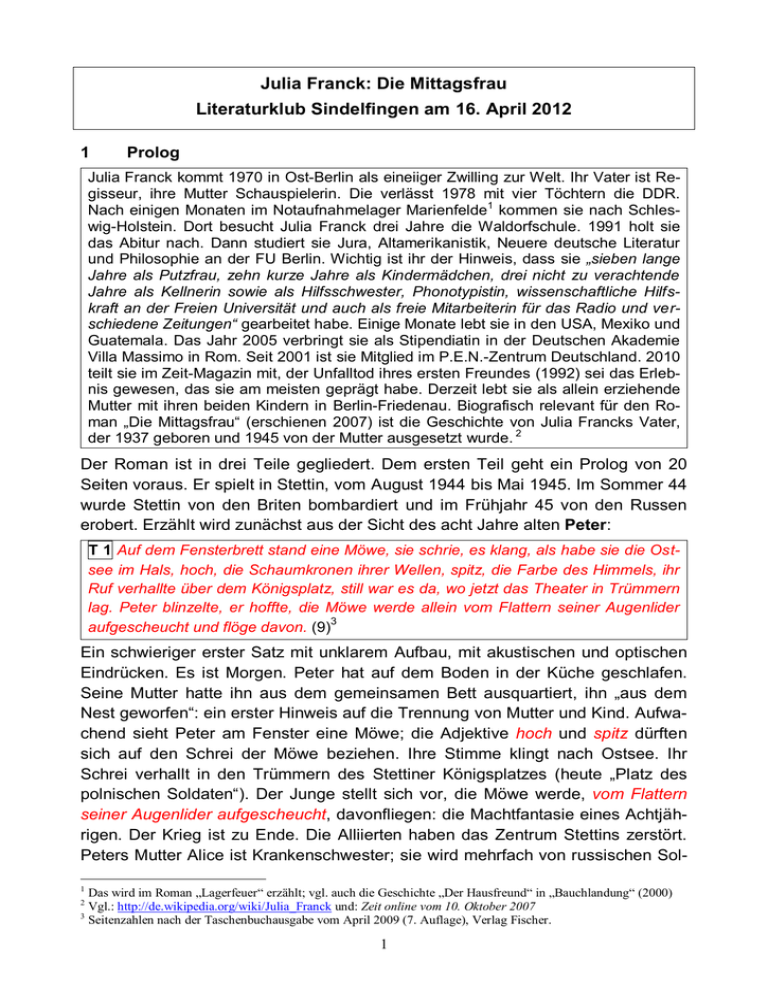
Julia Franck: Die Mittagsfrau Literaturklub Sindelfingen am 16. April 2012 1 Prolog Julia Franck kommt 1970 in Ost-Berlin als eineiiger Zwilling zur Welt. Ihr Vater ist Regisseur, ihre Mutter Schauspielerin. Die verlässt 1978 mit vier Töchtern die DDR. Nach einigen Monaten im Notaufnahmelager Marienfelde1 kommen sie nach Schleswig-Holstein. Dort besucht Julia Franck drei Jahre die Waldorfschule. 1991 holt sie das Abitur nach. Dann studiert sie Jura, Altamerikanistik, Neuere deutsche Literatur und Philosophie an der FU Berlin. Wichtig ist ihr der Hinweis, dass sie „sieben lange Jahre als Putzfrau, zehn kurze Jahre als Kindermädchen, drei nicht zu verachtende Jahre als Kellnerin sowie als Hilfsschwester, Phonotypistin, wissenschaftliche Hilfskraft an der Freien Universität und auch als freie Mitarbeiterin für das Radio und verschiedene Zeitungen“ gearbeitet habe. Einige Monate lebt sie in den USA, Mexiko und Guatemala. Das Jahr 2005 verbringt sie als Stipendiatin in der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. Seit 2001 ist sie Mitglied im P.E.N.-Zentrum Deutschland. 2010 teilt sie im Zeit-Magazin mit, der Unfalltod ihres ersten Freundes (1992) sei das Erlebnis gewesen, das sie am meisten geprägt habe. Derzeit lebt sie als allein erziehende Mutter mit ihren beiden Kindern in Berlin-Friedenau. Biografisch relevant für den Roman „Die Mittagsfrau“ (erschienen 2007) ist die Geschichte von Julia Francks Vater, der 1937 geboren und 1945 von der Mutter ausgesetzt wurde. 2 Der Roman ist in drei Teile gegliedert. Dem ersten Teil geht ein Prolog von 20 Seiten voraus. Er spielt in Stettin, vom August 1944 bis Mai 1945. Im Sommer 44 wurde Stettin von den Briten bombardiert und im Frühjahr 45 von den Russen erobert. Erzählt wird zunächst aus der Sicht des acht Jahre alten Peter: T 1 Auf dem Fensterbrett stand eine Möwe, sie schrie, es klang, als habe sie die Ostsee im Hals, hoch, die Schaumkronen ihrer Wellen, spitz, die Farbe des Himmels, ihr Ruf verhallte über dem Königsplatz, still war es da, wo jetzt das Theater in Trümmern lag. Peter blinzelte, er hoffte, die Möwe werde allein vom Flattern seiner Augenlider aufgescheucht und flöge davon. (9)3 Ein schwieriger erster Satz mit unklarem Aufbau, mit akustischen und optischen Eindrücken. Es ist Morgen. Peter hat auf dem Boden in der Küche geschlafen. Seine Mutter hatte ihn aus dem gemeinsamen Bett ausquartiert, ihn „aus dem Nest geworfen“: ein erster Hinweis auf die Trennung von Mutter und Kind. Aufwachend sieht Peter am Fenster eine Möwe; die Adjektive hoch und spitz dürften sich auf den Schrei der Möwe beziehen. Ihre Stimme klingt nach Ostsee. Ihr Schrei verhallt in den Trümmern des Stettiner Königsplatzes (heute „Platz des polnischen Soldaten“). Der Junge stellt sich vor, die Möwe werde, vom Flattern seiner Augenlider aufgescheucht, davonfliegen: die Machtfantasie eines Achtjährigen. Der Krieg ist zu Ende. Die Alliierten haben das Zentrum Stettins zerstört. Peters Mutter Alice ist Krankenschwester; sie wird mehrfach von russischen Sol1 Das wird im Roman „Lagerfeuer“ erzählt; vgl. auch die Geschichte „Der Hausfreund“ in „Bauchlandung“ (2000) Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Franck und: Zeit online vom 10. Oktober 2007 3 Seitenzahlen nach der Taschenbuchausgabe vom April 2009 (7. Auflage), Verlag Fischer. 2 1 daten vergewaltigt. Ihr Mann hat sich davongemacht. Alice will mit Peter die Stadt verlassen. Es gelingt ihnen, einen Stehplatz im Zug nach Westen zu erkämpfen. In Pasewalk steigen sie aus. Auf dem Bahnhof setzt Alice das Kind aus. Warum? 2 Die Familie Würsich Der Teil 1 (S. 31 – 133) trägt die Überschrift: Die Welt steht uns offen. Er setzt dreißig Jahre vor dem Prolog ein und umfasst die Jahre 1914 bis 1920, vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis kurz danach. Ort des Geschehens ist Bautzen im östlichen Sachsen (Oberlausitz). Auch hier wird überwiegend aus der KindPerspektive erzählt. Mit dem Pronomen uns der Überschrift sind zwei Mädchen gemeint, Martha, die zu Beginn 16 Jahre alt ist (geb. 1898), und ihre neun Jahre jüngere Schwester Helene (geb. 1907). Die beiden liegen gemeinsam in einem Metallbett, rangeln um die Wärmeflasche, reden über ihre Zukunft, beißen sich, sind zärtlich zueinander: ein Bild schwesterlicher Verbundenheit. Helene streichelt die Ältere oder zählt die Sommersprossen auf ihrem Rücken, während Martha in einem Band mit Gedichten von Lord Byron liest. Am Ende des 1. Teils, Martha ist nun 22 und Helene 13, wird erzählt, wie die Jüngere nach Hause kommt. Sie schlüpfte zu ihr unter die Decke. Martha legte einen Arm um sie und ein Bein, ihr schweres, langes Bein, unter dem sich Helene geborgen fühlte. (124). Diese Bett-, Wohn- und Lebensgemeinschaft hat bis zum Schluss Bestand, real oder wenigstens virtuell. Martha spielt zunächst die Rolle der Beschützerin ihrer kleinen Schwester. Sie ist eine Schönheit; junge Männer suchen ihre Nähe. Doch fürs Erste hat es ihr nur Arthur Cohen angetan. Dessen Familienname verweist auf jüdische Herkunft. Manchmal trifft sie sich mit ihm an der Spree, Helene ist dabei. Später verschwindet Arthur aus ihrem Leben; er soll in Heidelberg Botanik studieren. Als Soldat ist er nicht in Frage gekommen: Für einen rachitischen Juden ist in der deutschen Armee kein Platz. Dann befreundet sich Martha mit Leontine, der Tochter eines verwitweten Advokaten. Die lesbischen Zärtlichkeiten zwischen den beiden machen Helene eifersüchtig. Martha wird Krankenschwester. Die Zukunft der hochbegabten Helene liegt im Dunkeln. Martha prophezeit ihr, sie werde Medizin studieren. Doch die gesellschaftliche und politische Lage Deutschlands zwischen den Kriegen wird es nicht zulassen. Marthas und Helenes Mutter, Selma Würsich, hat den Verlust von vier Neugeborenen ertragen müssen, allesamt Knaben. Ab und zu überkommen sie Wutanfälle, dann wirft sie mit Gegenständen und tobt und schreit, oder sie ist in einem Zustand seelischer Dämmerung (96). Selma lebt in einem völlig zugemüllten Zimmer, weil sie alles sammelt und nichts wegwerfen kann. Vor allem Flederwische haben es ihr angetan, Gänse- oder Entenflügel, die man früher zum Staubwischen benutzt hat. Selma leidet am Messie-Syndrom, einer psychischen Störung. Die zeigt sich äußerlich als Unfähigkeit zur Organisation der eigenen Umgebung, verweist meist aber auf tiefer liegende seelische Verletzungen. 2 T 2 Die Mutter sammelte Äste und Schnüre, Federn und Stoffe, aber auch kein zerbrochenes Geschirr durfte weggeworfen werden, keine noch so angestoßene Schachtel und kein von Würmern zernagter Schemel, auch nicht, wenn er wackelte, weil eins der Beine inzwischen morsch und zu kurz war. [… Alles] wurde von der Mutter hinauf in die oberen Gemächer getragen […], in der Zuversicht, eines Tages einen Platz und eine Verwendung für den Gegenstand zu finden. Niemand konnte in der Ansammlung eine Ordnung erkennen, einzig die Mutter ahnte, in welchem Kleiderhaufen sie die kostbare sorbische Spitze abgelegt hatte. (39) Selma geht mit ihren beiden Töchtern ruppig um. Für Helene hat sie nie ein freundliches Wort, bezichtigt sie der Faulheit oder des Diebstahls und schlägt sie. Auch ist sie geizig und versteckt ihr Geld im Bett, nicht wissend, dass es wegen der Inflation ständig an Wert verliert. Martha nennt das Gebaren ihrer Mutter widerlich. Ihren Mann scheint Selma noch zu lieben, obwohl sie ihm keine intime Nähe mehr gestattet. Sie will nicht, dass er in den Krieg zieht, sondern bei ihr bleibt, und droht mit Selbstmord. Schon als junge Frau fiel sie wegen ihres aparten Wesens auf, besonders aber durch Hüte, die der Onkel, ein Hutmacher, an ihr ausprobierte. Die Bewohner Bautzens lehnen Selma Würsich wegen ihrer fragwürdigen Herkunft ab und weigern sich, sie auf der Straße zu grüßen. Sie hingegen verweigert sich dem gesellschaftlichen Leben der Stadt. Christliche Gottesdienste besucht sie nie. Warum? Wir ahnen es. Ernst Ludwig Würsich liebt seine Frau. Sie entstammt der jüdischen Familie Steinitz in Breslau. Dort findet die standesamtliche Heirat statt. Würsich ist Besitzer einer Druckerei und verlegt philosophische und literarische Bücher. In Bautzen genießt er hohes Ansehen. Als der Krieg beginnt, muss er einrücken; sein Husarenregiment erwartet ihn. Aber Selma lässt ihn nicht gehen. Die Staatsmacht bestraft die Verspätung mit der Degradierung zum einfachen Soldaten. Das wird ihm zum Verhängnis. In der Winterschlacht in Masuren (Februar 1915) verliert er beim Angriff seiner Truppe durch eine fehlgezündete Handgranate seines unmittelbaren Nachbarn das linke Bein und ein Auge (72). Die übrigen Kriegsjahre verbringt er in Lazaretten. Er hat viel Zeit nachzudenken. Zunehmend zweifelt er am Sinn des Krieges und seiner eigenen Rolle darin: Nicht einmal zu Gesicht bekommen hatte er einen Russen, keinem Feind ins Antlitz geschaut. (72) Sein militärischer Einsatz war sinnlos. Verletzt wurde er durch einen Zufall. Würsich denkt oft an seine Frau. Die hat ihm einen Stein als Talisman mitgegeben: T 3 Er fand sich in der Innentasche seiner Uniform eingenäht, ein Stein in der Form eines Herzens. Seine Frau wollte darin ein Lindenblatt erkannt haben, und er sollte den Stein auf jegliche Wunde legen, damit diese heile. Da ihm die Wunde unten am Rumpf nun aber zu groß erschien und er in den ersten Wochen nach dem Unglück den Blick hinab scheute, und erst recht jegliche Berührung mit dem weit unten befindlichen, wunden Fleisch vermied, legte er sich den Stein auf die Augenhöhle. Dort wog er schwer und kühlte angenehm. (72). 3 Das Lindenblatt wird noch eine Rolle spielen. Es erinnert an Siegfried (Nibelungenlied), der wegen des Blattes und eines Fehlers seiner Frau Kriemhild das Leben verliert. Selma glaubt an die Wirkung des Lindenblatt-Steines. Aber der Talisman schützt und heilt nicht. Ihr Mann stirbt an den Folgen der Verwundung. Im Lazarett fühlt er sich seiner Frau liebend verbunden; er schreibt ihr viele Briefe. Selma übergibt sie ungeöffnet der sorbischen Haushalthilfe Marie. Als Würsich zwei Jahre nach Kriegsende als Krüppel heimkehrt, weigert sich Selma, ihn zu sehen. Er hat furchtbare Schmerzen, Martha gibt ihm Morphium, das sie in der Klinik stiehlt. Lange lebt der Vater nicht mehr, trotz der aufopfernden Pflege der Töchter. Sein Beinstumpf entzündet sich; er bekommt Typhus. Es gibt eine letzte, von den Töchtern erzwungene dramatische Begegnung mit seiner Frau. Sie zeigt sich dabei blind am Herzen (120). Helene charakterisiert sie so: T 4 Etwas an dieser Frau erschien Helene so unermesslich falsch, so unbarmherzig auf sich selbst bezogen ohne den winzigsten Schimmer einer Liebe oder auch nur eines Blickes für den Vater, dass Helene nicht anders konnte, als ihre Mutter zu hassen. […] hier am Sterbebett ihres Mannes galt der Mutter offensichtlich nichts etwas als die eigene Ergriffenheit und die Niederung eines Fühlens, das nur noch für sich selbst langte. (120f). Allmählich beginnt auch Würsich seine Frau zu vergessen. Er stirbt unter Qualen. Selma weigert sich an der Beerdigung teilzunehmen. Während des Leichenschmauses im Ratskeller kommt es zwischen Martha und dem Pfarrer zu einem Gespräch über den christlichen Glauben. T 5 Das Leben, mein gutes Kind, hält so vieles bereit. – So vieles? Martha schnäuzte sich. Verstehen Sie Gott, verstehen Sie, warum er uns leiden lässt? – Der Pfarrer lächelte milde, als habe er auf diese Frage von Martha gewartet. Der Tod Ihres Vaters ist eine Prüfung. Gott meint es gut mit Ihnen, Martha, das wissen Sie. Es geht nicht um Verstehen, mein gutes Kind, Bestehen ist alles. Als der Pfarrer seine Hand über den Tisch hinweg ausstreckte, um sie tröstend auf Marthas zu legen, sprang Martha auf […] und verließ den Ratskeller. (130) Die Standardantwort des Geistlichen auf die Theodizee-Frage hat für Martha nichts Tröstliches. Sie verlässt die Trauergemeinde, sie verlässt auch das christliche Milieu. Zu Hause spritzt sie sich Morphium. Ihre Drogenkarriere hat begonnen. Die heile Welt der Schwestern bekommt Risse. In den Kriegsjahren und danach gehen die Geschäfte der Druckerei Würsich immer schlechter, ihre Geldreserven schwinden bzw. werden ein Opfer der Inflation. Dazu kommt das irrationale Verhalten der Mutter in Gelddingen. Der Drucker, ein Familienvater mit acht Kindern, wird entlassen, was den Ruf der Familie Würsich in der Stadt Bautzen noch mehr beschädigt. Helene, inzwischen 13, übernimmt die Geschäftsführung, gestaltet die Druck-Erzeugnisse, bedient die Maschinen und macht die Buchführung. Da es aber wegen der Wirtschaftskrise fast nichts zu tun gibt, lernt sie nebenbei medizinisches Basiswissen und liest heimlich Kleists 4 „Penthesilea“ und die „Marquise von O.“ sowie Goethes „Werther“. Der Wunsch nach einem Studium (113) bleibt wach. 3 Von Bautzen nach Berlin Der umfangreiche 2. Teil (S. 135 – 293) trägt die euphorische Überschrift: Kein schönerer Augenblick als dieser. Erzählt wird der Zeitraum vom Winter 1920 bis zum Mai 1930. Der Anfang spielt noch in Bautzen. Zufällig stoßen die Schwestern auf die Adresse von Fanny Steinitz, der Base ihrer Mutter. Die wohlhabende Jüdin lädt sie nach Berlin ein. Aber ehe sie fahren können, müssen sie sich noch zwei Jahre mit wirtschaftlichen Problemen herumschlagen: In den meisten Häusern ging das Brennholz Ende Januar [1923] aus. (137) Das Brot wird jeden Tag teurer, die finanzielle Lage der Familie Würsich ist bedrohlich. Auch die psychisch kranke Mutter macht den Schwestern das Leben schwer. Ihre Verwirrung und auch ihre Bosheit steigern sich. Der Bautzener Bürgermeister hatte Würsich einst geraten, seine Frau in ein Heim zu geben. Das wollte er nicht. Die Sorbin Marie erklärt sich das Leiden ihrer Dame mit der Geschichte von der Mittagsfrau. Bei Wikipedia erfahren wir über diesen Mythos Folgendes: T 6 Die Mittagsfrau, ein Felddämon, erscheint an heißen Tagen zur Mittagszeit, besonders zur Ernte, und verwirrt den Menschen den Verstand, lähmt ihnen die Glieder, fragt sie zu Tode oder tötet sie, indem sie ihnen mit der Sichel den Kopf abschneidet. Die von der Mittagsfrau Heimgesuchten können sich nur retten, indem sie ihr bis ein Uhr von der bäuerlichen Arbeit, insbesondere von der Flachsverarbeitung, erzählen. Nach Ablauf der Ruhestunde zwischen zwölf und eins verliert die Mittagsfrau ihre Macht. Die Mittagsfrau erscheint […] in verschiedener Form. Entweder als schwarzbehaarte Frau mit Pferdefüßen [ein Satansbild?] oder als Wirbelwind. […] In Beschreibungen, […] wird sie als totenbleich, hohlwangig und mit eingefallenen Zügen geschildert, […] in ein weißes Gewand oder Tuch gehüllt. Auch dies gibt einen Hinweis auf Ihre Anbindung zum mythischen Totenreich – traditionell hüllen sich in der niedersorbischen Tracht Frauen in Tieftrauer in ein großes weißes Trauertuch. 4 Die Mittagsfrau ist also eine Gestalt, die an den Tod gemahnt. Die schlichte Marie meint, Selma solle doch mit der Mittagsfrau reden, dann ginge es ihr besser, dann würde der Fluch verscheucht. Warum hat Julia Franck ihren Roman nach dieser mythischen Gestalt benannt? Es liegt nahe, in der Mutter Selma die Mittagsfrau zu sehen, deren Fluch sich auf die Töchter legt. Einmal ist ausdrücklich von der fluchenden Mutter die Rede (166). Die Wendung ist doppeldeutig; mit „fluchen“ ist auch „verfluchen“ gemeint. Werden die Töchter durch diesen Fluch allmählich selbst zu Mittagsfrauen? In den Zeiten ihrer schlimmsten Depression passt auf Helene die Beschreibung „totenbleich, hohlwangig und mit eingefallenen Zügen“. – Eine andere Stelle im Roman bestätigt den Gedanken vom Familienfluch. Dazu ein Vorgriff: Nach der Ankunft im Haus der Berliner Tante spritzt sich Martha als Erstes Morphium, vor den Augen Helenes. Die fragt sie: 4 http://de.wikipedia.org/wiki/Mittagsfrau 5 T 7 Warum machst du das jetzt? – Martha in ihrem Rücken antwortete nicht. Sie presste den Inhalt der Spritze langsam in ihre Vene und sank dann rückwärts auf das Bett. – Engelchen, gibt es einen schöneren Augenblick als diesen? Wir sind angekommen. […] Berlin, sagte sie leise, als sterbe ihre Stimme und ertrinke im Glück, das sind jetzt wir. – Das Gift ist süß, Engelchen. Schau mich nicht an wie eine Verdammte. Ich sterbe, ja und? Ein wenig Leben wird doch vorher gestattet sein? Martha kicherte, dass es Helene für einen Augenblick an die im Wahnsinn zurückgelassene Mutter erinnerte. (176f) Helene sieht einen Zusammenhang zwischen dem Wahnsinn der Mutter und Marthas Wahn. Die redet von Glück und Sterben. Die Mittagsfrau bringt den Tod. Auch Helene ist ihm mehrfach sehr nahe. Die Reise von Bautzen nach Berlin 1923 ist der Wechsel in eine andere Welt: von der biederen Kleinstadt in die vergnügungssüchtige Metropole. Ein Arzt bringt die Schwestern zum Bahnhof von Dresden, er lässt sogar Martha eine Weile fahren. Doch die steuert das Auto in einen Acker. Sie müssen es mühsam herausziehen und bekommen dabei schmutzige Schuhe, die ihnen in Berlin peinlich sind. Beim Aussteigen aus dem Zug am Anhalter Bahnhof stürzt Martha, fast verpassen sie die Ausgabe ihres Gepäcks, das Pferd ihrer Kutsche bricht bei der Fahrt zur Tante zusammen. An schlimmen Vorzeichen fehlt es also nicht. Die ersten Eindrücke von Berlin werden ausführlich beschrieben. Die Rufe der Zeitungsjungen geben einen Eindruck der politischen Lage: Besetzung im Ruhrgebiet dauert an! (171) Weiter lebe die Sturmabteilung der nationalsozialistischen Partei! (171). Eine Prophezeiung: Die Nationalsozialisten werden „leben“ und noch eine furchtbare Rolle spielen. Franck zeichnet über die Namen von Zeitungen, die das politische Spektrum widerspiegeln, ein Bild der Zeit: die Rote Fahne (Spartakusbund), der sozialdemokratische Vorwärts, die bürgerliche Vossische Zeitung, der Völkische Beobachter (NSDAP), die Weltbühne der intellektuellen Linken. Die Schwestern sind inzwischen (1923) 25 bzw. 16 Jahre alt. Sie entwickeln sich auseinander. Martha, die Drogenabhängige, taucht mit Fanny ins Berliner Nachtleben ein und nimmt die Beziehung mit Leontine wieder auf. Helene, die noch zu jung ist, bleibt zu Hause und liest. Die schwesterliche Bettgemeinschaft besteht weiter. Einer von Tante Fannys Liebhaber, der große[…] blonde[…] Erich (185), macht sich an Helene heran. Sie versucht ihm auszuweichen. Fanny fühlt sich verpflichtet, den Mädchen zu einer Arbeit zu verhelfen. Martha bekommt eine Stelle auf der Sterbestation des Jüdischen Krankenhauses (186), Helene macht einem Apotheker die Buchführung und hilft im Verkauf. Sie sieht die Entwicklung ihrer älteren Schwester mit Sorge; manchmal bereut sie die Reise nach Berlin. Der 19. Geburtstag Helenes am 21. Juni 1926 wird ausführlich erzählt. Zum ersten Mal darf sie, mit neuer Frisur, topfähnlichem Hut und einem durchsichtigen Schal aus Organza, in das Tanzlokal zur Weißen Maus, damals „eine verruchte Nackttanz- und Trinkstätte“. Darin ist einst Anita Berber mit ihrem Tanz des Las6 ters und des Grauens (202) aufgetreten.5 Helene fühlt sich von der totentanzartigen Atmosphäre bedroht. Ihr Retter wird Carl Wertheimer, ein Student der Philosophie, Literatur und alten Sprachen. Zwischen den beiden kommt es zu einem literarischen Dialog, der ein wenig an die Klopstock-Szene im „Werther“ erinnert. Sie zitieren das Gedicht „Weltende“ (1903) von Else Lasker-Schüler: Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär, und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen … Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen – Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Ist das ein pessimistisches Gedicht, wie Helene meint, oder ein optimistisches, wie Carl es sieht? Jedenfalls geht es (auch hier) ums Sterben. Helene zu Carl: T 8 Lasker-Schüler delektiert [ergötzt] sich nicht an Gott, sie erfreut sich auch nicht an den Menschen und ihrem Leid, dem sie gehorchen, nur gönnt sie ihnen einen Kuss vor dem Vergängnis. Glauben Sie mir, die eigene Sterblichkeit, der sie ins Auge blickt, ob an der Sehnsucht und begleitet von einem Weinen oder nicht, diese menschliche Sterblichkeit, ihre Einsicht, die Unausweichlichkeit, die steht doch deutlich der Unsterblichkeit Gottes gegenüber. (210) Ein grammatisch schwieriger Satz – Leid, dem sie gehorchen, ist an der Sehnsucht auf Sterblichkeit bezogen? – aber ein Satz, der Helenes pessimistische Sicht der Welt ausdrückt. Die Wörter Leid, Vergehen, Sterblichkeit, Unausweichlichkeit klingen depressiv. Allenfalls einen Kuss vor dem Vergängnis 6 könne man erwarten. Carl formuliert es so: Was ist verheißungsvollerer [!] als die Hingabe, der Kuss, eine Sehnsucht, die uns umfängt und sterben lässt. (210) Aber auch er redet vom Sterben. Wie gesagt: ein Totentanz. Carl und Helene treffen sich nun häufiger. Er stammt aus einer jüdischen Professorenfamilie. Seine Brüder sind gefallen, die Schwester studiert Physik. Bei einem Ausflug an den Wannsee reden die beiden über den Glauben. Religiös tief gehende Gespräche gibt es im Roman des Öfteren. Manchmal geht es auch um Literatur: Büchners „Lenz“ und Hofmannsthals „Lord Chandos“ spielen eine Rolle. Carl und Helene wollen sich nahe kommen, die suchen, wie es einmal heißt (223), einen Anschluss an ihr gemeinsames Denken. An einem Winterabend nach einem philosophischen Diskurs über die Stoa, Kant, Spinoza und Schopenhauer in Carls Bett, fällt der Spinoza-Satz: Die Vernunft kann die Leidenschaften überwinden, indem sie selbst zur Leidenschaft wird. (231). Nun wird bei ihnen die Leidenschaft Sieger über die Vernunft. Danach zieht Helene bei Carl ein. Das 5 6 Vgl. Anna-Katharina Hahn: Kürzere Tage. Ein selten gebrauchtes Wort 7 Bett neben Martha wird für Leontine frei. Die Schwestern sind fortan getrennt, ihr Gespräch versiegt. Sie hatten sich nichts mehr zu sagen. (223) Leontine zwingt Martha zu einem Entzug. Die finanzielle Lage der Tante verschlechtert sich; sie muss Wertgegenstände ins Pfandhaus bringen und Teile ihrer Wohnung vermieten, um finanziell über die Runden zu kommen. Auch Helenes Abendkurs kann sie nicht mehr bezahlen. 1928, am Ende des Sommers (234), besuchen Carl und Helene (inzwischen 21) eine Aufführung von Brechts „Dreigroschenoper“ im Theater am Schiffbauerdamm. Carl ist begeistert, Helene findet das Stück im wörtlichen Sinn „zum Kotzen“. Sie macht sich offenbar die Kritik Elias Canettis zu Eigen: „Die Leute jubelten sich zu, das waren sie selbst, und sie gefielen sich. Erst kam ihr Fressen, dann kam ihre Moral, besser hätte es keiner von ihnen sagen können. 7 Helene sagt es so: Mich ängstigt das, die gnadenlose Selbstherrlichkeit in allen Schichten. (236) Der Streit um die „Dreigroschenoper“ mündet in eine Lindenblattszene. Auf dem Heimweg vom Theater bückte sich Carl … T 9 und hob ein Lindenblatt auf. Unverwundbar gibt es das? Er hielt das Lindenblatt vor die Brust, etwa dorthin, wo die meisten Menschen ihr Herz vermuten. [Und etwas später:] Ein Blatt fiel vom Baum, es landete auf seiner Schulter. […] Helene pustete, sie wollte das Blatt von Carls Schulter pusten, […] aber das Lindenblatt blieb hartnäckig liegen. Jetzt hob sie ihre Hand, sie wollte nicht, dass er das Lindenblatt bemerkte, sie strich seinen Kragen glatt und sah aus dem Augenwinkel, wie das Blatt zu Boden segelte. (239f) Der Streit ist zwar ausgestanden, aber die Lindenblatt-Szene verdeutlicht: Wie Kriemhilds Siegfried verwundbar war, so ist es auch Helenes Carl. Sie wacht über ihn, will ihn beschützen, verschweigt ihm sogar eine Abtreibung. Aber sie kann das Unheil nicht fernhalten. Auch Carl ist nicht immer ehrlich, er verheimlicht, dass er (gelegentlich) Kokain schnupft. Es fehlt die letzte Offenheit zwischen den beiden. Dennoch verloben sie sich und machen ihre Beziehung öffentlich. Allerdings sträubt sich Helene hartnäckig, seine Eltern zu besuchen. Sie besteht das Abitur, Carl das Examen, summa cum laude. Im Frühjahr 1930 soll Hochzeit sein. Deutschland scheint sich 1929 wirtschaftlich zu konsolidieren, ein Irrtum, wie sich bald zeigt. Weil auch Tante Fannys ökonomische Lage wieder etwas stabiler ist, gibt sie eine Einladung. In den Gesprächen geht es u. a. um Philosophie, um den berühmten Streit zwischen dem jüdischen Denker Ernst Cassirer und Martin Heidegger in Davos im April 1929. Carl hat sich bei Cassirer beworben, dem vermeintlichen Verlierer dieses Streits. Der muss 1933 emigrieren. Die Katastrophe ereignet sich im Februar 1930. Carl und Helene haben sich für 13.00 Uhr (am Mittag!) vor dem Romanischen Café (Kurfürstendamm, nahe der Gedächtniskirche) verabredet. Aber Carl kommt nicht. Helene wartet stundenlang 7 http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Dreigroschenoper#Auff.C3.BChrungsgeschichte 8 auf ihn, gerät in Panik, denkt an vieles, auch an das gestürzte Pferd bei der Ankunft in Berlin – ein böses Vorzeichen bewahrheitet sich. Und sie liest in Carls Zimmer in einem Band von Gottfried Benn in einem Gedicht, aus dem Jahr 1927: was dann nach jener Stunde sein wird, wenn dies geschah weiß niemand, keine Kunde kam je von da, von den erstickten Schlünden, von dem gebrochnen Licht, wird es sich neu entzünden, ich meine nicht. … wenn die Nacht wird weichen, wenn der Tag begann, trägst du Zeichen, die niemand deuten kann, geheime Male von fernen Stunden krank und leerst die Schale, aus der ich vor dir trank. Erst später erfährt Helene von Carls Mutter, dass ihr Sohn bei Schnee und Glatteis einen Fahrradunfall hatte. Er kollidierte mit einem Auto und war sofort tot. 5 Helenes Leben nach Carl Der 3. Teil (S. 293 – 416) trägt den düsteren Titel Nachtfalle. Er umfasst die Zeit vom Sommer 1930 bis 1944 und beginnt mit Helenes langer und intensiver Trauerphase nach Carls Tod. Immer wieder träumt sie von ihm. Sie isst und trinkt zu wenig, magert ab, hat keine Blutungen mehr. Da der Apotheker sie nicht mehr bezahlen kann, wird sie wieder Krankenschwester, im Diakonissenkrankenhaus Bethanien (Bezirk Kreuzberg). Dort war einst Theodor Fontane als Apotheker tätig. Nach dem Krieg diente es eine Zeit lang als Künstlerkolonie. Helene wird von den Patienten sehr geschätzt. Von den anderen Schwestern kapselt sie sich ab. Sie wohnt wieder bei Fanny. Deren Freund Erich bedrängt sie immer noch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Sie wehrt sich nur wenig. Ihre Existenz erscheint ihr als sinnloses Weiterleben (304). Sie versucht zu beten, wartet auf ein Zeichen Gottes, spürt den klaren Wunsch nach Erlösung (304). Dabei denkt sie an ihre Mutter, die in allem ein Zeichen sehen konnte. Selma geht es schlecht. Weil sie auf dem Kornmarkt in Bautzen herumtobte, wurde sie in ein Heim nach Pirna gebracht. Dort prüft man, ob sie an einer erblichen Erkrankung leidet. Im Frühling des Jahres 1933 (kurz nach dem Reichstagsbrand) lernt Helene den Ingenieur Wilhelm Sehmisch kennen, ein mit seinem blonden Haar und den blauen Augen (311) gut aussehender Mann. Er entspricht wie Helene dem Schönheitsideal der Zeit. Spontan gibt er ihr den Namen Alice. Spätestens jetzt weiß der Leser, dass Helene alias Alice die Frau des Prologs ist. Wilhelm holt Helene fast täglich vom Krankenhaus ab und führt sie in ein Café. Dort muss sie Apfelku9 chen essen, obwohl sie ihn nicht mag. Wilhelm merkt das nicht; er merkt fast nie etwas. Helene mag auch Wilhelm nicht, lässt sich aber seine Werbung gefallen. Seine Freude gefiel ihr, die Leichtigkeit, mit der er lachte und sich auf die Schenkel klopfte (317). Auch seinen Geruch, die schönen Augen und warmen Hände findet sie angenehm. Er macht ihr einen Antrag; doch sie verweist auf ihre jüdische Mutter und das Fehlen standesamtlicher Unterlagen. Vor allem fehlt der Ahnenpass – eine damals wichtige Voraussetzung für die Ehe. Wilhelm will ihr einen Pass besorgen, der keinen Zweifel an deiner gesunden Herkunft lässt. (319) Sie denkt bei dieser Formulierung an das neue Gesetz über erbkranken Nachwuchs. 8 Das NS-Regime hat sich bereits etabliert. Im Roman ist zu lesen: T 10 SA-Truppen stürmten den Roten Block in Wilmersdorf, Schriftsteller und Künstler wurden dort verhaftet, ein paar ihrer Bücher wurden verbrannt, und es wurde Frühling, und mehr Bücher wurden verbrannt. (315) Der Rote Block war eine Künstlerkolonie am Rande von Wilmersdorf. Eine der ersten großen Razzien nach dem Reichstagsbrand fand hier statt. Der Schriftsteller Heinrich Mann lebte dort; er flüchtete nach diesen Unruhen. Im September 1935, kurz nach der Verabschiedung der Nürnberger Rassegesetze verliert Helene wegen der fehlenden Papiere ihre Stelle im Bethanien. Wilhelm macht sein Versprechen wahr und beschafft ihr ein Schwesternzeugnis und einen Ahnenpass: Ihr Name war Alice Schulze, ihr Vater ein Bertram Otto Schulze aus Dresden, die Mutter eine Auguste Clementine Hedwig, geborene Schröder (331). Die Schulzes waren einst Wilhelms Nachbarn. Einfache Leute, wie er sagt, und bereits tot. Die Tochter Alice verschwand eines Tages und blieb verschollen. Helene hat nun ihren Makel als Halbjüdin verloren und ist jetzt von „gesunder Herkunft“. Aber sie erkauft das mit der Abhängigkeit von Wilhelm. Allerdings gilt das auch umgekehrt; denn Wilhelm hat sich strafbar gemacht: Urkundenfälschung. Sie heiraten 1936 an einem frühen Maitag in Stettin. Es beginnt eine Ehe voller Missverständnisse. Eine Szene soll das belegen. Die beiden blicken auf den Stettiner Hafen. Helene reicht Wilhelm ein Viertel von einem schon leicht schrumpeligen Apfel. Die biblische Eva lässt grüßen. Dann heißt es: T 11 Eine Möwe lachte. Auf dem Weg etwas unterhalb schob eine junge Frau einen Kinderwagen, sie schob ihn mit der Hüfte vorwärts, Stoß um Stoß, das Kind hielt sie mit beiden Armen fest an sich gedrückt, es schrie […] als habe es Hunger und Schmerzen. – Unglaublich, nicht? Wilhelm schaute hinab. – Bestimmt hat es Bauchweh. – Den Verkehr meine ich. Das Apfelstück in der Hand zeigte Wilhelm mit ausgestrecktem Arm auf ein langes Schiff. (329) Eine Möwe lacht – lacht sie über diese Ehe? Eine junge Frau müht sich mit ihrem schreienden Kind und dem Kinderwagen ab. Es fällt das Wort unglaublich. Die beiden deuten es unterschiedlich. Helene verwendet es als Ausdruck der Empathie für Mutter und Kind; es ist ein Blick voraus auf das, was ihr bevorsteht. Wil8 Es wurde schon den 1920er Jahren diskutiert und fand damals auch Zustimmung bei SPD und Zentrum. 10 helm, der Ingenieur, bezieht das Wort auf den Schiffsverkehr im Hafen. Dann fordert er ein Lächeln seiner Frau und Helene bemühte sich um das Lächeln (330). Missverstehen, Freudlosigkeit und Unterdrückung der Frau bestimmen diese Ehe von Anfang an. Das zeigt sich auch in der Hochzeitsnacht. Wilhelm will Helene die Liebe zeigen, in seinem Ehebett lag sie, das er sich für die Ehe mit einer Jungfrau gekauft hatte, in dem er einer Jungfrau die Liebe beibringen wollte. (346) Nun muss er erkennen, dass sie keine Jungfrau mehr ist, sondern schon Bescheid weiß. Die Nacht endet damit, dass der Ehemann einen Wutausbruch bekommt und sich die Ehefrau verzweifelt fragt: Welches Missverständnis hatte sie miteinander in dieses Bett gebracht? Aber sie sind in dieser Konstellation gefangen und müssen sich arrangieren. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht verwöhnt Helene den Gatten mit Bohnenkaffee und geröstetem Brot. Er bemächtigt sich ihrer; sie denkt währenddessen an die Wäsche, das Mittagessen und das fehlende Bohnenkraut. Helene-Alice strengt sich an, ihre Pflichten zu erfüllen, führt den Haushalt so gut es irgend geht und ist dem Mann zu Willen: Sie drückt ihm die Pickel aus: ein Bild mit Symbolkraft. Die Juden gelten als die Parasiten im Volkskörper. Helene ist der Parasit in Wilhelms Körper. Als er sich zum Ausgehen ankleidet, sagt sie beiläufig den Satz: Wir bekommen ein Kind. (359) Er antwortet mit der Frage: Wir? Er zeigt keinerlei Freude; er ist nur froh, dass Helene endlich eine Aufgabe hat. T 12 Du hast das Kind gezeugt, Wilhelm. – Das behauptest du. Wilhelm schob Teller und Tassen beiseite. Er sah sie nicht an, in seiner Stimme lag mehr Empörung und Rechtfertigung als Betroffenheit. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Spott trat in sein Gesicht. Wer sagt mir, dass du nicht noch mit anderen schläfst, du, du …? Ich sage dir, etwas, Alice: Es ist mein Recht, hörst du, mein gutes Recht, dir beizugehen. Du hast das auch genossen, gibs zu. Niemand hat dir gesagt, dass du dabei schwanger werden sollst. – Nein, sagte Helene leise, sie schüttelte den Kopf, das hat mir niemand gesagt. (364) Der Dialog offenbart das Ende einer Beziehung, die nie richtig bestanden hat. Aufkommen will Wilhelm für Helenes Brut nicht. Nur einen Trost hat er für sie: Er werde sie nicht hochgehen lassen. Als sie erwidert, er würde dabei auch selbst auffliegen, schlägt er sie. Wilhelm ist im Roman der Repräsentant des Nationalsozialismus: blond und blauäugig, unsensibel und egozentrisch, brutal und unmenschlich, ideologisch blind, nur auf seine Interessen bedacht, ein Macho. Er „nimmt“ sich eine blonde Halbjüdin zur Frau und will sie sich gefügig machen. Als das misslingt, lässt er sie fallen. Das Kind kommt im November 1937 zur Welt. Wilhelm hat sich nach Königsberg abgesetzt, geht fremd. Helene muss allein in die Klinik. Dort fällt sie in die Hände einer Hebamme, die sich wie eine Offizierin gibt. Julia Franck erzählt die Geburtsszene mit brutalem Realismus. Als das Kind auf der Welt ist, zeigt sich ein weiteres Missverständnis: Helene hatte mit einem Mädchen gerechnet, nie mit einem Jungen. Nach dem Namen gefragt, den das Kind bekommen soll, fällt ihr 11 nur Peter ein. Er also ist der Junge, den der Leser bereits aus dem Prolog kennt. Die Distanz zwischen Mutter und Kind wird schon zu Beginn deutlich: T 13 Wie konnte sie ihm einen Namen geben, er gehörte ihr nicht. Welche Anmaßung, einen Namen für ein Kind. Wo sie doch selbst keinen Namen mehr hatte, zumindest nicht mehr den, der ihr für das Leben gegeben worden war. Er konnte sich umbenennen, später, wenn er wollte. (376) [Später sagt eine Frau zu ihr, sie könne stolz sein auf das Kind. Doch] Helene empfand keinen Stolz. Warum sollte sie stolz darauf sein, dass sie ein Kind hatte? Peter gehörte ihr nicht, sie hatte ihn geboren, aber er war nicht ihr Eigentum und nicht ihre Errungenschaft. (385) Eine Mutter, die sich scheut, ihrem Kind einen Namen zu geben und damit als ihr eigenes anzuerkennen. Geschieht das aus Achtung vor der Eigenständigkeit des kleinen Wesens oder liegt es daran, dass das Kind kein Mädchen war? Trotz ihres inneren Vorbehalts kümmert sich Helene um den kleinen Peter, so gut es in den Kriegszeiten geht. Wilhelm bleibt der widerliche Ehemann. Er beklagt sich über das nächtliche Schreien des Kindes (Ein arbeitender Mann braucht seinen Schlaf, 377) und merkt nichts, als seine Frau eine entzündete Brust hat und nicht mehr stillen kann. Wilhelm merkt nie etwas. Immerhin vermittelt er sie ans städtische Krankenhaus: Wir können uns keine Schmarotzer leisten. (377). Die Betreuung des Kindes übernimmt die im gleichen Haus wohnende freundliche, aber unzuverlässige Frau Kozinska. Sie spricht dem Alkohol zu und lässt Peter ab und zu allein in der Wohnung. Helene hat über 60 Stunden in der Woche Dienst. Es ist Krieg; die ersten Verwundeten werden gebracht. Man sucht Freiwillige für die Lazarette. Menschen jüdischer Herkunft verschwinden nach Osten (389). Als Peter drei ist, 1940, soll er in den Kindergarten, aber er will nicht und klammert sich an seine Mutter. Er fragt sie, warum sie immer so lange weg sei. Darauf weiß sie nur die eine Antwort: Arbeiten. Das stimmt, aber das Kind versteht es nicht. Es gelingt ihr auch nicht, mit dem Knaben darüber zu sprechen. Der wird von ihr streng und konsequent, aber auch mit Geduld erzogen. Als er die Kartoffeln nicht essen will, sondern auf den Boden wirft, schlägt sie ihn nicht. Im Prolog wird erzählt, dass Alice ihr Kind aussetzt. Das deutet sich bereits in einer Episode am Ende des dritten Kapitels an. Mutter und Kind sind auf Pilzsuche. Die Mutter hetzt durch den Wald, Peter hat Mühe, ihr zu folgen. Man hat den Eindruck, dass sie ihn abschütteln will: Peter klammerte sich an sie, griff nach ihrem Mantel, sie schüttelte ihren Arm, sie schüttelte heftig, bis er loslassen musste. Sie ging voran, er hinterher. Sie lief schneller als er. (408) Immer wieder ruft er Mutter! Er weint. Warum tut sie das? Sie weiß es selbst nicht. Doch ein beiläufiger Satz verrät es: wie süß war das Alleinsein (410). – An diesem Tag treffen sie auf einen haltenden Zug mit KZ-Häftlingen. Helene stößt auf einen Geflohenen und blickt in dessen ängstliche […], schwarze Augen. Da denkt sie an Martha. T 14 Es waren Marthas Augen, die Helene jetzt sah. Marthas ängstliche Augen. Helene sah Martha in dem Viehwaggon, sie sah, wie Marthas nackte Füße auf den Exkre12 menten ausrutschten, wie sie Halt suchte, das Stöhnen der Gepferchten, das Ächzen des Menschen, sein Zittern […]. Ein Schuss fiel. (407) Zwei Menschen suchen nach Pilzen und stoßen auf den Holocaust. Helene sieht in Marthas Augen das Schicksal der Juden, dem sie selbst entgangen ist. Wen der Schuss getroffen hat, wird nicht gesagt. Man kann es nur ahnen. Der dritte Teil endet mit der Vorbereitung der Reise nach Westen. Alle Deutschen sollen Stettin verlassen. Helene packt in Peters Koffer Kleidung, sein Lieblingsbuch, einen aus Horn geschnitzten Fisch, die Geburtsurkunde, etwas Geld und einen Zettel mit der Information: Onkel Sehmisch, Gelbensande. Sie sollten für Peter sorgen. Und: Es sollte ihm an nichts mangeln. Nun wird klar, dass sie ihn aussetzen will: Sie durfte ihm nicht sagen, dass es um den Abschied ging. Er würde sie nicht gehen lassen. (416) Gehen also will sie, das Kind soll sie nicht daran hindern. 6 Epilog Der Roman schließt mit einem elfseitigen Epilog. Er korrespondiert mit dem Prolog. Wir sind im Jahr 1954; Peter hat seinen 17. Geburtstag. Nach der Aussetzung in Pasewalk kam er tatsächlich zu seinem Onkel nach Gelbensande. Man nahm ihn auf, aber widerwillig – ein zusätzlicher Esser. Doch der Junge arbeitet fleißig und verdient sich sein Brot. Er ist klug, liest viel und besucht die Oberschule. Sein erträumtes Berufsziel: die Filmhochschule in Potsdam, also „was mit Medien“. Zum Geburtstag hat sich seine Mutter angesagt, elf Jahre nach der Trennung. Über Helenes Leben erfahren wir nur, dass sie in der Nähe von Berlin lebt, ganz bescheiden mit ihrer Schwester in einer Einzimmerwohnung (420), und dass sie viel arbeitet. Peter will seine Mutter nicht sehen und versteckt sich. Es ist seine Rache; er will sie quälen, wie sie ihn gequält hat: Sie würde ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen, jetzt nicht, heute nicht, und nie mehr. (426) Denn: Er konnte ihr nicht vergeben, niemals würde er ihr verzeihen können. (427) Das Schlussbild entspricht dem Anfang. Damals war es Morgen, jetzt ist es Abend: T 15 Peter hörte den Wind in den Pappeln. Die Tante öffnete die Pforten des Tors. Der Motor wurde gezündet, der kleine Lastwagen fuhr eine Schleife über den Hof und zur Ausfahrt hinaus. […] Peter legte sich auf den Rücken. Das Stroh kitzelte ihn im Nacken. Die Dunkelheit besänftigte ihn; er war ganz ruhig. (430) Wieder liegt Peter auf dem Boden. Statt des Schreis der Möwe hört er den Wind in den Pappeln. Die Mutter muss Gelbensande unverrichteter Dinge verlassen. Am Anfang will Peter eine Möwe verschwinden lassen; jetzt hat er die Mutter zum Verschwinden gebracht. Er ist mit sich im Reinen. Hat er sich dem Fluch der Mittagsfrau entzogen? Roland Häcker Sindelfingen, April 2012 www.roland-haecker.de 13