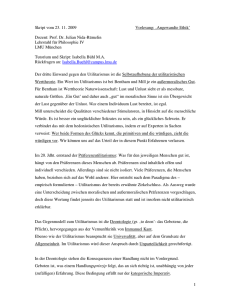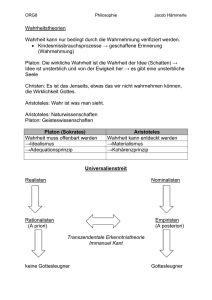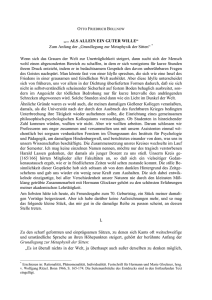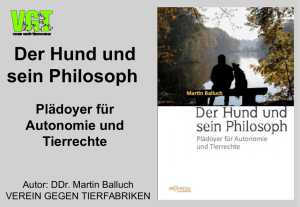Philosophie ohne Fortschritt_Druckdatei_final
Werbung

Philosophie ohne Fortschritt? Zur kritischen Erneuerung eines problematischen Begriffes DISSERTATION der Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen (HSG) zur Erlangung der Würde eines Doktors der Sozialwissenschaften vorgelegt von Till Wagner aus Deutschland Genehmigt auf Antrag der Herren Prof. Dr. Dieter Thomä und Prof. Dr. Michael Hampe Dissertation Nr. 4316 (Difo-Druck GmbH, Bamberg 2015) Die Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Internationale Beziehungen (HSG), gestattet hiermit die Drucklegung der vorliegenden Dissertation, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Anschauungen Stellung zu nehmen. St. Gallen, den 21. Mai 2014 Der Rektor: Prof. Dr. Thomas Bieger Gewidmet Josef Maria Häußling! Inhalt Vorwort................................................................................................................................. 7 Zusammenfassung ............................................................................................................. 11 Summary ............................................................................................................................ 12 1 Einleitung ........................................................................................................................ 13 Fortschritt und Kritik ........................................................................................................ 16 Begriffsgeschichtliche Deckungnahme ............................................................................ 23 Zum Weg dieser Untersuchung ........................................................................................ 28 Vor und nach 1660 ........................................................................................................... 33 2 Zwei begriffslogische Modifizierungen ......................................................................... 46 Entambiguisierung des Fortschrittsbegriffes .................................................................... 47 Die zwei Modi des Fortschrittsbegriffes .......................................................................... 51 3 Vollkommenheit als Ziel des Fortschritts? – zu Aristoteles ....................................... 55 4 „Befriedigung“ als Ziel des Fortschritts ....................................................................... 60 Von Aristoteles zu Hegel, ... ............................................................................................. 60 ... von Hegel zurück zu Aristoteles ... ............................................................................... 72 ... und über Kant ... ........................................................................................................... 83 ... zurück zu Hegel .......................................................................................................... 102 5 Subjektiver Fortschritt................................................................................................. 108 6 Objektiver Fortschritt .................................................................................................. 120 Befriedigung und Relativismus ...................................................................................... 120 Befriedigung und politisches Interesse? ......................................................................... 123 Befriedigung und Wahrheit? .......................................................................................... 125 Befriedigung und natürliche Vernunft ............................................................................ 133 Befriedigung und moralische Norm ............................................................................... 159 Befriedigung und die Bedingungen moralischen Verhaltens ......................................... 196 Philosophie ohne Fortschritt?......................................................................................... 232 Literatur ........................................................................................................................... 235 Vorwort Hätte ich im Vorhinein absehen können, wohin mich die Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsbegriff führen wird, nämlich zu der Einsicht in die „Notwendigkeit“ einer Überführung der Fortschrittsdiskussion von der Geschichtsphilosophie in die praktische Philosophie, ich hätte wahrscheinlich noch einmal so viel Zeit für die Arbeit anberaumen müssen, wie für das auf diesen Seiten vorliegende Ergebnis nötig war. Aus fünf Jahren wären zehn geworden. Dies hätte natürlich den Rahmen einer Promotion, in die meine Auseinandersetzung fließen sollte, gesprengt. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, mit dieser Veröffentlichung zunächst nur die halbe Wegstrecke zu gehen. Anders als man zunächst meinen könnte, hieß das für mich jedoch nicht, als diese erste Wegstrecke die historische Begriffs- und Diskussionsentwicklung anhand einschlägiger und weniger einschlägiger Autoren darzustellen, woraufhin als zweite Halbstrecke die Überführung vorzunehmen gewesen wäre. Denn zur Begriffsgeschichte gibt es bekannter Weise bereits eine ganze Reihe recht ergiebiger Arbeiten, auf die ich neben Primärtexten gerne zurückgegriffen habe und die mich in die Situation versetzt haben, diesen Schritt nicht mehr als eigenständigen Teil meiner Arbeit völlig neu und explizit gehen zu müssen. Anders sieht es mit der Überführung der Fortschrittsdiskussion von der Geschichtsphilosophie in die praktische Philosophie aus. Hier gibt es – wenn überhaupt – nur sehr wenig Material, das diesen Übergang thematisiert. Dieser Sachverhalt entspricht schlichtweg der Tatsache, dass dieser Übergang, diese Überführung noch nicht vollzogen ist, sondern überhaupt erst einmal vollzogen werden muss. „Muss“ meines Erachtens zumindest dann, wenn überhaupt die Chance bestehen soll, einen Begriff von Fortschritt zu entwickeln, der eine über begriffsgeschichtliche und ideologiekritische Relevanz hinausgehende Bedeutung für unser heutiges Selbstverständnis und unsere heutige Lebenspraxis aufzuweisen in der Lage ist. Dass dies eine philosophische und über philosophische Relevanz hinausgehende Aufgabe ist, davon gehe ich aus. Was die erste halbe Wegstrecke betrifft, so bestand die langsam immer deutlicher werdende Aufgabe darin, um in einem Bild zu sprechen, das Ufer der überkommenen geschichtsphilosophischen Fortschrittsbegriffe hinter mir zu lassen und mich mit so wenig Gepäck als möglich in den offenen und aus unterschiedlichsten Quellen sich speisenden, teils ruhigeren, teils wilderen Strom der Gedanken zu begeben, mit dem Ziel, schließlich das andere, das praktische Ufer zu erreichen, dieses erkunden zu können und ein Fundament zu legen für einen Brückenbau zum geschichtsphilosophischen Ufer zurück. Letzteren verstehe ich als die von mir in dieser Arbeit nicht mehr vollzogene zweite Wegstrecke. 7 Denn eine Brücke würde der gesuchten Überführung schließlich umfassender genüge tun als die expeditionshafte Überfahrt, die, sich auf das Notwendigste beschränkend, das „alte“ Ufer, ohne es zu vergessen, erst einmal hinter sich lässt. Eine solche Brücke würde über die Thematisierung der für die Fortschrittsdiskussion meines Erachtens allgemein vorauszusetzenden und in diesem Sinne notwendigen Bedeutung von Fortschritt als einer „objektiv guten Entwicklung“ hinausgehen und somit in einer umfassenderen Wiederaufnahme und Diskussion spezifischerer Thematiken der tradierten Fortschrittsbegriffe bestehen. Diese wären kritisch daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie auf dem bereiteten praktischen Fundament bestehen können. Zu denken wäre hier etwa an Thematiken wie die Entwicklung der Rechts- bzw. Verfassungswirklichkeit, die zum Beispiel in Kants Geschichtsphilosophie eine herausragende Rolle spielt; oder an die Betrachtung der Technik- und Wissenschaftsentwicklung sowie an kultur- bzw. sozialtheoretische Systematisierungen der Geschichte, darin Politik und Ökonomie mitbegriffen, die allesamt immer wieder im Zentrum der tradierten Fortschrittsdiskussionen und der Aufmerksamkeit ihrer Protagonisten standen; aber auch an naturgeschichtlich akzentuierte Evolutionsvorstellungen wie sie in unterschiedlicher Ausformung etwa bei Haeckel, später Teilhard de Chardin oder Delgaauw zu finden sind; oder an den Bildungsbegriff wie er von Herder und in Anschluss an diesen von Hegel in seinem umfassenden, die gesamte Geschichte einbeziehenden Sinne entwickelt wurde; sowie schließlich an den Begriff der Geschichtsphilosophie selbst. Und dennoch, bevor man eine solche Brücke baut, eine solche Überführung leistet, sollte zunächst das „neue“ Ufer, der andere Boden, auf dem einer der zwei notwendigen Brückenköpfe stehen soll, genauer auf die zu bauende Brücke hin untersucht und das Fundament auf diesem entsprechend gelegt werden, um diesbezüglich möglichen Fehlkonstruktionen der Überführung weitestgehend vorzubeugen. Die vorliegende Untersuchung ist ein kritikwürdiger und im positiven Falle sich bewährender Beitrag dazu. Lässt man sich einmal auf die praktische Wendung des Fortschrittsbegriffes ein, gewinnt man eine neue Perspektive, ein neues Blickfeld, in dem bereits vorhandenes Material plötzlich eine Relevanz für die Fortschrittsdiskussion erhält, die es vorher nicht zu haben schien und sodann für die umfassendere Überführung zur Verfügung steht. Klar sollte aber auch sein, dass selbst nach einer solchen Überführung der Fortschrittsdiskussion in die praktische Philosophie tradierte Thematiken zwar soweit als möglich aufgehoben sind, nicht aber mehr das Zentrum des Fortschrittsbegriffes ausmachen. Dieses wird stattdessen in praktischen Fragen liegen und alle Diskussionsfelder mit einbeziehen, die für diese Fragen von Bedeutung sind. Dazu gibt diese Arbeit einige Hinweise. Die Konzentration auf die praktische Wendung hat zur Folge, dass bestimmte Erwartungen hinsichtlich eines mit der Fortschrittsdiskussion in Verbindung zu bringenden Kanons von 8 Protagonisten sowie hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte, in Bezug auf welche auch zu diesem Kanon gehörende Autoren behandelt werden, enttäuscht werden. Dies ist nicht zu verhindern. Sowohl die Auswahl der Autoren als auch der thematischen Schwerpunkte orientiert sich allein an der Frage, ob und wie „Fortschritt“, verstanden als eine „objektiv gute Entwicklung“, praktisch-philosophisch gegriffen werden kann. Ich habe mich in der Beantwortung dieser Frage bemüht, soweit es geht in die Tiefe, nicht in die Breite zu gehen. Dieses Bemühen spiegelt sich sowohl in der Anzahl der ausführlicher diskutierten Autoren als auch in der zurückhaltenden Berücksichtigung von Sekundärliteratur in der Diskussion einiger Primärtexte wider, letzteres insbesondere in den ausführlicheren Kapiteln zu Aristoteles und Kant. Ich bitte dies Seitens der „übergangenen“ Forscher zu entschuldigen. Der Sache nach hat dieses Vorgehen ganz einfach einen großen Vorteil gehabt. Die Zeit, die zu einer umfänglicheren Aufarbeitung und textlichen Integration der für die anvisierte Fortschrittsdiskussion nicht unbedingt prädestinierten Sekundärliteratur nötig gewesen wäre, konnte so in die Entwicklung der primären Argumente und Argumentationsfolgen für eben diese Diskussion investiert werden. Auch blieb so genügend Raum, um für diese Untersuchung notwendige, wenn auch nicht selbst ausführlich explizierte, sondern textlich „nur“ durchscheinende Themen im Abgleich mit dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion gründlich zu erarbeiten, etwa hinsichtlich erkenntnistheoretischer Problematiken, Fragen zur Willensfreiheit im Besonderen wie zur Philosophie des Geistes im Allgemeinen oder hinsichtlich naturwissenschaftlicher Aspekte. Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit zu bewältigenden Aufgabe als auch des beschriebenen Umganges mit Autoren und Literatur könnte insgesamt der Eindruck eines etwas „abgekapselten“ Ergebnisses hervorgerufen werden. Dies wäre meines Erachtens nur folgerichtig. Denn von den einschlägigen Autoren und tradierten Fortschrittsbegriffen musste ich mich insofern „abkapseln“, als dass sie Fortschritt eben nicht primär praktisch thematisieren. In der praktischen Philosophie ist der Fortschrittsbegriff bisher nicht beheimatet. Wie soll es also anders sein, als dass insgesamt der Eindruck einer gewissen Abkapselung entsteht? Wenn von innen her in dieser so verstandenen und plausibilisierten Abkapselung ein fruchtbarer Samen liegt, der zu einer erneuerten Entfaltung der Fortschrittsdiskussion in einer tragfähigen und zeitgemäßen Weise beizutragen in der Lage ist, dann ist diese Abkapselung in Hinblick auf die Erfüllung der Aufgabe, der ich mich in dieser Arbeit gestellt habe, die Beschreibung eines optimalen Ergebnisses. Nun bleibt mir, Dank auszusprechen. Zunächst will ich Prof. Dieter Thomä für die Annahme dieses Promotionsprojektes und den philosophischen Freiraum, den er mir zu dessen Bearbeitung gegeben hat, danken. Der Stiftung der Deutschen Wirtschaft danke ich für die Gewährung eines Promotionsstipendiums. Bei meiner Familie bedanke ich mich für 9 die vielseitige und vielfältige Unterstützung, die ich während der gesamten Zeit der Promotion durch sie erfahren habe. Besonderer Dank gilt dabei meiner Freundin und unseren zwei Kindern, die mir vor allem in den letzten fünf Monaten der Fertigstellung des vorliegenden Textes aus- und durchhaltend für die Arbeit zuhause den Rücken freigehalten haben. Dies war wahrlich keine familienfreundliche Zeit. Der Weg bis zur Fertigstellung des Textes war weit. Und was wäre er gewesen ohne die vielen Gespräche und Anregungen, die ich mit anderen geführt bzw. von diesen erhalten habe. Ich danke den, wenn auch nicht namentlich genannten, unzähligen fachlichen und nicht-fachlichen Gesprächspartnern am Lehrstuhl, in Seminaren, Workshops, auf Konferenzen oder im privaten Umfeld, die mich auf meinem Weg auf verschiedenste Weise weiter gebracht haben. Bei Juliane Slotta bedanke ich mich für das sehr zuverlässige und zeitlich äußerst flexible Korrekturlesen des Textes. Schließlich danke ich Prof. Dieter Thomä und Prof. Michael Hampe für die Begutachtung der Arbeit und Abnahme der Disputation. Nicht mehr danken kann ich Prof. Josef Maria Häußling, den ich als meinen philosophischen Mentor an der Universität Witten/Herdecke und späteren Freund bezeichnen kann, für die Jahre seiner Begleitung, in denen ich mich, wenn man so will, auf die Promotion vorbereitet habe. Josef Maria Häußling verstarb 2012. Ihm widme ich diese Arbeit. Witten, den 15. Dezember 2014 10 Zusammenfassung Die vorliegende Untersuchung findet ihren Ausgangspunkt zunächst in einer begriffslogischen Erörterung von Fortschritt als einer „objektiv guten Entwicklung“. Diese führt zu einem modifizierten Verständnis von Fortschritt, in dem begriffliche Strukturen zum Vorschein kommen, die den Fortschrittsbegriff in Bezug zur antiken, vor allem der aristotelischen Philosophie und in dieser zu den Begriffen der eudaimonia und der entelechie setzen und damit zu einem Denken, das in der Fortschrittsdiskussion bisher keine Rolle gespielt hat. Von da aus gelangen wir zu Terry Pinkards zeitgenössischer Interpretation der Philosophie Hegels, die Pinkard als einen „entzauberten Aristotelismus“ versteht, in dem die eudaimonia in den Begriff der Befriedigung übergeht. Der in Pinkards Hegel-Interpretation entwickelte Begriff der Befriedigung dient sodann als eine erste Annäherung an ein Verständnis von Fortschritt im praktischen Sinne. Um deutlicher zu machen, was dieser Begriff gegenüber dem der Glückseligkeit zu leisten vermag, wendet sich die Untersuchung in einer kritischen Haltung erneut Aristoteles, dann aber auch Kant zu, in dessen praktischer Philosophie die Glückseligkeit ebenfalls eine entscheidende Stellung einnimmt. Die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Aristoteles und Kant dienen einer genaueren Qualifizierung des Begriffes der Befriedigung. Diese geht über in die Formulierung eines subjektiven Fortschrittes. Ein subjektivistisches Fortschrittsverständnis reicht offensichtlich nicht dazu hin, die Möglichkeit einer objektiv guten Entwicklung, eines objektiven Fortschrittes zu plausibilisieren. Der Gedanke, den subjektiven Relativismus durch einen politischen Zusammenhang als einem solchen theoretisch in den Griff zu bekommen, scheitert. Pinkards Versuch, das Problem des Relativismus durch den Wahrheitsbegriff zu lösen, wird kritisiert. In seiner Argumentation bleibt der Relativismus weiter bestehen. Der Wahrheitsbegriff kann nur die Aussicht auf eine Lösung bieten, wenn es möglich ist, ein normatives Faktum in der Natur der Fortschrittssubjekte aufzuweisen, an dem sich möglicher subjektiver Fortschritt praktisch orientieren kann. Für einen solchen Aufweis muss zunächst deutlich gemacht werden, was unter der Natur der Fortschrittssubjekte näher zu verstehen ist. In diesem Zusammenhang wird der Begriff einer natürlichen Vernunft entwickelt und ins Verhältnis zur Grundstruktur der Rationalitätstheorie von Jürgen Habermas gesetzt und vertieft. Im Anschluss daran wird der Versuch unternommen, in Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche eine moralische Norm als ein in der Natur der Subjekte gründendes normatives Faktum zu plausibilisieren, auf das hin sich ein objektiver Fortschritt als ein befriedigendes Leben in Frieden denken lässt. Schließlich stellt sich die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfüllung der moralischen Norm und danach, inwiefern davon ausgegangen werden kann, dass diese Bedingungen wirklich gegeben sind. Diese Fragen werden in einer kritischen Diskussion der religionsphilosophischen Überlegungen von Mark Johnston und der für diesen als Quelle dienenden Prozessontologie Alfred North Whiteheads sowie von Gunnar Hindrichs Begriff des Absoluten einer möglichen Antwort näher gebracht. 11 Summary This thesis begins with the conceptual analysis of progress as an „objectively good development”. This leads to a modified understanding of progress exhibiting conceptual structures which relate the concept of progress to antique philosophy, in particular Aristotelian philosophy and its concepts of eudaimonia and entelechie, i.e. to a thinking that so far has not played a role in the discussion on progress. From there, we will continue to Terry Pinkard’s contemporary interpretation of Hegel’s philosophy, which Pinkard understands as a ‘disenchanted Aristotelism’ in which the eudaimonia turns into the concept of satisfaction (Befriedigung). The concept of satisfaction developed in Pinkard’s interpretation of Hegel will serve as a first approach to an understanding of progress in the practical sense. In order to contrast this concept with the concept of beatitude (Glückseligkeit), this thesis will first return to Aristotle and then turn towards Kant, in whose practical philosophy the concept of beatitude also takes a prominent position. The results of this examination of Aristotle and Kant will serve a more precise qualification of the concept of satisfaction. Following this, a subjective progress will be formulated. A subjectivist understanding of progress is obviously not suitable to underpin the possibility of an objectively good development, an objective progress. The attempt fails to theoretically come to grips with subjective relativism by a political context as such. Pinkard’s attempt to solve the problem of relativism by the concept of truth is criticized. In his argumentation, relativism continues to exist. The concept of truth can only then provide a possibility for a solution if it is possible to establish a normative factum in the nature of the subjects of progress, which provides practical orientation to a possible subjective progress. For this, it will need to be clarified, what is to be understood by the nature of the subjects of progress. In this context, the concept of natural reason (natürliche Vernunft) is developed and set into context with the basic structure of Jürgen Hambermas rationality theory. In the following, Friedrich Nietzsche is discussed and an attempt is made to establish a moral norm as a normative factum rooted in the subjects’ rational nature that would allow for an objective progress as a satisfactory life in peace (befriedigendes Leben in Frieden). Finally, the prerequisites of the possibility of the moral norm’s fulfillment are discussed and it is examined whether these prerequisites are indeed given. This will include a critical discussion of the Mark Johnston’s deliberations concerning the philosophy of religion, Alfred North Whitehead’s process ontology, as well as Gunnar Hindrich’s concept of the absolute. 12 1 Einleitung Ohne viele Worte aufzuwenden, möchte ich direkt in das Thema dieser Arbeit einführen, welches sich, wie der Untertitel deutlich macht, in der Entwicklung eines Fortschrittsbegriffes findet. In einer sehr allgemeinen Formulierung geht es dabei um die Frage nach einer objektiv guten Entwicklung. Und es wird diskutiert werden, wie das Verhältnis zwischen einer solchen Entwicklung und unserem subjektiven Leben verstanden werden kann. Schließlich wird danach gefragt werden, inwiefern wir es als unsere Aufgabe begreifen können, einen Beitrag zu einem wie auch immer gearteten Fortschritt zu leisten. In der Philosophie ist es leise geworden um diese Fragen. Zu groß, ja uneinlösbar scheint der Anspruch des Fortschrittsbegriffes in seinen weit, manchmal sogar unendlich weit über das individuelle Subjekt hinausgreifenden Formulierungen zu sein. Mit dem Fortschritt ist die Frage nach seiner Universalität unweigerlich verbunden. Es ist nicht zuletzt diese „Maßlosigkeit“ des Fortschrittsbegriffes, die nicht nur jeden Versuch seiner Bestimmung an die Grenzen des begrifflich Leistbaren bringt, sondern ihn auch höchst verdächtig und anrüchig hat werden lassen. Historisch in das semantische Vakuum gezogen, das durch die im Laufe der Neuzeit immer breitenwirksamer werdende Abwendung von heilsgeschichtlich verklausulierten religiösen und weltlichen Machtambitionen entstand, erbte er ehemals in diesen Klauseln gebundene und nun ungebundene Sehnsüchte und Energien. Diese schlugen sich unter anderem in geschichtsphilosophischen Weltbildern nieder und in mit diesen verbundenen, teilweise verheerenden politischen Ideologien. Hier ist alle Kritik berechtigt und gefordert. Dies gilt insbesondere für Vorstellungen, in denen die universale Offenheit des Fortschrittsbegriffes blindlings in die geschlossene Universalität einer fixen Idee überführt und diese in den Lauf der Geschichte, der Welt oder sogar des Kosmos gelegt wird. Und genau von solchen Vorstellungen, von solchen Hypostasierungen gilt es den Fortschrittsbegriff zu befreien, wenn er dem, was er bedeutet, nicht selbst im Wege stehen soll: einer objektiv guten Entwicklung. Dies bedeutet, Fortschritt nicht mehr primär als einen geschichtsphilosophischen, sondern als einen praktischen Begriff zu verstehen. Es ist danach zu fragen, inwiefern Fortschritt als eine Möglichkeit unseres subjektiven Verhaltens begriffen werden kann. In diesem Verständnis folgt die Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsbegriff einem praktischen Interesse. Mit diesem ist aber auch unweigerlich ein theoretisches Interesse verbunden. Denn zur Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit von Fortschritt ist es notwendig, genauer zu erfassen, was unter dem Begriff des Fortschritts, unter einer objektiv guten Entwicklung, in praktischer Hinsicht sinnvoll verstanden werden kann. Somit ist dieses theoretische Interesse eines, das sich nicht aus einer Praxis heraushebt, sondern untrennbar mit dieser verbunden und also selbst praktisch ist. Als Frage nach einer objektiv guten Entwicklung ist mit der Frage nach einem Fortschritt immer schon ein über das fragende Subjekt hinausgehender Zusammenhang angesprochen, in dem es sich und sein Leben 13 auch in ein Verhältnis zu anderen Subjekten setzt. Die Frage nach dem Fortschritt geht so einher mit einem sozialen und politischen Interesse. Man kann schließlich das praktische Interesse, das theoretische Interesse und das soziale bzw. politische Interesse am Fortschrittsbegriff derart auffassen, dass sie jeweils verschiedene Aspekte ein und desselben immer wieder aktuellen Grundproblems betonen: Kann ein gutes Leben des Einzelnen mit dem der anderen in Einklang gebracht werden? Wenn wir Fortschritt nicht für möglich halten und nicht als eine konkrete Option unserer subjektiven Handlungen verstehen können, werden wir uns auch nicht um einen solchen bemühen, sondern ihn, so wir nicht ganz von diesem gedanklich ablassen wollen, in die Hoffnung auf eine Vorsehung, eine unsichtbare Hand, eine List der Vernunft, eine List der Geschichte, eine List der Natur oder ähnliches legen. Das ist, so denke ich, zu wenig. Um einem Missverständnis vorzubeugen, sei sogleich deutlich gemacht, dass es in dieser Arbeit nicht um die konkrete Ausmalung eines möglichen Fortschritts geht, mit Adorno könnte man sagen, um eine „ausgepinselte Utopie“.1 Denn Fortschritt ist, das ist ein Ergebnis dieser Untersuchung, kein Bild, dem wir zu entsprechen hätten, sondern vielmehr eine beständige Aufgabe, der wir uns stellen können. Aber es scheint mir doch unbefriedigend, was Adorno nach bezüglich des Fortschrittes theoretisch zu leisten sei: „Theoretische Rechenschaft über die Kategorie des Fortschritts verlangt, diese so nahe zu betrachten, daß sie den Schein des Selbstverständlichen ihres positiven wie negativen Gebrauchs verliert. Aber solche Nähe erschwert zugleich die Rechenschaft. Mehr noch als andere zergeht der Begriff Fortschritt mit der Spezifikation dessen, was nun eigentlich damit gemeint sei, etwa was fortschreitet und was nicht. Wer den Begriff präzisieren will, zerstört leicht, worauf er zielt. Die subalterne Klugheit, die sich weigert, von Fortschritt zu reden, ehe sie unterscheiden kann: Fortschritt worin, woran, in bezug worauf, verschiebt die Einheit der Momente, die im Begriff einander sich abarbeiten, in bloßes Nebeneinander. Rechthaberische Erkenntnistheorie, die dort auf Exaktheit dringt, wo die Unmöglichkeit des Eindeutigen zur Sache selbst gehört, verfehlt diese, sabotiert die Einsicht und dient der Erhaltung des Schlechten durchs beflissene Verbot, über das nachzudenken, was im Zeitalter utopischer wie absolut zerstörender Möglichkeiten das Bewußtsein der Verstrickten erfahren möchte: ob Fortschritt sei. Wie jeder philosophische hat der Terminus Fortschritt seine Äquivokationen; wie in jeglichem melden diese auch ein Gemeinsames an. Was man zu dieser Stunde unter Fortschritt sich zu denken hat, weiß man vag, aber genau: deshalb kann man den Begriff gar nicht grob genug verwenden.“2 1 Adorno, Theodor W.: „Fortschritt“, in: Helmut Kuhn/Franz Wiedmann: Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt, München: Verlag Anton Pustet, 1964, Seite 38. 2 Ebd., Seite 30. 14 Zwar stimme ich mit Adorno überein, dass es keinen Sinn macht, den Fortschrittsbegriff in eine Vielzahl von Spezialbedeutungen zu zerlegen, die demselben, so der Wunsch, eine instrumentelle Operabilität in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens verleihen. Der Fortschrittsbegriff beschreibt, wie er hier verstanden wird, zunächst eine Suchbewegung, nicht spezifisch-technisches Expertenwissen. Die mit dem Universalitätsgedanken verbundene Relevanz der Frage nach dem Fortschritt in allen denkbaren Lebensbereichen legitimiert sich nicht über ein jeweilig spezifisches Umsetzungswissen, sondern über die Tatsache, dass die Problematik einer objektiv guten Entwicklung das Leben des Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Und doch kann meiner Ansicht nach mehr geleistet werden, als die paradoxe Formulierung eines Fortschrittverständnisses, das „vag, aber genau“ sei, und man deshalb – in etwa der Logik folgend: je vager, desto genauer – „den Begriff gar nicht grob genug verwenden“ könne. Hier kann, so denke ich, mehr geleistet werden. Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Frage nach der Möglichkeit von Fortschritt. Es wird also nicht primär danach gefragt, wie genau sich Fortschritt umsetzen ließe, als vielmehr danach, ob Fortschritt überhaupt möglich ist, ob und inwiefern es Sinn macht, nach einem genauen „Wie“ zu suchen. Ist er nicht möglich, dann erübrigt sich die Frage nach dem „Wie“: Entweder weil wir davon ausgehen, dass Fortschritt so oder so stattfindet, oder, dass es ihn so oder so nicht geben kann. In beiden Fällen ist die Wirklichbzw. Unwirklichkeit des Fortschrittes völlig unabhängig davon, was wir erleben, und unabhängig davon, was wir denken und wie wir handeln, und jede weitere Auseinandersetzung um ein „Wie“ vergeudete Energie. Es erscheint also nicht nur aus Gründen wissenschaftlicher Redlichkeit angebracht, darauf zu verzichten, der Geschichte im Vorhinein einen Fortschritt zu unterlegen oder abzusprechen – in beiden Fällen ginge es ja dann nur darum, Argumente zur Bestätigung der einmal gesetzten Vorurteile zu finden, was mit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht viel zu tun hat. Es wäre auch aus pragmatischer Hinsicht ein sinnloses Unterfangen, Zeit und Kraft für eine Verständigung über etwas aufzubringen, dessen Wirklich- oder Unwirklichkeit völlig unberührt von eben dieser Verständigung bleibt. Wir könnten behaupten, dass es notwendigerweise einen Fortschritt in der Geschichte gibt, oder aber, dass es ihn nicht geben kann, wir würden nichts dadurch gewinnen. Auch keinen Einblick in die Wirklichkeit, denn diese könnte sich im positiven wie im negativen Votum genau gegensätzlich zu unseren Überzeugungen verhalten. So gewendet kann man nicht nur mein Interesse an dieser Untersuchung, sondern gerade auch die Entscheidung, den Fokus dieser Arbeit auf die Frage nach der Möglichkeit von Fortschritt als einer objektiv guten Entwicklung zu legen, pragmatisch nennen. Nach der Möglichkeit von Fortschritt zu fragen heißt, nach den Bedingungen der Möglichkeit einer objektiv guten Entwicklung zu fragen. Aber es heißt zum anderen auch, 15 der Frage nachzugehen, ob diesen Bedingungen und damit der Möglichkeit von Fortschritt selbst Wirklichkeit zugesprochen werden kann. Denn ohne die Wirklichkeit der Bedingungen der Möglichkeit hätte sich die Möglichkeit von Fortschritt erübrigt. Es bliebe bei einem von der Wirklichkeit losgekoppelten Gedankenspiel. Diese beiden Ebenen gilt es also im Kopf zu behalten, wenn in dieser Arbeit den Bedingungen der Möglichkeit von Fortschritt nachgegangen wird. Damit ist an die vorliegende Untersuchung der Anspruch einer begrifflichen Grundlagenarbeit gestellt, die im positiven Falle Anknüpfungspunkte auch für Auseinandersetzungen über ein konkreteres „Wie“ möglichen Fortschritts bieten wird. Fortschritt und Kritik Dass die erneuerte Diskussion des Fortschrittbegriffes laut Untertitel auf kritische Weise erfolgen soll, kann zum einen auf den vorausgesetzten Anspruch einer mit theoretischer Unvoreingenommenheit verbundenen kritisch-prüfenden Auseinandersetzung bezogen werden. Zum anderen klingt in dem Wort „kritisch“ aber auch der bereits angedeutete Sachverhalt an, dass die Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsbegriff selbst, soweit dieser nicht bloß kritisiert, sondern positiv zu begreifen versucht wird, tendenziell als ein heikles Unterfangen gesehen wird. Die Diskussion des Fortschrittsbegriffes ist auch in diesem Sinne eine kritische Angelegenheit. Man bewegt sich mindestens am Rande dessen, was in der Philosophie als Philosophie vertretbar ist. Wer sich mit dem Fortschrittsbegriff zu beschäftigen beginnt, wird in der philosophischen Diskussion unumgänglich auf einen Widerstand treffen, der sich beispielsweise in folgenden Sätzen wiederspiegelt: „Die Idee des Fortschritts ist in den letzten Jahren von einflußreichen Philosophen heftig attackiert worden“;3 „On se mobilise désormais contre le progrès;4 „Und schließlich verkümmerte sie [die Idee des Fortschritts; T. W.] zu einem diskreditierten, gescheiterten Mythos“;5 „Die Auseinandersetzung mit dem Fortschritt ist bekanntlich seit geraumer Zeit mehrheitlich eine kritische.“ 6 „Der moderne Fortschrittsbegriff ist [...] mittlerweile dermaßen in Ungnade gefallen, dass man sich nur noch unter großen Schwierigkeiten zu ihm bekennen kann.“7 Der in diesen Zitaten reflektierte Widerstand ist Ausdruck einer Entwicklung des geistigen Klimas, dessen Beschaffenheit für die Fortschrittsdiskussion alles andere als günstig 3 Zachriat, Wolf Gorch: Die Ambivalenz des Fortschritts – Friedrich Nietzsches Kulturkritik, Berlin: Akademie Verlag, 2001, Seite 11. 4 Taguieff, Pierre-André: Le Sens du Progrès – Une approche historique et philosophique, Paris: Éditions Flammarion, 2004, Seite 11. 5 Salvadori, Massimo L.: Fortschritt – die Zukunft einer Idee, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 2008, Seite 12. 6 Mäder, Denis: Fortschritt bei Marx, Berlin: Akademie Verlag, 2010, Seite 9. 7 Ebd., Seite 22. 16 gewesen ist. Die schon in der Zeit der Aufklärung, wie etwa bei Jean-Jacques Rousseau, und sich auch später bei Friedrich Nietzsche und Jacob Burckhardt äußernden kritischen Stimmen drängten sich spätestens in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Zuge der Erfahrung der zwei Weltkriege und der Monstrosität des deutschen Nationalsozialismus nun vollends in den Vordergrund. Dazu Hannah Arendt: „In weniger als sechs Jahren zerstörte Deutschland das moralische Gefüge der westlichen Welt, und zwar durch Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte [...].“8 Ernst Cassirer beschreibt die Situation nach den beiden Weltkriegen wie folgt: „In den letzten dreißig Jahren, in der Periode zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg, sind wir nicht nur durch eine ernstzunehmende Krise unseres politischen und sozialen Lebens gegangen, sondern wir wurden auch vor neue theoretische Probleme gestellt. Wir erlebten einen radikalen Wechsel in den Formen politischen Denkens. Neue Fragen wurden aufgeworfen und neue Antworten wurden gegeben. Probleme, die den politischen Denkern des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts unbekannt gewesen waren, traten plötzlich hervor. Vielleicht der wichtigste und beunruhigendste Zug in dieser Entwicklung des modernen politischen Denkens ist das Zutagetreten einer neuen Macht: der Macht des mythischen Denkens. Das Übergewicht mythischen Denkens über rationales Denken in einigen unserer modernen politischen Systeme ist augenfällig. Nach einem kurzen und heftigen Kampf schien das mythische Denken einen klaren und endgültigen Sieg zu gewinnen. Wie war dieser Sieg möglich? [...]. Wenn wir den gegenwärtigen Stand unseres kulturellen Lebens betrachten, bemerken wir sofort, dass ein tiefer Abgrund zwischen zwei verschiedenen Gebieten klafft. Kommt es zur politischen Handlung, dann scheint der Mensch Regeln zu befolgen, die ganz verschieden sind von denen, die er in allen seinen theoretischen Betätigungen anerkennt. Niemand würde daran denken, ein Problem der Naturwissenschaft oder ein technisches Problem durch die Methoden zu lösen, die zur Lösung politischer Fragen empfohlen und angewandt werden. Im ersten Fall streben wir, niemals andere als rationale Methoden zu gebrauchen. Rationales Denken behauptet hier seinen Boden und scheint sein Wirkungsfeld beständig zu erweitern. Wissenschaftliche Erkenntnis und technische Beherrschung der Natur gewinnen täglich neue und beispiellose Siege. Im praktischen und sozialen Leben des Menschen hingegen scheint die Niederlage des rationalen Denkens vollständig und unwiderruflich zu sein. Man glaubt, dass der moderne Mensch auf diesem Gebiet alles im Laufe seiner intellektuellen Entwicklung Gelernte vergisst. Man ermahnt ihn, auf die ersten und primitivsten Stufen menschlicher Kultur zurückzugehen. Hier bekennen rationales und wissenschaftliches Denken offen ihren Zusammenbruch; sie kapitulieren vor ihrem gefährlichsten Feind.“9 8 9 Arendt, Hannah: Besuch in Deutschland, Berlin: Rotbuch Verlag, 1993, Seite 23. Cassirer, Ernst: Vom Mythus des Staates, Zürich: Artemis, 1949, Seite 7f. 17 Der Fortschrittsbegriff, ehemals der Ausdruck rationaler Emphase, wurde in dieser Kapitulation nun selbst zu einem Mythos erklärt und aus der philosophischen Diskussion tendenziell ausgeschlossen. Im Folgenden werden acht Beispiele gegeben, die diese Situation verdeutlichen und noch einmal vor Augen führen, aus welch unterschiedlichen Richtungen der Widerstand gegen die Fortschrittsdiskussion erwuchs. Dabei wird weder der Anspruch erhoben, dass die genannten Beispiele auch nur annähernd erschöpfend wären, noch werden unterschiedliche Begründungen der Fortschrittskritik und etwaig sichtbar werdende generellere Divergenzen der einzelnen Positionen im Verhältnis untereinander genauer diskutiert. Man kann die folgenden Kurzdarstellungen als eine „makroskopische“ Wetterkarte verstehen, auf der einige der besonders großen und weithin sichtbaren Quellwolken verzeichnet sind, in denen sich jeweils Energien des geistigen Klimas zusammenzogen und in Gewittern gegen den Fortschrittsbegriff entluden. Claude Lévi-Strauss berichtet in seinen 1955 erschienenen Werk Traurige Tropen wie ihm auf seinen Forschungsreisen um die Weilt die dunkle Seite der eigenen Kultur bewusst wurde: „Denn der westlichen Kultur, der großen Schöpferin all der Wunder, an denen wir uns erfreuen, ist es nicht gelungen, diese Wunder ohne ihre Kehrseite hervorzubringen. [...] Was uns die Reisen in erster Linie zeigen, ist der Schmutz, mit dem wir das Antlitz der Menschheit besudelt haben.“10 1962 sprach Karl Löwith auf dem Siebten Deutschen Kongress für Philosophie zum Thema „Philosophie und Fortschritt“ vom „Verhängnis des Fortschritts“, das gerade in dem liege, was ihn scheinbar rechtfertige, seinem „ungeheuren Erfolg“.11 Selbst da also, wo man sein Gelingen vermuten könnte, versteckt sich seine Negation. Die vor allem technischen Errungenschaften der Menschheit haben die Grundübel des Lebens nicht beseitigen können, das Ausmaß potentiellen Leidens hingegen ins „Ungeheuerliche“ gesteigert. Vier Jahre später veröffentlichte Hans Blumenberg Die Legitimität der Neuzeit. Darin argumentiert er, dass die Fortschrittsidee „zu einer Generalisierung gedrängt“ wurde, „die ihren ursprünglich regional begrenzten und gegenständlich gebundenen Aussageumfang überbeansprucht.“ Sie versuche damit Antwort zu geben auf die „großen und allzu großen Fragen“ „nach dem Ganzen der Geschichte“, deren befriedigende Beantwortung schon das christliche Denken nicht habe leisten können. Anstatt aus dieser unbefriedigenden Antwort den Schluss der „reell nicht mehr einlösbaren Verbindlichkeit gegenüber dem Fortbestand der großen Fragen“ zu ziehen, fühle man sich dazu gedrängt, auf diese eine neue Antwort zu geben und habe die Fortschrittsidee und „ihre authentische Rationalität dabei 10 Lévi-Strauss, Claude: Traurige Tropen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1978, Seite 31. Löwith, Karl: „Das Verhängnis des Fortschritts“, in: Helmut Kuhn/Franz Wiedmann: Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt, München: Verlag Anton Pustet, 1964, Seite 15ff. 11 18 überzogen“. 12 Das Grundproblem sei die Überforderung des menschlichen Denkens hinsichtlich der unlösbaren Frage nach einer Totalstruktur der Geschichte, die ihren Ursprung letztlich in einer verwirrten Wissbegier des Menschen habe.13 Ebenfalls 1966 wendet sich Michel Foucault in Die Ordnung der Dinge gegen jede begriffliche Fixierung des Menschen, ja gegen den Begriff des Menschen überhaupt: „In unserer heutigen Zeit kann man nur noch die Leere des verschwundenen Menschen denken. Die Leere stellt kein Manko her, sie schreibt keine auszufüllende Lücke vor. Sie ist nichts mehr und nichts weniger als die Entfaltung eines Raumes, in dem es möglich ist, zu denken. [...] Allen, die noch vom Menschen, von seiner Herrschaft oder von seiner Befreiung reden wollen [...] kann man nur ein philosophisches Lachen entgegensetzen – das heißt: ein zum Teil schweigendes Lachen.“14 Kants Idee der Aufklärung als einer Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit mit Hilfe des selbstständigen Verstandesgebrauches im Hinblick auf die Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? wird bei Foucault geradezu umgekrempelt.15 Selbständig zu denken bedeutet für Foucault „in der Kontingenz, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, die Möglichkeit auffinden, nicht länger das zu sein, zu tun oder zu denken, was wir sind, tun oder denken.“16 Die kantischen Fragen werden archäologisch-genealogisch gewendet und nach vorne heraus indefinit. Der zu verfolgende philosophische Ethos sei das Bemühen, „so weit und so umfassend wie möglich, der unbestimmten Arbeit der Freiheit einen neuen Impuls zu geben.“17 Dies hieße aber auch, dass man „von allen Projekten Abstand nehmen muß, die beanspruchen global oder radikal zu sein.“18 Denn diese würden ja wiederum umfassende Bestimmungen voraussetzen, die es in der Geschichte zu verfolgen gäbe. Dass gerade die Idee eines universellen Fortschrittes diesem Verdacht ausgesetzt ist, liegt auf der Hand. Auch Jean-François Lyotard will sich von „der großen Erzählung“ der Menschheit trennen. In seinem 1979 veröffentlichten Bericht über Das Postmoderne Wissen attestiert er, dass die großen Emanzipations- und Spekulationserzählungen ihre Glaubwürdigkeit verloren haben.19 Einst dienten sie zur Legitimation epistemischer Praxis, doch sei in der inneren Struktur jener Erzählungen selbst bereits die Voraussetzung angelegt, dass sie diese Funktion heute nicht mehr erfüllen können. In der Unterscheidung zwischen präskriptiven und denotativen Äußerungen habe sich die heutige Wissenschaft auf letztere 12 Blumenberg, Hans: Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996, Seite 59ff. Vgl. ebd., Seite 263ff. 14 Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974, Seite 412. 15 Ebd., Seite 410ff. 16 Foucault, Michel: „Was ist Aufklärung?“, in: Eva Erdmann/Rainer Forst/Axel Honneth (Hrsg.): Ethos der Moderne Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt a.M./New York: Campus Verlag, 1990, Seite 49. 17 Ebd. 18 Ebd. 19 Lyotard, Jean-François: Das postmoderne Wissen, Wien: Passagen Verlag, 2009, Seite 99ff. 13 19 beschränkt. Dieses wissenschaftliche Wissen könne weder durch die Aussicht auf die Emanzipation autonomer Subjekte noch durch seinen Beitrag zu einem Prozess legitimiert werden, an dessen Ende auf eine absolute Erkenntnis spekuliert wird. Im ersten Fall hieße dies, denotative Aussagen durch präskriptive Aussagen begründen zu wollen. Dies sei unmöglich, wie auch der gegenteilige Versuch, präskriptive Aussagen aus denotativen Aussagen herzuleiten. Im zweiten Fall delegitimiere einerseits der Anspruch absoluter Erkenntnis denotative Aussagen in ihrem Status als „wirkliches“ Wissen. Andererseits delegitimiere eine als Zusammenhang denotativer Aussagen verstandene Wissenschaft den Wissensstatus der Spekulation. Weder vermögen die großen Erzählungen heutige Wissenschaft zu legitimieren, noch diese die großen Erzählungen. Deren Glaubwürdigkeit ist aufgebraucht. Da aber auch die heutige Wissenschaft ihr denotatives Apriori nicht denotativ begründen kann, sondern an dieser Stelle selbst präskriptiv verfährt, bleibt auch sie einer allgemeinen Legitimation verlustig. „Dessémination“ nennt Lyotard die Situation des heutigen Wissens. 20 Vor diesem Hintergrund plädiert er unter dem Titel der „Paralogie“ für die Anerkennung der Verschiedenheit der menschlichen Sprachspiele, von denen keines übergeordnete Geltung beanspruchen kann. Es ist eine pragmatische Sichtweise des menschlichen Wissens als Praxis sich einer universellen Legitimation entziehender maximal lokal-konsensueller Präskriptionen.21 Jegliche Aussagen, die den Anspruch erheben, metadiskursiv über die richtige Richtung dieses heteromorphen Sprachgeschehens aufklären zu können, sich also selbst aus der Reihe zeitlich und räumlich kontingenter Sprachspiele herausheben, verlieren gerade in diesem universalen Anspruch, durch den sie sich rechtfertigen wollen, ihre Glaubwürdigkeit. Dies trifft in besonderer Weise auch auf die verschiedenen Fortschrittsbegriffe zu. 1980 antwortet Robert Spaemann in einem Vortrag auf die Frage „Unter welchen Umständen kann man noch von Fortschritt sprechen?“ mit dem Vorschlag, auf den Fortschrittsbegriff, zumindest im Singular, ganz zu verzichten, weil dieser „längst zu einem Instrument der Selbstentfremdung des Menschen geworden“ sei.22 Oder man denke an Odo Marquard, der auszog, um „die Geschichtsphilosophie zu vertreten“, „diejenige die Fortschritt sieht und will [...]“, und heimkommt mit der Überzeugung, dass die Welt von solcher Philosophie zu verschonen sei.23 1989 macht Richard Rorty folgenden Vorschlag: „For we would no longer imagine a great big Incarnate Logos called ,Humanity‘ whose career is to be interpreted either as heroic 20 Ebd., Seite 104. Ebd., Seite 145ff. 22 Spaemann, Robert: „Unter welchen Umständen kann man noch von Fortschritt sprechen?“, in: ders.: Philosophische Essays, Stuttgart: Reclam, 1994, Seite 149f. 23 Marquard, Odo: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1982, Seite 13f. 21 20 struggle or as tragic decline. Instead, we should think of many different past human communities, each of which has willed us one or more cautionary anecdotes. Some of these anecdotes may serve the turn of one or more of the different human communities of the present day, depending upon their different needs and options. To think of history in this way would be to stop trying to pick out world-historical turning points or figures, stop trying to find historical events that somehow encapsulate and reveal the whole sweep of History by laying out the whole range of possibilities open to Humanity.“24 In Anbetracht dieser „Gegengewitter“ stieg das Ausmaß der zu leistenden Begründung für eine positive Aufnahme des Themas, zumindest innerphilosophisch, so immens an, dass eine direkte Aktualisierung des Fortschrittsbegriffes kaum noch ratsam erschien und bis heute offenbar erscheint. Begleitet und wahrscheinlich auch verstärkt wurde diese Kritik durch die sich immer weiter durchsetzende evolutionstheoretische Einsicht, dass die gesamte Wirklichkeit ein Prozess sei, der ziemlich langsam nirgendwohin gehe und Fortschritt allein noch als eine funktionale Illusion im „Höher, Weiter, Schneller” des soziobiologischen „struggle for life” verstanden werden könne.25 Aber trotz allem, klingt nicht in den angeführten Kritiken ein unausgesprochener semantischer Rest mit, dass es irgendwie und allgemein besser sei, vom Fortschrittsbegriff Abstand zu nehmen? Sind die Kritiken nicht also Ausdruck einer impliziten Denkbewegung, die genau dem entspricht, was explizit negiert wird?26 Es soll hier nicht in Abrede gestellt werden, dass das geschichtsphilosophische Fortschrittsdenken in seinen historischen Formen tatsächlich von unhaltbaren Vorstellungen geprägt war. Hier wäre vor allem die zum großen Teil mit diesen verbundene Hypostasierung des Fortschrittes, der daraus erwachsende Optimismus und die damit einhergehende Antizipation einer zukünftigen Perfektionierung zu nennen. Und es waren ja genau diese Vorstellungen, die angesichts der geschichtlichen Entwicklung im zwanzigsten Jahrhundert endgültig ihrer Illusionshaftigkeit überführt wurden; und auch ihrer Gefährlichkeit, weil ein solches Denken den Sinn und damit die Sorgfalt für die Realität verliert. Genau deshalb schlägt Spaemann vor, auf den Fortschritt im Singular zu verzichten, um die kleinen Einheiten wieder ins Licht zu rücken, um den „Mythos des 24 Rorty, Richard: „The End of Leninism, Havel and Social Hope“, in: ders.: Truth and Progress, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 242f. 25 Vgl. Ruse, Michael: „Evolution and Progress“, in: Trends in Ecology and Evolution, 8 (2), 1993, Seite 55-59; sowie Voland, Eckart: „Die Fortschrittsillusion“, in: Spektrum der Wissenschaft, 04/07, 2007, Seite 108-113. Es sei hier jedoch erwähnt, das Michael Ruse in Monad to Man herausgearbeitet hat, dass auch in der evolutionstheoretischen Betrachtung, sobald sie die Ebene der „micro-problems“ verlässt und in größere Zusammenhänge ausgreift, immer wieder auch der Fortschrittbegriff thematisch wird. Und es sei nicht zu erwarten, dass sich dieses ändern werde. Vgl. Ruse, Michael: Monad to Man – the concept of progress in evolutionary biology, Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 2009, Seite 484, Seite 525, Seite 539. 26 Vgl. Taguieff (2004), Seite 21ff. 21 Fortschritts im Singular [...] durch den einzig vernünftigen Begriff von akzidentellen Fortschritten und Rückschritten, von Verbesserungen und Verschlechterungen“ abzulösen.27 Anstatt darüber zu diskutieren, ob es einen globalen Fortschritt gibt, soll die Aufmerksamkeit auf die Entwicklungen in einzelnen Bereichen gerichtet werden, aus deren Zusammenspiel überhaupt so etwas wie ein Gesamtfortschritt erwachsen kann. Spaemanns Vorschlag, den Fortschritt als Singular preiszugeben, speist sich also aus dem Anliegen, auf die Gefahr hinzuweisen, die in der Hypostasierung des Fortschritts im Singular zu einer eigenen Wirklichkeit liegt.28 Diese von Spaemann und vielen anderen zu Recht kritisierte Problematik ist meines Erachtens aber nicht dadurch sinnvoll gelöst, dass man den Singular meidet und die Frage nach dem Fortschritt an diesem Punkt in gewisser Weise überhaupt abbricht. Denn mit der Fokussierung auf den situativen Plural gerät die für den Fortschrittsbegriff ganz entscheidende, universelle Offenheit der Fortschrittsdiskussion in den Hintergrund. Fortschritt im Singular muss ja gar nicht als hypostasierte Gesamtheit aller vergangenen und zukünftigen Veränderungen gedacht werden, als der eine Schritt der gesamten Menschheitsgeschichte, der entweder in Anbetracht negativer Entwicklungen sich in seiner Inkonsistenz selbst in Frage stellt oder den Blick für die konkreten Entwicklungen überhaupt verliert. Sondern er kann auch, und das vielleicht in einer stringenteren Weise, als die Frage nach den notwendigen Grundbedingungen begriffen werden, unter denen überhaupt Fortschritte im Plural möglich sind. Deren gedanklich projizierte Realisationen in ihrer Gesamtheit will sich der Gattungsgedanke dann in seinen emphatischen Singular als Singular einverleiben – als gäbe es nicht nur den einen Gattungsbegriff „Mensch“, sondern als gäbe es die eine Menschheit, für die Eins ist, was für die einzelnen Menschen Vieles ist, viele Schritte ein Schritt. Die Feststellung, dass sich die Frage nach dem Fortschritt sämtlichen Bereichen und Situationen des Lebens nach immer feiner aufgliedern lässt, ist kein Argument gegen den Singular, sondern das konkretisierte Bild seiner universalen Offenheit. Nicht der Singular selbst wäre demnach das Problem, sondern allein seine Hypostasierung, also die Behauptung, dass Fortschritt als Gesamtheit des historischen Geschehens Statt hat; als wäre – schwierig genug, das festzustellen – nicht nur die bisherige Geschichte bereits eine so geartete Realisierung, sondern auch die Zukunft, unabhängig von unseren tagtäglichen, immer erst noch zu zeitigenden Handlungen oder als würden diese gar nichts anderes als eine solche Entwicklung hervorbringen können. Anders verhält es sich aber, um mit Kant zu sprechen, wenn nach den Bedingungen der Möglichkeit von Fortschritten gefragt wird, als den Bedingungen, die sämtlichen Fortschritten ihrer Möglichkeit nach vorausgesetzt werden müssen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Formulierung eines Singulars nicht 27 28 Spaemann (1994), Seite 149. Vgl. ebd., 135ff. 22 nur möglich, sondern sinnvoll, ohne dabei die Mannigfaltigkeit der Bereiche und Situationen, in denen sich die Frage nach Fortschritt im Lebensvollzug jeweils wiederfindet, in Abrede zu stellen. Vielmehr als danach zu fragen, ob die Geschichte einem Fortschritt entspricht, soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, ob ein Fortschritt und damit auch mehrere Fortschritte überhaupt möglich sind. Begriffsgeschichtliche Deckungnahme Will man sich trotz der „Ungnade“, in die der Fortschrittsbegriff gefallen ist, und trotz der „großen Schwierigkeiten“, die sich diesbezüglich vor einem auftun, dennoch mit diesem „gescheiterten Mythos“ auseinandersetzen, gegen den „mobilisiert“ und der von einflussreicher Seite „attackiert“ wird, so scheinen sich, schaut man sich die Literatur der letzten ungefähr sechzig Jahre an, vor allem drei Varianten einer Strategie anzubieten, die man als „begriffsgeschichtliche Deckungnahme“ bezeichnen könnte. Die erste Variante ist die kommentierte Herausgabe historischer Originaltexte (beispielsweise Fetscher (1956) zu Auguste Comte, Alff (1976) zu Condorcet oder Rohbeck (1990) zu Turgot). Die zweite Variante dieser Strategie ist die mehr oder weniger umfassende Darstellung der historischen Entwicklung der Fortschrittsdiskussion mit ihren unterschiedlichen systematischen Gehalten (Nisbet 1980, Rapp 1992, Taguieff 2004). Die dritte Variante liegt in der fokussierten Herausarbeitung überkommener Fortschrittsbegriffe mit Konzentration auf einzelne, möglichst namhafte Protagonisten der Diskussion (Kleingeld (1995) zu Kant, Zachriat (2001) zu Nietzsche, Owen (2002) zu Habermas, Iser (2008) zu Habermas sowie Honneth und Mäder (2010) zu Marx). Solange man historisch vorgeht, können die systematisch dargestellten oder kommentierten Begriffe zumindest in begriffsgeschichtlicher Hinsicht gerechtfertigt werden. Diese Strategie verfolgte auch bereits John B. Bury in seiner 1920 veröffentlichten Studie The Idea of Progress – An Inquiery into its Origin and Growth, der ersten großen ideengeschichtlichen Abhandlung zum Fortschrittsbegriff: „To examine or even glance at this literature, or to speculate how theories of Progress may be modified by recent philosophical speculation, lies beyond the scope of this volume, which is only concerned with tracing the origin of the idea and its growth up to the time when it became a current creed.“ 29 Allerdings sah er sich im Vergleich zur heutigen Diskussion wohl aus umgekehrten Vorzeichen zu dieser begriffsgeschichtlichen Deckungnahme veranlasst, wenn er weiter schreibt: “But there is another order of ideas that play a great part in determining and directing the course of man’s conduct but do not depend on his will – ideas which bear upon the mystery of life, such as Fate, Providence, or personal 29 Bury, John B.: The Idea of Progress - An inquiry into its origin and growth (1960), Toronto: General Publishing Company, 1987, Seite 348. 23 immortality. Such ideas may operate in important ways on the forms of social action, but they involve a question of fact and they are accepted or rejected not because they are believed to be useful or injurious, but because they are believed to be true or false. The idea of progress of humanity is an idea of this kind, and it is important to be quiet clear on the point. We now take it so much for granted, we are so conscious of constantly progressing in knowledge, arts, organizing capacity, utilities of all sorts, that it is easy to look upon Progress as an aim, like liberty or world-federation, which it only depends on our own efforts and good-will to achieve. […] Enough has been said to show that the Progress of humanity belongs to the same order of ideas as Providence or personal immortality. It is true or it is false, and like them it cannot be proved either true or false. Belief in it is an act of faith.“30 Der „Glaube an den Fortschritt“ war damals wohl noch zu stark, als dass Bury ihn in der Öffentlichkeit generell in Abrede hätte stellen wollen. Dennoch scheint sein Zweifel an dieser Idee deutlich durch, wenn er danach fragt, ob es nicht gerechtfertigt sei, dieses Dogma gewissermaßen von sich selbst zu befreien („In escaping from the illusion of finality, is it legitimate to exempt that dogma itself?“); oder wenn er von einer Doktrin mit einem nur relativem Wert spricht, den diese allein für eine bestimmte nicht sehr weit fortgeschrittene Zivilisation habe („Progress itself suggests that its value as a doctrine is only relative, corresponding to a certain not very advanced stage of civilisation.“).31 Heute verhält es sich anders herum. Wer sich philosophisch zum Fortschrittsbegriff äußern möchte, der kann zwar durchaus auf einige positive Aspekte innerhalb der historischen Fortschrittsdiskussion hinweisen. Diese bleiben aber immer mit dem expliziten oder impliziten Zugeständnis verbunden, dass von einer generellen Rehabilitierung „des Fortschritts“ abgesehen wird und die Auseinandersetzung einer heilsamen Aufklärung dieses modernen Mythos diene, indem man auf die Grenzen des Fortschrittsbegriffes aufmerksam mache. Als rechtfertigendes Ziel einer solchen Auseinandersetzung wird nicht zuletzt auch die Aussicht auf ein besseres Verständnis unserer Zeit angeführt. Zu Variante 1: Iring Fetscher schreibt in seiner Einleitung zu Auguste Comtes Rede über den Geist des Positivismus: „Vielleicht ist aber heute die Zeit gekommen, da wir unbefangen und über polemische Abwehr erhaben, die großen Konstruktionen dieses Denkers würdigen können. Es wird sich zeigen, dass eine Reihe von voreiligen Urteilen [...] der Korrektur bedürfen [...]. [...] Heute ist uns die positivistische Geschichtsphilosophie und die ‚Pedantokratie‘ nur noch ein Gegenstand historischen 30 Ebd., Seite 1ff. Ebd., Seite 352. Robert Nisbet ist hier anderer Meinung und denkt, dass Bury die Idee des Fortschritts feiere. Er spricht in diesem Zuge von Burys „historiographic celebration of the idea of progress“, Nisbet, Robert: History of the Idea of Progress, New York: Basic Books, 1980, Seite 321. 31 24 Interesses, damit aber zugleich ein Mittel zum besseren Verständnis unserer Zeit.“ 32 Nostalgischer äußert sich Wilhelm Alff angesichts des in Condorcets Gedanken deutlich werdenden Menschheitsbewusstseins: „Angesichts dessen, was einmal bewußt war, will uns Trauer ergreifen über die kollektive Vergeßlichkeit, zu der die Nachwelt sich bereit gefunden hat.“ 33 Johannes Rohbeck gibt in der Einleitung der von ihm mitherausgegebenen geschichtsphilosophischen Texte Turgots, die zentral die „Fortschritte des menschlichen Geistes“ thematisieren, zu bedenken, dass in diesen eine Kritik an der Vorstellung einer „uneingeschränkten Machbarkeit der Geschichte“ deutlich werde, diesem „Mythos von Vernunft, der alles Denkbare auch für herstellbar hält.“ 34 Eine Beschäftigung mit Turgot „kann dadurch auch zur Selbstkorrektur des Prinzips Aufklärung beitragen.“35 Zu Variante 2: In ähnlichem Sinne schreibt Friedrich Rapp in Fortschritt – Entwicklung und Sinngehalt einer philosophischen Idee: „Das Wissen um Ursprung, Wandel und systematischen Gehalt der Fortschrittsidee ist geeignet, hier differenzierende und auf heilsame Weise relativierende Einsichten zu vermitteln.“36 Und Pierre-André Taguieff, der in seinem Le Sens du Progrès – une approche historique et philosophique die Wiederkehr der Fortschrittsidee im öffentlichen Diskurs diagnostiziert, ist der Meinung, dass man diese „säkulare Proto-Religion der Moderne“ („proto-religion séculière de la modernité“) dringend wieder in die philosophisch-klärende Diskussion aufnehmen und die Möglichkeit und Wünschbarkeit einer Rückkehr zur Idee des Fortschritts überdenken sollte, indem man ihre Ursprünge und Anfänge, ihre Funktionen und Wirkungen, ihre Abenteuer und Wandlungen thematisiert. 37 Die Wiederkehr der Fortschrittsidee in die Öffentlichkeit bringt für Taguieff die Notwendigkeit einer philosophischen Wiederaufnahme der Thematik mit sich, damit aus dieser Kreisbewegung kein Teufelskreis werde: „Il y a là un cercle théorique qui, pour ne pas devenir ‚cercle vicieux‘ doit faire l’objet d’une clarification.“38 In dieser Wiederkehr der Fortschrittsthematik und ihrer philosophischkritischen Durchdringung, der von Taguieff geforderten „clarification“, wird nun eine theoretische Bewegung deutlich, welche man in Anschluss an Habermas als „Aufklärung über die Aufklärung“ bezeichnen kann oder wie im obigen Zitat von Rohbeck als 32 Fetscher, Iring (Hrsg.): August Comte – Rede über den Geist des Positivismus, Hamburg: Felix Meiner, 1956, Einleitung, Seite XVf., Seite XLIV. 33 Alff, Wilhelm: „Condorcet und die bewußt gewordene Geschichte“, in: ders. (Hrsg.): Condorcet – Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1976, Einleitung, Seite 26. 34 Rohbeck, Johannes: „Turgot als Geschichtsphilosoph“, in: ders. (Hrsg.): Turgot – Über die Fortschritte des menschlichen Geistes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990, Seite 87. 35 Ebd. 36 Rapp, Friedrich: Fortschritt – Entwicklung und Sinn einer Philosophischen Idee, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, Seite 6. 37 Taguieff (2004), Seite 18f. 38 Ebd. 25 „Selbstkorrektur des Prinzips Aufklärung“.39 Es geht um die Kraft kritischen Denkens, das sich kritisch auch mit dem auseinandersetzt, was in seinem Namen an „Unheil“ angerichtet wurde, und so zu einer Läuterung des Aufklärungsbegriffes beiträgt.40 Zu dieser Läuterung gehöre es aber auch, von pauschalen Urteilen über „die Aufklärung“ abzusehen und das kritische Potential zu bergen, das in der vielstimmigen „Aufklärungskultur“ des achtzehnten Jahrhunderts selbst liegt, von vorurteilsbeladenen Generalisierungen jedoch verschüttet wird.41 Dass darin auch die Thematisierung des Fortschrittsbegriffes beinhaltet ist, sollte insofern auf der Hand liegen, als die in ihrem Beginn mit der Fortschrittsthematik in eins fallende Geschichtsphilosophie eines der zentralen Momente der philosophischen Diskussion der Aufklärungsepoche war.42 Zu Variante 3: Genau in einem solchen Sinne kann Pauline Kleingelds Untersuchung Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie Kants verstanden werden. Kleingeld fragt unter anderem nach der aktuellen Möglichkeit von Geschichtsphilosophie, die „heutzutage vielfach als ein im schlechten Sinne ‚spekulatives‘ Unternehmen aufgefaßt“ werde.43 Auch Kants Theorie des Fortschrittes gelte gemeinhin als überzogen.44 Kleingeld setzt sich in ihrer Untersuchung das Ziel, „diese Darstellung [...] zu korrigieren.“45 Auch wenn das natürlich nicht bedeute, dass sich Kants Geschichtsphilosophie „in unveränderter Form heute noch verteidigen ließe“, so kommt Kleingeld im Ergebnis zu einer „Behebung oder Nuancierung einiger oft gemachter Vorwürfe.“ 46 „Wenn Geschichtsphilosophie überhaupt noch möglich sein soll, so bilden Kants Gedanken [...] wohl einen Ansatz zu ihrer heutigen, nicht-dogmatischen Form.“ 47 Zwar nicht um eine Aufklärung „der Aufklärung“, doch aber um eine Aufklärung über die sich an diese anschließende Fortschrittsdiskussion im 19. Jahrhundert geht es auch in Denis Mäders Fortschritt bei Marx. Mäder will Marx vor der Ansicht schützen, sein Denken gehe von „einer dem Prinzip des Fortschritts untergeordneten Universalgeschichte“ aus, ein Bild, das immer noch die Marxrezeption präge.48 Die als Heilslehrenvorwurf und ambivalenztheoretische Kritik gegen das marxsche Denken gerichteten Anfechtungen seien insofern 39 Habermas, Jürgen: „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“, in: ders.: Kleine politische Schriften, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981, Seite 444-464. 40 Vgl. Rohbeck, Johannes: Aufklärung und Geschichte – Über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft, Berlin: Akademie Verlag, 2010, 32ff. 41 Vgl. ebd., Seite 39ff. 42 Vgl. Nagl-Docekal, Herta: „Ist Geschichtsphilosophie heute noch möglich?“, in: dies. (Hrsg.): Der Sinn des Historischen, Frankfurt a.M.: Fischer, 1996, Seite 7ff. 43 Kleingeld, Pauline: Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie Kants, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995, Seite 1ff. 44 Vgl. ebd. 45 Ebd. 46 Ebd. 47 Ebd.; vgl. Kleingeld, Pauline: „Zwischen kopernikanischer Wende und großer Erzählung. Die Relevanz von Kants Geschichtsphilosophie“, in: Herta Nagl-Docekal (Hrsg.): Der Sinn des Historischen, Frankfurt a.M.: Fischer, 1996, Seite 173ff. 48 Mäder (2010), Seite 9ff. 26 ungerechtfertigt, als dass Marx einen Fortschrittsbegriff entwickelt habe, der sich diesen gerade entziehe. „Fortschritt bildet für ihn die Möglichkeit positiver Entwicklung, ohne andersartige oder gegenläufige Entwicklungsformen (namentlich Regression und Stillstand) darin aufzuheben.“49 Marx gehe also gerade nicht von einer Identifizierung von Fortschritt und Geschichte aus, in der sich die Geschichte stetig einem „Heil“ nähert oder in ihrer konfliktartigen Natur den Fortschrittsbegriff letztlich zur Bedeutung eines ambivalenten Geschehens neutralisiert. Ebenfalls um den Abbau von interpretativen Vorurteilen geht es Wolf Gorch Zachriat in Ambivalenz des Fortschritts – Friedrich Nietzsches Kulturkritik. Zachriat kommt zu dem Schluss, dass, anders als gemeinhin angenommen, Nietzsches Philosophie nicht nur eine negative Positionierung zum Fortschrittsbegriff beinhalte, sondern auch eine „positive Fortschrittsvorstellung“ zur Verfügung stelle. 50 „In der Vereinbarkeit seiner antiprogressiven und progressiven Vorstellungen spiegelt sich letztlich die Ambivalenz eines Fortschrittsdenkens wieder, das sowohl die Verherrlichung als auch die Verdammung des Fortschritts als einseitig demaskiert.“51 Etwas anders als in den bisher genannten Beispielen verhält es sich bei den Arbeiten, deren Anliegen es ist, den Fortschrittsbegriff in ein Verhältnis zu zeitgenössischen Philosophien zu setzen, deren Ausbildung von Anfang an in eben jenem zur „begriffsgeschichtlichen Deckungnahme“ hindrängenden geistigen Klima stattfand. Die grundsätzliche Fragwürdigkeit des Fortschrittsbegriffes wurde nicht mehr vollzogen, bloß noch konstatiert. Damit war die Fraglichkeit bestimmter Fortschrittsvorstellungen in die Kritik der Fortschrittsdiskussion überhaupt übergegangen, der Begriff verlor seine diskursive Relevanz, zumindest in der Philosophie. Darin mag ein gewichtiger Grund dafür liegen, dass selbst diejenigen Philosophen, die wie Habermas an die Aufklärung anschließen wollen, es offensichtlich bewusst oder unbewusst vermieden haben, den Fortschrittsbegriff explizit zu erneuern. Dass eine solche Erneuerung zumindest bei Jürgen Habermas und Axel Honneth auf implizite Weise dennoch geschehen ist, versuchen David S. Owen in Between Reason and History – Habermas and the idea of Progress und Mattias Iser in Empörung und Fortschritt – Grundlagen einer kritischen Theorie der Gesellschaft deutlich zu machen.52 49 Ebd., Seite 10. Zachriat (2001), Seite 70ff. 51 Ebd., Seite 216. 52 Owen, David S.: Between Reason and History – Habermas and the idea of Progress, New York: State University of New York Press, 2002; Iser, Mattias: Empörung und Fortschritt – Grundlagen einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt a.M./New York: Campus Verlag, 2008. 50 27 Zum Weg dieser Untersuchung Wenn man von der Hypostasierung eines Fortschrittes in der Geschichte Abstand nimmt, bleibt alleine, den Fortschrittsbegriff ins Praktische zu wenden. Dieser Einsicht folgt auch Rohbeck in Aufklärung und Geschichte – Über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft. 53 Allerdings konzentriert sich dieser nicht direkt auf den Fortschrittsbegriff, sondern auf eine Erneuerung der Geschichtsphilosophie. „Wie im Titel ‚praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft‘ zum Ausdruck kommt, lege ich Wert auf die Nähe zur praktischen Philosophie. [...] Die Aufgabe besteht darin, alternative Handlungsmöglichkeiten in der Geschichte freizulegen, um die gegenwärtigen Lebensbedingungen nach ethischen Maßstäben verändern zu können. Dieses Programm, das an Rousseau, Nietzsche und Benjamin anschließt, lässt sich mit gegenwärtigen Theorien der Kontingenz so operationalisieren, dass neue Chancen für praktische Freiheit und verändernden Eingriff sichtbar werden. So verstärkt sich in der Geschichtswissenschaft das Interesse für ungenutzte Optionen, wie in methodologischen Reflexionen über kontrafaktische Erklärungen zum Ausdruck kommt. In den Sozialwissenschaften bis hin zur evolutionären Ökonomik richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Kontingenzen, um dem Mythos einer linearen Optimierung entgegenzutreten. Der Grundtenor besteht darin, trotz erdrückender Systemzwänge mit Kontingenzen vernünftig und verantwortungsvoll umzugehen. In diesen Tendenzen erkenne ich ein Zeichen dafür, dass die Rolle der handelnden Subjekte wiederentdeckt und aufgewertet wird. Selbstverständlich sind damit nicht nur Individuen gemeint, sondern vor allem auch kollektive Subjekte und Institutionen. In der Auflösung derartiger Knotenpunkte in sozialen Prozessen sehe ich die Funktion einer praktischen Geschichtsphilosophie der Zukunft.“54 Zunächst scheint der Fortschrittsbegriff bei Rohbeck kein zentraler Aspekt der Geschichtsphilosophie mehr zu sein, sondern wird als eine von drei möglichen Verlaufsformen geschichtlicher Prozesse thematisiert, „Fortschritt, Stagnation und Verfall. Die Fortschrittsidee schwingt im Utilitarismus mit, wenn eine Steigerung der Zivilisation angenommen und dann auch noch zugunsten zukünftiger Generationen zur Pflicht gemacht wird. Das Denkmuster der Stagnation schleicht sich ein, wenn etwa Jonas den Utopismus verurteilt und dazu aufruft, die gegenwärtige Natur und Kultur zumindest zu bewahren. Das Verfallsszenario kommt in aktuellen Zukunftsethiken ins Spiel, wenn offen darüber debattiert wird, ob eine Verschlechterung der Lebensbedingungen moralisch gerechtfertigt werden kann, wenn die natürlichen, technischen und organisatorischen Mittel erhalten bleiben, die es einer zukünftigen Generation ermöglichen, ihr kulturelles 53 54 Rohbeck (2010). Ebd., Seite 22f. 28 Niveau aus eigener Anstrengung wieder zu verbessern.“ 55 Diese Befreiung der Geschichtsphilosophie von der Dominanz des Fortschrittsbegriffes ist insofern verständlich, als dies ja gerade die Konsequenz der Absage an jegliche hypostasierte Festlegung der geschichtlichen Prozesse auf eine bestimmte Verlaufsform bedeutet. Doch führt man sich diese drei genannten Verlaufsformen genauer vor Augen, so muten diese in der für Rohbeck so entscheidenden praktischen Orientierung seiner Geschichtsphilosophie nicht sehr vielversprechend an. Die handelnden Subjekte können sich in diesem Bild gewissermaßen entscheiden zwischen einem Fortschritt, demzugute sie allein zugunsten anderer Verzicht leisten; einer Stagnation, die auf das in geschichtlicher Hinsicht wenig realistisch erscheinende Festhalten am Status quo zielt; sowie drittens einem Verfall, bei dem zwar nicht Verzicht geleistet werden muss, der aber auf Kosten zukünftiger Generationen geschieht, was wiederum mit dem von Rohbeck richtigerweise betonten verantwortungsvollen Umgang mit den uns gegebenen Handlungsmöglichkeiten nicht ganz zusammenstimmen will. Und Rohbeck selbst geht deshalb weiter. „Doch ist in diesen Debatten ein gemeinsamer Grundsatz erkennbar, der sich dem geschärften Geschichtsbewusstsein verdankt. Wenn von der prinzipiellen Offenheit des Geschichtsverlaufs auszugehen ist, folgt daraus für die Zukunftsethik, dass nicht primär für bestimmte Güter vorgesorgt wird, weil man ja nicht wissen kann, ob diese von den zukünftigen Generationen geschätzt werden. Vielmehr ist es geboten, die Bedingungen der Möglichkeit zu schaffen, dass verschiedenartige Güter zur Verfügung stehen. Ebenso wenig geht es um die Sorge für festgelegte Interessen später lebender Personen, sondern um die Entwicklung und Erhaltung von zumutbaren ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben. Ziel ist es, den Möglichkeitshorizont offen zu halten, indem Handlungsspielräume zur Verwirklichung je eigener Lebensentwürfe erhalten oder geschaffen werden. In diesem Kontext mutiert die ‚Offenheit der Geschichte‘ zu einer ethischen Kategorie.“56 In dieser Hervorhebung des gemeinsamen Grundsatzes der drei sich um Fortschritt, Stagnation und Verfall drehenden Debatten hält Rohbeck aber schließlich allein noch am Begriff des Fortschrittes fest. „Geschichtsphilosophisch formuliert, besteht die so ermöglichte Freiheit darin, generell den zivilisatorischen ‚Fortschritt‘ selbst zu bestimmen, indem auch zur Disposition steht, ob sich eine Generation auf einem bescheideneren Niveau andere Vorteile der Umwelt und sozialen Gerechtigkeit verschaffen kann.“57 Von Stagnation und Verfall ist nicht mehr die Rede. Verständlicherweise, denn diese sind keine vernünftig vermittelbaren Optionen praktischen Strebens. 55 Ebd., Seite 231. Ebd., Seite 232. 57 Ebd., Seite 233. 56 29 Allerdings, auch das wird bei Rohbeck deutlich, muss der Fortschrittsbegriff dafür neu gegriffen werden. Er kann nicht mehr allein als ein an einem allgemeinen oder universalen Maßstab gemessenes Steigerungsgeschehen bzw. Verbesserungsgeschehen verstanden werden. Es verbiete sich, „die aufeinanderfolgenden Epochen nach einem einheitlichen Maßstab zu beurteilen.“58 Was aber bedeutet Fortschritt dann? Dass Rohbeck dabei nicht zu einer völlig relativistischen oder subjektivistischen Vorstellung von Fortschritt übergehen will, wird in seinem Festhalten an der Entwicklung und Erhaltung von menschenwürdigen Lebensbedingungen deutlich. Aber ein genaueres Verständnis dieses neuen Fortschrittsbegriffes entwickelt er nicht. Die von Rohbeck mitgedachte Erneuerung des Fortschrittsbegriffes kann aber auch gar nicht Teil seiner anvisierten praktischen Geschichtsphilosophie sein. Vielmehr wird Fortschritt als das, was durch die geschichtsphilosophische Freilegung von Handlungsalternativen als „Chancen für praktische Freiheit und verändernden Eingriff“ befördert werden soll, begrifflich vorausgesetzt und kann nicht selbst aus der geschichtsphilosophischen Betrachtung heraus entwickelt werden. Jedoch nennt er im obigen Zitat selbst den Ansatzpunkt, an dem eine mögliche Erneuerung des Fortschrittsbegriffes ansetzen kann: die „handelnden Subjekte“. 59 Der in Frage stehende Fortschrittsbegriff kann nun nicht mehr als einer gedacht werden, der über die Köpfe der Subjekte einfach hinweggeht. Die Subjekte müssen es als eine wirkliche Option ihres Verhaltens verstehen können, etwa auch in Form der von Rohbeck vorgeschlagenen geschichtsphilosophischen Auseinandersetzung, zu einem solchen Fortschritt beizutragen. Rohbeck unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von Subjekten: individuelle Subjekte und kollektive Subjekte. Demnach gäbe es zwei Möglichkeiten, zu einer Erneuerung des Fortschrittsbegriffes anzusetzen. Der zweiten Möglichkeit scheinen mir, wenn auch eher implizit, Habermas und Honneth in ihrer Betonung der Interaktion und des Sozialen und mit ihnen Owen und Iser nachgegangen zu sein, zuletzt aber auch Philip Kitcher in The Ethical Project, wenn er den Fortschrittsbegriff im Hinblick auf die kollektive Hervorbringung und Weiterentwicklung sozialer Normen thematisiert. 60 Allerdings scheint mir dieser Ansatz bei den kollektiven Subjekten insofern nicht hinreichend zu sein, als dass die soziale Interaktion und die Normsetzungspraxis ja selbst wiederum Bereiche sind, die ihrerseits im Hinblick auf „Chancen für praktische Freiheit und verändernden Eingriff“ im Sinne des in Frage stehenden Fortschrittsverständnisses thematisiert werden können. So bleiben am Ende allein die individuellen Subjekte, von denen aus meines Erachtens eine grundlegende Erneuerung des Fortschrittsbegriffes zu beginnen hätte, auch wenn damit die unter anderem von der Frankfurter Schule betonte, 58 Ebd., Seite 230. Ebd., Seite 22f. 60 Kitcher, Philip: The Ethical Project, Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 2011. 59 30 mitunter sehr starke soziale Prägung und Abhängigkeit der Individualität in intersubjektiver Interaktion nicht geleugnet werden soll. Im Hinblick auf einen bei den individuellen Subjekten ansetzenden Fortschrittsbegriff kommt Kant als Wegbereiter meiner Ansicht nach deswegen nicht in Frage, weil er in seiner Vorstellung des individuellen moralischen Fortschrittes diesen allein als am allgemeinen Maßstab des moralischen Gesetzes orientiertes beständiges Verbesserungsgeschehen konzipiert. Über eine solche Vorstellung gilt es jedoch gerade hinauszukommen. Nietzsche, auf den sich wie im Zitat deutlich geworden auch Rohbeck beruft, scheint in seiner Hervorhebung der Individualität schon näher an dem gesuchten Fortschrittsverständnis zu liegen, jedoch bleibt er am Ende an einem entscheidenden Punkt zu sehr individualistisch. Den Weg über das Individuum sucht auch Hans Michael Baumgartner in seinem Aufsatz Die Idee des Fortschritts – Versuch einer Grundlegung.61 In diesem schlägt er ein Verständnis von Fortschritt als „Schritt auf dem Weg zur vollendeten Transparenz des absolut Vollkommenen in der endlichen Freiheit“ 62 vor. Dieses Transparent-Werden des absolut Vollkommenen in der endlichen, d.h. individuellen Freiheit versteht Baumgartner als einen Verwandlungsprozess individueller Freiheit, die sich im Anspruch eines absoluten Wert-Seins erfährt, auf welches hin sie sich öffnen und ihr Streben eine Richtung bekommen kann. Das absolute Wert-Sein ermögliche die objektive Bewertung von Veränderung hin zu einem Höhersein und damit eine wirkliche Orientierung und Fortschritt.63 Ich kann hier nicht in eine tiefere Diskussion von Baumgartners Argumentation einsteigen, aber soviel sei gesagt; Dieser Aufsatz stellt nur eine grundlegende Skizze eines Fortschrittsbegriffes dar, bei dem zentrale Aspekte nicht genauer argumentativ entwickelt werden, was eine ergiebige Kritik von vorn herein erschwert, wenn nicht verhindert. 64 Außerdem erscheint mir seine Konzeption des Verhältnisses zwischen absolutem Wert-Sein und endlicher Freiheit nicht plausibel. Und schließlich wird in dieser Konzeption wiederum an einem Verständnis von Fortschritt als ein an einem allgemeinen Maßstab orientiertes Steigerungsgeschehen festgehalten. „Die Freiheit schreitet fort, indem sie sich in ihrem Sichverstehen als Freiheit ermöglicht und im Selbstvollzug die gesamte Interpersonalität mit einbezieht, um im Medium einer anfänglich immer schon sichtbaren Bildlichkeit das absolute Bild der Vollkommenheit als die in der Sittlichkeit aller verwandelte Wirklichkeit ihrer selbst hervorzubringen.“65 61 Baumgartner, Hans Michael: „Die Idee des Fortschritts – Versuch einer Grundlegung“, in: Max Müller/Michael Schmaus (Hrsg.): Philosophisches Jahrbuch, 70. Jahrgang, 1. Halbband, München: Verlag Karl Alber, 1962, Seite 157-168. 62 Ebd., Seite 165. 63 Vgl., ebd., Seite 161ff. 64 Vgl., ebd., Seite 163, Seite 167. 65 Vgl. ebd., Seite 164. 31 Vor diesem Hintergrund blieb als Ausgangspunkt für diese Untersuchung nichts anderes übrig, als sich die Frage nach der Bedeutung von Fortschritt als einer objektiv guten Entwicklung und ihrem praktischen Verhältnis zum individuellen Subjekt von Grund auf neu zu stellen. Was sich im Folgenden als eine sich stringent aufbauende Gliederung darstellt, ist das Ergebnis einer intensiven Beschäftigung, die in vielerlei Hinsicht für mich selbst völlig unerwartete Wendungen genommen hat. Bei der Suche nach einem praktischen Verständnis des Fortschrittsbegriffes kamen Aspekte zum Vorschein und wurden begrifflich entscheidend, die an einigen Stellen nach einer weiteren Diskussion und Vertiefung geradezu rufen, die ich jedoch in dieser Arbeit auszuführen unterlassen habe, um nicht zu weit von dem Ziel abzukommen, ein grundlegendes Verständnis eines praktischen Fortschrittsbegriffes zu entwickeln. Der entwickelte Begriff ist zu verstehen als ein erster Entwurf, eine erste Wieder-Eröffnung der Diskussion auf der Suche nach einem positiven Verständnis von Fortschritt, das expliziert, was bei seinen Kritikern nur als impliziter semantischer Rest erscheint. Die vorliegende Untersuchung findet ihren Ausgangspunkt zunächst in einer begriffslogischen Erörterung von Fortschritt als einer objektiv guten Entwicklung. Diese führt zu einem modifizierten Verständnis von Fortschritt, in dem begriffliche Strukturen zum Vorschein kommen, die den Fortschrittsbegriff in Bezug zur antiken, vor allem der aristotelischen Philosophie und in dieser zu den Begriffen der eudaimonia und der entelechie setzen und damit zu einem Denken, das in der Fortschrittsdiskussion bisher keine Rolle gespielt hat. Von da aus gelangen wir zu Terry Pinkards zeitgenössischer Interpretation der Philosophie Hegels, die Pinkard als einen „entzauberten Aristotelismus“ versteht, in dem die eudaimonia in den Begriff der Befriedigung übergeht. 66 Der in Pinkards Hegel-Interpretation entwickelte Begriff der Befriedigung dient sodann als eine erste Annäherung an ein Verständnis von Fortschritt im praktischen Sinne. Um deutlicher zu machen, was dieser Begriff gegenüber dem der Glückseligkeit zu leisten vermag, wendet sich die Untersuchung in einer kritischen Haltung erneut Aristoteles, dann aber auch Kant zu, in dessen praktischer Philosophie die Glückseligkeit ebenfalls eine entscheidende Stellung einnimmt. Die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Aristoteles und Kant dienen einer genaueren Qualifizierung des Begriffes der Befriedigung. Diese geht über in die Formulierung eines subjektiven Fortschrittes. Ein subjektivistisches Fortschrittsverständnis reicht offensichtlich nicht dazu hin, die Möglichkeit einer objektiv guten Entwicklung, eines objektiven Fortschrittes zu plausibilisieren. Der Gedanke, den subjektiven Relativismus durch einen politischen Zusammenhang als einem solchen theoretisch in den Griff zu bekommen, scheitert. Pinkards Versuch, das Problem des Relativismus durch den Wahrheitsbegriff zu lösen, wird kritisiert. In seiner Argumentation bleibt der Relativismus weiter bestehen. Der Wahrheitsbegriff kann nur die Aussicht auf 66 Pinkard, Terry: Hegel´s Naturalism – Mind, Nature, and the Final Ends of Life, New York: Oxford University Press, 2012, Seite 17. 32 eine Lösung bieten, wenn es möglich ist, ein normatives Faktum in der Natur der Fortschrittssubjekte aufzuweisen, an dem sich möglicher subjektiver Fortschritt praktisch orientieren kann. Für einen solchen Aufweis muss zunächst deutlich gemacht werden, was unter der Natur der Fortschrittssubjekte näher zu verstehen ist. In diesem Zusammenhang wird der Begriff einer natürlichen Vernunft entwickelt und ins Verhältnis zur Grundstruktur der Rationalitätstheorie von Jürgen Habermas gesetzt und vertieft. Im Anschluss daran wird der Versuch unternommen, in Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche eine moralische Norm als ein in der Natur der Subjekte gründendes normatives Faktum zu plausibilisieren, auf das hin sich ein objektiver Fortschritt als ein befriedigendes Leben in Frieden denken lässt. Schließlich stellt sich die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfüllung der moralischen Norm und danach, inwiefern davon ausgegangen werden kann, dass diese Bedingungen wirklich gegeben sind. Diese Fragen werden in einer kritischen Diskussion der religionsphilosophischen Überlegungen von Mark Johnston und der für diesen als Quelle dienenden Prozessontologie Alfred North Whiteheads sowie von Gunnar Hindrichs Begriff des Absoluten einer möglichen Antwort näher gebracht. Vor und nach 1660 Bevor wir in die Entwicklung des in dieser Arbeit anvisierten Fortschrittsverständnisses einsteigen, lohnt es, sich noch einmal, wenn auch sehr selektiv, vor Augen zu führen, worin die zu Beginn angesprochene Ausfüllung des semantischen Vakuums, der semantischen Leerstelle für unser zeitgenössisches gesellschaftliches Selbstverständnis genauer besteht, welches mit dem neuzeitlichen Aufbegehren gegen die überkommenen Machtstrukturen des christlichen Europas entstand. Zwar werden wir am Ende dieses kurzen Nachvollzuges nur bis Adam Smiths An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations von 1776 gelangen, jedoch, so jedenfalls erscheint es mir, erreichen wir mit diesem dasjenige Selbstverständnis der modernen „westlichen Gesellschaft“, in dem wir heute der Tendenz nach leben und mit dem wir ringen, kommt es doch nun, nach über zweihundert Jahren, an eine Grenze, die Smith selbst, wenn auch nicht zeitlich datiert, so doch aber konzeptuell vorweg genommen hat. Beginnen möchte ich diesen Nachvollzug aber nicht mit Smith, sondern einem ihm selbst bekannten Zeitgenossen. „Les Anglais ont plus avancé vers la perfection, presque en tous les genres, depuis 1660 jusqu’à nos jours, que dans tous les siècles précédents.“67 Dieser Satz stammt aus dem im Jahre 1751 veröffentlichten Le siècle de Louis XIV. von Voltaire und führt uns in seinem 67 Voltaire, François Marie Arouet: Le sièle de Louis XIV. et de Louis XV., in: ders.: Œuvres Complètes, 14, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967, Chapitre XXXIV, Seite 559 ; vgl. im Folgenden Seele, Peter/Wagner, Till: „Eine kleine Geschichte des Neuen“, in: Peter Seele (Hrsg.): Philosophie des Neuen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschft, 2008, Seite 38-63, Seite 54ff. 33 Assoziationsraum zu zentralen Momenten der modernen Fortschrittsdiskussion. Voltaire huldigt den Engländern als der seit 1660 am weitesten zur Vervollkommnung fortgeschrittenen Nation des Menschengeschlechts. Vor und nach 1660 – das klingt wie die Einführung einer neuen Zeitrechnung. Nicht 1751 nach Christus, sondern im Jahr 91 nach 1660 hätte Voltaire diesen Satz dann veröffentlicht. Und tatsächlich ist diese kalendarische Gegenüberstellung, ja Provokation genau im Sinne ihres Erfinders. Doch warum 1660? Die Zahl bezeichnet das Gründungsjahr der Wissenschaftlichen Gesellschaft, dann Royal Society of London. 1663 wird in ihrer zweiten vom englischen König Karl II. unterzeichneten Charta der Name ergänzt zu: Regalis Societatis Londini pro Scientia naturali promovenda – The Royal Society of London for improving Natural Knowledge – Königliche Gesellschaft von London zur Förderung der Naturwissenschaft. Dort heißt es: „We have long and fully resolved with Ourself to extend not only the boundaries of the Empire, but also the very arts and sciences. Therefore we look with favour upon all forms of learning, but with particular grace we encourage philosophical studies, especially those which by actual experiments attempt either to shape out a new philosophy or to perfect the old. In order, therefore, that such studies, which have not hitherto been sufficiently brilliant in any part of the world, may shine conspicuously amongst our people, and that at length the whole world of letters may always recognize us not only as the Defender of the faith, but also as the universal lover and patron of every kind of truth: Know ye that we, of our special grace and of our certain knowledge and mere motion, have ordained, established, and granted, and by the presents for us, our heirs, and successors do ordain, establish, and grant, that henceforth for ever there shall be a Society consisting of a President, Council, and Fellows, who shall be called and named The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for improving Natural Knowledge (of which same Society we by these presents declare Ourself Founder and Patron); [...].“68 Der König Englands und des britischen Empires als Patron naturwissenschaftlicher Forschung. Als Gründer einer Institution, welche „von nun an bis in Ewigkeit“ die Grenzen der technischen Künste und Wissenschaften, dem Beispiel des Empires folgend, beständig erweitern und verbessern sollte. Als Fürsprecher einer Forschung, welche das Ziel verfolgte, auf experimenteller Basis eine neue Philosophie, ein neues Denken zu formen oder zumindest das alte zu perfektionieren. Diese Verbindung von weltlicher Macht und experimenteller Wissenschaft ist in der Tat Ausdruck einer einschneidenden Veränderung. Es ist nicht völlig abwegig, hierin das geschichtliche Gegenstück zum Dreikaiseredikt von 380 n. Chr. zu sehen, in dem das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Alle Bürger des römischen Reiches hatten sich verbindlich zur christlichen Lehre zu bekennen, ansonsten würde sie, des Wahnsinns und der Häresie angeklagt, das Urteil der Strafgerichte ereilen. Als sich die Royal Society eintausendzweihundertdreiundachtzig Jahre nach dem Edikt das Leitmotto „nullius in 68 The Second Charter (1663), royalsociety.org/about-us/history/royal-charters/. 34 verba“ auf die Fahnen schrieb und sich damit also – dem etwas schwierigen Wortlaut des Mottos folgend – in den Namen „keines auf Worten beruhenden (Wissens)“ stellte, dann lag darin nicht nur ein kleiner Seitenhieb gegen das Christentum verborgen. Aus dem auf die ersten Sätze der Genesis verweisenden en arche en ho logos, am Anfang war das Wort bzw. die sinnvolle Rede, zu Beginn des Johannes-Evangeliums wurde en arche en he empeiria, am Anfang war die Empirie, die empirisch-experimentelle Wissenschaft. Die Wörter sollten Sinn und Bedeutung nicht mehr aus der Annahme übernatürlicher, wie auch immer sich geoffenbarter Wahrheiten gewinnen, sondern durch empirisch-experimentelle Beobachtung eine „natürliche Bedeutung“ und einen „natürlichen Sinn“ erhalten.69 Der alt- und neutestamentarischen Tradition wurde mit den drei Worten „nullius in verba“ ihre Verbindlichkeit und Autorität abgesprochen. Aus dem Verteidiger des Glaubens an die universelle und wahre Liebe Gottes, wie sie zum Beispiel in Joh 3,16 zum Ausdruck kommt, wurde der „universal lover and patron of every kind of truth“. Aus dem Mysterium Crucis der christlichen Theologie wurde das Experimentum Crucis naturwissenschaftlicher Forschung. Den Ausdruck „Experimentum Crucis“ gebrauchte Newton, zwölfter Präsident der Royal Society, im Kontext seiner optischen Versuche und bezog sich dabei auf Francis Bacon, der im zweiten Buch seines 1620, also 40 Jahre vor Gründung der Royal Society erschienenen Novum Organum von den instantiae crucis, den Fällen des Kreuzes schrieb. Der Begriff klärt sich durch die Metapher eines Scheideweges, an dem ein Kreuz aufgestellt ist, das die unterschiedlichen Möglichkeiten anzeigt, den Weg fortzusetzen. In der naturwissenschaftlichen Forschung treten immer wieder Situationen auf, in denen im Rahmen der Interpretation eines beobachteten Phänomens unterschiedliche Möglichkeiten für dessen Erklärung denkbar sind. Über die richtige Erklärung in einem solchen Fall sollte nach Bacon nicht die vernünftige Abwägung von Möglichkeiten entscheiden, sondern allein die Beweiskraft eines speziell auf die jeweilige Frage zugeschnittenen Experimentes.70 Die Fälle des Kreuzes können hier aber nicht nur im Sinne einer Wegscheide innerhalb des naturwissenschaftlichen Forschungsprogramms verstanden werden, sondern darüber hinaus auch als eine Wegscheide in der Frage nach den Grundlagen der menschlichen Erkenntnis überhaupt. Es bleibt die Frage, ob es jemals gelingen wird, hier über eine eindeutige Richtung beweiskräftig zu entscheiden, ja ob eine solche Entscheidung überhaupt erstrebenswert ist. Auch wenn Bacon selbst nicht völlig ohne Zweifel war, so scheint er doch wenigstens entschieden gewesen zu sein. „I may hand over to men their fortunes, now their understanding is emancipated and come as it were of age; whence there cannot but follow an improvement in man's estate and an enlargement of his power over 69 Die Begriffe „natürliche Bedeutung“ und „natürlicher Sinn“ übernehme ich hier aus Wittgensteins Vortrag über Ethik; vgl Wittgenstein, Ludwig: „Vortrag über Ethik“, in: ders.: Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989, Seite 13. 70 Vgl. Bacon, Francis: Novum Organum, Book II, Art. XXXVI., Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 35 nature. For man by the fall fell at the same time from his state of innocency and from his dominion over creation. Both of these losses however can even in this life be in some part repaired; the former by religion and faith, the latter by arts and sciences. For creation was not by the curse made altogether and forever a rebel, but in virtue of that charter ,In the sweat of thy face shall thou eat bread‘, it is now by various labors (not certainly by disputations or idle magical ceremonies, but by various labors) at length and in some measure subdued to the supplying of man with bread, that is, to the uses of human life.“71 Nicht sophistische Dispute oder nutzlose magische Zeremonien würden der Menschheit auf dem Wege der Wiedergutmachung des Sündenfalls und der Wiederherstellung der Vollkommenheit nutzen. Sondern Technik und Wissenschaft würden es ermöglichen, Gottes Fluch zu überkommen, der Mensch solle im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen. Die schweißtreibende Arbeit wird durch Erfindungen erleichtert, der Abgrund der Sünde wird technisch-wissenschaftlich überbrückt. Die Erfahrungen der Jahrhunderte hatten immer wieder gezeigt, zu welchen Irrtümern, Verwerfungen und Grausamkeiten Wahrheitsbehauptungen geführt hatten, die sich einem empirisch-experimentellen oder logisch-argumentativen Nachvollzug entzogen und als Dogmen im Zweifel nur mit Macht und Gewalt durchgesetzt und erhalten werden konnten. Ob es tatsächlich stets die Durchsetzung von Wahrheitsbehauptungen war, die zur Ausübung von Macht und Gewalt führte, oder ob es nicht auch anders herum gewesen ist, dass bestimmte, unhaltbare Behauptungen, gerade auch religiösen Anstrichs, für das Ziel, Herrschaft auszuüben oder auszubauen, opportun erschienen, mag hier dahingestellt sein. Jedenfalls stellte Bacon resümierend fest, dass die technischen Entdeckungen die Wohlfahrt der gesamten Menschheit zu allen Zeiten ohne Grausamkeit befördern würden, während die politischen Fortschritte nur geographisch und zeitlich begrenzt sowie selten ohne Gewalt und Wirren durchgesetzt werden könnten.72 Gute 100 Jahre später sprach Voltaire 1734 von Gott als dem „éternel machiniste“, dem ewigen Maschinisten.73 Sein Blick in die Geschichte führte ihn zu der Überzeugung, dass alle Geschichte von Fabeln entstellt sei, die sich allzu leicht der Gutgläubigkeit („crédulité“) der Menschen bemächtigen, und zu Fanatismus führen würden. Bis schließlich die Philosophie in das Geschehen eingreife, um die Menschen aufzuklären („enfin la philosophie vienne éclairer les hommes“), den Geist von den Irrtümern der Jahrhunderte, den Zeremonien, Ereignissen und Denkmälern zu befreien, die allesamt zu nichts anderem als zur Lüge in die Welt gesetzt worden seien („des cérémonies, des faits, des monuments, établis pour constater des mensonges“).74 Man könne die Geschichte der 71 Ebd., Book II, Art. LII. Vgl. ebd., Book I, Art. CXXIX. 73 Voltaire, François Marie Arouet: Traité de Métaphysique, in: ders.: Œuvres Complètes, 22, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967, Chapitre VIII., Seite 223. 74 Vgl. Voltaire, François Marie Arouet: Essai sur le Mœurs et l’Esprit des Nations, in: ders.: Œuvres Complètes, 11-13, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967,13, Chapitre CXCVII., Seite 174f. 72 36 Religionen in unzähligen Bänden zusammenfassen oder aber in zweit Sätzen: „C’est que le gros du genre humain a été et sera très longtemps insensé et imbécile; et que peut-être les plus insensés de tous ont été ceux qui ont voulu trouver un sens à ces fables absurdes, et mettre de la raison dans la folie.“ 75 Die größte Sinnlosigkeit und Finsternis des menschlichen Geistes verortete Voltaire also dort, wo wie in der Scholastik versucht wurde, Glaubenssätze mit Vernunft zu begründen und damit seiner Meinung nach Vernunft in den Wahnsinn zu legen. Das Dunkel der Vergangenheit, insbesondere das dunkelste allen Dunkels, das Mittelalter, sollte nun durch die Aufklärung, dem platonischen Motiv folgend, ins Lichte geführt werden: das Siècle des Lumières, das Age of Enlightenment hatte begonnen. Aber was wäre denn dann die eigentliche, durch die Irrtümer der Menschen entstellte Geschichte gewesen? Die richtige Geschichte wäre jene gewesen, die vor dem Hintergrund des Wohls der Gesellschaft als einzigem Maßstab des moralisch Guten und Schlechten („le bien de la société est la seule mesure du bien et du mal moral“) verlaufen wäre. Nach dem gesellschaftlichen Wohl hätten sich alle Vorstellungen davon, was gerecht und ungerecht sei, zu richten und, wenn erforderlich, zu verändern. 76 Von Natur aus seien wir zur Gesellschaftsbildung veranlagt. „L’homme [...]; non seulement il a cet amour-propre nécessaire pour sa conservation, mais il a aussi, pour son espèce, une bienveillance naturelle.“77 Die Eigenliebe und das Wohlwollen anderen gegenüber seien die bewegenden Kräfte in der Geschichte. An anderer Stelle beschreibt Voltaire das Fundament der Gesellschaft als zwei Gefühle („sentiments“), die alle Menschen besitzen würden: Mitleid („commisération“) und Gerechtigkeit („justice“). 78 Ob nun „Eigenliebe“ und „Wohlwollen“ bzw. „Mitleid und Gerechtigkeit“, es seien diese natürlichen, unvergänglichen Anlagen im Menschen, die schon beim Kind und auch beim Wilden Urteile und Verhalten beeinflussen und ihm die richtige Richtung weisen, in Richtung einer Perfektionierung.79 „Il est perfectible; et de là on a conclu qu’il est perverti. Mais pourquoi n’en pas conclure qu’il s’est perfectionné jusqu’au point où la nature a marqué les limites de sa perfection?80 Anders als Bacon lässt Voltaire nun also auch die Bezugnahme auf den Sündenfall fallen. Zu jener natürlich begrenzten und auf das Wohl der Gesellschaft gerichteten Perfektion seien aber nicht nur das Mitleid und das Wohlwollen von entscheidender Bedeutung. Denn diese hätten bei weitem nicht dafür hingereicht, jene großen Reiche und blühenden Städte zu gründen; jene zivilisatorischen von Wohlstand und Aufgeklärtheit geprägten Leistungen 75 Voltaire Essai (1967), 11, Introduction V., Seite 15. Vgl. Voltaire Traité (1967), Chapitre IX., Seite 226. 77 Ebd., Chapitre VIII., Seite 222. 78 Vgl. Voltaire Essai (1967), 11, Introduction VII., Seite 22. 79 Vgl. ebd. sowie Voltaire Traité (1967), Chapitre VIII. 80 Voltaire Essai (1967), 11, Introduction VII., Seite 20. 76 37 einer neuen Humanität („humanité nouvelle“) hervorzubringen, die immer wieder von nichtigen Interessen („très légers intérêts“) und Launen („petits caprices“) bedroht würde.81 Vielmehr seien in Wahrheit die großen Leidenschaften („grandes passions“) des Menschen die Hauptursache für die allmähliche Vervollkommnung der Kulturen gewesen: Hochmut bzw. Stolz („orgueil“), Neid („envie“), Geiz („avarice“) und Eigenliebe („amourpropre“).82 „Ainsi, de proche en proche, les passions seules réunirent les hommes, et tirèrent du sein de la terre tous les arts et tous les plaisirs. C’est avec ce ressort que Dieu, appelé par Platon l’étérnel géomètre, et que j’appelle ici l’étérnel machiniste, a animé et embelli la nature: les passions sont les roues qui font aller toutes ces machines.“83 Gott als ewiger Maschinist? Einstmalige Todsünden als göttliches Pneuma, oder etwas „maschineller“, als die Pneumatik aufgeklärter Orgelmusik? Diese Töne klingen nach einer ganz anderen Fabel, als all jene, gegen die Voltaire sich so wortgewandt gewendet hatte. Die seit 1705 zunächst unter dem Titel The Grumbling Hive, ab 1714 dann als The Fable oft the Bees anonym in Umlauf gebrachten Gedanken Bernard Mandevilles hatte Voltaire spätestens in seinem englischen Exil von 1726 bis 1728 kennengelernt. Kern dieses Traktats mit dem Untertitel „Private Vices, Publick Benefit“ war die provozierende These, dass alle menschlichen Handlungen allein der Eitelkeit entspringen. Die Bienenfabel hatte zu großen Kontroversen geführt. Auch Adam Smith sah sich etwa dreißig Jahre nach der letzten Auflage der Bienenfabel dazu veranlasst, in einem Kapitel seiner 1759 erschienenen The Theory of Moral Sentiments Stellung zu beziehen.84 Er kritisierte Mandeville für dessen Einebnung des Unterschiedes zwischen wirklicher Tugend und egoistischer Eitelkeit („vanity“) und hielt entschieden an der Unterscheidung fest. Dennoch räumte Smith ein, dass der Erfolg Mandevilles selbst bei unüberlegten („injudicous“) und unerfahrenen („unexperienced“) Lesern nicht zu erklären wäre, wenn in dieser Fabel nicht doch zumindest eine Nähe zur Wahrheit gegeben sei. 85 Dieses Quäntchen an Wahrheit, das er Mandeville zugestand, brachte Smith an anderer Stelle seiner Theory vielleicht zu jener metaphorischen Formulierung, die nach ihrer Wiederaufnahme in An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ab 1776 auch über den wirtschaftswissenschaftlichen Fachkontext hinaus wohl wie nur wenige Metaphern zu – wenn auch meines Erachtens ambivalenten – Ruhm gelangte: „the invisible hand“. Man sollte die Metapher der „invisible hand“ aber nicht überstrapazieren, wie dies oftmals zur Untermauerung von Forderungen nach einer weitgehenden Beschneidung politisch-moralischer Diskurse geschieht. 81 Vgl. ebd., Chapitre CXCVII, Seite 183; sowie Voltaire Traité (1967), Chapitre VIII., Seite 222ff. Vgl. ebd. 83 Ebd., Seite 223. 84 Vgl. Smith, Adam: The Theory of Moral Sentiments, in: ders.: The Works of Adam Smith, Vol. I., Aalen: Otto Zeller, 1963, Part VII., Sect. II, Chap. IV., Seite 545ff. 85 Vgl. ebd., Seite 545, Seite 557. 82 38 Zwar hat Smith in seiner Theory noch viel eher als in der Inquiry an der einschlägigen Textstelle ein Bild gezeichnet, das zu einer solchen Interpretation einladen mag. Dort schreibt er, dass die Vorsehung, wenn sie auch die Erde an nur wenige Machthaber verteilt habe, alle anderen, die scheinbar leer ausgegangen seien, weder vergessen noch im Stich gelassen habe.86 Denn selbst die rücksichtslosesten Machthaber würden nur in ihrer eitlen Vorstellung die Früchte ihrer Besitzungen alleine ernten und konsumieren. In Wahrheit aber, entsprechend der Redewendung, dass die Augen größer sind als der Magen, seien sie dazu gezwungen, die immensen Überschüsse der ökonomischen Produktion mit denen, die sie tatsächlich erarbeiten, den Arbeitern, zu teilen. Die Reichen würden nur geringfügig mehr konsumieren als die Armen. Und obwohl sie nur ihrem eigenen Egoismus und Nutzen nachstreben würden, wäre auf diese Weise gesichert, dass aller ökonomischer Aufschwung allen zum Vorteil gereiche. Ohne es zu beabsichtigen, ja ohne es zu wissen, würden Grundbesitzer so, wie von einer „invisible hand“ geführt, eine Verteilung der zum Leben notwendigen Güter vorantreiben, welche an diejenige heranreiche, die sich einstellen würde, wäre die Erde allen Menschen zu gleichen Teilen zugeteilt. Alle würden ihren Anteil bekommen und im Bezug auf das, was das wirkliche Glück im Leben ausmacht, seien alle Schichten der Gesellschaft gleich auf. Der Bettler, der sich am Rande des „highway“ sonne, genieße die Sicherheit, für welche die Könige kämpften. Zugegeben, das sind starke Worte. Doch sollte der „überlegte“ und „erfahrene“ Leser hier nicht kritiklos vorübergehen oder gar einwilligen. Und Smith selber kritisiert in seiner Inquiry Adel und Klerus, als die großen Grundbesitzer vergangener Zeiten, welche die Abhängigkeit der Untergebenen ihrem Belieben nach ausgenutzt hätten. Er sieht in ihnen und insbesondere in der katholischen Kirche machtvolle, durch private Interessen zusammengehaltene Gefüge („ties of private interests“), die sich in der Geschichte in einem Zustand größter abergläubischer Wahnvorstellungen („grossest delusions of superstition“) gegen eine zivile Regierung des Lebens formiert hätten. Nur durch letztere würde aber gesichert werden, dass Freiheit, Vernunft und das Glück der Menschheit („liberty, reason, and the happiness of mankind“) erblühen können.87 Private Interessen und Eigennutz gereichen also auch bei Smith nicht automatisch zur „happiness of mankind“. Zwar führt er weiter aus, dass es eben dieser Eigennutzen war, der im Zuge der Geschichte zur Zersetzung jener Machtformationen führte. Aber damit ist nicht im Geringsten gesagt, dass nicht wiederum aus eigennützigen Motiven heraus neue, ebenso machtvolle Strukturen entstehen können, welche erneut Freiheit, Vernunft und Glück entgegenstehen. 86 Vgl. hier und im Folgenden ebd., Part IV., Chap. I., Seite 316ff. Vgl. Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, in: ders.: The Works of Adam Smith, Vol. II.-IV., Aalen: Otto Zeller, 1963, Book V., Chap. I., Part III., Article 3d., Seite 217f. 87 39 Aus Smiths Ausführungen, auf die ich noch einmal genauer zu sprechen kommen werde, geht darüber hinaus hervor, dass er das Problem weniger in den religiösen Dogmen der Kirche sah, sondern, wie auch beim weltlichen Adel, in deren umfänglicher Verfügung über die gesellschaftlich entscheidenden Ressourcen der ökonomischen Produktion, Legislatur und Jurisdiktion.88 Nicht religiöse Bezüge, die ja durchaus auch gegen das Verhalten der Kirche und ihre Dogmen vorgebracht werden konnten und wurden, waren der schneidende Punkt, sondern ihre Fülle an weltlicher Macht, welche konzentriert in den Händen weniger, wenn überhaupt, wohl nur äußerst selten zum Wohle aller gedeiht. Und die Gefahr neuer Machtstrukturen sah Smith genau.89 Es ist die Monopolisierung von Verfügungsrechten über sozial relevante Ressourcen in den Händen einzelner oder auch kleinerer Gruppen, die hier als der eigentliche Feind von Freiheit, Vernunft und dem Glück der Menschheit benannt wird. Diese Monopolisierung, d.h. Machtkonzentration, zu verhindern, wurde, zumindest in der theoretischen Diskussion, zur originären Aufgabe des modernen Staates, oder, in Smiths Worten, des „civil government“. Mit derselben Einsicht wollte gute 160 Jahre nach dem Erscheinen von Smiths Inquiry Walter Eucken, wie wohl kaum einer vor und nach ihm, das Problem der Macht ins Zentrum der ökonomischen Wissenschaft stellen: „Verstehen wirtschaftlicher Wirklichkeit in aller Vergangenheit und in der Gegenwart und wahrscheinlich in aller Zukunft erfordert daher Verstehen wirtschaftlicher Macht und zugleich Durchschauen der auffallend gleichförmigen Kampfmethoden wirtschaftlicher Machtgruppen. [...] Macht ist nur ein Wort –. Es genügt nicht, hie und da dieses Wort zu gebrauchen, auch nicht, zu erklären, Macht bedeute in der Wirtschaft, ebenso wie in der Politik, viel. Es besagt auch wenig, in etwas mystischer Weise von den ‚Mächten‘ des Kapitalismus und ihrem geheimnisvollen Wirken zu sprechen. Die Hauptsache ist vielmehr, den Kern des Phänomens wirtschaftlicher Macht sichtbar zu machen. Nicht anders aber lässt sich wirtschaftliche Wirklichkeit begreifen.“90 Smith beschrieb die Geschichte als eine Entwicklung, die sich in Folge verschiedener Machtasymmetrien von einem natürlichen Fortschritt des Wohlstands („natural progress of opulence“) immer wieder entfernt hatte, ja sich in vielerlei Hinsicht als in sein Gegenteil verdreht zeigte („it has, in all the modern states of Europe, been, in many respects, entirely inverted“). Diese Machtasymmetrien fänden ihren Ausdruck in den politischen Sitten („manners“) und Gewohnheiten („customs“) der Staaten, welche die von diesen Verhältnissen Begünstigten im Streben nach Machterhalt zu konservieren suchten und damit den natürlichen Fortschritt zum größtmöglichen Wohlstand aller hemmten, wenn nicht gar verhinderten. Darin liege der Grund, dass sich die geschichtlichen Verhältnisse 88 Vgl ebd., Seite 219. Ebd., Book I., Chap. XI., Part I., Seite 227ff., sowie „Conclusion of the Chapter“, Seite 392ff. 90 Eucken, Walter: Die Grundlagen der Nationalökonomie, Jena: Gustav Fischer, 1944, Seite 236ff. 89 40 auf so unnatürliche („unnatural“) und rückschrittliche („retrograde“) Weise entwickelt hätten. 91 Die entstellte Geschichte, all die Irrtümer, die sich in den Sitten und Gewohnheiten der Völker niederschlugen, das waren genau Voltaires Themen, denen er sich explizit in seinem Essay sur les mœurs et l’esprit des nations widmete. Es galt, all diese Märchen und Unwahrheiten zu erkennen und zu studieren, um sich aus deren Gefangenschaft zu befreien. Eben das sollte das philosophische Studium der Geschichte sein, die Philosophie der Geschichte. „Chez toutes les nations l’histoire est défigurée par la fable, jusqu’à ce qu’enfin la philosophie vienne éclairer les hommes; et lorsque enfin la philosophie arrive au milieu de ces ténèbres, elle trouve les esprits si aveuglés par des siècles d’erreurs, qu’elle peut à peine les détromper; elle trouve des cérémonies, des faits, des monuments, établis pour constater des mensonges.“92 Dass sich die Geschichte für Bacon, Voltaire und Smith, wie für viele andere auch, als eine Ansammlung von Irrtümern zeigte, die sich in den Sitten und Gebräuchen der Menschen niederschlugen; dass man diese studieren müsse, um aus ihnen zu lernen; und die damit verbundene Hoffnung, dass es besser werde; all dies heißt aber eben im Umkehrschluss nicht, dass, selbst wenn Sitten und Gewohnheiten sich ändern sollten, nicht neue Machtasymmetrien mit ähnlichen Problemen entstehen könnten. Smith machte dementsprechend sehr deutlich, dass gerade im Rahmen der ökonomischen Regulierung neue Gesetzesvorschläge mit großer Vorsicht („great precaution“) anzuhören seien und niemals umgesetzt werden sollten, ohne mit höchst gewissenhafter („most scrupulous“) und höchst argwöhnischer („most suspicious“) Aufmerksamkeit geprüft worden zu sein.93 Denn Entscheidungen, die in einer Interessenshinsicht als positiv erscheinen, könnten in anderer Hinsicht das genaue Gegenteil bedeuten. Der Staat muss sich demzufolge also peinlichst genau, wenn auch nicht planwirtschaftlich bestimmend, so doch das Zusammenspiel der Kräfte regulierend und austarierend, in die ökonomischen Zusammenhänge einmischen. Alles andere wäre eine Ideologisierung der „invisible hand“, eine weitere Fabel in der Geschichte, in welcher das Privatinteresse als neues Gottesgebot, als neuer Leitstern am Firmament eines providenziellen „Highways zum Heil“ erstrahlt, bei dem kein Bettler vergessen werden würde, der am Rande in dieser Sonne faulenzend sich labt, an dem, was von vorüberfahrenden, überladenen Wagen für ihn abfällt. Zu Recht gebrauchte Smith in der Inquiry die Metapher der „invisible hand“ viel zurückhaltender, als er dies noch in der Theory getan hatte. Sie diente ihm nun zur rhetorischen Pointierung der plausiblen Einsicht, dass Eigeninteresse und Fremdinteressen sich nicht grundsätzlich widersprechen müssen, sondern sich im Alltag auf vielfältige Weise verbinden können – nicht mehr und nicht weniger; das Quäntchen Wahrheit eben, 91 Vgl. Smith Inquiry (1963), Book III., Chap. I., Seite 73ff. Voltaire Essai (1967), Chapitre CXCVII., Seite 174. 93 Vgl. Smith Inquiry (1963), Book I., Chap. XI., „Conclusion of the Chapter“, Seite 397f. 92 41 das Smith Mandeville zugestanden hatte. 94 Weil sich aber dieses Zusammenspiel der Interessen in vielen Fällen nicht wie von selbst ergibt, wandte Smith sich an den Staat und konzipierte die „Political Œconomy“ als einen Zweig der Staatswissenschaften („Political œconomy considered as a branch of the science of a Statesman or Legislator“).95 Viel entscheidender und aufschlussreicher für die Fortschrittsdiskussion als das vermeintliche Paradigma der „invisible hand“ ist in Smiths ökonomischer Theorie in diesem Zusammenhang ein ganz anderer Punkt, der jedoch zumeist unter der Eingängigkeit jener Metapher verschüttet wird. Man bekommt ihn in den Blick, wenn man nach dem Grund fragt, warum Smith die Vermehrung des Wohlstandes, erstens des Volkes und zweitens der Regierung, als die zwei Ziele der Politischen Ökonomie vorschlägt („It proposes to enrich both the people and the sovereign“) und damit nichts anderes als das Wirtschaftswachstum ins Zentrum der ökonomischen Wissenschaft stellt.96 Die Antwort auf diese Frage erhält man wiederum an jenen Stellen im letzten Buch seiner Inquiry, an denen Smith recht versteckt unter den Überschriften „Of the Expence of the Institutions For the Education of a Youth“ und „Of the Expence of the Instituions For the Instruction of People of All Ages“ seine geschichtsphilosophischen Überlegungen ausführt. Smith war der Meinung, dass Vernunft allein nichts gegen die jeweiligen Machtstrukturen auszurichten vermochte, die sich gegen die Vernunft selbst sowie gegen Freiheit und Glück der Menschheit stellten. Wiederum unter besonderer Bezugnahme auf die katholische Kirche schrieb er: „[...] human reason might perhaps have been able to unveil, even to the eyes of the common people, some of the delusions of superstition; it could never have dissolved the ties of private interest. Had this constitution been attacked by no other enemies but the feeble efforts of human reason, it must have endured forever.“97 Die Lösung sah Smith viel eher in der durch neue technisch-naturwissenschaftliche Errungenschaften immer weiter ausgedehnten und auszudehnenden Vielfalt von Produkten und Erwerbsmöglichkeiten. In früheren Zeiten, in denen die ökonomische Produktion hauptsächlich aus schnell verrottenden Naturalien bestand, konnten die Grundeigentümer die Überschüsse weder selbst konsumieren noch über längere Dauer hin aufbewahren und waren so gezwungen, sie mit allen anderen Menschen zu teilen. Oft hätten sie dies unter der Maske von Wohltätigkeit und Nächstenliebe getan, um in dieser angeblichen Großzügigkeit sich der Dankbarkeit und Loyalität ihrer Untergebenen zu versichern. Dann aber seien durch die Entwicklungen in Handwerk und Technik Möglichkeiten entstanden, einen Großteil der Überschüsse für neuartige Produkte auszugeben, welche die Grundeigentümer ganz alleine für sich genießen konnten. Der Anteil, den sie als Lohn und 94 Vgl. ebd., Book IV., Chap. II., Seite 176ff. Vgl. ebd., Book IV., Introduction, Seite 138. 96 Ebd. 97 Ebd., Book V., Chap. I., Part III., Article 3d., Seite 218. 95 42 Wohltaten an andere Menschen verteilten, sei immer geringer geworden. Damit habe sich aber auch die Loyalität der anderen verringert. Diejenigen, die in ihrem „Anstellungsverhältnis“ blieben, hätten immer mehr arbeiten müssen, um nach wie vor die Überschüsse zu erwirtschaften, welche die Grundbesitzer nun in allerhand Luxus und dessen Erhalt investierten. Dazu hätten sie ihren Arbeitern aber auf längere Sicht finanzielle und rechtliche Zugeständnisse machen müssen, wodurch diese immer unabhängiger geworden wären. Darüber hinaus seien in Handwerk („arts“) 98 , Manufakturen („manufactures“) und im Handel („commerce“) mit deren Produkten immer mehr reale Alternativen entstanden, einen Lebensunterhalt unabhängig von Adel und Klerus zu sichern, was die Entwicklung seinerseits beschleunigte. Die Macht der alten Herren brach mehr und mehr zusammen. So erscheint diese Entwicklung, Ausweitung und Differenzierung der ökonomischen Produktion als eine Bedingung der Befreiung aus überkommenen Machtstrukturen, welche die Vernunft und das Glück der Menschen solange unterdrückt hatten. Das war Smiths Hauptargument hinter seiner Forderung nach Wirtschaftswachstum: Steigerung der Produktion und Produktvielfalt reduziert einseitige Abhängigkeitsverhältnisse, verringert also Machtasymmetrien. Dies setzt Vernunft frei für weitere Forschungen und Erfindungen, schafft weitere Produkte und Produktion, reduziert weitere Abhängigkeit. So werden Vernunft, Freiheit und Glück der Menschen Schritt für Schritt befördert, aber nicht durch die Macht einer unsichtbaren Hand, sondern durch die Steigerung der Produktion in sämtlichen Bereichen und ein hochsensibles Staatswesen, welches vermag, die Handlungen der Menschen in diesem Sinne zu regulieren, alte Vermachtungen abzubauen und neue zu vereiteln. Was Smith hier als historische Studie ausgewiesen im letzten Buch seiner Inquiery versteckt, ist die Aussicht auf einen Prozess, der auch in die Zukunft weist. Es ist ein „trojanisches Pferd“ an die Staatsmänner seiner Zeit, wenn er diesen empfiehlt: „enrich both the people and the sovereign“. Denn eine solche Wohlstandssteigerung wird auch die Macht der damals regierenden Souveräne nicht unberührt gelassen haben. Der Nutzen 98 Vgl. ebd.; Wurden bisher die sieben freien Künste, die artes liberales, die Voraussetzung für das Studium der höheren Fächer Theologie, Jurisprudenz und Medizin waren, in ihrem Ansehen über die praktischen Künste, die artes mechanicae, gestellt, werden nun von Smith, wie auch von Voltaire und vielen anderen „Aufklärern“ auch, letztere in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung gestellt. Die Theologie, die als das wichtigste Fach angesehen wurde, erscheint nur noch als großer Irrweg, der unter anderem dafür Verantwortung trägt, dass das Licht der Vernunft und damit die Möglichkeit der Einsicht in die Prinzipien des Lebens und deren Umsetzung immer wieder gelöscht wurde. Zu den sieben freien Künsten (lat. septem artes liberales), gehören der Teil des Trivium mit den Fächern Grammatik, Rethoreik, Dialektik (Logik) und der Teil des Quadrivium mit den Fächern Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. Das erste Mal wurden die sieben freien Künste im 1. Jahrhundert v. Chr. ausführlich von dem römischen Gelehrten Varro in seinen Disciplinae behandelt. Zu den artes mechanicae zählen als armatura Berufe des Handwerks und die der Bildenden Künste und der Baukunst, die agricultura, also die Landwirtschaft und das lanificium, das Bekleidunghandwerk. 43 dieser Strategie lag vor allem darin, dass sie sich politisch – die für Smith entscheidenden Konsequenzen in historischer Betrachtung chiffriert – selbst denen verkaufen ließ, die, allein auf ihren Vorteil bedacht, sich tatsächlich nicht um das Gemeinwohl kümmerten. Aber diesem Pluspunkt stehen in der langfristigen Bilanz zwei Hypotheken gegenüber, die es erst noch abzulösen gilt. Zum einen ist es nach wie vor erforderlich, dass sich im Zuge der Wohlstandssteigerungen auch tatsächlich jene sensiblen Staatswesen herausbilden, die zu einer Regulierung der ökomischen Prozesse zum Wohle aller fähig sind. Das ist, wie die Geschichte leidvoll und zu genüge gezeigt hat und noch zeigt, kein Prozess der sich wie von selbst erfüllt. Zum anderen stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Begrenzung der ökonomischen Ressourcen, wenn auch nicht ihre Endlichkeit, so doch die begrenzte Geschwindigkeit ihrer Regeneration, ein weiteres Ansteigen der Produktion an ein Ende kommen lässt, und damit das Wirtschaftswachstum als politisches Ziel entweder unglaubwürdig oder aber, da nur noch auf Kosten anderer gewachsen werden kann, in Aggression verkehrt wird? Zu „liberty, reason, and the happiness of mankind“ wird es dann nicht mehr dienen können. Auch wenn dieses Problem zu Smiths Zeiten noch nicht akut war, wie dies im Gegensatz dazu heute der Fall ist, war ihm klar, dass bei anhaltendem Wirtschaftswachstum irgendwann der Zeitpunkt kommen würde, an dem sich dieses stellen wird.99 Und dort stehen wir heute. Und wie hilflos scheinen wir zu sein, wenn die Europäische Union in ihrer grundsätzlichen Strategie bis zum Jahre 2020 diesem Problem Rechnung zu tragen meint, wenn sie als oberstes Ziel das Wirtschaftswachstum in die Dreifaltigkeit von intelligentem Wachstum, nachhaltigem Wachstum und integrativem Wachstum auffächert. 100 Dabei wird im globalen Zusammenhang immer deutlicher, dass die Ressourcenknappheit ein weiteres Wirtschaftswachstum nur noch kurzfristig zulassen wird. Es ist kein Zufall, dass in der Anerkennung der Grenzen des Wirtschaftswachstums und den mit dieser einhergehenden Diskussionen und Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit der Fortschrittsbegriff als das, was es zu suchen gilt, wieder in deren Zentrum rückt.101 Denn es war das politische Ziel des Wirtschaftswachstums, durch das 99 Vgl. ebd., Book I., Chap. IX., Seite 144. Vgl. Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, esf.de/portal/generator/15418/prooerty=data/2011_01_04_europa_2020-strategie.pdf. 101 Anfang 2008 wurde unter Präsident Nicolas Sarkozy in Frankreich die „Commission sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social“ unter der Beteiligung von namenhaften Wissenschaftlern wie Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Kenneth Arrow, Daniel Kahnemann, Nicholas Stern und anderen ins Leben gerufen. Aufgabe der Kommission ist es, die zentrale Rolle des Bruttoinlandproduktes als Indikator für „sozialen Fortschritt“ zu hinterfragen und Alternativen zu entwickeln. Vgl. Vgl. die Ausführungen zur Aufgabe der Kommission auf deren Internetseite, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/fr/index.htm. In Deutschland berief der Deutsche Bundestag 2010 eine Enquete-Kommission mit dem Titel „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem 100 44 wir in den letzten zweihundert Jahren der Suche nach einer objektiv guten Entwicklung eine konkrete Form gegeben und sie politisch operabel gemacht haben. In dem Moment, in dem diese Konkretisierung an die Grenzen ihrer Realisierbarkeit stößt, muss der Diskurs wieder auf die dahinterliegende Ebene der Fortschrittsfrage zurückgehen und eine Öffnung erfahren, damit wir unser gesellschaftliches Selbstverständnis entsprechend den Anforderungen der Zeit verändern können. Dies ist ein äußerst schwieriger Prozess, der geprägt sein wird durch Unsicherheit und Kämpfe um die Verteilung von Macht. Umso wichtiger ist es, diese notwendige Öffnung nicht in eine Beliebigkeit laufen zu lassen, sondern eine allgemeine Vorstellung von Fortschritt zu entwickeln, die dieser Suche eine Orientierung bietet, in der um ein neues gesellschaftliches Selbstverständnis und neue Konkretisierungen gerungen werden kann; und alte Fehler im Denken des Fortschrittsbegriffes vermieden werden, damit wir uns nicht, wie Taguieff sich ausdrückt, in einen Teufelskreis bewegen: „Il y a là un cercle théorique qui, pour ne pas devenir ‚cercle vicieux‘ doit faire l’objet d’une clarification.“ Die Philosophie sollte hier nicht schweigen, sondern ist der prädestinierte Ort einer rigorosen kritischen Auseinandersetzung um mögliche Formulierungen eines allgemeinen Fortschrittsverständnisses. Auch wenn sie nicht in Gänze schweigt, so ist es doch bezeichnend, dass in einem Projekt der OECD mit dem Titel The Global Project of Measuring the Progress of Societies in einer begriffsgeschichtlichen Auflistung als die einzigen zeitgenössischen Quellen Papst Paul der VI. mit seiner Enzyklika Populorum Progressio von 1967 und der ägyptische Ökonom Abdel Hamid El-Gahzali mit seinem Text Man is the Basis of the Islamic Strategy for Economic Development von 1994 genannt werden.102 Und auch Papst Benedikt XVI. hat in dreien seiner Enzykliken den Fortschrittsbegriff diskutiert. 103 Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die zeitgenössische Auseinandersetzung um den Fortschritt hier als in den Händen konfessioneller Religionen liegend erscheint, von denen man sich in der Fortschrittsdiskussion gerade distanzieren wollte. Ich will hier keine falschen Fronten proklamieren, aber ich denke, dass die Philosophie den Fortschrittsdiskurs nicht auf- und damit abgeben sollte. Denn es wäre naiv, zu glauben, dass die mit dem Fortschrittsbegriff verbundenen Fragen sich einmal erledigen werden. Die Frage nach dem Fortschritt als einer objektiv guten Entwicklung wird, wenn vielleicht auch nicht unter diesem Namen, ein ständiges Problem und somit, im positiven Falle, ein ständiges Projekt bleiben. Und als Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“. Auf Europäischer Ebene wurde in 2007 von der Europäischen Kommission eine Konferenz zu dem Thema „Beyond GDP: Measuring Progress in a Changing World“ ausgerichtet, aus der sich die bis heute aktive, internationale Initiative „Beyond GDP: Measuring progress, true wealth, and the well-being of nations“ entwickelt hat. Vgl. Für weitere Informationen siehe Webseite der Initiative, http://www.beyond-gdp.eu/. 102 Vgl. wikiprogress.org/index.php/Definition_of_progress#A_brief_history_of.C2.A0Progress.C2.A0. 103 Vgl. Benedikt XVI.: „Deus Caritas est“, 2005; ders.: „Spe salvi“, 2007; ders.: „Caritas in veritate“, 2009; alle online unter: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/index_ge.htm. 45 ein solches gilt es den Fortschritt zu verstehen. So erklärt sich schließlich auch der zweite Teil des Untertitels dieser Arbeit: Fortschritt ist ein problematischer Begriff. 2 Zwei begriffslogische Modifizierungen Schlägt man in einschlägigen Wörterbüchern das Wort „Fortschritt“ nach, so findet man Formulierungen wie diese: Die etymologischen Wurzeln „Epidosis, prokope, prokoptein, ‹profectus›, ‹proficere›, ‹progressio›, ‹progressus› bedeuten allgemein Fortgang, Fortschreiten primär zum Besseren, aber auch zum Schlechteren, Zunahme, Gedeihen, Wachstum.“ 104 –„Obwohl der Ausdruck gelegentlich auch Abläufe zum Schlechteren bezeichnen kann, meint ,Fortschritt‘ in der Regel eine Bewegung zum Besseren.“105 – „,Fortschritt‘ [...] enthält bis heute immer ein teleologisches Implikat über den unterstellten Verlauf der Ereignisgeschichte oder auch Handlungsgeschichte, meist eine Aufstiegserwartung.“ 106 – „,Fortschritt‘ [...] ist ein in der Alltagssprache, in Wissenschaften und in der Philosophie verwendeter Begriff zur Bezeichnung einer im Vergleich mit Vorausgegangenem oder Bestehendem positiv oder negativ bewerteten Entwicklung und Veränderung.“107 Drei Aspekte fallen in diesen Zitaten auf. Erstens tritt „Fortschritt“ als ein evaluativer Begriff in Erscheinung. Zweitens wird diese evaluative Komponente des Fortschrittsbegriffes ambivalent aufgefasst. „Fortschritt“ kann entweder eine positive oder negative Entwicklung bedeuten. Und drittens wird „Fortschritt“ stets als ein Steigerungsgeschehen dargestellt, ein Geschehen hin zum Besseren oder Schlechteren. Als erste Annäherung an ein Verständnis von „Fortschritt“ habe ich weiter oben die Formulierung einer „objektiv guten Entwicklung“ gebraucht. Diese Formulierung stimmt nur mit dem ersten der drei genannten Aspekte uneingeschränkt überein. Hinsichtlich der anderen beiden Aspekte bedeutet sie eine Modifizierung. Wenn „Fortschritt“ allein eine „gute Entwickung“ bezeichnen soll, noch dazu im objektiven Sinne, ist damit eine Bedeutungsverengung hinsichtlich des zweiten Aspektes verbunden: Eine Entwicklung zum Schlechteren wird begrifflich ausgeschlossen. In Bezug auf den dritten Aspekt ist mit der Formulierung einer „objektiv guten Entwicklung“ hingegen eine Ergänzung der in den Zitaten deutlich werdenen Engführung von „Fortschritt“ im Sinne eines 104 Ritter, Joachim: „Fortschritt“, in: ders. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2, Basel/Stuttgart: Schwabe & Co Verlag, 1972, Seite 1032. 105 Koselleck, Reinhart: „Fortschritt“, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Band 2, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1975, Seite 352. 106 Neuser, Wolfgang: „Fortschritt“, in: Hermann Krings/Hans Michael Baumgartner/Christoph Wild (Hrsg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Band 1, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2011, Seite 788. 107 Rosen, Michael: „Fortschritt“, in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie, Hamburg: Felix Meiner, 2010, Seite 218. 46 Steigerungsgeschehens verbunden. Zwar kann eine Verbesserung stets auch als „gute Entwicklung“ bezeichnet werden. Es fragt sich aber, ob jedwede „gute Entwicklung“ auch eine Verbesserung, also ein Steigerungsgeschehen bedeutet. Es sei hier bereits vorweggenommen, dass ich „Verbesserung“ nur als einen von zwei möglichen Modi verstehe, in denen sich eine Fortschrittsbewegung vollziehen kann. Im Folgenden gilt es nun, diese beiden Modifizierungen gegenüber dem in den philosophischen Wörterbüchern deutlich werdenden Verständnis von „Fortschritt“ zu begründen. Zunächst gehe ich auf die mit der semantischen Eingrenzung auf positiv bewertete Entwicklungen verbundene Entambiguisierung des Fortschrittsbegriffes ein. Im Anschluss daran werde ich zeigen, inwiefern zwischen zwei verschiedenen Fortschrittsmodi unterschieden werden kann und sollte. Entambiguisierung des Fortschrittsbegriffes Einen Grund, der für die Entambiguisierung des Fortschrittsbegriffes spricht, kann man in der Tatsache sehen, dass dem Ausdruck „Fortschritt“ in der Alltagssprache der Gegenwart grundsätzlich eine positive Bedeutung zukommt, welcher die immense philosophische Kritik des zwanzigsten Jahrhunderts offenbar nichts anhaben konnte.108 Besonders im Verhältnis zu den Begriffen „Stillstand“ und „Rückschritt“ wird die grundsätzliche Positivität des Fortschrittbegriffes deutlich. Jedes Zögern auf die Frage, ob man für Fortschritt sei, verwandelt sich spätestens in der Verneinung der weiteren Nachfrage, ob das Zögern denn als Zustimmung zu Stillstand oder gar Rückschritt zu deuten sei, zu einer latenten Bestätigung dieser Positivität. Genau aus diesem Grund konnte der jetzige USamerikanische Präsident, Barack Obama, in seinem ersten Wahlkampf 2008 in unkommentierter Weise mit dem Worten „progress“ und „change“ – natürlich zum Guten – für sich werben. Aber auch abseits des Alltages lässt sich diese Positivität des Fortschrittsbegriffes ausfindig machen. Die Verwendungen des Ausdruckes „Fortschritt“ in den Präambeln der Charta der Vereinten Nationen, der Menschenrechtsdeklaration und des Vertrages über die Europäische Union setzen eine positive Konnotation desselben voraus. Das Gleiche gilt für den Gebrauch des Wortes „Fortschritt“ in den nationalen und internationalen Diskursen zur Wachstumskritik. In der Ablehnung der ideologischen Fokussierung nationaler und internationaler Politiken auf ökonomisches Wachstum kommt der Ausdruck „Fortschritt“ als das ins Spiel, was es durch eben diese Entideologisierung zu befördern gilt.109 Wenn also der Ausdruck „Fortschritt“ gegenwärtig nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in politischen Diskursen bis hinein in internationale Vertragswerke allein positiv verstanden wird, lässt sich meines Erachtens zu Recht dafür 108 Vgl. Neuser (2011), Seite 788; sowie Baumgartner, Hans Michael: „Die Idee des Fortschritts“, in: Max Müller/Michael Schmaus (Hrsg.): Philosophisches Jahrbuch, 70. Jahrgang, 1. Halbband, München: Verlag Karl Alber, 1962, Seite 158ff. 109 Vgl. Seite 44ff. dieser Arbeit. 47 argumentieren, in dem historisch aufweisbaren ambivalenten Gebrauch nicht mehr als eine begriffsgeschichtliche Anekdote zu sehen, die für die aktuelle Bedeutung ohne Belang ist und deshalb ignoriert werden kann. Unabhängig davon aber lässt sich die grundsätzliche Positivität des Fortschrittsbegriffes meines Erachtens auch aus den etymologischen Wurzeln „Gedeihen“ und „Wachsen“ ableiten. Die „begriffsgeschichtliche Anekdote“ der negativen Konnotation erscheint sodann als Folge eines ungenauen Wortgebrauches. Man kann die vermeintliche Ambiguität des Ausdruckes „Fortschritt“ als eine aus der „Aggregationsproblematik“ herrührende Begriffsverzerrung verstehen. Die „Aggregationsproblematik“ ergibt sich aus einer über partielle Entwicklungen hinausgehenden Betrachtung einer Gesamtwirklichkeit. Eine differenzierte Betrachtung dieses Zusammenhanges kann dazu beitragen, den ambivalenten, ja geradezu paradoxen Gebrauch – dass ein Fortschritt auch eine negative Entwicklung, also einen Rückschritt bedeuten kann –, wenn nicht zu delegitimieren, so doch seiner Inkonsistenz in Bezug auf die etymologischen Wurzeln zu überführen. Die Entzerrung des Fortschrittbegriffes kann dabei auf zwei Ebenen vorgenommen werden, einer faktualen und einer evaluativen. Die Argumentation ist auf beiden Ebenen aber letztlich die gleiche. Ausgehend von den etymologischen Wurzeln des Fortschrittsbegriffes „Gedeihen“ und „Wachsen“ werde ich im Folgenden zunächst auf der faktualen, dann auf der evaluativen Begriffsebene die Stringenz des ambivalenten Gebrauches von „Fortschritt“ in Frage stellen. Es ist für ein Verständnis der sich anschließenden Ausführungen nicht unentscheidend, im Bewusstsein zu haben, dass „Gedeihen“ und „Wachsen“ nicht in ihrem vollen Bedeutungsumfang synonym gebraucht werden können. Denn insofern „Wachsen“ offenbar stets irgendeine Art von Steigerungsgeschehen meint, gilt dies nicht für das Wort „Gedeihen“. Zwar kann „Gedeihen“ als „gute Entwicklung“ auch einen Wachstumsprozess bezeichnen, ist aber nicht darauf reduziert. Es sind auch positive Entwicklungen denkbar, welche nicht als Steigerungsgeschehen zu chrakterisieren sind. Dazu später mehr. Wichtig ist an dieser Stelle erst einmal nur, im Kopf zu behalten, dass sich das Wort „Fortschritt“ seinen etymologischen Wurzeln nach nicht allein auf Steigerungszusammenhänge beziehen lässt und diese nur insoweit meinen kann, als sie einem „Gedeihen“ nicht abträglich sind. Faktuale Positivität Auf faktualer Ebene können „Fortschritte“ überall dort ausgemacht werden, wo etwas als faktisches „Gedeihen“ oder „Wachsen“ betrachtet wird. In der angenommenen Faktizität des Gedeihens, sei es nun Wachstum oder nicht, tritt eine Positivität zu Tage, die ich als faktuale Positivität bezeichnen möchte. Das Gedeihende erfährt durch sein Gedeihen eine faktische Bejahung. Ein so verstandener Fortschritt kann mit Blick auf das Gedeihende allein positiv verstanden werden, bezeichnet es in diesem Hinblick ausschließlich eine 48 „gute“ Entwicklung. Diese faktuale Positivität des Fortschrittsbegriffes erhält auch dadurch keinen Abbruch, dass ihre Wirklichkeit in anderer Hinsicht möglicherweise mit einer faktualen Negativität verbunden ist. So ist es denkbar, dass etwas anderes durch das Gedeihende negativ beeinflusst wird, nicht mehr wächst, nicht mehr gedeiht, vielleicht vermindert, gar vernichtet oder von vorne herein verhindert wird. Aber gerade wenn man einen solchen negativen Zusammenhang, ein solches Nicht- oder Nicht-mehr-Gedeihen mit in Betracht zieht, wird deutlich, dass dieses, weil es nicht „wächst“ oder „gedeiht“, eben keinen „Fortschritt“ bedeuten kann. Auf faktualer Begriffsebene ist „Fortschritt“ dem etymologischen Kern nach als „Gedeihen“ und „Wachsen“ allein positiv, ist Bejahung, keine Negation, Verhinderung, Verminderung oder gar Vernichtung. Sonst wäre „Gedeihen“ gleichbedeutend mit „Nicht-Gedeihen“, was offensichtlich ein Widerspruch ist. Der hypothetische Fall reinen „Nicht-“ oder „Nicht-mehr-Gedeihens“ kann nicht sinnvoll als Fortschritt im Sinne von „Gedeihen“ bezeichnet werden. Dies müsste er aber, wenn die vermeintliche Ambivalenz im Fortschrittsbegriff selbst liegen sollte. In diesem Zusammenhang wird also nicht ersichtlich, warum der Fortschrittsbegriff eine ambivalente Bedeutung haben, faktuale Positivität und Negativität, „Gedeihen“ und „Nicht-Gedeihen“ gleichermaßen umfassen sollte. Eine mögliche Überlegung bleibt. Vorausgesetzt jedes faktische „Gedeihen“ würde synchron oder asynchron mit einem „Nicht-Gedeihen“ einhergehen, dann wäre es richtig zu sagen, dass jeder Fortschritt sein Gegenteil gleichsam mitbedeute.110 Im ausschließlich positiven Begriffe würde dieser Zusammenhang unreflektiert verlorengehen. Aus Gründen einer diesbezüglichen Klarheit könnte es deshalb sinnvoll erscheinen, Fortschritt sowohl positiv als auch negativ zu begreifen. Meines Erachtens wird dadurch allerdings genau das Gegenteil erreicht. Die Unklarheit wird durch die widersprüchliche Begriffsverwendung, in der Fortschritt sowohl eine positive als auch eine negative Entwicklung bezeichnen kann, gesteigert und nicht beseitigt. Dabei kann man diese „Aggregrationsproblematik“ leicht in den Griff bekommen, wenn man sich Folgendes klar macht. „Fortschritt“ ist in erster Linie ein Partial-, kein Totalbegriff.111 „Fortschritt“ bezieht sich als Begriff zunächst nicht auf die Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit, sondern nur in Hinsicht auf partiell in ihr Gedeihendes oder Wachsendes. Dabei kann offen gelassen werden, ob zugleich anderes nicht gedeiht und eben keine Fortschritte macht. Nicht im Fortschrittsbegriff, sondern in dem Bergiff einer über partielles Gedeihen hinausgehenden Wirklichkeit ist die Ambivalenzproblematik zu verorten. Es ist die Gesamtwirklichkeit, die zugleich 110 Dieser Zusammenhang kann auf unterschiedliche Weise vorgestellt werden. In seinem Aufsatz „›Fortschritt‹ und ›Niedergang‹ – Nachtrag zur Geschichte zweier Begriffe“ macht Reinhart Koselleck vier verschiedene Formen dieses Zusammenhangs in der Begriffsgeschichte aus. „Fortschritt“ und „Niedergang“ erscheinen als Sukzessionsbegriffe, Gegenbegriffe, Korrelationsbegriffe oder Kompensationsbegriffe; Koselleck, Reinhart: „›Fortschritt‹ und ›Niedergang‹ – Nachtrag zur Geschichte zweier Begriffe“, in ders.: Begriffsgeschichten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006, Seite 162ff. 111 In diesem Punkt schließe ich mich Reinhart Koselleck an. Das aber heißt nicht, dass ein universaler Fortschritt prinzipiell unmöglich ist; vgl. Koselleck (2006), Seite 180. 49 „Fortschritte“ und „Rückschritte“, „Gedeihen“ und „Nicht-Gedeihen“ umfassen kann. Und wenn man danach fragt, ob die Wirklichkeit in ihrer Totalität einen Fortschritt darstelle, so könnte eine Antwort allein aus der Aggregation der partiellen Entwicklungen abgeleitet werden. In diesem Zusammenhang scheint der häufig vorgebrachte Hinweis, dass im Französischen und Englischen ursprünglich nur im Plural von „Fortschritten“ statt im Kollektivsingular „Fortschritt“ gesprochen wurde, auf die Sache nicht nur ein begriffsgeschichtliches, sondern auch ein systematisches Licht zu werfen.112 Ein zwischen Fortschritten und Rückschritten ausgeglichenes oder gar negatives Ergebnis stellt jedoch keinen Grund dafür dar, dem Fortschrittsbegriff eine ambivalente Bedeutung zuzusprechen, sondern allein dafür, in diesem Fall die Gleichsetzung von „Gesamtwirklichkeit“ und „Fortschritt“ zu verneinen. 113 Es macht in diesem Zusammenhang Sinn, zwischen der substantiellen Partialität und der aggregativen Universalität des Fortschrittsbegriffs zu differenzieren. Evaluative Positivität Die evaluative Ebene bedeutet die begriffliche Einbeziehung jenes Phänomens, das sich als subjektive Wertung faktischen Geschehens beschreiben lässt. Eine sich in faktischem Gedeihen manifestierende Positivität kann eine evaluative Bestätigung oder aber Ablehnung erhalten. Hierin nun könnte ein nachvollziehbarer Grund für einen ambivalenten Gebrauch des Fortschrittsbegriffes vermutet werden. Durch Einbeziehung der subjektiven Evaluation in den Begriff des Fortschritts scheint dieser nach zwei Seiten hin deutbar: zum Guten und zum Schlechten. Die Bewertung eines faktischen Gedeihens hängt davon ab, ob dieses mit den Interessen des wertenden Subjektes im Einklang steht oder nicht. Ein interessiertes Subjekt ist nun aber selbst eine Entität, deren Gedeihen bzw. Nicht-Gedeihen sich ohne Weiteres thematisieren lässt. Und entscheidend für das Gedeihen eines solchen Subjektes ist, dass die faktischen Entwicklungen seinen Interessen entsprechen. Analog führen Entwicklungen, die den Interessen des Subjektes entgegenstehen, zu einem Nicht-Gedeihen desselben. Steht ein faktisches Gedeihen im Einklang mit den subjektiven Interessen, dann wird jenes faktische Gedeihen durch ein faktisches Gedeihen des interessierten Subjektes begleitet. Wir haben es sowohl mit faktualer als auch evaluativer Positivität und in beiden Fällen mit einem Fortschritt im Sinne von Gedeihen zu tun. Widerspricht ein faktisches Gedeihen jedoch den subjektiven Interessen, dann steht jenes faktische Gedeihen einem faktischen Nicht-Gedeihen des interessierten Subjektes gegenüber. In diesem Fall haben wir es mit faktischer Positivität und evaluativer Negativität, einem Fortschritt als faktisches Gedeihen auf der einen und 112 Vgl. etwa Koselleck (2006), Seite 173. Was sollte uns auch die Anwendung eines ambivalenten Begriffes auf eine ambivalente Wirklichkeit bedeuten: die Ambivalenz der Ambivalenz? Wäre Ambivalenz dann doch nicht so ambivalent, wie wir denken? Es ist begrifflich sinnvoll, den Fortschrittsbegriff von einer grundsätzlichen Gleichsetzung mit einer Gesamtwirklichkeit und damit von der in dieser möglichen Ambivalenz zu befreien. 113 50 einem Rückschritt als faktisches Nicht-Gedeihen auf der anderen Seite zu tun. Wieder ist es die über das einzelne Gedeihen hinausgehende Wirklichkeit, die sowohl Positivität als auch Negativität, also Ambivalenz aufweisen und, insofern sie dies etwaig tut, gerade nicht als Fortschritt bezeichnet werden kann. Die zwei Modi des Fortschrittsbegriffes Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass ich den Begriff der „Verbesserung“ nur als einen von zwei möglichen Fortschrittsmodi verstehe. Und in den obigen Anmerkungen über das Verhältnis der beiden etymologischen Grundbedeutungen von Fortschritt, „Gedeihen“ und „Wachsen“, lag auch bereits ein erster Hinweis darauf, worin der zweite der beiden Modi besteht. Es wurde deutlich, dass der Ausdruck „Fortschritt“ im Hinblick auf „Wachstum“ ein Steigerungsgeschehen beinhalten kann, aber nur insofern dieses einem „Gedeihen“, einer „guten Entwicklung“ entspricht. Nicht jede gute Entwicklung aber bedeutet ein Steigerungsgeschehen. Die Realisierung von Fortschritt als einer „guten Entwicklung“ lässt sich demnach auf zwei verschiedene Weisen denken. Zum einen kann eine „gute Entwicklung“ eine Verbesserung bedeuten, sofern mit der Veränderung die Vorstellung eines Übergangs von einem schlechteren zu einem besseren Zustand verbunden wird – wobei hier erst einmal offen gelassen werden kann, wie genau dieses „Besserwerden“ konkret zu verstehen ist. Zum anderen kann unter einer „guten Entwicklung“ aber auch die Fortführung einer bereits „gut“ verlaufenden Bewegung verstanden werden. In diesem Falle genügt die Bewegung einem bestimmten Anspruch, ohne dass dieses Genügen mit einer Steigerung verbunden ist. Die Eigenschaft, sich in einem der beiden Modi Verbesserung oder Genügen äußern zu können, nenne ich die Bimodalität des Fortschrittsbegriffes.114 Vor dem Hintergrund der begriffsgeschichtlichen Entwicklung in philosophischen und politischen Auseinandersetzungen scheint der Modus der Verbesserung, modus meliorativus, keiner weiteren Rechtfertigung zu bedürfen. Schaut man sich das Fortschrittsverständnis einschlägigier philosophischer Konzepte und politischer Programme der Vergangenheit an, dann geht es vornehmlich um Verbesserung bzw. Steigerungsgeschehen. Ganz anders der Modus des Genügens, modus sufficiens. Es lässt sich meines Erachtens aber recht einfach zeigen, dass es dabei letztlich um keine Erweiterung des Fortschrittsbegriffes, sondern um die Explikation eines jeder „Verbesserung“ immanenten Bedeutungsaspektes geht. Bei all dem gelten die folgenden Überlegungen nicht erst für ein allgemeines Verständnis, sondern ebenso für zeitlich, räumlich und sachlich relativierte Bedeutungen von „Fortschritt“. 114 Ähnlich hat Robert Spaemann eine Unterscheidung zwischen von ihm so benannten „A-Fortschritten“ und „B-Fortschritten“ vorgenommen; vgl. Spaemann (1994), Seite 130ff. 51 Eine „Verbesserung“ ist eine Veränderung, eine Bewegung oder ein Werden im modus meliorativus, eben ein „Besserwerden“. Ein solches aber ist nur denkbar im Hinblick auf einen Zielpunkt, dem sich die in Frage stehende Bewegung annähert. 115 Das „Besserwerden“ kann hier im Grunde als Synonym zu dieser Annäherung verstanden werden. Die Annäherung an ein Ziel bedeutet so die graduelle Steigerung im Hinblick auf die Erfüllung eines Zieles. Dabei ist vorauszusetzen, dass das Ziel als Ziel der Bewegung stets bewahrt bleibt. Die Bewahrung des Zieles schließt die Bewahrung des Anspruches der Zielerfüllung mit ein. Zielvorstellungen, die nicht erfüllt werden können, sind aus praktisch-theoretischer Sicht als Zielsetzungen zu diskreditieren. Diesen Zusammenhang möchte ich als teleologische Suffizienz-Bedingung bezeichnen. „Verbesserung“ ist eine teleologische Dynamik. Es sei hier nebenbei bemerkt, dass die Bewahrung eines Zieles in der Veränderung nichts anderes heißt, als dass die Verbesserung in ihrem Kern einen dritten, wenn auch für sich nicht schon progressiven Modus enthält, den modus conservativus. Modus conservativus und modus meliorativus sind also, anders als man vor dem Hintergrund politischer Debatten vorschnell meinen könnte, nicht nur keine sich widersprechenden Modi einer Bewegung, sondern letzterer setzt ersteren sogar voraus. Das Gesagte gilt auch dann, wenn die Zielbezogenheit nur von außen an eine Bewegung herangetragen wird, ohne dass ihr dieser Zielbezug als immanenter selbst zukäme. Auch in einer solchen Projektion muss die Bewegung beständig auf ein, wenn auch ihr äußerlich zugesprochenes, Ziel bezogen werden, soll sie als „Verbesserung“ thematisiert werden können. Ob in eine Bewegung bloß projiziert oder dieser als Realität zukommend, der Begriff der „Verbesserung“ kommt im Hinblick auf seine notwendige Zielorientierung nicht ohne einen modus conservativus aus. Anders aber als letzterer schließt der modus meliorativus über die Bewahrung der Zielorientierung hinaus auch die Vorstellung einer tatsächlichen Annäherung an die vollständige Erfüllung des Zieles mit ein. Sobald diese Annäherung unterbrochen wird, hört die Bewegung auf, eine Verbesserung zu sein. Die Erfüllung der Zielorientierung und -bewahrung ist der erstnotwendige, der Übergang zur vollständigen Zielerfüllung der letztmögliche und letzthinreichende Schritt der Annäherung einer jeglichen Verbesserungsbewegung. Eine Verbesserung stellt also nicht deshalb eine „gute“ Entwicklung dar, bloß weil in ihr irgendetwas gesteigert würde, sondern weil „Steigerung“ als eine graduelle Annäherung an die vollständige Erfüllung eines Zieles zu verstehen ist. Und eine graduelle Steigerung im Hinblick auf eine Zielerfüllung kann natürlich auch mit einer für die Erfüllung des Zieles notwendigen Schrumpfung bzw. Reduzierung von etwas einhergehen. Wenn Fortschritt als teleologische Dynamik auf die vollständige Erfüllung eines Zieles abhebt, dann scheint, zumindest auf den ersten Blick, mit Eintreten der Zielerfüllung jede 115 Vgl. Robert Spaemanns Definition von „A-Fortschritten“, ebd. 52 weitere Fortschrittsbewegung ausgeschlossen. Fortschritt wäre so nur im Sinne einer Steigerung des Grades der Zielerfüllung, also allein als Verbesserung denkbar und damit Verbesserung die einzig mögliche Bedeutung von Fortschritt: Ist das Ziel vollständig erreicht, so ist der Fortschritt abgeschlossen, die progressive Dynamik am Ende. Ich teile diesen Gedanken, allerdings nur unter einem entscheidenden Vorbehalt: nämlich allein in Zusammenhang mit der Vorstellung eines Zieles, welches man durch einen abschließend zu erreichenden Zustand erfüllen kann. Nicht aber gilt dies im Verhältnis zu Zielvorstellungen, deren vollständige Erfüllung nicht in einem endgültigen Zustand mündet, sondern nur über einen stetigen Erfüllungsvollzug erreicht werden kann. Zur Veranschaulichung eines solchen Vollzusgszieles kann zum Beispiel die menschliche Atmung dienen. Das im modus conservativus verfolgte Ziel ist eine suffiziente Sauerstoffversorgung des Körpers. Diese lässt sich nicht über einen zu erreichenden Endzustand, sondern nur über eine fortlaufend ausreichende Atmung sicherstellen. Soweit der Körper weder mit zu wenig noch mit zuviel Sauerstoff versorgt wird, kann dieses Ziel in einem modus sufficiens weiterhin erfüllt, nicht aber verbessert bzw. gesteigert werden. Ein solcher Fortgang der Atmung im modus sufficiens ist nichtsdestotrotz dynamischer Natur. Die Atmung, an sich bereits Bewegung, verändert sich im Hinblick auf ihr Ziel erheblich. Atemfrenquenz und -volumen variieren zum Beispiel in Abhängigkeit zur Belastung des Körpers, um diesen jeweils im richtigen Maße mit Sauerstoff zu versorgen. Die suffiziente Atembewegung samt ihrer Veränderungen kann also mit Fug und Recht als eine Dynamik beschrieben werden, die, trotz Erfüllung des gegebenen Zieles, in dieser Erfüllung weder an ein Ende kommt noch eine „Verbesserung“ bedeutet. Damit wäre die Vorstellung einer teleologischen Dynamik gewonnen, welche dem Fortschrittsbegriff eine von „Verbesserung“ abweichende Bedeutung verleihen kann. Eine Dynamik, die sich vor dem Hintergrund der Suffizienzwahrung als eine „gute“ Entwicklung im modus sufficiens beschreiben lässt. Für ein weniger physiologisches Beispiel liegt hier nicht zuletzt der Gedanke an die aristotelische eudaimonia nahe. Sie ist wohl eine der wirkungsmächtigsten philosophischen Konzeptionen eines solchen Vollzugszieles. Und sie steht nicht nur formal, sondern auch inhaltlich in Nähe zu dem hier beschriebenen Fortschritt als ein „Gedeihen“ im modus sufficiens. Die eudaimonia ist für Aristoteles „das vollkommene und selbstgenügsame Gut“, nach dem es im menschlichen Leben zu streben gilt, und in Bezug auf welches andere Ziele nur als Mittel erscheinen können.116 Die eudaimonia ist kein zu erreichender Zustand, sondern wird von Aristoteles als eine „tugendmäßige Tätigkeit der Seele“ bestimmt.117 Deshalb könnte auch 116 Aristoteles: Nikomachische Ethik (Übers. Olof Gigon), Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler, 2001, Seite 25f. 117 Vgl. ebd., Seite 33, 39. 53 selbst derjenige, der sein ganzes bisheriges Leben hindurch vollkommen tugendhaft gelebt hat und mit den notwendigen äußeren Gütern versorgt war, nicht schon glückselig genannt werden. Denn vor ihm liegt eine unabsehbare Zukunft, in der er seine Glückseligkeit erst noch und immer wieder neu erringen muss bzw. immer in der Gefahr schwebt, diese zu verlieren.118 Die eudaimonia, die Glückseligkeit, findet für Aristoteles ihre Verwirklichung nicht grundsätzlich in einem Steigerungsgeschehen. Denn „der wahrhaft Gute und Verständige“ trägt „in guter Haltung jede Art von Schicksal“ und tut „in der gegebenen Lage stets das Beste“. 119 Vollkommene Tugendhaftigkeit ist bei Aristoteles keine „Verbesserung“, sondern das stetige Hervorbringen des „Besten“. Heute das „Beste“ zu tun, ist nicht weniger gut als morgen das „Beste“ zu tun. Der Superlativ ist „das vollkommen Gute“, verstanden als eine die notwendigen äußeren Güter nicht aussparende tugendhafte Tätigkeit, das prakton agathon.120 Dementsprechend müsste die Komparation auch nicht heißen „gut/besser/am besten“, sondern etwa „am wenigsten gut/weniger gut/gut“. „Weniger gut“ ist „besser“ als „am wenigsten gut“, „gut“ ist „am besten“. Die eudaimonia kann also als ein Fortschritt im modus sufficiens verstanden werden. Ein Fortschritt im modus meliorativus ist im Rahmen dieser aristotelischen Konzeption als Einübung und Steigerung tugendhaften Verhaltens bis hin zu jenem vollkommenen Vollzug denkbar. Analog zu der hier getroffenen Unterscheidung zwischen NichtVollzugszielen und Vollzugszielen unterscheidet auch Aristoteles zwischen zweckdienlichen (kinetischen) und selbstzwecklichen (energetischen) Vollzügen.121 Auch wenn sich also ein „Gedeihen“ im modus sufficiens verständlich machen lässt, ist damit letztlich aber noch nicht begründet, warum der Fortschrittsbegriff nicht dennoch auf den modus meliorativus, auf die Vorstellung eines ansteigenden Erfüllungsgrades beschränkt werden sollte. Denn man könnte ja weiterhin dafür argumentieren, mit dem Ausdruck „Fortschritt“ allein Bewegungen im modus meliorativus zu bezeichnen. Anders formuliert: Warum sollte nicht genauso wie das „Gedeihen“ den Umfang des im Fortschrittsbegriff umschlossenen „Wachsens“ einschränkt, das „Wachsen“ den Umfang des im Fortschrittsbegriff enthaltenen „Gedeihens“ einschränken? Warum sollte die begriffliche Einschränkung asymmetrisch ausfallen? Warum sollte „Fortschritt“ nicht ausschließlich als „Verbesserung“ verstanden werden? Das grundlegende Argument für diesen Schritt wird deutlich, wenn man sich die Plausibilität der folgenden Reformulierung des modus meliorativus vor Augen führt: Der modus meliorativus ist ein graduell zu seiner vollständigen Verwirklichung drängender modus sufficiens. Es wird mit dem modus sufficiens also kein völlig neuer 118 Vgl. ebd., Seite 45. Vgl. ebd. Seite 43. 120 Vgl. ebd., Seite 24. 121 Aristoteles: Metaphysik (Übers. Hermann Bonitz), Zweiter Halbband, Buch IX Kapitel 6, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1991, Seite 115ff.; Aristoteles NE (2006), Seite 9. 119 54 Fortschrittsmodus eingeführt, als vielmehr der eigentliche überhaupt erst benannt. Ich habe bereits herausgestellt, dass der modus meliorativus in der Orientierung an einem Ziel dem Anspruch der vollständigen Erfüllung desselben insofern genügt, als dass er einer tatsächlichen Annäherung an diese Erfüllung entspricht. Denn in der Annäherung ist das Erreichen des Zieles mitgedacht, steht die vollkommene Erfüllung mindestens als projizierte am Ende der Bewegung. Sobald die Steigerung des Erfüllungsgrades einer solchen Bewegung unterbrochen wird, hört sie auf, dem Anspruch der vollständigen Erfüllung gerecht zu werden, diesem in ihrer Dynamik zu genügen, hört sie auf, eine Verbesserung zu sein. Eine Verbesserung ist eine teleologische Bewegung, die durch die Steigerung des Erfüllungsgrades der vollständigen Erfüllung eines Zielanspruches gerecht wird. Verbesserung ist also ein Erfüllungsgeschehen. Eine Verbesserung, eine Bewegung im modus meliorativus, kann als eine besondere Form des modus sufficiens bezeichnet werden. Nicht Steigerung steht im Zentrum des Verbesserungsbegriffes, sondern Erfüllung, wenn auch als eine bloß projizierte am Ende des Prozesses. Erfüllung aber ist kein Steigerungsgeschehen. Wenn etwas erfüllt wird, wird es erfüllt, nicht gesteigert. Selbstverständlich kann Erfüllung auf dem Wege einer graduellen Steigerung der Erfüllung erreicht werden. Dann wäre sie mit „Verbesserung“ gleichbedeutend. Genauso ist aber auch ein Erfüllungsgeschehen denkbar, das, soweit die Erfüllung eines Zieles nicht abschließend zu erreichen ist, sich als fortschreitende vollständige oder vollkommene Erfüllung im modus sufficiens darstellt. Wenn es im Kern also gar nicht um Verbesserung geht, sondern diese vielmehr als eine Variante einer auf „vollständige Erfüllung des Zielanspruches“ gerichteten Bewegung zu verstehen ist, dann erscheint der modus sufficiens als die grundsätzliche Bewegungsform von Fortschritt. Dieser kann sich entweder in vollkommener oder aber verzögerter Ausprägung manifestieren. Der modus meliorativus ist, wenn man so will, ein dilatorischer modus sufficiens. 3 Vollkommenheit als Ziel des Fortschritts? – zu Aristoteles Dass der modus sufficiens bisher in der Fortschrittsdiskussion keine begriffsbildende Beachtung findet, drückt sich unter anderem darin aus, dass die antike Philosophie, anders als die mit der jüdisch-christlichen Tradition verschmolzene Philosophie, in der grundlegenden Diskussion des Fortschrittsbegriffs keine Rolle spielt. So schreibt etwa Christian Meier in seiner Übersicht über den „‘Fortschritt’ in der Antike“, dass sich in der Antike nie ein eigentlicher Fortschrittsbegriff gebildet habe, „mindestens in der heidnischen Antike hat man nie gemeint, daß die gesellschaftlichen und ethischen Bedingungen sich prozessual verbesserten, ja daß die Geschichte in einem umfassenden 55 Veränderungsprozeß bestehe“. 122 Ähnlich vertitt auch Friedrich Rapp in seiner Untersuchung über Entwicklung und Sinngehalt der Fortschrittsidee die Ansicht, dass es „für die unbedingte Fortschrittserwartung der Moderne [...] in der Antke kein Gegenstück“ gibt.123 Diese Diagnose ist insoweit nachvollziehbar, als die genannten Autoren, und wohl die meisten mit ihnen, von dem sich spätestens seit dem achtzehnten Jahrhundert durchsetzenden, zunächst mit einem grundsätzlichen Optimismus verbundenen Verständnis von „Fortschritt“ als „universales Verbesserungsgeschehen“ ausgehen. Diese begriffliche Reduzierung vor Augen, ist es nur verständlich, dass Fortschritt zwar als Säkularisierung der mit Augustinus einsetzenden systematischen theologischen Deutung der Geschichte im Sinne eines auf ein erst noch zu erreichendes Heil bezogenen Geschehens verstanden werden kann, nicht aber als eine Modifizierung der der Antike für gewöhnlich zugeschriebenen Vorstellung von der Geschichte als „Wiederkehr des Gleichen“.124 Letztere scheint hingegen viel eher mit dem modus sufficiens vereinbar, insofern dieser als stetiges Hervorbringen des gleichen Sachverhalts interpretiert werden kann. Solange „Fortschritt“ ausschließlich als „Verbesserung“ verstanden wird, können antike Konzepte wie zum Beispiel die aristotelische eudaimonia im Rahmen einer grundlegenden Analyse des Fortschrittsbegriffes keine positive Bedeutung gewinnen. Wenn aber, wie dargelegt, der modus sufficiens, sei es in seiner vollkommenen oder dilatorischen Form, als der eigentliche Modus des Fortschritts angesehen wird, dann ist damit die Möglichkeit eröffnet, aus diesem Grund bisher ausgeklammerte Bezüge in die Fortschrittsdiskussion mit einzubeziehen. Dies gilt, wie am Beispiel der aristotelischen eudaimonia deutlich geworden, auch im Hinblick auf die Philosophie der Antike. Ein anderer mit dem Verständnis von Fortschritt als „universales Verbesserungsgeschehen“ in Zusammenhang stehender Grund für die bisherige Vernachlässigung der antiken Philosophie besteht darin, dass die auch in der Antike vorhandenen Vorstellungen von meliorativen Entwicklungen nicht universell genug gedacht wurden, um in die Nähe des modernen Fortschrittsbegriffes zu kommen. In diesem Sinne schreibt Christian Meier: „Subjekte wie Bereiche dieses Fortschreitens sind in der Regel partiell, die zeitlichen Dimensionen eng begrenzt.“125 Und Friedrich Rapp 122 Meier, Christian: „‘Fortschritt’ in der Antike“, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Band 2, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1975, Seite 353f. 123 Vgl. Rapp, Friedrich: Fortschritt – Entwicklung und Sinn einer Philosophischen Idee, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, Seite 108. 124 Als paradigmatische Ausformulierung des Gedankens, den Fortschrittsbegriff als Säkularisierung der jüdisch-christlichen Heilsvorstellung zu verstehen, kann Karl Löwiths Weltgeschichte und Heilsgeschehen gelten. Dort stellt auch er der linearen Geschichtsvorstellung des Mittelalters und der Moderne die zirkuläre der Antike gegenüber; vgl. Löwith, Karl: Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart: Kohlhammer, 1973; vgl. auch Rapp ( 1992), Seite 104ff. 125 Meier, Christian (1975), Seite 353. 56 führt aus: „Doch dieses partielle und eher zufällige Fortschrittsverständnis darf nicht überinterpretiert werden. Es unterscheidet sich sowohl von der konkreten Einlösung als auch von den theoretischen Hintergrundvortellungen her grundsätzlich von den systematischen und weitreichenden Fortschrittserfahrungen in allen Lebensbereichen, wie sie für die Moderne charakteristisch sind.“126 Auch dieser Aspekt erscheint in einem anderen Licht, wenn der modus sufficiens als der grundlegende Modus von Fortschritt in den Blick kommt. Wenn auch die antiken Vorstellungen von „Verbesserungen“ nur „partiell“ und „zufällig“ erscheinen mögen, so gilt dies zum Beispiel wiederum nicht für die aristotelische Vorstellung einer „guten Entwicklung“ im modus sufficiens. Denn bei Aristoteles lässt sich eine nicht „zufällige“, sondern systematische Vorstellung eines nicht „partiellen“, sondern universellen Fortschritts im modus sufficiens ausmachen. In aller Kürze127: Aristoteles legt der gesamten Natur, dem gesamten Kosmos das Prinzp der Entelechie zugrunde, nicht als singuläre Zielstrebigkeit der einen Natur, sondern als sämtlichem individuellen Strebensprozessen in der Natur zukommender Drang zur vollkommenen Verwirklichung wesenhafter Anlagen. Trotz ihrer Indiviualität und Diversität treffen sich die unzähligen Strebensprozesse in ihrem Drang nach Vervollkommnung, in ihrer Ausrichtung auf Vollkommenheit. Diese Vollkommenheit, auf die jegliches individuelle Streben gerichtet ist, ist keine Vorstellung oder andersartige Vorwegnahme der jeweiligen individuellen Vollkommnheit, sondern eine vollkommene Wirklichkeit, die Gottheit, der unbewegte Beweger. Die Gottheit „zieht“ in ihrer Vollkommenheit „wie ein Geliebtes“ alles Seiende, oder besser, Werdende zu sich hin und so in seine jeweilige wesenhafte Vervollkommnung.128 Nach Aristoteles kommt jedem Streben die seinem Wesen entsprechene Vervollkommnung zunächst nur als Potentialität (dynamei) zu. Ihre Verwirklichung (entelechie/energeia) ist offen. Die Verwirklichung der Potentialität, die entelechie, kann nun im obigen Sinne als ein Erfüllungsgeschehen verstanden werden. Sie ist die Erfüllung jeweiliger Wesenheit. Was sich hier abzeichnet, ist ein zumindest denkbarer universeller Fortschritt als synchrone und asynchrone Vervollkommnung sämtlichen individuellen Strebens im modus sufficiens. Wolfgang Welsch schreibt: „Wenn man so will, hat Aristoteles die bei Platon auf den Mensch beschränkte homoiosis theo (Platon, Theatet 176 b 1 f.) ontologisch universalisiert.“129 Die homoiosis theo, „die Verähnlichung mit Gott [...], daß man gerecht und fromm sei mit Einsicht. [...] Gott ist niemals auf keine Weise ungerecht, sondern im höchsten Sinne 126 Rapp, Friedrich (1992), Seite 108. Zum ausführlicheren Nachvollzug der folgenden Kurzdarstellung verweise ich neben der Lektüre der Primärtexte, vor allem Physik Bücher II, VII und VIII sowie Metaphysik, Buch XII, auf Weischedel, Wilhelm: Der Gott der Philosophen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, Seite 45-59; Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Die Naturphilosophie des Aristoteles, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 1980; und Welsch, Wolfgang: Der Philosoph. Die Gedankenwelt des Aristoteles, München: Wilhelm Fink Verlag, 2012, Kapitel IV und VI. 128 Vgl. Aristoteles ME (1991), Zweiter Halbband, Buch XII, 1072 b 3, Seite 255. 129 Welsch (2012), Seite 271, Fn. 78. 127 57 vollkommen gerecht, und nichts ist ihm ähnlicher, als wer unter uns ebenfalls der Gerechteste ist. Und hierauf geht auch die wahre Meisterschaft eines Mannes, so wie seine Nichtigkeit und Unmännlichkeit. Denn die Erkenntnis hiervon ist wahre Weisheit und Tugend, und die Unwissenheit hierin offenbare Torheit und Schlechtigkeit“. 130 Die platonische homoiosis theo wird bei Aristoteles als eudaimonia zur anthropologischen Spezifizierung des universal anwendbaren entelechischen Begriffs der Vervollkommnung. Bei Aristoteles kann sich nicht mehr nur der Mensch „gut entwickeln“, sondern alles, aber auch alles, was sich im Kosmos überhaupt entwickelt. Universaler geht es wohl nicht. Nur bedeutet diese Vorstellung einer universalen Vervollkommnung nicht unbedingt eine „universale Verbesserung“. Zwar ist auch im Rahmen dieses Begriffes eines „universalen Fortschritts“ eine „universale Verbesserung“ denkbar. Solange sich mindestens einer der individuellen Vervollkommnungsprozesse im modus meliorativus vollzieht, ohne dass diese Verbesserung in der Aggregation sämtlicher Prozesse durch anderweitige Rückschritte aufgehoben würde, hätten wir es es mit einer „universalen Verbesserung“ zu tun. Aber die Potentialität universaler Verbesserung bleibt endlich. Sie endet in dem Moment, in dem sich sämtliche Strebensprozesse gemäß ihres jeweiligen Wesens vollkommen entwickeln, ohne dass deshalb die individuellen Entwicklungen oder die universale Entwicklung als Aggregat der individuellen Prozesse an ein Ende gekommen sein müssten. Der Maximalbegriff des Fortschritts, einer „guten Entwicklung“, wäre diese vollkommene Entwicklung sämtlicher im Kosmos enthaltener Strebensprozesse im modus sufficiens. Besser ginge es nicht. Die Philosophie Aristoteles eröffnet dabei auch einen Ausblick darauf, wie es möglich ist, an der Universalisierbarkeit des Fortschrittsbegriffes festzuhalten, ohne in das Zwielicht der Ambivalenz zu treten. Weil Aristoteles die Vervollkommnung primär in individueller Entwickung sucht, lässt sich auch im Kontext einer synchrone und asynchrone Rückschritte aufweisenden Gesamtwirklichkeit widerspruchsfrei von Fortschritt bzw. Fortschritten sprechen. Dass Aristoteles zumindest für den Menschen als zoon politikon die Verwirklichung dieser Vervollkommnung unausweichlich an ein staatliches Gemeinwesen rückgebunden sieht, bedeutet hier keinen Widerspruch. Denn der Staat erhält seine Bedeutung wiederum nur im Hinblick auf die durch ihn und in ihm zu erreichende Vollkommenheit des Einzelnen, bestenfalls jedes Einzelnen.131 Der Staat hat keine vom Zusammenspiel der individuellen Vollkommenheitsbestrebungen unabhängige Wirklichkeit. Und die Individuen streben ihrerseits nach einem Staat nur, insoweit es zu ihrer wesenhaften Natur gehört, ihre individuelle Vollkommenheit in staatlicher Gemeinschaft zu erlangen. Die Wirklichkeit einer über die individuellen Entwicklungen 130 Platon: Theaitetos, in: ders.: Werke, Band 6, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990, Seite 107. 131 Vgl. Welsch (2012), Seite 310. 58 hinausgehenden universalen Vervollkommnung wird so niemals unabhängig von ersteren veranschlagt werden können und kann deshalb nicht in Widerspruch zu diesen stehen. Universaler Fortschritt wird vor diesem Hintergrund nicht als substantielle, sondern als eine von individuellen Wirklichkeiten abhängige aggregative Eigenschaft der Gesamtwirklichkeit verstanden. Wenn es die individuellen Prozesse ihrer Wirklichkeit und ihrem Zusammenspiel nach nicht hergeben, dann findet eben kein universaler Fortschritt statt. Seine Potentialität bleibt nichtsdestotrotz widerspruchsfrei denkbar. Wenn Friedrich Rapp im Zitat Christian Meiers mit diesem darüber übereinstimmt, dass der antike Fortschrittsgedanke nichts über die Zeit im Ganzen besage und dementsprechend verschiedenste Veränderungen zum Guten und zum Schlechten nebeneinander wahrgenommen werden könnten, ohne dass dies einen Widerspruch bedeuten würde, dann trifft diese Aussage in etwa – aber eben nicht genau – den soeben beschriebenen Zusammenhang.132 Denn im Kontext des hier entwickelten „aristotelischen“ Fortschrittsverständnisses sind sehr wohl Aussagen über die Zeit, und den Raum, im Ganzen möglich. Werden Veränderungen zum Guten von Veränderungen zum Schlechten überwogen, so lässt sich daraus ableiten, dass eine so beschaffene Wirklichkeit im Ganzen eben keinen Fortschritt verzeichnet. Das aber heißt weder, dass ein universeller Fortschritt unmöglich wäre, noch, dass „die Antike“ keine Ansatzpunkte für die Vorstellung eines solchen bereithielte. Und dieses „aristotelische“ Fortschrittsverständnis scheint mir schließlich auch in keinem grundsätzlichen Widerspruch zu der begriffslogischen Analyse und Kritik zu stehen, die Friedrich Rapp in dieser Hinsicht für den modernen Fortschrittsbegriff liefert: „Der ganzheitlich betrachtete Geschichtsprozeß ist anders strukturiert als das zielgerichtete Tun der wertenden, wollenden und handelnden Person. Das Zusammenspiel der unkoordinierten und oft sogar gegenläufigen Umstände, Tendenzen, Absichten und Maßnahmen läßt sich nur im metaphorischen Sinne einem Geschichtssubjekt zuschreiben.133 [...] Doch es entsteht ein falsches Bild, wenn man dem subjektiven Streben der Individuen bzw. des Kollektivs eine objektive Erfolgsgarantie unterlegt, d.h. wenn man den Fortschrittsgedanken verdinglicht und ihm eine eigenständige, automatische Wirksamkeit zubilligt. Hier gilt die treffende Bemerkung, die sich in Kants handschriftlichem Nachlaß fand (HN, 172): ‘Der Moralische Wahn besteht darin, daß man die Meinung von einer möglichen moralischen Vollkommenheit vor eine solche wirklich hält.’“ 134 Man sollte zwischen der substantiellen Partialität und der aggregativen Universalität des Fortschrittsbegriffs unterscheiden. 132 Vgl. Rapp (1992), Seite 108. Ebd., Seite 48. 134 Rapp (1992), Seite 59. 133 59 4 „Befriedigung“ als Ziel des Fortschritts Von Aristoteles zu Hegel, ... Es ist aber nicht so, dass sich die Relevanz der antiken Philosophie für das Fortschrittsdenken vor dem Hintergrund der oben entwickelten Modifizierungen nun erst im Nachhineien ergeben würde. Vielmehr kann gezeigt werden, dass sie für die moderne Fortschrittsdiskussion immer schon ein entscheidender Gesprächspartner war. Dies gilt zum Beispiel für die Philosophie Hegels, einem der profiliertesten Protagonisten der modernen Fortschrittsdiskussion. Folgt man Terry Pinkard, der wiederum als einer der wichtigsten zeitgenössischen Hegel-Interpreten gelten kann, so ist Hegels Philosophie sogar als ein „Disenchanted Aristotelian Naturalism“ zu verstehen, ein entzauberter aristotelischer Naturalismus.135 Aus zwei Gründen werde ich im Folgenden genauer auf Pinkards Hegel-Interpretation eingehen: Zum einen, weil sie an einem konkreten Beispiel deutlich macht, dass eine vorschnelle und oberflächliche Gleichsetzung von „Fortschritt“ und „universaler Verbesserung“ nicht nur, wie gezeigt, in systematischer, sondern möglicherweise auch in begriffsgeschichtlicher Hinsicht unhaltbar ist. Setzt man den modernen Fortschrittsbegriff (als wenn es den einen Fortschrittsbegriff gäbe) in undifferenzierter Weise mit dem einer „universalen Verbesserung“ gleich, so verliert man den Blick für das kritische Potential gegenüber einer solchen Gleichsetzung und die damit verbundene Aktualität, die in der modernen Fortschrittsdiskussion selbst liegen. 136 In diesem Zusammenhang steht denn auch der zweite Grund für eine genauere Auseinandersetzung mit Pinkards Verständnis der hegelschen Philosophie. Denn Pinkard geht es ja nicht primär darum, der langen Reihe von Hegel-Interpretationen bloß eine weitere, neuartige hinzuzufügen. Sondern es geht ihm darum, aus der hegelschen Philosophie Grundlagen für ein aktuelles Verständnis unseres Menschseins zu gewinnen, das im Einklang mit der zeitgenössischen Wissenschaft steht und uns bei der Orientierung unseres Lebensvollzuges behilflich sein kann. Auch wenn Pinkard seine Auseinandersetzung mit Hegel selbst nicht, zumindest nicht explizit, als Beitrag zur Fortschrittsdiskussion formuliert, so wird deutlich werden, dass sie als ein solcher verstanden werden kann. Genausowenig wie Pinkard strebe ich nach so etwas wie einer „Rehabilitierung“ der aristotelischen oder hegelschen Philosophie. Es ist mir an einer kritischen Wiederaufnahme der Fortschrittsdiskussion gelegen. Dabei bietet Pinkards 135 Vgl. Pinkard, Terry: Hegel´s Naturalism – Mind, Nature, and the final Ends of life, New York: Oxford University Press, 2012, Seite 17. 136 Diesem Anliegen folgt auch Johannes Rohbeck in seiner Wiederaufnahme geschichtsphilosophischer Diskussionen; Rohbeck, Johannes: Aufklärung und Geschichte – Über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft, Berlin: Akademie Verlag, 2010, Seite 32ff. 60 Auseinandersetzung mit „Hegels Aristotelismus“ einen guten Ansatzpunkt, mit dem oben modifizierten Fortschrittsbegriff in der zeitgenössischen Philosophie anzuknüpfen. Auch wenn Pinkard den Ausdruck „Disenchanted Aristotelian Naturalism“ explizit nur als Überschrift des ersten Kapitels in Hegel´s Naturalism gebraucht, verbirgt sich dahinter ein Gedanke, der sich durch das gesamte Buch zieht. Die „Entzauberung“ besteht nach Pinkard darin, dass Hegel die aristotelische Philosophie von dem Gedanken einer „teleologically and devinely ordered nature“ befreit hat.137 Wir erinnern uns an Aristoteles Vorstellung eines Kosmos, in welchem alles Streben in seiner Erfüllung auf die Gottheit, den unbewegten Beweger hin ausgerichtet ist. Hegel hat nun, folgt man Pinkard, den Kosmos von dieser Gottheit befreit, dessen Wirklichkeit Aristoteles als „Denken des Denkens“138, als ein selbstbezogenes Denken konzipierte. Die Gottheit ist in ihrer ewigen Selbstgenügsamkeit vollkommen erfüllt und der Zielpunkt sämtlichen Strebens, das sich nach dieser selbstgenügsamen Vollkommenheit „sehnt“. 139 Aus der aristotelischen eudaimonia, als die der menschlichen Natur entsprechende Variante dieser ersehnten Vollkommenheit, sei, so Pinkard, bei Hegel die „Befriedigung“ geworden.140 Zu Hegels Begriff des „guten Lebens“ schreibt er: „It would be life of Befriedigung, satisfaction, success in living a good life. Although such a social world may lack the warmth of the Greek direct democracy, it nonetheless has a kind of fragile nobility that Greek life lacked: It is a world in which faith in the organic unity of the people and the whole cannot not be present and in which whatever unity there is must instead be held in place by each thinking of himself or herself as both sovereign and subject of the whole. It is, that is, a world where the ‘concept’ – reason itself – and not the organic per se is authoritative.“141 Bei Aristoteles lag die Antwort auf die Frage nach dem „guten Leben“ noch in der Souveränität einer göttlich geordneten, unveränderlichen Natur. Die subjektive Suche nach dem „guten Leben“ konnte ihre Erfüllung nur in einer dieser objektiven Ordnung entsprechenden Lebensführung finden. Hegel aber verstand die Vorstellung einer solchen göttlichen Ordnung als eine Projektion des menschlichen Denkens. In dieser Projektion verkennt das Denken, dass es selbst Urheber und insofern Souverän dieser Ordnung und der mit dieser verbundenen Vorstellung von einem „guten Leben“ ist. Die Natur „an sich“ hat kein Ziel, auf das hin die Frage nach einem „guten Leben“ eine Antwort finden könnte. Und das gilt nicht allein für das menschliche Leben: „However, even at the level of organic life, the stage of natural development at which the terms better and worse begin to become meaningful, nature remains impotent since nature on its own can not organize itself into something like the best version of a lion, a rose, or a trout, much less organize 137 Pinkard (2012), Seite 129. Vgl. Aristoteles Metaphysik (1991), Buch XII Kapitel 9, Seite 269. 139 Vgl. Welsch (2012), Seite 266f. 140 Vgl. Pinkard (2012), Seite 94. 141 Ebd., Seite 145. 138 61 itself as a whole into a better whole. As a whole, nature aims at nothing, even if there are some creatures in the natural order that do aim at some things.“142 Schon einfachen Organismen unterliegende Prozesse weisen in ihrer Ausrichtung auf Erhaltung und Reproduktion eine sehr rudimentäre Form von Normativität auf und können dem Gebrauch von Ausdrücken wie „gute Entwicklung“, „besser“ und „schlechter“ einen Sinn verleihen.143 Darüber hinaus bekommt auch die Rede von „Gründen“ vor dem Hintergrund der hier angesprochenen Normativität einen Gehalt. Die Ausrichtung auf Erhaltung und Reproduktion stellt für den jeweiligen Organismus in konkreten Situation einen Grund dar, etwas zu tun oder zu unterlassen – etwa für einen Hasen angesichts eines über ihm kreisenden Raubvogels im nächsten Gebüsch Schutz zu suchen. Dass der Hase diesen Begründungszusammenhang unserer Annahme nach nicht reflektiert, bedeutet hier keinen Widerspruch. Gründe müssen als solche nicht gewusst werden, um wirklich bzw. wirksam zu sein. Und schließlich gibt noch jeder Einzeller in seiner nicht durch die äußere Natur erklärbaren Ausrichtung auf Erhaltung und Reproduktion, in dieser inneren „Zentriertheit“ oder „Innerlichkeit“, auch dem Ausdruck „Subjekt“ eine über den logischgrammatikalischen Sinn hinausgehende, tiefere Bedeutung.144 Mit Hegel unterscheidet Pinkard zwischen zwei Stufen dieser Innerlichkeit.145 Auf der ersten Stufe besteht die Innerlichkeit in einem „bloßen“, auch für Tiere und einfachere Organismen geltenden selbstbezüglichen Verhalten. Die Selbstbezüglichkeit des Verhaltens besteht in der durch die äußere Natur nicht erklärbaren Zielgerichtetheit des Verhaltens. Der Organismus verhält sich zu seinen ihm eigenen Zielen. Auf der zweiten Stufe wird diese Innerlichkeit dadurch kompliziert, dass sie in sich selbst reflektiert wird. Bedeutet die erste Stufe ein „bloßes“ selbstbezügliches Verhalten, so bedeutet die zweite Stufe ein selbstbezügliches Verhalten, das sein selbstbezügliches Verhalten selbst reflektiert. Diese zweite, dem Menschen eigentümliche Stufe der Innerlichkeit, die „inwardness as inwardness“ wie Pinkard auch sagt, ist dabei nicht im Sinne einer substantiellen Unterscheidung zwischen nicht-menschlicher und menschlicher Natur zu verstehen, sondern eher als ein gradueller Unterschied der Selbstbezüglichkeit von Organismen.146 Davon unberührt bleibt die Feststellung, dass dieser graduelle Unterschied der Selbstbezüglichkeit mit enorm unterschiedlichen Verhaltensweisen der jeweiligen Organismen einhergeht. Ein Lebewesen, das sein eigenes zielgerichtetes Verhalten reflektiert, löst sich in der Reflexion seiner Ziele als Ziele aus einem eher dispositional zu charakterisierenden Verhalten. Es kann nicht nur darüber reflektieren, auf welchen Wegen 142 Ebd., Seite 22f. Vgl. ebd., Seite 17ff. 144 Hegel benutzt den Ausdruck „Zentrum“, vgl. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, in ders.: Werke 9, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986, § 350-352, Seite 430ff.; ähnlich spricht Teilhard de Chardin von der „Zentriertheit“ oder „Zentro-Komplexität“, vgl. Teilhard de Chardin, Pierre: Die Entstehung des Menschen, München: C. H. Beck, 2006, Seite 20. 145 Pinkard (2012), Seite 17ff. 146 Ebd., Seite 27ff. 143 62 ein bestimmtes Ziel erreicht werden kann und welchen dieser Wege es einzuschlagen gilt, weil er die größte Aussicht auf Erfolg verspricht. Sondern es kann auch darüber reflektieren, wie es sein würde, andere Ziele zu verfolgen, und welche es letztendlich verfolgen will und aus welchen Gründen. Damit wird der Spielraum möglichen Verhaltens immens erweitert. Die vorgestellte zweistufige Differenzierung ist mit den evolutionstheoretischen Argumentationsmustern der Naturwissenschaft kompatibel. Der Entwicklungsgedanke sollte dabei aber nicht nur auf den Übergang von der ersten zur zweiten Stufe der Innerlichkeit bzw. Subjektivität bezogen werden, sondern er behält seine Relevanz auch auf den jeweiligen Stufenniveaus. Bei Hegel wird die aristotelische Vorstellung einer göttlich geordneten Natur zur Episode eines geschichtlichen Prozesses, in dem sich das menschliche Leben in sozialer Reziprozität auf immer neue Weise formuliert. Dabei werden die natürlichen Anlagen des Menschen nicht überwunden, aber sie besitzen eine gewisse Plastizität, können in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedlich figurieren, unterschiedliche Rollen oder Funktionen ausfüllen. Diese Gestaltungen können sich in ihrem Zusammenspiel stabilisieren und sich so zu einer „Lebensform“ fügen bzw. ordnen. Eine solche Lebensform konkretisiert in ihrer Ordnung, was es heißt, ein „gutes Leben“ zu führen: eben eine den Ordnungsvorstellungen dieser Lebensform gemäße Lebensführung. Aber so träge eine Lebensform auch sein mag, so sehr sie sich auch als „zweite Natur“ in den Prozess des menschlichen Lebens einschreiben mag, sie bleibt nicht unveränderlich. Wenn Hegel von der Gestaltlosigkeit der Zukunft spricht, dann meint er damit die Offenheit, in die hinein sich die von der Vergangenheit geprägte Gegenwart gestaltet.147 Der historische Prozess ist bei Hegel nicht bloß eine sequentielle Abfolge unzähliger Ereignisse und verschiedener Lebensformen. Die Geschichte ist vielmehr der „Raum“, in dem „das Denken“ auf die von ihm selbst geprägten Lebensvollzüge und insofern auf sich selbst trifft. Jeder Tag konfrontiert uns neu mit den Lebensgestaltungen vergangener Tage. Die Vergangenheit bleibt so immer im doppelten Sinne in der Gegenwart aufgehoben. Und dies nicht allein effektiv, sondern auch reflexiv. Das Denken dringt allmählich zu dem Punkt vor, an dem es sich als Autor der das menschliche Leben und die Geschichte prägenden Ordnungsvorstellungen erkennt. Es wird sich seiner selbst bewusst, es denkt sich selbst. Das von Aristoteles auf eine äußere Gottheit projizierte Sich-selbst-Denken wird bei Hegel vom Denken in sich selbst zurückgeholt. Denken aber ist eine Tätigkeit endlicher Subjekte, so auch das Sich-selbst-Denken des Denkens. Endliches Denken kann keine absolute Souveränität besitzen. Jedes endliche Subjekt bleibt in seinem Denkvollzug von „erster“ und „zweiter“ Natur, von natürlichen und erworbenen Verhaltensdispositionen sowie von äußeren natürlichen und sozialen Anforderungen 147 Vgl. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: ders.: Werke, Band 18, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979, Seite 501. 63 beeinflusst und ist in diesem Zusammenhang weder autonom, geschweige denn selbstgenügsam oder vollkommen. 148 Aber das endliche Denken weiß in seinem Selbstbewusstsein um seinen, wenn auch verschwindend geringen, Anteil an der Entwicklung des Ganzen.149 Es erkennt sich in seiner Teilhabe am „absoluten Geist“ als der von den Individuen in ihrem Zusammenspiel hervorgebrachte, Zeiten und Räume überspannende Prozess des in den Formen des Lebens sich entäußernden, diese wieder in sich aufnehmenden und umgestaltenden Denkens. So weiß sich das endliche Individuum in diesem partialen Sinne als „sovereign and subject of the whole“. Darin liegt für Pinkard die „nobility“ des modernen Selbstbewusstseins, wenn man so will, seine wahrhafte Charakterstärke. Sie vermag es, die in die griechischen Ruinen dringende Kälte tapfer zu tragen. Die Kälte speist sich letztlich aus der Erkenntnis, dass die dem menschlichen Leben Orientierung gebenden Ordnungsvorstellungen und die aus ihnen erwachsenden formellen und informellen Institutionen keine unbedingte Geltung beanspruchen können. Es gibt keine „absolute“, d.h. vom Denken unabhängige Orientierungsmöglichkeit wie sie im Hinblick auf die aristotelische Naturordnung thematisch wird. Zwar stehen die Lebensformen der endlichen Subjektivität als objektive gegenüber. Sie besitzen jedoch nur insoweit Objektivität, als sie der Macht – wenn auch nicht dem Einfluss – der einzelnen endlichen Individuen entzogen sind, nicht aber als unabhängig vom Denken überhaupt Bestehende. Trotz seiner Machtlosigkeit erkennt das endliche Selbstbewusstsein die Lebensformen als Emanationen des übergreifenden Denkprozesses, des „absoluten Geistes“. Und insofern der „absolute Geist“, aus dem die Lebensformen fließen, nicht ohne das individuelle, endliche Denken denkbar ist, insofern das Individuum also Teil hat an jenem „Absoluten“, versteht es sich als Souverän, als nicht an die Ordnungen Gebundenes, sondern diese Gründendes. Darin liegt der „Eigensinn“ der Menschen begründet, der nach Hegel darin besteht, „nichts in der Gesinnung anzuerkennen zu wollen, was nicht durch den Gedanken gerechtfertigt ist [...].“150 Diese Rechtfertigung geschieht für Hegel im Zuge reflexiver Aneignung, „denn erst im Denken bin ich bei mir, erst das Begreifen ist das Durchbohren des Gegenstandes, der nicht mehr mir gegenübersteht und dem ich das Eigene genommen habe, das er für sich gegen mich hatte.“151 Das Denken ist die „unbedingte“ Instanz, insofern es sich selbst der Grund ist, etwas zu wollen. Das endliche Selbstbewusstsein stellt sich so als zwischen den Extremen der Souveränität und der Machtlosigkeit oszillierend dar. Seine dieser Oszillation entsprechende Wirklichkeit liegt dazwischen: Es gründet nicht, sondern 148 Vgl. Pinkard (2012), Seite 101. Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes, in: ders.: Werke, Band 3, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970, Seite 67. 150 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: ders.: Werke, Band 7, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986, Seite 27; vgl. Pinkard (2012), Seite 173ff. 151 Hegel (1986), Seite 47; vgl. Pinkard (2012), Seite 30ff. 149 64 modifiziert, es wird nicht gezwungen, sondern erkennt an. Was auf den ersten Blick als eine zum Zerreißen bestimmte Spannung erscheint, in der das endliche Selbstbewusstsein dazu gedrängt wird, sich auf einer Seite der beiden sich gegenseitig ausschließenden Extreme zu verorten, wird im „wahren“ Selbstbewusstsein in der Erkenntnis des eigenen Wesens aufgehoben, das sich weder als absolut souverän noch absolut machtlos erkennt. Vielmehr kann es sich als, wenn auch verschwindend geringen, Teil des Ganzen und so sein Leben in einem über es hinausgehenden Sinnzusammenhang verstehen. Pinkard fasst zusammen: „[...] that means learning to live by breathing rather thin air or, as Hegel himself concluded his preface to his 1807 Phenomenology, it means acknowledging that ‘the share in the total work of spirit which falls to the activity of any individual can only be very small.’ This self-reflection on the part of natural creatures is the final end of the world, at least in the sense that there is no further purpose outside of that purpose itself and that such a purpose is, or can become, intellegible to itself. Hegel´s claim is not that the world was designed in any way to achieve that goal, nor is it a claim that we create the sense of the world (as if we could do that in any such way we pleased). The meaning that we are to find in the world has to do with the facts of our being the primates we are, and also we can sublate some of those facts – we can circumscribe their authority – we cannot ignore them. We are the creatures for whom our existence is a problem, and in becoming self-conscious, we institute a space of reasons that we ourselves do not then control.“152 Warum Pinkard zufolge die beschriebene Selbstreflexion als Endzweck der Welt, oder vielleicht besser, als Endzweck unseres Lebens in der Welt gelten kann, erschließt sich nur dann, wenn man jene Reflexion in Verbindung zu der Vorstellung eines „befriedigenden Lebens“ setzt, die Pinkard als hegelsche Wendung der aristotelischen eudaimonia interpretiert.153 Jene Selbstreflexion schützt uns in der Oszillation zwischen Souveränität und Machtlosigkeit davor, in der Fixierung auf einen der beiden Pole, wenn man so will, manisch bzw. depressiv oder im ständigen Hin-und-her-Springen zwischen den Polen manisch-depressiv zu werden. Es ist dieser Zusammenhang, in dem Hegel für Pinkard weniger als „the alleged philosopher of totality“ erscheint, denn als „philosophical therapist trying to inoculate us against the temptations toward wholeness in a sphere (the finite) where it cannot be found“.154 In der Selbstreflexion erkennen wir unser endliches Leben als eine zwischen Souveränität und Machtlosigkeit gespannte Oszillation. Eine Spannung, die sich auch im Zusammenhang des politischen Status widerspiegelt, der dem menschlichen Individuum vor dem Hintergrund dieser Selbstreflexion in modernen Staaten zugesprochen wird. Auf der einen Seite wird jedes Individuum als freies, selbstbestimmtes 152 Pinkard (2012), Seite 191. Vgl. ebd., Seite 191f.; Pinkard selber spricht an dieser Stelle nicht mehr von „Befriedigung“, sondern von „successful lives“, meint damit aber, soweit ich sehe, das Gleiche. 154 Ebd., Seite 175. 153 65 Subjekt anerkannt. Auf der anderen Seite ist dieser politische Status der individuellen Autonomie abhängig von der Anerkennung durch andere. Im Akt der politischen Anerkennung individueller Autonomie wird diese sogleich und unvermeidbar relativiert. Diese Spannung zieht sich durch sämtliche Zusammenhänge des menschlichen Lebens. Das moderne, sich selbst reflektierende Subjekt nimmt sich stets als seine Ziele selbst setzendes und verfolgendes Individuum wahr, zum anderen aber auch in seiner unüberwindbaren Abhängigkeit von anderem und anderen. Diese Spannung bedeutet keinen Widerspruch. Ein solcher entsteht nur dann, wenn Autonomie und Abhängigkeit absolut gesetzt werden. Nur für ein Subjekt, das Autonomie absolut versteht, muss diese mit der Abhängigkeit von anderem und anderen in einen Widerspruch geraten. Nur für ein Subjekt, das Abhängigkeit absolut versteht, ist diese mit jeglichem Gedanken von Autonomie unvereinbar. Solange wir die sich zwischen Souveränität und Machtlosigkeit liegende Spannung nicht als natürliche Eigenschaft unseres Lebens verstehen, werden wir dazu neigen, uns selbst fremd zu sein, uns in unserem Leben nicht beheimatet zu fühlen. Wir werden immer wieder versuchen, diese Entzweiung von unserem Leben in der Auflösung dieser Spannung zu suchen. Dies wäre nur dadurch möglich, wenn wir uns auf eine Seite der beiden widersprüchlichen Pole von absoluter Autonomie und absoluter Abhängigkeit schlagen könnten. Die extremen Positionen in der Debatte um die Freiheit bzw. Determiniertheit des menschlichen Willens können durchaus als reflexive Versuche einer solchen Spannungslösung verstanden werden. Aber für uns Lebewesen, die weder absolut frei noch absolut determiniert sind, wird dadurch nichts gewonnen. Vielmehr entfernen wir uns durch solcherlei Extrempositionen noch weiter von uns selbst. Ein „befriedigendes Leben“ ist auf diesem Wege nicht zu erreichen. Die einzige Lösung, folgt man Pinkards Hegel-Interpretation, liegt darin, unser Leben gerade als die zwischen Souveränität und Machtlosigkeit liegende Spannung zu begreifen, anstatt diese Spannung überwinden zu wollen. In einem Leben, in dem wir immer wieder und unausweichlich der Situation ausgesetzt sind, etwas zu wollen, das nicht nur von anderem und anderen abhängig ist, sondern häufig auch verhindert wird, oder etwas zu tun, das nicht unserem eigenen Willen entspricht, sondern zu dem wir uns von anderem und anderen gedrängt sehen, besteht die einzige Aussicht auf ein „befriedigendes Leben“ darin, diese Spannung als wesenhafte Eigenschaft unseres Lebens zu verstehen. Dieses Verständnis unseres eigenen Wesens ist der Ausgangspunkt, von dem aus wir uns von allen uneinlösbaren normativen Ansprüchen, von allen uneinlösbaren Vorstellungen eines „guten Lebens“ befreien können. Aber diese Befreiung bedeutet eben keine Auflösung der Spannung, sondern, diese in den Griff zu bekommen: „The goal of coming to grips with that tension in self-conscious life and the activity itself of coming to grips with the tension and remaining at one with oneself 66 within the tension are not a means to freedom. It is freedom itself.“155 Freiheit als Bei-sichselbst-Sein kann hier also in dem Sinne verstanden werden, dass das, was wir tun, dem entspricht, was wir wollen. Andernfalls würden unser Tun und unser Wollen sich widersprechen und wir in diesem Sinne nicht bei uns selbst und also unfrei sein. Auf den ersten Blick liegt es nahe, diese Freiheit im gebräuchlichen Sinne von „Handlungsfreiheit“ zu verstehen. Aber das wäre nicht richtig. Es geht hier nicht darum, dass wir frei sind, wenn wir tun, was wir wollen, und unfrei, wenn wir nicht tun, was wir wollen. Denn dann würde das In-den-Griff-Bekommen der Spannung, das es zu erlernen gilt („coming to grips with the tension“), doch nur Mittel zum Zweck der Freiheit und nicht selbst Freiheit sein können. Freiheit würde so wieder nur in dem aussichtslosen Unterfangen der Auflösung der Spannung gesucht, nicht aber erreicht werden können. Der sich aus der obigen Feststellung ergebende Widerspruch, dass Freiheit als Bei-sichSein in der Spannung auf der einen Seite als Entsprechung von Wollen und Tun zu verstehen ist, auf der anderen Seite wiederum auch nicht, kann aufgelöst werden, wenn man sich vor dem Hintergrund des Gesagten Folgendes klar macht: Indem wir die beschriebene Spannung als wesenhafte Eigenschaft unseres Lebens anerkennen, wird die Zielsetzung der Auflösung dieser Spannung sinnlos. Sie widerspricht unserer Natur. Würden wir ihr folgen, wären wir nicht bei uns und damit unfrei. Wir würden etwas Unmögliches wollen. Es bleibt uns allein das Ziel, die Spannung in den Griff zu bekommen. Indem wir uns in diesem Selbstbewusstsein dasjenige Tun als Ziel setzen, das unserer Natur – nicht der Natur – entspricht, sind wir bei uns selbst und also frei. Und dies auch dann, wenn das, was wir im alltäglichen Leben wollen, von anderem und anderen abhängig ist oder verhindert wird – und auch dann, wenn wir etwas tun, was wir nicht wollen, sondern zu dem wir uns von anderem und anderen gedrängt sehen.156 Dieses Ziel ist kein Ziel, das zu irgendeinem Zeitpunkt unseres endlichen Lebens abschließend erfüllt werden könnte. Es entspricht vielmehr der Aufgabe, mit der wir, als die Lebewesen, die wir sind, von der Geburt bis zum Tod das gesamte Leben hindurch konfrontiert werden. Und dies auch dann, wenn wir diese Aufgabe uns nicht als Ziel setzen oder sie noch nicht einmal als Aufgabe und mögliches Ziel reflektieren. Unser Leben bedeutet immer schon ein Suchen danach, diese Spannung in den Griff zu bekommen, ist letztlich diese Suche. Soweit wir uns diese auch reflexiv als Ziel setzen, sind wir bei uns selbst, sind wir frei, wollen wir das, was wir tun, ja was wir sind, was immer auch die konkreten Kontexte und Konsequenzen dieses Tuns sein mögen. Sich dieses Ziel zu setzen, kann so als ein sich selbst wollendes Leben verstanden werden. Insoweit scheint dieser Zielsetzung eine gewisse, wenn auch unvollkommene 155 156 Ebd., Seite 107f. Vgl. ebd., Seite 174. 67 Selbstgenügsamkeit nicht abgesprochen werden zu können. Darüber hinaus scheint es auch so, als könne dieses Ziel als eine Art „final end“, als ein Endzweck, für uns gelten. Nicht als Ziel, um dessen willen wir alles andere tun, sondern als eine quasi-unbedingte Norm. Die „Quasi-Unbedingtheit“ ergibt sich daraus, das jene als Ziel gesetzte Aufgabe sich zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens erübrigt, sich nicht nur in bedingten Situationen unseres Lebens einstellt – mag unser Leben auch noch so bedingt sein. Die Spannung ist eine wesenhafte Eigenschaft unseres bedingten, endlichen Lebens, der Umgang mit ihr eine Notwendigkeit, auch dann, wenn wir dies nicht reflektieren und reflektiert darauf zielen. Stets sind wir durch unser Leben dazu aufgefordert, unsere „erste“ und „zweite Natur“ sowie die Bedingungen unserer natürlichen und sozialen Umwelt zu modifizieren oder anzuerkennen, wenn die Modifizierung eines konkreten Sachverhaltes zumindest zeitweilig außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Was es genau bedeutet, diese Spannung in den Griff zu bekommen, dazu macht Pinkard keine genaueren Aussagen. Meines Erachtens kann es sinnvoll nur bedeuten, in der Vermittlung von Modifikation und Anerkennung die Spannung in einem Bereich zu halten, in welchem die individuellen Kräfte nicht übermäßig gespannt und daraufhin „irrational“ entladen werden. Eine „irrationale“ Entladung wäre dabei als ein in Negation des eigenen Lebens mündendes Tun zu verstehen. Entweder unmittelbar als Autoaggression oder mittelbar als Aggression gegenüber einer Umwelt, von der das Individuum abhängig ist. In dieser Negation des eigenen Lebens sind wir nicht bei uns selbst, also unfrei. Vor diesem Hintergrund wird so auch die Normativität des Zieles nachvollziehbar. In all unserem konkreten Modifizieren und Anerkennen kann das In-denGriff-Bekommen der Spannung als übergeordnete Norm verstanden werden, im Hinblick auf welche wir unser Tun stets orientieren müssen, wenn wir bei uns selbst bleiben und in diesem Sinne frei sein wollen. Darüber hinaus delegitimiert dieses Ziel seinem Inhalt nach grundsätzlich alle konkreten oder abstrakten Zielsetzungen, welche für ein Individuum unerfüllbar sind, da die Verfolgung uneinlösbarer Zielsetzungen ja gerade zu übermäßiger Spannung führt. Dementsprechend scheint es auch plausibel, von der grundsätzlichen Erfüllbarkeit dieser quasi-unbedingten Norm auszugehen. Als erfüllbares normatives Ziel weist das In-denGriff-Bekommen der Spannung auf ein Leben, das in dem Erfüllt-Werden dieses Zieles und der damit einhergehenden Vermeidung von Aggression in doppeltem Sinne „Befriedigung“ mit sich bringt, wenn auch keine Aussicht auf eine aristotelische „Glückseligkeit“. Das ist im Kern der Hintergrund, vor dem Pinkards Aussage, dass die beschriebene Selbstreflexion als „final end of the world“ gelten kann, Sinn zu machen beginnt, der Einsicht zugänglich wird – „such a purpose is, or can become, intellegible to itself“. Wir sind Lebewesen, die sich selbst in gewisser Weise ein Endzweck bzw. Selbstzweck sind und sich diesen Sachverhalt in der Reflexion einsichtig machen können. 68 Und dies auch dann, wenn wir uns im Sinne der heute in den Naturwissenschaften vorherrschenden Vorstellung als zufällige Produkte der kosmologischen Evolution verstehen und nicht als Teil einer „teleologically and devinely ordered nature“. So jedenfalls verstehe ich Pinkards Interpretation der hegelschen Philosophie als entzauberten Aristotelismus. Die Entzauberung mündet in die Aufhebung der eudaimonia in der „Befriedigung“, in einem „befriedigenden Leben“. Es ist an dieser Stelle nicht mein Interesse, danach zu fragen, ob Pinkard mit seinem Verständnis des hegelschen Denkens als einer Transformation der aristotelischen Philosophie Recht hat. Für Schnädelbach zum Beispiel läge hier Platon näher.157 Interessant ist jedoch, dass Schnädelbach in seiner Beantwortung der Frage, was es vom hegelschen Erbe für eine aktuelle Philosophie, die den Versuch einer „gedanklichen, theoretischen und praktischen Weltorientierung“ unternimmt, aufzuheben gilt, zu ähnlichen Schlüssen kommt.158 Mit Hegel gälte es an der Einheit der Vernunft festzuhalten, wenn diese auch nicht mehr die „‚Totalität aller Gesichtspunkte‘ [...] aus Gründen unserer Endlichkeit, sondern allein die Einheit der endlichen Vernunft selber“ sein könne.159 „Damit ist nichts Ontisches gemeint oder Psychisches, so als gäbe es das: die ‚eine‘ Vernunft in allen Menschen oder Kulturen. Auch verstehe ich darunter nicht Uniformität des Vernünftigen in der Welt oder seine systematische Unterordnung unter ein Prinzip. ‚Einheit der Vernunft‘ – das ist wie ‚Einheit der Welt‘: grundsätzliche Zugänglichkeit auch ihrer entlegenen Territorien, prinzipielle Verständlichkeit des in ihr Geschehenen, Gelebten und Gesagten. Nicht der ‚Pluralismus‘ ist die Alternative zu Hegels Singular, sondern das, was in der Menschenwelt Pluralität möglich macht: die kommunikative Einheit der Vernunft; nur durch sie wird die ‚Vielheit ihrer Stimmen‘ überhaupt vernehmbar. Ich halte es für eine wichtige Aufgabe, dieses Vernunftkonzept in einer Theorie der Rationalität systematisch zu entwickeln und in einer Anthropologie der Vernunft abzusichern, die uns auf der Grundlage humanwissenschaftlichen Wissens zeigt, was es bedeutet, daß wir endliche, zugleich natürliche und geschichtliche und im übrigen auch vernunftbegabte Wesen sind. In der praktisch-politischen Verlängerung des Gedankens der kommunikativen Einheit der Vernunft wird das sichtbar, was auch real solche Einheit allein ermöglicht: der Frieden. Die Idee des Friedens tritt so an die Stelle der Utopie der Versöhnung; sie ist keine Utopie, sondern ein Ziel, das auch endliche Wesen im Prinzip realisieren können, während Versöhnung nicht in unserer Macht steht. Das Christentum war so weise, Versöhnung zur Angelegenheit Gottes zu erklären; Frieden hingegen ist eine menschliche Angelegenheit: auch als untereinander und mit der Wirklichkeit Unversöhnte können wir Frieden 157 Vgl. Schnädelbach, Herbert: Hegels Lehre von der Wahrheit, Berlin: Humboldt-Universität, 1993, Seite 6ff. 158 Ebd., Seite 22. 159 Ebd. 69 schließen und Frieden halten; das können wir von uns verlangen. So weist die Einheit der Vernunft selbst auf die Idee des Friedens und damit auf eine Ethik der Solidarität unter endlichen, natürlichen und geschichtlichen, im übrigen vernunftbegabten Lebewesen. Hegel wäre dies nicht genug, aber uns sollte es genügen.“160 Wenn Schnädelbach die „Einheit der kommunikativen Vernunft“ als „prinzipielle Verständlichkeit“ des in der Welt „Geschehenen, Gelebten und Gesagten“ mit Habermas Worten raumzeitlich in die Vermittlung der „Vielheit ihrer Stimmen“ aufgehen lässt, dann steht das in einer gewissen Nähe zu Pinkards Beschreibung der hegelschen Vernunft als „ongoing interchange“ oder „ongoing process of understanding the world and ourselves“, als einem Prozess, in dem „the infinite exists, as it were, as our own reflective consciousness of this finitude“. 161 Auch Schnädelbachs Absage an die „Utopie der Versöhnung“ liegt nicht weit von Pinkards Hegel-Darstellung als einem „philosophical therapist trying to inoculate us against the temptations toward wholeness in a sphere (the finite) where it cannot be found“. 162 Und schließlich weist nicht nur Schnädelbachs „Einheit der Vernunft“ auf die „Idee des Friedens“, sondern auch die bei Pinkard deutlich gemachte Ausrichtung auf ein „befriedigendes Leben“, ein unserem Tun Rationalität verleihendes Ziel, das in seiner Verwirklichung in doppeltem Sinne „Befriedigung“ zeitigt – als Erfüllung des Zieles und in der damit verbundenen Vermeidung von Aggression sich selbst und anderen gegenüber. Dass dieser Frieden sowohl bei Schnädelbach, als auch bei Pinkard für uns „untereinander und mit der Wirklichkeit Unversöhnte“ nicht ohne Spannung zu haben ist, entspricht unserer endlichen Natur und sollte uns nicht stören. Im Gegenteil „uns sollte es genügen“, wie Schnädelbach, oder „that should suffice“, wie Pinkard sagt. 163 „Die unversöhnte Welt wird so endlich davon befreit, als durchschlagendes Argument gegen Vernunft überhaupt herhalten zu müssen; vielleicht erhöht genau dies die Chancen ihrer Veränderung [...]“ 164 – zum Guten, wie ich zu ergänzen geneigt bin. Pinkards Hegel-Interpretation kann meines Erachtens geradezu als ein Beitrag zu der von Schnädelbach verfolgten Theorie der Rationalität verstanden werden. Ob dies Hegel genügen würde oder nicht, sei dahingestellt. Entscheidend für eine aktuelle philosophische Diskussion, auch des Fortschrittsbegriffs, ist es, das kritische Potential zu bergen, das in der Auseinandersetzung etwa mit Hegel liegt – oder aber anderen Protagonisten, die hier ebenfalls hätten zu Wort kommen können –, unabhängig davon, ob man die Quelle dieses kritischen Potentials innerhalb oder außerhalb des Denkens verortet, mit dem man sich auseinandersetzt. 160 Ebd., Seite 22f. Pinkard (2012), Seite 186ff. 162 Ebd., Seite 175. 163 Ebd., Seite 195. 164 Schnädelbach (1993), Seite 21. 161 70 Es bedarf nun keines großen Schrittes mehr, um die Verbindungen zwischen dieser für die Gegenwart nutzbar gemachten Auseinandersetzung mit Hegel und dem oben entwickelten modifizierten Verständnis des Fortschrittsbegriffes zu explizieren. „Befriedigung“ im vorausgesetzten Sinne kann bei Pinkard, und meines Erachtens auch bei Schnädelbach, als Superlativ dessen verstanden werden, was wir auf der Suche nach einem „guten Leben“ in unserer Endlichkeit erreichen können. Nicht als Folge der Realisierung bestimmter Vorstellungen eines „guten Lebens“, auch wenn derlei Vorstellungen bei der Suche eine Rolle spielen mögen, sondern als „gutes Leben“ selbst, als das durch Modifizierung und Anerkennung von „erster“ und „zweiter Natur“ sowie von natürlichen und sozialen Bedingungen unserer Umwelt zu erreichende In-den-Griff-Bekommen der Spannung. Jener Spannung, die unser Leben von der Geburt bis zum Tod durchzieht, unser Leben ausmacht, in gewisser Weise unser Leben ist. „Befriedigung“ meint individuelle „Befriedigung“, auch dann, wenn ihre Realisierung von anderem und anderen abhängig ist. So wird sie der oben geforderten substantiellen Partialität gerecht. Damit vermeidet sie auch die Ambivalenzproblematik. Universalität wird aggregativ gedacht, im besten Fall als ein „befriedigendes Leben“ aller zu einer Zeit sowie zukünftig lebenden und zur „Befriedigung“ fähigen Wesen. Und schließlich wird „Befriedigung“ auch der Bimodalität des Fortschrittsbegriffes gerecht. Ein „unbefriedigendes Leben“ gibt Anlass und Raum zur Verbesserung, dem modus meliorativus. Ein „befriedigendes Leben“ erübrigt nicht die weitere Suche nach der Realisierung eines solchen im modus sufficiens. Die vorangehenden Ausführungen geben nicht nur Grund zu der Wahrnehmung, dass die antike Philosophie mehr zum Fortschrittsbegriff zu sagen hat, als bisher angenommen wurde, sondern auch zu dem Verdacht, dass die zeitgenössische Philosophie viel mehr über den Fortschrittsbegriff diskutiert, als es oberflächlich den Anschein hat. Solange man, wie auch Pinkard, „Fortschritt“ auf „Verbesserung“ oder gar auf „universale Verbesserung“ reduziert, scheint jene Wahrnehmung und dieser Verdacht unbegründet.165 Akzeptiert man jedoch die begrifflichen Modifizierungen, beginnt sich die Perspektive zu ändern. Ich halte den von Pinkard in Auseinandersetzung mit Hegel entwickelten Begriff der „Befriedigung“ im Rahmen der Fortschrittsdiskussion für sehr fruchtbar. Mit ihm nehmen wir Abstand von uneinlösbaren Vorstellungen darüber, was es zu tun gilt. Nichterfüllbare Zielvorstellungen sind als Zielsetzungen zu verabschieden. Warum sollten wir uns um etwas bemühen, das wir nicht erfüllen können und so ein unbefriedigendes Leben führen? Mit dem Begriff der „Befriedigung“ begeben wir uns reflexiv auf die Suche nach einer Lösung dieser praktischen Problematik. Wenn wir mit Pinkard dieses Anliegen auch Hegel unterstellen, dann könnte man den hegelschen und von Schnädelbach als „skandalös“ bezeichneten Satz, „was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig“ wenn nicht verteidigen, so doch im hegelschen Sinne aufheben. Eine solche Aufhebung könnte in etwa lauten: Was vernünftig ist, muss stets wirklich sein 165 Vgl. Pinkard (2012), Seite 120; dort definiert er „progress“ als „getting better at any kind of practice“. 71 können, was wirklich ist, muss stets vernünftig sein können.166 Damit wäre nicht mehr, aber auch nicht weniger gesagt, als dass Vernunft und Wirklichkeit nicht grundsätzlich gegeneinander verschlossen sein dürfen, vernünftiges Tun sich stets verwirklichen können muss. Es wäre nicht vernünftig, vernünftiges Tun in unrealisierbaren Vorstellungen zu suchen. Weiter oben habe ich diesen Sachverhalt als teleologische Suffizienz-Bedingung bezeichnet.167 Für ein genaues Verständnis dessen, was der Begriff eines „befriedigenden Lebens“ in dieser Hinsicht für die philosophische Diskussion des Fortschrittsbegriffes leistet, lohnt es sich, noch einmal nachzuvollziehen, worin die Problematik des aristotelischen Glückseligkeitsgedankens liegt, die, folgt man Pinkard, von Hegel durch den Befriedigungsbegriff gerade gelöst wurde. Anders als Pinkard, bin ich nicht der Meinung, dass Aristoteles Glückseligkeitsbegriff zu abstrakt ist.168 Vielmehr scheint er mir, wie ich zu zeigen versuche, in gewisser Hinsicht viel zu konkret. Ich werde im Folgenden also Aristoteles Begriff der Glückseligkeit einer kritischen Diskussion unterziehen. Aber nicht nur für Aristoteles Denken war die Glückseligkeit zentral, sondern auch für Immanuel Kant. In der Auseinandersetzung mit ihm tritt die teleologische Suffizienz-Problematik im Rahmen der Glückseligkeitsdiskussion vor verändertem theoretischen Hintergrund noch einmal in aller Schärfe hervor. Deshalb möchte ich auch Kant als weiteren Gesprächspartner ins Spiel bringen. Wir werden sehen, dass auch er das Problem nicht gelöst hat. Im Nachvollzug der kantischen Argumentation erreichen wir jenen Stand der Diskussion, an den Hegel historisch anknüpfte. Vor diesem Hintergrund gewinnt sein Denken an Deutlichkeit, weshalb es auch Pinkard ratsam erschienen sein mag, von der Einleitung bis zum Schluss seiner Hegel-Interpretation beständig den Kontrast zu Kant zu suchen. Wir werden so ein besseres Verständnis davon erreichen, inwiefern es der von Pinkard in seiner Auseinandersetzung mit Hegel herausgearbeitete Begriff der „Befriedigung“ vermag, eine adäquatere Berücksichtigung der teleologischen SuffizienzBedingung im Rahmen der Fortschrittsdiskussion zu ermöglichen. In der Diskussion der kantischen Philosophie wird auch deren Verhältnis zu Aristoteles deutlich werden. ... von Hegel zurück zu Aristoteles ... Aristoteles erklärte denjenigen für vollkommen glückselig, der sein gesamtes Leben hindurch bis in den Tod hinein tugendhaft gehandelt hat und mit den notwendigen äußeren Gütern versorgt war.169 Geht einer seiner Glückseligkeit verlustig, so wird er nur, wenn 166 Vgl. Schnädelbach (1993), Seite 12; Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: ders.: Werke, Band 7, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986, 24. 167 Vgl. Seite 52 dieser Arbeit. 168 Vg. Pinkard (2012), Seite 90. 169 Vgl. Aristoteles NE (2001), Seite 45. 72 überhaupt, unter großen Schwierigkeiten und mit Glück zu einem glückseligen Leben zurückfinden, die vollkommene Glückseligkeit aber bleibt für immer außerhalb seiner Reichweite.170 Aristoteles sah die Glückseligkeit vor allem durch äußere Schicksalsschläge gefährdet. Um sie dennoch als ein nicht allein von Zufall und Glück, das „bei einem und demselben Menschen vielfach kreist“171, abhängiges Ziel deutlich zu machen, hielt er dieser Unwägbarkeit die „Beständigkeit“ der „tugendgemäßen Handlungen“ entgegen.172 Wenigstens diese der Vernunft obliegenden Glückseligkeitsbedingung liegt bei Aristoteles in individueller Hand, so „daß der wahrhaft Gute und Verständige in guter Haltung jede Art von Schicksal trägt und in der gegebenen Lage stets das Beste tut [...]. Wenn das so ist, dann wird der Glückselige niemals unselig werden, wohl aber auch nicht vollkommen selig, wenn er nämlich in Schicksale wie das des Priamos gerät.“173 Man kann dies als Einsicht seitens Aristoteles lesen, dass vollkommene Glückseligkeit kein lebenspraktisches Ziel sein kann. Es würde unvernünftig und unbefriedigend sein, in einem auch durch negative Zufälle geprägten Leben sein Lebensglück an vollkommener Glückseligkeit zu messen. In diesem Sinne ist dann auch die Einschränkung zu verstehen, die Aristoteles seiner Aussage anfügt, dass diejenigen unter den Lebenden glückselig genannt werden können, die ein den beschriebenen Vorstellungen entsprechendes Leben führen und führen werden: „glückselig freilich als Menschen“. 174 Deutlicher wird Aristoteles an anderer Stelle: „Denn nichts, was zur Glückseligkeit gehört, darf unvollkommen sein. Aber ein solches Leben ist höher als es dem Menschen als Menschen zukommt.“ 175 Der Tugendhafte führt ein Leben zwischen Unseligkeit und vollkommener Glückseligkeit. Er sollte sich damit zufrieden geben. Der Ausdruck „Befriedigung“ scheint mir deshalb auf den Punkt zu bringen, was Aristoteles mit der Unterscheidung zwischen vollkommener Glückseligkeit und (unvollkommener) Glückseligkeit deutlich zu machen versuchte. Die (unvollkommene) Glückseligkeit versteht Aristoteles als einen aus tugendhafter Tätigkeit selbst entspringenden Genuss, der dem Tugendhaften, wenn auch nicht vollkommen, so doch weitgehend unabhängig vom äußeren Schicksal zuteil wird. 176 Dieser Genuss ist Bedingung dafür, auch in einem unvollkommenen Leben „Befriedigung“ zu finden. Dass Aristoteles anders als Hegel diese „Befriedigung“ letztlich ins Verhältnis zu einer vollkommenen Gottheit, dem unbewegten Beweger als einer vollkommen selbstgenügsamen Wirklichkeit setzte, einem „Ursprünglichen und Ewigen“, in dem sich „nichts Schlechtes, kein Fehl, nichts Verdorbenes“ findet und das in einem durch Zufälle 170 Vgl. ebd. Ebd., Seite 41. 172 Vgl. ebd., Seite 43 173 Ebd., Seite 43f. 174 Vgl. ebd., Seite 45. 175 Ebd., Seite 443. 176 Vgl. ebd., Seite 35. 171 73 und Schicksalsschläge beeinträchtigten Leben als unveränderlicher Orientierungspunkt die Möglichkeit vernünftigen, d.h. tugendhaften auf Glückseligkeit gerichteten Tuns garantiert, ändert nichts an der grundsätzlichen Gemeinsamkeit, Vernunft und Wirklichkeit praktisch-theoretisch in Einklang miteinander bringen zu wollen.177 Der Unterschied liegt „allein“ in der Konzeption jenes Orientierungspunktes, der bei Hegel, folgt man Pinkard, in der Ausrichtung auf die individuelle, wenn auch von anderem und anderen abhängige, „Befriedigung“ selbst als in der Ausrichtung auf eine göttliche Vollkommenheit zu finden ist. Genau darin, in dieser Befreiung von der Gottheit, sieht Pinkard ja gerade die Leistung der hegelschen Philosophie als einem „entzauberten Aristotelismus“. Weitab davon diese „Befreiung von Gott“ aus einem antimetaphysischen Dogmatismus heraus gut zu heißen, scheint mir die aristotelische Konzeption der Glückseligkeit in ihrem Verhältnis zu einer göttlichen Vollkommenheit, selbst wenn diese nicht selbst als göttlich, sondern als „das Göttlichste in uns“ interpretiert wird, tatsächlich ein grundlegendes Problem zu enthalten, das einer Auflösung bedarf.178 Ausgangspunkt der aristotelischen Ethik ist der teleologische Gedanke, dass die Frage, was es zu tun gilt, reflexiv nur zufriedenstellend beantwortet werden kann durch etwas, das ausnahmslos um seiner selbst willen angestrebt wird und demnach nicht wiederum auf etwas anderes verweist. Platon hatte diesen formalteleologischen Gedanken durch die Idee des Guten, das agathon, inhaltlich zu füllen gesucht. Das Gute als ewige Idee war für ihn das einzig mögliche Endziel alles vernünftigen Strebens. Zu Beginn seiner Nikomachischen Ethik kritisiert Aristoteles nun diese platonische Idee. Eine ewige Idee ist nichts in der Endlichkeit zu Verwirklichendes und kann für endliche Wesen wie uns deshalb auch kein Endziel ihres Tuns sein. „Auch wenn das Gute existiert, das eines ist und allgemein ausgesagt wird, oder das abgetrennt und an und für sich besteht, so ist es doch klar, daß dieses Gute für den Menschen weder zu verwirklichen noch zu erwerben ist. Nun ist es aber ein solches, was wir suchen.“ 179 In der Glückseligkeit meint er eben ein solches realisierbares „vollkommene und selbstgenügsame Gut“ als „Endziel des Handelns“ gefunden zu haben.180 Auf dieser abstrakten Ebene allerdings ist damit noch nicht viel gewonnen. Denn auf der einen Seite wird das vernünftige und tugendhafte Streben unmissverständlich als Streben nach vollkommener Glückseligkeit verstanden, auf der anderen Seite müsste es aber als unvernünftig und also nicht tugendhaft angesehen werden, die vollkommene Glückseligkeit als Ziel endlichen Strebens zu setzen, da sie durch ein solches, wie 177 Vgl. Aristoteles ME (1991), Seite 131f.; ich vertrete also nicht die unter dem Schlagwort „don´t mix ethics with metaphysics“ vertretene These, dass aristotelische Ethik und Metaphysik strikt voneinander zu trennen seien. 178 Aristoteles NE (2001), Seite 439. 179 Ebd., Seite 23. 180 Vgl. ebd., Seite 27. 74 Aristoteles selbst sagt, nicht erfüllbar ist. Das unerfüllbare endliche Streben nach vollkommener Glückseligkeit müsste eine Unzufriedenheit mit sich bringen, die der von Aristoteles mit der (unvollkommenen) Glückseligkeit verbundenen Vorstellung von Genuss bzw. „Befriedigung“ geradewegs entgegensteht. Die (unvollkommene) Glückseligkeit würde so nichts anderes bedeuten, als dass das Ziel des Strebens, vollkommene Glückseligkeit, nicht erfüllt würde, unbefriedigt bleibt. Sich mit der (unvollkommenen) Glückseligkeit zufrieden zu geben aber hieße dann, die vollkommene Glückseligkeit als Zielsetzung aufzugeben, durch die nach Aristoteles das vernünftige und tugendhafte Leben und damit die (unvollkommene) Glückseligkeit doch überhaupt erst möglich sein soll. Auf dieser abstrakten Ebene also kann Aristoteles das Problem, Vernunft und Wirklichkeit praktisch-theoretisch in Einklang miteinander zu bringen, nicht lösen. Er bliebe, vor verändertem theoretischen Hintergrund, jenem Defizit verhaftet, welches Aristoteles in Zusammenhang mit der Idee des Guten für die platonische Philosophie diagnostizierte, und das zu lösen er sich gerade zum Ziel setzte. Für Aristoteles ist das Streben nach Glückseligkeit als dem letzten und für sich selbst, d.h. nicht um irgendetwas anderen willen, erstrebte Gut eine anthropologische Konstante. „Aber damit, daß Glückseligkeit das höchste Gut sei, ist vielleicht nicht mehr gesagt, als was jedermann zugibt. Wir möchten aber noch genauer erfahren, was sie ist.“181 Und genau in dieser Konkretisierung muss er nun das leisten, was seiner Meinung nach Platon mit seiner Idee des Guten schuldig geblieben ist: die Realisierbarkeit des Guten zu plausibilisieren. Dazu muss Aristoteles nicht nur verständlich machen, inwiefern unser Streben nach vollkommener Glückseligkeit nicht in Widerspruch mit der von ihm konstatierten Tatsache gerät, dass wir diese in unserer Endlichkeit nicht werden erreichen können. Sondern er muss auch deutlich machen, inwieweit die vollkommene Glückseligkeit im Einflussbereich unseres Tuns liegt. Dass alle Menschen ihre vollkommene Glückseligkeit durchweg begrüßen würden, soll hier zugestanden werden. Aber entscheidend ist, dass sie auch als zumindest potentieller Zielpunkt unseres Tuns angesehen werden kann. Das kann sie jedoch nur, wenn sie im Bereich dessen liegt, was wir durch unser Tun erreichen können. Nicht aber wenn es einer Notwendigkeit entspricht oder dem Schicksal anheim gestellt ist, ob sie uns zuteil wird oder nicht. So sehr man Glückseligkeit auch begrüßen mag, es würde keinen Sinn machen, praktisch nach ihr zu streben, wenn die Erfüllung außerhalb dessen liegt, was durch das praktischen Streben erreicht werden kann. 182 Die Konkretisierung des 181 Ebd., Seite 27. Aristoteles macht dies selbst an verschiedenen Stellen deutlich. Sehr ausführlich zum Beispiel: „Überlegt man nun alles und ist alles ein Gegenstand der Überlegung, oder gibt es Ausnahmen? Wir müssen vielleicht sagen: Gegenstand der Überlegung natürlich nicht für den Einfältigen oder Wahnsinnigen, sondern für den Verständigen. Über das Ewige stellt man keine Überlegungen an, etwa über den Kosmos oder darüber, daß Diagonale und Seite inkommensurabel sind. Ebenso tut man es nicht über 182 75 Glückseligkeitsstrebens muss also ein auf den ersten Blick unlösbar erscheinendes Problem lösen. Sie muss die Aussage, dass vollkommene Glückseligkeit das Endziel unseres praktischen Strebens ist, mit der Aussage, dass vollkommene Glückseligkeit außerhalb dessen liegt, was wir in unserem endlichen Leben erreichen können, in einen plausiblen Zusammenhang bringen. Weiter oben wurde deutlich, dass Aristoteles die Unvollkommenheit der von uns endlichen Wesen zu erreichenden Glückseligkeit im äußeren Schicksal begründet liegen sah. In dieses äußere Schicksal sind wir in all denjenigen Zusammenhängen verwickelt, in denen wir aufgrund unserer Natur von äußeren Gütern abhängig sind, seien diese physischer oder sozialer Art. Es ist deshalb konsequent, wenn Aristoteles das Streben nach der Verwirklichung der Glückseligkeit, wie im Übrigen auch Platon, in einer „inneren“ Tätigkeit des Menschen sucht, der Tätigkeit der Vernunft. Wo, wenn nicht hier, kann eine gegenüber dem äußeren Schicksal weitestgehend unabhängige und unserem Einfluss obliegende Tätigkeit gefunden werden? Das vernünftige Tun, das sind die „tugendgemäßen Handlungen“ denen wir uns in einem unwägbaren Leben mit „Beständigkeit“ widmen können. Doch auch diese und der mit ihnen sich einstellende Genuss bleiben, soweit sie sich auf äußere Güter beziehen, in den Wendekreis des Schicksals gebannt. Die durch sie zu gewinnende Glückseligkeit bleibt problematisch. Wir mögen uns um sie bemühen, ihr Eintreten aber liegt nicht in unserer Gewalt. Dies gilt bei Aristoteles für alle Tugenden, bis auf eine Ausnahme: „die betrachtende Tätigkeit der Vernunft“, die theoria. 183 Ihr nun kommt im letzten Buch der Nikomachischen Ethik die Rolle zu, der formalen Bestimmung der Glückseligkeit als dem „vollkommenen und selbstgenügsamen Gut“, als dem „Endziel des Handelns“ eine inhaltliche Konkretisierung zu geben, welche, anders als das platonische agathon, die gesuchten Bedingungen praktisch-theoretischer Suffizienz erfüllt. Aristoteles beschreibt das „Betrachten“ als „Tätigkeit Gottes, die an Seligkeit alles übertrifft [...]“.184 „So groß aber der Unterschied ist zwischen diesem Göttlichen selbst und dem aus Leib und Seele zusammengesetzten Wesen, so groß ist auch der Unterschied zwischen der Tätigkeit, die von diesem Göttlichen ausgeht und allem sonstigen tugendgemäßen Tun. Ist nun die Vernunft im Vergleich mit dem Menschen etwas Göttliches, so muß auch das Leben nach die Dinge, die in Bewegung sind, und zwar immer in derselben Weise, sei es aus Notwendigkeit oder durch Natur oder aus irgendeiner andern Ursache, wie etwa Sonnenwenden und -aufgänge. Ebenso auch nicht über das, was immer wieder anders ist, wie Dürre und Regenfälle; und ebenso nicht über das Zufällige, wie das Finden eines Schatzes. Und auch nicht über sämtliche menschlichen Dinge: Kein Spartaner wird sich überlegen, wie etwa die Skythen ihren Staat am besten einrichten könnten, denn derartiges steht gar nicht in unserer Gewalt. Wir überlegen uns also die Dinge, die in unserer Gewalt und ausführbar sind. Denn das ist auch das einzige, was übrig bleibt.“, ebd., Seite 103. 183 Ebd., Seite 443. 184 Vgl. ebd., Seite 449. 76 der Vernunft im Vergleich mit dem menschlichen Leben göttlich sein.“185 „Soweit sich demnach das Betrachten erstreckt, soweit erstreckt sich auch die Glückseligkeit, und den Wesen, denen das Betrachten in höherem Grade zukommt, kommt auch die Glückseligkeit in höherem Grade zu, nicht zufällig, sondern eben aufgrund des Betrachtens, das seinen Wert in sich selbst hat. So ist denn die Glückseligkeit ein Betrachten.“ 186 Die Glückseligkeit ist für Aristoteles demzufolge die selbstgenügsame und mit einem eigenen Genuss verbundene Tätigkeit des Betrachtens, die Tätigkeit der „theoretischen Vernunft“. Sie ist das prakton agathon. In ihr strebt man nicht mehr nach Glückseligkeit, sondern man hat sie erreicht. Sie ist vollkommen, „wenn sie auch noch die volle Länge eines Lebens dauert“.187 Inwiefern schafft es nun diese inhaltliche Bestimmung der Glückseligkeit, die Aussage, dass vollkommene Glückseligkeit das Endziel unseres Strebens ist, mit der Aussage, dass vollkommene Glückseligkeit außerhalb dessen liegt, was wir in unserem endlichen Leben erreichen können, ohne Widerspruch in Einklang miteinander zu bringen? Zunächst einmal liegt für Aristoteles die selbstgenügsame Betrachtung der „theoretischen Vernunft“ im Rahmen unserer menschlichen Möglichkeit. Da sich die aristotelische Glückseligkeit in dieser betrachtenden Tätigkeit selbst findet und sich nicht erst als etwas dieser Tätigkeit Äußeres einstellen würde, das womöglich wiederum von anderem abhängig wäre, ist Glückseligkeit etwas, das wir tatsächlich erreichen können: eben indem wir theoretisch betrachten. Also auch dann, wenn sie nicht vollkommen ist, d.h. unser gesamtes endliches Leben ausfüllt. Wenn wir theoretisch betrachtend der Glückseligkeit teilhaftig werden, so ist dieser Genuss unabhängig davon, ob er sich nun über ein vollständiges Leben hinzieht oder nicht. Nach vollkommener Glückseligkeit zu streben, bedeutet also, soviel als möglich in der theoretischen Betrachtung zu leben. Hier gibt es keine theoretisch vorwegzunehmende Grenze, sondern diese hängt allein von den zu einem jeweiligen Zeitpunkt gegebenen individuellen Möglichkeiten ab. Nach vollkommener Glückseligkeit zu streben, heißt alle Anstrengungen darauf zu richten, unser jeweiliges diesbezügliches Maximum auszuschöpfen. In dem Streben nach vollkommener Glückseligkeit wird diese also nicht als ein zu erfüllendes Ziel gedacht. Sie wird vielmehr als Inbegriff des jeweils maximal Möglichen, als ein Ideal verstanden. Aristoteles hätte dementsprechend auch schreiben können, dass es für uns endliche Wesen darum geht, zu einem jeweiligen Zeitpunkt alles dafür zu tun, einen möglichst langen Zeitraum in der betrachtenden Tätigkeit der „theoretischen Vernunft“ zu verbringen. In diesem Sinne scheint die Aristotelische Konkretisierung der Glückseligkeit den Widerspruch zwischen dem Streben nach vollkommener Glückseligkeit und der Unmöglichkeit, diese in einem endlichen Leben zu erreichen, in den Griff zu bekommen. 185 Ebd., Seite 443. Ebd., Seite 449. 187 Vgl. ebd., Seite 443. 186 77 Aber dieser Schein ist meines Erachtens durch eine Ungenauigkeit erkauft, die ich im Folgenden kurz herausarbeiten möchte. Die Tätigkeit der „theoretischen Vernunft“ kann Aristoteles nur dann als Konkretisierung der Glückseligkeit plausibilisieren, wenn sie die formalteleologischen Charakteristika eines Endziels aufweist. Die Glückseligkeit soll ein selbstgenügsames Ziel sein, das wir um seiner selbst willen anstreben und in dessen Erreichen unser Streben seine Erfüllung findet. Dementsprechend stellt Aristoteles die Betrachtung dar als eine Tätigkeit der „theoretischen Vernunft, die nicht handelt und nicht hervorbringt“, die also weder als Klugheit (phronesis) noch als Kunst (techne), die allein Tugenden unserer „praktischen Vernunft“ sind, mit unserem Streben in Verbindung steht. Die „theoretische Vernunft“ betrachtet einfach, nicht aber um zu betrachten, auch nicht um glückselig zu sein, sondern ist in ihrer Selbstgenügsamkeit und dem mit ihr verbundenen Genuss die der Glückseligkeit entsprechende Tätigkeit.188 Die Unterscheidung zwischen „theoretischer“ und „praktischer Vernunft“ richtet sich nach der Unterscheidung der Inhalte, die durch die Vernunft „betrachtet“ werden.189 Vernunft ist für Aristoteles stets eine „betrachtende Tätigkeit“, deren Inhalte sich entweder auf „notwendige“ („was sich nie anders verhalten kann“) oder „mögliche Wahrheiten“ („was sich so und anders verhalten kann“) beziehen können.190 „Notwendige Wahrheit“ findet sich im Hinblick auf ewig gültige Sachverhalte, die durch Geist (nous), Wissenschaft (episteme) und Weisheit (sophia) erkannt werden können. „Mögliche Wahrheit“ bedeutet ein durch Geist (nous), Klugheit (phronesis) oder Kunst (techne) sicherzustellendes, richtiges bzw. gutes Verhalten im Bereich unseres „Handelns“ und „Hervorbringens“.191 Die „theoretische Vernunft“ ist also deshalb „reine“ betrachtende Tätigkeit, weil ihr Inhalt sich weder mittelbar oder unmittelbar auf unsere Handlungen bezieht noch sich auf ein Hervorbringen richtet oder von ihr hervorgebracht wird. Diese Unterscheidung der „theoretischen Vernunft“ von der „praktischen Vernunft“ lässt sich jedoch nur im Hinblick auf den Inhalt der Vernunft festmachen, nicht im Hinblick darauf, was die Vernunft als „betrachtende Tätigkeit“ selbst ist. Die „theoretische Vernunft“ ist, nicht anders als die „praktische Vernunft“, ein Handeln. Die „theoretische Vernunft“ ist ein Handeln, das „notwendige Wahrheiten“ betrachten will, die „praktische Vernunft“ ein Handeln, das auf das Erfassen „möglicher Wahrheiten“ gerichtet ist. Von dieser praktischen Seite her betrachtet, d.h. wenn wir die Vernunft als ein Handeln endlicher Wesen verstehen, verliert aber noch die theoretischste Vernunft ihre Selbstgenügsamkeit. Jegliche Vernunfttätigkeit bedarf als Tätigkeit endlicher Wesen sowohl physischer Güter, d.h. der notwendigen körperlichen Ernährung, Pflege und 188 Zur aristotelischen Unterscheidung zwischen der „praktischen“ und der „theoretischen Vernunft“ gemäß der von ihm angenommenen Zweiteilung des vernunftbegabten Teiles der Seele vgl. ebd., Seite 237ff. 189 Vgl. ebd., Seite 237f. 190 Vgl. ebd., Seite 249. 191 Zur Rolle des Geistes (nous) für die praktische Vernunft vgl. ebd., Seite 239f., 247f. 78 Gesundheit, als auch sozialer Güter, d.h. eines sozialen Umfeldes, in dem ihre Betätigung, wenn nicht sogar gefördert, so doch zumindest nicht gestört oder verhindert wird. Zwar erkannte Aristoteles dies grundsätzlich an: „Auch bedarf diese Glückseligkeit der äußeren Güter nur wenig oder doch weniger als das Leben gemäß den ethischen Tugenden. Mögen beide das zum Unterhalt Nötige auch gleich sehr brauchen [...], so muß sich doch bei der jeweiligen Tätigkeit ein großer Unterschied ergeben. Der Freigebige braucht Geld [...], und der Gerechte braucht es, [...]; der Mutige bedarf der Kraft, [...] und der Mäßige bedarf der Freiheit. [...] Man zweifelt freilich, welches von den Erfordernissen der Tugend das wichtigere ist, der Wille oder das Werk. Doch findet sie offenbar ihre Vollendung erst in beiden zugleich. Nun bedarf sie aber, um zu handeln, vieler Dinge und bedarf ihrer desto mehr, je größer und schöner ihre Handlungen sind. Der Betrachtende aber hat, wenigstens für diese seine Tätigkeit, keines dieser Dinge nötig, ja sie hindern ihn eher daran. Sofern er aber Mensch ist und mit vielen zusammenlebt, wird er auch wünschen, die Werke der ethischen Tugend auszuüben; so wird er denn solcher Dinge bedürfen, um als Mensch unter Menschen zu leben.“192 Aristoteles begründete aber dieses Eingebettet-Sein des theoretischen Betrachtens in die menschlichen Zusammenhänge nicht über die Natur der „theoretischen Vernunft“ selbst. Er begründete es überhaupt nicht, er konnte es schlichtweg nicht leugnen. Das Vernachlässigen dieses Begründungszusammenhangs lässt ihn an einer merkwürdigen Spaltung der Vernunft hinsichtlich des menschlichen Lebens festhalten. So zum Beispiel, wenn er die durch die Tugenden der praktischen Vernunft erreichbare Glückseligkeit mit jener der theoretischen Vernunft vergleicht: „Somit ist auch das ihnen gemäße Leben menschlich, und menschlich auch die Glückseligkeit, die es gewähren kann. Dagegen diejenige, die das Leben nach der Vernunft gewährt, ist für sich.“193 Die Vernunft erscheint zwiegespalten. Zum einen in ihrem Bezug auf das menschliche Leben und die menschliche Glückseligkeit, zum anderen in ihrem Bezug auf das „göttliche“ Leben und die „göttliche“ Glückseligkeit, die irgendwie „für sich“ ist. Und tatsächlich nimmt Aristoteles eine Aufteilung der Vernunft vor. Er überträgt die Unterscheidung der Inhaltsarten auf die Vernunft selbst. Insofern die Inhalte einen kategorischen Unterschied zwischen „notwendigen Wahrheiten“ und „möglichen Wahrheiten“ aufweisen, so ist ihm auch die Vernunft kategorisch in zwei Teile geteilt. Aristoteles spricht von „Gattungen“: „Denn wenn die Gegenstände der Gattung nach verschieden sind, so ist auch der dem einen oder andern Gegenstand zugeordnete Seelenteil der Gattung nach verschieden, wenn nämlich das Erkennende auf Grund einer 192 193 Ebd., Seite 445f. Ebd., Seite 445. 79 gewissen Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit dem Gegenstande erkennt.“194 Zwar ist diese schon zu vorsokratischer Zeit verbreitete epistemologische Vorstellung der Ähnlichkeit „des Erkennenden [...] mit dem Gegenstande“ gewissermaßen dem damaligen Wissensstand geschuldet. Aber es hätte für Aristoteles doch wahrlich im Rahmen seiner Möglichkeiten gelegen, folgende Frage zu stellen: Wenn es zwei Teile der Vernunft gibt, die jeweils unterschiedliches erkennen, und demnach unterschiedlich sind, wie kann es dann sein, dass es möglich ist, die unterschiedlichen Inhalte aufeinander zu beziehen, miteinander zu vergleichen und zu verbinden? Die Vernunft kann also nicht einfach in einem Nebeneinander zweier Vernunftvermögen bestehen. Vielmehr müsste entweder ein drittes Vermögen vorausgesetzt werden, das sich der anderen beiden Vernunftvermögen bedient, oder aber, was ebenso gut denkbar und weniger voraussetzungsreich wäre, die individuelle Vernunft ist insgesamt nur eine einzige, welche sich jedoch auf unterschiedliche Inhalte beziehen kann. Und er selbst hat mit seinem Begriff des Geistes (nous) einen Ansatzpunkt für die Konzeption einer solchen Einheit der individuellen Vernunft gegeben. Denn „Geist“ (nous) versteht Aristoteles als Voraussetzung und Vermögen, die Wahrheit zu finden, „teils im Bereich dessen, was sich nie anders verhalten kann, teils auch im Bereich dessen, was sich so und anders verhalten kann“, also als gemeinsamen Ausgangspunkt des Erfassens sowohl „notwendiger“ als auch „möglicher Wahrheiten“.195 Hätte Aristoteles den Gedanken der individuellen Einheit der Vernunft weiter verfolgt, so hätte er in der Bestimmung derselben nicht bei der Spezifizierung ihrer möglichen Inhalte stehen bleiben können. Er hätte auch ihre von spezifischen Inhalten unabhängigen Eigenschaften explizieren müssen. Das aber hätte bedeutet, sowohl die „theoretische Vernunft“ als auch die „praktische Vernunft“ allgemein als „betrachtende Tätigkeiten“ endlicher Wesen, oder genauer, insofern sie, wie Aristoteles selbst sagt, demselben auf Wahrheit gerichteten „Geist“ entspringen, als Handlungen vernunftbegabter endlicher Wesen zu verstehen. Als ein Handeln endlicher Wesen aber verweist Vernunft, oder vielleicht besser vernünftige Tätigkeit, nicht erst ihrem möglichen Inhalte nach auf physische und soziale Güter. Sie ist niemals selbstgenügsam. Oder wie Aristoteles sagt: „Denn die Natur genügt sich selbst zum Betrachten nicht; dazu bedarf es auch der leiblichen Gesundheit, der Nahrung und alles anderen, was zur Notdurft des Lebens gehört.“ 196 Doch merkwürdigerweise hat er aus dieser immer wieder anklingenden Einsicht nicht die naheliegenden Konsequenzen gezogen und der Vernunft insgesamt, also auch der theoretischen, Selbstgenügsamkeit abgesprochen. 194 Ebd., Seite 239. Vgl. ebd., Seite 247f. 196 Ebd., Seite 449. 195 80 Aber nicht nur auf dieser Vollzugsebene erweist sich die Selbstgenügsamkeit der „theoretischen Vernunft“ als unhaltbar. Die Selbstgenügsamkeit der „theoretischen Vernunft“ sieht Aristoteles, wie bereits deutlich gemacht, deshalb gegeben, weil sie auf inhaltlicher Ebene weder auf eine ihr äußerliche, zu vollziehende Handlung noch auf einen ihr äußerlichen, hervorzubringenden Gegenstand oder Sachverhalt gerichtet ist. Aber selbst diese inhaltliche Selbstgenügsamkeit löst sich auf, sobald man sich den Handlungscharakter der „theoretischen Vernunft“ vor Augen führt. Denn dann fragt sich, was das Ziel des theoretischen Handelns ist. Nach Aristoteles wäre es die Erkenntnis „notwendiger Wahrheiten“. Nun mag noch die Erkenntnis solcher „notwendigen Wahrheiten“ in den Bereich des theoretischen Handelns, in die Tätigkeit selbst fallen – wobei sie genaugenommen als ein Hervorbringen der Erkenntnis auch als ein praktisches Handeln bezeichnet werden könnte. Das aber, was erkannt wird, fällt wohl kaum in dessen Bereich. Denn die Erkenntnis „notwendiger Wahrheiten“ ist selbst nicht mit diesen „notwendigen Wahrheiten“ identisch. Sie ist deshalb auch in inhaltlicher Hinsicht nicht selbstgenügsam, sondern, zumindest dem Anspruch nach, auf „äußere“, d.h. von ihr unabhängige Sachverhalte bezogen. Nun mag angenommen werden – was durchaus bezweifelt werden kann –, dass das auf die Erkenntnis „notwendiger Wahrheiten“ zielende theoretische Handeln nichts anderem dient als dieser Erkenntnis und ihm so eine relative Selbstgenügsamkeit zukäme und wegen der Notwendigkeit seiner Inhalte in gewisser Weise auch der Zufall ausgeschaltet wäre. Jedoch würde auch dies alles nichts daran ändern, dass das theoretische Handeln weder dem Inhalt noch dem bloßen Vollzug nach einer selbstgenügsamen Tätigkeit gleichkäme. Es wäre eine uns mögliche Handlung, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von anderen Handlungen und Gütern in ein „befriedigendes“ Zusammenspiel mit diesen gebracht werden müsste. Sie läge also nicht auf einer der praktischen Vernunft entrückten Sphäre, sondern wäre Teil einer vernünftigen Praxis, die bei Aristoteles ihr Zentrum im tätigen Geist (nous) als Inbegriff des Vernunftvermögens hätte finden können. So wäre die theoretische Betrachtung eine Tugend nicht über, sondern neben anderen Tugenden. Und selbst wenn man, wie Aristoteles, dieser eine auch noch so große Genussfülle zuschriebe, so würde dies nichts darüber aussagen, wann und wie lange man sich dieser Tätigkeit für ein glückseliges Leben widmen sollte.197 So kann die theoretische Betrachtung keineswegs mehr als das übergeordnete und selbstgenügsame Ziel menschlichen Tuns, als die Glückseligkeit selbst verstanden werden. Anders als es Aristoteles zu zeigen versuchte, verfehlt sie die formalteleologischen Bedingungen. In der Forschung ist bereits viel darüber diskutiert worden, wie die Rolle der theoretischen Betrachtung im Sinne von Aristoteles zu interpretieren sei. Dabei wird zwischen einer 197 Vgl. ebd., Seite 445. 81 „dominanten Interpretation“ und einer „inklusiven Interpretation“ unterschieden.198 Die „dominante Interpretation“ geht davon aus, dass Aristoteles die theoretische Betrachtung mit der Glückseligkeit gleichsetzte. Die „inklusive Interpretation“ geht ihrerseits davon aus, dass die theoretische Betrachtung einen wichtigen, nicht aber den alleinigen Beitrag zur Glückseligkeit leistet. Ich will und kann hier nicht entscheiden, welche dieser beiden Interpretationen im Sinne Aristoteles ist. Es lässt sich aber Folgendes sagen: Aristoteles hätte in dem Versuch, die Glückseligkeit in eine maßgeblich unserem Einfluss obliegende Tätigkeit zu legen und damit die der platonischen Philosophie diagnostizierte teleologische Suffizienz-Problematik zu lösen – anders als Platons Idee des Guten sollte die Glückseligkeit verwirklichbar sein –, bei der „dominanten Interpretation“ landen müssen. Meines Erachtens muss der Versuch, Selbstgenügsamkeit in einer sehr spezifischen und alles andere als selbstgenügsamen Tätigkeit des menschlichen Lebens zu suchen, jedoch scheitern. Ich betrachte die „inklusive Interpretation“ für die systematisch haltbarere. Da aber das inklusive Verständnis der Glückseligkeit weitgehend in die vom Schicksal durchzogene Sphäre äußerer Güter verwoben ist, muss mit diesem der Anspruch auf eine uns obliegende Verwirklichbarkeit aufgegeben werden. Wir mögen uns um unsere Glückseligkeit bemühen, indem wir ihr nicht vorsätzlich zuwiderhandeln und sie begrüßen, wenn sie sich für kurze oder längere Zeit einstellen sollte. Aber wir selbst können Glückseligkeit nicht verwirklichen. Welche der beiden Interpretationen man auch immer Aristoteles zuschreiben mag, letztlich ist keine der beiden in seinem Sinne, wenn es darum gegangen sein sollte, zu zeigen, dass Glückseligkeit etwas ist, das wir in unserem endlichen Leben verwirklichen können. Da hilft auch Aristoteles folgender Aufruf nichts: „Man darf aber nicht auf jene Meinung hören, die uns anweist, als Menschen nur an Menschliches und als Sterbliche nur an Sterbliches zu denken, sondern wir sollen, soweit es möglich ist, uns bemühen, unsterblich zu sein und alles zu tun, um nach dem Besten, was in uns ist, zu leben. Denn mag es auch klein an Umfang sein, ist es doch an Kraft und Wert das bei weitem über alles Hervorragende. Ja, jeder Einzelne ist wohl gerade dieses, wenn anders es unser vornehmster und bester Teil ist. Also wäre es auch unsinnig, wenn einer nicht sein eigenes Leben leben wollte, sondern das eines anderen. Und was wir oben gesagt haben, paßt auch hierher. Was einem Wesen von Natur eigentümlich ist, ist auch für es das beste und genußreichste. Für den Menschen ist dies das Leben nach der Vernunft, wenn die Vernunft am meisten der Mensch ist. Also ist dieses Leben auch das glückseligste.“199 Was aber, so kann man zurückfragen, wenn es gerade unsere Vernunft ist, die uns in praktischtheoretischer Hinsicht deutlich macht, dass es keinen Sinn macht und alles andere als 198 Vgl. Horn, Christoph: „Glück bei Aristoteles“, in: Dieter Thomä/Christoph Henning/Olivia Mitscherlich-Schönherr (Hrsg.): Glück – Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart: J. B. Metzler, 2011, Seite 123f. 199 Aristoteles NE (2001), Seite 443f. 82 befriedigend ist, nach etwas zu streben, das nicht in unserer Macht steht? Was, wenn es gerade unsere Vernunft ist, die uns sagt, dass es sinnlos und unbefriedigend ist, wenn wir unsere Vernunft über unsere sonstige Natur stellen, anstatt sie ohne eine grundsätzliche Hierarchisierung in ein „befriedigendes“ Zusammenspiel mit dieser zu bringen? Im wortwörtlichen Sinne merkwürdig ist es, dass Aristoteles, der sich dieses Widerspruchs bewusst gewesen sein muss, versucht hat, diesen in deontologischem Wortlaut vom Tisch zu wischen: „Man darf aber nicht“ und „wir sollen“. So scheint sich uns, zumindest für einen kurzen Moment, eine der bekanntesten und wirkungsreichsten Strebensethiken unter der Hand als Sollensethik zu entpuppen. Es geht hier nicht allein um die auch Aristoteles nicht verborgen gebliebene Tatsache, dass wir Menschen keineswegs immer alles dafür tun, „nach dem Besten, was in uns ist, zu leben“, keineswegs immer das Beste in diesem Sinne wollen. Diesen Widerspruch zwischen ethischem Anspruch und ethischer Wirklichkeit hätte Aristoteles unter Umständen noch durch das Wort „sollen“ in den Griff bekommen können. Dies aber ist unmöglich, wenn, wie bei ihm der Fall, ein Widerspruch in dem ethischen Anspruch, im „Sollen“ selbst zutage tritt. Etwas nicht Leistbares verwirklichen zu sollen, ist genauso unvernünftig wie etwas nicht Leistbares verwirklichen zu wollen. Sein Verweis auf ein Sollen hilft Aristoteles also nicht weiter. Er hat den Widerspruch zwischen der Aussage, dass vollkommene Glückseligkeit das Endziel unseres Strebens ist, und der Aussage, dass vollkommene Glückseligkeit außerhalb dessen liegt, was wir in unserem endlichen Leben erreichen können, nicht aufgelöst. Aristoteles hat es demnach nicht geschafft, Vernunft und Wirklichkeit praktisch-theoretisch in Einklang miteinander zu bringen, wenn ein vernünftiges Leben in der Verwirklichung von Glückseligkeit in unserem endlichen Leben bestehen soll. ... und über Kant ... Dieses Ergebnis aber ließe die Glückseligkeit als zeitlich zu verwirklichendes Ziel unseres Handelns ausscheiden. Dementsprechend könnte auch kein praktisch relevanter Fortschrittsbegriff auf dem der Glückseligkeit aufbauen. Einer der diesen Schritt nicht gehen wollte, war Immanuel Kant. Diese Feststellung mag vielleicht verwundern, wird doch die kantische Ethik für gewöhnlich geradezu in Gegensatz zur aristotelischen gestellt. Für mich spricht allerdings vieles gegen eine solche Gegensätzlichkeit. Dies wird allein daran deutlich, dass im Zentrum sowohl der aristotelischen als auch der kantischen Ethik ein tugendhaftes und auf Glückseligkeit zielendes Leben nach der Vernunft steht. Damit sollen nicht die Unterschiede zwischen beiden Ethiken geleugnet werden. Aber ich denke, dass sie nicht im Sinne einer grundsätzlichen Gegensätzlichkeit interpretiert werden müssen. Vielmehr kann die Ethik Kants als ein Versuch verstanden werden, die von Aristoteles nicht aufgelöste teleologische Suffizienz-Problematik des 83 Glückseligkeitsbegriffs schließlich doch in den Griff zu bekommen. Es wird sich jedoch zeigen, dass auch Kant diese Aufgabe nicht gelöst hat. Die „dominante Interpretation“ der aristotelischen Glückseligkeit hat sich als theoretisch unhaltbar erwiesen. Auch für Kant kam ein solches eingeschränktes Verständnis der Glückseligkeit nicht in Frage. In großer Nähe zur „inklusiven Interpretation“ schreibt er: „Glückseligkeit ist der Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es, im ganzen seiner Existenz, alles nach Wunsch und Willen geht, und beruhet also auf der Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zwecke, imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrunde seines Willens.“200 Nicht anders als Aristoteles ist Kant sich jedoch im Klaren, dass ein solcher vollkommener „Zustand“ nicht etwas ist, dessen Erreichen wir für unser endliches Leben auch nur erhoffen können. Erneut finden wir uns also in jener widersprüchlichen Situation wieder, in der die vollkommene Glückseligkeit zum Ziel unseres Strebens gesetzt wird, gleichzeitig aber als außerhalb dessen liegend angenommen wird, was wir in unserem endlichen Leben erreichen können. Auch Kant muss also Antwort auf die Frage geben, inwiefern vollkommene Glückseligkeit sinnvoll als Ziel vernünftigen Strebens gelten kann. Vor dem Hintergrund seines „inklusiven“ Verständnisses ist es Kant von vornherein verwehrt, die Auflösung dieses Problems in der Identifizierung der Glückseligkeit als einer vom äußeren Schicksal möglichst unabhängigen partikularen Tätigkeit zu suchen, in deren Rahmen „Vollkommenheit“ als Inbegriff des je „maximal Möglichen“ zu verstehen wäre. Er muss also auf andere Weise „das Schicksal“ in den Griff des individuellen Handelns bekommen und die Vollkommenheit der Glückseligkeit mit der Unvollkommenheit unseres endlichen Lebens in Einklang bringen. Kant ist sich dieser praktisch-theoretischen Problematik nicht nur bewusst, sondern er macht die teleologische Suffizienz-Bedingung explizit zum entscheidenden Prüfstein seiner praktischen Philosophie. Im Abschnitt über die „Antinomie der praktischen Vernunft“ schreibt Kant in der Kritik der praktischen Vernunft: „Da nun die Beförderung des höchsten Guts [...] ein a priori notwendiges Objekt unseres Willens ist, und mit dem moralischen Gesetze unzertrennlich zusammenhängt, so muß die Unmöglichkeit des ersteren auch die Falschheit des zweiten beweisen. Ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich, so muß auch das moralische Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein.“201 An der Frage nach der Möglichkeit der Verwirklichung des dem moralischen Willen notwendig zukommenden Zieles entscheidet sich für Kant also, ob 200 Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft, in: ders.: Werke in zwölf Bänden, Band VII, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956, Seite 255. 201 Ebd., Seite 242f. 84 dem moralischen Gesetz objektive Geltung zugesprochen werden kann, entscheidet sich seine Wahrheit. Noch einmal etwas genauer: Kants Antwort auf die Frage, was es zu tun gilt, ist bekanntlich der kategorische Imperativ. In der Analytik der Kritik der praktischen Vernunft formuliert er diesen als das „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ 202 In der Dialektik bestimmt er dann „die Bewirkung des höchsten Gutes in der Welt“ als „das notwendige Objekt eines durchs moralische Gesetz bestimmbaren Willens“. 203 Kants „höchstes Gut“ ist als Zusammenstimmen von Tugend und Glückseligkeit, d.h. von moralischem Willen und einem mit seiner Verwirklichung verbundenen Genuss zu verstehen.204 Als das „höchste Gut“ physischer, sozialer und theoretischer Wesen geht dieses, soweit es in unserer Welt verwirklicht wird, mit dem Genuss physischer, sozialer und theoretischer Güter einher, wird aber nicht durch diese bestimmt.205 Dazu Kant: „Daß Tugend (als die Würdigkeit glücklich zu sein) die oberste Bedingung alles dessen, was uns nur wünschenswert scheinen mag, mithin auch aller unserer Bewerbung um Glückseligkeit, mithin das oberste Gut sei, ist in der Analytik bewiesen worden. Darum ist sie aber noch nicht das ganze und vollendete Gut, als Gegenstand des Begehrungsvermögens vernünftiger endlicher Wesen; denn, um das zu sein, wird auch Glückseligkeit dazu erfordert, und zwar nicht bloß in den parteiischen Augen der Person, die sich selbst zum Zwecke macht, sondern selbst im Urteile einer unparteiischen Vernunft, die jene überhaupt in der Welt als Zweck an sich betrachtet. Denn der Glückseligkeit bedürftig, ihrer auch würdig, dennoch aber derselben nicht teilhaftig zu sein, kann mit dem vollkommenen Wollen eines vernünftigen Wesens, welches zugleich alle Gewalt hätte, wenn wir uns auch nur ein solches zum Versuche denken, gar nicht zusammen bestehen.“206 Für Kant ist also die „völlige Angemessenheit der Gesinnung zum moralischen Gesetze die oberste Bedingung des höchsten Guts“,207 „worin doch Tugend immer, als Bedingung, das oberste Gut ist, weil es weiter keine Bedingung über sich hat, Glückseligkeit immer etwas, was dem, der sie besitzt, zwar angenehm, aber nicht für sich allein schlechterdings und in aller Rücksicht gut ist, sondern jederzeit das moralische gesetzmäßige Verhalten als Bedingung voraussetzt“.208 Deshalb 202 Ebd., Seite 140. Ebd., Seite 252. 204 Vgl. ebd., Seite 238ff.; ich schließe mich mit dieser Interpretation der Untersuchung Pauline Kleingelds an; vgl. Kleingeld, Pauline: Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie Kants, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995, Seite 152ff. 205 Vgl. Kleingeld (1995), Seite 144f. 206 Kant KpV (1956), Seite 238. 207 Ebd., Seite 252. 208 Ebd., Seite 239. 203 85 muss die völlige Angemessenheit der Gesinnung „eben sowohl möglich sein, als ihr Objekt, weil sie in demselben Gebote es zu befördern enthalten ist“.209 Nach der Vernunft zu leben, bedeutet für Kant das „unaufhörliche Streben“ zur „pünktlichen und durchgängigen Befolgung“ des moralischen Gesetzes. 210 In dieser „Gesinnung“ zielen wir notwendigerweise auf „die Beförderung des höchstens Guts“ als der Übereinstimmung von Tugend und Glückseligkeit. 211 Eine „durchgängige und pünktliche Befolgung“ des moralischen Gesetzes aber wäre nicht nur eine „völlige Angemessenheit der Gesinnung zum moralischen Gesetze“, sondern auch eine „völlige Angemessenheit des Willens“ insgesamt, d.h. vollkommene Sittlichkeit, die nach Kant vollkommene Glückseligkeit zur Folge haben müsste. 212 „Sofern nun Tugend und Glückseligkeit zusammen den Besitz des höchsten Guts in einer Person, hiebei aber auch Glückseligkeit, ganz genau in Proportion der Sittlichkeit (als Wert der Person und deren Würdigkeit glücklich zu sein) ausgeteilt, das höchste Gut einer möglichen Welt ausmachen: so bedeutet dieses das Ganze, das vollendete Gute, [...].“213 Auf was wir nach Kant also in unserem vernünftigen Streben nach „pünktlicher und durchgängiger Befolgung“ des moralischen Gesetzes notwendigerweise zielen, ist letztlich vollkommene Glückseligkeit. In diesem Zusammenhang wird der erste Aspekt seines Lösungsversuches der teleologischen Suffizienz-Problematik deutlich. Kant schließt, anders als Aristoteles, das „Schicksal“ als Störungsgröße zwischen Sittlichkeit bzw. Tugendhaftigkeit und „inklusiver“ Glückseligkeit aus. Glückseligkeit wird „ganz genau in Proportion der Sittlichkeit“ ausgeteilt. Weiter unten wird genauer gezeigt werden, wie Kant diese Annahme zu rechtfertigen sucht. Mit dieser Annahme tritt die Frage nach der Angemessenheit bzw. Unangemessenheit des Willens zum moralischen Gesetz ins Zentrum der Problematik. Als einzige Begründung für das Ausbleiben unserer vollkommenen Glückseligkeit bliebe so unsere sittliche Fehlbarkeit. Nun könnte an dieser Stelle der Zufall erneut seine Finger ins Spiel bringen. Kann es nicht sein, dass unsere sittlichen Fähigkeiten stark durch das „Schicksal“ geprägt sind? Kant geht dieser 209 Ebd., Seite 252. Vgl. ebd., Seite 253. 211 Vgl. ebd., Seite 252. 212 Diese Unterscheidung zwischen „völliger Angemessenheit der Gesinnung“ und „völliger Angemessenheit des Willens“ ist, wie wir sehen werden, für die kantische Argumentation sehr entscheidend. Die „völlige Angemessenheit der Gesinnung“ zum moralischen Gesetz als „unaufhörliches Streben“ nach „durchgängiger und pünktlicher Befolgung“ desselben und damit nach vollkommener Glückseligkeit ist uns nach Kant als endlichen Wesen möglich. „Sie [die völlige Angemessenheit der Gesinnung; T. W.] muss also ebenso möglich sein, als ihr Objekt, weil sie in demselben Gebote dieses zu befördern enthalten ist.“ Die „völlige Angemessenheit des Willens“ aber, als vollkommene Übereinstimmung unseres Tuns mit dem moralischen Gesetze ist zwar Ziel der „völligen Angemessenheit der Gesinnung“ liegt aber außerhalb dessen, was wir in einem endlichen Leben erreichen können. „Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein vernünftiges Wesen der Sinnenwelt, in keinem Zeitpunkte seines Daseins, fähig ist.“; vgl. ebd., Seite 252. 213 Ebd., Seite 239. 210 86 Möglichkeit durch seine Konzeption der moralischen Gesinnung von vorherein aus dem Weg. Indem er die Glückseligkeit als Glückseligkeit vernünftiger Wesen definiert, grenzt er alle Fälle fehlender Vernunft aus. Mag der Zufall auch unvernünftige Lebewesen hervorbringen, sie bleiben außerhalb der kantischen Ethik. Vernunft aber ist für Kant am Ende allein praktisch, „weil alles Interesse zuletzt praktisch ist, und selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt und im praktischen Gebrauche allein vollständig ist.“214 Praktische Vernunft zu haben wiederum bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, a priori, d.h. unabhängig von irgendwelchen empirischen Umständen, das moralische Gesetz zu erkennen und zum Inhalt der „Gesinnung“ zu machen. Dies ist meines Erachtens auch einer der Hauptgründe, warum sich Kant von der aristotelischen Klugheitslehre distanziert hat. Die Klugheit (phronesis) ist zu sehr vom Zufall bestimmt, als dass sie im Zentrum rationalen Handelns stehen könnte. Zum einen ist auch für Aristoteles Klugheit, so wie alle anderen Tugenden, eine Eigenschaft, die nur mühsam durch Erfahrung erworben, durch falsche Erziehung und falsche Ratschläge jedoch stark behindert werden kann. Erziehung und fremde Ratschläge aber sind empirische Umstände, die für denjenigen, dem sie zuteil werden, zufällig sind. Zum anderen muss, und dies scheint mir für Kant das entscheidendere Argument zu sein, eine endliche Vernunft in dem Versuch der Erkenntnis des überkomplexen Zusammenhangs möglicher Handlungen und deren Verhältnis zur Glückseligkeit stets an ihre Grenze stoßen. Und das umso mehr, als die Klugheit eben nicht auf partiale Qualitäten einzelner Handlungen, sondern auf deren Qualifizierung in Bezug auf „das gute Leben im ganzen“ gerichtet ist.215 Sie kann aus Gründen ihrer Endlichkeit oder auch Begrenztheit selbst unter den besten Voraussetzungen prinzipiell nicht leisten, was Aristoteles von ihr verlangt, nämlich im Zusammenspiel mit dem Geist (nous) die praktische „Wahrheit“ zu finden, d.h. das der Glückseligkeit entsprechende richtige Tun. So zumindest sieht es Kant: „Was aber wahren dauerhaften Vorteil bringe, ist allemal, wenn dieser auf das ganze Dasein erstreckt werden soll, in undurchdringliches Dunkel eingehüllt, und erfordert viel Klugheit, um die praktische darauf abgestimmte Regel durch geschickte Ausnahmen auch nur auf erträgliche Art den Zwecken des Lebens anzupassen.“216 Eine so geartete Klugheit kann in Bezug auf die Glückseligkeit nicht zum praktischen Kriterium einer vernünftigen Praxis werden, wenn die Vernünftigkeit der Praxis unter anderem gerade darin bestehen soll, dass das Erreichen gesetzter Ziele im Einflussbereich individuellen Strebens liegt. Wenn die „inklusive“ Glückseligkeit von der Klugheit als der zwischen den verschiedenen Tugenden vermittelnden Tugend abhängig gemacht wird, diese aber nicht nur vom Zufall beeinflusst ist, sondern dem an sie gestellten Anspruch prinzipiell, d.h. auch unabhängig von der Zufallsproblematik, nicht gerecht werden kann, dann erfüllt noch nicht einmal die „innere“ 214 Ebd., Seite 252. Vgl. Aristoteles NE (2001), Seite 245. 216 Kant KpV (1956), Seite 149. 215 87 Tugendtätigkeit jene praktisch-theoretische Suffizienz-Bedingung, die Aristoteles durch diese gerade gesichert sehen will. Tugendhaftes Handeln läge so außerhalb unseres Einflussbereiches. Dann wäre es nicht nur unmöglich, „daß der wahrhaft Gute und Verständige in guter Haltung jede Art von Schicksal trägt und in der gegebenen Lage stets das Beste tut [...].“217 Sondern der „wahrhaft Gute“ wäre selbst eine Unmöglichkeit. Die kantische Kritik an Aristoteles erwächst meines Erachtens nicht in Hinsicht auf das Verhältnis zwischen Tugend und Glückseligkeit. Denn auch Aristoteles macht wie Kant die Tugend zur Bedingung der Glückseligkeit. Dies wird gerade auch im Rahmen seiner Ausführungen zur Klugheit deutlich. „Wie wir sagen, daß Menschen, die gerecht handeln, darum noch nicht Gerechte sind, etwa solche, die das von den Gesetzen Vorgeschriebene nicht aus sich tun, sondern widerwillig oder aus Unwissenheit oder aus irgendeiner anderen Ursache (dennoch tun sie aber, was man soll und was der Tugendhafte tun soll), so scheint es auch eine bestimmte Verfassung zu geben, in der man erst handelt, so daß es wirklich gut ist, ich meine durch Willensentscheidung und um der Tat selbst willen. Die Willensentscheidung wird nun durch die Tugend richtig; daß aber alles geschieht, was seiner Natur nach um dieses Zieles willen geschehen muss, das ist nicht das Werk der Tugend [nicht der ethischen Tugend, doch aber der dianoethischen Tugend; T. W.], sondern einer andern Fähigkeit. [...] Man muß aber noch einen kleinen Schritt weitergehen: nicht nur die Haltung gemäß der rechten Einsicht, sondern auch diejenige mit der rechten Einsicht ist Tugend. Die rechte Einsicht in diesen Dingen ist aber die Klugheit.“218 Das Handeln aus „rechter Einsicht“ und nicht aus Gründen der Lust oder Unlust ist bei Aristoteles nicht anders als bei Kant die für das tugendhafte Handeln und die Glückseligkeit entscheidende Haltung. „Denn die Prinzipien des Handelns liegen in seinem Zwecke. Ist man aber durch Lust oder Schmerz verdorben, so sieht man gleich das Prinzip nicht mehr, und man weiß nicht mehr, daß man um seinetwillen und wegen ihm alles wählen und tun soll.“219 Bei Aristoteles ist dieses Prinzip die um ihrer selbst willen erstrebte Glückseligkeit. Klugheit bedeutet die „rechte Einsicht“ bezüglich all dessen, „was seiner Natur nach um dieses Zieles willen geschehen muss“. Kant negiert nun, dass uns eine empirisch gegründete Klugheit zu dieser Einsicht verhelfen kann. Nach Aristoteles müssten wir bezüglich einer bestimmten Handlung in etwa zur folgenden Einsicht gelangen können: Ich tue dieses bestimmte, weil es der Glückseligkeit entspricht und die Glückseligkeit „das Ziel und das Beste ist“.220 Zu einer solchen Einsicht in die Verbindung bestimmter Handlungen mit dem Ziel der Glückseligkeit aber ist laut Kant die endliche Vernunft überhaupt nicht fähig. Wäre sie es, so hätte Kant wohl keine 217 Aristoteles NE (2001), Seite 43f. Ebd., Seite 265ff. 219 Ebd., Seite 247. 220 Vgl. ebd., Seite 265. 218 88 grundsätzlichen Probleme mit der aristotelischen Ethik gehabt, sieht man einmal von seiner Kritik der Mesotes-Lehre ab.221 Egal wie tugendhaft eine bestimmte Handlung in bestimmter Hinsicht auch immer sein mag, wir können nicht einsehen, ob sie zur Glückseligkeit gereicht. Damit kann die Glückseligkeit, wenn sie auch das Ziel unseres Handelns sein mag, nicht als Prinzip der Bestimmung unseres Willens dienen. Wenn auch in der aristotelischen Ethik gilt, keine Glückseligkeit ohne Tugend, so bleibt die Verbindung und damit die Orientierung tugendhafter Handlungen im Hinblick auf die Glückseligkeit ungeklärt. Sie wird in dem Begriff der „Klugheit“ bloß postuliert. Und Kant wäre der letzte, der Postulate im praktisch-theoretischen Zusammenhang abgelehnt hätte. Ihm zufolge widerspricht diesem Postulat aber die Erfahrung, dass die endliche Vernunft zu einer solchen Leistung überhaupt nicht fähig ist. Ein Postulat, das der Erfahrung widerspricht, verliert grundsätzlich seine Berechtigung. Kann die Glückseligkeit aus den genannten Gründen nicht als Handlungsprinzip, d.h. zur Bestimmung des Willens dienen, so liegt der Verdacht nahe, dass einer durch das Ziel der Glückseligkeit bestimmten Praxis hinterrücks nichts anderes übrig bleibt, als sich an Lust und Unlust zu orientieren, die Lust zu suchen, die Unlust zu meiden.222 Ein solches Lust-Unlust-Kalkül kann aber weder für Kant noch für Aristoteles Bestimmungsgrund von Tugend sein. In seiner Überschätzung der Fähigkeit der endlichen Vernunft kann Aristoteles noch behaupten, dass die Prinzipien des Handelns in seinem Zweck, d.h. in der Glückseligkeit liegen. Kant aber sieht, dass die aristotelische Klugheit in ihrer empirischen Begrenztheit das Streben nach Glückseligkeit ungewollt zu einem Streben nach eigenem Lustempfinden verkommen lässt. So bezeichnet er denn auch die Klugheit als „Maxime der Selbstliebe“.223 Wenn die Glückseligkeit also nicht zur Orientierung des endlichen Willens dienen kann, dann stellt sich die Frage, worin anders das Prinzip des Handelns liegen kann. Kant argumentiert dafür, dass der „kategorische Imperativ“ als das „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“ eben dieses Prinzip darstelle. Er ist der Ansicht, dass die endliche Vernunft, anders als hinsichtlich der von Aristoteles postulierten, auf Glückseligkeit gerichteten Klugheit, zur Erkenntnis des „sittlichen Gesetzes“ a priori in der Lage ist. Was nach diesem Prinzip „zu tun sei, ist für den gemeinen Verstand ganz leicht und ohne Bedenken einzusehen“, so dass selbst „der gemeinste und ungeübteste Verstand selbst ohne Weltklugheit damit umzugehen“ weiß.224 „Dem kategorischen Gebote der Sittlichkeit Genüge zu leisten, ist in jedes Gewalt zu aller Zeit, der empirisch-bedingten Vorschrift der Glückseligkeit nur selten, und bei weitem nicht, auch nur in Ansehung einer einzigen Absicht, für jedermann möglich.“225 Wie oben deutlich gemacht, bedeutet dies jedoch 221 Vgl. Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten, in: ders.; Werke in zwölf Bänden, Band VIII, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956, Seite 535f., 566f. 222 Vgl. Kant KpV (1956), Seite 128f. 223 Vgl. ebd., Seite 148. 224 Vgl. ebd., Seite 149. 225 Ebd., Seite 149. 89 nicht, dass damit Glückseligkeit als Ziel eines auf das „sittliche“ oder „moralische Gesetz“ gerichteten Willens wegfallen würde. Vielmehr bezieht Kant die Glückseligkeit im Rahmen des Begriffs des „höchsten Guts“ als das „notwendige Objekt eines durchs moralische Gesetz bestimmbaren Willens“ unmissverständlich mit ein.226 Glückseligkeit bleibt als Aspekt der Zielbestimmung bestehen, nicht aber als Prinzip der Bestimmung des Willens. Genauso wenig wie bei Aristoteles die Glückseligkeit von der Tugend entkoppelt ist, lässt Kant die Glückseligkeit als Ziel des Wollens fallen. Anders aber als Aristoteles, und meines Erachtens aus nachvollziehbaren Gründen, vertritt Kant die Position, dass der Begriff der Glückseligkeit letztlich keine Handlungsorientierung biete, die, über den bloßen Anspruch hinaus, eine vom Hedonismus zu unterscheidende Praxis ermöglichen würde. Wenn Aristoteles im Hinblick auf die Glückseligkeit sagt, „man darf aber nicht auf jene Meinung hören, die uns anweist, als Menschen nur an Menschliches und als Sterbliche nur an Sterbliches zu denken, sondern wir sollen, soweit es möglich ist, uns bemühen, unsterblich zu sein und alles zu tun, um nach dem Besten, was in uns ist, zu leben“227, so kann man Kants Konzentration auf das „Sollen“ als den Versuch verstehen, die im aristotelischen „Sollen“ unbewältigte teleologische Suffizienz-Problematik zu lösen. Und in der Konzentration auf das „Sollen“, so Kants Position, ist es selbst dem „gemeinen Verstand ganz einfach und ohne Bedenken“ möglich, das entscheidende Prinzip zu erkennen, das „zu aller Zeit“ ein tugendhaftes Leben ermöglicht. Ein solches uneingeschränkt gültiges Prinzip muss, so Kant, die Form eines allgemeinen Gesetzes annehmen. Denn ohne Allgemeingültigkeit könnte es nicht zur durchgehenden Orientierung eines tugendhaften Lebens dienen. Dieses Gesetz aber, insofern es uneingeschränkt gültig sein soll, kann nicht als abhängig von irgendwelchen empirischen Bedingungen gedacht werden. Deshalb „bleibt nichts, als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlung gemäß sein soll [...].“228 „Der Wille wird als unabhängig von empirischen Bedingungen, mithin, als reiner Wille, durch die bloße Form des Gesetzes als bestimmt gedacht, und dieser Bestimmungsgrund als die oberste Bedingung aller Maximen angesehen. [...] Denn der Gedanke a priori von einer möglichen allgemeinen Gesetzgebung, der also bloß problematisch ist, wird, ohne von der Erfahrung oder irgend einem äußeren Willen etwas zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. [...] Man kann das Bewußtsein dieses Grundgesetztes ein Faktum der Vernunft nennen [...].“229 Insofern für diese subjektive Einsicht nach Kant zunächst nichts weiter als endliche Vernunft selbst vorausgesetzt werden muss und sie demnach als jedem vernünftigen Subjekt zugängliche Einsicht verstanden werden kann, erscheint es gerechtfertigt, ihr nicht nur subjektive, sondern auch objektive Gültigkeit zuzusprechen. 226 Vgl. ebd., Seite 238f., Seite 252ff., sowie Seite 178f. Aristoteles NE (2001), Seite 443f. 228 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metapyhsik der Sitten, in: ders.: Werke in zwölf Bänden, Band VII, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956, Seite 51. 229 Kant KpV (1956), Seite 141. 227 90 Sie gilt für alle vernünftigen Wesen. „Reine Vernunft ist für sich allein praktisch, und gibt (dem Menschen) ein allgemeines Gesetz, welches wir das Sittengesetz nennen.“230 Oder, wie weiter oben bereits zitiert, das „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“231 Kants Formulierung dieses Grundgesetzes führt uns auf das „Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung“, d.h. auf die Form der allgemeinen Gesetzgebung als Prinzip der Tugend überhaupt zurück. Deren durchgängige Befolgung hätte eine Welt zur Folge, in der die „vernünftigen Wesen in ihr, sofern deren freie Willkür unter moralischen Gesetzen sowohl mit sich selbst, als mit jedes anderen Freiheit durchgängige systematische Einheit an sich hat“ 232, es im Ganzen ihrer Existenz also „alles nach Wunsch und Willen“ ginge, glückselig wären.233 So wird verständlich, inwiefern sich Kant dazu berechtigt sieht, „eigene Vollkommenheit“ und „fremde Glückseligkeit“ als die beiden „Zwecke, die zugleich Pflichten sind“, aus dem „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft“ abzuleiten. „Eigene Vollkommenheit“, die „völlige Angemessenheit des Willens“ zum moralischen Gesetz ist ein Zweck, den sich die subjektive Willkür setzen kann. Er ist zugleich Pflicht, insofern das moralische Gesetz eben genau dies fordert. Mit der „eigenen Vollkommenheit“ zielt die subjektive Willkür zugleich aber auch auf „fremde Glückseligkeit“, weil die „eigene Vollkommenheit“ der maximale, subjektiv mögliche Beitrag eben zu jenem Zusammenstimmen der eigenen mit jeder anderen Freiheit ist, also für eine Welt, in der allen „alles nach Wunsch und Willen geht“. „Eigene Glückseligkeit“ sei zwar ein Zweck, könne aber keine Pflicht sein, weil jeder sie ohnehin „von selbst will“. „Fremde Vollkommenheit“ könne weder Pflicht noch Zweck sein. Denn sich diese zum Zweck zu setzen, obliege allein der jeweiligen fremden Willkür, könne also auch nur für diese eine Pflicht sein. 234 „Eigene Vollkommenheit“ und „fremde Glückseligkeit“ sind die zwei Seiten des „Grundgesetzes der reinen praktischen Vernunft“, dessen „notwendiges Objekt“ das „höchste Gut“ als die durch Glückseligkeit vollendete Tugend ist. Die Vorstellung der durchgängigen Befolgung des moralischen Gesetzes führt uns zu der Vorstellung einer „moralischen Welt, in deren Begriff wir von allen Hindernissen der Sittlichkeit (der Neigungen) abstrahieren, ein solches System der mit der Moralität verbundenen proportionierten Glückseligkeit auch als notwendig denken, weil die durch sittliche Gesetze teils bewegte, teils restringierte Freiheit selbst die Ursache der allgemeinen Glückseligkeit, die vernünftigen Wesen also selbst, unter der Leitung solcher Prinzipien, 230 Ebd., Seite 142. Ebd., Seite 140. 232 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, in: ders: Werke in zwölf Bänden, Band III und IV, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956, Seite 679. 233 Vgl. Kant KpV (1956), Seite 255. 234 Vgl. Kant MdS (1956), Seite 515f. 231 91 Urheber ihrer eigenen und zugleich anderer dauerhaften Wohlfahrt sein würden.“235 Auch wird hier noch einmal deutlich, inwiefern Glückseligkeit zwar das Ziel eines durch das moralische Gesetz bestimmten Willens ist, nicht aber als Prinzip der Bestimmung subjektiver Willkür dient. Nicht aus dem Begriff der Glückseligkeit kann bestimmt werden, was zu tun sei, sondern im Hinblick auf das, was zu tun sei, erscheint Glückseligkeit als mögliche Wirklichkeit am Horizont der praktischen Vernunft. Nun ist der kantischen Philosophie immer wieder der Vorwurf gemacht worden, mit ihrer Konzeption des Tugendprinzips die ethische bzw. moralische Problematik auf eine abstrakte und rein formale Ebene zu heben, die weit davon entfernt ist, eine alltagstaugliche und der Wirklichkeit gerecht werdende Orientierung bieten zu können. Weil das „Grundgesetz der praktischen Vernunft“ von allen empirischen Bedingungen des Handelns absehe, könne es nicht als praktikables Prinzip von Handlungen dienen. Vor diesem Hintergrund müsste allem Handeln, das stets durch empirische Faktoren geprägt und der Wille also niemals „rein“ und durch die „bloße Form des Gesetzes“ bestimmt ist, letztlich die Tugendhaftigkeit abgesprochen werden. Tugend wäre somit ein Ding der Unmöglichkeit. Und man könnte daher den Schluss ziehen, dass Kant es aus diesem Grunde genauso wenig wie Platon und Aristoteles geschafft hat, die teleologische Suffizienz-Problematik zu lösen. Ich bin dahingegen der Ansicht, dass sich Kants Philosophie gegen die Abstraktheits- und Formalismus-Vorwürfe gut verteidigen lässt. Hierzu sei neben Kants eigenen Ausführungen zur konkreten Anwendung des kategorischen Imperativs und der aus ihm abgeleiteten Tugendpflichten auf die Arbeiten von Onora O´Neill, Marcia Baron und Christoph Horn verwiesen.236 Der kategorische Imperativ abstrahiert zwar als solcher von allen empirischen Bedingungen, erfährt seine Anwendung aber gerade im Hinblick auf eine empirische Praxis. Er ist als Prinzip eines reflexiven Verfahrens zu verstehen, in dem es vernünftigen Wesen im Hinblick ihrer wie auch immer bedingten Handlungsmöglichkeiten möglich ist, jene Handlungen auszuscheiden, die der Pflicht und damit der Tugendhaftigkeit widersprechen. Der kategorische Imperativ ist entscheidend für die Bestimmung der Maximen, denen konkrete Handlungen entsprechen sollen, nicht aber für die Bestimmung der konkreten Handlungen selbst. „Denn wenn das Gesetz nur die Maxime der Handlungen, nicht die Handlungen selbst, gebieten kann, so ist´s ein Zeichen, daß es der Befolgung (Observanz) einen Spielraum (latitudo) für die freie Willkür überlasse, d. i. nicht bestimmt angeben 235 Kant KrV (1956), Seite 680. Vgl. Kant GMS (1956), Seite 52ff.; sowie die Kasuistiken in der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten, Kant MdS (1956), Seite 553ff.; O´Neill, Onora: „Kantische Gerechtigkeit und kantianische Gerechtigkeit“, in: Karl Ameriks/Dieter Sturma (Hrsg.): Kants Ethik, Münster: mentis, 2004, Seite 58-73; Baron, Marcia: „Handeln aus Pflicht“, in: ebd., Seite 80-97; Horn, Christoph: „Die Menschheit als objektiver Zweck – Kants Selbstzweckformel des kategorischen Imperativs“, in: ebd., Seite 195-212 sowie Horn, Christoph/Mieth, Corinna/Scarano, Nico: „Kommentar“ in: Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007. 236 92 könne, wie und wie viel durch die Handlung zu dem Zweck, der zugleich Pflicht, gewirkt werden sollte.“237 Für Kant gibt es, wie gezeigt, zwei Zwecke, die zugleich Pflichten sind: „eigene Vollkommenheit“ und „fremde Glückseligkeit“.238 Aus diesen leitet er weitere Pflichten „gegen sich selbst“ und „gegen andere“ ab, die wiederum stets nur als Maximen von Handlungen, nicht aber zur konkreten Bestimmung von Handlungen dienen können. In diesem hier von Kant offen gelassenen Spielraum ist nicht nur Platz für die Klugheit, wie Kant es selbst in der Metaphysik der Sitten ausführt,239 Sondern meines Erachtens auch für die aus „erster“ und „zweiter Natur“ erwachsenden Bedürfnisse und Bedingungen, unter deren Einfluss sich die Bestimmung von konkreten Handlungsmöglichkeiten vollzieht.240 Kant negiert nicht den Einfluss von „erster“ und „zweiter Natur“ sowie von Klugheit auf die Praxis, sondern er negiert nur ihre Eignung, dem Handeln vernünftiger Wesen eine „auf das ganze Dasein“ bezogene Richtung geben zu können. Diese findet sich nach Kant allein in dem Prinzip der reinen praktischen Vernunft als der formalen Bestimmung einer allgemeinen Gesetzgebung, die unbedingt und widerspruchsfrei gebietet, welcher Maxime nach es zu handeln gilt. Es war mir wichtig, deutlich zu machen, dass das Problem der kantischen Philosophie in Bezug auf die teleologische Suffizienz-Bedingung nicht in der formalen Definition des kategorischen Imperativs liegt. Ich sehe nicht, dass seine Abstraktheit es grundsätzlich verhindern würde, ihn in einen sinnvollen Zusammenhang mit empirischen Sachverhalten zu setzen. Meines Erachtens liegt das Problem vielmehr, wie ich nun zeigen will, im Festhalten an dem Begriff der Glückseligkeit. Kant hat es selbst als ein Problem angesehen, dass jene Vorstellung einer „moralischen Welt“ als einem „System der mit der Moralität verbundenen proportionierten Glückseligkeit“ als solche an die Bedingung gekoppelt ist, dass alle vernünftigen Wesen in ihren Handlungen dem moralischen Gesetz entsprechen. „Aber dieses System der sich selbst lohnenden Moralität ist nur eine Idee, deren Ausführung auf der Bedingung beruht, daß jedermann tue, was er soll, d. i. alle Handlungen vernünftiger Wesen so geschehen, als ob sie aus einem obersten Willen, der alle Privatwillkür in sich, oder unter sich befaßt, entsprängen. Da aber die Verbindlichkeit aus dem moralischen Gesetze für jedes besonderen Gebrauche der Freiheit gültig bleibt, wenn gleich andere diesem Gesetze sich nicht gemäß verhielten, so ist weder aus der Natur der Dinge der Welt, noch der Kausalität der Handlungen selbst und ihrem Verhältnis zur Sittlichkeit bestimmt, wie sich ihre Folgen zur Glückseligkeit verhalten werden, und die angeführte notwendige Verknüpfung der Hoffnung, glücklich zu sein, mit dem 237 Kant MdS (1956), Seite 520. Vgl. ebd., Seite 515. 239 „Denn beide Tugendpflichten haben einen Spielraum der Anwendung (latitudinem) und, was zu tun sei, kann nur von der Urteilskraft, nach Regeln der Klugheit (den pragmatischen), nicht denen der Sittlichkeit (den moralischen) [...] entschieden werden.“ Ebd., Seite 567, Fußnote. 240 Vgl. ebd., Seite 522. 238 93 unablässigen Bestreben, sich der Glückseligkeit würdig zu machen, kann durch die Vernunft nicht erkannt werden, wenn man bloß Natur zum Grunde legt [...].“241 Was Kant hier bemerkt, ist, dass es einem vernünftigen, sich durch das moralische Gesetz bestimmenden und darin notwendig auf das zweite „Bestandsstück“ des höchsten Gutes als der proportional zur Sittlichkeit zuteilwerdenden Glückseligkeit zielenden Willen zuwiderlaufen würde, wenn diese proportionale Zuteilung ausbliebe.242 Halten sich nicht alle vernünftigen Wesen an das moralische Gesetz, so ist nicht zu ersehen, wie in einer so gearteten Welt der noch so tugendhaft Handelnde von dem durch andere verursachten Leid und Unglück freigehalten werden soll. Man kann diese Problematik noch einmal verschärfen: In einer Welt, in der nicht nur sozialer Unbill als Quelle von Unglück gelten kann, sondern in der wir auch von anderen negativen Umwelteinflüssen bedroht sind, können wir selbst dann, wenn sich alle vernünftigen Wesen vollkommen tugendhaft verhielten, nicht einsehen, wie eine proportionale Entsprechung von Tugend und Glückseligkeit jemals als gesichert angenommen werden kann. So sehr wir uns also auch tugendhaft verhalten mögen und uns in diesem Sinne der Glückseligkeit als würdig erweisen, können wir „weder aus der Natur der Dinge der Welt, noch der Kausalität der Handlungen“ entnehmen, wie uns Glückseligkeit in Proportion zu unserer Sittlichkeit überhaupt zuteil werden könnte, außer durch einen völlig unwahrscheinlichen Zufall. Vor diesem theoretischen Hintergrund verliert, so Kant, alle Moralität an Kraft und es liegt der Gedanke nahe, dass „das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich“ und „das moralische Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein“ muss. 243 „Denn der Glückseligkeit bedürftig, ihrer auch würdig, dennoch aber derselben nicht teilhaftig zu sein, kann mit dem vollkommenen Wollen eines vernünftigen Wesens [...] gar nicht zusammen bestehen.“ 244 Um dieses Problem zu lösen, hat Kant nun die praktische Vernunft dazu berechtigt gesehen, „das Dasein Gottes“ zu postulieren. Nur ein der moralischen und natürlichen Welt gemeinsamer Urheber könne den „notwendigen Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und der ihr proportionierten Glückseligkeit eines zur Welt als Teil gehörigen, und daher von ihr abhängigen, Wesens, welches eben darum durch seinen Willen nicht Ursache dieser Natur sein, und sie, was seine Glückseligkeit betrifft, mit seinen praktischen Grundsätzen aus eigenen Kräften nicht durchgängig einstimmig machen kann“, gewährleisten. 245 „Folglich ist das Postulat des höchsten 241 Kant KrV (1956), Seite 680f. Kant KpV (1956), Seite 258. 243 Vgl. ebd., Seite 242f. 244 Ebd., Seite 238. 245 Vgl. ebd., Seite 255f. 242 94 abgeleiteten Guts (der besten Welt) zugleich das Postulat der Wirklichkeit eines höchsten ursprünglichen Guts, nämlich der Existenz Gottes.“246 Man kann die Legitimität dieser „Moraltheologie“ mit Recht in Frage stellen.247 Denn dadurch, dass wir die Wirklichkeit eines Gottes voraussetzen müssen, damit das kantische moralische Gesetz uns nicht als „phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch“ erscheint, ist dessen Existenz nicht im geringsten bewiesen. Es sei Kant hier aber zugestanden, dass durch die Berechtigung des Zweifels nicht auch schon das Gegenteil gilt, die Nichtexistenz Gottes. Und solange es zumindest möglich ist, die Existenz eines Gottes, wie ihn Kant uns hier vorstellt, zu denken, ohne die praktische Vernunft in einen Widerspruch mit der theoretischen Vernunft zu bringen, führt die Abhängigkeit von diesem moraltheologischen Glaubensakt zumindest nicht zur Inkonsistenz der kantischen Ethik, wenn sie vielleicht auch an Überzeugungskraft verliert. Man kann Kant also das Gottespostulat konsistenztheoretisch zugestehen, solange es nicht durch einen unaufhebbaren Widerspruch im Verhältnis zu unserer theoretischen Vernunft oder durch einen empirischen Nachweis der Nichtexistenz des kantischen Gottes falsifiziert wird. Ich sehe nicht, dass dies bereits geschehen wäre, noch wie dies geschehen sollte. Auf der Ebene begrifflicher Konsistenz mag Kant das Problem des Zusammenhangs von Tugend und Glückseligkeit bis hierhin also gelöst haben. Weiter oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Voraussetzung einer Austeilung der Glückseligkeit „ganz genau in Proportion der Sittlichkeit“ zur Folge hat, dass als einziger Grund für das Ausbleiben vollkommener individueller Glückseligkeit die sittliche Fehlbarkeit der jeweiligen subjektiven Willkür angenommen werden kann. Nun nimmt Kant aber nicht nur dieses an, sondern auch, dass keine endliche Vernunft jemals vollkommen glückselig sein könne. Welches endliche und vernünftige Wesen könnte schon von sich behaupten, dass es ihm „im ganzen seiner Existenz, alles nach Wunsch und Willen“ ginge? Auch Aristoteles war der Überzeugung, dass ein vollkommen glückseliges Leben höher sei „als es dem Menschen als Menschen“ zukommt. Und ich denke, wir können Aristoteles und Kant getrost darin zustimmen. Nun heißt dies vor dem Hintergrund der kantischen Konzeption des Zusammenhanges zwischen Tugend und Glückseligkeit aber nichts anderes als: Wenn auch „die völlige Angemessenheit der Gesinnung zum moralischen Gesetze“ als das „unaufhörliche Streben“ zur „pünktlichen und durchgängigen Befolgung“ des moralischen Gesetzes als eine Möglichkeit endlicher Vernunft gedacht wird, wäre ihr die tatsächlich „pünktliche und durchgängige Befolgung“ desselben unmöglich. 248 Andernfalls wäre es unverständlich, warum vollkommene Glückseligkeit einer endlichen Vernunft nicht zuteil werden kann. Genau in diesem Sinne 246 Ebd., Seite 256. Kant KrV (1956), Seite 683. 248 Vgl. Kant KpV (1956), Seite 252f. 247 95 schreibt Kant: „Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum moralischen Gesetze ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein Wesen der Sinnenwelt, in keinem Zeitpunkte seines Daseins, fähig ist.“249 Nun stellt sich aber die Frage, wie endliche Vernunft es sinnvoll als ihre eigene Pflicht verstehen kann, sich die „völlige Angemessenheit des Willens“ zum moralischen Gesetz als Ziel ihrer „Gesinnung“ zu setzen, wenn ihr zugleich die Erfüllung desselben unmöglich ist. Kann dieser Widerspruch nicht aufgelöst werden, so ist die „eigene Vollkommenheit“ als eine vernünftige Zielsetzung zu verwerfen, weil ein unerfüllbares Ziel kein wirkliches Ziel sein kann. „Die völlige Angemessenheit der Gesinnung zum moralischen Gesetze“ als das Streben nach der „eigenen Vollkommenheit“ wäre praktisch-theoretisch unverständlich, geschweige denn als Pflicht anerkennungsfähig. Kant muss die Möglichkeit der „eigenen Vollkommenheit“ für seine Ethik jedoch voraussetzen. Dies kann er schließlich nur über die Ent-Endlichung der Vernunft im Postulat der „Unsterblichkeit der Seele“. „Da sie [die Vollkommenheit; T. W.] indessen gleichwohl als praktisch notwendig gefordert wird, so kann sie nur in einem ins Unendliche gehenden Progressus zu jener völligen Angemessenheit angetroffen werden, und es ist, nach Prinzipien der reinen praktischen Vernunft, notwendig, eine solche praktische Fortschreitung als das reale Objekt unseres Willens anzunehmen. Dieser unendliche Progressus ist aber nur unter der Voraussetzung einer ins Unendliche fortdauernden Existenz und Persönlichkeit desselben vernünftigen Wesens (welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt) möglich. Also ist das höchste Gut, praktisch, nur unter der Voraussetzung der Unsterblichkeit der Seele möglich; mithin diese, als unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz verbunden, ein Postulat der reinen praktischen Vernunft [...].“250 So versucht Kant die „eigene Vollkommenheit“ in einem die Unsterblichkeit der Seele voraussetzenden „ins Unendliche gehenden Progressus zu jener völligen Angemessenheit“ als Möglichkeit vernünftigen Handelns praktisch-theoretisch aufrecht zu erhalten.251 Anders als das Gottespostulat scheint mir dieser Schritt jedoch völlig ins Leere zu laufen. Nicht deshalb, weil die „Unsterblichkeit der Seele“, was immer genau darunter zu verstehen wäre, als empirisch widerlegt gelten muss. Sondern weil die Vorstellung eines „ins Unendliche gehenden Progressus zu jener völligen Angemessenheit“ in sich inkonsistent ist. Denn auch eine unendliche Annäherung ist keine Erfüllung der völligen Angemessenheit. So bliebe es selbst in einer unendlichen Fortdauer der Existenz dabei, dass wir moralisch zu etwas aufgefordert wären, das wir niemals erfüllen können. Kant widerspricht sich selbst, wenn er auf der einen Seite fordert, dass die „völlige Angemessenheit“ möglich sein soll, auf der anderen Seite jedoch die Unmöglichkeit, diese 249 Ebd., Seite 252. Ebd. 251 Ebd.; vgl. auch 143f. 250 96 in unserer „Sinnenwelt“ vollkommen zu erreichen, „ins Unendliche“ verlängert, um am Ende diesen Widerspruch in einer göttlichen, die Unendlichkeit umfassenden Anschauung aufzulösen, in der jener unendlichen Unmöglichkeit völliger Angemessenheit dann doch irgendwie die Eigenschaft zukommt, „völlig adäquat zu sein“.252 Auch für einen Gott, noch dazu einen, der, wie Kant sagt, ohne „Nachsicht und Erlassen“ schaut, kann nicht aus einer unendlichen Unmöglichkeit der völligen Angemessenheit eine völlige Angemessenheit werden. Kants Argument ist nicht konsistent und leistet allein schon aus diesem Grund nicht das, was es bezwecken soll 253 : die objektive und unbedingte Gültigkeit, die Wahrheit des moralischen Gesetzes praktisch-theoretisch dadurch abzusichern, dass die Möglichkeit der Erfüllung desselben konsistenztheoretisch plausibel gemacht wird.254 Kant hätte in seinem Festhalten an dem Anspruch „völliger Angemessenheit“ einerseits und der Unmöglichkeit, diesem in unserem endlichen Leben gerecht zu werden, andererseits viel eher deutlich machen müssen, wie sich unser angenommenes Dasein nach dem Tod verändert, so dass wir schließlich doch die Möglichkeit haben, jenen Anspruch zu erfüllen. Darüber hinaus hätte er erklären müssen, in welchem Verhältnis unser endliches Dasein zu dieser Veränderung steht, sodass deutlich wird, inwiefern der moralische Anspruch schon in unserem endlichen Leben unbedingte Relevanz entfalten kann. Für eine solche Lösung der Problematik hätte Kant allerdings einen tiefen Zug aus der Pfeife metaphysischer Dichtkunst nehmen müssen, was ihm sicherlich nicht nur Unbehagen bereitet hätte, sondern was er, und zumindest für die Wissenschaft zu Recht, zutiefst ablehnte. So blieb ihm nichts übrig, als die für unser endliches Leben angenommene Unmöglichkeit „völliger Angemessenheit“ in die Unendlichkeit zu verlängern und den damit ebenfalls in die Unendlichkeit verlängerten Widerspruch vorgeblich in einer göttlichen, zeitlosen Schau aufzulösen, welche uns unter der Bedingung der Zeit lebenden Menschen verwehrt sei. An dieser Stelle entpuppt sich das vermeintliche Argument nicht als eine Auflösung des Widerspruchs, sondern als eine Verdrängung und Verklärung desselben im Namen des „Unendlichen“.255 Das kann nicht gut gehen. Es ist in gewisser Weise bezeichnend, dass Kant seine Verklärung dieses Widerspruchs durch eine Nutzenerwägung ergänzt. „Der Satz von der moralischen Bestimmung unserer Natur, nur allein in einem ins Unendliche gehenden Fortschritte zur völligen Angemessenheit mit dem Sittengesetz gelangen zu können, ist von dem größten Nutzen, nicht bloß in Rücksicht auf die gegenwärtige Ergänzung des Unvermögens der 252 Ebd., Seite 254. Andere Kritikpunkte gegenüber Kants Konzeption der Unsterblichkeit können darüber hinaus angebracht werden; vgl. Kleingeld (1995), Seite 156. 254 Vgl. Kant KpV (1956), Seite 242f. 255 Vgl. ebd., Seite 253. 253 97 spekulativen Vernunft, sondern auch in Ansehung der Religion.“256 Der Nutzen liegt für Kant zum einen darin, dass durch einen in praktischer Hinsicht notwendig anzunehmenden unendlichen Fortschritt die Postulierung der „Unsterblichkeit der Seele“ gerechtfertigt würde, wozu die „spekulative“ oder „theoretische Vernunft“ niemals hinreiche. Zum anderen liegt der Nutzen in der Disziplinierung des endlichen Willens. Denn was Kant weiter zum Stichwort der „Religion“ ausführt, zielt darauf, dass die Annahme eines im endlichen Dasein unmöglich zu erfüllenden und einen unendlichen Fortschritt voraussetzenden Gesetzes mögliche Vorstellungen von einer „nachsichtlichen“ Moral auf der einen und „theosophische Träume“ von einem „völligen Erwerb der Heiligkeit des Willens“ auf der anderen Seite vereiteln würde, „durch welches beides das unaufhörliche Streben, zur pünktlichen und durchgängigen Befolgung eines strengen unnachsichtlichen, dennoch aber nicht idealischen, sondern wahren Vernunftgebots, nur verhindert wird“.257 Haben hier das Ziel, die Behauptung der „Unsterblichkeit der Seele“ rechtfertigen zu können, und ein vermeintlicher psychologischer Nutzen Kant zur begrifflichen Verklärung anstatt zur konsistenten Aufklärung des Widerspruchs motiviert? Es gibt meines Erachtens zwei Möglichkeiten, mit dem aufgezeigten Widerspruch umzugehen. Eine Möglichkeit besteht darin, die völlige Angemessenheit der Unangemessenheit in dem Sinne zu interpretieren, dass es für unser Dasein völlig angemessen ist, die völlige Angemessenheit unseres Willens zum moralischen Gesetz nicht zu erreichen. Wollte man dabei überhaupt noch an Kants moralischem Vollkommenheitsanspruch festhalten, so könnte dies, anders als dieser meinte, nur mit „Nachsicht“ und „Erlass“ einhergehen. Auch bräuchte es für ein solches Verständnis weder die Vorstellung eines „ins Unendliche gehenden Progressus“ noch die für diesen vorauszusetzende Unsterblichkeit der Seele. Wenn es für uns in unserem Dasein völlig angemessen ist, dem moralischen Gesetz nicht völlig angemessen zu sein, entfällt die Notwendigkeit nach einer argumentativen Vermittlung zwischen dem Anspruch der Vollkommenheit und der Unmöglichkeit dieser in einem endlichen Leben gerecht zu werden. In dieser Auflösung des Widerspruchs ist letztlich kein Platz für eine unbedingte Geltung des kantischen moralischen Gesetzes. Ist die Erfüllung des moralischen Gesetzes nicht möglich, kann dieses aus praktisch-theoretischer Sicht keine objektive und unbedingte Gültigkeit für uns besitzen. Es könnte maximal, was Kant bestreitet, als ein Ideal, nicht aber als ein „wahres Vernunftgebot“ verstanden werden.258 Die zweite und, wie ich weiter unten zu zeigen mich bemühen werde, sinnvollere Möglichkeit der Auflösung des Widerspruchs besteht darin, die Unmöglichkeit der „völligen Angemessenheit“ als, und hier kann man der wortwörtlichen Formulierung 256 Ebd. Vgl. ebd. 258 Vgl. ebd., Seite 253. 257 98 Kants folgen, Unmöglichkeit der „völligen Angemessenheit“ zu einem „Zeitpunkte“ zu verstehen.259 Das moralische Gesetz kann nur im Vollzug völlig erfüllt werden. Kant selbst nennt „das unaufhörliche Streben, zur pünktlichen und durchgängigen Befolgung eines strengen unnachsichtlichen, dennoch aber nicht idealischen, sondern wahren Vernunftgebots“ als Modus der Erfüllung.260 Man kann dem moralischen Gesetz nicht dadurch völlig genügen, dass man sich diesem allein zu einem bestimmten Zeitpunkt angemessen verhält. Diese situative Angemessenheit zu einem Zeitpunkt ist zwar notwendig, nicht aber hinreichend für eine „völlige Angemessenheit“. Letztere ist nur als durchgängige Erfüllung im modus sufficiens denkbar. In diesem Verständnis ergibt sich erst gar kein Widerspruch zwischen dem Anspruch „völliger Angemessenheit“ und der Unmöglichkeit, diesem zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres endlichen Lebens völlig gerecht zu sein. Es ist eben nur möglich, dem Anspruch völlig gerecht zu werden. Das moralische Gesetz wird als ein Vollzugsziel gedacht. Natürlich kann ein solches Gerecht-Werden auch in einem modus meliorativus seinen Vollzug finden, soweit situative Angemessenheit nicht erreicht ist. Aber ein modus meliorativus als ein, wie Kant schreibt, „Progressus ins Unendliche, von den niederen zu den höheren Stufen der moralischen Vollkommenheit“ kann nicht nur nicht zu „völliger Angemessenheit“ führen, sondern negiert von vorne herein selbst die Möglichkeit situativer Angemessenheit. 261 Denn der modus meliorativus setzt situative Unangemessenheit voraus. Kann diese aber selbst in einem unendlichen „Progressus“ nicht überwunden werden, was für die Vorstellung einer unendlichen Bewegung im modus meliorativus vorauszusetzen wäre, dann bleibt also bereits die situative Angemessenheit außerhalb unserer Möglichkeiten. Es wäre ein Ziel, dem weder situativ noch durchgehend angemessen entsprochen werden könnte, und das aus diesem Grund nicht nur keine unbedingte Geltung, sondern überhaupt keine praktische Relevanz besitzen könnte, ja praktisch-theoretisch überhaupt nicht als Ziel zu begreifen wäre. Nur wenn die situative Angemessenheit als möglich gedacht wird, und wenn die Unmöglichkeit der völligen Angemessenheit zu einem Zeitpunkt des endlichen Daseins nichts anderes heißt, als dass ein Vollzugsziel, als welches hier das moralische Gesetz verstanden wird, eben nicht zu einem Zeitpunkt abschließend erfüllt werden kann, dann lässt sich der Widerspruch als ein scheinbarer auflösen und das moralische Gesetz könnte tatsächlich als ein „wahres Vernunftgebot“ begriffen werden. Es wäre von der durchgängigen Möglichkeit situativer Angemessenheit auszugehen, die in ihrer „unaufhörlichen“ und „durchgängigen“ Verwirklichung zu völliger Angemessenheit entwickelt werden könnte. Und will man unter „völliger Angemessenheit“ nicht eine 259 Vgl. ebd., Seite 252, 253f. Ebd., Seite 253. 261 Ebd. 260 99 solche verstehen, die das gesamte Leben von der Geburt bis zum Tode andauert, um nicht demjenigen, der einmal vom moralischen Gesetz abgewichen ist, dieses Ziel als unerfüllbares auf immer zu entziehen, so kann das nur heißen: Das moralische Gesetz ist als ein Vollzugsziel zu verstehen, dessen völlige Erfüllung als Möglichkeit durchgehender situativer Angemessenheit von einem beliebigen Zeitpunkt endlichen Daseins aus bis zum Tode hin immer wieder neu zu denken ist. Auch für ein solches Verständnis des moralischen Gesetzes bräuchte es weder einen „ins Unendliche gehenden Progressus“ noch eine für diesen vorauszusetzende „Unsterblichkeit der Seele“. Man kann sich nun fragen, was Kant daran gehindert hat, sich auf eine der beiden aufgezeigten Möglichkeiten zur Auflösung des Widerspruchs einzulassen. Dass beide auf ihre Weise die teleologische Suffizienz-Bedingung berücksichtigen, hätte für Kant wohl kaum ein Argument gegen diese sein können. Die erste hätte er wahrscheinlich deshalb abgelehnt, weil sie letztlich auf einen moralischen Relativismus hinausläuft. Für die zweite Möglichkeit aber gilt dies nicht. Was also hielt Kant auch von dieser zweiten Lösungsmöglichkeit ab? Hier fällt zunächst ins Auge, dass diese, genau wie die erste, ohne das Postulat der „Unsterblichkeit der Seele“ auskommt, also einem jener Aspekte, für welche die Annahme eines „ins Unendliche gehenden Progressus“ nach Kant „von dem größten Nutzen“ sei. Die schon angedeutete Vermutung, dass Kants Philosophie von dem Ziel motiviert gewesen sein könnte, eine Rechtfertigung für die Annahme der „Unsterblichkeit der Seele“ zu finden, könnte in diesem Zusammenhang noch einmal verstärkt und etwa mit Blick auf jenen Zusatz von 1787 in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft erhärtet werden: „Und gerade in diesen letzteren Erkenntnissen, welche über die Sinnenwelt hinausgehen, wo Erfahrung gar keinen Leitfaden, noch Berechtigung geben kann, [...] die wir, der Wichtigkeit nach, für weit vorzüglicher, und ihre Endabsicht für viel erhabener halten, als alles, was der Verstand im Felde der Erscheinungen lernen kann, wobei wir, sogar auf die Gefahr zu irren, eher alles wagen, als daß wir so angelegene Untersuchungen aus irgendeinem Grunde der Bedenklichkeit, oder aus Geringschätzung und Gleichgültigkeit aufgeben sollten. Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft selbst sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit [Hervorhebung im Original; T. W.].“262 Man muss nicht von diesen „unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft“ ablassen, um zugestehen zu können, dass Kant irrte, wenn er meinte, durch den „ins Unendliche gehenden Fortschritte“ ein Argument für die Rechtfertigung der Annahme der „Unsterblichkeit der Seele“ gegeben zu haben. Aber selbst wenn man von der zumindest nicht völlig abwegigen Vermutung einer solchen Motivierung der kantischen Philosophie absieht, so gibt es einen zweiten Gesichtspunkt, der ihn auch dann noch an einer Auflösung des Widerspruchs gehindert haben würde. Dabei geht es um die vollkommene Glückseligkeit, die nach Kant das „höchste Gut“, „das 262 Kant KrV (1956), Seite 49. 100 notwendige Objekt eines durchs moralische Gesetz bestimmbaren Willens“ erst vollendet.263 Denn solange man mit Kant erstens an der Glückseligkeit, von der er mit Aristoteles übereinstimmend und zu Recht meinte, dass sie im endlichen Leben nicht zu erreichen sei, als einem Teilaspekt praktischer Zwecksetzung festhält, und zweitens das Erlangen derselben in genauer Proportionalität von der Angemessenheit des Willens zum moralischen Gesetz abhängen lässt, dann muss vor diesem Hintergrund auch die Erfüllung des letzteren als für ein endliches Leben unmöglich erreichbar konzipiert werden. Natürlich könnte man nun weitere Überlegungen dazu anstellen, inwiefern Kants Festhalten am Begriff der Glückseligkeit mit dem möglichen Motiv der Rechtfertigung der Unsterblichkeits-Annahme in Zusammenhang steht. Man könnte argumentieren, dass er die Glückseligkeit instrumentalisierte. Im Zusammenhang mit dem moralischen Gesetz hätte er die Glückseligkeit als etwas im endlichen Leben nicht zu Erreichendes dann dafür gebraucht, um einen unendlichen Fortschritt in moralischer Hinsicht voraussetzen und die „Unsterblichkeit der Seele“ postulieren zu können. Die Glückseligkeit als Erfüllungsgehilfe der Unsterblichkeit? Weiter war es ja auch die Glückseligkeit bzw. das Problem ihrer zur Glückswürdigkeit proportionalen Austeilung, das zum Postulat der Existenz Gottes geführt und damit nach Kant zur Auflösung einer weiteren jener „unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft“ beigetragen hat. Vielleicht war es aber auch anders herum Kants primäres, praktisch-philosophisches Festhalten an dem aristotelischen Zusammenhang von Tugend und Glückseligkeit, das ihn erst sekundär zu den Postulaten von der „Unsterblichkeit der Seele“ und der „Existenz Gottes“ führte. Wie dem auch sei, ob von Kant instrumentalisiert oder nicht, es ist die beschriebene Engführung von Moral und Glückseligkeit, die dazu führt, dass die Erfüllung des moralischen Gesetzes prinzipiell der Reichweite endlicher Praxis entzogen wird, und Kant dazu Anlass gibt, in seinem Versuch einer praktisch-theoretischen Plausibilisierung des moralischen Anspruches jene haltlose Formulierung eines unendlichen Fortschritts im modus meliorativus zu konstruieren. Der Begriff eines unendlichen Fortschritts im modus meliorativus ist systematisch unhaltbar, damit einhergehend aber auch jegliches durch einen solchen vermeintlich zu erreichendes Ziel, und damit wiederum die Vorstellung eines Gesetzes, das ein nur so zu erreichendes Ziel zum „notwendigen Objekt“ hat. Mit Kants eigenen Worten lässt sich schließlich folgern: Damit aber „ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich“ und „so muß auch das moralische Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein.“ 264 Kants Philosophie hält dem von ihm selbst gesetzten Prüfstein der teleologischen Suffizienz-Bedingung nicht stand. Genauso wenig wie Aristoteles schafft es Kant, die Glückseligkeit praktisch-theoretisch als Ziel tugendhaften bzw. moralischen Handelns zu plausibilisieren. Und sein Festhalten an der Glückseligkeit 263 264 Ebd., Seite 252. Siehe Kant KpV (1956), Seite 242f. 101 disqualifiziert schließlich auch das moralische Gesetz, das genauso wie die aristotelische Klugheit nicht dazu hinreicht, eine endliche Vernunft der Glückseligkeit teilhaftig werden zu lassen. ... zurück zu Hegel Kant hat mit seiner Aussage Recht, dass vollkommene Glückseligkeit etwas ist, dessen wir, wenn überhaupt, nur in einem Dasein nach dem Tode teilhaftig zu werden hoffen können. Auch Aristoteles hätte sich damit einverstanden geben können, wenn auch mit der Bemerkung, dass er das Postulat der „Unsterblichkeit der Seele“ ablehne und eine diese voraussetzende Hoffnung deshalb als illusorisch ansehe. Auch hat Kant in seiner Kritik an Aristoteles Recht damit, dass der Glückseligkeitsbegriff im Zusammenspiel mit der Klugheit nicht zur Orientierung endlicher Vernunft dienen kann. Sein Versuch, eine solche Orientierung in einem moralischen Gesetz zu finden, muss jedoch in dem Moment scheitern, in dem er die Erfüllung desselben in genauer Proportion zur Glückseligkeit setzt und so die endliche Unerreichbarkeit der letzteren auf die erstere überträgt. Der einzige Ausweg, der ihm bleibt, ist, auf irgendeine Art und Weise die endliche Vernunft über den Tod hinaus existieren zu lassen, damit sie etwas sinnvoll als ein praktisches Ziel verstehen kann, dessen endliche Verwirklichung unmöglich ist. Eine solche Annahme bedürfte aber weiterer Annahmen über die Eigenart dieses nachtodlichen Daseins und dessen Verhältnis zum endlichen Dasein, sodass verständlich wird, wie die Verwirklichung schließlich möglich ist und warum es schon im endlichen Dasein darum gehe, jenes endlich nicht zu verwirklichende Ziel zu verfolgen. Die von Kant vorgeschlagene Verunendlichung der endlichen Unmöglichkeit reicht nicht aus und ist begrifflich inkonsistent. Aber auch unabhängig von dieser Inkonsistenz, hätte sich Kant von solcherlei Spekulation über die Eigenart eines nachtodlichen Daseins fernhalten sollen. Die Möglichkeit eines Daseins nach dem Tod muss nicht bestritten werden, um einsehen zu können, dass wir ganz gewiss in unserem endlichen Dasein keine Erfahrungen haben, die uns dazu berechtigen, etwa von einer unendlichen Zeitlichkeit eines möglichen nachtodlichen Daseins oder von einer dann gegebenen moralischen Perfektibilität auszugehen. Wenn es uns empirisch auch versagt ist, die Möglichkeit eines Daseins nach dem Tode zu falsifizieren, so sollte diese Unmöglichkeit nicht als Freifahrtschein dafür genommen werden, willkürlich formulierte Ansprüche an die endliche Vernunft, welche zu einer Überspannung derselben führen, durch ein nachtodliches Dasein theoretisch rechtzufertigen zu suchen. Wenn Kant meint, dass diejenigen, die von einer im endlichen Dasein möglichen Erfüllung des „moralischen Gesetzes“ ausgehen, das „Vermögen des Menschen [...] über alle Schranken hoch gespannt“ haben und etwas annehmen, „das aller Menschenkenntnis widerspricht“, so kann er dies nur sagen, weil er zuvor seine Vorstellung vom „moralischen Gesetz“, nicht zuletzt in der Verknüpfung zur 102 Glückseligkeit, selbst so hoch gehängt hat, dass sie für ein endliches Leben unerreichbar sein muss.265 Nicht die anderen, sondern er selbst überspannt den Bogen. Anders als Kant halte ich es nicht für „schwärmende, de[r] Selbsterkenntnis ganz widersprechende theosophische Träume“, sondern für eine praktisch-theoretische Notwendigkeit, dass ein Gesetz, dem zu entsprechen endliche Vernunft sich aufgefordert verstehen können soll, von dieser auch erfüllt werden kann, ohne dass sie dafür ihre Verunendlichung annehmen müsste.266 Die in Auseinandersetzung mit Aristoteles und Kant gewonnenen Befunde lassen es schließlich ratsam erscheinen, den Glückseligkeitsbegriff im Rahmen praktischer Handlungsziele fallen zu lassen. Auf der Suche nach einem praktisch relevanten Fortschrittsbegriff kann uns weder die aristotelische eudaimonia noch Kants „höchstes Gut“ richtungsweisend sein. Ob Kant mit seinem Bezug auf das „moralische Gesetz“ vielleicht dennoch einen zu diskutierenden Ansatzpunkt für eine Orientierung des Fortschrittsbegriffes gegeben hat, wird noch zu untersuchen sein. Zumindest ist ein „moralisches Gesetz“, das in der aufgezeigten Weise an den Begriff der Glückseligkeit gekoppelt ist, nicht hilfreicher als die Glückseligkeit selbst. Nach der zeitlichen Verwirklichung der zeitlich nicht zu verwirklichenden Glückseligkeit bzw. des „höchsten Gutes“ zu streben, ist ein äußerst unbefriedigendes Unterfangen und steht dem, was durch dieses Streben erreicht werden soll, geradewegs entgegen. Ein solches Streben würde nicht nur nicht zu einem „glückseligen“, sondern noch nicht einmal zu einem „befriedigenden Leben“ führen. Die Sehnsucht nach einem glückseligen Leben, in dem nach Aristoteles „nichts [...] unvollkommen sein [darf]“ oder mit Kants Worten „alles nach Wunsch und Willen geht“267, wird, wenn sie sich bewusst oder unterbewusst als etwas zeitlich zu Verwirklichendes mit unseren praktischen Zielen verbindet, vielmehr zum Nährboden lebensfeindlicher Reflexe, die bis zu politisch verheerenden Einstellungen und Überzeugungen hin auswachsen können. Wer die Unvollkommenheit der Spannung des Lebens zwischen Souveränität und Machtlosigkeit nicht als etwas versteht, was es zu halten, sondern was es aufzulösen gilt, wendet sich gegen die Natur unseres endlichen Daseins. Pinkard zufolge war dies auch Hegels Einsicht: „On Hegel´s view, which only really comes to full display in his Berlin lectures in the 1820s, one of the deeper pathologies of modern European life is its widespread failure to come to grips with these tensions inherent in that form of life and that, rather than seeking a sublation of those tensions within a more comprehensive vision of self-interpreting agency and in the limited although necessary aspirations of political and social life, a large element within it instead longs for 265 Ebd., Seite 258. Ebd., Seite 253. 267 Aristoteles NE (2001), Seite 443; Kant KpV (1956), Seite 255. 266 103 some state of resolved tension, a new golden age or a utopia yet to come, which, instead of sublating these tensions, seeks to overcome them or transcend them. The way this demand for reconciliation and this feature of life feed on each other is itself the basis of the perpetual temptation to push toward the disaster that lies in any attempt to fashion a politics that would make us completely whole again.“268 Man muss Aristoteles und Kant in diesem Zusammenhang zugute halten, dass sie beide deutlich darauf hinwiesen, dass Glückseligkeit nichts ist, was wir in der Endlichkeit erreichen könnten. Zur Rechtfertigung in der Endlichkeit zu realisierender Glückseligkeitsverheißungen lassen sie sich also nicht instrumentalisieren. Dennoch bleibt es dabei, dass sich beide auf ihre Weise dafür aussprechen, dass es für die endliche Vernunft darum geht, nach der zeitlichen Verwirklichung von Glückseligkeit und damit nach einer Auflösung der Spannung des unvollkommenen, endlichen Lebens zu streben, auch wenn man diese in der Endlichkeit nicht zu erreichen vermag. Dies ist nicht nur im Hinblick auf die begriffliche Praxis eine unbefriedigende Position. Wenn es zu entscheiden gilt zwischen den praktischen Zielsetzungen der Glückseligkeit bzw. des „höchsten Gutes“ auf der einen Seite, die weder zu einem glückseligen noch zu einem befriedigenden Leben führen, und der „Befriedigung“ im Pinkard-Hegelschen Sinne auf der anderen Seite, die eine realistische Chance auf Erfüllung hat, so ziehe ich entschieden die letztere vor. Trotz all der Kritik an Aristoteles und Kant in Bezug auf die Glückseligkeit, wäre es meines Erachtens vermessen und dem eigenen Erleben widersprechend, so zu tun, als ob diese damit nicht etwas tief in unserer Natur Verwurzeltes angesprochen hätten. Das Empfinden von Glück ist ein überaus wichtiger Aspekt unseres Lebens. Wir sind nicht nur glücksfähig, sondern auch glücksbedürftig. Keine noch so volle sinnliche oder soziale „Befriedigung“ kann uns die auf Sinnlichkeit und sozialen Status nicht reduzierbare Lust am Leben, die wir auch Freude oder eben Glück nennen können, ersetzen. Zumeist entfaltet dieses Glück ganz versteckt seine Wirkung, kann aber hier und da und immer mal wieder in den Vordergrund treten, um dann jäh wieder in den Hintergrund zu rücken, von wo aus es unbemerkt das Leid des Lebens zu tragen hilft. Und mir erscheint es so, dass Glückseligkeit nichts anderes meint als das pure, durch nichts getrübte Lebensglück. Doch wie soll das in unserem endlichen und unvollkommenen Dasein möglich sein. Wie sollte die Verwirklichung eines solchen Purismus in der unvollkommenen Endlichkeit gelingen. Man könnte denken, durch Reduzierung von Leid. Doch der Glücks-Purismus kennt nicht die Grenze, an der das Ziel der Verringerung von Leiden sich auf Leid bringende Weise gegen die Leid verursachenden und empfindenden Wesen selbst zu richten beginnt. Das Ziel der Verringerung von Leiden ist eines, das Ziel des Glücks-Purismus etwas anderes.269 268 269 Siehe Pinkard (2012), Seite 174f. Auf dieses Problem werden wir weiter untern noch einmal zurückkommen, vgl. Seite 142 dieser Arbeit. 104 Wenn ich mich hier deutlich gegen eine teleologische Bestimmung des Fortschrittsbegriffes durch den Begriff der Glückseligkeit bzw. des „höchsten Gutes“ und für den Begriff der „Befriedigung“ ausspreche, so heißt dies jedoch mitnichten, dass hier an einem Fortschrittsverständnis gearbeitet wird, welches mit dem Begriff des Glücks überhaupt inkompatibel wäre. Dies ist nicht der Fall. Man muss keine „Feindschaft“ oder generelle „Abstinenz“ gegenüber dem Glücksbegriff hegen, um zu verstehen, dass nicht nur die Glückseligkeit, sondern auch das unvollkommenere und sehr wohl erlebbare zeitliche Glück nicht im Sinne eines in der Zeit zu verwirklichenden Zieles dienen kann.270 Mit Dieter Thomä bin ich der Meinung, dass einen gerade die Auseinandersetzung mit dem Glück zu der Erkenntnis gelangen lässt, „dass es nämlich nicht geschaffen wird, sondern zuteil wird. Beim Liebäugeln mit dem Glück bezieht man sich auf etwas, das den Zugang verwehrt, wenn man es in den Griff bekommen will.“271 Mit der Absage an den Glücksbegriff als Zielbestimmung des Fortschritts ist die Vorstellung völlig vereinbar, dass dieser mit dem Erleben von Glück einhergehen kann. Aber Glück kann eben nicht sinnvoll als ein praktisches Ziel begriffen werden, und deshalb dem Fortschrittsbegriff auch keine praktische Richtung geben. Es geht beim Fortschritt nicht darum, Glück herzustellen oder zu verwirklichen. Nicht weil Glück etwas wäre, dessen wir nicht bedürften und das wir nicht begrüßen sollten, wenn es sich einstellt, sondern weil es sich einer vorsätzlichen Herstellung entzieht. Glück kann nicht kreiert werden. Und gerade in dieser Einsicht liegt eine gewisse Glücksträchtigkeit. „Das dualistisch verspannte Bild subjektiver Zielsetzungen und objektiver Bedürftigkeiten in der Moderne führt dazu, daß vom Glück, von dem doch nicht gelassen werden kann, Zerrbilder entworfen werden. Das moderne Konzept selbstbestimmten Lebens hadert mit dem glücklichen Lebensvollzug, dem glücklichen Eingelassensein in das Leben, und so gleitet ihm das Glück durch die Finger. Diejenigen, die ihm dann um so hartnäckiger nachjagen, bemerken nicht, daß sie es nur weiter vor sich her und von sich weg treiben. Wenn man sich statt dessen in die Unverfügbarkeit des Glücks findet, so heißt dies auch, daß man die Tatsache dieser Unverfügbarkeit selbst zu genießen bereit ist. Sie gehört geradewegs zum Glücke selbst. Das Glück hängt an dem Selbst, das sich dessen erfreut und damit im reinen ist, sich nicht vollends im Griff zu haben.“272 Und wenn dieses Damit-im-Reinen-Sein, „sich nicht vollends im Griff zu haben“ letzlich auf nichts anderes verweist, als was man mit Pinkard als Selbsterkenntnis und Anerkennung der eigenen Natur als einer Spannung zwischen Souveränität und Machtlosigkeit bezeichnen kann, die es zu halten gilt, dann sollte dieser Hinweis genügen, um deutlich zu machen, an welcher Stelle das Glück in dem noch weiter zu entwickelnden Fortschrittsbegriff sogar seinen systematischen Platz erhält. 270 Die Begriffe „Feindschaft“ und „Abstinenz“ im Zusammenhang mit dem Glück übernehme ich aus Thomä, Dieter: Vom Glück in der Moderne, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003, Seite 12. 271 Ebd., Seite 267. 272 Ebd., Seite 269. 105 Nur sollte man eben nicht meinen, die Spannung des eigenen Lebens deshalb halten oder in den Griff bekommen zu können, weil man glücklich sein will, noch, dass ein In-denGriff-Bekommen der Spannung schon auch bedeutet, glücklich zu sein. Das In-den-GriffBekommen der Spannung ist primär ein Tun, ist Tätigkeit. Und „natürlich findet man im Zusammenhang mit dem Glück an vorderer Stelle Lebensformen, die mit Schaffensdrang und tätiger Erfüllung verbunden sind. Doch das Glück fällt damit nicht einfach zusammen, mit ihm ist vielmehr eine unaufhebbare Differenz zu einem rein tätigen Selbstverständnis festgeschrieben.“273 Es handelt sich hierbei nicht um ein auf die Kritik folgendes, ehrerbietiges Zugeständnis an zwei Größen der menschlichen Geistesgeschichte. Denn wenn ich auch dem Glück abspreche, dem Fortschrittsbegriff eine Orientierung geben zu können, so heißt dies nicht, dass in der Bestimmung des letzteren auf das erstere gänzlich verzichtet werden könnte. Denn mit dem Glück ist ein Erleben angesprochen. Der Kern dieses Erlebens drückt sich meines Erachtens in positiven und negativen Empfindungen aus, zu denen eben auch das Glück als die positivste, wenn auch nicht unbedingt aufdringlichste aller Empfindungen gehört. Dieses Erleben ist nicht nur kompatibel mit dem Fortschrittsbegriff, sondern es gehört sogar zu dessen Bestimmung, insoweit es zur Charakteristik derjenigen Subjekte gehört, für die der Fortschrittsbegriff überhaupt Relevanz besitzt, die also die Subjekte von Fortschritt sind und sich als solche verstehen können. Ohne dieses Erleben würde die Formulierung einer „guten Entwicklung“ höchstens funktionalen Sinn haben können. Aber funktionale Subjekte, von denen man zum Beispiel im Zusammenhang von künstlicher Intelligenz sprechen kann, stehen ihrem Tun und ihrer Entwicklung letztlich indifferent gegenüber. Ihre Existenz geht sie auf dieser fundamentalen Ebene nichts an, sie ist ihnen egal. Sie haben keine Lust am Dasein, sie empfinden weder Freude noch Glück, und auch kein Leid. Wenn es jemals eine künstliche Intelligenz geben könnte, die erleben würde – was ich stark bezweifele, hier aber nicht weiter diskutieren kann –, dann könnte sie sehr wohl zu den Fortschrittssubjekten gezählt werden. Ohne positives und negatives Erleben könnte die Spannung, die es im Rahmen des Fortschrittsbegriffs in den Griff zu bekommen gilt, überhaupt nicht in den Blick kommen. Ein Roboter kann zwar bestimmte Ziele verfolgen und Lernprozesse durchlaufen, aber sie bedeuten ihm nichts. Und mag er selbst seine Ziele und seine Erfolge bzw. Misserfolge operativ reflektieren, so aber leidet er weder, wenn er seine Ziele nicht erreicht, noch freut er sich, wenn er sie erfüllt. Er hat kein unbefriedigendes oder befriedigendes Erleben. Aus funktionaler Sicht mag es für einen Roboter ein „Gut“ oder „Schlecht“ geben, nicht aber aus phänomenaler Sicht. Phänomenalität bedeutet primär Erleben, nicht Reflexivität. Ein funktionales Subjekt erlebt sich selbst nicht als Subjekt einer guten oder schlechten Entwicklung und kann sich damit auch nicht als Subjekt eines Fortschritts, einer „guten“ 273 Ebd., Seite 267. 106 bzw. „befriedigenden“ Entwicklung wahrnehmen. Nur erlebende Subjekte sind Subjekte des Fortschritts. Und wenn es im Fortschritt im Sinne eines „befriedigenden Lebens“ darum geht, die phänomenale Spannung, die das Leben dieser Subjekte ausmacht, in den Griff zu bekommen, zählt es wahrscheinlich zu einer der schwersten Übungen, das Glück unausweichlich zu begrüßen, nicht aber kreieren zu wollen. Aristoteles und Kant haben dieser Versuchung zumindest auf der Ebene begrifflicher Praxis, soweit ich sehe, nicht widerstanden und blieben insoweit nicht hinreichend gespannt. Es sollte nun deutlich sein, worin die Leistung des Begriffs der „Befriedigung“ besteht, wie Pinkard ihn in der Auseinandersetzung mit Hegel herausgearbeitet hat. Er gibt uns nicht nur eine alternative Zielformulierung zu jener in unserer erlebenden Natur wurzelnden und aus dieser erwachsenden Glückssuche, die einen, je sehnsüchtiger sie betrieben wird, umso unbefriedigender zurücklässt. Er befreit uns nicht nur von den mit dieser Glückssuche verbundenen begrifflichen Unzulänglichkeiten und Inkonsistenzen sowie den die endliche Vernunft überfordernden Ansprüchen. Sondern er schafft es auch, das Glück im hegelschen Sinne in sich aufzuheben. Mit dem Begriff der „Befriedigung“ wird das Glück nicht aus dem Fortschritt verbannt, sondern erhält einen systematischen Platz. 274 Wir haben einen kurvenreichen Weg hinter uns. In der systematischen Modifizierung des Fortschrittsbegriffes landeten wir bei Aristoteles. Von diesem aus gelangten wir zu Hegel, dessen Philosophie Pinkard als einen entzauberten Aristotelismus versteht und der uns zu jenem Begriff der „Befriedigung“ führte. Um besser zu verstehen, welches Defizit der aristotelischen Philosophie durch diesen gelöst wird, ging es von Hegel zurück zu Aristoteles und dessen Begriff der eudaimonia, der sich als praktisch inoperabel erwies. Glückseligkeit lässt sich im unvollkommenen endlichen Leben nicht als ein zu verwirklichendes Ziel verstehen. Von da aus ging es über Kant, der die Glückseligkeit zu retten versuchte, es aber auch über die Annahme des „moralischen Gesetzes“ und der „Unsterblichkeit der Seele“ nicht schaffte, die mit der Vorstellung einer praktischen Verwirklichung von Glückseligkeit verbundenen Widersprüche aufzulösen, zurück zu Hegel und dem Begriff der „Befriedigung“. Das Ergebnis ist keine völlige Verabschiedung des Glücks, sondern seine Aufhebung in einer veränderten begrifflichen Konstellation. 274 Zwar spricht auch Pinkard von der „sublation of happiness“, arbeitet aber nicht genauer aus, wie diese Aufhebung zu verstehen ist; vgl. Pinkard (2012), Seite 89ff. 107 5 Subjektiver Fortschritt Stellen wir die „Befriedigung“ als ein durch Modifikation und Anerkennung zu verwirklichendes In-den-Griff-Bekommen der phänomenalen Spannung zwischen Souveränität und Machtlosigkeit ins Zentrum des Fortschrittsbegriffes, so nehmen wir nicht nur Abschied von der Glückseligkeit, sondern von allen praktisch uneinlösbaren Zielvorstellungen, die uns im Versuch ihrer Verwirklichung in ein unbefriedigendes Leben führen würden. Ein so verstandener Fortschritt kann per Definition kein unrealisierbares Unternehmen sein. Es ist die Vorstellung eines Fortschrittes, der seine Substanz in individuellen Subjekten findet, soweit diese es im Abgleich ihrer natürlichen und erworbenen Dispositionen mit den natürlichen und sozialen Bedingungen ihrer Umwelt vermögen, ein „befriedigendes Leben“ zu führen. Wie die individuelle „Befriedigung“ zu verwirklichen ist, kann nicht allgemein geklärt werden, sondern ist eine, durchaus sehr anstrengende, Aufgabe, deren Lösung nur von den konkreten Subjekten in den konkreten Verhältnissen, in denen sie sich bewegen, jeweils immer wieder neu entwickelt werden kann. Fortschritt als „Befriedigung“ hebt so nicht ab auf allgemeingültige Vorstellungen davon, was ein Subjekt in einer bestimmten Situation konkret wollen sollte, sondern überlässt es weitgehend den Subjekten selbst, wie die Frage und das Bedürfnis nach einem „befriedigenden Leben“ für sie im Konkreten zu beantworten ist. Insofern könnte man auch von einem subjektivistischen Fortschrittsbegriff sprechen. Dieses subjektivistische Verständnis ist, wie deutlich geworden sein sollte, jedoch nicht als ein Individualismus zu verstehen, der das individuelle Subjekt als eine Instanz versteht, die in einer bestimmten Situation völlig willkürlich über ihre Bedürfnisse oder Interessen und die Wege ihrer Befriedigung entscheiden könnte. So ist unsere situative Suche nach subjektiver Befriedigung stark beeinflusst durch unsere biologische Konstitution, bisherige biographische Prägungen und die aktuellen natürlichen, sozialen und kulturellen Umweltbedingungen, die allesamt nicht zu unserer freien Disposition stehen. Doch im Umgang mit diesen liegt stets ein Freiheitsgrad, der, wenn er auch oft nicht ins Bewusstsein kommt und nicht selten sehr gering sein mag, niemals unterschätzt werden sollte. Was in einer konkreten Situation als marginal und zu vernachlässigen erscheint oder vielleicht noch nicht einmal wahrgenommen wird, kann auf lange Sicht einen immensen Unterschied bedeuten, der die Grenze unserer Wahrnehmung zum anderen Extrem hin überschreitet. Diese bedingte Freiheit ist die notwendige Bedingung vor deren Hintergrund die Rede sowohl von einer Spannung zwischen Souveränität und Machtlosigkeit als auch von Modifikation und Anerkennung überhaupt Sinn ergibt. Die bedingte Freiheit ist diese subjektive Spannung zwischen Souveränität und Machtlosigkeit, ist das subjektive Modifizieren und Anerkennen, ist das Subjekt selbst, nicht als ein sich raumzeitlich verwirklichendes identisches Selbst, sondern als ein sich erst noch entwickelndes, um sein Dasein sich mühendes individuelles Leben. Ich gebe Pinkard Recht, wenn er sagt: „The 108 goal of coming to grips with that tension in self-conscious life and the activity itself of coming to grips with the tension and remaining at one with oneself within the tension are not a means to freedom. It is freedom itself.“275 Aber anders als es zumindest der Formulierung nach den Anschein hat, kann Freiheit nicht an die Bedingung der reflexiven Zielsetzung, jene Spannung durch Modifizierung und Anerkennung in den Griff zu bekommen, und ein sich anschließendes Bemühen geknüpft sein, dieses zu tun, um in diesem Tun bei sich selbst zu bleiben. Denn die reflexive Zielsetzung des In-den-Griff-Bekommens der Spannung könnte herzlich wenig ausrichten ohne die primäre Eigenschaft, modifizieren und anerkennen zu können. Freiheit, das eigene Schaffen, hängt nicht von dieser reflexiven Zielsetzung ab. Vielmehr halte ich diese reflexive Zielsetzung, wie jede andere auch, für eine modifizierte Entwicklung von Freiheit. Das sich reflexive Ziele setzende Leben kann gerade vor dem Hintergrund evolutionstheoretischer Überlegungen als eine die Bedingungen seiner selbst und seiner Umwelt anerkennende Modifikation eines vorgängigen Lebens verstanden werden. Und insofern dieses vorgängige Leben sich unter Anerkennung der Bedingungen – auf einer vor-reflexiven Praxisebene vielleicht besser Anpassung oder Adaption – zu einem selbstbewussten Leben modifiziert hat, kann es, in dieser Eigenschaft des eigenen Schaffens, mit vollem Recht als ein freies Leben bezeichnet werden. Also auch dann, wenn es sich die durch Modifizierung und Anerkennung in den Griff zu bekommende Spannung nicht reflexiv, sondern eher reflexhaft zum Ziel setzt. Die Spannung und das Bedürfnis ihres In-den-Griff-Bekommens ist kein Problem, das erst durch Reflexivität virulent wird. Sie ist gegeben mit dem Dasein phänomenaler Subjekte, deren für sie bedeutsames Dasein nicht erst reflexiv, sondern existenziell ein Problem ist; deren Leben also nicht einfach gegeben ist, sondern um das sie sich, wie gering das Ausmaß auch immer sein mag, durch Modifikation und Adaption beständig neu bemühen müssen. Würden sie dazu nicht frei sein, würden sie nicht existieren. Am Ende seiner Vorrede zur Phänomenologie des Geistes schreibt Hegel: „Weil übrigens in einer Zeit, worin die Allgemeinheit des Geistes so sehr erstarkt und die Einzelheit, wie sich gebührt, um soviel gleichgültiger geworden ist, auch jene an ihrem vollen Umfang und gebildeten Reichtum hält und ihn fordert, der Anteil, der an dem gesamten Werk des Geistes auf die Tätigkeit des Individuums fällt, nur gering sein kann, so muß dieses, wie die Natur der Wissenschaft schon es mit sich bringt, sich um so mehr vergessen, und zwar werden und tun, was es kann, aber es muß ebenso weniger von ihm gefordert werden, wie es selbst weniger von sich erwarten und für sich fordern darf.“276 Wenn man mit Pinkard daran festhält, dass Hegels „Geist“ kein metaphysisches Wesen ist, das sich in der Natur und den natürlichen Wesen entäußert und diese als seine Emanationen erkennend wieder 275 276 Ebd., Seite 107f. Hegel (1970), Seite 67. 109 in sich zurücknimmt und durch den Prozess der Geschichte hindurch sich allmählich seiner selbst bewusst wird, sondern „Geist“ die Eigenschaft bewusster Wesen ist, sich in ihrem Tun von allen Inhalten ihres Tuns als Ziele oder Gründe, d.h. sich reflexiv von sich selbst zu differenzieren und dadurch Selbst-bewusstsein zu haben, dann kann man vor dem Hintergrund der aktuellen, überaus kontroversen Diskussionen in der Philosophie des Geistes das hegelsche Zitat in folgender Weise geradezu umdrehen.277 „Weil übrigens in einer Zeit, worin der Zweifel des Geistes an seiner allgemeinen Natur so sehr erstarkt und die Einzelheit, wie sich gebührt, um soviel entscheidender geworden ist, auch jener an keinem vollen Umfang und gebildeten Reichtum mehr festhält und ihn fordert, der Anteil, der an dem gesamten Werk des Geistes auf die Tätigkeit des Individuums fällt, zwar nur gering sein kann, so muss dieses doch, wie die Natur der Wissenschaft schon es mit sich bringt, um so mehr bedacht werden, und zwar wie es denn konnte, was es wurde und tat, aber es muss ebenso weniger von ihm gefordert werden, wie es selbst von sich hat erwarten und fordern können.“ Das heißt, wenn wir danach fragen, wie es denn dazu kam, dass wir „Geist“, also ein sich von seinem Tun und damit von sich selbst reflexiv differenzierendes Selbst-bewusstsein haben, dann lautet die Antwort, wie sie die heutige, evolutionstheoretisch geprägte Wissenschaft mit sich bringt: weil die Individuen, in deren Entwicklungslinie wir stehen, dazu frei waren, unter Anerkennung bzw. Adaption der extra- und intraindividuellen Bedingungen ihres jeweiligen Daseins, dieses jeweils, und wenn nur in äußerst geringem Maße, in einer Weise zu modifizieren, dass in der Abfolge unzähliger Generationen seit einigen tausend Jahren Lebewesen geboren werden, die sich in ihrem Tun von sich selbst reflexiv differenzieren können. Denn was in dieser Hinsicht phylogenetisch über die Individuen einer evolutionären Linie hinweg gilt – dass dem vorgängigen Leben die, wenn auch unreflektierte, Freiheit zugekommen sein muss, ein solches selbst-reflexives Bewusstsein hervorzubringen –, muss zumindest indirekt auch ontogenetisch für diese Individuen selbst gelten, ohne die jene supraindividuelle Entwicklung überhaupt nicht hätte stattfinden können. Aber wir sollten natürlich nicht fordern, dass auch nur irgendeines jener unreflektierten Individuen sich diese Entwicklung unreflektiert, geschweige denn reflektiert zum Ziel gesetzt hat. Sie folgten „nur“ ihrem Interesse nach Erhaltung und Reproduktion ihres zur Modifikation und Adaption fähigen Daseins, d.h. nach der Erhaltung und Weitergabe eines bedingt freien Lebens, das ihre bedingte Freiheit ausmachte, ja das sie selbst waren. Geist, verstanden als Selbst-Bewusstsein, ist nicht die Bedingung von Freiheit, sondern deren Folge. Und so hat jedes dieser unzähligen unreflektierten Individuen, die uns niemals bekannt sein werden, seinen eigenen uns ebenfalls niemals bekannt werdenden Anteil „an dem gesamten Werk des Geistes“, weil sie es waren, die sich unter den Bedingungen ihres Daseins individuell in einer Weise modifiziert haben, die uns die Wirklichkeit eröffnet hat, uns reflexiv von unserem eigenen 277 Vgl. Pinkard (2012), Seite 45ff., Seite 105. 110 modifizierenden und anerkennenden Tun und damit von uns selbst zu differenzieren, die uns die Wirklichkeit eröffnet hat, selbst-bewusst zu sein. Man kann in diesem Gedanken sogar bis an den Anfang allen Lebens zurückgehen. Folgen wir etwas ausführlicher dem, was Daniel Dennett in Ellbow Room dazu schreibt: „In the beginning, there were no reasons; there were only causes. Nothing had a purpose, nothing had so much as a function; there was no teleology in the world at all. The explanation for this is simple: there was nothing that had interests. But after millennia there happened to emerge simple replicators, and while they had no inkling of their interests, and perhaps properly speaking had no interests, we, peering back from our Godlike vantage point at their early days, can nonarbitrarily assign them certain interests – generated by their defining ‚interests’ in self-replication. That is, maybe it really made no difference, was a matter of no concern, didn´t matter to anyone or anything whether or not they succeeded in replicating (though it does seem we can be greatful that these simple replicators did) but at least we can assign them interests conditionally. If these simple replicators are to survive and replicate, thus persisting in the face of increasing entropy, their environment must meet certain conditions: conditions conducive to replication must be present or at least frequent. Put more anthropomorphically, if these simple replicators want to continue to replicate, they should hope and strive for various things: they should avoid the ‚bad’ things and seek the ‚good’ things. Still more dramatically, were we to imagine ourselves as guardians of their interests, we could see quite clearly that there would be steps to be taken, assistance to be rendered, warnings to be issued. This is not to saying very much yet, for it is also true that if we imagine ourselves to take a fancy to some particular beautiful rock formation spewed up millions of years ago by some volcanic eruption, we can readily imagine the steps we would have to take to preserve it – to protect it from erosion, from being buried in sediment, from being broken by subsequent volcanic eruptions, and so on. What is the difference? In what way did the interests of replicators take on a life of their own? Just this: the replicators began to turn into crude guardians of their own interests. Indeed their power of self-replication depended on it. Unlike the volcanic sculpture, they were not utterly helpless and dependent on the solicitude of others; they could fend for themselves, a bit. The day that the universe contained entities that could take some rudimentary steps toward defending their own interests was the day that interests were born. The very tendencies of these organisms to preserve this and that (their varieties of homeostasis) helped sharpen the definition of their interests. Only certain sorts of homeostasis tended to be self-preserving in the long run; those kinds were replicated and hence persisted, and hence gave further definition to crude, primordial ‚interests’ in self-preservation and self-replication. Thus if body-temperature maintenance played an important role in the self-preservation of members of a species, bodytemperature maintaining control systems that evolved would persist. And that species’ catalog of interests would come to include the maintenance of a certain (range of) body 111 temperature. The basic themes of this story have been well presented many times. Food seeking, predator avoiding, mate locating, mating, and health maintaining (self-repairing, trauma avoiding, energy conserving, and so on) are the highest-level subgoals of replicators. In interaction with the particular species’ circumstances, these subgoals breed other, instrumental subgoals: odor detecting, hole digging, locomoting, pattern recognizing, pain feeling, mate impressing, and so forth.“278 Wir haben gute Gründe, aus evolutionstheoretischer Perspektive auf die Entstehung unserer Lebensform zu blicken. Aber wir sollten sehr vorsichtig sein, welche Geschichten wir über diese Entwicklung erzählen. Insbesondere dann, wenn wir uns gedanklich deren „Anfang“ nähern, von dem es uns versagt ist, unmittelbar etwas zu erfahren. Was immer die genaueren Bedingungen waren, unter denen das oder die ersten Lebewesen entstanden sind, wenn es an jenem Anfang, wie Dennett sagt, nur „äußere“ Ursachen (causes) aber keine „inneren“ Gründe (reasons) in der Natur, in der Welt und im Kosmos gegeben hat, dann geht die so lapidar daherkommende Formulierung „but after millennia there happened to emerge simple replicators“, die ein Interesse bzw. einen „inneren“ Grund aufwiesen, schwungvoll über ein meines Erachtens riesiges explanatorisches Problem hinweg. Denn wie ist es einzusehen, dass in einem Kosmos bloß „äußerer“ Ursachen ein Lebewesen mit einem „inneren“ Grund entsteht – zunächst wohl als ein unreflektiertes Interesse? Aus äußeren Ursachen kann ein „inneres“ Interesse nicht erklärt werden. Auch nicht durch die Vorstellung eines Schöpfers oder intelligenten Designers, der für das begriffliche „Ur-Subjekt“, um das es hier geht, als deren angenommene Ursache völlig äußerlich bleibt. Natürlich muss die Potentialität der Entstehung interessierter Subjekte vorausgesetzt werden. Aber diese Potentialität kann eben nicht als Ursache gedacht werden, wie man etwa einen Menschen als Potentialität seiner Handlungen beschreiben könnte. Es gibt meines Erachtens keine befriedigendere Lösung dieses explanatorischen Problems – und ich kann dieser Position hier nur Ausdruck verleihen, nicht aber für sie ausgiebig argumentieren –, als anzuerkennen, dass die Entstehung interessierter Subjekte nicht aus der Natur, der Welt, dem Kosmos oder sonst einer als Ursache verstandenen Wirklichkeit erklärt werden kann. Um Pinkard in dieser Hinsicht erneut zu zitieren: „However, even at the level of organic life, the stage of natural development at which the terms better and worse begin to become meaningful, nature remains impotent since nature on its own can not organize itself into something like the best version of a lion, a rose, or a trout“ – oder, wie ich ergänzen will: into the worst version of even a most simple unicellular organism.279 Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass die Entstehung des Lebens aus sich selbst heraus erklärt werden könnte. Die Entstehung von Leben, die Entstehung 278 279 Dennett, Daniel C.: Ellbow Room, Cambridge, MA/London, England: The MIT Press, 1984, Seite 21f. Pinkard (2012), Seite 22f. 112 eines individuellen lebendigen Subjektes hat ihren Grund nicht in sich selbst. Dazu müsste es ja bereits existieren. Es bleibt auf die Möglichkeit der Entstehung von lebendigem Dasein verwiesen. Weder ist es selbst seine Möglichkeit noch ist diese Möglichkeit die Möglichkeit eines bestimmten interessierten Daseins. Das interessierte Subjekt ist kein Individuum, das seine individuelle Möglichkeit ergreift, sondern ein individuelles Ergreifen der Möglichkeit lebendigen Daseins überhaupt. Und dieses individuelle Ergreifen der Möglichkeit verstehe ich als den „inneren“ Grund, das „Ur-Interesse“, welches ich als das Zentrum eines jeden interessierten Subjektes begreife. Insofern die Entstehung des interessierten Subjekts weder durch Ursachen noch durch einen ihm eigenen Grund und auch nicht durch die vorauszusetzende Potentialität der Entstehung interessierter Subjekte überhaupt vollständig zu erklären ist, bleibt eine Restwirklichkeit, die in kausaler Hinsicht als Wunder, in statistischer Hinsicht als Zufall, in praktischer Hinsicht als Freiheit bezeichnet werden kann. Wenn Dennett schreibt „the day that the universe contained entities that could take some rudimentary steps toward defending their own interests was the day that interests were born“, dann kommt darin genau diese Gleichursprünglichkeit von interessiertem Subjekt und Freiheit zum Ausdruck – auch wenn ich nicht den Eindruck habe, dass Dennett selbst diese Konsequenz so klar gezogen hat. Die „entities“ mussten frei sein, ihre Interessen zu verteidigen, konnten dazu aber nur frei sein, wenn sie mindestens ein Interesse hatten. Ohne ein einziges Interesse wird eine uninteressierte Entität, ihr mögen Freiheitsgrade in welcher Hinsicht und in welchem Umfang auch immer zugesprochen werden, nicht frei sein, ihre Interessen zu verteidigen. Und welche Freiheit für diese Entität auch angenommen werden mag, so wird es nicht die Freiheit sein können, sich aus sich selbst heraus zu einem interessierten Subjekt zu verwandeln. Denn soweit sie nur aus „äußeren“ Ursachen heraus entsteht, kann sie nicht mehr als ein physikalisch oder chemisch strukturierter Stoff oder Prozess sein, der keine ihm eigene Individualität besitzt, das, was man als „Innerlichkeit“ oder „Zentriertheit“ bezeichnen kann, und also nicht einmal ansatzweise aus sich selbst heraus auch nur zu irgendetwas sich zu entwickeln fähig ist. Das minimal vorauszusetzende und zentrale Interesse muss meines Erachtens also das individuelle Ergreifen der Möglichkeit interessierten Daseins selbst sein, die freie Wirklichkeit eines individuellen Bemühens um das eigene Dasein. Wäre ein solches, zwar unbegründetes, dennoch aber grund-legendes Interesse nicht möglich, könnte meines Erachtens die Existenz interessierter Lebewesen nicht erklärt werden und wir müssten in unseren erklärenden Reflexionen letztlich unsere eigene Existenz negieren.280 Natürlich ist 280 Es ist genau dies die Konsequenz moderner Selbstorganisationstheorien, in denen das „Selbst“ letztlich zu einem Niemand erklärt, meines Erachtens verklärt wird. Dazu Michael Hampe: „Das ‚Selbst‘ der Selbstorganisationstheorien und die ‚Autonomie‘ dissipativer Strukturen haben weniger oder nichts mit einer selbstbewußten Reflexivität zu tun als vielmehr mit dem, was wir meinen, wenn wir sagen, etwas geschehe ‚von selbst‘. Wenn die Tür ‚von selbst‘ zugeht oder sich der Schmerz ‚von selbst‘ legt, dann 113 eine solche Erklärung, das gestehe ich gerne zu, wohl eher das Eingeständnis der Grenze unserer Erklärungsmacht, als eine wirkliche Erklärung – aber wer sagt, dass solche Eingeständnisse nicht Teil der Wissenschaft sein dürfen? Ich verstehe ein solches Eingeständnis im Sinne einer epistemischen Haltung, die Alfred North Whitehead als Demut und Bescheidenheit theoretischer Tätigkeit bezeichnet hat.281 Es ist kein „Opfer des Intellekts“, sondern die Anerkennung einer Begrenzung desselben, die man mit Max Weber geradezu als „Rechtschaffenheitspflicht“ wissenschaftlichen Arbeitens verstehen kann. Und es erscheint mir in diesem Sinne angebracht, diese Grenze expressiv kenntlich, d.h. explizit zu machen, und nicht, wie es etwa Dennett tut, über diese hinwegzuwischen, so als sei nichts gewesen.282 Für die Annahme der Freiheit, ein Interesse verteidigen zu können, reicht es aber noch nicht aus, die Gleichursprünglichkeit von Freiheit und Interesse vorauszusetzen. Das minimal vorauszusetzende Interesse muss als ein wirkliches, wenn nicht schon als ein reflektiertes, dann doch in anderer Hinsicht einen Unterscheid zu einer uninteressierten Wirklichkeit wie etwa Dennetts vulkanischer Gesteinsformation aufweisen. Es reicht nicht, wie es Dennett im Zusammenhang dieses Beispiels tut, die Antwort darauf zu reduzieren, dass im Unterschied zu der Gesteinsformation „the replicators began to turn into crude guardians of their own interests“. Denn wie sollten sie als unreflektierte Lebewesen dazu fähig sein, ihr Verhalten auf ein Interesse zu zentrieren? Was also könnte die Eigenschaft sein, welche dieses unreflektierte interessierte Verhalten verständlich macht? Die einzige plausible Antwort auf diese Frage scheint mir das im letzten Abschnitt bereits angesprochene Erleben zu sein, das sich als ein positives und negatives Empfinden in Abhängigkeit von einer dem Interesse entsprechenden oder widersprechenden Entwicklung manifestieren kann. Natürlich könnte man ein solches Erleben auch als eine Art von Reflexivität bezeichnen. Aber es ist eine Reflexivität des Erlebens, nicht des meinen wir nicht, daß hier in der Tür oder dem Schmerz Prozesse der Reflexivität ablaufen, die uns Respekt abfordern. Vielmehr hat niemand die Tür zugemacht, und niemand muß etwas gegen den Schmerz tun, weil hier etwas ohne Planung und Intention geschehen ist bzw. geschehen wird.“ Hampe, Michael: Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbegriffs, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007, Seite 129. Titeltragend kommt diese „Verniemandung“ des Subjekts auch in Thomas Metzingers Being No One zum Ausdruck. Metzinger, Thomas: Being No One, Cambridge, MA/London: The MIT Press, 2004. Diese Abschaffung des „Selbst“, das wird bei Metzinger deutlich, erwächst aus einer meiner Meinung nach nicht begründbaren Reduzierung desselben auf seine reflexive Tätigkeit und der in einer solchen möglichen Selbstbezüglichkeit. Ich hingegen halte, wie ich hier deutlich mache, Reflexivität für eine evolutionär späte Entwicklung und Ausdifferenzierung eines ein interessiertes Erleben voraussetzenden reflexhaften Resonierens. Und dieses je individuelle interessierte Erleben ist nicht Niemand, sondern jeweils ein Jemand, der, das werde ich an einer anderen Stelle dieser Arbeit herausstellen, einen Wert bedeutet (vgl. Seite 147f. dieser Arbeit). Und genau dieser Wert, nicht Reflexivität ist es, was uns Respekt abverlangen kann und sollte. Diese Diskussion verlangt letztlich auch nach einem neuen Willensbegriff, der nicht auf Reflexivität und Planung reduziert werden kann, sondern diese müssten vielmehr ihrerseits auf einen, wenn auch grund-losen, so doch aber grund-legenden, vor-reflexiven Lebenswillen zurückgeführt werden. 281 Vgl. Whitehead, Alfred North: Prozeß und Realität, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979, Seite 56. 282 Vgl. Weber, Max: Wissenschaft als Beruf, Stuttgart: Recalm, 1995, Seite 40ff. 114 begrifflichen Urteilens oder gar Wissens. Erleben setzt kein begriffliches Urteilen voraus. Ich möchte sie deshalb als ein eher reflexhaftes Resonieren eines erlebenden Ergreifens von einem reflexiven Räsonieren eines intelligenten Begreifens unterscheiden.283 Ohne ein solches erlebendes reflexhaftes Resonieren sehe ich nicht, wie jene unreflektierten „replicators“ jemals dazu fähig und frei gewesen wären, erste Schritte zur Verteidigung ihrer Interessen zu unternehmen, sich auch nur in die Richtung irgendeines Interesses zu organisieren, zu einem Organismus zu entwickeln. Ich nehme aus diesem Grund die Gleichursprünglichkeit nicht nur von Freiheit und Interesse, sondern auch von Erleben an. Die vorangegangenen Überlegungen führen, das sollte deutlich geworden sein, die Auseinandersetzung um den Fortschrittsbegriff auch ins Zentrum der zeitgenössischen Philosophie des Geistes und zu dem von David Chalmers sogenannten „explanatory gap“.284 Auch hier wird in meinem Verständnis also implizit über den Fortschrittsbegriff mitverhandelt. Ich werde mich diesbezüglich auf keine weiteren Detaildiskussionen einlassen können, weil dies von dem Ziel dieser Arbeit, ein grundlegendes Verständnis des Fortschrittsbegriffes zu entwickeln, zu weit abführen würde. Es kann an dieser Stelle nur festgehalten werden, dass die in diesen Diskussionen erörterten Fragen von entscheidender Bedeutung für das hier noch weiter zu entwickelnde Verständnis von Fortschritt sind. Was meine eigene Position betrifft, so habe ich deutlich gemacht, dass ich nicht denke, dass wir dieses explanatorische Problem oder diese explanatorische Lücke – wohl eher expressiv als explanatorisch – befriedigend werden lösen können ohne die Konzession an eine kausale Unerklärlichkeit, sei es im Hinblick auf äußere Ursachen, sei es im Hinblick auf innere Gründe. 285 Das bedeutet keine creatio ex nihilo! Denn die vorauszusetzende Möglichkeit oder Potentialität der Entstehung interessierter, erlebender und freier Subjekte muss eine wirkliche Möglichkeit und damit eine Wirklichkeit und kein nihilo sein. Aber nicht nur das ex nihilo greift hier vorbei, sondern auch die creatio trifft den Zusammenhang nicht. Denn eine creatio verweist auf eine Erschaffung eines Geschöpfes durch einen Schöpfer. Ein solches Verhältnis kommt meines Erachtens aber in der Relation zwischen Potentialität und der Entstehung interessierter, erlebender und freier Subjekte gerade nicht in Frage.286 Genau deshalb habe ich ihre Entstehung in kausaler 283 Zum Begriff des Reflexes und seiner Bedeutung für das individuelle Erleben vgl. Hampe, Michael: Erkenntnis und Praxis, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006, Seite 110ff. 284 Chalmers, David: „Facing Up to the Problem of Consciousness“, in: Journal of Consciousness Studies, 2(3), 1995, Seite 200-219. 285 In dem Eigeständnis einer bloß expressiven Lösung des explanatorischen Problems der Entstehung von Leben liegt eine Verbindung zu einem weiter unten ausführlich diskutierten Teilaspekt vernünftigen Verhaltens, den man als ästhetisch-diskursives Verhalten bezeichnen kann. Bei diesem Hinweis will ich es an dieser Stelle belassen; vgl. Seite 141ff. dieser Arbeit. 286 Gunnar Hindrichs, der sich, soweit ich sehe, in Das Absolute und das Subjekt gedanklich mit genau dem gleichen Problem auseinandersetzt, spricht nachvollziehbarerweise in diesem Zusammenhang deshalb auch von einem „Ungrund“. Hindrichs, Gunnar: Das Absolute und das Subjekt, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2008, Seite 290ff.; meines Erachtens könnte man auch von einer absoluten Potentialität 115 Hinsicht als Wunder, statistischer Hinsicht als Zufall und in praktischer, man könnte auch sagen, erlebender Hinsicht als Freiheit bezeichnet. Ich neige dazu, einen Wirklichkeitsbegriff zu vertreten, den man wohl am ehesten als Individualpsychsimus oder aber in Anlehnung an Pierre Teilhard de Chardin auch als Korpuskularpsychismus benennen kann, ohne dass mit dieser Bezugnahme eine Zustimmung zu seiner Vision der Evolution als einer progressiven Bewegung auf eine Vollendung hin verbunden wäre.287 In dieser Sichtweise kann zwar keinen Stoffen, doch aber Molekülen oder Atomen ein Erleben zugesprochen werden. Wenn Michael Hampe schreibt, dass der metaphysische Empirismus von Charles Sanders Peirce und Alfred North Whitehead in Hinsicht auf den „Verdacht des Anthropomorphismus oder Panpsychismus“ vielleicht dahingehend präzisiert werden sollte, dass „das Auftreten von Empfindungen außerhalb der Relevanzordnung von Perspektiven innerhalb solcher Ordnung terminologisch scharf zu trennen“ ist, dann gebe ich ihm Recht.288 Und ich sehe eine solche scharfe Trennung eben in dem Unterschied zwischen Individualität und Stofflichkeit und denke, dass man Individualität – nicht Identität – als die grundlegende Bedingung von perspektivischen Relevanzordnungen verstehen kann. Ein Stein also erlebt demnach nicht, weil er keine Individualität hat, sondern ein Stoff ist. Durchaus halte ich es aber für denkbar, dass mit den einzelnen Molekülen, die einen Stein ausmachen, und in diesen mit den Atomen je ein wie auch immer geartetes individuelles Erleben korreliert. Es handelt sich bei dieser Version eines metaphysischen Empirismus also nicht um einen Panpsychismus, zumindest nicht im klassischen Sinne. Auch denke ich nicht, das man hier von einem Anthropomorphismus sprechen sollte, bei dem man zwischen zwei Spielarten unterscheiden kann: einer positiven und einer negativen. Der positive Anthropomorphismus projiziert die menschliche Form des Erlebens in die Gegenstände seiner Reflexion, der negative hingegen spricht diesen mit der menschlichen Form des Erlebens auch das Erleben selbst ab. Ist Erleben aber an eine bestimmte Form gebunden? Ich will es hier bei diesen Anmerkungen belassen und nur noch eine letzte hinzufügen: Da Fortschritt über das individuelle Subjekt hinausgeht, dem Begriffe nach zeitlich und räumlich über dieses in eine weite prozesshafte Offenheit ausgreift, liegt die Bedeutung der Entwicklung einer Prozessphilosophie, welche die Irreduzibilität des individuellen interessierten, erlebenden und freien Subjekts auf äußere Ursachen oder innere Gründe mitdenkt, für den hier vorgeschlagenen Fortschrittsbegriff auf der Hand. Alfred North Whiteheads Philosophie bietet dazu meines Erachtens zumindest einen Ausgangspunkt, sowie die für seine Philosophie wichtigen Denker Charles Sanders Peirce, William James sprechen, wenn diese eben nicht als schöpferische Macht, sondern allein als ermöglichende Kraft zu verstehen wäre. Ich werde weiter unten noch darauf zu sprechen kommen; vgl. Seite 216ff. dieser Arbeit. 287 Vgl. Teilhard de Chardin (2006), Seite 19ff. 288 Hampe (2006), Seite 116f. 116 und John Dewey. Jedoch scheint mir zum Beispiel Hans Jonas’ Kritik an Whiteheads Prozessontologie bedenkenswert, wenn er schreibt, dass sie entscheidende Fragen der Lebenserfahrung am Ende ausklammern muss, so nicht zuletzt die individuelle Angst vor dem Tod, ein Aspekt der uns weiter unten noch beschäftigen wird: „Während die Polarität von Selbst und Welt, wie auch von Freiheit und Notwendigkeit, Raum in Whiteheads System findet, tut es die von Sein und Nichtsein entschieden nicht – und damit auch nicht das Phänomen des Todes (noch, beiläufig, das des Bösen): welches Verständnis des Lebens aber kann es geben ohne ein Verständnis des Todes? Die tiefe Angst biologischer Existenz hat in diesem großartigen Schema keinen Platz.“289 Trotz oder gerade mit solchen kritischen Einwänden im Sinn stimme ich Michael Hampe zu, wenn er im Text auf dem Buchrücken von Erkenntnis und Praxis – Zur Philosophie des Pragmatismus schreibt: „Es gilt, an das philosophische Differenzierungsniveau wieder anzuknüpfen, das der klassische Pragmatismus und seine Metaphysik in ihrem Verständnis vom individuellen Leben, von der Wissenschaft und der Religion schon einmal erreicht hatten.“290 Eine Empfehlung, die aber nicht als „Zurück zu Peirce, James, Dewey und Whitehead“ zu verstehen ist.291 Wenn, wie ich argumentiert habe, das minimale und zentrale Interesse eines jeden noch so einfachen Organismus das individuelle Ergreifen der Möglichkeit interessierten Daseins überhaupt ist, dann steht dieses Verständnis im völligen Einklang mit unserer Beschreibung von Organismen als sich um ihr eigenes Dasein bemühende Lebewesen. Aber nicht nur mit dem Bemühen um die eigene Existenz, sondern auch mit dem Bemühen um Reproduktion ist dieser innerste Nisus zu vereinen.292 Da das individuelle Ergreifen ein Ergreifen der Möglichkeit interessierten Daseins überhaupt ist, bedeutet es nicht nur ein Interesse am eignen Dasein, also an Selbsterhaltung, sondern eben auch ein Interesse an der Möglichkeit anderen Daseins, besteht mit dem individuellen Ergreifen der Möglichkeit auch das wirkliche Interesse an Reproduktion, der Ermöglichung neuen interessierten Daseins. Aber wiederum kann die Verwirklichung dieses Reproduktionsinteresses nicht als Ursache neuen interessierten Daseins verstanden werden. Denn es bleibt dabei, dass ein solches nicht aus „äußeren“ Ursachen entstehen kann. Die an Reproduktion interessierten Organismen können nur durch Adaption und Modifikation diejenigen Bedingungen herbeiführen, unter denen sich ein neues individuelles Ergreifen der Möglichkeit 289 Jonas, Hans: Organismus und Freiheit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973, Seite 150. In dieser Hinsicht müsste meines Erachtens an einer Modifizierung von Whiteheads Ontologie gearbeitet werden. Ein entscheidender Ansatzpunkt scheint mir die Thematisierung des individuellen Interesses am Leben und Erleben zu sein. Denn nur weil wir ein grund-legendes individuelles Interesse an unserem Leben und Erleben haben, bedeutet der Tod ein Problem für uns. Die Möglichkeit einer Erweiterung der whiteheadschen Ontologie durch den Begriff des Interesses wird an einer anderen Stelle dieser Arbeit etwas deutlicher, wenn auch nicht ausgiebig diskutiert werden; vgl. Seite 151ff. dieser Arbeit. 290 Hampe (2006). 291 Vgl. ebd., Seite 44. 292 Den Begriff des „innersten Nisus“ entlehne ich Williams, Bernard: Ethics and the Limits of Philosophy, London: William Collins, 1985, Seite 44. 117 interessierten Daseins überhaupt unbegründet zu einem ihnen ähnlichen Organismus entwickeln kann. Dieses neue individuelle Ergreifen adaptiert die vorgefundenen Bedingungen, bleibt aber darin frei, diese in Verfolgung seiner Interessen in welch geringem Umfang auch immer zu modifizieren, die Form seines Lebens weiterzuentwickeln und weiterzugeben. Das Leben nimmt seinen evolutionären Lauf. Hinsichtlich der Unbegründetheit des Entstehens eines individuellen Subjektes jedoch ist die Entwicklung jedes neuen Organismus ein Anfang nicht weniger als jener des oder der ersten. Im letzten Abschnitt habe ich bereits deutlich darauf hingewiesen, dass die Subjekte des Fortschritts in einer erlebenden Beziehung zu ihren Zielen stehen müssen. Diese vorauszusetzende Verbindung wurde nun noch einmal ausführlicher dargestellt und durch den Freiheitsbegriff ergänzt. Dabei habe ich Pinkards in seiner Hegel-Interpretation entwickeltes Verständnis von Freiheit als ein „Bei-sich-selbst-Sein“ kritisiert. Hinter dem „Bei-sich-selbst-Sein“ verbirgt sich eine Vorstellung von Freiheit, in deren Zentrum ein selbst-bewusstes Subjekt steht, das sich reflexiv das Ziel setzt, die Spannung, die es als sich selbst begreift, in den Griff zu bekommen, und insofern es dieses vermag, bei sich selbst ist und bleibt. Vor evolutionstheoretischem Hintergrund habe ich dafür argumentiert, dass es sich dabei um eine Modifikation von Freiheit handelt, für die nicht schon ein selbst-bewusstes Subjekt vorausgesetzt werden muss, sondern ein bewusstes bzw. erlebendes Subjekt bereits hinreicht. Ein erlebendes Subjekt ist in der modifizierenden und adaptierenden Verfolgung seiner Interessen frei. Und so es sich seinen Interessen entsprechend verhält, ist es erlebend bei sich, wenn auch nicht bei-sichselbst im Pinkard-Hegelschen Sinne. Pinkard selbst weist mit Referenz auf Hegels Begriff des „Selbstgefühls“ auf dieses eher reflexhafte Selbstverhältnis als eine Vorform intelligenterer, d.h. reflexiver Selbstverhältnisse hin.293 Der Begriff des Protobewussteins, wie er in der Philosophie des Geistes immer wieder auftaucht, scheint mir in diesem Zusammenhang völlig berechtigt. In der Darstellung des Begriffes der „Befriedigung“ habe ich darüber hinaus deutlich gemacht, dass die selbst-bewusste Freiheit nicht als „Handlungsfreiheit“ zu verstehen sei. Das gleiche gilt für die „bloß“ erlebende Freiheit. Auch ein unreflektiertes Subjekt, wenn es durch was auch immer daran gehindert wird, einem bestimmten Interesse nachzukommen, und auch daran scheitert, die äußeren Bedingungen daraufhin seinem Interesse gemäß zu modifizieren, bleibt darin frei, sein Interesse entsprechend zu adaptieren. Die Anpassung der Interessen ist selbst ein Tun, eine innere Modifikation. Das unreflektierte Subjekt ist so stets dazu frei, irgendetwas zu tun, auch wenn das eben nicht heißt, dass es alles tun kann, woran auch immer es ein Interesse entwickelt. Es ist eine physische Freiheit, insoweit sie sich in dem verwirklicht, was wir Materie nennen. Es ist 293 Vgl. Pinkard (2012), Seite 57f. 118 eine metaphysische Freiheit, insofern sie nicht durch die Materie als solche, vorgestellt als raumzeitlicher Wirkungszusammenhang bloß „äußerer“ Ursachen, erklärt und also nicht auf diese reduziert werden kann. Die Existenz interessierter, erlebender und freier Subjekte setzt, um es noch einmal zu sagen, meines Erachtens eine Gesamtwirklichkeit voraus, in der praktische Freiheit, statistischer Zufall und kausale Wunder ihren Platz haben. Eine Wirklichkeit, die gerade so viele Wunder enthält wie es Lebewesen, in welcher Form auch immer, gab, gibt und geben wird. Eine Wirklichkeit, in welcher der statistische Zufall in Relation zu den Bedingungen, in denen er jeweils registriert wird, sich zu statistischen Regelmäßigkeiten verdichtet. Regelmäßigkeiten, die wiederum niemals erkannt werden könnten, wären nicht Lebewesen entstanden, die zur Entwicklung erkenntnisfähiger Subjekte beizutragen frei gewesen sind. Diese metaphysisch-physische Freiheit ist mitnichten unbedingt oder absolut zu verstehen, sondern als eine von ihrer Potentialität und den raumzeitlichen Bedingungen, in denen sie sich verwirklicht, bedingte. Ohnehin halte ich den Begriff einer „absoluten“ oder „unbedingten Freiheit“ für in sich widersprüchlich. Ein absolut freies Wesen wäre, wenn auch zu nichts anderem, so doch zu seiner Freiheit bestimmt, oder stärker formuliert, verdammt, was mit der suggerierten Vorstellung einer absoluten Freiheit nicht in Einklang zu bringen ist. Selbst ein Gott könnte niemals absolut frei sein. Insofern verstehe ich die Bedingtheit der Freiheit anders als etwa Hans Jonas nicht als eine „Antinomie der Freiheit“, sondern als die Natur der Freiheit selbst. 294 Zu einer „Antinomie“ oder „dialektische(n) Freiheit“ kann die bedingte Freiheit nur werden, wenn wir sie zuvor, meiner Meinung nach fälschlicherweise, mit dem Begriff der Unbedingtheit implizit kurzschließen. Es ist vielmehr dieser Kurzschluss, der zu einer selbst für einen Gott unauflösbaren Antinomie führt. Ein freies Wesen sollte seine bedingte Freiheit also nicht als Mangel oder gar Degradierung verstehen, sondern als die Natur der Freiheit selbst. Unsere Natur ist die phänomenale Spannung zwischen Souveränität und Machtlosigkeit, die es für uns auf befriedigende Weise zu leben gilt. Diese Formulierung scheint mir eine plausible, möglichst allgemeine Formulierung dessen zu sein, was wir sind und um was es uns geht, insofern sie sich auf das gesamte Leben eines individuellen Subjektes beziehen lässt, unabhängig davon, unter welchen Bedingungen ein solches Leben konkret gelebt wird. Diese Bedingungen, die Kontexte, die Formen, in denen wir unsere Natur leben, können sehr unterschiedlich sein. Aber bei aller Verschiedenheit geht es in unserem natürlichen Gespannt-Sein zwischen Souveränität und Machtlosigkeit darum, diese Spannung durch Modifizieren und Anerkennen auf befriedigende Weise zu leben. Ein solches befriedigendes Leben, nicht die Reflexion unserer Natur, ist der Endzweck, nicht der Welt, sondern unser jeweiliger Endzweck in der Welt. Die Selbst-Reflexion kann dabei helfen, von unerfüllbaren und dieser Natur 294 Vgl. Jonas (1973), Seite 130ff. 119 widersprechenden Zielsetzungen im Kleinen wie im Großen Abstand zu nehmen, und so ihren Teil zu einem befriedigenden Leben beitragen. Aber sie ist nicht selbst unser Endzweck, sondern ermöglicht „nur“ diesen reflexiv zu begreifen, um ihn für unsere reflexive Praxis bestimmend werden zu lassen. Ich denke, dass dies als eine subjektiv nachvollziehbare allgemeine Formulierung des Lebenszieles interessierter, erlebender und freier Subjekte in der Welt gelten kann. Individuelle, nach „Befriedigung“ suchende Lebewesen sind die Subjekte des Fortschritts. 6 Objektiver Fortschritt Eine Antwort auf die Frage nach objektivem Fortschritt zu geben, das sollte soweit deutlich sein, kann nicht heißen, von der individuellen Suche nach einem befriedigenden Leben Abstand zu nehmen. Objektiver Fortschritt setzt in seiner substantiellen Partialität die „Befriedigung“ individueller Subjekte voraus. Aber der Begriff eines objektiven Fortschritts kann nicht bei der individuellen Befriedigung stehen bleiben, sondern er muss, um einer möglichen aggregativen Universalität gerecht werden zu können, auch verständlich machen, in welcher Verbindung die Suche nach einem befriedigenden Leben eines einzelnen Subjektes mit denen anderer steht. Es muss aufgezeigt werden, inwiefern die individuelle Suche nach Befriedigung die Befriedigung anderer nicht ausschließen muss und so mit der Möglichkeit eines befriedigenden Lebens aller zu einer Zeit sowie zukünftig lebenden und zur „Befriedigung“ fähigen Wesen zusammengedacht werden kann. Außerdem gilt es herauszuarbeiten, inwiefern ein Subjekt es als ein mit seiner individuellen Befriedigung vereinbares, praktisches Ziel verstehen kann, sein Leben in einer Weise zu gestalten, die einer solchen Möglichkeit nicht widerspricht und worin diese Weise genauer besteht. Nur so kann ersichtlich werden, inwiefern die individuelle Suche nach einem befriedigenden Leben im doppelten Sinne „Befriedigung“ mit sich bringen kann, als ein befriedigendes Leben in Frieden. Dieses Optimum eines objektiven Fortschritts ist, das sei hier noch einmal mit Schnädelbachs Worten deutlich gesagt, keine „Utopie der Versöhnung“, sondern ein spannungsgeladenes, mitunter äußerst anstrengendes und niemals abschließend zu erfüllendes Projekt. Befriedigung und Relativismus Was wir soweit durch den Begriff der „Befriedigung“ gewonnen haben, ist ein allgemeines Verständnis davon, um was es individuellen Subjekten in ihrem Leben geht. Die Allgemeinheit dieses Begriffs sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht dazu hinreicht, uns ein adäquates Verständnis von Fortschritt in einem objektiven Sinne zu vermitteln. Zwar kann der allgemeinen Beschreibung unseres Daseins als individueller, 120 wenn auch von anderem und anderen abhängiger Suche nach einem befriedigenden Leben meines Erachtens mit guten Gründen Objektivität zugesprochen werden. Man müsste schon begründet behaupten können, dass es uns umgekehrt subjektiv um ein unbefriedigendes Leben ginge oder es uns gleich wäre, ob wir ein befriedigendes oder unbefriedigendes Leben führen. Dies halte ich für abwegig. So unterschiedlich oder gar gegensätzlich die konkreten Bedürfnisse und Interessen verschiedener Subjekte oder eines individuellen Subjektes im Verlauf seines Lebens auch sein mögen, stets geht es um die Erfüllung bzw. Befriedigung derselben. Die Suche nach Befriedigung kann mit Recht als das übergeordnete Ziel eines jeden individuellen Lebens bezeichnet werden. Und dieses Ziel lässt es ratsam erscheinen, unsere Freiheit dafür zu gebrauchen, uns von allen uneinlösbar erscheinenden Bedürfnissen und Zielen zu verabschieden, deren Verfolgung uns bloß unbefriedigt oder frustriert zurücklassen würde. Aber damit ist eben noch keine Antwort auf die Frage nach einem objektiven Fortschritt gegeben. Wir hätten nur eine negative Orientierung gewonnen, die man etwa in der folgenden Weise in Form eines kategorischen Imperativs ausdrücken kann: Wolle niemals etwas, das zu verwirklichen dir unmöglich ist. Dieser Imperativ erfüllt notwendig die teleologische Suffizienzbedingung. Wenn wir uns in unserer Freiheit nur diejenigen Ziele setzen, die wir auch verwirklichen können, dann ist die Realisierbarkeit derselben von vornherein gegeben und es scheint, als sei damit eine Orientierung gewonnen, die uns den Weg in ein befriedigendes Leben mit einem Minimum an Frustration weist. Aber hier regt sich ein gewisser Widerstand. Mit Bernard Williams können wir diesen wie folgt formulieren: „It is not enough, though, for this freedom merely that we should not be frustrated in doing whatever it is we want to do. We might be able to do everything we wanted, simply because we wanted too little. We might have unnaturally straitened or impoverished wants. This consideration shows that we have another general want, if an indeterminate one: we want (to put it vaguely) an adequate range of wants.“295 Dieser Einwand bringt zum Ausdruck, dass die negative Normativität des Befriedigungsbegriffes es letztlich unbestimmt lässt, ob es nicht innerhalb des Bereiches des subjektiv Realisierbaren allgemeine Ziele bzw. Interessen gibt, deren Nichterfüllung wiederum Frustration, also ein unbefriedigendes Leben zur Folge hat. Es könnte unbefriedigend sein, den Bereich des subjektiv Realisierbaren der Verbindlichkeit eines subjektiven Relativismus zu überlassen. Williams fasst die Möglichkeit solcher allgemeinen Interessen in dem unbestimmten Interesse zusammen, einen angemessenen Umfang von Interessen zu haben. Aber worin dieser Umfang an Interessen genau besteht, diesbezüglich ist er sehr zurückhaltend. Zu Recht, denn konkrete Vorstellungen davon, worin genau ein angemessener Umfang von Interessen besteht, sind, zumindest zum größten Teil, nichts, was für alle Menschen und über alle Zeiten hinweg allgemeingültig feststeht. Sondern solche Vorstellungen sind das Ergebnis eines intersubjektiven 295 Williams (1985), Seite 57. 121 historischen Prozesses, in dem sich, zunächst und zumeist lokal begrenzt, Vorstellungen über das, was es heißt, nicht nur „Befriedigung“, sondern „Befriedigung“ in einem „guten Leben“ zu finden, erst herausbilden und die im Laufe der Zeit immer wieder modifiziert werden. Die Hervorbringung solcher Vorstellungen ist eine soziale Notwendigkeit, zumindest dann, wenn Sozialität, also ein Minimum an Zusammenhalt überhaupt möglich sein soll. Ohne gemeinsame normative Vorstellungen kann eine Gesellschaft keine Stabilität erhalten, würde sie in sich zusammenfallen bzw. sich erst gar nicht herausbilden. Aus dieser sozialen Notwendigkeit erwachsen die historischen Lebensformen, von denen wir mit Hegel sprechen können, und die ihnen entsprechenden Vorstellungen von einem „guten Leben“.296 Natürlich sind diese Vorstellungen Konventionen. Aber das heißt nicht, dass sich ein Individuum diesen einfach entziehen könnte, weil es ihre Konventionalität reflektiert. Die Konventionalität verhindert nicht ihre objektive Geltung, die derjenige erfahren wird, der sich nicht entsprechend den jeweils gültigen Konventionen seines Lebensumfeldes verhält. Es ist für die objektive Geltung von Konventionen ohne Belang, das es Zeiten gab, in denen sie nicht galten, und es Zeiten geben wird, in denen sie nicht mehr gelten werden. Eine solche Endlichkeit objektiver Sachverhalte ist auch nichts, das allein in ethischen Zusammenhängen aufträte. Das Glas ist voll Wasser. Ich trinke das Wasser. Das Glas ist leer. Historizität und Konventionalität sind per se keine Argumente gegen die Objektivität, d.h. gegen die von der Zustimmung eines individuellen Subjektes unabhängige Geltung normativer Vorstellungen. Vielmehr erklärt die Konventionalität ja gerade die Geltung überindividueller Normen, nicht allein ihre Veränderlichkeit. Sie gelten, weil eine Vielzahl von Gesellschaftsmitgliedern aus welchen Gründen auch immer diese Normen unbewusst oder bewusst, implizit oder explizit anerkennt und sie durch ihr Verhalten dem individuellen und sozialen Leben informell und formell einschreibt, sich mit ihnen biographisch verbindet, sie verkörpert und als „zweite Natur“ an die nächste Generation weitergibt. Ihre Konventionalität kann also kein generelles Argument gegen die objektive Geltung von Normen und für ihre Problematisierung sein. Wann aber werden konventionelle Normen problematisch? Sie werden es dann, wenn die Erfüllung einer objektiven Norm, die Erfüllung einer anderen objektiven Norm unmöglich macht. So können zum Beispiel Arbeitsethos und Familienethos einer Gesellschaft in Konflikt miteinander geraten oder pazifistische Überzeugungen mit der Forderung nach militärischem Handeln, um unterdrückten Menschen in anderen Ländern Hilfe zu leisten oder angesichts anderer Sachverhalte, die etwaig als Anlass gesehen werden. Die Kontexte und Gründe der gesellschaftlichen Hervorbringung widersprüchlicher, objektiver Normen können vielfältig sein, brauchen uns hier im Detail aber nicht weiter anzugehen. Ein Widerspruch zwischen objektiven Normen zeigt an, dass sie problematisch geworden sind. Es ist also der Widerspruch zwischen Konventionen, nicht die Konventionalität oder der 296 Vgl. Seite 63 dieser Arbeit. 122 Inhalt einer einzelnen Konvention per se, der diese delegitimiert. Ein solcher Widerspruch kann nicht gelebt werden, ohne dass mindestens eine der Normen in ihrer objektiven Geltung relativiert wird. Kann dieser Widerspruch nicht über eine grundsätzliche oder bedingte Hierarchisierung oder eine anderweitige Anpassung der Normen aufgelöst werden, besteht die Notwendigkeit, dass sich die Gesellschaft von mindestens einer der Normen ganz verabschiedet. Welche Lösung auf welchem Wege auch immer gefunden werden mag, sie ist wiederum nur als ein konventionelles Ergebnis zu verstehen, dessen Erfolg mit der gelebten Anerkennung dieser Lösung gleichbedeutend ist. Ist eine Gesellschaft, sind ihre Mitglieder in einem Konfliktfall nicht zu einer solchen Anpassung ihrer Lebensform und -weise bereit, wird dies im günstigen Fall nur zu einer Destabilisierung des sozialen Zusammenhalts führen.297 Befriedigung und politisches Interesse? Bringt uns nun dieser gesellschaftliche Hintergrund dem objektiven Fortschrittsbegriff näher? Zumindest ist es so, dass wir, soweit wir in Gesellschaft leben und in dieser ein befriedigendes Leben führen wollen, uns den in dieser objektiv gültigen Normen nicht einfach entziehen können. Auch dem Prozess der konfliktinduzierten Anpassung objektiver Normen können wir aus diesem Grunde nicht gleichgültig gegenüberstehen. Das subjektive Interesse entwickelt sich zu einem politischen Interesse. So könnte das unbestimmte Interesse, von dem Williams schreibt, durch dieses politische Interesse näher definiert werden. Und der Zusammenhang des individuellen Interesses an einer Gesellschaft mit den durch dieses Interesse verbundenen objektiven Anforderungen scheint uns tatsächlich der Vorstellung eines objektiven Fortschritts näherzubringen. Denn was hier sofort deutlich wird, ist, dass nicht mehr nur die jeweils individuelle Suche nach „Befriedigung“ praktisch relevant ist, sondern notwendigerweise auch die Suche nach „Befriedigung“ anderer Mitglieder der Gesellschaft. Die Objektivität dieses Fortschritts läge dabei nicht in erster Linie in der objektiven Gültigkeit bestimmter gesellschaftlicher Normen, sondern darin, dass das in der Gesellschaft lebende individuelle Subjekt seine subjektive Suche nach Befriedigung nicht allein mit sich selbst ausmachen kann. Es ist auf die Koordination seiner Interessen mit denen anderer angewiesen. Das individuelle Subjekt ist nicht die allein entscheidende Instanz. Und nur insoweit die intersubjektive Interessenskoordination die Ausbildung objektiv gültiger Normen notwendig macht, ist in dem politischen Interesse die Anerkennung und Geltung derselben eingeschlossen. Objektiver Fortschritt könnte in diesem Sinne als die mit dem politischen Interesse der individuellen Subjekte verbundene Hervorbringung, Anerkennung und Weiterentwicklung überindividueller Normen bedeuten. Es wäre ein Fortschritt, dessen Erfolg in der 297 Vgl. Pinkard (2012), Seite 115ff. (Antike); sowie 147ff. (Moderne). 123 Herausbildung, in dem Bestand und in der Fortentwicklung eines wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Zusammenhanges gesehen werden könnte. Diese Vorstellung eines objektiven Fortschritts würde aber weiterhin unbestimmt lassen, welchen Inhaltes die objektiv gültigen Normen sind. Ihre konkrete Gestaltung hängt von den konkreten Interessen derjenigen Subjekte ab, die in einer gegebenen Situation für die Ausbildung der Normen entscheidend sind. Wer aber entscheidend ist, das ist im Zweifel eine Frage physischer und psychischer Macht bzw. Gewalt, die sich im Extrem nur insoweit zur Koordination mit anderen ihr widersprechenden Interessen aufgefordert sieht, als sie diese durch Zwang zu unterdrücken oder gar zu vernichten sucht, um ihre eigenen Interessen weitestgehend durchzusetzen. Koordination muss keine Kooperation bedeuten. Der Zusammenhalt einer Gesellschaft kann real auf despotische Gewalt gebaut, die intersubjektive Interessenkoordination zu einem großen Teil negativer Natur sein. So aber kann ein gesellschaftlicher bzw. politischer Zusammenhang einem objektiven Fortschritt – im optimalen Fall die Befriedigung aller im gesellschaftlichen Zusammenhang lebender Subjekte – genau entgegenstehen. Politisches Interesse als solches zeigt der individuellen Suche nach Befriedigung keine Richtung auf, in der ein objektiver Fortschritt am Horizont sichtbar wird. Das politische Interesse ist eben kein Selbstzweck, sondern bleibt an andere individuelle Interessen, deren Befriedigung ein Subjekt in einer Gesellschaft verwirklicht wissen will, ja an die individuelle Suche nach Befriedigung als dem einzigen Selbstzweck überhaupt rückgebunden. Spätestens wenn ein Subjekt keine seiner sonstigen Interessen in einer Gesellschaft verwirklichen kann, verliert es sein Interesse an dieser und wird nur noch mit Zwang zur Einhaltung der gesellschaftlichen Normen gebracht werden können. Es gibt kein unbedingtes politisches Interesse. Das politische Interesse bleibt am Ende der individuellen Suche nach „Befriedigung“ untergeordnet und kann den Begriff eines objektiven Fortschritts aus sich heraus nicht näher bestimmen. Was aber wiederum nicht heißt, dass Politik für den Fortschrittsbegriff keine Rolle spielen würde. Es wird noch deutlich werden, inwiefern sie dieses tut. Auch Pinkard weist darauf hin, dass das Einbezogen-Sein in historisch-gesellschaftliche Zusammenhänge, welche Gestalt diese im Laufe der Geschichte auch immer angenommen haben und annehmen werden, nicht ausreicht, um dem Leben eine über die individuelle Subjektivität hinausgehende, aber dennoch befriedigende Richtung geben zu können. „Acknowledging the historical situatedness of any form of life would be, of course, if left at that stage, completely unsatisfactory. If left in that abstract form, it would simply be yet another blandly self-contradictory muddle in the way that all forms of radical relativism are blandly self-contradictory muddles.“298 Eine historische Lebensform beinhaltet zwar ohne Frage objektive Normen, aber diese Normen ändern sich nicht nur, sondern können, und das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt, einem befriedigenden Leben massiv 298 Ebd., Seite 188. 124 entgegenstehen. Wenn wir das politische Interesse und die mit diesem verbundenen historischen Lebensformen als solche ins Zentrum unserer Praxis stellen, landen wir erneut in einem, wenn auch historisch-politisch verkomplizierten Relativismus, hätten also gegenüber dem bloßen Begriff der subjektiven Befriedigung für ein Verständnis der Möglichkeit objektiven Fortschritts nichts gewonnen. Befriedigung und Wahrheit? Mit Hegel will Pinkard das selbstwidersprüchliche und unbefriedigende Durcheinander dieses Relativismus durch den Begriff der „Wahrheit“ in Ordnung bringen. „To avoid this kind of bland relativism, Hegel’s proposal, stated most generally, is to make philosophy the study of the development of the „Idea“ – the joint conception of our norms, the world, and how the world (as it were) does or does not cooperate with the fulfillment of those norms – as a way of characterizing the point of view in which we acknowledge our own fallibility while at the same time continuing to commit ourselves to a robust conception of truth.“ 299 Aber es bleibt dabei meines Erachtens völlig ungeklärt, wie uns diese Verpflichtung gegenüber einer „robust conception of truth“ dem Problem dieses normativen Relativismus positiv und auf befriedigende Weise begegnen lässt. Was Pinkard unter einem robusten Wahrheitsbegriff versteht, wird von ihm nicht explizit definiert. Ich gehe davon aus, dass er damit zumindest nicht den hegelschen Wahrheitsbegriff meint. Denn dieser mag sein, was er will, robust ist er jedenfalls nicht. Dies hat unter anderem Schnädelbach sehr deutlich herausgearbeitet. Hegel versteht Wahrheit „objektiv nicht nur im Sinne eines Geltungsanspruches, sondern sie ist objektiv wie ein Objekt. – Wahrheit als Gegenstand der Philosophie ist ferner ein Singular; sie ist eine, und es gibt nur die eine Wahrheit. Die Namen der Wahrheit sind: das Ganze (‚Das Wahre ist das Ganze.‘), das Absolute (‚... daß das Absolute allein wahr, oder das Wahre allein absolut ist.‘) – Gott (die Philosophie hat wie die Religion ‚die Wahrheit zu ihrem Gegenstande, und zwar im höchsten Sinne – in dem, daß Gott die Wahrheit und er allein die Wahrheit ist.‘) – Dieses Ganze, Absolute, das die religiöse Rede Gott nennt, ist drittens auch die Wahrheit dessen, wovon die Philosophie handelt, wenn sie nicht nur von jenem Singular spricht: von dem Gebiete des Endlichen, von der Natur und dem menschlichen Geiste.“300 Schnädelbach argumentiert, und wie ich meine zu Recht, dass ein solcher Wahrheitsbegriff, oder vielleicht besser: -anspruch, nicht haltbar ist. Wir können eine solche Wahrheit in unserer Endlichkeit nicht nur nicht erkennen, wir können sie noch nicht einmal denken. Dies ist, um es Hegel parodierend auszudrücken, absolut unbefriedigend. 299 300 Siehe Pinkard (2012), Seite 188. Siehe Schnädelbach (1993), Seite 4f. 125 Ich erlaube mir, Schnädelbach diesbezüglich weiter ausgiebig zu zitieren: „Wenn das Wahre das Ganze ist, dann bekommen wir logische Probleme. Schon Kant erkannte, daß das Unbedingte [als das Ganze; T. W.] ohne Widerspruch nicht gedacht werden kann, denn wir denken es erst, wenn wir es als Einheit des Unbedingten und des Bedingten denken. Hegel macht an dieser Stelle aus der Not eine Tugend: Das Unbedingte könne nur mit dem Widerspruch und als Widerspruch gedacht werden, aber wer von uns kann wirklich den Widerspruch denken? (Ich habe den Verdacht, daß die Verteidiger der Dialektik, sofern es sie überhaupt noch gibt, das auch nicht können.) – Daraus ergeben sich semantische Kopfschmerzen: Ist nur das Ganze wahr, dann kann es das Falsche nicht außer sich haben; also müssen wir Wahrheit als wahre Einheit von Wahrheit und Falschheit denken – aber können wir so etwas überhaupt verstehen? – ferner bringt uns der Holismus der Wahrheit methodologisch in Schwierigkeiten, denn ist das Wahre das Ganze, dann kann die Methode, dieses Wahre zu erkennen, kein von ihm Verschiedenes und ihm Äußerliches sein; das Wahre wäre sonst nicht das Ganze. Also müssen wir das Wahre als Einheit von Sache und Methode denken; aber wie ist das möglich? Wir hören hier von der ‚Selbstbewegung der Sache‘, der ‚Bewegung des Begriffs‘, vom ‚bacchantischen Taumel‘, der ‚ebensosehr die einfache Ruhe ist‘, und wir fühlen den Verdacht in uns aufsteigen, das sei magisches Denken oder bestenfalls ein Rattenkönig irreführender Metaphern. – Wer Hegels Wahrheitslehre folgt, kommt dann auch nicht umhin, seinen skandalösen Satz ‚Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig‘ zu verteidigen. Wenn die Erkenntniswahrheit von der Seinswahrheit abstammt, können wir nur das mit Wahrheit erkennen, was wahr ist, d. h. was wir als das Wahre erkennen können. Vernunft ist nach Hegel das Vermögen, die Wahrheit zu erkennen; damit sich dieses Vermögen verwirklicht, muß die Wahrheit wirklich sein. Vernunft kann sich aber nach Hegel nur in etwas verwirklichen, was Wirklichkeit der Vernunft ist, also muß am Orte der Wahrheit das Vernünftige wirklich und das Wirkliche vernünftig sein. Aus dem Satz, daß nur die Erkenntnis des Wahren wahr sein kann, folgt, daß wir nur das vernünftig erkennen können, was wir als vernünftig erkennen können, und genau dies muß von der Wirklichkeit gelten. So hinterlässt Hegel seinen Erben, wenn sie sich seiner Lehre von der Wahrheit annehmen, schwer zu beantwortende Fragen: Wie können wir das Wahre als das Ganze denken, wenn wir dabei in Widersprüchen denken sollen? Was ist Wahrheit als Einheit des Wahren und Falschen? Was heißt Einheit von Methode und Sache? Wie können wir uns vernünftig der Einheit von Vernunft und Wirklichkeit versichern?“301 Schnädelbach macht aber nicht nur auf diese Unzulänglichkeiten des hegelschen Wahrheitsanspruches aufmerksam, sondern auch auf eine mit diesem verbundene normative Problematik: „Mit diesen theoretischen Rätseln aber ist es nicht genug; Hegels Lehre von der Wahrheit hat auch normative Implikationen, wie seine Beispiele ‚wahrer Freund‘, ‚wahres Kunstwerk‘, ‚wahrer Staat‘ zeigen: ‚Unwahr heißt dann soviel als 301 Schnädelnach (1993), Seite 11f. 126 schlecht, in sich unangemessen. ‘ Hegel zufolge hat die Konstatierung von Unwahrheit immer auch eine wertende Komponente, aus der z.B. folgt, daß das, was ‚in sich unangemessen‘ seinem Begriff nicht entspricht, mit Recht zugrunde geht. Umgekehrt soll das Wahre zugleich das wirkliche und lebendige Gute sein, d.h. die durch Selbstreferenz und neuzeitliche Subjektivität dynamisierte platonische Idee, die ja selbst schon das Wahre und das Gute in sich vereinigte. (Für Hegel ist der Schopenhauersche Gedanke, das wahre Sein als „unvergängliches Leben“ könne nicht gut, sondern vielleicht das Böse selbst sein, schlicht unfaßbar). Für die Philosophie, die Hegel in diesem Punkt folgt, bedeutet dies eine schwere Hypothek: Sie kann nur dann beanspruchen, die Wirklichkeit vernünftig zu erkennen, wenn sie sie nicht nur als vernünftig, sondern auch als gut erkennt. Damit geht das theoretische Ziel der Philosophie in ein praktisches über: aus der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit wird notwendig die Versöhnung mit der Wirklichkeit. Umgekehrt kann die Wirklichkeit, die mit der Versöhnung unmöglich ist, nicht die Wirklichkeit der Idee sein; sie ist entweder ,faule Existenz‘ oder nur ,irgendeine Abstraktion, die nicht zum Begriffe befreit ist‘ und die nicht die Idee selbst, sondern nur irgendwelchen fehlgeleiteten Subjekten zuzuschreiben ist. Hegelianer sind strukturell konservativ, denn bei ihnen gehört die Versöhnung mit der Wirklichkeit selbst zum Wahrheitsbeweis ihrer Philosophie; die steht und fällt auch in ihrem theoretischen Teil mit der Möglichkeit, in der faktischen Macht die Macht der Idee als des ,lebendigen Guten‘ wiederzuerkennen und das natürliche und historische Schicksal der Menschen mit der Wirklichkeit der Vernunft in Verbindung zu bringen. Der ,Beweis‘ der Vernunft in der ,Erkenntnis der Vernunft‘ – das ist der Hegelsche Gottesbeweis, der in der ,Wissenschaft der Logik‘ zu führen ist; der Philosophie in ihren materialen Teilen hingegen – als Naturphilosophie und als Philosophie des Geistes – weist Hegel über den Gottesbeweis hinaus die Aufgabe der Theodizee zu: ‚Man schleppt es als eine Tradition mit sich, daß Gottes Weisheit in der Natur zu erkennen sei. So war es eine Zeitlang Mode, die Weisheit Gottes in Tieren und Pflanzen zu bewundern. Man zeigt, daß man Gott kenne, indem man sich über menschliche Schicksale oder über Produktionen der Natur erstaunt. Wenn zugegeben wird, daß sich die Vorsehung in solchen Gegenständen und Stoffen offenbare, warum nicht in der Weltgeschichte?‘“302 Ich habe Schnädelbach in diesem Zusammenhang so ausführlich zitiert, weil in seiner Formulierung der Kritik des hegelschen Wahrheitsanspruches sehr deutlich wird, inwiefern mit diesem in der Identifizierung von Wahrheit, Wirklichkeit und Vernunft nicht nur die Vorstellung des gegenwärtigen Werdens als ein gutes, sondern auch die Hoffnung auf oder sogar die Überzeugung von einer zukünftig guten Entwicklung verbunden ist. Mit einem solchen Wahrheits-„Verständnis“ im Rücken würde sich erklären, warum Hegels „Eule der Minerva“ dem Relativismus, dem „bacchantischen Taumel“ der Geschichte zuschauen kann und dennoch „die einfache Ruhe“ bewahrt, ohne genauer zu wissen, wie das, was sie erhofft oder wovon sie überzeugt ist, wirklich werden kann und was ihr 302 Ebd., Seite 12f. 127 eigener Anteil daran sein mag. Sie braucht es nicht zu wissen, sollte es auch nicht von sich fordern, sondern damit zufrieden sein: Das Individuum muss „sich um so mehr vergessen, und zwar werden und tun, was es kann, aber es muß ebenso weniger von ihm gefordert werden, wie es selbst weniger von sich erwarten und für sich fordern darf.“303 Ich denke, dass Schnädelbach in seinem Verständnis des hegelschen Wahrheitsanspruches als „die durch Selbstreferenz und neuzeitliche Subjektivität dynamisierte platonische Idee“ Recht hat und es erscheint mir deshalb zumindest etwas einseitig, Hegels Philosophie, wie Pinkard dies tut, als einen entzauberten Aristotelismus zu verstehen. Aber sei es drum, entscheidend sind für mich letztlich, wie gesagt, die Konsequenzen, die man aus der Auseinandersetzung, in diesem Fall mit Hegel, zu ziehen bereit ist, unabhängig davon, ob man diese affirmativ, modifizierend oder negierend gegenüber dessen Philosophie versteht. Und ich habe den Eindruck, dass Pinkard und Schnädelbach auch bezüglich des Wahrheitsbegriffes, den es zu bewahren gilt, durchaus nahe beieinander liegen. Zunächst Schnädelbach: „Ist unsere Vernunft endlich, bedeutet dies den Abschied vom Idealismus, womit ich nicht bloß eine erkenntnistheoretische Position meine, sondern die Gestalt, die diese Position in der deutschen Philosophie durch Fichte angenommen hatte: eine Philosophie des Absoluten in der Perspektive des absoluten Bewußtseins selber, also die Synthese aus Spinoza und Kant, von der schon die Rede war, und der sich Kant selbst noch widersetzt hatte. Absoluter Idealismus aber und eine Philosophie des Wahren als des Ganzen – gleichgültig, ob sie sich zu Hegel bekennt oder nicht – ist ein und dasselbe; in welcher Transformation auch immer: eine solche Wahrheitstheorie überspringt träumend die Grenzen unserer Endlichkeit. Haben wir das eingesehen, können wir in der Wahrheitstheorie Hegels objektive adeaquatio auf sich beruhen lassen, weil die nur einem absoluten Bewußtsein zugänglich wäre. Wir treten den Rückstieg an vom metaphysischen Wahrheitsbegriff zu dem der begründeten Geltungsansprüche, und damit müssen wir nicht länger die Objektivität des Wahren als das Ganze fordern, damit das, was wir sagen, wahr sein kann; ebensowenig müssen wir die objektive Einheit von Vernunft und Wirklichkeit und die Versöhnung mit ihr fordern, um selbst vernünftig sein zu können. Die unversöhnte Welt wird so endlich davon befreit, als durchschlagendes Argument gegen die Vernunft überhaupt herhalten zu müssen; vielleicht erhöht genau dies die Chancen ihrer Veränderung [...].“ 304 Pinkard ist hier weniger explizit, aber er verabschiedet sich ebenfalls, wenn auch mit Hegel, von der Vorstellung einer Versöhnung in der vergänglichen Wirklichkeit und bezeichnet Hegel, wie schon erwähnt, in diesem Zusammenhang als „philosophical therapist trying to inoculate us against the temptations toward wholeness in a sphere (the finite) where it cannot be found.“305 Und anderer Stelle schreibt Pinkard: „If there is to be anything like empirical truth – any meaningful 303 Hegel (1970), Seite 67. Schnädelbach (1993), Seite 20f. 305 Pinkard (2012), Seite 175. 304 128 conception of our experience as offering us genuine reasons for belief about things in the world – then one must at least minimally take it for granted that there is a normative line to be drawn between our awareness of an object and the object itself, and that it must be the object itself that makes our awareness (or statement expressing our awareness or based on our awareness) true.“306 Ich schließe mich dem Wahrheitsbegriff im Sinne begründeter Geltungsansprüche genauso an, wie der Überzeugung, dass eine Versöhnung, die über den Begriff eines immer noch spannungsreichen befriedigenden Lebens in Frieden hinausgeht, in der Vergänglichkeit nicht zu verwirklichen ist. Kommen wir mit dem hier auch Pinkard unterstellten Verständnis von Wahrheit als begründetem Geltungsanspruch noch einmal zurück zu seinem Vorschlag, durch den Wahrheitsbezug Ordnung in das relativistische Durcheinander zu bringen. Pinkard macht zwar geltend, dass dieses möglich sei, macht aber nicht deutlich wie dies geschehen könnte. Er beschreibt zunächst lediglich die Situation, dass wir in unserer normativen Praxis dazu gezwungen sind, bestimmten Handlungsgründen eine unbedingte Geltung zukommen zu lassen. Erstens, weil wir in unserer endlichen Vernunft nicht dazu in der Lage sind, Letztbegründungen zu leisten. Zweitens, weil wir selbst und gerade auch in diesem Wissen, nicht umhinkommen, bestimmte Gründe ohne Begründung, d.h. unbedingt, gelten zu lassen oder zur Geltung zu bringen. Wir wären sonst nicht handlungsfähig. Diese praktische Problematik ist ein weiterer Aspekt unseres Lebens in Spannung zwischen Souveränität und Machtlosigkeit. „Each acknowledges his own finitude and partiality, and in doing so, in the give-and-take of their encounter, each forgives the other for having claimed such an absolute status for himself. In religious terms, each acknowledges that he is not without sin, but in the same more secular terms favored by Hegel, each acknowledges his own radical fallibility and the temptation to claim a knowledge of the unconditional that outstrips the resources of the individual agent. The ,true infinity‘ the agents seek is to be found within the ongoing interchange itself, insofar as that interchange is oriented to truth. To phrase Hegel’s conclusion in a rather breathlessly abstract manner: Amphibians breathe the thin air lying within the twin commitments to truth („infinity“) and to their own fallibility („finitude“), to the ideals of reason and the often prosaic and banal world in which it finds its actualization. Their public lives display the same tension. It would be futile to expect politics to abolish that tension, but it would be irrational to think that it could not be made to live with it. The world as we find it is never fully rational, and ,who is not clever enough to see a great deal in his own surroundings which is in fact not what it ought to be?‘ As Hegel phrased the point in his 1819 lectures, we should say that ,the actual comes to be the rational,‘ not that we need think that it has ever finally completed its job, or that what is effectively at work in the world is rational at this moment. To understand that requires 306 Ebd., Seite 49. 129 attention to philosophical argument, but it also requires a form of life of rights-bearing, moral individuals, who acquire a sense of egalitarian right from childhood onward, whose participation in civil society is coupled with a feel for what is practical and workable, and whose political temperament is shaped by a shared commitment to political and social justice. It requires a ,second nature‘ that can live without enchanted illusions but not without ideals and that, like all other human strivings, succeeds only when it also aims at truth.“307 Es wird mir nicht ersichtlich, in welcher Weise der Wahrheitsbegriff, zumindest in Anbetracht dessen, was Pinkard als wahre Erkenntnis gelten lässt, dem normativen Relativismus auf befriedigende Weise entgegenwirkt. Er spricht von einer historischen Lebensform, unserer modernen „westlichen“, in der sich die Individuen als rechtstragend und moralisch verstehen und von Kindheit an an die Gedanken von rechtlicher Gleichheit sowie politischer und sozialer Gerechtigkeit gewöhnt sind, diese aber zugleich nicht als unbedingte Gebote, sondern als Ideale erkennen, um nicht den Sinn dafür zu verlieren, was praktisch möglich ist und funktioniert; und fügt an, dass ein so geprägtes Streben, wie alles andere menschliche Streben auch, nur erfolgreich sein könne, wenn es zugleich auf Wahrheit ziele. Aber in welchem Zusammenhang stehen Wahrheitsbegriff und die konventionellen Normen dieser historischen Lebensform? Soweit ich Pinkard verstehe, bedeutet die Orientierung an der Wahrheit für ihn hier vor allem das reflexive Eingeständnis unserer Begrenztheit, unser reflexives Vermögen mit eingeschlossen. Die Anerkenntnis unserer Endlichkeit („finitude“) und Partialität („partiality“) bedeutet in normativen Zusammenhängen das Eingeständnis unserer Unfähigkeit, unbedingte Gründe für dieses oder jenes Tun geben zu können. Wir kennen kein unbedingtes Richtig oder Falsch. Dies wird besonders in der folgenden Passage deutlich: „Many of those who followed in Kant’s wake took it that the task of grasping the unconditioned had to be itself an infinite task, something we postulated but that in principle could never be completed in human time – the mythical point at which the last metaphysician supposedly finally delivers the knockout argument, and the project is over. Hegel, on the other hand, thought that this task was always in the process of being accomplished and that it is our reflective consciousness of this ongoing process of understanding the world and ourselves as the kinds of creatures who must ask those questions that is the permanent element in the story. As ‚Idea,‘ we have a view of ourselves and the world as standing in one unity. The finite world is the world in which we live, where our metaphysical speculations inevitably contradict each other and the infinite exists, as it were, as our own reflective consciousness of this finitude. To compress this view into Hegel’s own preferred jargon: ,Reason is at the same time only the infinite insofar as it is absolute freedom which consequently presupposes to itself its own 307 Ebd., Seite 186f. 130 knowledge and by that means makes itself finite, and it is the eternal movement to sublate this immediacy, to comprehend itself, and to be knowledge of the rational.‘“308 In der Reflexion unserer Endlichkeit erkennen wir, dass alle unsere Spekulationen über das Unbedingte dieses nicht zu fassen vermögen und, insofern wir dies gleichwohl versuchen, uns mit unseren endlichen, bedingten Begriffen notwendigerweise widersprechen müssen. Es ist in dieser Hinsicht keine Wahrheit zu haben. Die Suche nach dem Unbedingten, das Pinkard hier offensichtlich mit Hegel als die „Idee“ bzw. „das Ganze“ versteht, wird so zu einem endlosen Prozess, in dem, solange immer wieder neu nach dem Unbedingten gefragt und Antwort gegeben wird, sich stets neuer Widerspruch erheben wird. Dieser Widerspruch kann allein in der Anerkennung der Endlichkeit und Bedingtheit unserer Vernunft aufgehoben werden, wodurch wir überhaupt erst zur Vernunft bzw. diese zu sich selbst gelangt. Die individuelle Vernunft differenziert sich von sich selbst, bestimmt sich reflexiv allein durch sich selbst und ist in diesem Sinne „unbedingt“ oder „infinit“, d.h. ist in dieser Reflexion durch nichts anderes außer sich selbst begrenzt und frei.309 Aber insofern Vernunft, um zu sich selbst zu kommen, das Wissen um sich selbst, also sich selbst voraussetzen muss, ist sie in sich selbst, d.h. ihrer eigenen Wirklichkeit oder Natur nach, bedingt und endlich. Der Widerspruch zwischen Bedingtheit und Unbedingtem wird so in der selbst-reflexiven Erkenntnis der eigenen Endlichkeit der Vernunft aufgehoben, die zu einer unbedingten Erkenntnis, auch ihrer selbst, nicht fähig ist. So kann es der endlichen Vernunft nur immer wieder neu darum gehen, zu verstehen, um was es ihr geht und was ihre endliche Wirklichkeit für sie bedeutet, ohne jemals zu einer unbedingten Erkenntnis darüber zu gelangen. Pinkard schließt aus dieser Unmöglichkeit unbedingter Erkenntnis auf unsere radikale Fehlbarkeit („radical fallibility“), nicht nur, aber gerade auch in normativer Hinsicht. Nun stellt sich jedoch die entscheidende Frage: Wenn es für uns normativ kein unbedingtes Richtig oder Falsch gibt, und wenn wir diesen Umstand erkennen, wie können wir dann in dem, was wir tun, normativ jemals radikal fallibel sein. Natürlich wird in dieser Erkenntnis niemand mehr mit irgendeinem Recht behaupten können, dass er in seinem Tun richtig läge, weil dieses Tun durch einen unbedingten Grund gerechtfertigt werde. Aber das bräuchte er in dieser Erkenntnis ja auch überhaupt nicht und es dürfte von ihm konsequenterweise auch nicht erwartet werden. Es würde am Ende sogar die unbegründete Feststellung genügen, dass er etwas will; dass er will, was er tut; dass er tut, was er tut. Und wie sollte jemand darin jemals falsch liegen? Dass jemand anderes etwas anderes will und tut, mag er Gründe dafür geben oder nicht, würde mitnichten die Fehlbarkeit des ersten noch die seiner selbst bedeuten und wäre auch überhaupt kein Problem, solange ihr Wollen und Tun sich nicht widerspricht. Aber auch im Falle eines 308 309 Ebd., Seite 188. Vgl. ebd., Seite 45ff. 131 Widerspruches läge dann keiner der beiden im eigentlichen oder eben radikalen Sinne falsch. Eine andere Frage ist es, wie diese problematische Situation gelöst wird. Und hier kommt die Lebensform ins Spiel, die Ideale und Normen bereit hält, welche einen Rahmen setzen, innerhalb dessen mit oder ohne Einsatz dritter Gewalt der Widerspruch praktisch aufgelöst werden kann. In Bezug auf einen solchen Rahmen könnte man dann natürlich von einem Richtig oder Falsch sprechen, mit Sicherheit aber nicht in einem radikalen, sondern nur in einem relativen Sinn. Man könnte also nur von einer relativen Fallibilität sprechen. Denn die gültigen Ideale und Normen sind in Anbetracht der konstatierten Konventionalität und Historizität jeder Lebensform ja nicht notwendig etwa auf rechtliche Gleichheit sowie politische und soziale Gerechtigkeit hin ausgelegt. Die Lösung dieses Widerspruches bleibt in historisch-politisch verkomplizierter Weise relativistisch. Und ich sehe nicht, wie die Ausrichtung auf Wahrheit, zumindest in ihrer von Pinkard beschriebenen Konsequenz für die Selbst-Erkenntnis, hieran irgendetwas ändern könnte. Im Gegenteil, sie scheint mir den Relativismus, offenbar ungewollt, weiter festzuschreiben. Wenn uns der Begriff der Wahrheit in diesem Kontext wirklich weiter helfen soll, dann müsste von der grundsätzlichen Möglichkeit begründeter Aussagen über ein von seiner Reflexion und also auch von historischen Konventionen, welche ohne Reflexion nicht zu denken sind, unabhängiges normatives Faktum ausgegangen werden. Hierbei muss es nicht schon um etwas Unbedingtes gehen. Es würde ein Sachverhalt genügen, der in unserer bedingten Natur begründet liegt. Auch macht es dann keinen Sinn, davon auszugehen, dass wir uns in dieser Hinsicht notwendig widersprechen müssten. Natürlich bleibt die Möglichkeit des Widerspruches bestehen. Aber dieser wäre in epistemischen Fehlern oder in Missverständnissen, nicht im Gegenstand der Erkenntnis begründet. Und erst unter der Voraussetzung eines solchen normativen Faktums würde auch die Rede von unserer radikalen und nicht nur relativen Fallibilität in normativen Zusammenhängen wenn überhaupt einen Sinn ergeben. Ist eine solche Erkenntnis möglich? Bernard Williams äußert sich diesbezüglich eher pessimistisch: „The project of giving to ethical life an objective and determinate grounding in considerations about human nature is not, in my view, very likely to succeed. But it is at any rate a comprehensible project, and I believe it represents the only intelligible form of ethical objectivity at the reflective level.“310 Ob wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, gehen wir nicht von einer grundsätzlichen Erkenntnismöglichkeit eines normativen Faktums aus, dann könnte der Begriff der Wahrheit dem Relativismus nicht im Geringsten etwas entgegenstellen, das uns, wenn auch keine „einfache Ruhe“ gibt, so doch auch nicht hilflos in den „bacchantischen Taumel“ der Geschichte blicken lässt. Ohne diese Möglichkeit würden wir uns von hegelschen Eulen in benjaminsche Engel der Geschichte verwandeln, die mit 310 Williams (1985), Seite 153. 132 aufgerissenen Augen und offenem Mund, ihre Flügel im Sturm verfangen mit dem Rücken voran in die Zukunft getrieben werden, um zu sehen wie sich vor ihnen „unablässig Trümmer auf Trümmer häuft.“311 Befriedigend wäre diese Aussicht nicht. Ich stimme mit Bernard Williams insoweit überein, dass, wenn eine solche durch unsere Natur begründbare, objektive Aussage über ein normatives Faktum möglich sein sollte, diese Erkenntnis weder Grund der Möglichkeit wäre, uns diesem entsprechend zu verhalten, noch, dass ein solches Verhalten durch einen solchen Aufweis erst zu einem richtigen oder „wahren“ würde.312 Die praktischen Konsequenzen einer solchen Untersuchung werden also nicht neu und ungewohnt erscheinen müssen. Aber ich bin der Ansicht, dass wir in unserer reflexiven Natur nicht auf die Explikation eines solchen normativen Faktums, wenn dies möglich ist, verzichten sollten. Denn unsere Praxis ist von unseren Reflexionen darüber, was wir als wahr oder nicht-wahr ansehen, stark beeinflusst. Die Reflexion ist selber Teil der Praxis. Und allein ein solches normatives Faktum könnte dem Fortschrittsbegriff über den Relativismus hinaushelfen. Bevor ich zu dem Versuch des Aufweises eines solchen in unserer Natur liegenden normativen Faktums mit einer sich daran anschließenden Wiederaufnahme der hier vorgebrachten Kritik an der pinkardschen Argumentation übergehe, ist es jedoch notwendig, deutlich zu machen, was ich dabei als „unsere Natur“ voraussetze. Befriedigung und natürliche Vernunft Ich will mit Schnädelbachs Worten danach fragen, was es auf einer sehr allgemeinen Ebene „bedeutet, daß wir endliche, zugleich natürliche und geschichtliche und im übrigen vernunftbegabte Wesen sind.“313 Zunächst einmal denke ich, dass die Begriffe „endlich“, „natürlich“ und „geschichtlich“ auf unterschiedliche Weise in die gleiche Richtung zeigen. Sie weisen auf unsere Begrenztheit hin; unsere „Endlichkeit“ bedeutet die raumzeitliche Begrenztheit unserer Fähigkeiten sowie unserer Existenz insgesamt; unsere „Natürlichkeit“ weist auf unsere Begrenztheit in Form der Abhängigkeit von unserer physischen und sozialen Umwelt; unsere „Geschichtlichkeit“ meint unsere Begrenztheit in Hinsicht auf die Determination unserer Existenz durch vergangenes Geschehen, aber auch die Notwendigkeit zur Veränderung. Was aber bedeutet die „Vernunftbegabtheit“? Ich will „Vernunft“ zunächst nicht schon als Reflexivität oder gar Diskursivität verstehen, sondern ihren Kern in dem weiter oben beschriebenen eher reflexhaft sich verhaltenden interessierten, erlebenden und freien Subjekt suchen, das sich im Ergreifen der Möglichkeit interessierten Daseins überhaupt um sein individuelles, nicht einfach 311 Benjamin, Walter: „Über den Begriff der Geschichte“, in: ders.: Erzählen – Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007, Seite 133. 312 Vgl. Williams (1985), Seite 155. 313 Schnädelbach (1993), Seite 23. 133 gegebenes Dasein bemüht.314 Damit aber wird Vernunft an die Thematik der Begrenztheit zurückgebunden. Denn dieses subjektive Dasein ist ein endliches, natürliches und geschichtliches. Und gerade in der Begrenztheit des subjektiven Daseins kann, so denke ich, deutlich werden, was Vernunft meint. Hierin stimme ich wiederum mit Bernard Williams überein, der darauf hingewiesen hat, dass es die Begrenzungen, die Restriktionen sind, vor deren Hintergrund überhaupt deutlich werden kann, was es heißt, vernünftig zu sein. Er bezeichnet ein vernünftiges Wesen als einen „finite, embodied, historically placed agent“.315 Ähnlich verstehe ich Vernunft als ein bestimmtes Verhalten eines endlichen, verkörperten bzw. natürlichen und geschichtlichen sowie interessierten, erlebenden und freien Daseins. Es bleibt die Frage, worin dieses Verhalten genauer besteht. Dazu gilt es zunächst einen kleinen Umweg zu machen und sich Folgendes deutlich vor Augen zu führen. Mit der Begrenztheit ist eine grundlegende Differenz zwischen dem begrenzten Subjekt selbst und der es umgebenden Umwelt gesetzt. Dabei handelt es sich letztlich um die gleiche Differenz von der auch Pinkard spricht, wenn er, wie schon zitiert, in Bezug auf den Wahrheitsbegriff schreibt: „[...] one must at least minimally take it for granted that there is a normative line to be drawn between our awareness of an object and the object itself.“316 An anderer Stelle führt er aus: „Direct observation involves drawing a quasi-metaphysical line between appearance and the „inner“ of appearance – between appearance and what appears – and that line is drawn within experience itself by our conceptual capacities as linked to our sensory capacities, not by our sensory capacities alone.“317 Dazu will ich anmerken: Selbst wenn es jeweils das Subjekt ist, das diese Linie, diese Differenz reflexhaft oder reflexiv zieht, haben wir, so denke ich, allen Grund, nicht nur von einer „quasi-metaphysical line“ zu sprechen, sondern von einer metaphysischen Differenz, die tatsächlich, also auch unabhängig von ihrer Reflexion besteht. Diese Differenz kann nicht weniger objektiv sein als die Gegenstände, die wir als von uns geschieden erkennen. Natürlich sollte diese Differenz nicht zu einem Ding hypostasiert werden, das unabhängig von den sich unterscheidenden Entitäten besteht. Auch bedeutet sie mitnichten die Negation der wechselseitigen Beeinflussung von Subjekt und Umwelt. Aber das ändert nichts daran, dass es sich dabei um eine reale oder wirkliche Differenz handelt. Und insofern sie mit den Sinnen nicht zu erkennen ist, die uns mit den äußeren Gegenständen verbinden, für sich also diese Grenzlinie vielmehr überschreiten als sie zu setzen, ist diese Differenz mit vollem Recht als metaphysisch zu bezeichnen. Ich verstehe den Begriff der „Metaphysik“ nicht in einer Weise, die seine grundsätzliche Loslösung von 314 Vgl. Seite 108ff. dieser Arbeit. Vgl. Williams (1985), Seite 57f. 316 Pinkard (2012), Seite 49. 317 Ebd., Seite 52f. 315 134 der „Physik“ propagiert, wenn auch als einen Bereich von Erkenntnissen, welche nicht durch Sinneswahrnehmung begründet werden können. Negiert man die Objektivität dieser metaphysischen Differenz, so befindet man sich unausweichlich entweder auf dem Weg zu einer im Solipsismus endenden Verabsolutierung der eigenen Subjektivität oder man muss behaupten, dass das individuelle Subjekt im eigentlichen Sinne gar nicht existiert. Ich denke nicht, dass diese Positionen theoretisch haltbar sind – was ihrer möglichen heuristischen Funktion im Rahmen kognitiver Experimentalität keinen Abbruch tut –, und mit Sicherheit sind sie es auch nicht praktisch. Niemand wird im Alltag darum herum kommen, diese Differenz vorauszusetzen. Man mag hier noch einwenden, dass diese Differenzierung zwar praktisch notwendig sei, dies jedoch keinen Beweis für deren Objektivität bedeute, d.h. für deren vom Subjekt unabhängiges Bestehen. Nun, sie besteht sicher nicht unabhängig von ihm, insofern diese subjektive Unterscheidung objektiv auch das sich von den äußeren Gegenständen unterscheidende Subjekt voraussetzt. Aber sie besteht sicherlich unabhängig von ihrer subjektiven Anerkennung. Mehr als die zugestandene, praktisch erfahrene Notwendigkeit dieser Unterscheidung braucht meines Erachtens auch gar nicht gefordert zu werden, um die Objektivität dieser Differenz begründet behaupten zu können. Die Objektivität dieser Unterscheidung sagt dabei noch nichts über das Verhältnis zwischen unseren positiven Vorstellungen und den Gegenständen aus, die wir durch diese Vorstellungen repräsentieren. Hier bleibt aller Raum für Diskussionen. Ich für meinen Teil gehe nicht davon aus, dass wir die Dinge wahrnehmen können, wie sie an sich sind. Denn unsere Wahrnehmungen von den Dingen sind unsere Wahrnehmungen von den Dingen und geben keine Auskunft darüber, wie es denn ohne diese um die Dinge stünde. Ob etwa ein Baum auch wie ein Baum aussieht, wenn ihn keiner sieht, ist eine sinnlose Frage. Dennoch halte ich einen bescheideneren adaequatio-Begriff für haltbar und sinnvoll. Wir können die von uns unterschiedenen Gegenstände so wahrnehmen, wie es für unsere Zwecke hinreichend und in diesem Sinne adäquat ist. Die Feststellung, dass es von uns und unserer Wahrnehmung unabhängige Dinge gibt und diese einen Einfluss darauf haben, dass und wie wir sie wahrnehmen, bleibt davon unberührt. Und in diesem Zusammenhang kann auch Kants Begriff des „Dinges-ansich“ eine durchaus sinnvolle Bedeutung bekommen. Das „Ding-an-sich“ meint dann nichts weiter, als dass etwas von mir real Verschiedenes existiert, ohne damit irgendwelche weiteren Ansprüche hinsichtlich einer Erkenntnis dieses „an-sich“ zu stellen und ohne diesem mit der Existenz auch schon eine unbedingte Substanzialität, d.h. eine selbstsuffiziente Existenz zusprechen zu wollen. Vor dem Hintergrund der beschriebenen metaphysischen Differenz zwischen Subjekt und Umwelt sowie dem vorgeschlagenen Begriff der Adäquanz, der nicht nur in epistemischer Hinsicht verstanden werden kann, werde ich nun versuchen, deutlich zu machen, worin ich die Natur der Vernunft oder die natürliche Vernunft liegen sehe. Ich verstehe die 135 natürliche Vernunft, wie bereits gesagt, als eine grundlegende Verhaltensweise endlicher, natürlicher und geschichtlicher sowie interessierter, erlebender und freier Subjekte. Ein solches Subjekt steht in einer metaphysischen Differenz zu seiner Umwelt, von der es doch abhängig ist, auf die es zur Verwirklichung seiner Interessen angewiesen ist, nicht zuletzt in Bezug auf sein Interesse am eigenen Dasein. Vernunft ist das subjektive Bemühen um ein nicht völlig beherrschbares, nicht abschließend zu erreichendes adäquates Zusammenspiel zwischen Subjekt und Umwelt, das mit einem befriedigenden Erleben einhergeht. Vernunft ist die auf Adäquanz mit der Umwelt zielende Aktivität des Subjekts. Das Subjekt muss sich um die Verwirklichung seiner Interessen bemühen, sie werden von der Umwelt nicht einfach erfüllt. Dabei kann man meines Erachtens zwischen drei Aspekten unterscheiden. Zum einen muss das Subjekt die Umwelt modifizieren, bearbeiten und gestalten, sie seinen Interessen adäquat machen. Ich möchte dies den kreativen Aspekt der Vernunft nennen. Zugleich aber findet das Subjekt in sich und der Umwelt Bedingungen vor, an die es sich und seine Interessen anzupassen ein Interesse hat, um ein adäquates Verhältnis zwischen sich und der Umwelt herzustellen. Diesen Zusammenhang bezeichne ich als adaptiven Aspekt der Vernunft. Und schließlich kann das Subjekt in einem Verhältnis zu anderen Subjekten in der Umwelt stehen und ein Interesse daran haben, seine Interessen mit denen der anderen in adäquater Weise zu koordinieren. Dies nenne ich den kooperativen Aspekt der Vernunft. Zwar ist auch im Rahmen des kooperativen Aspektes der Vernunft kreatives und adaptives Verhalten gefragt, dennoch unterscheidet sich dieser Aspekt deutlich von den anderen Aspekten. Wir werden noch darauf zurückkommen. Die dargestellten Aspekte verstehe ich als die drei nur reflexiv voneinander zu trennenden Grundfähigkeiten jedes individuellen vernunftbegabten Subjektes. Die konkrete Ausprägung dieser Aspekte kann evolutionär bedingt unterschiedlich stark und sehr verschieden sein. Reflexivität und Diskursivität begreife ich dabei als evolutionäre Weiterentwicklungen der sich „bloß“ auf reflexhafte Weise kreativ, adaptiv und kooperativ verhaltenden Subjektivität, nicht also als eine notwendige Bedingung von Vernunft. Und so finden wir denn auch in unserem reflexiven und diskursiven Verhalten alle drei Vernunftaspekte wieder. Wir können reflexiv und diskursiv nach neuen Möglichkeiten suchen, unsere Interessen zu verwirklichen. Dies bedeutet zugleich aber auch ein Interesse daran, unsere Reflexionen und Diskurse an die gegebenen, objektiven Bedingungen anzupassen, unter denen sich diese Möglichkeiten allein ergeben. Schließlich können Reflexivität und Diskursivität auch dem Interesse an der intersubjektiven Koordination von Interessen dienen. Es ist nun nicht mehr schwer, eine evolutionäre Brücke zu schlagen von dem Begriff eines reflexhaft vernünftigen und selbstbezüglichen Verhaltens zu einem reflexiv vernünftigen Verhalten, das sich selbst reflektiert und das, worum es in seiner Individualität den drei Aspekten nach geht, in einem Begriff als das gestaltend zu verwirklichende Schöne 136 (kreativer Aspekt), das Wahre (adaptiver Aspekt) und das Gute (kooperativer Aspekt) vereint;318 und soweit die Adäquanz zwischen Subjekt und Umwelt keine abschließend zu erreichende ist, diesen Inbegriff der Aspekte als ein gleichbleibendes Telos versteht. Wird dieser Zielbegriff dann noch mit dem der Existenz kurzgeschlossen, dann sind wir in etwa bei Platon. Die Verfolgung des Schönen, Wahren und Guten würde mit einem befriedigenden, vielleicht sogar glücklichen Erleben einhergehen. In Bezug auf die weiter oben ausführlicher behandelten Denker könnte man weiter sagen, dass Aristoteles das teleologische Augenmerk von den drei Aspekten vernünftigen Verhaltens weg auf das subjektive Erleben der Adäquanz hin gerichtet hat, die Befriedigung. Glückseligkeit wäre, im Sinne meiner obigen Argumentation, die Befriedigung des puren Interesses am Dasein, ein purer Genuss des Daseins.319 Aristoteles zufolge wäre dieser durch eine Betrachtung oder Reflexion der ewigen Wahrheiten (adaptiver Aspekt) bzw. durch die Ausübung der menschlichen Tugenden (kooperativer Aspekt) zu verwirklichen (kreativer Aspekt). Kant kam zu der in Selbstreflexivität gründenden Formulierung des moralischen Gesetzes (kooperativer Aspekt), dem es das Verhalten anzupassen gilt (adaptiver Aspekt), was die Bedingung dafür ist, Glückseligkeit zu verwirklichen (kreativer Aspekt). Hegel hob dann die Selbstreflexion als solche in ihrer Abstraktheit in den Vordergrund und versuchte sie als Kulminationspunkt einer diesen hervorbringenden ewigen Bewegung der Gesamtwirklichkeit (kreativer Aspekt) zu sehen, die zugleich als das Wahre (adaptiver Aspekt) und das Gute (kooperativer Aspekt) zu verstehen sei.320 Diese verheiße dem endlichen, natürlichen und geschichtlichen Subjekt keine Glückseligkeit, sondern allein Befriedigung, wenn es seinen ihm adäquaten kreativen, adaptiven und kooperativen Anteil an dieser Gesamtbewegung nimmt. Ich bin mir der äußerst groben Holzschnittartigkeit dieser Darstellung sehr bewusst. Aber sie macht dennoch nachvollziehbar, dass in diesen Reflexionen, die allesamt darüber Auskunft geben wollen, worum es vernünftigen Wesen in ihrem Leben geht oder gehen sollte, worin ein vernünftiges Leben besteht, neben der Ebene des Erlebens immer auch die drei genannten Aspekte virulent sind. Ebenfalls sehr deutlich wird dieser Zusammenhang in der an Max Webers kulturhistorische Diagnose der „Entzauberung der Welt“ anschließenden Theorie der Rationalität von Jürgen Habermas.321 Im Laufe der abendländischen Geschichte, so der 318 Wem diese evolutionstheoretische Brücke als eine allzu brüchige, spekulative Konstruktion erscheint, der sei auf die Ontogenese eines jeden menschlichen Daseins in seiner Entwicklung von seinem in der Verschmelzung von Eizelle und Samen gründenden Ursprung bis zu einem sich reflexiv, selbstreflexiv und diskursiv verhaltenden Subjekt hingewiesen. Warum sollte das, was in dieser individuellen Entwicklung möglich ist, nicht auch in einer interindividuell-sukzessiven Evolution möglich sein? Allzumal wir das menschliche Leben in seiner Entstehung ja gerade als aus einer solchen phylogenetischen Entwicklung hervorgehend verstehen. 319 Vgl. Seite 104 dieser Arbeit. 320 Hegel benutzt den Begriff des Guten nicht in dieser Weise, aber sinngemäß ergibt sich dieser Zusammenhang aus seiner Wahrheitslehre; vgl. Seite 125ff. dieser Arbeit. 321 Weber (1995), Seite 19. 137 Grundgedanke, sei die platonische Vorstellung der Vernunft als ein auf die ewige Idee des Schönen, Wahren und Guten gerichtetes Handeln in die prozedurale Verwirklichung dreier voneinander differenzierter Diskurse überführt worden: den ästhetischen, den theoretischen und den praktischen. In diesen drei Diskursen würden dabei jeweils unterschiedliche Geltungsansprüche „mit einem differentiellen Grad diskursiver Verbindlichkeit“ erhoben: im ästhetischen die Authentizität (kreativer Aspekt), im theoretischen die Objektivität (adaptiver Aspekt) und im praktischen die Moral (kooperativer Aspekt). 322 Habermas versteht diese drei Geltungsansprüche „als gleichursprüngliche Bezugspunkte eines dreistrahligen Differenzierungsprozesses“, der ihre Loslösung voneinander bedeutet und eine „nachträgliche Integration von Inhalten“ ausschließt.323 Zusammengehalten werden sie dabei allein von ihrer auf die Norm des Konsenses zielenden diskursiven Form. In ihrer inhaltlichen Losgelöstheit erscheint für Habermas am Horizont diskursiver Praxis, „wenn die Argumentation nur offen genug geführt und lange genug fortgesetzt werden könnte“ 324 , die Möglichkeit, dass die Geltungsansprüche eines jeden dieser drei Diskursfelder in der gegenseitigen, begründeten Kritik jeweils gleichberechtigter Diskursteilnehmer lösbar sind.325 Und nur dadurch, dass die drei Diskurse inhaltlich voneinander getrennt werden und zu ihrem je eigenen Recht kommen, sei eine vernünftige Gestaltung der alltäglichen Lebenswelt möglich, in der am Ende allein eine Vermittlung der drei ausdifferenzierten Diskurse ihren Ort und ihr Leben haben kann. 326 In dieser philosophischen Konzeption der Vernunft ist es also die diesseitige alltägliche Praxis, das Alltagsbewusstsein, in der unter Rückgriff auf die drei voneinander getrennten Rationalitätsdiskurse nach einer Integration derselben zu suchen ist, und nicht mehr „jenseits, in den Gründen und Abgründen der klassischen Vernunftphilosophie“.327 Der im theoretischen Diskurs angesiedelten Philosophie bleibt allein, sich innerhalb desselben zwischen den einzelnen Fachwissenschaften sowie nach außen hin zwischen den Diskursen und der konkreten Alltagswelt hin und her zu bewegen und diskursive Angebote zu machen, nicht aber darüber zu bestimmen, wie das Zusammenspiel der ansonsten diskursiv fragmentierten Rationalität gedacht werden könnte. Die Philosophie ist, bildlich gesprochen, nicht mehr das Herz der Vernunft, sondern der diskursive Blutkreislauf, nicht mehr das Hirn, sondern das Nervensystem einer rationalen Lebenspraxis. Man kann sich 322 Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995, Seite 339f. 323 Habermas, Jürgen: „Entgegnung“, in: Axel Honneth/Hans Joas: Kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2002, Seite 327-405, Seite 334; 340. 324 Habermas (1995), Band 1, Seite 71. 325 Vgl. de Vries, Hent: Theologie im pianissimo & Zwischen Rationalität und Dekonstruktion, Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1989, Seite 23ff. 326 Vgl. Habermas (1995), Band 1, Seite 339; sowie Habermas (1995), Band 2, Seite 586. 327 Habermas, Jürgen: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983, Seite 26. 138 nur schwer dem Eindruck erwehren, dass für Habermas mit der Projektion eines solchen diskursiv diversifizierenden und alltäglich integrativen Rationalisierungsprozesses die Aussicht auf ein gutes, glückendes und befriedigendes, unter Umständen sogar glückliches Leben verbunden ist. „Verständigung wohnt als Telos der menschlichen Sprache inne“328 und Verständigung, als dynamische Abfolge partikularer Konsense, könnte mit Habermas durchaus als eine, wenn auch formale, „Antizipation des guten Lebens“ verstanden werden.329 Hier sei an das Zitat von Schnädelbach erinnert: „In der praktisch-politischen Verlängerung des Gedankens der kommunikativen Einheit der Vernunft wird das sichtbar, was auch real solche Einheit allein ermöglicht: der Frieden.“330 Ich möchte im Folgenden den Begriff der Vernunft wie ich ihn vorgeschlagen habe in Annäherung an diese Grundstruktur von Habermas’ Rationalitätstheorie weiter verdeutlichen. Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen den von mir unterschiedenen drei gleichursprünglichen Aspekten der Vernunft und den drei gleichursprünglichen Bezugspunkten der voneinander differenzierten Diskursformen sowie zwischen meinem Verständnis der Vernunft als ein Verhalten und der Prozeduralität der Diskurse ruft geradezu nach einem solchen Vergleich; ebenfalls die, wenn auch bloß formale Vorwegnahme eines friedlichen Lebens, auf welches diese Praxis zielt. Ich werde mich dabei von jeglicher Detailkritik der habermasschen Argumentation fernhalten. Allerdings wird in dieser Annäherung trotz aller strukturellen Gemeinsamkeit eine grundsätzliche Kritik deutlich werden, die zugleich den Begriff der Vernunft als ein kreatives, adaptives und kooperatives Verhalten eines interessierten, erlebenden und freien Subjektes im Verhältnis zu seiner Umwelt tiefergehender qualifiziert. Ein erster entscheidender Unterschied liegt in der Orientierung vernünftigen Verhaltens. Während bei Habermas der intersubjektive Konsens, die diskursive Übereinstimmung als oberste Norm der Rationalität angenommen wird, ist es bei dem von mir vorgeschlagenen Vernunftbegriff die Übereinstimmung, die Adäquanz im Verhältnis zwischen interessiertem Subjekt und physischer sowie sozialer Umwelt. In diesem Vernunftverständnis wird der Verweis auf eine metaphysische Differenz zwischen Subjekt und Umwelt vorausgesetzt. Ich nehme aber an, dass auch die Norm des Konsenses nicht ohne diese Differenz auskommt. Habermas kann nicht im Ernst diese Differenz bestreiten wollen, setzt er sie doch selbst in Form der voneinander unterschiedenen, um einen Konsens ringenden Subjekte voraus. Eine Negation derselben hieße letztlich, seine Rationalitätstheorie sowie die Wirklichkeit, die sie beschreiben soll, als ein Selbstgespräch eines individuellen, sich selbst undurchsichtigen absoluten Subjektes zu verstehen, das, 328 Habermas (1995), Band 1, Seite 387. Habermas, Jürgen: „Ein Interview mit der New Left Review“, in: ders.: Die neue Unübersichtlichkeit, Kleine politische Schriften V, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985, Seite 213-257, Seite 236; vgl. de Vries (1989), Seite 38 n. 97. 330 Schnädelbach (1993), Seite 23. 329 139 soweit es nicht Habermas selbst ist und auch nicht jeweils wir anderen, die wir uns mit seinen Gedanken beschäftigen, ein drittes über uns stehendes sein müsste. Oder aber die Konsequenz wäre, seinen im Diskurs befindlichen Subjekten und auch sich selbst ihre wirkliche Existenz als Individuen abzustreiten, was die Sache nicht leichter macht. Denn zur Negation der individuellen Existenz muss zumindest die Existenz des individuellen Gedankens der Existenznegation vorausgesetzt werden. Oder, wenn auch diesem Gedanken – so wie dem diesen denkenden Individuum – eine wirkliche Existenz abgesprochen werden soll, dann müsste erklärt werden, wie es denn sein kann, dass ein „nicht wirklich“ existierendes individuelles Subjekt sowohl über den Begriff eines Individuums als auch über den einer „wirklichen“ Existenz verfügen kann, ohne die es sich seine „wirkliche“ Existenz als Individuum gar nicht absprechen könnte. Man müsste etwa von angeborenen Begriffen der Individualität und einer „wirklichen“ Existenz ausgehen und zugleich erklären, wie diese einem nicht „wirklich“ existierenden Individuum überhaupt angeboren sein können; und sich damit in den verwegensten metaphysischen Spekulationen ergehen und meines Erachtens verlieren. Wir können zwar erleben, dass wir „etwas“ denken oder sagen, nicht aber verstehen, was wir denken oder sagen, wenn wir uns unsere individuelle Existenz absprechen. Es ist dies die alte und doch immer wieder neue, prominent bei Augustinus und Descartes zu findende Erkenntnis, dass sich ein Zweifel an unserer individuellen Existenz gar nicht durchhalten lässt, und, so wir über eine berechtigte Heuristik hinaus nicht Abstand davon nehmen, in Verzweiflung geraten. Mit dieser Erkenntnis muss weder die Annahme eines identischen metaphysischen Selbst noch eine existenzielle Unabhängigkeit von der Umwelt postuliert werden. Das tue ich explizit nicht. Weder schreibe ich einem individuellen Subjekt eine metaphysische Identität zu, noch behaupte ich seine von der Umwelt unabhängige Existenz. Ich behaupte allein seine Individualität und eine metaphysische Differenz derselben zur Umwelt. Und ich nehme vor dem Hintergrund des Gesagten an, dass ich mit Habermas über diese Annahme einen Konsens erzielen kann, weil er sie für seine Theorie selbst voraussetzen muss, in seiner Alltagspraxis es ohnehin tun wird. Es wäre ein Konsens über eine für den Konsens und damit für die Norm seiner Theorie selbst vorauszusetzende Bedingung. Und indem dieser Konsens meinem Verständnis nach nichts anderes heißt, als dass wir in diesem Konsens unsere Reflexion und unser Selbstverständnis in ein adäquates Verhältnis zur Umwelt setzen, liegt in der Norm des Konsenses selbst ein Verweis auf die Norm der Adäquanz zur Umwelt verborgen. Kommen wir nun zur Diskussion des Verhältnisses zwischen den drei Aspekten der Vernunft und den drei Diskurstypen bei Habermas. Überraschenderweise wird diese Annäherung vor allem eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem ästhetischen 140 Diskurs bedeuten, in deren Verlauf allerdings auch der theoretische und der praktische Diskurs thematisch bleiben werden. Zunächst – und kurz – zu den meiner Meinung nach weniger problematischen Verhältnissen. Der adaptive Aspekt ist mit dem theoretischen Diskurs nicht schwer in Verbindung zu bringen. Der auf objektive Geltungsansprüche zielende theoretische Diskurs kann ohne größere Schwierigkeiten als die gemeinsame Suche nach Adaption unserer Reflexion an die unveränderlichen oder veränderlichen Bedingungen unseres Lebens verstanden werden. Auch das Verhältnis zwischen kooperativem Aspekt und praktischem Diskurs ist meines Erachtens unproblematisch. Im praktischen Diskurs suchen wir reflexiv nach einer Einigung über die Regeln, nach denen wir unsere Interessen koordinieren wollen. Wie aber verhält es sich mit dem kreativen Aspekt, den ich als ein interessegeleitetes Gestalten der Umwelt verstehe, und dem ästhetischen Diskurs? In welchem Sinne könnte der ästhetische Diskurs seine Basis in einem interessegeleiteten Gestalten der Umwelt finden? Und ist es nicht gerade die Intentionslosigkeit ästhetischen Schaffens, über die Habermas den Vernunftbegriff über ein instrumentalistisches, auf die Verwirklichung von Interessen gerichtetes Verständnis hinaus erweitern will?331 Hinter dem ästhetischen Diskurs verbirgt sich bei Habermas, soweit ich dies sehe, eine intersubjektive Vergegenwärtigung und Vergewisserung des zweckfreien individuellen Erlebens.332 Auf der Basis seiner authentischen Expressivität im Kunstwerk und dessen Rezeption und Kritik können für das individuelle Erleben neben den auf Allgemeinheit und Universalität hin ausgerichteten Diskursen über Objektivität und Moral Freiräume geschaffen und seine diskursive Anwesenheit behauptet werden. Ich möchte zumindest kurz umreißen, vor welchem Hintergrund diese These plausibel wird. Was wie selbstverständlich klingt, zumindest für aufgeklärte Ohren, dass ein zweckfreies individuelles Erleben nicht Gegenstand Allgemeingültigkeit beanspruchender theoretischer und praktischer Reflexionen sein kann, ist nicht immer so selbstverständlich gewesen. So sicherte die sich bei Platon findende sowie etwa mit den biblischen Religionen verbundene und von Kant vor verändertem argumentatorischen Hintergrund aufgenommene Vorstellung eines Erlebens nach dem Tod dem individuellen Subjekt diese Selbstbezüglichkeit nicht nur in der behaupteten oder postulierten Objektivität dieses nachtodlichen Daseins, sondern auch in den Vorstellungen der Moral, in denen es ja gerade darum ging, sich um dieses jenseitige Erleben aus freien Stücken zu sorgen oder zumindest einen Ausblick darauf zu bekommen. Bei Aristoteles war diese Selbstbezüglichkeit des Erlebens, wenn auch nicht in der Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele, so doch aber in der Ausrichtung auf das Erleben der eigenen Glückseligkeit thematisch; wobei man sich durchaus fragen kann, was Aristoteles eigentlich genau damit meinte, wenn er sagt, dass wir uns soweit als möglich bemühen sollen, „unsterblich zu 331 332 Vgl. de Vries (1989), Seite 26ff. Vgl. ebd., Seite 25ff. 141 sein“.333 Sollte dies nur heißen, sich der betrachtenden Existenz der unsterblichen Götter, an die er doch nicht glaubte, oder dem ewigen „unbewegten Beweger“ soweit wie möglich anzugleichen? Oder hielt er ein Dasein nach dem Tode, nicht der menschlichen Seele, die er ja als den strebenden Aspekt unseres endlichen Lebens verstand, sondern als ein nicht mehr strebendes, einfaches, unbewegtes und glückseliges Erleben für möglich? Hier ist vor allem an seine Diskussion des nous in „De anima“ zu denken.334 Wenn ich hier hinsichtlich des Unsterblichkeitsgedankens von einer Selbstbezüglichkeit des zweckfreien individuellen Erlebens spreche, so mag das vielleicht verwundern, weil gerade mit solchen metaphysischen Gedanken zumeist die Vorstellung einer Zweck- oder Sinngebundenheit verbunden wird. Aber welcher Sinn läge denn, zu Ende gedacht, in einem Erleben nach dem Tod? Meines Erachtens kein anderer als im Erleben des morgigen, des heutigen und gestrigen Tages: nämlich keiner. Erleben als solches, mag es noch so unsterblich sein, hat keinen Sinn oder Zweck und kann so letztlich auch dem diesseitigen Erleben keinen Sinn oder Zweck verleihen. Nun mag noch die Vorstellung eines nachtodlichen Heils oder einer vollkommenen Glückseligkeit als ein solcher Sinn oder Zweck gedacht werden. Aber welchen Sinn und Zweck hätte ein solches Erleben? Die Antwort lautet wiederum: keinen. Es könnte schön, glückselig oder wunderbar genannt werden und man könnte es als „sinnvoll“ beschreiben, ein solches leidloses Erleben anzustreben. Aber wenn der Sinn des Erlebens in der Suche nach einem leidlosen Erleben gesucht würde – ob diesseitig oder jenseitig – das ist letztlich ganz egal, dann würden wir spätestens mit dem Erreichen desselben in einem sinnlosen Erleben landen. Wer darauf besteht, dass dem Erleben ein Sinn zukommt und dieser im Heil zu finden sei, der müsste konsequenterweise auch auf das Leid bestehen, weil es dem ansonsten sinnlosen Erleben überhaupt erst einen Sinn zu geben vermag. Die Sinnstiftung läge dann also gerade im Leid und nicht in einem leidlosen Erleben. Der den Sinn des Erlebens im Heil Suchende befindet sich in einer masochistischen, vielleicht sogar sadomasochistischen Sackgasse. Das Erleben, ob im Diesseits oder möglicherweise auch im Jenseits, ist sinn- und zweckfrei. Und selbst ein „Dasein Gottes“ würde daran nichts ändern. Völlig unberührt von dieser Sinn- und Zweckfrage bleibt hingegen, dass wir ein immenses Interesse am individuellen Erleben entwickeln können und dass jedes Erleben immanent immer schon mit einem Interesse verbunden ist. Es geht um die oben beschriebene Gleichursprünglichkeit von Interesse, Erleben und Freiheit.335 Ich komme wieder darauf zurück. Es sollte nun verständlich sein, wieso ich auch in den metaphysischen Gedanken über ein Erleben nach dem Tod die Selbstbezüglichkeit eines zweckfreien individuellen Erlebens sehe. 333 Siehe Aristoteles NE (2001), Seite 443. Aristoteles: Über die Seele, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1995; vgl. hierzu Welsch (2012), Seite 207. 335 Vgl. Seite 113ff. dieser Arbeit. 334 142 Für ein sich in der Neuzeit immer weiter verbreitendes empirisches Denken erscheint dieser Selbstbezug des Erlebens im Rahmen metaphysischer Ausgriffe auf ein nachtodliches Erleben im zunehmenden Maße als unredlich. Vorstellungen über ein Erleben nach dem Tod, auch in Form von Reinkarnationsgedanken, sind empirisch prinzipiell nicht überprüfbar und verlieren für ein empirisches Denken, zumindest wenn es konsequent durchgehalten wird, notwendig den Status berechtigter Behauptungen, ihren Status als Wissen. Sie scheiden aus dem theoretischen Diskurs aus. Auch aus dem praktischen Diskurs müssen sie deshalb für ein konsequent bleibendes empirisches Denken herausfallen. Sie können nicht mehr in Verbindung mit vorauszusetzenden Normen zur Konstruktion von Grund-Folge-Kalkülen in Hinblick auf jenseitigen Lohn oder jenseitiger Strafe gebraucht werden; zur Begründung von Normen haben solche Vorstellungen noch nie dienen können. Ich möchte hier allerdings betonen, dass es ebenso in der Konsequenz des empirischen Denkens liegen muss, die mit der Abstinenz gegenüber jeglichen empirischen Ausmalungen verbundene Möglichkeit eines Erlebens nach dem Tode offen zu halten. Denn genauso wenig, wie sich Vorstellungen über ein solches nachtodliches Erleben empirisch überprüfen lassen, lässt sich auch die Negation desselben überprüfen. Dies wird von einem nicht mehr empirischen Denken oft vergessen, welches das spätestens seit Francis Bacon explizit formulierte naturwissenschaftlich-experimentelle Programm zur Speerspitze einer „Vernunft“ macht, die nicht nur ein metaphysisches Weltbild nach dem anderen zum Platzen bringen will, sondern ein ebensolches hinter sich herzieht. Die sensualistisch-materialistische Verklärung, aus der eine solche Negation erwächst, hat im Rahmen evolutionstheoretischer Gedankengänge auch ein anderes in diesem Zusammenhang merkwürdiges Ergebnis mit sich gebracht. Aus einer sich im Unsterblichkeitsgedanken ausdrückenden Selbstbezüglichkeit des individuellen Erlebens wurde eine in die Unendlichkeit ausgreifende genetische Selbstbezüglichkeit. In der Evolutionstheorie wird mittlerweile die „inclusive fitness“, zu verstehen als generationsübergreifende, im Prinzip unendliche Weitergabe individueller Gene, als „ultimate causality“, als die letztendliche Ursache individueller Motivation diskutiert.336 So wird die Unsterblichkeit des Erlebens materialistisch transformiert und in die Obhut einer genetischen „Vernunft“ gegeben, die sich sogar in einem die Erfolgsaussichten steigernden altruistischen Verhalten äußern könne, also wiederum praktische Aspekte, nun aber auf genetischer Basis, in den theoretischen Diskurs integriert. Ein Gedanke, der meines Erachtens materialistisch überhaupt nicht durchzuhalten ist. Denn letztlich werden nur genetische Informationen, nicht aber die materiellen Träger der Information weitergegeben. Die nach Unsterblichkeit strebende genetische „Vernunft“ hat also, genau 336 Bernard, Larry u.a.: „A Evolutionary Theory of Human Motivation“, in: Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131(2), 2005, 129-184, Seite 134ff. 143 genommen, eine nicht-materielle Kehrseite. Was man aber unter dieser nicht-materiellen Kehrseite genauer zu verstehen hat und inwiefern diese in irgendeiner Hinsicht ein Interesse an ihrem Fortbestand haben könnte, aus dem heraus sie Individuen zu altruistischem oder sonstigem ihren Fortbestand sicherndem Verhalten veranlasst und wie sie dazu fähig wäre, bleibt dabei völlig ungeklärt. Und ich habe den Eindruck, dass hier die Phantasie über ein begründetes Denken hinwegschnellt. Wie dem auch sei, für ein konsequent empirisches Denken können wir Folgendes festhalten: Aus dem theoretischen und praktischen Diskurs sind alle Ausmalungen über ein Erleben nach dem Tod auszuschließen, nicht aber die Möglichkeit eines solchen. Diese Möglichkeit liefert aber weder dem theoretischen Diskurs einen zu erforschenden Gegenstand noch kann sie im praktischen Diskurs weiterhin für Grund-Folge-Kalküle gebraucht werden. Wie aber hängt dieses vor dem Hintergrund der Entwicklung des neuzeitlichen empirischen Denkens für den theoretischen und den praktischen Diskurs nachvollziehbare Ergebnis mit der Ausbildung des ästhetischen Diskurses zusammen? Um einer möglichen Antwort näher zu kommen, lohnt es sich, noch einmal einen Schritt zurück und hinüber zum praktischen Diskurs zu gehen. Die Konsequenz, die das empirische Denken für den praktischen Diskurs bedeutet, ist, dass in diesem Grund-Folge-Kalküle nicht mehr mit Spekulationen über ein nachtodliches Erleben aufgeladen werden können. Wenn man nun bedenkt, dass dadurch die Möglichkeit von Grund-Folge-Kalkülen im praktischen Diskurs nicht generell aufgehoben ist, dann wird deutlich, dass hinter den Vorstellungen über ein nachtodliches Erleben natürlich etwas anderes stecken muss, als eben diese Kalküle überhaupt zu ermöglichen. Ein Aspekt ist Macht. Indem man etwa mit ewigen Qualen, aus denen es anders als in einer kontingenten Welt keine Chancen des Entrinnens gibt, noch nicht einmal durch den Tod, sondern dieser im Gegenteil gerade den Einstieg dorthin bedeutet, oder aber zumindest mit dem Fegefeuer drohte, konnte man suggestiv, ja nicht zuletzt auch autosuggestiv Gefügigkeit erzeugen; anders herum natürlich auch durch das Versprechen ewiger Wonne. Etwas weniger drastisch sind die Wege der Reinkarnation. Aber auch hier gilt: Es gibt kein Entkommen. Insofern bedeutet der empirische Abgesang an die Nachtodphantasien eine Befreiung zumindest von diesen Mächten. Und diese Befreiung ist in der Kunst offensichtlich. Denn es war ja gerade die Kunst, die diesen Gedanken einen ästhetischen Ausdruck verlieh und die Bildwelten der Menschen prägte. Man braucht sich nur die Veränderung künstlerischer Motive vor Augen zu halten, um diese Befreiung zu erkennen. Aber diese Befreiung erklärt nicht auch schon das Festhalten am künstlerischen Schaffen und die Herausbildung des ästhetischen Diskurses. Es gibt neben der Macht noch einen zweiten und ich denke auch ursprünglicheren Hintergrund, und dieser wird sich für den ästhetischen Diskurs als entscheidend entpuppen. Der Gedanke an ein nachtodliches Erleben entspringt dem Interesse am individuellen Erleben überhaupt, jenes grundlose Interesse, das ich als das grund-legende Interesse aller 144 individuellen Subjektivität beschrieben habe, und das wir je selbst sind.337 Individuelles Erleben ist ohne dieses Interesse nicht zu haben, es fällt mit diesem wortwörtlich individuell zusammen. Es ist an diesem Punkt ganz entscheidend, das individuelle Erleben als ein interessiertes Erleben zu verstehen. Denn was sich anders als im Hinblick auf den bloßen Begriff des Erlebens mit dem Interesse am eigenen Erleben auftut, ist die Selbsttranszendenz eines jeden Subjekts. Ein Subjekt transzendiert sich im Interesse an seinem nicht einfach gegebenen, sondern immer wieder neu zu erringenden Erleben in eine unbestimmte Zukunft, die es aber gerade noch nicht erlebt. Das Innerste eines Subjekts kann deshalb nicht auf den Begriff des Erlebens reduziert werden. Und diese Selbsttranszendenz gilt für jeden noch so einfachen Organismus. Das Selbsterhaltungsinteresse, ja allein schon das Selbsterhaltungsverhalten eines jeden Organismus bedeutet eine über die Gegenwart hinausgehende Selbsttranszendenz in ein noch unbestimmtes individuelles Erleben hinein. Ich schließe mich in dieser Betrachtung einer philosophischen Biologie an, wie ihr auch Hans Jonas in Organismus und Freiheit gefolgt ist.338 Jonas macht den Begriff einer solchen natürlichen Transzendenz von Organismen allerdings allein im Hinblick auf die Bedürftigkeit bzw. Abhängigkeit desselben von seiner Umwelt deutlich. Der Organismus geht in seiner Abhängigkeit von einer von ihm unterschiedenen Umwelt immer schon über sich hinaus und hat „Welt“.339 Ich bin jedoch der Ansicht, dass auch die im Interesse am individuellen Erleben deutlich werdende Transzendenz in ein individuelles zukünftiges Erleben hinein eine natürliche Transzendenz eines jeden Organismus ist. Diese Selbsttranszendenz ist nicht abhängig von ihrer Reflexion, sondern ist die Bedingung derselben, weil ohne sie überhaupt keine zur Reflexion fähigen Organismen existieren könnten. Und diese Selbsttranszendenz des Organismus wird exakt bis zu jenem Augenblick anhalten, in dem dieser stirbt. Dass nun, soweit ein Organismus dazu fähig ist, in der individuellen Reflexion dieser vorgängigen Selbsttranszendenz und der reflexiven Vorwegnahme des eigenen Todes der Gedanke an ein nachtodliches Erleben und, insofern der Organismus an seinem Erleben interessiert ist, auch ein Interesse an einem solchen geradezu reflexhaft entstehen muss, scheint mir auf der Hand zu liegen. Weil Jonas diese organismische Selbsttranszendenz des Interesses am eigenen Erleben nicht expliziert, entsteht in seiner biologischen Philosophie eine Kluft zwischen der Betrachtung natürlicher Organismen und der philosophischen Thematisierung des Todes, einschließlich des Unsterblichkeitsgedankens. Dies spiegelt sich schon im inhaltlichen Aufbau seines Werkes wider. Er thematisiert den Tod „nur“ rahmend zu Beginn und am Ende seiner philosophischen Auseinandersetzung, schafft es aber nicht, diesen in die philosophische 337 Vgl. Seite 112ff. dieser Arbeit. Jonas, Hans: Organsimus und Freiheit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973. 339 Vgl. ebd., Seite 133f. 338 145 Betrachtung der Organismen selbst zu integrieren und wird damit seiner gegenüber Whitehead geäußerten Kritik nur teilweise gerecht.340 Worauf ich hier letztlich hinaus will, ist aber weniger der Gedanke an ein Erleben nach dem Tode, sondern das diesem zugrunde liegende, nicht unbedingt reflektierte individuelle Interesse am Erleben. Dieses vor-reflexive individuelle Interesse hält, wie gesagt, bis in den Tod eines Organismus an, denn erst in diesem endet sein sich selbst transzendierendes Selbsterhaltungsinteresse und -verhalten. In evolutionstheoretischen Überlegungen wird dieses bis zum Ende der Selbsterhaltung andauernde Interesse am individuellen Erleben zumeist dadurch kaschiert, dass dieses seine Erfüllung in der Reproduktion finden würde, bildlich gesprochen etwa ein Einzeller in seiner Teilung. Dies halte ich für eine ungenaue Beschreibung. Der Einzeller findet in der Teilung nicht die Erfüllung seines individuellen Selbsterhaltungsinteresses, sondern das Ende desselben. Denn die Teilung ist nicht seine Teilung – ein Individuum lässt sich nicht aufteilen –, sondern eben sein Ende und bedeutet das Entstehen neuer Individuen.341 Man sollte, so denke ich, Selbsterhaltungsinteresse und Reproduktionsinteresse nicht ineinander auflösen, auch wenn, ohne Frage, bei einem Einzeller die Erfüllung des letzteren mit dem Ende des ersteren einhergeht. Warum ich dies hier so deutlich mache und was dies mit dem ästhetischen Interesse zu tun hat, wird noch klarer werden. Ich halte die Ineinssetzung von Selbsterhaltungsinteresse und Reproduktionsinteresse, wie sie auch im Rahmen der oben beschriebenen Vorstellung einer genetischen Unsterblichkeitssuche deutlich wird, für ein Residuum, eine Reminiszenz oder ein nostalgisches Echo jener Suche nach dem Sinn oder Zweck des Lebens, von dem doch gerade die Evolutionstheorie vorgibt, Abstand zu nehmen. Es wird nicht recht durch- und ausgehalten, dass das individuelle Erleben keinen Sinn oder Zweck hat, und so sucht man einen solchen in den Nachkommen. Da hat sich ein Individuum sein Leben lang abgerackert, um am Leben zu bleiben, keine Mühe gescheut und dann muss es doch sterben. Welchen Sinn hat diese Plackerei gehabt? Dann doch wenigstens den, eigene Nachkommen in die Welt zu setzen, die obendrein noch seine Gene in sich tragen und diese weitergeben und weitergeben und weitergeben. Aber hätte dies einen Sinn? Ich habe bereits deutlich gemacht, dass es kein zum Erfolg führendes Unternehmen ist, der Unsterblichkeitsgedanke vermag dem Leben keinen Sinn oder Zweck zu geben. Das gilt auch für seine genetische Transformation, unabhängig von ihrer grundsätzlichen Fraglichkeit. So behält die Evolutionstheorie in ihrer Absage an den Sinn des Lebens, wenn auch ungewollt, auch in Bezug auf das Individuum am Ende zwangsläufig Recht. 340 Vgl. Seite 117 dieser Arbeit. Vgl. Lowe, E. Jonathan: The Possibility of Metaphysics – Substance, Identity, and Time, Oxford/New York: Oxford University Press, 2001, 174ff. 341 146 Individuelles, interessiertes Erleben hat keinen Sinn oder Zweck und erhält einen solchen auch weder durch den Gedanken an ein Erleben nach dem Tod noch durch die Weitergabe individueller Gene. Und genau aus diesem Grund können wir uns auf das individuelle Interesse am Erleben konzentrieren und den meines Erachtens ganz natürlich und reflexhaft aus diesem erwachsenden Gedanken an ein mögliches nachtodliches Erleben beiseite lassen, weil er diesem Interesse keinen zusätzlichen Gehalt gibt, sondern nichts anderes als dessen Ausdruck ist: ein sich selbst bis zuletzt transzendierendes Interesse am individuellen Erleben. Was hier in der Thematisierung des individuellen Todes, des Endes aller selbsttranszendierenden Bemühungen um Selbsterhaltung, und der Kritik der evolutionstheoretischen Ineinssetzung von Selbsterhaltungs- und Reproduktionsinteresse aufscheint, ist, dass nicht nur das individuelle Erleben, wie ich weiter oben ausgeführt habe habe, sondern auch das Interesse am individuellen Erleben ein zweckfreies ist. Interessiertes Erleben ist interessiertes Erleben, ob jetzt oder in Zukunft, es hat keinen Zweck: Es ist interessiertes Erleben. Das im Interesse antizipierte zukünftige Erleben kann dem jetzigen Erleben keinen Zweck verleihen, weil es selbst keinen hat und niemals haben wird. Das Interesse an diesem ist zweckfrei. Aber diese Zweckfreiheit des individuellen Interesses am Erleben ändert nicht in geringster Weise irgendetwas an dem Erleben dieses Interesses und sollte es auch nicht. Vielmehr lässt sie dieses viel deutlicher noch hervortreten. Weil dieses Interesse keinem Zweck untergeordnet werden kann – auch nicht dem, Nachkommen hervorzubringen –, bekommt es umso mehr einen Wert in sich. Dieser Wert ist kein unbedingter, weil, wie oben angemerkt, das interessierte Erleben nicht selbst seine Möglichkeit ist.342 Aber es ist ein unbestimmbarer, unschätzbarer Wert. Und wenn ich in meinem interessierten Erleben diese grund-legende Wertschätzung erkenne, die unreflektiert und grund-los meinem Erleben immer schon zu eigen ist, dann und nur dann kann deutlich werden, was mit den Worten „Sinn“ und „Zweck“ des Lebens sinnvoll gemeint sein kann. Es ist der Wert, den ein interessiertes Individuum durch sein interessiertes Erleben seinem Erleben je gibt. Es ist die sinn- und zweckfreie Wertfülle des individuellen Erlebens. Das Leben macht für mich genau dann einen Sinn, wenn ich es für mich als wertvoll erlebe. Die Sinnsuche wäre die Suche danach, dieses innerste Interesse, diesen innersten Wert im Erleben zu halten. Und allein vor diesem Hintergrund macht es auch Sinn von der Befriedigung als einem Endzweck eines jeden interessierten, erlebenden und freien Subjektes zu sprechen.343 Ein befriedigendes Erleben ist oder hat keinen Zweck, sondern ist ein Wert in sich. Das sinnvolle Leben und jede teleologische Rede liegen so gerade in einem sinn- oder zweckfreien interessierten Erleben, einem zweckfreien Werterleben begründet. Dieser Gedanke zeigt zugleich, dass ein sinn- oder zweckfreies 342 343 Vgl. Seite 112ff. dieser Arbeit. Vgl. Seite 119f. dieser Arbeit. 147 Leben nicht als ein sinn- oder zweckloses Leben in der Bedeutung von wertfrei oder gar wertlos missverstanden bzw. erlebt werden sollte. Es handelt sich hier also um keinen Nihilismus – das genaue Gegenteil ist der Fall! Und es zeigt sich, dass ein wertvolles Erleben nicht ohne Interesse und damit nicht ohne die damit verbundene Selbsttranszendenz zu haben ist. Der Begriff des Erlebens als solcher könnte uns dieses zweckfreie Werterleben nicht vermitteln, es sei denn, das interessierte Erleben würde implizit schon mitgedacht. Explizit wird es nur erklärlich, insofern wir an unserem individuellen Erleben ein Interesse haben bzw. ein Interesse sind. Und dieses zweckfreie Interesse ist meines Erachtens das ontogenetisch unverzichtbare Interesse, ohne das kein Organismus sich entwickeln könnte und so auch kein Mensch.344 Alle anderen Interessen setzen es voraus, wenn sie ihm auch nicht unbedingt dienen müssen und sich sogar gegen dasselbe wenden können. Ein individuelles Leben ist in seinem Grunde die Verwirklichung dieses grund-losen und zweckfreien individuellen Interesses im und am Erleben. Es deutet sich bereits an, wohin uns dies führt. Ich habe den kreativen Aspekt als ein interessegeleitetes Gestalten der Umwelt beschrieben. Fragt man nun im Rahmen des ästhetischen Diskurses nach einer authentischen Expressivität des individuellen Subjekts, so verstehe ich das vorhergehend dargelegte zweckfreie Interesse am Erleben als den innersten und insofern authentischen Kern und Wert eines jeden Subjektes, den es in einer solchen Expressivität zu entäußern gilt. Die Expressivität dieses allen anderen Interessen zu-grunde liegenden und selbst zweckfreien Interesses bedeutet dann im Hinblick auf den kreativen Aspekt nichts anderes, als eine zweckfreie, aber dennoch interessengeleitete Gestaltung der physischen und sozialen Umwelt, d.h. eine von anderen Interessen, Gewohnheiten und Notwendigkeiten des Lebens nicht unberührte, so aber ihrer Richtung nach unbestimmte oder offene Gestaltung unseres Lebensraumes. Der Künstler kann uns so immer wieder Räume eröffnen, in denen wir an die zweckfreie Werthaftigkeit unseres individuellen interessierten Erlebens anschaulich erinnert werden und uns in dieser Anschauung erleben können. Das empirische Denken kann auf die Expressivität dieses innersten Interesses nicht verzichten, es müsste sich dafür schon selber abschaffen, da dieses ihm selbst zu-grunde liegt. Weil es sich aber den Ausdruck desselben im theoretischen und praktischen Diskurs versagt, in denen dieses zweckfreie Interesse sich nicht anders als in reflexhaft über den Tod ausgreifenden ästhetischen Vorstellungen manifestieren kann – es gibt keinen inneren Zweck, den erfüllend das zweckfreie Interesse am Erleben ästhetisch ein zeitliches Ende finden könnte –, muss es sich in Form einer zweckfreien Gestaltung der physischen und sozialen Umwelt in eben diese und ihre Vergänglichkeit entäußern; darin inbegriffen, was man unsere geistige Umwelt nennen kann, die in intersubjektiver Reziprozität reflexiv-diskursiv ausgefüllte Raumzeit. 344 Vgl. Seite 113ff. dieser Arbeit. 148 Das empirische Denken ist auf die Kunst und den ästhetischen Diskurs angewiesen. Der theoretische Diskurs kann dem zweckfreien Interesse keine Heimat mehr sein. Denn wenn er auch ohne letzteres nicht zu denken ist, so geht das zweckfreie Interesse doch nicht in der intersubjektiven Adaption der Reflexion an die unveränderlichen und veränderlichen Bedingungen des Erlebens auf. Im Hinblick auf den praktischen Diskurs gilt das gleiche. Auch diesem liegt es zu-grunde. Aber das individuelle zweckfreie Interesse kann sich nicht in der Koordination von Interessen und den dafür zu schließenden Kompromissen erschöpfen; es ist, weil es für sämtliche Interessen und damit auch jegliche InteressenKompromisse stets vorauszusetzen ist, in gewisser Weise kompromisslos. Die intersubjektive Vergegenwärtigung und Vergewisserung des zweckfreien individuellen Interesses im ästhetischen Diskurs ist meines Erachtens ein natürliches Anliegen des empirischen Denkens und bringt immer wieder neu eine grundlegende Wahrheit ans Licht. Das individuelle Subjekt kann in seinem interessierten Erleben, kann seiner interessierten Natur nach weder in der biologischen Reproduktion, noch – in soziokultureller Verlängerung der Evolutionstheorie – in der Reproduktion von Lebensformen völlig aufgehen, sondern braucht immer wieder eigene Raumzeit. Und je größer im Zuge der Evolution nicht die Freiheit, sondern die Flexibilität oder Optionalität in der Verfolgung des Interesses am Erleben geworden ist, je mehr Optionen sich aufgetan haben, mit denen ein interessiertes Erleben sich verbinden kann – und hier spielen die evolutionäre Entwicklung von Reflexivität und Diskursivität und die aus diesen erwachsenen Kulturen und Wertvorstellungen eine entscheidende Rolle – desto größer ist die Gefahr, den Sinn für den ursprünglichen Wert und den Grund jeglichen individuellen Werterlebens zu verlieren, das grund-legende zweckfreie individuelle Interesse am Erleben überhaupt. So erinnert der Künstler uns nicht nur an einen objektiven Aspekt einer jeden subjektiven Natur, sondern auch an den Grund aller moralischen Diskussionen. Deshalb erscheint mir der ästhetische Diskurs tatsächlich nicht nur von individuellem, sondern auch von allgemeinem Interesse zu sein. Zudem werden das Kunstschaffen und der ästhetische Diskurs auch evolutionstheoretisch so wirklich verständlich. Sie erwachsen dem jedem individuellen Lebewesen zu-grunde liegenden zweckfreien Interesse am zweckfreien Erleben. Der ästhetische Diskurs ist der siebente Tag, ist der Sabbat empirisch-diskursiven Verhaltens. Zu Beginn dieser Annäherung des von mir vorgeschlagenen Vernunftbegriffes an die Grundstruktur der habermasschen Theorie der Rationalität habe ich bereits darauf hingewiesen, dass in dieser eine grundsätzliche Kritik zum Vorschein kommen würde. Diese will ich nun im Hinblick auf das Ergebnis meiner Reflexionen über das Verhältnis von Authentizität und kreativem Aspekt verdeutlichen. Das Ergebnis besteht in der Feststellung, dass der ästhetische Diskurs seine Kraft aus dem jedem Subjekt zukommenden zweckfreien individuellen Interesse am Erleben schöpft, das zugleich die 149 Bedingung aller anderen Interessen ist, auch der sich im theoretischen und praktischen Diskurs ausdrückenden, und auf das diese immer wieder zurückverwiesen sind. Ohne das individuelle zweckfreie Interesse der Subjekte, sich in einer physischen und sozialen Umwelt im Erleben zu halten, brächen sowohl der theoretische als auch der praktische Diskurs zusammen – und natürlich auch der ästhetische –, weil es keinen Grund mehr gäbe, ihnen nachzugehen. Diese nicht sonderlich spektakulär klingende Einsicht verweist jedoch darauf, dass nicht der Konsens, sondern eben jenes je individuelle Interesse allem vernünftigen Verhalten, auch dem diskursiv-prozeduralen in seinen drei unterschiedlichen Formen, vorangeht. Zwar sind die so interessierten Subjekte für den Erhalt und in der Gestaltung ihres Lebens von ihrer physischen und sozialen Umwelt abhängig und damit, insoweit es sich um reflexions- und diskursfähige Subjekte handelt, auch von den geschichtlich geprägten Diskursen und in diesen auf die Möglichkeit des Konsenses angewiesen. Aber es bleibt dabei, dass sie immer wieder jeweils auf ihr individuelles zweckfreies Interesse am Erleben und damit auf sich selbst zurückkommen müssen. Ohne dieses macht nichts einen Sinn oder hat einen Wert, ist nichts vernünftig. Ich will in diesem Zusammenhang an Max Webers eindrückliche und im Kern völlig berechtigte, wenn in ihrer Formulierung auch mit Humor zu nehmende Schilderung des „,Erlebnis[ses]‘ der Wissenschaft“ erinnern: „Und wer nicht die Fähigkeit besitzt, sich einmal sozusagen Scheuklappen anzuziehen und sich hineinzusteigern in die Vorstellung, daß das Schicksal seiner Seele davon abhängt: ob er diese, gerade diese Konjektur an dieser Stelle dieser Handschrift richtig macht, der bleibe der Wissenschaft nur ja fern. Niemals wird er in sich das durchmachen, was man das ,Erlebnis‘ der Wissenschaft nennen kann. Ohne diesen seltsamen, von jedem Draußenstehenden belächelten Rausch, diese Leidenschaft dieses: ,Jahrtausende mußten vergehen, ehe du ins Leben tratest, und andere Jahrtausende warten schweigend‘: – darauf, ob dir diese Konjektur gelingt, hat einer den Beruf zur Wissenschaft nicht und tue etwas anderes. Denn nichts ist für den Menschen als Menschen etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft tun kann.“345 Was Weber hier ausdrückt, ist das Erlebnis einer unschätzbaren Wertschätzung, die er in seiner Arbeit erlebt, oder besser, die er dieser gegenüber aufbringt. Denn ohne dass er diese Wertschätzung aufgebracht hätte, hätte er sie auch nicht erleben können. Aus der Arbeit selbst und seinen Werken aber konnte er sie wohl nicht genommen haben, denn einige Seiten später fügt er an: „Jeder von uns dagegen in der Wissenschaft weiß, daß das, was er gearbeitet hat, in 10, 20, 50 Jahren veraltet ist. Das ist das Schicksal, ja: das ist der Sinn der Arbeit der Wissenschaft [...] jede wissenschaftliche ,Erfüllung‘ bedeutet neue ,Fragen‘ und will ,überboten‘ werden und veralten.“346 Ganz Recht behalten sollte Weber damit nicht. Er formulierte diese Sätze für einen Vortrag im Jahre 1917. Dass seine Werke 345 346 Weber (1995), Seite 12. Ebd., Seite 17. 150 auch heute noch, fast einhundert Jahre später, immer noch zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am theoretischen Diskurs, und das weltweit, als wichtige Bezugsquellen gelten, belehrt uns eines Besseren. Von epistemischen Fehlschlüssen und zeitlich bedingten Sachverhalten abgesehen, scheint es also doch möglich, zu bestimmten Einsichten zu gelangen, die die von Weber angepeilte Haltbarkeit deutlich, ich würde sogar sagen bei weitem übersteigen. Und auch wenn diese Einsichten, sind sie einmal formuliert, im Hinblick auf den Gesamtdiskurs keinen Neuheitswert mehr zu haben scheinen, so sind sie doch, für jede am Diskurs teilnehmende Person, die zu ihnen zum ersten Mal gelangt, im Akt des Begreifens neu. Denn das individuelle Begreifen wird niemals in einen Diskurs externalisiert werden können. Mit dieser Feststellung und vor dem Hintergrund des Ergebnisses meiner Überlegungen sowie der darin liegenden Kritik an Habermas’ Rationalitätstheorie möchte im Folgenden eine fünfstufige Inversion von der diskursiven Ebene bis zu jenem innersten zweckfreien individuellen Interesse am Erleben hin vorschlagen. Dazu werde ich in leicht abgeänderter Form auf Whiteheads Stufen- oder Phasenmodell der Entstehung aussageartigen Erlebens zurückgreifen.347 Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass wir jede Aussage, die wir in einem Diskurs äußeren, auch erleben (Phase 5). Wir können aber eine Aussage nur als Aussage erleben, wenn wir auch das Erlebnis eines Begriffes haben, dem wir mit dem Aussageerlebnis Ausdruck verleihen (Phase 4). Für ein Begriffserlebnis wiederum müssen wir mindestens ein Gegenstandserlebnis voraussetzen, das den Inhalt dieses Begriffes bestimmt (Phase 3). Und für ein Gegenstandserlebnis müssen wir ein physisches Erlebnis voraussetzen, ohne das uns das Gegenstandserlebnis nicht möglich wäre (Phase 2).348 Bei Whitehead endet das Phasenmodell an dieser Stelle. Ich bin jedoch der Ansicht, dass das physische Erleben, wie Whitehead es versteht, nicht die letzte Voraussetzung sein kann. Wenn es zwar noch kein Gegenstandserlebnis ist, so bedeutet es aber doch ein unbestimmtes Differenzerlebnis, man könnte auch sagen, das Erlebnis der Gegenwart eines noch unbestimmten Anderen. Zu diesem Erlebnis aber muss erstens die Möglichkeit des Erlebens überhaupt vorausgesetzt werden. Und zweitens muss diese Möglichkeit zugleich die Möglichkeit des Differenzerlebnisses erklären können. Ein pures Erleben muss nicht schon das Erleben von etwas anderem sein, als das Whitehead das physische Erleben als ein „bezeichnendes“ Erleben ja gerade versteht. Es könnte 347 Vgl. Whitehead (1979), Dritter Teil: „Die Theorie des Erfassens“, Seite 401ff.; zusammenfassend Seite 474ff. 348 Die Phasen 2, 3, 4 entsprechen bei Whitehead den Phasen α, β, γ. Dem Ausdruckserleben gibt Whitehead kein eigenes Symbol. Das Begriffserlebnis in Phase 4 kann sowohl singuläre als auch die Integration einer Mehrzahl von Gegenstandserlebnissen meinen, was auf der Ausdrucksebene zum Unterschied etwa von Erlebnissen der Namensnennung und abstrakten Begriffserlebnissen, die sich auf bestimmte oder, insofern die Potentialität weiterer ähnlicher Gegenstandserlebnisse integriert wird, auch auf unbestimmte Mengen von Gegenstandserlebnissen beziehen können. Diese Unterscheidung macht Whitehead durch Einführung der δ-Phase deutlich. 151 ebenso das Erleben bloßer differenzloser Gegenwart sein – ein Erleben freilich, das für uns Menschen wohl kaum vorstellbar ist. Nun bin ich der Ansicht, dass die Möglichkeit eines solchen Differenzerlebnisses nur durch ein interessiertes Erleben erklärt werden kann. Ohne das Erleben eines Widerspruchs könnte es kein Differenzerlebnis geben. Ein Widerspruchserlebnis aber ist nur dort möglich, wo es ein Interesse gibt, dem widersprochen werden kann. Also muss ein interessiertes Erleben für ein im Widerspruch gründendes Differenzerlebnis vorausgesetzt werden. Und insofern ohne Differenzerlebnis kein interessiertes Erleben an einem so erlebten Anderen möglich ist, für das Differenzerlebnis jedoch ein interessiertes Erleben bereits vorausgesetzt werden muss, kann dieses interessierte Erleben nur als Interesse am Erleben selbst, d.h. als zweckfreies individuelles Interesse am Erleben verstanden werden (Phase 1). Und das zweckfreie individuelle Interesse am Erleben, das habe ich deutlich gemacht, bedeutet ein Werterleben. So lässt sich meines Erachtens stringent zeigen, dass sämtliches in den Diskursen erlebbares Ausdrucksverhalten auf jenes grund-legende zweckfreie individuelle Interesse am Erleben zurückweist, weil es die Bedingung der Wahrnehmung von Differenz und damit von Gegenständen und Begriffen und auf diese sich beziehender Ausdrücke ist. Allein das ein zweckfreies individuelles Interesse am Erleben voraussetzende „objektive Datum“ eines Differenzerlebnisses gibt uns die „logischen Subjekte“ unserer Prädikationen an die Hand, wenn man so will, die „Dinge-an-sich“. Und andersherum können wir die Aussage eines Anderen erst wirklich verstehen, wenn wir uns von der Wahrnehmung der Prädikation des Anderen zumindest einmal bis zu jenem im zweckfreien individuellen Interesse am Erleben wurzelnden Differenzerlebnis sozusagen durchgelebt bzw. durcherlebt haben.349 Ein wirkliches Verstehen findet also erst unter Einbezug einer vor-diskursiven, vor-reflexiven, vor-kognitiven evaluativen Ebene statt, die ein zum evaluativen Erleben fähiges Subjekt voraussetzt, d.h. ein zweckfreies individuelles Interesse am Erleben. Und es kann für ein befriedigendes Leben oftmals ratsam sein, den Anderen nicht wirklich verstehen zu wollen – etwa wenn jemand uns von einem schrecklichen Erlebnis berichtet. Wirkliches Verstehen, wirklicher Konsens kann 349 Es wäre eine interessante Untersuchung, diesen Gedankengang mit den fünf Momenten der Erkenntnis bei Platon zu vergleichen, wie er sie etwa im „Siebenten Brief“ beschreibt: Name, Begriff, Sinneswahrnehmung, geistige Erkenntnis, Idee; Platon: Siebenter Brief, in: ders.: Werke, Band 5, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990, Seite 415ff. Name, Begriff und Sinneswahrnehmung scheinen mir mit den Phasen 5, 4, 3 einfach in Verbindung zu bringen zu sein. Die geistige Erkenntnis, die Wesens-Erkenntnis, könnte man insofern mit Phase 2 in ein analoges Verhältnis setzen, als sich in dieser das „objektive Datum“ eines unabhängigen „Ding[es]-an-sich“ oder, mit Whitehead, ein „logisches Subjekt“ einstellt. Die Idee allerdings geht in eine völlig andere Richtung. Statt weiter zu sich selbst, zum erkennenden Individuum hin, führt sie Platon in das Reich der Ideen, mit der höchsten Idee des Schönen, Guten und Wahren. Weiter oben habe ich bereits meinem Verständnis Ausdruck verliehen, dass ich darin eine Teleologisierung und Hypostasierung der individuellen kreativen, adaptiven und kooperativen Verhaltensaspekte sehe (vgl. Seite 136f. dieser Arbeit). Warum ist Platon an dieser Stelle diesen Schritt in die Welt der Ideen gegangen? 152 nicht stets das letzte Ziel rationalen Handelns sein. Ich denke, dass man sich darauf verständigen kann. Ich möchte die von mir so genannte Phase 1 natürlich nicht als ein der Entstehung eines Lebewesens zeitlich vorausgehendes Moment verstehen, aber als eines, das von Anfang an jeder individuellen Ontogenese zugesprochen werden kann und das sich bis zu ihrem Ende hin durchhält. Das zweckfreie individuelle Interesse am Erleben ist das raumzeitlich nicht zu lokalisierende Zentrum jeder Ontogenese. Es ist keine Identität, sondern eine raumzeitlich sich prozesshaft ausdehnende Individualität.350 Und diese Individualität tritt uns etwa in der sinnlichen Wahrnehmung von Organismen deutlich entgegen. Die Phase 1 ist das individuelle, sich prozesshaft entwickelnde zweckfreie interessierte Erleben selbst. Ein solches verbindet sich in seiner Ontogenese mit den je individuellen, geschichtlich bedingten Gegebenheiten und Erlebnissen, verwächst mit diesen, kann im Falle eines Menschen sich von evaluativem zu kognitivem, zu reflexivem und diskursivem Verhalten ausbilden. 351 Die Zweckfreiheit des individuellen interessierten Erlebens bedeutet grundsätzliche die Freiheit, sich mit den unterschiedlichsten Gegebenheiten, Sachverhalten und Vorstellungen, mit verschiedenen Wertungs- und Ordnungsgewohnheiten sowie Wertungs- und Ordnungsgedanken und den mit alldem einhergehenden Wertpositionierungen zu verbinden. Individuell ist diese Freiheit durch die geschichtlichen Umstände bedingt, in denen sie sich verwirklicht. Doch die grund-legende Zweckfreiheit des individuellen Interesses kann nicht aufgehoben werden und ein Minimum an Freiheit bleibt so stets gewahrt. In dieser interessierten Freiheit stehen wir nun von Anfang unserer je individuellen Entwicklung an in den historischen Bedingungen unserer physischen und sozialen Umwelt und bemühen uns in dieser um den Erhalt unseres Erlebens. Wir entwickeln dabei weitere geschichtlich bedingte Interessen, suchen danach, diese zu verwirklichen, passen uns an und müssen unsere Interessen mit denen anderer koordinieren. So bemühen wir uns, unsere Interessen in ein befriedigendes Zusammenspiel mit unserer Umwelt zu bringen, 350 Anders als Hans Jonas, bin ich der Ansicht, dass man den Begriff der Identität auf Organismen nicht anwenden sollte. „Identität“ verstehe ich letztlich als die Eigenschaft, sich nicht zu verändern, so auch Jonas. Genau dies trifft auf einen Organismus nicht zu. Ein Organismus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein individueller Prozess, als ein solcher aber bedeutet er Veränderung. So schreibt denn auch Hans Jonas über das „Problem der Identität“: „Die organische Identität muß von ganz anderer Art sein“, etwa als die Identität eines sich nicht verändernden Teilchens; Jonas (1973), Seite 128ff. Ich würde hingegen sagen, dass es überhaupt kein Problem der Identität gibt, weil ein Organismus gar keine Identität hat oder ist, sondern eben eine Individualität. Man könnte höchstens von einer numerischen Identität sprechen. Aber auch darin sehe ich keinen Sinn. Ein individueller Prozess ist ein individueller Prozess und wird nicht in irgendeiner Weise mehr ein individueller Prozess dadurch, dass man ihm eine numerische Identität zuspricht. Die Individualität reicht dazu völlig aus. 351 Ich kann es hier nicht leisten, diese Gedanken mit entwicklungsphysiologischen und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen ins Verhältnis zu setzen, bin aber der Meinung, dass dies eine lohnende Arbeit wäre. 153 unser Interessiert-Sein und unsere Umwelt in ein adäquates Verhältnis zueinander zu setzen. Diese niemals abzuschließende Suche nach Adäquanz ist Vernunft, das individuell vernünftige, nie zu einem Abschluss kommende, seiner Wirklichkeit nach weder evaluativ noch kognitiv, noch reflexiv und damit auch diskursiv nicht einzuholende Verhalten interessierter, erlebender und freier Subjekte. Dass dabei für uns menschliche Wesen die Diskurse von enormer Bedeutung sind, und wir auf diese nicht verzichten können, ändert aus dieser Sicht nichts daran, dass sich Vernunft nicht in diesen und damit auch nicht im Konsens erschöpfen kann. Das diskursive Verhalten findet seinen Ausgangs- und Endpunkt in allen seinen Ausprägungen immer wieder neu in der individuellen Suche nach Adäquanz zur Umwelt und einem damit einhergehenden befriedigenden Erleben. Es ist nicht eine Alltags- oder Lebenswelt, sondern es sind die diese Alltags- oder Lebenswelt immer wieder neu formenden, nach einem befriedigenden Erleben suchenden Individuen, in denen die Diskurse ihren Grund haben, zusammenkommen und ihre Rationalität erhalten. Es erscheint mir dabei durchaus irrational, nicht an den Diskursen soweit als individuell möglich teilzunehmen, weil sie uns auf der Suche nach einem befriedigenden Erleben nicht gleichgültig sein können. Wir können in unserer grundsätzlichen, aber jeweils auch individuell bedingten Begrenztheit in unschätzbarem Maße von einem andauernden intersubjektiven Abgleich unserer Reflexionen profitieren. Aber die Diskurse als solche verbürgen nicht ihre eigene Rationalität, sondern bleiben an ein vor-diskursives, vor-reflexives und vor-kognitives evaluatives Verhalten, und darin an das zweckfreie individuelle Interesse an einem im Verhältnis zur Umwelt zu suchenden, befriedigenden Erleben zurückgebunden. Ich schließe mich damit einer oftmals gegen Habermas’ Theorie der Rationalität vorgebrachten Kritik an, dass die Vorstellung einer völligen inhaltlichen Trennung des ästhetischen, theoretischen und praktischen Diskurses nicht plausibel ist. Das gilt zum einen innerhalb der einzelnen Diskurse, die jeweils nie ganz auf die Aspekte der jeweils anderen Diskurse verzichten können. Dies erscheint mir allein schon deshalb unabwendbar so zu sein, weil in jeder Aussage, wie ich durch die fünfstufige Inversion von Prädikationen zu zeigen versucht habe, Werterlebnisse, physische Erlebnisse, Begriffserlebnisse, also praktische ästhetische und theoretische Erlebnisse stets ineinander verschlungen sind. Oder wie Hent de Vries es formuliert: „Denn die theoretischen, praktischen und ästhetisch-expressiven Äusserungen sind in den kontingenten Situationen, in denen sie vorgebracht werden, immer schon unaustilgbar miteinander verfilzt.“352 Dies führt dazu, dass wir uns auch im ästhetischen und theoretischen Diskurs immer wieder auf die Normen ihres Vollzuges einigen müssen. Auch im ästhetischen und praktischen Diskurs kommen wir nicht um bestimmte Objektivitätsannahmen herum. Schließlich sind auch der theoretische und der praktische Diskurs nicht ohne ästhetische Vorstellungen und 352 de Vries (1989), Seite 42. 154 Darstellungen zu haben. Die nicht vorhandene Plausibilität einer völligen inhaltlichen Trennung der drei Diskurse offenbart sich aber auch in der Frage nach ihrer Vermittlung. Was gewährleistet denn die Rationalität ihres Zusammenspiels, die ja nun nicht mehr erneut über einen der drei Rationalitätsaspekte gefasst werden könnte? „Gerade dieser Sachverhalt“, so schreibt Hent de Vries in Theologie im Pianissimo & Zwischen Rationalität und Dekonstruktion, „macht die Frage nach einer interdiskursiven ‚Urteilskraft‘ so wichtig.“353 Dem stimme ich völlig zu. De Vries bezieht sich in seinen sehr aufschlussreichen kritischen Ausführungen zu Habermas’ Rationalitätstheorie in diesem Zusammenhang unter anderem auf Martin Seel. „Laut Martin Seel ist Vernunft nicht gleichbedeutend mit Argumentierbarkeit, wie es Habermas’ Konzept vortäuscht. Vernunft steckt vielmehr in dem ‚Vermögen einer interrationalen Urteilskraft, die nicht selbst wieder als Form einer ausschreitenden Logik der Argumentation expliziert werden kann‘. Der vernünftige und kritische Charakter dieses Urteilsvermögens stehe und falle mit der Möglichkeit sich einen ‚überschreitenden Umgang mit dem immanenten anderen einer jeden Form der Rationalität‘ anzueignen.“354 An anderer Stelle hält er mit Verweis auf Herbert Schnädelbach zusammenfassend fest: „Die meisten der bis jetzt erörterten Überlegungen und Bedenken bestätigen die von Schnädelbach festgestellte ‚Unmöglichkeit, Rationalität vollständig in Prinzipien, Regeln oder Normen zu repräsentieren‘. Aus der Tatsache, dass Rationalität prinzipiell ein ‚offenes Konzept‘ ist, ergeben sich nach ihm unumgänglich die Einsicht in die Historizität der Vernunft und ein nicht entrinnbarer Restdezisionismus in der Ethik. Die Vernunft kann nie ausreichend expliziert werden, weil es eben ‚niemals zu einer in dem Sinne totalisierenden Rationalitätstheorie kommen (kann), dass es ihr möglich wäre, ihre externen Bedingungen vollständig zu internen zu machen.‘“ 355 Um dennoch der Rationalität im Diskurs nicht verlustig zu gehen, ergibt sich für de Vries daraus bereits die Konsequenz, nach einer „postklassische[n] metaphysische[n] Dimension der Exteriorität [Hervorhebung im Original; T. W.]“ zu suchen, worunter er ein negativ-metaphysisches ganz Anderes der endlichen Vernunft versteht, ein „Ab-solutes“, das sich uns entzieht und doch irgendwie auch nicht; etwas, das gedacht und doch wieder nicht gedacht werden kann; das gedacht wird im Sinne eines „sich jedem festen oder definitiven Bedeutungskontext Entringenden“; etwas, das nicht existiert, doch aber irgendwie auch nicht nicht existiert, ein „Tertium Datur“, das den onto-logischen Satz vom ausgeschlossenen oder zu vermeidenden Widerspruch hinter sich zu lassen vermag.356 353 Ebd., Seite 32. Ebd., Seite 46. 355 Ebd., Seite 52f. 356 Ebd., Seite 46.; vgl. ebd., Seite 1ff. 354 155 Ganz so schnell gehe ich nicht voran. Vor dem Hintergrund meiner vorangehenden Erörterungen folge ich vielmehr einer anderen Spur, die de Vries in seinem Text selbst ausgelegt, ohne ihr jedoch weiter nachzugehen. Wiederum in einem Verweis, dieses Mal auf den Religionsphilosophen Klaus-M. Kodalle, schreibt de Vries im Hinblick auf den moralischen Diskurs: „Kodalle knüpft an seine kritischen Bemerkungen den Vorwurf einer ‚Gleichschaltung symbolisch vermittelter nicht-identischer Gehalte‘. Habermas verkenne die (Bedingungen der) Möglichkeit von aus der Ordnung fallenden Diskurse, die einer ‚unbestimmte(n) Freiheit‘ zum Ausdruck verhelfen. Man sollte, so Kodalle, im Hinblick auf vor-reflexive, aber unabdingbar gültige Lebensformen die ‚Grenzen der Begründungsforderung des Universalisierungsimperativs der Moral‘ bedenken. Denn sowohl der Antrieb zu und das Verlangen nach Interaktion, als auch deren Qualität stammen nicht aus der universalistischen Vernunft selber. Sie sind auch zu fragil und zu einfach pervertierbar, als dass sie mit dem Mass des kommunikativen Handelns gemessen werden könnten.“357 Hierin sehe ich nun einen Verweis, der von der diskursiven Ebene letztlich bis auf das von mir oben dargestellte vor-diskursive, vor-reflexive, vor-kognitive und vor-evaluative zweckfreie individuelle Interesse am Erleben durchreicht. Denn genau in diesem sehe ich jene, wenn auch historisch bedingte, so doch unbestimmt bleibende Freiheit begründet, von der Kodalle spricht. Dieses zweckfreie individuelle Interesse am Erleben ist der grundlose Grund allen reflexhaften und kognitiven Werterlebens, aller reflexiven Bewertungen und Urteile sowie der aus diesen hervorgehenden Diskurse, auch der Grund unseres Antriebs und Verlangens nach Interaktion. Wenn Seel von dem „Vermögen einer interrationalen Urteilskraft“ spricht, bei dem es darum ginge, einen „überschreitenden Umgang mit dem immanenten anderen einer jeden Form der Rationalität [Hervorhebungen im Original; T. W.]“ zu entwickeln, so lohnt es sich meines Erachtens, in der Suche nach einem solchen Umgang dem zweckfreien individuellen Interesse am Erleben weiter nachzuspüren. Dann besteht das immanent andere der drei diskursiven Rationalitätsformen nicht allein in den jeweils anderen Rationalitätsformen, auch nicht allein in dem abstrakten Begriff einer zwischen diesen vermittelnden Urteilskraft. Denn diese Urteilskraft lässt sich dann weiter spezifizieren als eine aus dem vor-diskursiven, vor-reflexiven, vor-kognitiven und vor-evaluativen zweckfreien individuellen Interesse am Erleben entspringende, individuelle Fähigkeit zu einem adäquaten kreativem, adaptivem und kooperativem Verhalten. Das zweckfreie individuelle Interesse am Erleben ist zu seiner Verwirklichung in der Umwelt auf alle drei Verhaltensaspekte angewiesen und soweit es im Zentrum allen Verhaltens gehalten wird, auch dazu fähig, ein sich reflexhaft nach „oben“ bis zur reflexiven und diskursiven Ebene hin übersetzendes adäquates Zusammenspiel derselben in Richtung auf ein befriedigendes Leben zu bewirken. 357 Ebd., Seite 38. 156 Diese Fundierung der interrationalen Urteilskraft im zweckfreien individuellen Interesse am Erleben bedeutet mitnichten eine von Schnädelbach völlig zu Recht in Abrede gestellte „totalisierende Rationalitätstheorie“, die es vermag, ihre „externen Bedingungen vollständig zu internen zu machen“. Denn, wie gesagt, der Wirklichkeit nach ist das hier vorgeschlagene Verständnis von Vernunft als ein vernünftiges Verhalten interessierter, erlebender und freier Subjekte weder evaluativ noch kognitiv, noch reflexiv und damit auch diskursiv nicht einzuholen. Aber ich halte es auch in diesem Zusammenhang mit dem zu Beginn dieses Abschnitts gegebenen, bescheideneren adaequatio-Begriff, der darin liegt, dass eine für uns hinreichende Erkenntnis nicht in einer totalen Erkenntnis der Gegenstände liegen muss, in diesem Falle der Vernunft. Ich kann mich sehr gut mit dem Gedanken anfreunden, dass ein begründbarer Erkenntnisgehalt in einem Meer von Unerkanntem schwimmt. Und vielleicht kann er es gerade aus diesem Grund, weil er das Meer das Meer sein lässt, in dem er schwimmt. Und es scheint mir in diesem Sinne durchaus eine Möglichkeit zu bestehen, grundsätzliche Aspekte und Bedingungen vernünftigen Verhaltens zu benennen, die in gewissem Sinne nicht historisch aufzulösen sind und die These von der Historizität der Vernunft nur teilweise stützen. Diese These trifft zu, insofern Vernunft, d.h. vernünftiges Verhalten, die historische Existenz sich potentiell vernünftig verhaltender Subjekte voraussetzt. Diese These trifft ebenfalls insofern zu, dass die historischen Bedingungen, unter denen sich vernünftig verhaltende Subjekte um ein befriedigendes Erleben bemühen, stets einem evolutionärem Wandel unterliegen und dementsprechend ganz unterschiedliche Herausforderungen bereithalten und mitentscheidend dafür sind, was ein vernünftiges individuelles Verhalten konkret bedeutet. Wie auch der Begriff der Vernunft selbst historisch an die Bedingung der Entstehung von zu reflexivem und diskursivem Verhalten fähigen Subjekten geknüpft ist. Insofern bleibt auch der hier vorgeschlagene Vernunftbegriff ein „offenes Konzept“. Die These von der Historizität der Vernunft trifft jedoch, wenn man sich auf dieses „offene Konzept“ einlassen kann, nicht zu im Hinblick auf den Gehalt, der unter diesen Bedingungen begrifflich erfasst werden kann: Vernunft ist ein kreatives, adaptives und kooperatives Bemühen um ein nicht völlig beherrschbares, nicht abschließend zu erreichendes adäquates Zusammenspiel zwischen Subjekt und Umwelt, das mit einem befriedigenden Erleben einhergeht und sein Kraftzentrum in jedem individuellen zweckfreien Interesse am Erleben findet. Auch besteht so, zumindest an dieser Stelle der Diskussion, noch keine Notwendigkeit nach einer „postklassische[n] metaphysische[n] Dimension der Exteriorität [Hervorhebung im Original; T. W.]“ zu suchen. Denn das exterritoriale Andere der Vernunft, des individuellen vernünftigen Verhaltens, das ist zunächst einmal die physische und soziale Umwelt. Dadurch allein ist bereits jeder blanke Subjektivismus von vorn herein vereitelt. 157 Ich will mit all dem nicht sagen, dass ästhetischer, theoretischer und praktischer Diskurs ineinander aufzulösen seien, doch aber, dass sie, anders als Habermas es zumindest explizit zulassen will, sich nicht nur berühren und bereichern können, sondern, wenn sie auch unterschieden werden können, in ihrem Grunde nicht voneinander zu trennen sind; so wie auch die drei vor-reflexiven und vor-diskursiven Aspekte der Vernunft es nicht sind. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Der ästhetische, der theoretische und der moralische Diskurs sind Bereiche einer allgemeinen Diskursivität, die jeweils einen Hauptakzent auf einen der drei Vernunftaspekte legen, mag man sie nun Authentizität, Objektivität und Moral nennen oder, in der Betonung ihrer vor-reflexiven und vordiskursiven Grundlage, den kreativen Aspekt, den adaptiven Aspekt und den kooperativen Aspekt. Die Philosophie wäre dann jener Bereich der allgemeinen Diskursivität, in dessen Zentrum alle drei Vernunftaspekte zumindest annähernd gleich stark akzentuiert sein können, ohne dass sie deshalb zur Leitfigur der allgemeinen Diskusivität stilisiert werden sollte. Die Akzentuierungen in den drei Diskursen führt, wenn man so will, zu den drei intersubjektiv sich explizierenden Dialekten einer jeden individuellen Vernunft, ohne dass damit ein doppeldeutiger Verweis auf ein dialektisches Verhältnis derselben verbunden wäre. Sie können sich in ihrem Zusammenspiel durchaus nicht-dialektisch ergänzen. Und sie spielen nur dann nicht mehr zusammen, wenn aus der Akzentuierung ideologische Vereinseitigungen in Richtung eines Ästhetizismus, Objektivismus oder Moralismus werden. Die Philosophie wiederum spricht dann, um im Bild zu bleiben und sich nicht allzu weit von Habermas zu entfernen, weder einen ganz eigenen Dialekt noch schwingt sie sich zu einer Hochsprache auf, sondern kann in der gleichberechtigten Akzentuierung das Gemeinsame, die Verbindungen der Dialekte herausarbeiten, die wie in jeder Sprachverwandtschaft so auch in der „dreistrahligen“ Sprachverwandtschaft der vernünftigen Diskursivität zu finden sind. Die Philosophie ist in diesem Zusammenhang keine Meisterdisziplin und kein Metadiskurs, sondern eine Mittlerdisziplin und ein Mesodiskurs, auch wenn sie dabei durchaus von sich aus Themen zur Sprache und zum Vorschein bringen kann, die im Zuge auch nicht-ideologischer Vereinseitigungen aus dem Blickfeld der Diskurse geraten. So vermag sie der ideologischen Abkapselung der drei reflexiv-diskursiven Rationalitätsformen zumindest angebotsweise und immer wieder nur partiell entgegenzuarbeiten, damit das labile „Mobile“ des vernünftigen Verhaltens endlicher, natürlicher, geschichtlicher sowie interessierter, erlebender und freier, zur Reflexion und Diskursivität fähiger Subjekte sich nicht ineinander verhakt, sondern schwingen kann.358 358 Hier beziehe ich mich auf Habermas, der in Bezug auf die drei Rationalitätsformen von einem „Mobile, das sich hartnäckig verhakt hat“ spricht. Der Philosophie sollte es nach seinem Verständnis darum gehen, dieser Verhakung zu einem neuen Zusammenspiel zu verhelfen, vgl. Habermas (1983), Seite 26; vgl. de Vries (1989), Seite 30. 158 Die Übergänge zwischen Philosophie und den drei anderen Diskursbereichen sowie zwischen diesen selbst sind fließend und die Vermittlung ist nicht an professionelle Berufsbezeichnungen gebunden. Zudem bringt es das alltägliche Arbeiten, die Konzentration auf bestimmte Fragen mit sich, dass man nicht immer alle drei Aspekte gleich stark betonen kann, manchmal auch nur einen. Unsere Vernunft ist endlich. Und dennoch kann auch in der reflexiven Konzentration auf einen der drei Vernunftaspekte die Gleichberechtigung der beiden anderen implizit thematisch bleiben. Philosophieren heißt also nicht, sich im Zentrum der Philosophie zu wähnen, auch nicht die Abhängigkeit von den drei Aspekten zu leugnen, sondern nicht nur von einem und auch nicht bloß von zweien, sondern sich von allen drei Aspekten zugleich abhängig zu sehen, weil sie zu unserer je individuellen Natur gehören. Darin sehe ich, was man mit Karl Jaspers Worten als die „Unabhängigkeit des philosophierenden Menschen“ bezeichnen könnte. 359 Im Vollzug vernünftiger Reflexion können wir hier und dort, oder dort drüben, da vorn oder hier hinten einen Akzent legen, in einem Gedanken, in einer Diskussion, einem Brief, in einem Aufsatz, einem Buch oder einem gesamten beruflichen Leben. Egal wie kurz oder wie lang und an welchem genauen Ort unserer intersubjektiven Diskursivität, wer sich in Reflexion und Diskussion stets allen drei Aspekten verpflichtet weiß, der philosophiert und macht sich von einer starren Positionierung im Hinblick auf die drei Diskurse unabhängig. Und dies ist nicht so sehr ein Wissen, als vielmehr ein Tun. Vernunft ist ein Verhalten, hier stimme ich mit Habermas völlig überein, ist prozedural und an natürliche und geschichtliche Bedingungen geknüpft, ist ein Verhalten natürlicher Lebewesen. Befriedigung und moralische Norm Nachdem ich nun deutlich gemacht habe, was ich darunter verstehe, „daß wir endliche, zugleich natürliche und geschichtliche und im übrigen vernunftbegabte Wesen sind“, um es erneut mit Schnädelbachs Worten zu sagen, möchte ich nun wie angekündigt versuchen, aufzuzeigen, worin ich das angesprochene in unserer bedingten Natur liegende normative Faktum sehe, das es ermöglicht, über den Relativismus und jene negative Deontologie hinauszugelangen: Wolle niemals etwas, das zu verwirklichen dir unmöglich ist.360 Bernard Williams schreibt, „any ethical determinate outlook is going to represent some kind of specialization of human possibilities. That idea is deeply entrenched in any naturalistic, or, again, historical conception of human nature – that is, in any adequate conception of it – and I find it hard to believe it will be overcome by an objective inquiry, or that human beings could turn out to have a much more determinate nature than this suggested by what we already know, one that timelessly demanded a life of a particular kind.“361 Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass ich Williams darin Recht gebe, dass das „project of giving 359 Jaspers, Karl: Die Unabhängigkeit des philosophierenden Menschen, München: dtv, 1980. Schnädelbach (1993), Seite 23; vgl. Seite 121 dieser Arbeit. 361 Williams (1985), Seite 153. 360 159 to ethical life an objective and determinate grounding in considerations about human nature“ 362 nicht zu völlig neuartig erscheinenden Konsequenzen führen wird. Denn wenn das gesuchte normative Faktum in unserer Natur begründet liegt, dann ist zu erwarten, dass wir in irgendeiner Weise immer schon mit diesem zu tun haben und zumindest teilweise nach diesem unser Leben gestalten. Auch bin ich mit Williams der Meinung, dass mit dem gesuchten normativen Faktum nicht eine festgelegte Art eines Lebens verbunden ist, doch, so erscheint es mir, vielleicht eine Lebensart, wenn man darunter eine bestimmte Haltung versteht, mit der ein Leben geführt werden kann, aber nicht muss. Ich nenne dieses normative Faktum die moralische Norm. Hiermit komme ich schließlich auch zu meiner obigen Andeutung zurück, dass Kant mit der Suche nach einem „moralischen Gesetz“ vielleicht doch nicht grundsätzlich falsch lag. Es ist nur die Frage, was man anders darunter verstehen kann, damit es wirklich als ein „wahres Vernunftgebot“ verstanden werden kann.363 Ich verdanke für die folgenden Überlegungen Leonard Nelson wichtige Anregungen. Da ich mich jedoch in entscheidenden Aspekten von dem in seiner Kritik der praktischen Vernunft entwickelten Begriff des „Sittengesetzes“ entfernt habe, und ich hier keinen Vergleich desselben mit dem von mir vorgeschlagenen Begriff der moralischen Norm anstrebe, will ich es vornehmlich bei dieser Erwähnung belassen, halte ihn aber nach wie vor für einen sehr wichtigen, leider etwas in Vergessenheit geratenen „Gesprächspartner“.364 Schon in der Definition des für die moralische Diskussion so entscheidenden Pflichtbegriffes gehe ich einen anderen Weg als Nelson, der ähnlich wie auch Kant unter Pflicht eine „Handlung, sofern sie schlechthin geboten ist“, versteht.365 Ich möchte unter dem Pflichtbegriff keine moralische Pflicht verstehen, sondern eine natürliche Pflicht. Was das heißt, werde ich sogleich verdeutlichen. Die natürliche Pflicht leite ich ab aus der Konsequenzhaftigkeit natürlicher Existenz. Diese Konsequenzhaftigkeit, die nicht mit einem vollkommenen Determinismus verwechselt werden sollte, ist selber keine Konsequenz, sondern eine natürliche Bedingung unter der alles Geschehen in der Natur sich vollzieht. Und so haben auch wir für alles, was wir tun, die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen. Ob wir wollen oder nicht, wir sind den Konsequenzen unseres Tuns stets verpflichtet. Und das auch dann, wenn nicht im Vorhinein völlig determiniert und geklärt ist, was die Konsequenzen im Einzelnen sein werden, was unsere Verpflichtung im Einzelnen bedeuten wird. Jede Handlung birgt ein Wagnis in sich, eben eine „Pflicht“ der etymologischen Wurzel nach.366 Ohne Konsequenz kein Wagnis. Diese 362 Ebd. Vgl. Seite 98f. dieser Arbeit. 364 Nelson, Leonard: Kritik der praktischen Vernunft, in: ders.: Gesammelte Schriften in neun Bänden, Vierter Band, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972, Seite 126ff. 365 Ebd., Seite 82. 366 Vgl. Kluge, Friedrich: „Pflicht“, in: ders.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin: Walter de Gruyter, 2002, Seite 696. 363 160 Verpflichtung wird besonders in Konfliktfällen deutlich, wenn wir für das, was wir getan haben, von anderen verantwortlich gemacht werden oder uns selbst verantwortlich machen. Wir antworten, wägen Gründe für und gegen unser Tun ab. Dieses muss aber nicht erst im Nachhinein geschehen. Auch im Vorhinein einer bestimmten Handlungsmöglichkeit können wir abwägen, können nach Gründen für oder gegen eine Handlung suchen. Darin liegt Sorgfalt um unser Tun und das, was daraus erwächst – auch das eine etymologische Bedeutung von „Pflicht“.367 Ohne Konsequenz gäbe es nichts, worauf sich Sorgfalt beziehen könnte. Die Sorgfalt holt den möglichen Konflikt vor eine Handlung, versucht zu klären, was es zu tun oder zu unterlassen gilt. Die Frage ist: Was soll ich tun? – jene Frage, die mit Bernard Williams als Ausgangspunkt aller ethischen Auseinandersetzungen verstanden werden kann.368 Die im Abwägen liegende Sorgfalt ist selbst ein Tun, ein sorgfältiges Tun. Im Vorhinein handeln wir aus, was mögliche Konsequenzen eines Tuns sein könnten, im Nachhinein, was die Konsequenzen sind. Die Konsequenzhaftigkeit unseres Handelns macht uns haftbar, begründet unsere Verpflichtung. Dies gilt auch für die epistemische Praxis. Darauf hat unter anderem Robert Brandom in Making it explicit eindringlich hingewiesen.369 Wenn wir etwas „wahrnehmen“, bedeutet es genau das. Wir beziehen Stellung, sind haftbar für die mit unseren Wahrnehmungen verbundenen Konsequenzen. „Wahrnehmung“ darf dabei nicht allein im Sinne von Perzeption verstanden werden. Auf einer allgemeineren Ebene liegt die Bedeutung den etymologischen Wurzeln folgend in den Begriffen „wahren“ und „bewahren“, die über das Wort „wahr“ wiederum im semantischen Kontext von „Treue“, „Zustimmung“, „Verpflichtung“ und „Glaube“ stehen.370 Eine „Wahrnehmung“ bedeutet das Eingehen einer Verbindlichkeit, das sich über den Bereich der sinnlich akzentuierten Perzeption hinaus auch in logischen, mathematischen und metaphysischen Zusammenhängen einstellt. Diese „Wahrnehmung“ teile ich und teile sie hier mit. Dies führt zu der entscheidenden und nicht oft genug zu betonenden Konsequenz: Wenn Wahrnehmung nicht auf rein passive Rezeption reduziert werden kann, sondern bedeutet, dass wir Stellung beziehen und dass sie also zu einem nicht unerheblichen Anteil als ein (konstruktives) Tun zu verstehen ist, dann steht jede Wahrnehmung unter Vorbehalt. Dieser Vorbehalt gilt auch für begründete Wahrnehmungen. Denn begründen können wir wiederum nur durch Wahrnehmung von etwas, das wir in dieser Wahrnehmung als einen Grund annehmen. Diese Wahrnehmung kann aber wie jede andere auch willkürlich oder unwillkürlich in Frage gestellt werden. In der Begründung von Wahrnehmungen können wir stets nur auf Wahrnehmungen zurückgreifen, die zu begründen wir uns wiederum bemühen können, 367 Vgl. ebd. Vgl. Williams (1985), Seite 18. 369 Brandom, Robert B.: Making It Explicit, Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 1994. 370 Vgl. Kluge (2002), „wahren“, Seite 968; sowie „wahr“, ebd. 368 161 wobei wir erneut auf Wahrnehmungen zurückgreifen müssen. Begründungen bleiben deshalb potentiell problematisch, und so auch begründetes Handeln ein Wagnis. Das sollte uns nicht hindern, dieses Wagnis einzugehen. Denn, dass jegliche Wahrnehmung in Frage gestellt werden kann, heißt nicht auch schon, dass Wahrnehmungen grundsätzlich falsch sein müssen. Ob falsch oder nicht, unsere Wahrnehmungen von Gründen, die für oder gegen bestimmte Handlungen sprechen, beeinflussen unser Tun. Wenn ich etwas als eine Gefahr wahrnehme, so ist diese Wahrnehmung ein Grund für mich, mich so zu verhalten, dass ich mich vor dieser Gefahr schütze. Und dies gilt völlig unabhängig davon, ob das, was ich als Gefahr wahrnehme, tatsächlich auch eine Gefahr für mich ist. Für Subjekte, die diesen Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Tun reflektieren können, ja die sogar reflektieren können, dass Wahrnehmung selbst eine Form von Tun ist, bedeutet dies: Wenn meine subjektiven Wahrnehmungen mein Tun beeinflussen, meine Wahrnehmungen aber selbst ein Tun sind, dann scheint es auf die aus der sorgfältigen Pflicht erwachsende Frage, was ich tun soll, auf die Frage, was ich in einer Situation erstreben sollte, keine endgültige Antwort zu geben. Zum einen kann nicht endgültig geklärt werden, was denn überhaupt die Situation ist. Denn auch „die Situation“ ist ja stets eine subjektive Wahrnehmung einer Situation und also ein Tun, nichts, das einfach gegeben wäre. Auch wenn die Wahrnehmung einer Situation mit objektiven Sachverhalten zusammenhängen mag, so ist die Situation doch stets durch das die objektiven Sachverhalte wahrnehmende und modifizierende Subjekt mitbestimmt. Zum anderen wäre auch, eine so bestimmte Wahrnehmung einer Situation vorausgesetzt, die Vorstellung davon, was es in einer solchen Situation zu tun gilt, selbst wiederum eine Wahrnehmung. Als Wahrnehmung steht diese Vorstellung so selbst im Bann der Frage, auf die sie eine Antwort geben soll. Die Suche nach einer Antwort auf die Frage, was es zu tun gilt, kann in ihrer umfassenden, auch unser epistemisches Tun einschließenden Reflexion keiner Antwort näher gebracht werden. An diesem Punkt schlägt die Frage in eine Wahrnehmung um. Aus der Frage „Was soll ich tun?“ wird die Feststellung „Ich setze, was ich tun soll.“. Insofern in der umfassenden Reflexion das Sein des Subjektes selbst als Tätigkeit deutlich wird, kann man sogar sagen, dass das Subjekt sich als ein Subjekt wahrnimmt, das sich selbst sein „Gesetz“ ist, das sich selbst in seinem Handeln setzt. Diese Selbstwahrnehmung ist keine Wahrnehmung von etwas Gegebenen, es ist eine Selbstsetzung des Subjektes, das sich in dieser Wahrnehmung als ein Setzendes setzt. Es differenziert sich als Wahrgenommenes von sich selbst als Wahrnehmendem. Auch wenn dieser subjektiven Differenzierung keine objektive Differenz entspricht, dem Subjekt also kein Objekt gegenübersteht, das in irgendeiner Weise, als „truth-maker“ die Wahrheit dieses Gedankens begründen könnte, so scheint der Gedanke doch wahr zu sein. Denn Gedanke und gedanklicher Inhalt entsprechen sich. In dieser Entsprechung liegt die Evidenz des Gedankens. Es denkt und setzt sich in diesem 162 Denken als sich selbst durch das Denken setzend. Es denkt, was es tut, und tut, was es denkt. Das Denken denkt sich selbst. Es ist die in das Subjekt zurückgeholte aristotelische Gottheit.371 Aber im Unterschied zu jener ist dieses Sich-selbst-Denken des Denkens alles andere als selbstgenügsam und vollkommen. Es bleibt existentiell auf anderes und andere angewiesen. Es gibt keine Reflexion ohne ihre Körperlichkeit oder, um an die phänomenologische Begrifflichkeit anzuschließen, ohne ihre Leiblichkeit samt der mit dieser verbundenen Bedürfnisse. Das Sich-selbst-Denken des Denkens ist „bloß“ ein Pars pro Toto des denkenden Organismus, einer erlebenden körperlich-geistigen Individualität. Es gibt kein Denken, das in seinem Sich-selbst-Denken nicht jäh aus dem Gedanken gerissen würde, um sich auf Bedürfnisbefriedigungen zu konzentrieren. Bedürfnisse gibt es verschiedene, die Wege zu ihrer Befriedigung sind mannigfaltig, die mit diesen verbundenen Konsequenzen unabsehbar. Diese Unabsehbarkeit ist wiederum der Hintergrund, vor dem das Bedürfnis nach Orientierung immer wieder neu entfacht wird, die Frage „Was soll ich tun?“ stets virulent ist. Nun wurde aber deutlich, dass in der subjektiven Reflexion dieser Frage keine definitive Antwort gefunden werden kann, da jede Reflexion zum einen selbst ein Tun ist, zum anderen auf Wahrnehmungen zurückgreifen muss, für die eben das gleiche gilt. Die Reflexion führt an einen Punkt, an dem Wahrnehmungen und die auf diese fußenden Reflexionen als ein Tun des Subjektes, das Subjekt selbst als ein Tun erscheint, als ein sich durch sein Tun Setzendes. Insofern das Subjekt ein Tun ist, kann es aus sich selbst keine Antwort auf die Frage schöpfen, was es tun soll. Es kann dieses und jenes tun. Aber es kann sich selbst nicht reflexiv beantworten, ob es dieses und jenes tun soll. Das Subjekt kann das Bedürfnis nach der Orientierung seines Tuns, wie andere Bedürfnisse auch, nicht aus sich selbst befriedigen bzw. es kann dies nur insoweit, als es sich selbst dazu entscheidet, etwas Bestimmtes zu tun, und damit ein auch durch Sorgfalt nicht aufzulösendes Wagnis eingeht. Es wird sich zeigen, was die Konsequenzen sein werden, was seine Pflicht bedeuten wird. Was in dieser Reflexion wiederum aufscheint, ist der ethische Restdezisionismus, von dem im vorhergehenden Abschnitt mit Schnädelbach die Rede war, jene unbestimmte Freiheit von der Kodalle geredet hat, die sich in all unserem Tun stets ihre Bahn brechen muss, weil wir diese Freiheit jeweils selbst sind, jenes zweckfreie individuelle Interesse am Erleben.372 Es gibt keinen Zweck, den wir reflexiv erfassen könnten und der uns eindeutig bestimmen ließe, was wir tun sollen. Wir können unsere Natur als zweckfrei interessierte, erlebende und freie Subjekte in der Reflexion nicht hinter uns lassen, sondern sie in einer solchen immer nur wieder aufs Neue erkennen. Wir kommen in der Reflexion zu keinem Punkt, an dem wir unserer Zweckfreiheit plötzlich beraubt wären und durch unser Denken 371 372 Vgl. Seite 63f. dieser Arbeit. Vgl. Seite 148f. dieser Arbeit. 163 ein vorgegebener Zweck uns bloß noch dazwischen entscheiden ließe, ob wir diesem entsprechen wollen oder nicht. Der einzige „Zweck“, so habe ich deutlich gemacht, liegt in dem Wert unseres Daseins und Erlebens, den dieses für uns durch uns hat und den es zu leben und zu erleben gilt. Dieser „Zweck“ aber gibt uns nicht vor, wie er zu leben sei, denn wir sind dieser „Zweck“, dieser Wert jeweils selbst. Wir können noch so viele Gründe haben, etwas Bestimmtes zu tun oder zu behaupten, dem so zu Tuenden oder zu Behauptenden einen Wert beizumessen, indem wir es tun und behaupten. Doch dadurch wird uns nicht die Freiheit genommen, dieses wiederum in Frage zu stellen oder einfach etwas anderes zu tun oder zu behaupten. Dass diese Freiheit durchaus in ein unbefriedigendes Leben führen kann, weil unsere zweckfreie Natur nicht bedingungslos ist, ist eine andere Sache. Dem Subjekt jedenfalls bleibt in seiner Freiheit nichts anderes, als diejenigen Interessen und Ziele zu verfolgen, die im Hinblick auf ein befriedigendes Leben in Adäquanz mit der physischen und sozialen Umwelt am meisten Erfolg zu versprechen scheinen. Damit aber zeigt sich, dass die Reflexion uns diesbezüglich nicht klüger macht, als andere Lebewesen auch. Ein Sollen in diesem Sinne lässt sich aus Reflexion allein nicht gewinnen, damit aber auch keine Moral oder so etwas wie eine Pflicht gegen sich selbst – es wäre auch die Frage, ob so etwas überhaupt „klug“ genannt werden könnte. Mit Blick auf Kant könnte man sagen, es gibt keine reine praktische Vernunft. An Kants Überzeugung hingegen, dass am Ende alles vernünftige Verhalten praktisch ist, kann man sehr wohl festhalten.373 Moral wird erst in intersubjektiver Reziprozität thematisch. Hier bin ich wiederum sehr nah bei Nelson und auch bei Williams, auch wenn letzterer es vorziehen würde, allein von Ethik zu sprechen.374 Und nur insoweit wir in Gesellschaft leben, haben wir immer schon notwendigerweise mit moralischen Fragen zu tun. Aber es ist ja durchaus denkbar, dass sich ein Mensch dazu entschließt, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen und ein einsames Leben in der Natur zu führen. Daran ist erstens nichts moralisch Verwerfliches zu finden und zweitens haben in dem Moment, in dem er für sich alleine lebt, zumindest Fragen zwischenmenschlicher Moral für ihn keine Relevanz mehr. 375 Er wird sich nach wie vor ethische Fragen stellen können und darüber nachdenken, was für ihn zu einem befriedigenden Leben gehört, kann dementsprechend sein Leben versuchen einzurichten. Und vielleicht kommt er in diesem Nachdenken ja irgendeines Tages zu dem Entschluss, wieder in Gesellschaft zurückkehren zu wollen. Dann aber wird aus seinem ethischen Interesse notwendig ein moralisches werden. Was verstehe ich nun genauer unter diesem moralischen Interesse und worin liegt es begründet? 373 Vgl. Kant, KpV, Seite 249ff. Vgl. Nelson (1972), Seite 137; vgl. Williams (1985), Seite 182. Williams behält den Ausdruck „Moral“ allein für die Pflichtenethik. Vgl. ebd., Seite 174ff. 375 Auch gegenüber nicht-menschlichen Lebewesen ist moralisches Verhalten möglich. Ich will mich im Folgenden aber auf die zwischenmenschliche Moral konzentrieren. Vgl. Nelson (1972), Seite 166ff. 374 164 Beginnen wir mit der letzten Frage. Die vorhergehenden Reflexionen haben uns erneut an einen Punkt geführt, an dem wir uns in unserer Natur als zweckfreies Interesse am Erleben erkennen können. In diesem messen wir unserem Tun, welcher Art auch immer, einen Wert bei. Dies allein dadurch, dass wir als der Wert, der wir für uns selbst jeweils sind, tun, was wir tun. Wir legen in unserem Tun unseren Wert unausweichlich in dieses Tun. Diese individuelle Wertsetzung, die unser Leben bedeutet, gilt für alle interessierten, erlebenden und freien Subjekte. Nun kann man aus diesem Zusammenhang Schlüsse ziehen, die sich zu etwas verdichten lassen, was ich als Ethik der Natur oder natürliche Ethik bezeichnen will. Das individuelle Leben und Erleben ist nicht einfach gegeben, sondern muss durch eine Gestaltung der Umwelt stets neu errungen werden. Schon die Homöostase des Organismus bedeutet ein Gefügig-Machen der Umwelt, indem die Stoffe der Umwelt dem Existenzinteresse des Subjektes entsprechend aufbereitet, genutzt und ausgeschieden werden. Jedes individuelle Tun bedeutet ein interessiertes Gefügig-Machen der Umwelt, das zugleich mit einer Wertsetzung verbunden ist. Natürlich wird ein so tätiges Subjekt da, wo es auf unabänderliche Bedingungen stößt, nicht umhinkommen, sich selbst diesen Bedingungen anzupassen, wenn es darum geht, ein befriedigendes Leben zu verwirklichen. Aber in allen anderen Zusammenhängen ist mit seinem Interesse zunächst unauflöslich das Interesse verbunden, sich die Umwelt gefügig, seinem Interesse adäquat zu machen. Das gilt auch im Zusammenspiel mit anderen interessierten Subjekten, auf die es in seiner Umwelt trifft. Soweit sich die Interessen nicht widersprechen, liegt hierin kein Problem. Erst angesichts eines gegebenenfalls auftretenden Widerspruches lässt sich wiederum ein immanentes Interesse ausmachen, sich diese anderen Subjekte gefügig zu machen und nur, wo dies nicht möglich ist, ist andersherum das Subjekt selbst gezwungen, sein eigenes Interesse anzupassen. Was sich hier als Bild der natürlichen Ethik auftut, scheint eines des bloßen Spieles der Macht zu sein. Wer die Macht hat, der regiert, wenn auch lokal und bedingt, das Geschehen. Man könnte dieses Spiel mit den naturphilosophischen Überlegungen aus Friedrich Nietzsches Nachlass vergleichen: „Ich hüte mich, von chemischen ‚Gesetzen‘ zu sprechen: das hat einen moralischen Beigeschmack. Es handelt sich vielmehr um eine absolute Feststellung von Machtverhältnissen: das Stärkere wird über das Schwächere Herr, so weit dies eben seinen Grad Selbstständigkeit nicht durchsetzen kann, – hier giebt es kein Erbarmen, keine Schonung, noch weniger eine Achtung vor ,Gesetzen‘! [...] Es gibt kein Gesetz: jede Macht zieht in jedem Augenblick ihre letzte Consequenz [Hervorhebung im Original; T. W.].“376 Dies ist meines Erachtens aber nur die halbe Wahrheit. Und auch Nietzsche bleibt dabei 376 Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente – Herbst 1884 bis Herbst 1885, in: ders.: Nietzsche Werke, VII3, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1974, 36[18], Seite 283; ders.: Nachgelassene Fragmente – Anfang 1888 bis Frühjahr 1889, in: ders.: Nietzsche Werke, VIII3, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1972, 14[79], Seite 50. 165 nicht stehen. Im Folgenden will ich mich nun über Nietzsche allmählich der Formulierung des moralischen Interesses und schließlich auch der moralischen Norm annähern. Evolutionstheoretische Gedanken, wie sie auch in dieser Arbeit vorgebracht wurden, parodierend schrieb er in Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben: „So weit flog die Geschichtsbetrachtung noch nie, selbst nicht, wenn sie träumte; denn jetzt ist die Menschengeschichte nur die Fortsetzung der Tier- und Pflanzengeschichte; ja in den untersten Tiefen des Meeres findet der historische Universalist noch die Spuren seiner selbst, als lebenden Schleim; den ungeheuren Weg, den der Mensch bereits durchlaufen hat, wie ein Wunder anstaunend, schwindelt dem Blicke vor dem noch erstaunlicheren Wunder, vor dem modernen Menschen selbst, der diesen Weg zu übersehen vermag. Er steht hoch und stolz auf der Pyramide des Weltprozesses; indem er oben darauf den Schlußstein seiner Erkenntnis legt, scheint er der horchenden Natur rings umher zuzurufen: ‚wir sind am Ziele, wir sind das Ziel, wir sind die vollendete Natur.‘ Überstolzer Europäer des neunzehnten Jahrhunderts, du rasest! Dein Wissen vollendet nicht die Natur, sondern tötet nur deine eigne. Miß nur einmal deine Höhe als Wissender an deiner Tiefe als Könnender. Freilich kletterst du an den Sonnenstrahlen des Wissens aufwärts zum Himmel, aber auch abwärts zum Chaos. Deine Art zu gehen, nämlich als Wissender zu klettern, ist dein Verhängnis; Grund und Boden weicht ins Ungewisse für dich zurück; für dein Leben gibt es keine Stützen mehr, nur noch Spinnefäden, die jeder neue Griff deiner Erkenntnis auseinanderreißt. – Doch darüber kein ernstes Wort mehr, da es möglich ist, ein heiteres zu sagen.“377 Nietzsche wendet sich mit diesen Sätzen gegen jenen, wie er sagt, Zynismus seiner Zeit, der die „Jugendhoffnungen und Jugendkräfte“ der Menschen erstickt, die der „Grund und Boden“ sind, aus dem überhaupt so etwas wie Kultur entstehen und, sich erneuernd, lebendig bleiben kann. Die Moderne wähnt sich in ihrem Wissen auf dem Gipfelpunkt aller kulturellen Leistungen und merkt nicht, wie sie sich dabei selbst zerstört, in dem sich der Mensch in seinem vermeintlichen Wissen in einem „Weltprozeß“ selbst untergehen lässt. Die Kritik gilt zum einen der hegelschen Metaphysik, aber auch, wie im Zitat deutlich geworden, dem metaphysisch-antimetaphysischen Dogma des Darwinismus; den Marxismus kann man hier ebenfalls einreihen. „In das Wohlgefühl eines derartigen Zynismus flüchtet sich der, welcher es nicht in der Ironie aushalten kann; ihm bietet überdies das letzte Jahrzehnt eine seiner schönsten Erfindungen zum Geschenke an, eine gerundete und volle Phrase für jenen Zynismus: sie nennt seine Art, zeitgemäß und ganz und gar unbedenklich zu leben, ‚die volle Hingabe der Persönlichkeit an den Weltprozeß‘. Die Persönlichkeit und der Weltprozeß! Der Weltprozeß und die Persönlichkeit des Erdflohs! Wenn man nur nicht ewig die Hyperbel aller Hyperbeln, das Wort: Welt, Welt, Welt hören müßte, da doch jeder, ehrlicherweise, nur von Mensch, Mensch, Mensch reden 377 Nietzsche, Friedrich: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, in: ders.: Unzeitgemässe Betrachtungen, Zweites Stück, in: ders.: Nietzsche Werke, III1, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1972, Seite 308f. 166 sollte! Erben der Griechen und Römer? des Christentums? Das scheint alles jenen Zynikern nichts; aber Erben des Weltprozesses! Spitzen und Zielscheiben des Weltprozesses! Sinn und Lösung aller Werde-Rätsel überhaupt, ausgedrückt im modernen Menschen, der reifsten Frucht am Baume der Erkenntnis! – das nenne ich ein schwellendes Hochgefühl; an diesem Wahrzeichen sind die Erstlinge aller Zeiten zu erkennen, ob sie auch gleich zuletzt gekommen sind.“378 In seiner Anspielung auf die Griechen, Römer und Christen steckt zum einen der Hinweis und die Warnung, dass auch schon andere Kulturen, die sich als Spitze aller kulturellen Entwicklung verstanden, von der Geschichte eines Besseren belehrt wurden; zum anderen aber auch Nietzsches latentes Festhalten an der Metaphysik, der es ihm zufolge aber, anders als dies die antiken sowie christlichen Denker und auch Hegel wahrhaben wollten, nur mit einem ironischen Wissen zu begegnen gilt.379 Das ironische Wissen kann man vielleicht beschreiben als aus einem notwendigen metaphysischen Denkbezug quellende Reflexionen, die, sobald sie in gesichertes „Wissen“ zu gerinnen beginnen, durch Ironie wieder verflüssigt werden müssen, weil sie sonst dem, was aus ihnen wiederum quellen soll, nicht mehr gerecht werden können: dem menschlichen Leben. Ironie aber ist keine Kultur, kein System, kein Wissen, kein Sein, sondern eine individuelle Tätigkeit und ein Umgang des reflektierenden Menschen mit sich selbst. Der wirkliche Mensch ist für Nietzsche diejenige individuelle Kraft, die sich nicht nur gegen das Ist der Natur, sondern auch das Ist der Kultur stemmt, und gegen das Ist seines eigenen Charakters, um die Lebendigkeit nicht zu verlieren. Das ist Nietzsches „Wille zur Macht, – der unerschöpfte zeugende Lebens-Wille.“ 380 „Denn rede man von welcher Tugend man wolle, von der Gerechtigkeit, Großmut, Tapferkeit, von der Weisheit und dem Mitleid des Menschen – überall ist er dadurch tugendhaft, daß er sich gegen jene blinde Macht der Fakta, gegen die Tyrannei des Wirklichen empört und sich Gesetzen unterwirft, die nicht die Gesetze jener Geschichtsfluktuationen sind. Er schwimmt immer gegen die geschichtlichen Wellen, sei es, daß er seine Leidenschaften als die nächste dumme Tatsächlichkeit seiner Existenz bekämpft oder daß er sich zur Ehrlichkeit verpflichtet, während die Lüge rings um ihn herum ihre glitzernden Netze spinnt. Wäre die Geschichte überhaupt nichts weiter als ‚das Weltsystem von Leidenschaft und Irrtum‘, so würde der Mensch so in ihr lesen müssen, wie Goethe den Werther zu lesen riet: gleich als ob sie riefe, ‚sei ein Mann und folge mir nicht nach!‘ Glücklicherweise bewahrt sie aber auch das Gedächtnis an die großen Kämpfer gegen die Geschichte, das heißt gegen die blinde Macht des Wirklichen, und stellt sich dadurch selbst an den Pranger, daß sie jene 378 Ebd., Seite 308. Vgl. Zachriat (2001), Seite 144ff. 380 Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra, in: ders.: Nietzsche Werke, VI1, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1968, Seite 143. 379 167 gerade als die eigentlich historischen Naturen heraushebt, die sich um das ‚so ist es‘ wenig kümmerten, um vielmehr mit heiterem Stolze einem ‚so soll es sein‘ zu folgen. Nicht ihr Geschlecht zu Grabe zu tragen, sondern ein neues Geschlecht zu begründen – das treibt sie unablässig vorwärts: und wenn sie selbst als Spätlinge geboren werden – es gibt eine Art zu leben, dies vergessen zu machen – die kommenden Geschlechter werden sie nur als Erstlinge kennen.“381 Um was es Nietzsche hier geht, ist das Gegenteil eines Sich-Überlassens an ein bloß schicksalhaftes Spiel der Mächte. Wolf Gorch Zachriat hat dies in seiner Arbeit Ambivalenz des Fortschritts – Friedrich Nietzsches Kulturkritik nachvollziehbar herausgearbeitet. 382 In der Betonung individueller „Selbstüberwindung“ in einem „experimentell-geistigen Fortschreiten“ sieht Nietzsche „die Morgenröthe eines kulturellen Fortschritts“ aufgehen, in dem nicht mehr blinder Machtwille vorherrscht, sondern eine moderne Aristokratie von freien Geistern.383 „Selbstständige und vorsichtige Haltung der Erkenntnis schätzt man beinahe als eine Art Verrücktheit ab, der Freigeist ist in Verruf gebracht, namentlich durch Gelehrte, welche an seiner Kunst, die Dinge zu betrachten, ihre Gründlichkeit und ihren Ameisenfleiss vermissen und ihn gern in einen einzelnen Winkel der Wissenschaft bannen möchten: während er die ganz andere und höhere Aufgabe hat, von einem einsamen Standorte aus den ganzen Heerbann der wissenschaftlichen und gelehrten Menschen zu befehlen und ihnen die Wege und Ziele der Kultur zu zeigen.“384 Was Nietzsche hier vorschwebt, ist eine freigeistige Elite, deren Mitglieder „im Zwiegespräch“ untereinander jeweils immer wieder neu „ermitteln“ und „bestimmen“, welchen Weg die Kultur einzuschlagen habe, die „den Gang der Kultur maßgeblich bestimmen, d.h. das vielfältige Machtstreben auf zumindest temporär sinnvolle Ziele ausrichten.“ 385 Dabei wird das Machtstreben der Freigeister untereinander durch die „Beachtung der Rangordnung des Machtstrebens [...], die nach dem Vermögen der Mächte bemessen wird, das Widerstrebende sinnvoll zu interpretieren und zu einigen“ entschieden.386 Die Kultur, die Gesellschaft, brauche diese interpretierende Tätigkeit der Freigeister. Sie geben der Kultur den historischen Horizont vor, „eine Linie“, ohne die sie sich im „Unaufhellbaren Dunkeln“ des geschichtlichen Prozesses verlieren würde. „Und dies ist ein allgemeines Gesetz: jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar werden; ist es unvermögend einen Horizont um sich zu ziehen und zu 381 Nietzsche Nutzen und Nachteil der Historie (1972), Seite 307. Zachriat (2001). 383 Die zitierten Ausdrücke habe ich den Überschriften der Kapitel III.4.2, IV.4.3, IV.4.4 entnommen; vgl. Zachriat (2001), ebd., Inhaltverzeichnis, Seite 8f. 384 Nietzsche, Friedrich: Menschliches, Allzumenschliches – Erster Band, in: ders.: Nietzsche Werke, IV2, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1967, Seite 235. 385 Vgl. Zachriat (2001), Seite 188. 386 Ebd., Seite 188. 382 168 selbstisch wiederum, innerhalb eines fremden den eigenen Blick einzuschliessen, so siecht es matt und überhastet zu zeitigem Untergange dahin. Die Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe That, das Vertrauen auf das Kommende – alles das hängt, bei dem Einzelnen wie bei dem Volke, davon ab, dass es eine Linie gibt, die das Uebersehbare, Helle von dem Unaufhellbaren Dunkeln scheidet [...]“387 So wäre für Nietzsche ein Fortschritt zumindest denkbar. „Aber die Menschen können mit Bewusstsein beschliessen, sich zu einer neuen Cultur fortzuentwickeln, während sie sich früher unbewusst und zufällig entwickelten: sie können jetzt bessere Bedingungen für die Entstehung der Menschen, ihre Ernährung, Erziehung, Unterrichtung schaffen, die Erde als Ganzes ökonomisch verwalten, die Kräfte der Menschen überhaupt gegeneinander abwägen und einsetzen. Diese neue bewusste Cultur tödtet die alte [...]; sie tödtet auch das Misstrauen gegen den Fortschritt, – er ist möglich.“388 Wie Zachriat betont, geht es Nietzsche bei der freigeistigen Aristokratie und ihrem „Willen zur Macht“ nicht um tyrannische Machtgier. Sondern es „soll sich das Machtstreben der künftigen Aristokraten durch das Vermögen des geistreichen Interpretierens auszeichnen, daß die eigene Position und die widerstrebenden Mächte hinsichtlich der Realisierungschancen vorsichtig abtastet und sich bemüht, ihnen jeweils gerecht zu werden. Dank dieses Vermögens soll es den vornehmen Individuen der Zukunft möglich sein, die fremden und die eigenen Grenzen zu erkennen und ihresgleichen zu respektieren. In einem Kurztext mit der Überschrift Meine Utopie wird zudem die Leidensfähigkeit der Individuen als das Maß einer besseren gesellschaftlichen Ordnung bestimmt. Entgegen den bisher bekannten Aristokratien soll sich demnach der Rang in der künftigen Gesellschaft auch nach der feinfühligen Empfindsamkeit des Einzelnen richten.“389 Und genau hier, hinsichtlich des Vermögens des vorsichtigen Abtastens, des GerechtWerdens, des Erkennens der eigenen und fremden Grenzen, des gegenseitigen Respektierens, hinsichtlich der Leidensfähigkeit, der Feinfühligkeit und der Empfindsamkeit lohnt es sich, noch einmal genauer hinzuhören und nachzufragen. Denn diese Vermögen und Fähigkeiten sind bei dem sonst so wortgewaltigen Nietzsche offenbar das leise, fast unmerklich pochende Herz eines möglichen Fortschritts, das sich gegen „eine absolute Feststellung von Machtverhältnissen“ stemmt, dagegen, dass „jede Macht [...] in jedem Augenblick ihre letzte Consequenz“ zieht.390 Das sind ganz andere Töne als der Ruf nach seinem Übermenschen: „Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Mann muss schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne unrein zu werden. Seht, ich lehre Euch den Übermenschen: der ist dieses Meer, in ihm kann Eure große Verachtung untergehen.“ 391 In dem peitschenden Wellenschlag 387 Nietzsche Vom Nutzen und Nachteil der Historie (1972), Seite 247f. Nietzsche Menschliches, Allzumenschliches – Erster Band (1967), Seite 41. 389 Zachriat (2001), Seite 190. 390 Nietzsche Nachgelassene Fragmente – Anfang 1888 bis Frühjahr 1889 (1972), Seite 50. 391 Nietzsche Zarathustra (1968), Seite 9. 388 169 seiner Polemik hätte es Nietzsche sicher nicht geschadet, in seinem Übermenschen dem von ihm verachteten „historische[n] Universalist[en]“ einmal bis zu der Stille in die „untersten Tiefen des Meeres“ zu folgen, bis zu jenem am Grunde „lebenden Schleim“, und sich zu wundern, dass auch dort unten, in den für den Menschen unwirtlichen Tiefen Leben herrscht und nicht nur lebloser Stoff. Mit etwas Feinfühligkeit hätte er dann vielleicht erkennen und zugestehen können, dass es nicht abwegig ist, anzunehmen, dass auch die Organismen in diesem Schleim „einen tanzenden Stern gebären“ können.392 Es geht nicht darum, in diesen die Spuren unserer selbst erblicken zu wollen, dennoch aber können sie uns etwas bedeuten. Denn was bedeutet es, wenn auch diese einfachen Lebewesen ein zweckfreies Interesse am individuellen Erleben haben, sie sich, wenn auch unreflektiert, ein Wert sind? Wenn wir uns „der Natur“ auf diese Weise nähern, dann kann in dem Bild der natürlichen Ethik etwas anderes sichtbar werden als bloß „eine absolute Feststellung von Machtverhältnissen“. Denn dann kann schon in diesem einfachen Leben das als grundlegend angelegt gesehen werden, was uns Menschen als aus unserer diskursiven Reflexivität erwachsend in der Geschichte von Religion, Kunst und Moral und auch der Wissenschaft begegnet. In dieser drückt sich die aus einem vorgängigen Leben selbsttranszendierender, zweckfrei am eigenen Erleben interessierter Individuen, drückt sich die aus zweckfreier Werthaftigkeit hervorgehende kreative, adaptive und kooperative Suche nach einem befriedigenden Leben aus. Sicherlich ist diese Geschichte durchdrungen von grausamen Machtspielen, von Leidenschaft und Irrtum. Aber dies ist eben nicht alles. Es gibt auch noch eine andere Seite, die sich merklich Gehör verschaffen will. Auch die einfachsten Lebewesen unterliegen nicht einer „blinde[n] Macht der Fakta“, sind Tatsachen auch in dem Sinne, dass sie ihrem eigenen zweckfreien Interesse, das sie selbst je sind, in der Wirklichkeit tätig Ausdruck verleihen; die, wie bedingt und eingeschränkt auch immer, die Wirklichkeit dem Gesetz ihres eigenen zweckfreien Interesses unterwerfen. Dieser Wille, wohnt schon dem noch so Kleinen inne, der „Wille zur Macht, – der unerschöpfte zeugende Lebens-Wille.“393 Kein Leben, kein interessiertes Verhalten ist absolut festgestellt, sondern bedeutet stets auch Selbstbestimmung. Wie wäre die Evolution, gerade auch in ihrer menschlichkulturellen Verlängerung, sonst überhaupt denkbar? Und so erscheint es alles andere als unnatürlich, dass in der evolutionären Weitergabe und -entwicklung der Lebensformen aus dem grund-legenden zweckfreien individuellen Interesse am Erleben, das sich seiner eigenen lebendigen Macht und der anderer zunächst reflexhaft, dann reflexiv bewusst wird, ein Interesse entsteht, dass im Falle intersubjektiver Widersprüche die anderen, so sie aufgrund ihrer Natur und Existenz dazu fähig sind, ihre Macht dazu nutzen, sich dem 392 393 Ebd., Seite 13. Ebd., Seite 143. 170 individuellen Interesse aus sich heraus anzupassen; es entsteht das Interesse, dass diese anderen aus der in ihrer natürlichen Existenz gründenden Freiheit heraus sich dem individuellen Interesse zuwenden. Dieses Interesse ist letztlich aber nicht in Reflexionen oder in vorreflexiver Reflexhaftigkeit fundiert. Vielmehr wird es sich anders herum im Zuge der Entwicklung reflexhaft in Reflexionen seinen Ausdruck verliehen haben und weiterhin verleihen. Es gründet allein in der grund-legenden Natur eines um Verwirklichung seiner Interessen bemühten je individuellen Erlebens. Eher noch, als die Kraft darein zu investieren, andere dem eigenen Interesse gefügig zu machen, und dadurch vom primären Interesse zunächst oder potentiell ganz abgehalten zu werden, entsteht im Falle eines Widerspruchs das Interesse, dass die anderen, so sie in der Lage dazu sind, sich aus sich selbst heraus anpassen mögen. Sie sollen, wenn möglich, in ihrer Freiheit dem ihrem eigenen Interesse widersprechenden Interesse entsprechen. Genau ein solches Verhalten aber, ein freies Anpassen an ein dem eigenen Interesse widersprechendes anderes Interesse, verstehe ich als moralisches Verhalten. Für diesen Begriff moralischen Verhaltens braucht es kein Gesetz der reinen Vernunft, keinen kategorischen Imperativ. Es braucht allein zwei aufeinander treffende interessierte, erlebende und freie Subjekte, von denen mindestens eines seiner Existenz nach in der Lage ist, sich dem seinem eigenen Interesse widersprechenden Interesse anzupassen, was auch immer die Interessen im Konkreten sein mögen. Wohin uns dieser Gedankengang führt, ist eine Wirklichkeit, in der interessierte, erlebende und freie Subjekte aus ihrer natürlichen Existenz heraus ein immanentes Interesse daran entwickeln, dass die jeweils anderen Subjekte, auf die sie in ihrer Umwelt treffen und so deren natürliche Existenz dies zulässt, ihrerseits ein Interesse entwickeln, aus ihrer Freiheit heraus sich im Falle eines Widerspruches dem anderen individuellen Interesse anzupassen. Das aber heißt nichts anderes, als dass jedes einzelne dieser Subjekte ein Interesse daran hat, dass die jeweils anderen Subjekte ein moralisches Interesse entwickeln. So eröffnet sich uns der Blick auf eine Wirklichkeit, in der jedes dieser individuellen Subjekte zum einen ein immanentes Interesse daran hat, dass alle anderen dazu fähigen Subjekte ein moralisches Interesse ausbilden, und zum anderen jedes individuelle Subjekt dem jeweiligen Interesse der jeweils anderen Subjekte ausgesetzt ist, selbst ein solches hervorzubringen. Das Bild der natürlichen Ethik als das eines reinen Spiels der Mächte wird in dieser Weise ergänzt und durchsetzt von einer Konstellation reziproker moralischer Ansprüche. Diese moralischen Ansprüche sind nicht unbedingt, insofern sie an die Bedingung der Existenz interessierter, erlebender und freier Subjekte und in diesen an die Fähigkeit gebunden sind, diesem Anspruch prinzipiell Genüge zu leisten. Aber sie sind universal in einem konzeptualistischem Sinne, da mit diesen Bedingungen auch die jeweils individuellen moralischen Ansprüche entstehen. Ich stimme Kodalle zu, wenn er unter Hinweis auf vorreflexive Lebensformen – darin für mich inbegriffen auch das vorgängige vor-reflexive 171 Verhalten eines jeden zur Reflexion fähigen Organismus – von den „Grenzen der Begründungsforderung des Universalisierungsimperativs der Moral [Hervorhebung im Original; T. W.]“ spricht.394 Und ich denke, dass wir diese Grenzen begründend gerade dadurch erreichen können, indem wir uns darauf besinnen, was unsere Natur uns als interessierte, erlebende und freie Subjekte in dieser Hinsicht bedeutet. Der Universalisierungsimperativ der Moral ist dann nichts anderes als Ausdruck eines faktischen Interesses und Anspruches, den natürliche Subjekte unter bestimmten Bedingungen zumindest latent an jeweils andere Subjekte stellen sowie andersherum von diesen erfahren. Jedes einzelne dieser Subjekte hat dieses Interesse und stellt diesen Anspruch und, soweit es dies reflektiert, weiß es darum, dass auch die anderen dies tun. Das „moralische Gesetz“ liegt nicht in einer reinen Vernunft, sondern in unserer bedingten, reziproken Natur als interessierte, erlebende und freie Subjekte begründet. Das „moralische Gesetz“, das sind die moralischen Ansprüche, denen wir uns unserer Natur nach gegenseitig aussetzen. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob es bei diesem je individuellen Interesse am moralischen Verhalten anderer bleibt oder ob auch ein natürliches Interesse am eigenen moralischen Verhalten plausibel zu machen ist. Denn nur wenn die Subjekte in ihrer Freiheit je ein Interesse am eigenen moralischen Verhalten entwickeln, vermag das reine Spiel der Macht zumindest potentiell durchbrochen zu werden. Meines Erachtens hat Kant diese entscheidende Frage dadurch zugunsten der Moral auflösen wollen, dass er es zum einen als reinen Willen oder reines Interesse des Subjektes konzipierte und zum anderen das moralische Verhalten an ein mit diesem in genauer Proportion einhergehendes Zuteilwerden von Glückseligkeit knüpfte. Wer will nicht seinem reinsten Interesse entsprechen und wer seiner eigenen Glückseligkeit nicht entgegenarbeiten? – So könnte man sagen, war sein Kalkül. Den Widerspruch, in den er dadurch geriet, habe ich oben deutlich gemacht.395 Wenn wir aber den Begriff der Befriedigung, wie er hier in Anlehnung an Pinkards HegelInterpretation als ein stetiges und spannungsreiches Bemühen um ein in Adäquanz zur physischen und sozialen Umwelt zu suchendes befriedigendes Leben und Erleben verwendet wird, ins Zentrum vernünftigen Verhaltens stellen, dann sehe ich tatsächlich die Möglichkeit, ein natürliches individuelles Interesse am eigenen moralischen Verhalten plausibel zu machen. Es ist dann nicht so sehr die Frage eines Sollens, sondern die, ob wir in Gesellschaft ein befriedigendes Leben führen wollen. Denn mir scheint es unausweichlich der Fall zu sein, dass mit einem Interesse an einem für den Einzelnen befriedigenden sozialen Zusammenleben das individuelle Interesse am eigenen moralischen Verhalten geradezu erwachsen muss. Dies bedeutet nicht, dass in jeder 394 395 Vgl. Seite 156 dieser Arbeit. Vgl. Seite 83ff. dieser Arbeit. 172 sozialen Interaktion ein diesem Interesse entsprechendes Verhalten auch schon verwirklicht wird. In sozialen Interaktionen ohne Interessenswidersprüche ist dies ohnehin nicht akut von Bedeutung. Allerdings sind Situationen, in denen sich die Interessen verschiedener Individuen widersprechen, mit Sicherheit nicht von geringerer Häufigkeit. Und in diesen kann man auf ein moralisches Verhalten allein dann verzichten, wenn man die physische und psychische Macht hat, andere seinen Interessen gefügig zu machen. In allen anderen Fällen wird sich das Interesse am eigenen moralischen Verhalten nicht unbedingt ausschließlich, aber allein schon deshalb durchsetzen, um anderen zumindest keinen Grund zu geben, einen selbst anders und entgegen dem eigenen moralischen Anspruch zu behandeln. Es ist dies die aus der Konsequenzhaftigkeit natürlicher Existenz erwachsende Pflicht, die Sorgfalt um das eigene Tun auf der Suche nach einem befriedigenden Leben. Und auch „die Mächtigen“ werden, umso mehr sie ihre Macht über ihren kleinsten Kreis hinaus ausweiten wollen, nicht ohne ein freiwilliges Anpassen ihrer Interessen an widersprechende Interessen anderer, ohne ein moralisches Verhalten überhaupt auskommen; und werden mit Sicherheit auch nicht ohne ein Interesse an der freiwilligen Anpassung derjenigen leben, über die sie zu herrschen gedenken, werden deren moralisches Verhalten, ungeachtet ihres eigenen konträren Verhaltens, uneingeschränkt weiterhin einfordern. Denn individuelle Macht ist endlich, endlicher als es oft den Anschein haben mag. Dieses „Müssen“ zum moralischen Interesse ist dennoch nicht als ein unbedingtes zu verstehen. Es bleibt an die individuelle Beantwortung der Frage gebunden, ob ein befriedigendes Leben in einem gesellschaftlichen Zusammenhang gewollt wird. Und hier gibt es, das haben die Überlegungen zu Beginn dieses Abschnittes deutlich gemacht, kein unbedingtes Sollen. Die Frage ist allein, wofür wir uns in unserer zwar bedingten, doch aber unbestimmten Freiheit entscheiden wollen. Bei positiver Beantwortung aber scheint mir die Entwicklung des individuellen moralischen Interesses unausweichlich und insofern, diese Bedingung vorausgesetzt, wie der moralische Anspruch ebenfalls in einem konzeptualistischem Sinne universal zu sein. Das moralische Interesse ist prinzipiell nicht an bestimmte positive Normsetzungen gebunden. Denn die Zweckfreiheit eines jeden individuellen Interesses bedeutet, dass es keinen vorgegebenen Zweck gibt, der es unmöglich machen würde, unter den unterschiedlichsten und noch so absurd erscheinenden Normen und den mit diesen verbundenen Selbstverständnissen sich immer wieder aufs Neue auf ein stets mit Widerwillen verbundenes moralisches Verhalten in freiwilliger Beachtung der Interessen anderer einzulassen und diese Vorstellungen damit zu replizieren. Diese Normkulturen, oder, um an das hegelsche Vokabular anzuschließen, Lebensformen ermöglichen dem Individuum ja gerade ein gesellschaftliches Zusammenleben, von dem es profitiert und in dem es ein befriedigendes Leben führen kann. Solange es auch die Beachtung seiner nach 173 der jeweiligen von ihm affirmierten Normkultur ihm zustehenden Interessen erfährt, kann sich ein Individuum als Teil derselben verstehen und wird diese als moralisch gerecht wahrnehmen. Die Freiheit eines zweckfreien individuellen Interesses, sich in seiner normativen Unbestimmtheit unterschiedlichsten Normvorstellungen anzuschließen, ist aber zugleich auch der normative Stachel, der sich jederzeit wider dieselben wenden kann. Denn die positiven Normvorstellungen, so sehr ihre objektive Geltung in intersubjektiver Reziprozität auch erfahren werden kann, bleiben an die je individuelle Einstimmung und die individuellen Vorstellungskräfte zurückgebunden. Auch in Hinsicht darauf, was diese Normen in einer konkreten Situation für eine Handlung gebieten. Hier wird es notwendig, zu Interpretationsdifferenzen kommen, weil ein Individuum auch in seiner Vorstellungskraft seine Individualität und unbestimmte Freiheit, die es ist, nicht wird hinter sich lassen können. Selbst in den harmlosesten Interpretationsdifferenzen steckt der Hinweis darauf, dass positive Normvorstellungen nicht unabhängig von den Subjekten existieren, welche diese hervorbringen und sich mit diesen verbinden. Diese Vorstellungen aber sind und bleiben am Ende, trotz ihrer unweigerlichen soziokulturellen Prägung, ebenso unweigerlich je individuell. Es ist also keinesfalls immer Widerwilligkeit, die zu Widersprüchen in sozialen Interaktionen führt. Positiv können wir das als alltägliche Erinnerung verstehen, dass nicht die Normen uns, sondern wir die Normen bestimmen, wenn auch nur im bedingten Sinne. Mit den Interpretationsdifferenzen ist zugleich jene Konsequenzhaftigkeit verbunden, in der darüber verhandelt wird, welche Schlüsse aus den Interpretationsdifferenzen zu ziehen sind, was die Konsequenzen für die beteiligten Individuen sein werden. In gegenseitigem Geben von Gründen für und gegen die jeweiligen Interpretationen und die zu ziehenden Konsequenzen wird nach einer Lösung des Interessenstreites gesucht. Das gegenseitige Begründen und die zu ziehenden Konsequenzen sind ihrerseits geprägt durch die Normkultur und das mit dieser verbundene Verständnis seiner selbst und der anderen. Aber auch das Verständnis seiner selbst und der anderen, es mag gesellschaftlich und biographisch noch so geprägt sein, ist ein in der individuellen Unbestimmtheit aktualisiertes und bleibt offen für Veränderungen, bleibt aber auch vor allem zurückgebunden an die je individuellen Bedürfnisse und die je individuelle Suche nach einem befriedigenden Leben. Das gegenseitige Begründen wird so schließlich auch die Normen und das jeweilige Selbstverständnis und Verständnis der anderen nicht unangetastet lassen, die am Ende allein an ihrem Beitrag für das individuelle befriedigende Leben gemessen werden. Und wenn die in einer Gesellschaft gültigen Normen und Vorstellungen eines „guten Lebens“ dem Selbstverständnis der Individuen und den mit diesem verbundenen Interessen im steigenden Maße nicht mehr Genüge leisten, dann beginnt der gesellschaftliche Zusammenhalt den Boden zu verlieren, auf dem allein er gründen kann. Individuelle 174 Interessen werden nun nicht mehr freiwillig angepasst, sondern gesellschaftlich unterdrückt, was zu der Wahrnehmung moralischer Ungerechtigkeit führt. Die Bindung des moralischen Interesses an die Normvorstellungen schwindet und damit ihre freiwillige Befolgung. Eine Zeit lang mögen die durch die Normen nicht mehr gebundenen Kräfte durch Zwang unter Kontrolle gehalten werden. Aber Zwang kann das moralische Interesse nicht ersetzen. Es muss zu friedlichen oder unfriedlichen, sich dem Zwang widersetzenden Anpassungen der Interessenswidersprüche und damit einhergehend der Selbstverständnisse und Normen kommen, wenn der gesellschaftliche Zusammenhang auf Dauer nicht ganz zerstört werden soll – diese Dynamik wurde weiter oben in der Thematisierung des politischen Interesses bereits angesprochen. Ich denke, dass Nietzsche irrte, wenn er schreibt: „Der Moralität geht der Zwang voraus, ja sie selber ist noch eine Zeit lang Zwang, dem man sich zur Vermeidung der Unlust, fügt. Später wird sie Sitte, noch später freier Gehorsam, endlich beinahe Instict: dann ist sie wie alles lang Gewöhnte und Natürliche mit Lust verknüpft – und heisst nun Tugend.“396 Nietzsche verwechselt hier Moralität mit Normativität. Was Nietzsche schreibt, kann für bestimmte Normen gelten, nicht aber für moralisches Verhalten. Moralisches Verhalten meint ja gerade die freie Berücksichtigung der zunächst eigenem Interesse widersprechenden Interessen anderer, völlig unabhängig von der konkreten Normkultur, in der dies geschieht. Man kann unter Umständen jemanden zu Einhaltung von Normen zwingen, nicht aber zu moralischem Verhalten – in dieser Hinsicht hatte Kant meiner Ansicht nach völlig Recht. Aus dem Zwang zur Einhaltung einer Norm kann freier Gehorsam nur werden, wenn diese Norm dem individuellen befriedigenden Leben nicht grundsätzlich abträglich ist und sie schließlich individuell auch tatsächlich in freier Anpassung und Anerkennung befolgt wird. Nietzsche unterschlägt in seiner Betonung des Zwangs und der zu vermeidenden Unlust meines Erachtens auch, dass es anders herum und von Anfang an ein positives Interesse sein kann, sich auf die Befolgung von Normen freiwillig einzulassen, nämlich dann, wenn ein befriedigendes Leben in einer Gesellschaft gesucht wird. Und schließlich ist es gerade die Freiwilligkeit moralischen Verhaltens, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stets als ein labiles Geschehen erweist. Wäre es so einfach, wie Nietzsche es hier behauptet, dann könnte man sich fragen, warum all die Potentate der Geschichte in ständiger Sorge um ihre Macht und die Einhaltung der von ihnen gesetzten Normen lebten und leben, sich immer wieder gezwungen sahen und sehen, ihre Macht in „ihrem“ Volk stets aufs Neue zu exemplifizieren. Moralisches Verhalten, d.h. das mit Widerwillen verbundene freiwillige Berücksichtigen der Interessen anderer, kann nicht erzwungen werden. Vielmehr fordert das moralische Interesse da, wo es nicht schon freiwillig mit bestimmten Normvorstellungen immer wider neu sich verbindet, dennoch aber von anderen zu deren Einhaltung aufgefordert wird, 396 Nietzsche Menschliches, Allzumenschliches – Erster Band (1967), Seite 94. 175 Gründe für seine mögliche Einwilligung. Diese Begründungsversuche, da sie nach über das Individuum hinausgehenden allgemeinen Rechtfertigungen suchen, greifen schnell ins Grundsätzliche und Umfassende, greifen schließlich auf das Verständnis des Lebens überhaupt aus. Genau in diesem Sinne können auch sämtliche Versuche verstanden werden, Normen eine unbedingte Begründung zu geben. Sie können gelesen werden als die Suche nach zwingenden Argumenten für oder auch gegen bestimmte Normen. An dieser Stelle kommen wir wiederum zu der zu Beginn dieses Abschnitts deutlich gemachten Unmöglichkeit einer zwingenden Begründung eines Sollens zurück. Gerade die verbissensten und stets erfolglosen Versuche, andere durch unbedingte Gründe von der Gültigkeit bestimmter Normvorstellungen zu überzeugen, bezeugen diesen Zusammenhang. Normen lassen sich nicht unbedingt begründen, eben weil sie durch die Subjekte, für die sie gelten, bedingt sind. Genau das gilt auch für das moralische Interesse. Wie der moralische Anspruch ist es an die Bedingung der Existenz interessierter, erlebender und freier Subjekte, dann aber auch an deren Interesse gebunden, ein befriedigendes Leben in einer Gesellschaft zu führen. Das moralische Interesse ist aber keine Norm, sondern eben ein Interesse, das sich mit den unterschiedlichsten Normkulturen verbinden kann. Nietzsche hatte vor diesem Hintergrund völlig Recht mit seiner Kritik, wenn man sie als Kritik gegen die Identifizierung von Moral und von bestimmten historischen Normvorstellungen versteht. Moralität liegt nicht in Konventionen, nicht in Reflexionen und ebenfalls nicht – im religiösen Zusammenhang – in sogenannten Offenbarungen begründet. Moral, Moralität bzw. moralisches Verhalten heißt im hier vorgeschlagenen Sinne nichts weiter als die freiwillige Berücksichtigung dem eigenen Interesse widersprechender Interessen anderer. In diesem Verständnis ist der Moralbegriff in seinem Grunde von jeglichen Normvorstellungen unabhängig. Um das zu verdeutlichen, kann man sich zwei individuelle Subjekte vorstellen, die mit widersprechenden Interessen aufeinander treffen und sich in freiwilliger, gegenseitiger Berücksichtigung der Interessen des jeweils anderen zu einer wie auch immer gearteten Auflösung des Widerspruchs durchringen. Die so gefundene Lösung ist eine moralische, völlig unabhängig von ihrem konkreten Inhalt, sie ist in moralischer Hinsicht perfekt. Nun kann man, und ich halte dies auch für sinnvoll, in diesem Kontext ebenfalls vom Einhalten einer aus moralischem Anspruch und moralischem Interesse erwachsenden Norm sprechen. Man könnte diese etwa als moralische Norm oder die Norm moralischen Verhaltens bezeichnen. Aber es ist für meine Begriffe ganz entscheidend, sich dabei darüber im Klaren zu sein, dass erstens dieser Norm zwei von ihrer Formulierung unabhängige natürliche Interessen der Subjekte, der moralischer Anspruch und das moralisches Interesse, vorausgehen, die sich unter bestimmten Bedingungen aus der Natur interessierter, erlebender und freier Subjekte notwendig entwickeln; und, dass diese Norm sich zweitens völlig neutral gegenüber dem konkreten Inhalt der sich widersprechenden 176 Interessen sowie gegenüber dem Inhalt der auf moralischem Wege gefundenen Lösung verhält. Für die Moralität ist allein zentral, dass die physische und psychische Macht der sich in ihren Interessen zunächst widersprechenden Subjekte allein in einer freiwilligen Annäherung und Modifikation der jeweiligen individuellen Interessen ihren Ausdruck findet. Dass eine solche, wenn auch nicht machtfreie, so doch aber die Macht nicht zur Unterdrückung anderer gebrauchende Annäherung individueller Interessen im Rahmen unserer Natur prinzipiell möglich ist, wird nicht zuletzt dann plausibel, wenn wir uns wiederum die schon den einfachsten Lebewesen zukommende Zweckfreiheit des je individuellen Interesses am Erleben vor Augen führen. Denn dann gilt, dass die in den Möglichkeitsraum eines individuellen Subjekts fallenden konkreten Interessensoptionen, die im Laufe der Evolution über das für all diese Interessen notwendige Interesse am Erleben und die mit diesem einhergehende Selbstbestimmung hinausgehend entwickelt wurden und sich weiter entwickeln werden, in gewisser Weise stets zweitrangig bleiben. In seiner Zweckfreiheit ist das individuelle Interesse am Erleben über die Selbsterhaltung und Selbstbestimmung hinaus prinzipiell nicht an eine bestimmte Form seiner Verwirklichung gebunden. Und es erscheint aus diesem Grund alles andere als abwegig, von der grundsätzlichen Möglichkeit einer moralischen Lösung von Interessenswidersprüchen auszugehen. Dass gegen eine solche Lösung vor allem auch im Hinblick auf diskursiv vermittelte, in intersubjektiver Reflexivität sich stabilisierende und von Nietzsche mit Vorliebe attackierte Wertvorstellungen und Normen, wie sie den menschlichen Kulturen zugrunde liegen und intergenerational weitergegeben werden, erheblicher Widerstand erwachsen kann, soll damit nicht geleugnet werden. Aber ist es auch unmöglich, die historischen Bedingungen, unter denen ein individuelles Leben sich und seine soziokulturell geprägte „zweite Natur“ entwickelt, außer Acht zu lassen, so besteht doch die Möglichkeit eines unbestimmten oder kreativen Umgangs mit diesen, so klein dieser Freiheitsgrad unter Umständen, und für ein einzelnes Individuum ohnehin, auch manchmal sein mag. Dieser Freiheitsgrad, der letztlich die unbestimmte Freiheit des individuellen Subjekts selbst bezeichnet, sollte jedoch nicht unterschätzt werden und ist vielleicht oft und anders herum sogar größer als wahrgenommen. In dieser Hinsicht kann man von Nietzsches Ablehnung einer wissenden Einstellung und seiner Betonung einer experimentell-forschenden Haltung in stetiger Überwindung einer vermeintlich feststehenden Wirklichkeit meines Erachtens einiges lernen – Pflicht ist ein Wagnis. 397 Auch kommen wir hier zurück zu Nietzsches vorsichtigem Abtasten, GerechtWerden und dem Erkennen der eigenen und fremden Grenzen, dem gegenseitigen 397 Vgl. Zachriat (2001), Seite 119ff., 181ff. 177 Respektieren, der Feinfühligkeit sowie der Empfindsamkeit; aber auch der Leidensfähigkeit, weil es unter Umständen auch darauf ankommt, tiefliegende, das bisherige Leben bestimmende Gewohnheiten und Wertvorstellungen zu hinterfragen und hinter sich zu lassen – Pflicht ist Sorgfalt. Aber in vielen Situationen wird es auch in moralischer Hinsicht nicht um ein solches bis an die Grenzen des Realisierbaren reichendes Hinterfragen des eigenen Selbstverständnisses gehen, geschweige denn um eine Totalrevision oder, wie Bernard Williams sagt, „conversion“ desselben.398 Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen verstehe ich auch folgendes Zitat von Nietzsche: „Der Fortschritt in der Moral bestünde in dem Überwiegen altruistischer Triebe über egoistische und ebenso der allgemeinen Urteile über die individuellen? Ist jetzt der locus communis. Ich sehe dagegen das Individuum wachsen, welches seine wohlverstandenen Interessen gegen andere Individuen vertritt (Gerechtigkeit unter Gleichen, insofern es das andere Individuum als solches anerkennt und fördert); ich sehe die Urtheile individueller werden und die allgemeinen Urtheile flacher und schablonenhafter werden.“399 Auch wenn Nietzsche selbst immer wieder mit dem Titel des „Immoralisten“ kokettiert hat, so stimme ich Zachriat zu, dass eine ausgewogene Interpretation seines moralischen Denkens nicht bei den „grellen, starken Worten, die dessen eigentliche, vielschichtige Philosophie verbergen“, verweilen sollte. 400 Und vielleicht findet man den Kern seiner Moral ja gerade in den leiseren Tönen, in denen er nicht polemisiert. Und selbst wenn dieses Verständnis nicht im Sinne Nietzsches selbst gewesen sein sollte, so steht es uns doch frei, aus seiner Philosophie das mitzunehmen, was uns richtig und wichtig erscheint; und das hinter uns zu lassen, was uns weniger sinnvoll erscheint, so zum Beispiel seinen intellektuellen Aristokratismus. Was ist dagegen zu sagen, dass Nietzsche Gleichheit in der Anerkennung des Individuums als solchem sieht und Gerechtigkeit darin, das ihm Mögliche zu dessen Förderung beizutragen, ohne dass dies heißen muss, die eigenen Interessen selbstlos aufzugeben? Um Annäherung und Kompromissbereitschaft wird auch Nietzsche dabei nicht herumgekommen sein. Es kann keine Förderung eines anderen Individuums geben, ohne auf ein egoistisches Durchsetzen eigener Interessen zu verzichten. Und erneut kommen wir hier zum vorsichtigen Abtasten, zum Gerecht-Werden und dem Erkennen der eigenen und fremden Grenzen, dem gegenseitigen Respektieren, der Feinfühligkeit, der Empfindsamkeit und der Leidensfähigkeit zurück. Ein solches Verhalten in sozialer Interaktion ist, das habe ich deutlich gemacht, unter Umständen keine leichte Angelegenheit; man sollte hier nichts romantisieren. Sie bedarf bisweilen der Selbstüberwindung, des Ablegens von Gewohnheiten, Vorurteilen und tief verwurzelten 398 Williams (1985), Seite 39. Nietzsche zitiert nach Zachriat (2001), Seite 159. 400 Vgl. Zachriat (2001), Seite 169, n.416. 399 178 Wertvorstellungen, manchmal auch von Lebensträumen. Dies kann mitunter äußerst anstrengend sein, sodass es nicht selten als Nötigung erscheinen mag, sich überhaupt auf ein solches Verhalten einzulassen. Es braucht sogar so viel Kraft, dass ein Einzelner nur wenige Beziehungen in wirklicher Nähe führen kann. Ich halte von Kants Betonung des Anstrengenden und des Nötigenden in moralischen Zusammenhängen nach wie vor sehr viel, ohne dass dies bedeuten soll, dass es darum ginge, den Bogen zu überspannen. Max Weber kannte seinen Nietzsche, wenn er sagt: „Es ist das Schicksal unserer Zeit, mit der ihr eigenen Rationalisierung und Intellektualisierung, vor allem: Entzauberung der Welt, daß gerade die letzten und sublimsten Werte zurückgetreten sind aus der Öffentlichkeit, entweder in das hinterweltliche Reich mystischen Lebens oder in die Brüderlichkeit unmittelbarer Beziehungen der Einzelnen zueinander. Es ist weder zufällig, daß unsere höchste Kunst eine intime und keine monumentale ist, noch daß heute nur innerhalb der kleinsten Gemeinschaftskreise, von Mensch zu Mensch, im pianissimo, jenes etwas pulsiert, das dem entspricht, was früher als prophetisches Pneuma in stürmischem Feuer durch die großen Gemeinden ging und sie zusammenschweißte.“401 Dennoch, auch bei all dieser „Individualitas“ und bei all diesem „Intimissimo“ – für ein Pianissimo haben beide, sowohl Nietzsche als auch Weber, zu lautstark argumentiert – sehe ich nicht, warum man aus dieser moralischen Einsicht und Überzeugung kein allgemeines moralisches Prinzip oder eine allgemeine Norm formulieren kann. Weiter oben habe ich bereits von der moralischen Norm oder der Norm moralischen Verhaltens gesprochen. Man kann ein solches Verhalten nach dem Gesagten aber auch noch einmal anders greifen als über den Begriff der Moral. Denn das moralische Verhalten, zumindest wie es hier verstanden wird, bedeutet letztlich nichts anderes, als dass in der interindividuellen Annäherung das zweckfreie und selbstbestimmte interessierte Erleben und damit der Wert und die Würde seiner selbst und des anderen ins Zentrum des Verhaltens gestellt wird. „Würde“ heißt in diesem Zusammenhang, dass die Anerkennung des Wertes mit der Anerkennung der Selbstbestimmung über diesen und seine Verwirklichung einhergeht. Selbstbestimmung, das sollte deutlich geworden sein, wird hier nicht in dem Sinne verstanden, tun und lassen zu können, was immer man will, sondern eine aktive Rolle in der Bestimmung seiner Interessen in Adäquanz zur physischen und, in moralischer Hinsicht, zur sozialen Umwelt zu übernehmen. Es bedeutet auch nicht, den Versuch zu unternehmen, eine unparteiische Position zu beziehen, in der man alle seine Bedürfnisse und Interessen grundsätzlich hinter sich zu lassen gedenkt und sich dazu aufschwingen will, gewissermaßen von nirgendwo auf sich und den anderen zu blicken – dies ist, was Nietzsche meinte, wenn er sagt: „Ich sehe dagegen das Individuum wachsen, welches seine wohlverstandenen Interessen gegen andere Individuen vertritt.“ Darüber hinaus ist damit den Begriffen der Gleichheit und Gerechtigkeit eine Richtung gegeben. Gleichheit bedeutet nicht „Gleichmacherei“, sondern die gleiche Berechtigung, 401 Weber (1995), Seite 44. 179 seine Interessen zu entwickeln und zu vertreten, zur Not Unterstützung dabei zu bekommen, wenn man dies selbst nicht kann; auch das heißt fördern. Gerechtigkeit bedeutet, nicht nur von anderen moralisches Verhalten einzufordern, sondern auch selbst ein solches so weit wie nur möglich hervorzubringen. Weiter oben habe ich argumentiert, dass es mit dem hier vorgeschlagenen Moralverständnis und damit auch mit dem individuellen Wert und der Würde vereinbar ist, sich in die unterschiedlichsten Normkulturen einzubinden. Solange ein individuelles Subjekt sich als Teil einer wie auch immer gearteten Normkultur verstehen kann, wird es sein normkonformes Verhalten, auch in moralisch relevanten Situationen, nicht als Zwang erleben. Ist Moral in normativer Hinsicht demnach relativistisch? Man kann diese Frage meines Erachtens mit ja, aber auch, und das wird für die folgenden Überlegungen entscheidend sein, mit nein beantworten. Denn wenn man sich vor Augen führt, dass das moralische Verhalten, die freiwillige Beachtung von dem eigenen Interesse widersprechenden Interessen anderer, in allen Normkulturen stets von zentraler Bedeutung war und ist, weil diese ohne dasselbe gar nicht erst zustande kommen oder aber auseinanderbrechen würden, scheint Moral in gewisser Weise ein ahistorischer Aspekt gesellschaftlichen Zusammenlebens zu sein. Keine Normkultur kann auf das moralische Verhalten der in ihr lebenden Subjekte verzichten. Darin steckt meines Erachtens ein gewichtiger Hinweis: Letztlich sind es nicht die jeweils spezifischen Normen, sondern ist es das moralische Verhalten, das zu allen Zeiten und an allen Orten die Basis gesellschaftlichen Zusammenhalts ausmachte und ausmacht. Gesellschaftliches Zusammenleben erscheint damit von einem Verhalten bedingt, das, um an Nietzsches Wortlaut anzuknüpfen, nicht in jenen normativen „Geschichtsfluktuationen“ gründet. Dieser Schluss steht wiederum in völligem Einklang mit der aus unserer Natur erwachsenden konzeptualistischen Universalität von moralischem Anspruch und moralischem Interesse. Damit drängt sich eine weitere Überlegung auf. Für interessierte, erlebende und freie Subjekte, die in ihrer reflexiven und diskursiven Vernunft über die Bedingungen eines befriedigenden Zusammenlebens in Anbetracht ihrer natürlichen Bedingtheit nachdenken, bleibt damit am Ende als einzige sinnvolle Möglichkeit, das moralische Verhalten und damit den Wert und die Würde eines jeden Individuums selbst als oberste Norm ihres Zusammenlebens zu setzen. Es sollte nach den bisherigen Ausführungen klar sein, dass mit einer solchen Normsetzung nicht die Vorstellung der Verwirklichung eines glückseligen Lebens verbunden ist, einem Leben, in dem es im Ganzen, wie Kant sagt, „alles nach Wunsch und Willen geht“.402 Genau das ist nicht der Fall. Denn moralisches Verhalten ist nur dort gefragt, wo Interessenswidersprüche zwischen Individuen bestehen, deren friedliche und insofern 402 Kant KpV (1956), Seite 255. 180 befriedigende Auflösung gerade und unter Umständen eine immense Anstrengung bedeutet. Es bedeutet eine Welt, in der es alles in allem eben nicht nach Wunsch, doch aber nach Willen gehen kann, wenn man das moralische Verhalten als dem individuellen Interesse entsprechendes Verhalten auf der Suche nach einem befriedigenden Leben in Gesellschaft versteht. Dabei sind die Interessenswidersprüche und das Ausbleiben der Glückseligkeit, anders als bei Kant, nicht auf eine grundsätzliche Unangemessenheit des je individuellen Willens zum „moralischen Gesetze“ zurückzuführen, sondern entsprechen den natürlichen Bedingungen unseres Lebens als in Gesellschaft lebende interessierte, erlebende und freie Subjekte. Noch und ebenfalls anders als bei Kant besteht, mit Blick auf die Zweckfreiheit des individuellen Interesses am Erleben, eine generelle Unfähigkeit, der Norm moralischen Verhaltens gerecht zu werden. 403 Es ist ein Vollzugsziel, dem situativ und durchgehend im modus meliorativus oder, im optimalen Falle, im modus sufficiens entsprochen werden kann. Moralische Perfektion im universalen Sinne bedeutet kein glückseliges, sondern ein spannungsreiches, dennoch aber unterdrückungsfreies befriedigendes Leben in Frieden über Kulturen und Generationen hinweg; bedeutet, sich gegenseitig immer wieder in die Pflicht zu nehmen, ist Wagnis und Sorgfalt zugleich. Zur moralischen Sorgfalt gehört es meiner Ansicht aber auch, in der Anerkennung der Freiwilligkeit moralischen Verhaltens Folgendes zu bedenken. Sobald mindestens ein Subjekt in einem interindividuellen Interessenwiderstreit seine Freiheit nicht dazu nutzt, nach einer moralischen Lösung zu suchen, bedeutet dies unweigerlich die Rückkehr zu einem Machtkampf, dem sich das oder die anderen Subjekte nur entziehen können, solange sie bereit sind, auf ihr Interesse und eine Entsprechung ihres moralischen Anspruches ganz zu verzichten. Es gibt keine andere Alternative. Diese mag in einigen Situationen durchaus vertretbar sein, sicherlich ist sie es aber in vielen Situationen auch nicht. Die Machtproblematik wird stets akut bleiben. Vor diesem Hintergrund wird der moralische Anspruch in ein moralisch-politisches Interesse an eine dritte Macht oder Gewalt übergehen, welche die durch moralisches Verhalten nicht aufgelösten Interessenwidersprüche durch Machtspruch beizulegen fähig ist. Auf ein solches moralisch-politisches Interesse kann wiederum nur derjenige verzichten, der die physische und psychische Macht besitzt, sich über die Interessen anderer hinwegzusetzen. Wird im Hinblick auf das moralisch-politische Interesse konsequenterweise weiterhin an der moralischen Norm, die den Wert und die Würde jedes individuellen Subjektes sowie damit einhergehend Gleichheit und Gerechtigkeit ins Zentrum allen moralischen Handelns stellt, als durch unsere Natur bedingte Bedingung eines gesellschaftlichen Zusammenlebens festgehalten, dann kann diese dritte Gewalt nur als eine gedacht werden, die diesen Prinzipien selbst gerecht wird. Das kann sie am Ende jedoch nur, wenn sie nicht nach einer ihr eigenen Willkür verfährt und dabei die individuelle Würde, d.h. die individuelle Selbstbestimmung im politisch-normativen Zusammenhang übergeht, sondern die 403 Vgl. ebd., Seite 252. 181 Subjekte, die unter ihrem Machtspruch stehen, in irgendeiner Weise an der Setzung und Fortentwicklung der Normen, nach denen ein konkreter Interessenstreit politisch gelöst werden kann, gleichberechtigt beteiligt werden. Ich werde hier auf weitere detaillierte Ausführungen verzichten, da die Richtung, in die dieser Gedankengang führt, klar sein sollte. Er deutet in die Richtung eines politischen Prozesses, der als sein Prinzip die moralische Norm und damit den individuellen Wert und die Würde eines jeden sowie Gleichheit und Gerechtigkeit fortwährend umkreist. Dieses Prinzip bildet auf diese Weise ein aus unserer bedingten Natur erwachsendes quasiungeschichtliches Zentrum, um das herum die dieses Prinzip hervorbringenden moralischen Ansprüche und moralischen Interessen der Subjekte in Abhängigkeit zu den raumzeitlich bedingten natürlichen und sozialen Anforderungen in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens in positiven Normen immer wieder neu sich konkretisieren und aktualisieren können. Normen, die wiederum nur deshalb vonnöten sind und zum Einsatz kommen, weil eine moralische Lösung von Interessenswidersprüchen in je einzelnen Fällen nicht erreicht wird, und eine moralisch-politische Lösung unausweichlich bleibt; zumindest dann, wenn es dabei bleiben soll, dass das reine Spiel der Macht durchbrochen wird. Ein solches Durchbrechen des Machtspiels ist kein Automatismus und kein zu erreichender Zustand, sondern ein stetiger Prozess, der vom je individuellen Verhalten in sämtlichen Bereichen des Lebens abhängig ist und bleibt; damit aber auch von jener nietzscheanischen „Individualitas“ und jenem weberschen „Intimissimo“. Auch die aus dem moralisch-politischen Interesse erwachsende „dritte Gewalt“, der moralische Staat, kann das moralische Verhalten der in ihm lebenden Subjekte nicht ersetzen, ist allein eine moralisch-politische Rückversicherung; aber dies auch nur dann, wenn die individuellen Subjekte, in welcher konkreten Form und wie direkt oder indirekt auch immer, tatsächlich an der Setzung der positiven Normen, d.h. an der Rechtssetzung, der Setzung des objektiven Rechts, sei es in latenter Bestätigung oder Weiterentwicklung desselben, beteiligt werden und sich beteiligen. Sowohl moralisches Verhalten als auch moralischpolitische Normen können nur und immer wieder neu aus einer gelebten Praxis heraus entwickelt, nicht aber rein theoretisch bestimmt und vorweggenommen werden. Moralisches Verhalten und moralisch-politische Normativität ist kein Selbstverständnis, sondern ein vom Selbstverständnis, von den Interessen und dem alltäglichen Verhalten der individuellen Subjekte in moralischen und moralisch-politischen Zusammenhängen abhängiges Geschehen. Mit der Thematisierung des Selbstverständnisses kommen wir an dieser Stelle nun schließlich zu jenem in der Auseinandersetzung mit Pinkards Hegel-Interpretation sichtbar gewordenen Problem zurück, von dem her die Überlegungen dieses und des vorigen 182 Kapitels ihren Ausgang genommen haben.404 Im Folgenden werde ich Pinkards an Hegel angelehnte Argumentation noch einmal genauer nachvollziehen und auf sein Verständnis der Moralität hin zuspitzen, um im Anschluss daran den hier von mir in Auseinandersetzung mit Nietzsche entwickelten Moralbegriff zu diesem ins Verhältnis zu setzen. Pinkard beschreibt das moderne Selbstverständnis als eines, das sich seiner Endlichkeit („finitude“) und Partialität („partiality“) bewusst ist und in normativer Hinsicht mit dem Eingeständnis unserer Unfähigkeit, unbedingte Gründe für oder gegen ein bestimmtes Verhalten zu geben, einhergeht. Er schließt daraus auf unsere radikale Fehlbarkeit („radical fallibility“) auch in normativen Zusammenhängen. So wie ich Pinkard verstehe, ist dieses Selbstverständnis gerade als Folge der Orientierung unserer begrifflich-diskursiven oder reflexiv-diskursiven Tätigkeit an Wahrheit zu verstehen: „[...] each acknowledges his own radical fallibility and the temptation to claim a knowledge of the unconditional that oustrips the ressources of the individual agent. The ,true infinity’ the agents seek is to be found within the ongoing interchange itself, insofar as that interchange is oriented to truth. [...] The finite world is the world in which we live, where our metaphysical speculations inevitably contradict each other and the infinite exists, as it were, as our own reflective consciousness of this finitude.“ Meine Kritik lag nun darin, dass diese Konsequenz des Wahrheitsbezuges, anders als Pinkard dies geltend macht, weder dazu hinreicht, eine radikale normative Fehlbarkeit zu begründen, noch dazu, Ordnung in das relativistische Durcheinander historischer Normativität zu bringen. Das Hauptproblem in seiner Argumentation liegt meines Erachtens darin, dass er von der Annahme ausgeht, dass wir in unserer selbst-reflexiven Natur allein über die Setzung einer unbedingten Norm in der Lage sind, Orientierung zu gewinnen. Da jedoch jede Setzung als Setzung bedingter Subjekte eben nur bedingt sein kann, müsse dies zu unauflöslichen Widersprüchen zwischen dieser reflexiven Setzung und unserer bedingten Welt und Praxis führen. Diese Widersprüchlichkeit könne theoretisch befriedigend nur über das Eingeständnis der Bedingtheit unserer Reflexionen in den Griff bekommen werden und damit in die Erkenntnis übergehen, dass unsere so gesetzten Normen bloße Konventionen oder, um mit Habermas zu sprechen, gesellschaftliche Konsense seien. An diesen müssten wir, um die Orientierung nicht zu verlieren, dennoch als quasi-unbedingte Normen solange festhalten, bis sie durch neue, wiederum quasi-unbedingte Normen ersetzt werden. Der aus diesem Grunde unaufhebbare Widerspruch zwischen dieser reflexiven Normierung und unserer bedingten Praxis könne nur mit einer nicht formalisierbaren praktischen Fähigkeit („practical skill that resists formal codification“) überbrückt werden, welche als Moralität zu verstehen sei.405 Allein vor diesem Hintergrund sei es auch für unsere moderne Zeit möglich, zumindest zeitweise eine Ordnung in unser Zusammenleben zu bringen. 404 405 Vgl. Seite 125ff. dieser Arbeit. Pinkard (2012), Seite 138, Seite 186. 183 Dieser theoretische Hintergrund wird in Pinkards Hegel-Interpretation insbesondere in der Thematisierung des modernen Individualismus seit der Aufklärung deutlich.406 Die von Nietzsche so unermüdlich betonte Individualität erscheint hier nicht als eine natürliche Bedingung oder Eigenschaft unserer subjektiven Existenz, sondern als ein konsensuell anerkannter Status, den wir uns in intersubjektiver Reziprozität zuschreiben. Dazu Pinkard ausführlich: „On the basis of the kind of philosophical history that he developed at length in his 1807 Phenomenology, Hegel took himself to have shown that the unargued premise of modern life has to be that of freedom, and the basic questions about it – including the crucial philosophical issue of what exactly freedom is and whether it is even intelligible to speak of human freedom – have to do with whether it can indeed be actualized. This turned on the Socratic invention of morality – in effect, the invention of ,the individual.‘ Now, although, the ,individual‘ had proven to be the element of corruption in the ancient Greek social order, in the modern social order, the ,individual‘ seems to be the core unit, its most important achievement. To be an ,individual‘ is to be taken by oneself and others to be a self-originating source of claims against others and against the political order as a whole. This self-orgiginating status of ,individual‘ is a social status sustained in a structure in which agents recognize each other as entitled to that status and in which agents take this entitlement to be an unargued premise of the social order. How, then, can agents sustain a kind of mutual recognition of a status that looks as if it asserts itself as not being dependent on any kind of recognition as a status at all? Taken merely as a self-originating source of claims, ,the individual‘ is (in Hegel’s sense) only ,abstract‘. As a bedrock status of ,the right‘ in general, such individuals are said to have rights, and thinking about which rights they might have quickly falls out into something like the basic Lockean triad of rights to life, liberty, and property (as the kind of claims an individual can typically make against the characteristic types of injuries that can be visited on him by something like royal authority). This is so not because such agents already are in a metaphysical sense Lockean individuals, but because historically they have come to occupy the social status of something like Lockean individuals. As general statements of the unconditional claims ,individuals‘ can make against each other and against state authority, such inalienable rights are ,abstract‘ – their actualization is not given in the mere statement of what such unconditional claims are.“407 Pinkard schließt nun mit Hegel daraus auf eine tiefliegende Problematik des modernen Selbstverständnisses, weil die Annahme unbedingter Rechte im Verhältnis zur sonstigen Lebenspraxis schnell zu unauflöslichen Widersprüchen führt, in der diese Rechte so unbedingt offenbar nicht gelten. 408 Sie werden vielmehr stets unbeabsichtigt oder beabsichtigt eingeschränkt, kommen also nur zu bedingter Geltung. Dies führe zu den 406 Vgl. ebd., Seite 135ff. Ebd., Seite 136f. 408 Vgl. ebd., Seite 137. 407 184 bekannten rechtsphilosophischen Fragen, ob diese individuellen Rechte tatsächlich unbedingt sind oder in Abhängigkeit zu einer kontingenten gesellschaftlichen Absicht oder den Befehlen eines wie auch immer gearteten Souveräns stehen oder bloß als historischkonventionell akzeptierte allgemeine Regeln zu verstehen seien. Es sei auch völlig unklar, wie diese unbedingten individuellen Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum in Balance miteinander zu halten sind, da sie sich in konkreten Situationen durchaus widersprechen können. In diesen Widerspruchssituationen müssten die Gründe, nach denen wir uns für die Bevorzugung des einen oder des anderen Rechts entscheiden, logischerweise wie die Rechte selbst einen unbedingten oder universalen Status besitzen, damit die Bevorzugung des einen oder des anderen Rechts nicht als Verletzung ihrer unbedingten Geltung, als ein individueller oder gesellschaftlicher Dezisionismus erscheint. „Thus, we are required by the logic of the classical Lockean rights themselves as they are to be put into practice to seek, in Hegel’s words, ,a justice [...] freed from subjective interest and subjective shape and from contingency of power.‘“409 Eine kontraktualistische Lösung dieses Problems sei ausgeschlossen, weil in einer solchen nicht nur die Rechte, sondern auch die Entscheidungen über ihre Aktualisierung ihrerseits nicht unabhängig von der vertraglichen Rechtssetzung und den Entscheidungen über ihre Aktualisierung gerechtfertigt werden könnten und in diesem Sinne kontingent und auf subjektive bzw. intersubjektivverkomplizierte Weise relativistisch bleiben müssten. Pinkard zieht den Schluss: „If there can be no a priori (i.e., traditional philosophical) resolution of these disputes, then the solution to some of the various antinomies of ,abstract right‘ must be practical, not theoretical. There must be an institutional setup that makes these unavoidable tensions livable and rational to hold. A balance between competing unconditional rights must be struck, even though there can be no a priori reason to strike it one way as opposed to another. Rights require recognition both of their unconditional status and of their relative status within a distinct way of life. That makes them necessary and deeply problematic. Only the ,moral point of view‘ – the standpoint Socrates invented – can promise to carry out such an adjudication since it commits us both to doing the right thing because it is the right thing, even in those cases where it goes against our own interests, and doing the right thing from a standpoint that transcends any particular point of view. ,Morality‘ is required if abstract right is to be actual and not remain merely ,abstract.‘“410 Weiter führt Pinkard aus: „While the turn to ,morality‘ is (for us moderns) to be justified by its being necessary for the actualization of ,abstract rights‘, morality itself, of course, emerged long before any such conception of rights had been developed. However, the Socratic invention of morality also brought in its wake what Hegel calls ,the inward turn‘ in individual life – an in-sich-gehen, in Hegel’s invented terminology. Although neither Socrates nor anybody else invented inwardness, the 409 410 Ebd., Seite 137. Ebd., Seite 138. 185 Socratic insistence on the individual’s distancing himself from all of his socially given requirements and, most important, on appealing only to his own insight into the rationality of things bestowed a new authority to this inwardness.“411 Zwar kommt auch Pinkard schließlich zu dem Punkt, dass Individualität weder etwas ist, das in jenem modernen politischen Status und in der mit diesem verbunden Rechtsbegrifflichkeit begründet liegt, noch sonst auf eine menschliche „Erfindung“ zurückzuführen sei. Dennoch hält er daran fest, dass es ein entscheidender Schritt in der Geschichte war, dieser Individualität bzw. Innerlichkeit dadurch eine neue Autorität zu verleihen, dass sie zur letzten Instanz eines vernünftigen Verhaltens in Abhängigkeit ihres begrifflichen Vermögens erhoben wurde. Durch das reflexive Begreifen wurde es möglich, sich von der Eingebundenheit in die Umwelt und damit auch von den sozialen Normen des Lebensumfeldes individuell zu distanzieren, sie in Frage und zur Disposition zu stellen. Durch diese reflexive Distanzierung von allen kontingenten Verhaltensnormen und anforderungen, so der Gedanke, wurde jene Instanz des „Selbst“ geschaffen, die sich mit der Kontingenz dieser Welt nicht mehr zufrieden geben kann und nach einer unbedingten Orientierung zu suchen beginnt. Nur ein Unbedingtes könnte dieser praktischen Reflexion in einer kontingenten Welt zur Orientierung und Begründung von Verhalten dienen, auch in moralischen Zusammenhängen; ja die Orientierung am Unbedingten, Universalen oder Absoluten wurde geradezu zur Bedingung und zum Inbegriff moralischen Verhaltens. Der moderne Begriff unbedingten Rechts wäre demnach nur eine besondere Auskristallisierung dieser Bewegung hin zum Unbedingten. Da aber Moralität bzw. das moralische Verhalten stets das Verhalten eines endlichen Individuums im Hinblick auf die bedingte Setzung eines nur quasi-unbedingten Normbegriffes sei, müsse der Versuch scheitern, Moralität unabhängig von solchen normativen Setzungen zu begreifen; und soweit er in Bezug auf die nur quasi-unbedingten Normbegriffe definiert wird, notwendig zu Widersprüchen führen. „,Morality‘ is an actualization of ,the individual‘. It supposes that the ,individual rational agent‘ has within himself or herself the necessary resources to make moral judgments and put them into practice. Such individuals may depend on each other in a variety of empirical ways, and some of these dependencies may go as deeply as any organic fact can go. Nonetheless, the ,moral point of view‘ is that of something at least like, if not identical with, Kant’s ,kingdom of ends‘, in which each agent is both sovereign as lawmaker and subject to the commands of a moral law whose validity and binding power transcend his own individuality. In Kantian terms, the moral agent becomes an actual moral agent in the process of thinking himself as belonging to such an idealized community of moral agents. As a limited (finite) expression of the unconditional demands of practical reason – and thus as a finite expression of the absolute – ,morality‘ generates conflicting conceptions of 411 Ebd. 186 itself. Detached from being embedded in a larger practical life, it runs into the same kind of regresses and conflicts that all such purely conceptual dilemmas about the unconditional encounter.“ 412 Vor dem Hintergrund der beschriebenen reflexiven Distanzierung von sämtlichen konkreten Verhaltensanforderungen und der damit unweigerlich verbundenen Verhaltensproblematik des sich von sich selbst distanzierenden und in quasi-unbedingten Normbegriffen nach einer Begründung und Orientierung seines Verhaltens suchenden individuellen „Selbst“ ist auch Pinkards folgende Aussage zu verstehen: „The meaning that we are to find in the world has to do with the facts of our being the primates we are, and also we can sublate some of those facts – we can circumscribe their authority – we cannot ignore them. We are the creatures for whom our existence is a problem, and in becoming self-conscious, we institute a space of reasons that we ourselves do not then control.“413 Doch es bleibt meines Erachtens genau in Pinkards Sinne weiter danach zu fragen, was genau die fehlende Kontrolle über den „Raum der Gründe“ bedeutet; oder, um sich seinem Wortlaut anzunähern: „to circumscribe the authority of the fact that we are not able to control the space of reasons we institute.“ Die Unfähigkeit, den „Raum der Gründe“ kontrollieren zu können, besteht nach Pinkard in der Unmöglichkeit, in diesem eine unbedingte Orientierung finden zu können, gerade auch in normativen Zusammenhängen. Er schließt daraus, dass wir den Unbedingtheitsanforderungen unserer eigenen praktischen Vernunft („unconditional demands of practical reason“) nicht gerecht werden können. Aber dieser Schluss führt nicht zu einer „Einschränkung der Autorität“ dieser problematischen Eigenschaft unserer reflexiven Natur bzw. einem positiven Verständnis derselben, sondern bedeutet allein deren Konstatierung. Ich denke, dass man auch anders mit diesem Sachverhalt umgehen kann. Zum einen kann unsere Unfähigkeit, den „Raum der Gründe“ kontrollieren zu können, in dem Sinne verstanden werden, dass intersubjektiv gültige Gründe unserer individuellen Willkür und damit auch unserer individuellen Kontrolle entzogen sind; ohne dass damit eine thematische Beschränkung auf konventionelle oder konsensuelle Sachverhalte verbunden wäre. Zum anderen kann diese Unfähigkeit zugleich dahingehend interpretiert werden, dass die subjektive Einsicht in intersubjektiv gültige Gründe intersubjektiv nicht erzwungen werden kann und der „Raum der Gründe“ auch in diesem Sinne unserer Kontrolle entzogen ist. Zu jeder begründeten Einsicht braucht es die individuelle Willkür eines Subjektes, das begründet einsehen kann und will. Die Suche nach intersubjektiv begründbaren Aussagen ist keine Zwangsveranstaltung, sondern steht unter der Bedingung der Freiheit. Für den theoretischen Diskurs heißt das mit Benard Williams: „if it were not uncoerced, we could not explain it as a process that arrives at truth.“414 412 Ebd., Seite 138f. Ebd., Seite 191. 414 Williams (1985), Seite 171. 413 187 Die Suche nach einem unbedingten Grund, das habe ich bereits weiter oben deutlich gemacht, sehe ich als den Versuch an, ein zwingendes Argument für eine bestimmte Aussage oder anderweitiges Verhalten zu finden, sei es intra- oder intersubjektiv. Folgt man der wiederum nicht erzwingbaren Einsicht, dass Wahrheit und Freiheit keine gegensätzlichen, sondern komplementäre Charakteristiken unseres reflexiven Verhaltens sind, dann erscheint allein schon die Suche nach einem zwingenden, unbedingten Grund als ein wahrheitswidriges Unternehmen, geschweige denn die Behauptung eines solchen. Versteht man die fehlende Kontrolle des „Raums der Gründe“ in diesem Sinne, so kann derselbe in einem viel unproblematischerem, wenn auch nicht unproblematischen Licht erscheinen als er dies bei Pinkard tut. Seine Problematik kann dann vielmehr mit der Möglichkeit wahrer oder objektiver Erkenntnisse überhaupt gleichgesetzt werden. Ich unterstelle Pinkard nicht, selbst der Versuchung unbedingter Begründungen erlegen zu sein. Aber in seiner Absage an die Möglichkeit, aus dem „Raum der Gründe“ eine nichtkonventionelle oder nicht-konsensuelle normative Orientierung zu gewinnen, weil eine solche einen unbedingten Grund voraussetzen würde, den wir, wie er zu Recht meint, zu geben natürlich nicht fähig sind, hält er meines Erachtens negativ an jener Suche nach unbedingten Begründungen fest. Deutlich wird dieses negative Festhalten an unbedingten Begründungen schließlich auch in seinem Verständnis des Moralbegriffes. Diesen konzipiert er in Abhängigkeit von den ihrer Unbedingtheit entkleideten quasi-unbedingten Normgründen; hält also auch hier negativ an der Orientierung des Moralbegriffes an unbedingten Gründen fest. Damit scheint eine begriffliche Unabhängigkeit der Moralität von jenen negativ-unbedingten Gründen unmöglich zu sein. Noch einmal und auf unser modernes Politikverständnis hin zusammengefasst: Pinkard begründet den modernen Moralbegriff durch die mit dem modernen Selbstverständnis verbundene Annahme unbedingter individueller Rechte und der aus dieser erwachsenden Widersprüchlichkeit zwischen der angenommenen Unbedingtheit derselben und der alltäglichen Praxis, in der diese Rechte offenbar nicht unbedingt gelten. Nur insofern wir an dieser Unbedingtheit festhalten und damit in jenen Widerspruch geraten, gibt es überhaupt einen Grund, nach einem moralischen Verhalten zu fragen. „Rights require recognition both of their unconditional status and of their relative status within a distinct way of life. That makes them necessary and deeply problematic. Only the ,moral point of view‘ – the standpoint Socrates invented – can promise to carry out such an adjudication [...]. [...] ,morality‘ is (for us moderns) to be justified by its being necessary for the actualization of ,abstract rights.“ Die Unbedingtheit der individuellen Rechte wird bei Pinkard, wie deutlich gemacht, zu einer speziellen Ausprägung jener in den philosophiegeschichtlichen Anfängen von Sokrates, Platon und Aristoteles vorangetriebenen individuellen Distanzierung von allen kontingenten Verhaltensanforderungen und der damit einhergehenden 188 Orientierungsproblematik, die diese über die Annahme eines Guten, Wahren und Schönen bzw. des unbewegten Bewegers auflösen wollten. Mit Hegel führt Pinakrd aus, dass für die moderne Lebensform oder Kultur eine solche Auflösung der Orientierungsproblematik zwar nicht mehr gangbar sei, dennoch aber auch sie in jener nicht mehr aus der Welt zu schaffenden reflexiven Distanzierung des individuellen „Selbst“ der Aufgabe einer Setzung eines unbedingten Bezugspunktes nicht entgehen könne, um die reflexive Suche nicht in einem unendlichen Regress ins Nirgendwo laufen zu lassen und damit jegliche subjektive sowie intersubjektive Orientierung und Ordnung unmöglich zu machen. „Hegel [...] thought that this task was always in the process of being accomplished and that it is our reflective consciousness of this ongoing process of understanding the world and ourselves as the kinds of creatures who must ask those questions that is the permanent element in the story.“415 Es sei nun als eine historisch gewachsene Tatsache zu betrachten, dass man sich in der Moderne darauf geeinigt hat, diese Unbedingtheit in die individuellen Rechte und damit verbunden in den politischen Status des Individuums zu setzen. „This self-orgiginating status of ,individual‘ is a social status sustained in a structure in which agents recognize each other as entitled to that status and in which agents take this entitlement to be an unargued premise of the social order.“ Die sich aus den individuellen Rechten ergebenden Widersprüche und die darin liegende Notwendigkeit eines moralischen Verhaltens machen eine institutionelle Organisation notwendig, „that makes these unavoidable tensions livable and rational to hold.“416 „[...] it [...] requires a form of life of rights-bearing, moral individuals, who acquire a sense of egalitarian right from childhood onward, whose participation in civil society is coupled with a feel for what is practical and workable, and whose political temperament is shaped by a shared commitment to political and social justice. It requires a ,second nature‘ that can live without enchanted illusions but not without ideals and that, like all other human strivings, succeeds only when it also aims at truth.“417 Es bleibt dabei; es scheint mir eine Wahrheit zu sein, dass Pinkard mit seiner Argumentation dem normativen Relativismus nichts entgegenzusetzen hat, als die Beschreibung einer historischen gewachsenen Lebensform, in der man sich auf bestimmte als unbedingt geltende Normen geeinigt hat, die jedoch gerade in der theoretischen Kritik ihrer Relativität überführt werden. Der Moralbegriff erscheint überhaupt nicht erst als Möglichkeit, dem Relativismus reflexiven Widerstand leisten zu können, weil er selbst in Abhängigkeit zu jenen relativen Normsetzungen konzipiert wird. 415 Pinkard (2012), Seite 188. Ebd., Seite 138. 417 Ebd., Seite 187. 416 189 Der zentrale Dreh- und Angelpunkt in Pinkards an Hegel angelehnter Argumentation ist dabei die Annahme, dass aus den Bedingungen unserer Reflexivität in normativen Zusammenhängen unausweichlich die Behauptung eines unbedingten Grundes erwachse und aus dieser jene Widersprüche, die Moralität erst erforderlich machen. In der Thematisierung des Begriffes eines „unbedingten Grundes“ gilt es nun meiner Ansicht nach Folgendes zu beachten, um mit der beschriebenen Problematik umzugehen – nicht um sie zu kontrollieren. Erstens sind Gründe immer bedingt, weil ein Grund ein wahrnehmendes Subjekt voraussetzt, das einen Sachverhalt als einen Grund überhaupt wahrnehmen kann und will. Zweitens kann ein Grund insofern als „unbedingt“ angesehen werden, insofern der als Grund wahrgenommene Sachverhalt als unabhängig von seiner Wahrnehmung durch das Subjekt bestehend gelten kann. Und drittens kann einem solchen von der Wahrnehmung des Subjektes als unabhängig geltenden Sachverhalt eventuell Unbedingtheit zugesprochen werden. Aber weder durch eine solche UnbedingtheitsZuschreibung noch durch Unabhängigkeit von der Wahrnehmung eines Subjektes wird ein Sachverhalt auch schon zu einem Grund für ein solches. Es kann einen unbedingten Sachverhalt geben, niemals aber einen unbedingten Grund dafür, einen solchen oder sonstige von der subjektiven Wahrnehmung unabhängige Sachverhalte anzunehmen bzw. als Grund anzuerkennen. Anders herum heißt dies jedoch nicht, dass es nicht bedingte Gründe für die Annahme wahrnehmungsunabhängiger bedingter Sachverhalte oder eines wahrnehmungsunabhängigen unbedingten Sachverhaltes geben kann. Mit diesen Anmerkungen im Hinterkopf kann man sich nun fragen, welchen bedingten Grund wir haben, der es uns plausibel erscheinen lässt, dass wir im Sinne der „unconditional demands of practical reason“ normative Sachverhalte, im Kontext der Moderne individuelle Rechte, notwendig mit der Eigenschaft unbedingter Geltung verbinden müssen. Mir fällt kein Grund ein. Pinkard führt mit Hegel die Bedingung unserer selbst-bezüglichen Reflexion an. Aber auch in dieser, das habe ich zu Beginn dieses Kapitels deutlich gemacht, kann ich keinen solchen Grund finden. Im Gegenteil, die selbst-bezügliche Reflexion führte an einen Punkt, an dem das Eingeständnis der Unmöglichkeit der Erkenntnis einer unbedingten Normgeltung und nicht die Behauptung einer solchen erfolgte. Es bleibt zu überlegen, ob die Bedingungen unserer intersubjektiven Praxis für uns einen Grund darstellen können, die unbedingte Geltung von Normen behaupten zu müssen. Aber auch hier scheint mir die Antwort negativ auszufallen. Erstens wird, so auch laut Pinkard, gerade in der intersubjektiven Praxis die angenommene Unbedingtheit der Normgeltung in Frage gestellt; und zweitens gibt es eine schier unübersehbare Anzahl von Normen, die in unserer Praxis Geltung haben, ohne dass wir dafür die Unbedingtheit ihrer Geltung annehmen müssten. Der einzig plausible mir ersichtliche Grund, warum versucht wird, bestimmten Normen eine unbedingte Geltung zuzuschreiben, ist der, dass diese Normen denjenigen, die ihnen 190 unbedingte Geltung zuschreiben, von herausragender Bedeutung sind, und die deshalb in der intersubjektiven Reflexion diesen Normen durch die Behauptung ihrer unbedingten Geltung ein unhintergehbares, zwingendes Antlitz verschaffen wollen. Dieser bedingte Grund ist aber kein Grund, der es plausibel machen könnte, warum wir Normen eine unbedingte Geltung zuschreiben müssen, sondern einer, der es plausibel macht, warum allein wir dies tun. Eine solche Zuschreibung von Unbedingtheit wird dann aber alles andere als der „Forderung einer vom subjektiven Interesse und Gestalt sowie von der Zufälligkeit der Macht befreiten“ Norm gerecht, sondern ist vielmehr die Vortäuschung einer solchen Eigenschaft.418 Es gibt meines Erachtens nicht nur keinen bedingten Grund, der dafür spricht, Normen eine unbedingte Geltung zuzuschreiben, sondern es spricht meines Erachtens sogar vieles dafür, eine solche Zuschreibung zu unterlassen, weil sie uns von einem wirklichen Verständnis unserer Normsetzungen und der Gründe, die für oder gegen bestimmte Normen sprechen, abhalten und unter Umständen der „Zufälligkeit der Macht“ gerade in die Hände spielen können. Normativität ist immer an subjektive Interessen zurückgebunden und daran kann auch die Behauptung ihrer Unbedingtheit nichts ändern – warum hat sich Kant wohl so sehr darauf konzentriert, das „moralische Gesetze“ nicht nur als reinen individuellen Willen, also als reines Interesse eines jeden vernünftigen Individuums, sondern auch mit der Aussicht auf die Glückseligkeit zu konzipieren? Auf diesen Zusammenhang habe ich bereits hingewiesen.419 Ich spreche mich hier entschieden gegen die Annahme unbedingter Geltung von Normen aus. Schließlich kommt alles auf die Frage an, ob wir bedingte Gründe für einen von subjektiver Wahrnehmung unabhängigen, intersubjektiv gültigen und bedingten Sachverhalt angeben können, der nicht vorgibt, subjektive Interessen überhaupt aus dem Spiel lassen zu können, dennoch aber dem Objektivitätsanspruch gerecht werden und so sowohl dem Relativismus als auch der Machtproblematik reflexiv etwas entgegenhalten kann. Die Frage habe ich in diesem Kapitel in der Thematisierung von moralischen Ansprüchen und moralischen Interessen interessierter, erlebender und freier Subjekte positiv zu beantworten versucht. Nach Pinkards Argumentation müsste mit der Absage an Unbedingtheitsannahmen auch der Begriff der Moral bzw. Moralität in normativen Zusammenhängen seine Anwendbarkeit verlieren, weil er an die Bedingung der Setzung unbedingter Normen und die mit dieser einhergehenden Widersprüche gebunden sei, ja überhaupt durch diese gerechtfertigt würde: „,morality‘ is (for us moderns) to be justified by its being necessary for the actualization of ,abstract rights‘.“ Ohne diese würde Moralität jeglichen Inhalts bar, wenn man so will ein Wortklang bzw. -bild ohne Bedeutung. 418 419 Hegel (1986), § 103, Seite 197. Vgl. Seite 172 dieser Arbeit. 191 In dem in diesem Kapitel entwickelten und von bestimmter Normativität unabhängigen Verständnis von Moralität als einem freiwilligen Anpassen an die dem eigenen Interesse widersprechenden Interessen anderer erscheint dieser Schluss als unbegründet. Und Pinkard selbst nennt diese Bedeutung versteckt, wenn er schreibt: „Only the ,moral point of view‘ – the standpoint Socrates invented – can promise to carry out such an adjudication since it commits us both to doing the right thing because it is the right thing, even in those cases where it goes against our own interests, and doing the right thing from a standpoint that transcends any particular point of view [Hervorhebung T. W.].“ Nur würde ich, anders als Pinkard, eben weder sagen, dass Moralität „even in those cases where it goes against our own interests“ eine Rolle spielt, sondern allein in diesen Fällen; noch, dass der „moral point of view“ ein Standpunkt ist, „that transcends any particular point of view“, weil moralisches Verhalten sich gerade in der Annäherung konkreter sich widersprechender Interessen vollzieht. Und da Interessenswidersprüche die potentiellen Bruchstellen aller sozialen Zusammenhänge sind, ist Moralität, wenn auch keine unbedingte, so sie an die Existenz interessierter, erlebender und freier Subjekte und deren Interessen gebunden ist, doch aber eine für ein befriedigendes Zusammenleben derselben notwendige Voraussetzung. Und unter der Bedingung, dass wir einen solchen sozialen Zusammenhalt suchen wollen, sprechen alle Gründe dafür, moralisches Verhalten als die oberste Norm gesellschaftlichen Lebens zu setzen; damit aber auch dafür, den Wert und die Würde eines jeden Individuums sowie Gleichheit und Gerechtigkeit als die zentralen Prinzipien unseres Verhaltens anzuerkennen. Diese Behauptung ist nicht als Widerspruch gegen die historische Tatsache zu verstehen, dass sich maßgeblich erst in der Moderne diese Prinzipien als Prinzipien in politischen Prozessen zu explizieren beginnen. Aber es ist ein Widerspruch gegen die These, dass „die“ moderne Lebensform „of rights-bearing, moral individuals, who acquire a sense of egalitarian right from childhood onward, [...] and whose political temperament is shaped by a shared commitment to political and social justice“ [Hervorhebungen T. W.] am Ende durch die aus normativen Unbedingtheitsannahmen entstehenden Widersprüche zu rechtfertigen sei: „There must be an institutional setup that makes these unavoidable tensions livable and rational to hold.“ Ich halte es für ein Faktum unserer natürlichen Vernunft, dass das moralische Verhalten und damit Wert und Würde eines jeden Individuums sowie Gleichheit und Gerechtigkeit als oberste Prinzipien gesellschaftlichen Zusammenlebens aus unserer bedingten Natur allein begründbar sind – und dieses Faktum, um Pinkards Worte auf das für all dies vorauszusetzende, einem jedem Organismus zugrunde liegende, zweckfreie individuelle Interesse am Erleben zu wenden, „goe(s) as deeply as any organic fact can go“; nicht aus einem Widerspruch zwischen unserer Reflexion und unserer Praxis, sondern aus den Widersprüchen konkreter individueller Interessen und der mit diesen einhergehenden individuellen moralischen Ansprüchen 192 sowie moralischen Interessen kann moralisches Verhalten als das einzige vernünftige Prinzip gesellschaftlichen Verhaltens gerechtfertigt werden. Auch vor diesem Hintergrund gilt in gewisser Weise, was Pinkard mit Bezug auf Kant festhält: „each agent is both sovereign as lawmaker and subject to the commands of a moral law whose validity and binding power transcend his own individuality.“ Nur ist diese moralische Transzendenz der Individualität dann nicht als Bezug zu einem abstrakten Gesetz oder Sollen zu verstehen, sondern als Transzendenz zu anderen konkreten Individuen. Das moralische Sollen gründet in konkreten Beziehungen interessierter, erlebender und freier Subjekte. Sein konkreter Inhalt ist immer wieder neu das konkrete Ergebnis der Auflösung eines konkreten Interessenwiderspruches individueller Subjekte in gegenseitiger moralischer Zuwendung. In dem hier vorgeschlagenen Verständnis erscheint Pinkards Frage in Bezug auf den scheinbar paradoxen politisch-rechtlichen Status der Individualität, „How, then, can agents sustain a kind of mutual recognition of a status that looks as if it asserts itself as not being dependent on any kind of recognition as a status at all?“ einer „einfachen“ Beantwortung zugänglich. Der Status der Individualität und der mit diesem verbundenen moralischen Ansprüchen und Interessen ist primär kein politischrechtlicher, sondern ein natürlicher, den wir, soweit wir uns für ein befriedigendes Leben in Gesellschaft entscheiden wollen, konsequenterweise auch sekundär in politischem Kontext anerkennen, in unserer Rechtsetzung als oberstes Prinzip berücksichtigen und in der Rechtsprechung bis hin zum Strafrecht und -vollzug Ausdruck verleihen sollten – das bedeutet unsere moralische Sorgfalt. Die politisch-rechtliche Anerkennung des natürlichen Status ist keine Selbstverständlichkeit, sondern bleibt an die Bedingung ihres tagtäglichen Vollzuges, an das moralisch-politische sowie das moralische Verhalten eines jeden Individuums einer Gesellschaft gebunden, ist allein praktisch zu konkretisieren und kann nicht theoretisch vorweggenommen und abgesichert werden. Hier stimme ich Pinkard zu, Moralität ist am Ende eine nicht formalisierbare praktische Fähigkeit, ein „practical skill that resists formal codification“, oder anders, eine praktische Haltung – das bedeutet unser moralisches Wagnis. Diese Sorgfalt und dieses Wagnis sind eine Möglichkeit unserer bedingten natürlichen Pflicht.420 „[...] any ethical determinate outlook is going to represent some kind of specialization of human possibilities. That idea is deeply entranched in any naturalistic, or, again, historical conception of human nature – that is, in any adequate conception of it – and I find it hard 420 An dieser Stelle stellt sich spätestens die Frage nach dem Verhältnis des vorgeschlagenen Moralbegriffs zu dem Begriff des Naturrechts. Ich kann hier keine Diskussion dieses Verhältnisses leisten, sondern allein meiner Position kurz Ausdruck verleihen, dass ich davon ausgehe, dass alles Recht vom Menschen gesetzt wird und ich insofern den Begriff des Naturrechts ablehne, soweit er die unbedingte Geltung von Rechten vertritt. Das heißt aber nicht und sollte deutlich geworden sein, dass ich der Meinung wäre, dass die theoretische Betrachtung der menschlichen Natur nicht hinlangen würde, plausible Gründe für eine nicht bloß relativistische Normsetzungs- und Vollzugspraxis zur Verfügung zu stellen. 193 to believe it will be overcome by an objective inquiry, or that human beings could turn out to have a much more determinate nature than this suggested by what we already know, one that timelessly demanded a life of a particular kind. The project of giving to ethical life an objective and determinate grounding in considerations about human nature is not, in my view, very likely to succeed. But it is at any rate a comprehensible project, and I believe it represents the only intelligible form of ethical objectivity at the reflective level.“421 Wie ich schon mehrfach deutlich gemacht habe, stimme ich diesen Anmerkungen von Bernard Williams zu, teile jedoch nicht seine Skepsis, insofern wir meines Erachtens aus der theoretischen Betrachtung der menschlichen Natur hinreichende Gründe zu finden in der Lage sind, welche die Annahme des moralischen Verhaltens als der obersten, quasiahistorischen Norm gesellschaftlichen Zusammenlebens rechtfertigen. Dass diese Norm in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft keineswegs sämtliche Lebensformen bzw. Kulturen in diesem Sinne geprägt hat, prägt und möglicherweise auch nicht prägen wird, ist eine damit völlig in Einklang stehende Feststellung. Es liegt an uns und unserer Bereitschaft, das moralische Verhalten als oberste Norm zu setzen und dieser nachzuleben. Es liegt an uns, tagtäglich neu herauszufinden, was unser moralisches und moralisch-politisches Verhalten im Konkreten für uns individuell und gesellschaftlich bedeuten kann. Moralisches Verhalten beruht auf Freiwilligkeit. Auch ist es nicht der Fall, dass diese Norm eine Forderung nach einer zeitlosen Lebensform oder Lebensart bedeutet („timelessly demanded a life of a particular kind“), doch aber nach einer bestimmten, wenn eben auch nicht weiter formalisierbaren Haltung, in der nach einem lebendigen Zusammenleben stets neu zu suchen ist. Dies ist kein Widerspruch zum normativen Festhalten am moralischen Verhalten sowie damit einhergehend an den Prinzipen des Wertes und der Würde aller Individuen sowie an Gleichheit und Gerechtigkeit. Denn diese Prinzipien sind die Bedingungen unter denen ein solches Suchen allein gelingen kann. Auch Williams Denken scheint mir, ähnlich wie das Pinkards, in gewisser Hinsicht von einem negativen Festhalten an unbedingten Begründungen im Kontext normativer Objektivitätsannahmen geprägt. Denn auch er versteht Moralität als einen an Unbedingtheit gebundenen Begriff, sieht ihn geknüpft an die Bedingung eines unbedingten unparteiischen Standpunktes. „How can I that has taken on the perspective of impartiality be left with enough identity to live a life that respects its own interests? If morality is possible at all, does it leave anyone in particular for me to be? These are important questions about both morality and life: about morality because, as a particular view of the ethical, it raises that question in a particularly acute form, and about life because there are, on any view of ethical questions, real issues about the relations between impartiality and personal satisfactions and aims – or, indeed, personal commitments that are not necessarily egoistic but are narrower than those imposed by a universal concern or respect for 421 Williams (1985), Seite 153. 194 rights.“422 Hätte sich Williams von der Bindung des Moralbegriffes an einen unbedingten unparteiischen Standpunkt gelöst und wie in dieser Arbeit für eine Rückbindung der Moralität an individuelle Interessen argumentiert, dann wäre sein Urteil über einen möglichen positiven Ausgang des Projektes „of giving to ethical life an objective and determinate grounding in considerations about human nature“ vielleicht weniger skeptisch ausgefallen. So aber kommt er zu dem Ergebnis: „Many philosophical mistakes are woven into morality. It misunderstands obligations, not seeing how they form just one type of ethical consideration. It misunderstands practical necessity, thinking it peculiar to the ethical. It misunderstands ethical practical necessity, thinking it peculiar to obligations. Beyond all this, morality makes people think that, without its special obligation, there is only inclination; without its utter voluntariness, there is only force; without its ultimately pure justice, there is no justice. Its philosophical errors are only the most abstract expressions of a deeply rooted and still powerful misconception of life.“423 Die Kritik richtet sich in philosophischer Hinsicht hauptsächlich gegen Kant. Man kann mit Recht in Frage stellen, ob diese Vorwürfe in Gänze der kantischen Philosophie gegenüber gerechtfertigt sind. Mit Sicherheit sind sie es aber nicht gegenüber einem Moralbegriff der mit Nietzsche „das Individuum [...], welches seine wohlverstandenen Interessen gegen andere Individuen vertritt (Gerechtigkeit unter Gleichen, insofern es das andere Individuum als solches anerkennt und fördert) [Hervorhebung im Original; T. W.]“ und die Suche desselben nach einem befriedigenden Leben zum Ausgangspunkt nimmt. Bei dieser Suche, darauf hat Williams selbst hingewiesen, „It is not enough, though, [...] merely that we should not be frustrated in doing whatever it is we want to do. We might be able to do everything we wanted, simply because we wanted too little. We might have unnaturally straitened or impoverished wants. This consideration shows that we have another general want, if an indeterminate one: we want (to put it vaguely) an adequate range of wants.“424 Im Zusammenhang des Fortschrittsbegriffes und des vorgeschlagenen Begriffes moralischen Verhaltens können wir nun etwas genauer konkretisieren, worin außer dem Interesse an einem befriedigenden Leben ein adäquater Umfang an Interessen liegen kann. Neben unseren sonstigen Interessen sollte uns daran gelegen sein, ein moralisches Interesse und ein moralisch-politisches Interesse zu entwickeln; unter der Bedingung, dass uns an einem befriedigenden Leben in Gesellschaft gelegen ist. Es ist also kein unbedingtes Sollen, sondern eines, das von der individuellen Entscheidung, ein solches Leben zu suchen, und einer daran sich anschließenden Konsequenzhaftigkeit 422 Ebd., Seite 69f. Ebd., Seite 196. 424 Ebd., Seite 57. 423 195 im Denken und Verhalten abhängig bleibt. Diese moralische Bedingtheit ist wiederum Ausdruck des ethischen Restdezisionismus, von dem mit Schnädelbach schon mehrmals die Rede war. Und ich selber sehe diesen in genauer Kongruenz zu der von Pinkard beschriebenen fehlenden Kontrolle über den „Raum der Gründe“ oder, positiv formuliert, zu der auch in diesem sich ausdrückenden bedingten, oder mit Kodalle, unbestimmten Freiheit, ohne die wir zu wahren Erkenntnissen überhaupt nicht erst gelangen könnten – da bin ich mit Williams einer Meinung. In die Freiheit des Lesers ist es nun gestellt, die Argumentationen und Begründungen, die hier für die Annahme des moralischen Verhaltens als vernünftigerweise oberster Norm gesellschaftlichen Zusammenlebens gegeben wurden, nachzuvollziehen, zu kritisieren oder weiterzuentwickeln; und sich im für den Autor positiven Falle vielleicht dabei das eine oder andere Mal zu fragen: Wissen wir das alles nicht irgendwie immer schon? Befriedigung und die Bedingungen moralischen Verhaltens Setzt man das moralische Verhalten im hier entwickelten Sinne als oberste Norm intersubjektiver Interaktion, so stellt sich in der theoretischen Erörterung ein entscheidendes Problem. Dieses Problem wird sichtbar, wenn man sich noch einmal deutlich vor Augen führt, was mit dem moralischen Verhalten gefordert wird. Ich habe herausgearbeitet, dass es für Moralität allein entscheidend ist, dass im Falle eines Interessenwiderspruches die physische und psychische Macht der beteiligten Subjekte allein in einer freiwilligen Annäherung und Modifikation der jeweiligen individuellen Interessen ihren Ausdruck findet. Es gibt weder eine allgemeingültige inhaltliche Vorgabe, welche Interessen in einer moralischen Verhandlung zur Disposition stehen, noch in welches Ergebnis eine solche Verhandlung in moralischer Perfektion inhaltlich zu münden hätte. Entscheidend ist allein die Haltung, in der nach einer Lösung gesucht und eine solche gefunden wird. Diese Haltung ist von der gegenseitigen Anerkennung des Wertes und der Würde sowie in dieser Anerkennung von den Prinzipen der Gleichheit und Gerechtigkeit bestimmt. Die in ihren Interessen sich widerstreitenden Subjekte sollen in gleicher Weise den Wert und die Würde des jeweils anderen anerkennen, dem gegenseitigen Anspruch auf moralisches Verhalten in der Anpassung ihrer jeweiligen individuellen Interessen in gleicher Weise gerecht werden. Wie aber ist ein solches moralisches Verhalten nicht seinem Begriffe nach, sondern praktisch bzw. seiner Wirklichkeit nach möglich? Leonard Nelson hat im Rahmen seiner Formulierung des „Sittengesetzes“ die Forderung aufgestellt, „daß wir unsere Interessen so weit einschränken, wie wir sie einschränken würden, wenn die fremden Interessen auch unsere eigenen wären [...].“425 Doch wie sollten 425 Nelson (1972), Seite 134. 196 wir als Individuen jemals dazu in der Lage sein, den widerspruchsvollen fremden Interessen in gewisser Weise den gleichen Status wie den unsrigen einzuräumen? Interindividuelle Interessenskonflikte sind ja zum einen und zunächst gerade dadurch bestimmt, dass die konkreten zum Widerspruch führenden Interessen eben nicht jeweils in gleicher Weise individuelle Berücksichtigung finden. Zum anderen halte ich es für ausgeschlossen, dass durch eine reflexive Integration der widersprüchlichen Interessen anderer diese Asymmetrie tatsächlich aufgehoben werden könnte. Die Reflexion der Interessen anderer macht diese nicht schon zu unseren Interessen. Wir sind interessierte, erlebende und freie individuelle Subjekte und können diese Natur auch in der Reflexion nicht hinter uns lassen. Wir können uns nicht in einer Weise von unseren individuellen Interessen distanzieren, die es ermöglichen würde, die Interessen anderer so zu unseren zu machen, als ob sie unsere eigenen wären, oder wie Nelson sagt, als ob „die Interessen der anderen mit den unsrigen in einer Person vereinigt wären.“426 Für eine solche Fähigkeit müssten wir uns unserer Individualität, unseres individuellen Interessiert-Seins, unserer individuellen interessierten Natur entheben und uns zu einem von dieser unbedingten unparteiischen Standpunkt aufschwingen können. Nur so könnte diese Asymmetrie in der reflexiven Berücksichtigung der Interessen anderer nicht nur relativiert, sondern zumindest theoretisch entschärft werden. Und gerade die Zuschreibung einer solchen Fähigkeit kann man etwa mit Williams zu Recht bezweifeln: „How can I that has taken on the perspective of impartiality be left with enough identity to live a life that respects its own interests? If morality is possible at all, does it leave anyone in particular for me to be?“427 Ich denke, dass es für ein Subjekt unmöglich ist, einen interesselosen oder unparteiischen Standpunkt in der Welt einzunehmen, von dem aus es über seine Interessen entscheiden könnte. Ein über den grammatikalischen oder den logischen Sinn hinausgehendes Subjekt zu sein, bedeutet immer schon, mindestens ein Interesse zu haben. Ein Interesse kann also immer nur durch andere Interessen relativiert werden. Über ein Interesse abzuwägen bedeutet nicht, einen unparteiischen Standpunkt gegenüber diesem einzunehmen, sondern sich von ihm zu distanzieren, indem man reflexiv Partei für andere Interessen ergreift. Und in diesem Sinne beschreibt auch Pinkard das Selbstbewusstsein eines Subjektes nicht als ein Bewusstsein über sich selbst als einem von allen Interessen losgelösten Ich, sondern als das Residuum der reflexiven Distanzierung von sämtlichen Interessen im Sinne der Erkenntnis, dass jedes Interesse durch jeweils andere Interessen in Frage gestellt werden kann. „Self-consciousness establishes a potential distinction of itself from each and every 426 427 Ebd. Williams (1985), Seite 69f. 197 end an agent may elect in that each can entertain the possibility of throwing any of those ends into question in the light of other ends.“428 Um genau zu bleiben, müsste man meiner Ansicht nach jedoch noch einen Schritt weiter gehen. Die Distanzierung von sämtlichen Interessen, von der Pinkard schreibt, ist in Wahrheit keine Distanzierung von sämtlichen Interessen, sondern entspringt selbst einem Interesse, von dem man sich in dieser Distanzierung gerade nicht distanziert. Ähnlich hat Bernard Williams mit Bezug auf John Rawls’ „Schleier des Nichtwissens“ darauf aufmerksam gemacht, dass das Bemühen um einen möglichst unparteiischen Standpunkt selbst als ein Interesse, oder wie er sagt, eine Disposition zu verstehen sei: „Unless you are already disposed to take an impartial or moral point of view, you will see as highly unreasonable the proposal that the way to decide what to do is to ask what rules you would make if you had none of your actual advantages, or did not know what they were.“429 Anders als Williams und im Hinblick auf den oben vorgeschlagenen Moralbegriff würde ich solche reflexiven Versuche der Unparteilichkeit in Bezug auf die Setzung allgemeiner normativer Konventionen, Regeln und Gesetze nicht primär als moralisches Verhalten verstehen, sondern nur sekundär als Ausdruck eines aus moralischem Anspruch und moralischem Interesse erwachsenden moralisch-politischen Interesses. Man muss solche Gedankenexperimente der Unparteilichkeit nicht ablehnen und ihre sinnvolle heuristische Funktion in normativen Zusammenhängen negieren, um zugestehen zu können, dass ein unparteiischer Standpunkt für ein Individuum erstens keine real einzunehmende Perspektive darstellt und zweitens solche Gedanken selbst einem bestimmten Interesse folgen. Meines Erachtens gilt es festzuhalten, dass man über ein Interesse nur insofern abwägen kann, als man es durch reflexives Parteiergreifen für andere Interessen in Relation zu diesen in Frage stellt. Über Interessen abzuwägen bedeutet also nicht, wie bereits erwähnt, einen unparteiischen Standpunkt gegenüber diesen einzunehmen, sondern sich von diesen zu distanzieren, indem man reflexiv Partei für andere Interessen ergreift. Ein Interesse in Frage zu stellen, bedeutet also immer, mindestens für ein anderes Interesse Partei zu ergreifen. Bei solchen Reflexionen handelt es sich also eher um Unentschiedenheit als um Unparteilichkeit. Nun kommt im Rahmen des moralischen Verhaltens, wie gesagt, alles darauf an, dass die Annäherung der Interessen ohne physische oder psychische Unterdrückung des jeweils Anderen vollzogen wird. Diese Bedingung lässt die Auflösung des Widerspruches nicht nur inhaltlich völlig offen, sondern auch bezüglich der Frage, ob die Lösung dadurch erreicht wird, dass sich einer dem Interesse des anderen völlig anpasst, d.h. freiwillig auf sein Interesse verzichtet, oder ob das Ergebnis in einem wie auch immer gearteten Kompromiss besteht. Für die moralische Qualität ist allein entscheidend, dass die 428 429 Pinkard (2012), Seite 105. Williams (1985), Seite 64. 198 jeweiligen Subjekte ihre Macht im Sinne einer freiwilligen Annäherung ihrer Interessen nutzen. Für das moralische Verhalten gibt es über die Anerkennung des Wertes und der Würde und die Beachtung von Gleichheit und Gerechtigkeit hinaus keine allgemeinen Regeln, die darüber bestimmen könnten, wie ein Interessenswiderspruch gelöst werden soll. Und genau genommen handelt es sich bei diesen Regeln nur um die allgemeine Charakterisierung eines praktischen Verhaltens, das seiner Wirklichkeit nach keine Regel, sondern eine jeweils individuell und wirklich einzunehmende praktische Haltung bedeutet. Eine Haltung, deren Vollzug mit Nietzsche vielmehr als ein vorsichtiges Abtasten, ein Gerecht-Werden und ein Erkennen der eigenen und fremden Grenzen, ein gegenseitiges Respektieren, als Feinfühligkeit, Empfindsamkeit und Leidensfähigkeit beschrieben werden kann, denn als Einhalten bestimmter, konventioneller Vorstellungen, Regeln oder Gesetze; vielmehr beschrieben werden kann als ein experimentelles Erforschen der Möglichkeiten, als ein technisch-instrumentelles Wissen; oder wie Pinkard sagt, als „practical skill that resists formal codification“. 430 Wie aber ist eine solche Haltung wirklich möglich? Das Problem, auf das ich hier hinaus will, kann man mit Mark Johnston und in Anlehnung an Augustinus und Martin Luther als Eigenschaft interessierter, erlebender und freier Subjekte beschreiben, in sich selbst „gebogen“ oder „gekrümmt“ zu sein. Was Augustinus und Martin Luther mit dem Ausdruck „incurvatus in se“ bezeichnet haben, kann man genau in dem hier problematisierten Zusammenhang als die Eigenschaft verstehen, sein individuelles interessiertes Dasein nicht hinter sich lassen zu können.431 Auch Johnston unterscheidet zwischen konventionellen Vorstellungen, Regeln und Gesetzen – deren Einhaltung er, anders als ich dies tue, mit dem Begriff der Moral engführt – und der Möglichkeit zu einem wirklich guten Verhalten anderen gegenüber. Erstere könnten Letzterem entschieden entgegenstehen: „And there is considerable evidence that the triumph of moral effort over self-will [...] is far from costless when it comes to the virtues of flexibility, openness, self-directed irony, and an appreciation of the festive character of life.“432 Jedoch, so fragt er weiter: „What of the no doubt attractive, and even to some degree excellent, life of a person who has the ordinary virtues of self-confidence, flexibility, openness, self-directed irony, perseverance, fair-dealing, moderation, and good judgment? [...] we are still left with two things that speak against the claims of the life of ordinary virtue to be the ethical life. One is the reminder that the apparent selfsustainability of the ordinary virtuous life is merely apparent, given the large-scale structural defects of human life. Those defects present themselves either as destructive fates that will obliterate much of the significance of virtue, or as intimations that there is something more than ordinary virtue. The second thing, and this testifies to great dignity of 430 Pinkard (2012), Seite 186. Johnston, Mark: Saving God, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009, Seite 84, 88. 432 Ebd., Seite 88f. 431 199 philosophy, is the description here and there within the philosophical tradition of a form of life distinct from and arguably higher than the virtuous life. Thus philosophy keeps to the old promise of ex veritate vita. The truly ethical life is a life in which you encounter yourself as one person among others, all equally real. This means that the legitimate interests of others, insofar as you can anticipate them, will figure on a par with your own legitimate interests in your practical reasoning – that is, in your reasoning as to what you should do and what you should prefer to happen. Inevitably, given that each one of the others counts the same as you in your practical reasoning, the interests of others often will swamp your interests in your own practical reasoning as to what you should do and prefer. For you will find yourself to be only one of the others, the one you happen to know so much about, thanks to being him or her. Here I follow Thomas Nagel in identifying the ethical life with a life whose guiding principle is radical altruism or agape.“433 Johnston führt weiter aus, dass diese Vorstellung eines ethischen Lebens zugleich deutlich mache, dass uns die Verwirklichung eines solchen aufgrund unserer Natur entzogen sei. Denn unsere praktischen Reflexionen würden auch insoweit sie sich auf die Interessen anderer beziehen und mit dem Ziel verbunden sind, diese zu berücksichtigen, am Ende abhängig bleiben von unseren impliziten oder expliziten individuellen Vorstellungen von einem bedeutungsvollen Leben („meaningful life“). Dieses beschreibt Johnston als „delicate cross-time construction, put together with some care by the agent whose life it is. It requires a systematic implementation of the agent’s distinctive conception of what is valuable; and this in its turn involves a certain blindness to, and even obtuseness about, the radical needs, and hence the legitimate interests, of all those others.“434 Ich stimme dem zu. Wir können selbst in der reflexiven Berücksichtigung der Interessen anderer unser individuelles Interessiert-Sein nicht hinter uns lassen; wir sind und bleiben in unserer interessierten Natur in uns selbst „gebogen“ oder „gekrümmt“, sind Individuen „incurvatus in se“. Johnston zieht daraus nun mit Kant den Schluss, dass wir in dem Sinne „radikal böse“ seien, insoweit wir unserer Natur nach gar nicht anders können, als die Interessen anderer und damit diese selbst zu verletzen. „Kant himself would have been among the last to deny the condition that Augustine and Luther describe as ,Homo incurvatus in se‘, the condition of man being turned in upon himself. Kant has a vivid sense of the overwhelming centripetal force of illegitimate self-love. Famously, he asserts that we are radically evil. By this Kant does not mean that we are bad to the bone and, hence, irredeemably evil. He means that by nature each one of us demands premium treatment for himself; each sets his own interests up as an overriding principle of his will, so that each is really an enemy of 433 434 Ebd., Seite 90. Ebd., Seite 90f. 200 the others and of the ethical itself.“435 Jedoch merkt Johnston kritisch an: „But what is the source of redemption from natural evil in Kant? Given that we are radically evil, then, if we have no source of redemption, do we not have a proof from Kantian premises that our sense of the demands of the moral ought are simply illusory. For ought implies can, and we can’t, at least not left to our own devices. To be sure, Kant thought that there were proofs of the immortality of the soul, of the freedom of the will, and of a just God who will come to judge us, proofs from the preconditions of moral action and the rational hope that there should be a situation in which just desert and happiness are correlated. Still, the conclusions of these proofs are propositions that we would be required to believe if Kant’s arguments are good. But belief in a proposition cannot redeem us from the condition of being incurvatus in se.“436 In Johnstons Ausführungen wird dabei eine Kritik an Kant deutlich, die im Grunde der von mir in dieser Arbeit geäußerten Kritik entspricht. Denn die von Kant in die Unendlichkeit verlängerte Unmöglichkeit der völligen Angemessenheit des Willens zum moralischen Gesetz bedeutet ja letztlich nichts anderes als der von Johnston herausgestellte Sachverhalt, dass Kants Argumentation das Problem nicht löst, wie wir unsere „radikal böse“ Natur hinter uns lassen könnten und wie damit das moralische Sollen als ein moralisches Können jemals für uns Relevanz besitzen sollte. Allerdings nähert sich Johnston der Kritik hier aus einer anderen Richtung. Während die Kritik in dieser Arbeit ihr Augenmerk auf Kants Argumentation richtete und in den Schluss überging, dass dessen Argumente, um Johnstons Wortwahl zu gebrauchen, in diesem Zusammenhang „nicht gut“ sind, konzentriert Johnston seine Kritik auf den Widerspruch in Kants Definition der menschlichen Natur als solcher. Wie können wir unsere „radikal böse“ Natur, insofern „radikal“ hier gerade meint: zu unserer Natur gehörig, in eben dieser Natur jemals überwinden? Kant hätte an dieser Stelle und im Zuge seiner Postulierung der Unsterblichkeit der Seele viel weiter ausholen und ausführen müssen, wie sich unsere Natur nach dem Tode verändert, dass eine solche Überwindung möglich wird, und wie diese Veränderung mit unserer diesseitigen Natur in Zusammenhang steht, damit die Relevanz des moralischen Gesetzes schon für unser diesseitiges Leben einsichtig werden kann. Dass Kant sich solche Spekulationen selbst versagt hat, davon kann man meines Erachtens ausgehen. Johnston fasst seine Kritik zusammen: „We are left with the anti-Kantian argument, the argument that Kant perhaps should have given: the moral ought, the felt demand that our wills should be good or be made good, and so be moved by the interests of all considered equally, is a complete illusion. For ought implies can, and because we are radically evil, we actually can’t make our wills good. The conclusion of that argument provokes moral 435 436 Ebd., Seite 91. Ebd., Seite 92. 201 despair, but we cannot back out of it by denying that we are radically evil, at least when this is properly understood. Could we try to become less evil, less turned in upon ourselves? Well, not simply by our own intentional act or acts. For those acts would have maxims, and those maxims would inevitably be rendered crooked by the centripetal force of self-love. Being radically evil, that is, natural opponents of the ethical life, we naturally can will only evil; that is, we can act only on maxims conditioned by our self-interest. So left to our own devices, willing our own improvement is just another cunning form the evil can take. [...] Here Kant’s moral theory presents as a philosophical appropriation of Christianity, an appropriation that is inconsistent because it is incomplete. We are in a condition of natural or original sin, but the ethical demand is something like the demand of agape, on its face an impossible demand given the centripetal force. Kant has sin and agape, but no redeemer. Is it not the case that the existence of a redeemer, a source of grace – that is, something transformative entering from outside our fallen natures – is also in need of being deduced as another ,postulate of practical reason‘, a belief required if we are to avoid moral despair? Kant’s problem is our problem, at least if we allow that something like agape constitutes ethical life, and admit that human beings are naturally turned in upon themselves in sin. We need a redeemer, an external source of grace that could overcome the centripetal force of self-will.“437 Johnston eröffnet aus der Problemstellung des „incurvatus in se“ nun also die Frage nach Gott und diese in Richtung der kantischen Philosophie dahingehend, ob Kant sein Postulat von der Existenz Gottes nicht im Sinne eines Erlösers, Retters oder Heilands hätte konzipieren müssen und nicht allein als ein Distributor der Glückseligkeit, der in Anbetracht der Angemessenheit des jeweiligen individuellen Willens zum moralischen Gesetz peinlich genau darauf achtet, dass auch niemand ein Quäntchen zu viel oder zu wenig von jener erhält. Johnston zielt in seiner Thematisierung des Gottesgedankens als einer Gnadenquelle, die gewissermaßen von außen transformativ auf unsere „radikal böse“ Natur einwirkt, nun nicht auf eine Wiederbelebung eines Schöpfergottes, der in die Geschichte und das Leben von Individuen eingreift. Sondern er identifiziert unser individuelles Leben, die Geschichte, die natürliche, ja sogar die kosmische Entwicklung mit Gott selbst, „The Highest One = the outpouring of Existence Itself by way of its exemplifications in ordinary existents for the purpose of self-disclosure of Existence Itself“.438 Dabei sei diese, wie er sagt, panentheistische Identifizierung nicht zu verwechseln mit der pantheistischen Identifikation von Gott und Natur. „Against such a pantheistic identification, the panentheist will assert that God is partly constituted by the natural realm, in the sense that his activity is manifest in and through natural processes alone. But 437 438 Ebd., Seite 92f. Ebd., Seite 120. 202 his reality goes beyond what is captured by the purely scientific description of all events that make up the natural realm. Nothing in the natural realm lies outside God, and God reveals himself in the natural realm by disclosing in religious experience an ultimate form of the world, one that is in no way at odds with the form of the natural realm disclosed by science: that is, a causal realm closed under natural law. The identification [...] characterizes that ultimate form of reality, and thereby expresses a type of panentheism. It identifies God with a universal process understood as outpouring and self-disclosure. Here, God is no longer in the category of substance, as in traditional theology, but in the category of activity.“439 Johnston versteht diesen Process Panentheism in der Tradition von Whiteheads Prozessontologie. Ich werde hier keine umfängliche Diskussion und Kritik seiner Position vornehmen können, sondern werde dies nur insoweit leisten, als sie uns einer theoretischen Einsicht in die praktische Möglichkeit eines befriedigenden Umgangs mit der Problematik des „incurvatus in se“ näher bringt. Wenn Johnston in der zitierten Textstelle davon spricht, dass Gott sich in der religiösen Erfahrung als der Enthüllung einer höchsten Form der Welt offenbart, die nicht im geringsten Widerspruch steht mit dem, was sich uns in Form naturwissenschaftlicher Beschreibungen der Welt enthüllt, dann kann diese religiöse Erfahrung auch verstanden werden als etwas, das Johnston an anderer Stelle seiner Untersuchung als tieferes Verständnis des göttlichen Geistes als der Totalität aller völlig adäquaten und vollzähligen Modi der Realitätspräsentation beschreibt („the totality of fully adequate and complete modes of presentation of reality“).440 „Of course, this is an ideal limit, and who can tell what transformations of individual minds and bodily structures would be required to better approximate to it. Nevertheless, part of the self-disclosure of the Highest One involves the disclosure of his mind, by way of our movement in the direction of deepening understanding. A comparison with the evolutionary significance of increasing cooperation may be helpful here. It is not that the normative principles of cooperation and kin altruism could have any causal influence on evolution and natural selection. It is just that, as a matter of fact, animals that are prepared to cooperate with their kin, and to some extent sacrifice their interests for those kin, confer a collective advantage on their kin and clan. To that extent, cooperative and kin-altruistic animals are likely to become more numerous in evolutionary history. The same holds for animals with mental capacities that enable them to grasp more adequate and complete modes of presentation. Here, then, is a variant on Hegel’s theme of the cunning of history; you might call it cunning of nature. There is a natural selective pressure to develop more adequate ideas, to deepen understanding, and this takes us in the direction of gradually confirming our minds to the Mind of God, understood as the totality of fully adequate modes of presentation.“441 439 Ebd., Seite 119f. Ebd., Seite 155. 441 Ebd., Seite 155f. 440 203 Durch die natürliche evolutionäre Selektion, so seine These, entstehen Lebewesen mit einem immer tieferen Verständnis der Realität, d.h. mit einem immer tieferen Verständnis Gottes selbst. „Reality is Being-making-itself-present-to-beings [...]. The beings, that is, each and every creaturely thing that exists, are themselves exemplifications of Being. Each is, as it were, precipitated or individuated out of Being, and is thus none other than a finite expression of Being, distinctive thanks to its distinctive finite essence or principle of individuation. So the general form of reality is at least the outpouring of Being itself by way of its exemplification in ordinary beings and its self-disclosure to some of those beings. Seeing reality in that way, holding that frame in place as the basic frame in which one experiences the world, supports a profound background feeling of gratitude in response to the ,double donatory‘ character of reality. First, I am an expression of Being Itself, as are all the things present to me [...]. Second, all of THIS is made available to me, gratis. Whatever happens then, I have already been endowed with great gifts; I have already won the cosmic lottery. Seeing all this, perhaps I can then begin to overcome the centripetal force of the self, the condition of being incurvatus in se, and instead turn toward reality and the real needs of others [Hervorhebungen im Original; T. W. ].“442 So wird deutlich, worin Johnston das transformative Einwirken Gottes sieht, durch das unsere „radikal böse“ Natur überwunden werden kann. Er versteht das individuelle Leben als eine pure und bedingungslose Entäußerung der Existenz selbst, die er letztlich in Analogie zur selbstlosen und überfließenden Liebe des christlichen Gottes versteht, als agape. Je mehr wir uns im Laufe der Evolution, d.h. im Prozess der Realität, in unseren Begriffen diesem Verständnis der Realität und damit der Existenz selbst und somit auch unserer eigenen als Entäußerungen derselben nähern, wird sich dieses Verständnis wiederum in unserem Verhalten äußern, ja wir selbst werden uns mehr und mehr selbstlos an die Welt und vor allem an unsere menschliche Mitwelt entäußern und unser „incurvatus in se“ hinter uns lassen. Dieses Selbstlos-Werden interpretiert Johnston als ein Überwinden der „Ur-Sünde“, die darin läge, ein Wissen davon vorzugeben, worin ein gutes Leben bestünde. Den Mythos vom Biss in den am Baum der Erkenntnis hängenden Apfel versteht Johnston als eine dramatische Stilisierung der menschlichen Neigung „driven by [...] anxious hope that ,wisdom‘, a correct conception of good and evil, and hence the knowledge of how to live, could be got from a tree, off the shelf as it were – as if it were something fixed and complete like an ideal commodity, as if it were something that could be possessed by human beings. Our original sin thus consists in self-will combined with the aspiration to possess the knowledge of how to live, a false grasping after ready-towear righteousness, something that is inherently compromised. [...] That combination produces self-will as a constant deliberative motif, along with a need for a guiding conception of the good to silence the emergent voice that demands that we live our life. Unfortunately, the guiding conception of the good can initially come only from a tree, 442 Ebd., Seite 156f. 204 from off the shelf, from what the others expect of us. And this means that our actual life is parceled out between two bad masters: our own self-will and a compromised conception of the good. How is it compromised? It is averaged out because commonly available, it is held to with the sense of false necessity, and it needs to be defended beyond its merits because otherwise we sense that we would have no idea of how we are to live. Indeed it must be defended, even with violence, for otherwise we would have to face the terror of discovering that we have no satisfactory way of being distinctively human, no good response to the voice that commands us to live our lives. In fact our own self-will, our various defections form the otherregarding demands presented by our internalized conception of the good, already testifies to the intrinsic weakness of the conception; we know that it cannot fully command our own assent, so we know it must be policed in order that we may fend off the terror below.“443 In gewisser Weise liegt Johnston hier nicht weit von Pinkards Position entfernt. Dieser hat mit Hegel, wie deutlich gemacht, vor dem Hintergrund der reflexiven Selbst-Distanzierung von allen konkreten Verhaltensanforderungen und der aus dieser entstehenden Orientierungsproblematik auf die Notwendigkeit geschlossen, nach einem Begriff des Unbedingten zu suchen, der in der Kontingenz des Lebens eine Richtung vorzugeben in der Lage ist. Doch sämtliche Begriffe eines Unbedingten, die als solche stets bedingt sind, müssten sich notwendig widersprechen und könnten im gesellschaftlichen Zusammenhang nur insoweit bestehen, als sich ein intersubjektiver Konsens oder, wie Johnston es hier ausdrückt, ein Kompromiss darüber herauskristallisiert, wie das unserem Leben eine Richtung gebende Unbedingte zu begreifen sei. Doch auch in diesem konsensuellen Verständnis bleibt es dabei, dass diese Begriffe notwendigerweise zu Widersprüchen zwischen ihrer gedachten Unbedingtheit und unserer bedingten Praxis führen müssen. In „der“ modernen Welt manifestiere sich diese Widersprüchlichkeit zwischen der Annahme unbedingter individueller Rechte und ihrer bedingten praktischen Geltung. Wie Pinkard ist nun auch Johnston der Meinung, dass diese von ihm als „Ur-Sünde“ und Grund unserer „radikal bösen“ Natur bezeichnete Problematik nur dadurch gelöst werden kann, dass wir uns die Bedingtheit und damit auch Falschheit dieser Begriffe von einem guten oder richtigen Leben eingestehen. Die Möglichkeit dazu liege, laut Johnston, in dem Gewahr-Werden der doppelt schenkenden Qualität der Realität bzw. Existenz („,double donatory‘ character of reality“) und dem damit verbundenen grundlegenden Gefühl der Dankbarkeit („profound background feeling of gratitude)“ für all das, was uns mit diesem Leben immer schon und bedingungslos geschenkt sei. Dieses in der religiösen Erfahrung als höchste Form existenzieller Selbstenthüllung sich manifestierende tiefe Verständnis der Existenz sei der Ausgangspunkt, das „incurvatus in se“ zu überwinden und sich der Realität und den wirklichen Bedürfnissen bzw. Interessen der anderen zuzuwenden. Die 443 Ebd., Seite 168f. 205 Gnade der Dankbarkeit erlaube es, von vermeintlichen Verletzungen „des Guten“ abzusehen und sich von all seinen individuellen Vorstellungen über ein gutes Leben zu lösen, die man in der „Ur-Sünde“ zwischen einen selbst und die anderen zu setzen geneigt ist. Johnston versteht die Geschichte Christi als ästhetische Darstellung des Ideals dieser Befreiung. „After all, what does [...] Christ offer in place of righteous legitimacy? Not a way to live, certainly not in the sense of something that would allow a new form of readyto-wear righteousness to be passed, so as to make for a stable settlement with things. All that is offered instead are impossible commandments from out of the blue: Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment. And the second is like it, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. [...] This is the sense in which Christ destroys the Kingdom of self-love and false righteousness. Of course, it is not that the psychological power of self-love and false righteousness is actually diminished by the Passion and Crucifixion. Instead, self-love and false righteousness – that is to say, the central elements of the characteristically human form of life – no longer make up a defensible realm.“444 Die im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe doppelt geforderte Überwindung des „Selbst“ ist in Johnstons Interpretation die der doppelt schenkenden Qualität der Existenz entsprechende Antwort endlicher Existenz. Zum einen ist jede bedingte Existenz Entäußerung der Existenz überhaupt und somit Teil Gottes. Zum anderen ist diese Entäußerung bedingungslos und geschenkter Überfluss, ist agape. Die Zuwendung zu Gott, d.h. zur Existenz überhaupt, bedeutet so zugleich die Zuwendung zu all ihren Entäußerungen, so auch zum Nächsten, und dies in der Qualität eines selbstlosen Schenkens, in der Qualität der agape. Und die Überwindung des „Selbst“ hin zur Selbstlosigkeit bestehe eben in Richtung der durch die religiöse Erfahrung und die Kraft der Dankbarkeit möglich werdende Abkehr vom wissenden Besitz des Lebens und den Vorstellungen darüber, wie dieses richtig zu führen sei. In diesem Verständnis endlicher Antwort auf die göttliche agape liegt Johnston wiederum unweit von Pinkard, der im Hinblick auf die aus unseren Versuchen, das richtige oder gute Leben in metaphysischen Spekulationen zu begreifen, erwachsenden Spannungen schreibt: „Those tensions are ineradicable but necessary components of modern life. Something like practical wisdom, and not a final metaphysical solution, is the proper response. [...] Each acknowledges his own finitude and partiality, and in doing so, in the give-and-take of their encounter, each forgives the other for having claimed such an absolute status for himself. In religious terms, each acknowledges that he is not without sin, [...] each acknowledges his own radical fallibility and the temptation to claim a knowledge of the unconditional that outstrips the resources of the individual agent. The ,true infinity‘ the agents seek is to be found within the ongoing interchange itself, insofar as that interchange is oriented to 444 Ebd., Seite 172f. 206 truth.“ 445 Und genau in diesem Sinne, so denke ich, kann man auch Johnstons philosophisches Anliegen verstehen: „Thus philosophy keeps to the old promise of ex veritate vita. The truly ethical life is a life in which you encounter yourself as one person among others, all equally real.“446 Das Eingeständnis unserer in der Anmaßung eines unbedingten Wissens vom richtigen Leben liegenden „Ur-Sünde“, das Eingeständnis unserer „radikalen Fallibilität“ ist die notwendige Bedingung der mit dem Biss in den Apfel verbundenen Vertreibung aus dem „Paradies“, dieser in der reflexiven Selbstanmaßung und Verabsolutierung unserer bedingten Begriffe liegenden Fallibilität immer wieder neu zu begegnen, um auf diese Weise unserer bedingten Natur, unserer selbst und den anderen annähernd gerecht zu werden und ein befriedigendes Leben in Gesellschaft zu führen. So gesehen gibt uns Johnston eine theologisch kontextualisierte Vorstellung des pinkardschen Verständnisses moralischen Verhaltens als „practical skill that resists formal codification“.447 Doch mein Eindruck ist der, dass Johnston seiner an Kant in Bezug auf die Definition der menschlichen Natur als einer „radikal bösen“ geäußerten Kritik selbst nicht gerecht wird und uns damit theoretisch genauso wenig wie jener die Möglichkeit einer tatsächlichen Überwindung des „incurvatus in se“ plausibel macht. Selber bezeichnet er die im Rahmen seiner Vorstellung der agape diskutierten Gebote der Gottes- und Nächstenliebe als „impossible commandments from out of the blue.“ Auch besteht er weiterhin auf die „psychological power of self-love and false righteousness“, so wie etwa auch Pinkard bezüglich der mit den metaphysischen Spekulationen verbundenen Spannungen ausführt: „Those tensions are ineradicable but necessary components of modern life.“ Das in der Geschichte Christi vorgestellte Ideal einer Antwort endlicher Existenz auf die göttliche agape wird bei Johnston zu einer Vision eines vielleicht irgendwann einmal möglichen vollkommenen Verständnisses der Existenz und eines damit einhergehenden vollkommenen, von agape erfüllten Lebens. Aber, so schränkt Johnston selbst ein: „Of course, this is an ideal limit, and who can tell what transformations of individual minds and bodily structures would be required to better approximate to it.“ Was Kant bezüglich einer möglichen Veränderung unserer nachtodlichen Natur zur Plausibilisierung seines „moralischen Gesetzes“ unterließ und schuldig blieb, bleibt auch Johnston letztlich schuldig und setzt es vielmehr in die providenzielle Schuld eines evolutorischen Vielleicht. Damit aber re-messianisiert er in seiner evolutorischen Theologie den in der Auseinandersetzung mit Kant von ihm hervorgehobenen Heilsgedanken im Sinne eines Noch-nicht und ist, wenn auch nur in eingeschränktem Sinne, der jüdischen Religion viel näher als der christlichen; damit aber auch einer Wirklichkeit unseres natürlichen Lebens, 445 Pinkard (2012), Seite 181, 186. Johnston (2009), Seite 90. 447 Pinkard (2012), Seite 186. 446 207 die metaphorisch nicht durch die Geschichte Christi und die darin sich ausdrückende agape zu erfassen ist, sondern durch eine Beschreibung, die Johnston selbst in seiner Deutung von Yahweh gibt: „Now the strange character of Yahweh, the loving, jealous, and genocidal god, is no longer a mystery. He appears as the Lawgiver to ,a stiffnecked people‘. He commands and sanctifies another compromised conception of how to live. For this work, for it to prevent self-will from exposing the unsatisfactory nature of what is commanded, the Lawgiver has to make it known that he is not to be messed with, that he himself has an enormous capacity for retributive violence. Yahweh exactly fits the bill; this is why it would be utterly naive to bowdlerize the Hebrew scriptures, to omit or neglect Yahweh’s immense cruelty, and emphasize only his justice, mercy, and love. That is to fail to understand the religious function of Yahweh. Yahweh needs to be an unpredictable threat if he is to successfully resolve the real crisis produced by original sinfulness, and so be a god for men [Hervorhebung im Original; T. W,].“448 Insofern Gott, „The Highest One“, für Johnson die Existenz selbst ist, verstanden als „the outporing of Existence Itself by way of its exemplifications in ordinary existents for the purpose of selfdisclosure of Existence Itself“, hätte er meines Erachtens konsequenterweise zu dem Schluss kommen müssen, dass diese sich uns offenbar als der in seinem Sinne verstandene Yahweh erweist und nicht als agape. Bis auf Weiteres scheinen wir in unserer Existenz in der „Ur-Sünde“ gefangen zu sein, damit aber auch in der laut Johnston damit verbundenen natürlichen Gegnerschaft zu einem ethischen Leben; wir müssten uns als „natural opponents of the ethical life“ verstehen. Johnston kann dem allein einen evolutions-theologisch-messianischen Glauben entgegenhalten, nach dem sich irgendwann einmal die Qualität unserer Existenz ändern wird – etwa analog zu Teilhard der Chardins evolutionstheoretischen Überlegungen oder deren Aufnahme und in Auseinandersetzung mit Heidegger vorangetriebenen Weiterentwicklung von Bernard Delfgaauw. 449 Aber selbst wenn man, was zu Recht bezweifelt werden kann, die Möglichkeit einer solchen evolutionär-providenziellen Potentialität in Betracht zieht, so bleibt deren Wirklichkeit offenbar noch aus; mit dieser aber auch unsere Möglichkeit im Sinne der von Johnston entwickelten Vorstellung der agape, unser „Selbst“ in einem „radical altrusim“ zu überwinden. Sein Glaube, dass sich irgendwann einmal die Dinge ändern, ist nicht weniger ein Glaube an eine Proposition als der Kants. Und so gelten Johnstons eigene Worten für ihn selbst: „But belief in a proposition cannot redeem us from the condition of being incurvatus in se [Hervorhebung im Original; T. W.].“ 448 Johnston (2009), Seite 169f. Teilhard de Chardin (2006); Delgaauw, Bernard: Geschichte als Fortschritt, Band I - III, Köln: Verlag J. P. Bachem, 1962-1966. 449 208 Pragmatischer geht Philip Kitcher unsere altruistische Fehlbarkeit in The Ethical Project an. Ebenfalls vor evolutionstheoretischem Hintergrund beschreibt er es als ein permanentes ethisches Projekt der menschlichen Natur, unsere altruistische Fehlbarkeit durch die Hervorbringung gesellschaftlicher Normen immer wieder neu und, möglicherweise, immer besser in den Griff zu bekommen. Die von ihm vertretene Position nennt er einen „pragmatic naturalism“. „As the name suggests, pragmatic naturalism has affinities with both pragmatism and naturalism. In focusing on ethical practice and its history, it attempts to honor John Dewey’s call for philosophy to be reconnected with human life. Further, it articulates a Deweyan picture of ethics growing out of the human social situation; its conception of ethical correctness is guided by Williams James’s approach to truth. The naturalism consists in refusing to introduce mysterious entities – ,spooks‘ – to explain the origin, evolution, and progress of ethical practice. Naturalists intend that no more things be dreamt of in their philosophies than there are in heaven and earth. They start from the inventory of the world allowed by the totality of bodies of wellgrounded knowledge (the gamut of scholarly endeavors running from anthropology and art history to zoology), and, aware of the certain incompleteness of the list, allow only such novel entities as can be justified through accepted methods of rigorous inquiry. Appeals to divine will, to a realm of values, to faculties of ethical perception and ,pure practical reason‘, have to go. Pragmatic Naturalism engages with the religious entanglement of ethics more extensively than is usual in secular philosophical discussion – for the pragmatist reason that the entanglement pervades almost all versions of ethical life. Yet, in accordance with its naturalist scruples, it cannot maintain the image favored by those who would ground ethics in the divine will. [...], there are powerful reasons to suppose, even if there were any deity, ethics could not be fixed by its (his? her?) tastes. More fundamentally, pragmatic naturalism maintains that, when religion is understood as a historically evolving practice, it is overwhelmingly probable that all the conceptions of a transcendent being ever proposed in any of the world’s religions are false. For the conceptions introduced in the various religions are massively inconsistent with one another. [...] If there are beings of hitherto unrecognized sort, approximating some idea of the ,transcendent‘, we have every reason to think we have absolutely no clues, or categories, for describing them.“450 Auch Kitcher reiht sich also ein in die Absage an die Möglichkeit begrifflichen Wissens bezüglich unbedingter Sachverhalte, nicht nur, aber vor allem in normativen Zusammenhängen, und betont wie Pinkard und Johnston die notwendige Widersprüchlichkeit, in die wir uns mit solchen begrifflichen Annäherungen bringen müssten. Anders als diese begreift Kitcher solche Bezugnahmen, vor allem religiöse, nicht als eine „ursprüngliche Sünde“, sondern spricht ihnen in ihrer Entstehung im 450 Kitcher, Philip: The Ethical Project, Cambridge, MA/London England: Harvard University Press, 2011, Seite 3. 209 funktionalistischen Sinne primär eine positive Wirkung zu. Allein es sei der Fall, dass im Fortschreiten des ethischen Projektes diese Unbedingtheitsannahmen ihre positive Wirkung verloren haben, nicht zuletzt deshalb etwa, weil sie in einer Welt, in der nun auf globaler Ebene, d.h. interkulturell, nach gemeinsamen Regeln zur Fortführung des ethischen Projektes gesucht werden muss, Normen nicht mehr in widersprüchlichen und Uneinigkeit hervorbringenden Unbedingtheitskonzeptionen begründet werden können. „Religious entanglement in ethical practice is no accident. [...], appealing to gods as ,guardians of morality‘ can bring social benefits. Nevertheless, the appeal has distorted the ethical project. Undoing the distortions is not simply a matter of eradicating religion, hacking out the places where false belief has intruded. A secular renewal of the ethical project requires constructive work, positive steps going beyond brusque denial.“451 Ob und wie erfolgreich Kitcher in seinem Versuch und seiner Argumentation dieser von ihm wahrgenommenen Aufgabe im Detail gerecht wird, steht hier nicht zur Debatte.452 Vielmehr will ich im Kontext des von mir vorgeschlagenen Moralbegriffes anmerken, dass auch Kitchers als permanenter Prozess verstandenes ethisches Projekt stets von einer praktischen Haltung der an ihm teilnehmenden Subjekte abhängig bleibt, in der sie gewillt sind, die ethischen Regeln zur Überwindung altruistischer Fehlbarkeit immer wieder neu hervorzubringen, zu kritisieren und weiterzuentwickeln. Dies wird bei Kitcher selbst explizit deutlich, wenn er die ethische Methode und die diskursiven Regeln beschreibt, durch deren Einhalten seiner Ansicht nach die Möglichkeit einer erfolgreichen Verfolgung des Projektes überhaupt besteht.453 Als Inbegriff der seiner ethischen Methodik und den in dieser anzuwendenden Regeln zugrunde liegenden Haltung benutzt er den Ausdruck „mutual engagement“.454 Bereits für die Anerkennung des methodischen Verfahrens muss die Bereitschaft und die Fähigkeit der Diskusteilnehmer vorausgesetzt werden, das „incurvatus in se“ im Sinne des „mutual engagement“ zu überwinden. Diese Bereitschaft kann aber nicht selbst wiederum in einer ethischen Methodik, ethisch-diskursiven Regeln oder sonstigen Reflexionen begründet liegen, sondern muss diesen immer schon vorausgehen. Genau in diesem Sinne hat auch de Vries in seiner Kritik an der von Kitchers methodologischen Vorstellungen nicht allzu weit entfernt liegenden habermasschen Diskursethik und mit Verweis auf Kodalle deutlich gemacht: „Denn sowohl der Antrieb zu und das Verlangen nach Interaktion, als auch deren Qualität stammen nicht aus der universalistischen Vernunft selber [Hervorhebungen im Original; T. W.].“455 Oder, noch einmal in anderen Worten: „Man hat überdies mit Recht darauf hingewiesen, dass die von 451 Ebd., Seite 4f. Dazu Baurmann, Michael/Leist, Anton (Hrsg.): Analyse und Kritik, 2012 (34) Heft 1, Symposium on Philip Kitcher, The Ethical Project; sowie Derpmann, Simon/Düber, Dominik/ Rojek, Tim/ Schnieder, Konstantin: “Can Kitcher Avoid the Naturalistic Fallacy?”, in: Marie I. Kaiser/Ansgar Seide (Hrsg.): Philip Kitcher – Pragmatic Naturalism, Heusenstamm: ontos verlag, 2013, Seite 61. 453 Vgl. Kitcher (2011), Seite 330ff. 454 Ebd., Seite 342. 455 de Vries (1989), Seite 38. 452 210 Habermas betonte ‚zentrale Erfahrung der zwanglos einigenden, konsensstiftender Kraft argumentativer Rede‘ nicht selber theoretisch explizierbar ist. Innerhalb des theoretischen, aber auch innerhalb des praktischen Diskurses sowie innerhalb der ästhetischen und therapeutischen Kritik kann der Trieb oder die Bereitschaft zur Argumentation nicht selber aufs neue argumentativ plausibel gemacht werden [Hervorhebungen im Original; T. W.].“456 Dass diese Bereitschaft meines Erachtens sehr wohl argumentativ plausibel gemacht werden kann, wenn sie auch nicht erst durch diese Plausibilisierung hervorgebracht wird, habe ich bereits herausgestellt. Sie ist argumentativ zu plausibilisieren, wenn wir sie als Folge unserer Natur als interessierte, erlebende und freie sowie nach einem befriedigenden Leben in Adäquanz zur natürlichen und sozialen Umwelt suchende Subjekte voraussetzen; wozu wir allen Grund haben. Ich habe diese Bereitschaft als individuelles moralisches Interesse bezeichnet. Die Frage ist hier, inwiefern wir auch über diese Bereitschaft hinaus, zu der angesprochenen praktischen bzw. moralischen Haltung wirklich fähig sind. Ich will den Wert von Kitchers Auseinandersetzung mit der menschlichen normativen Praxis und ihren Ursprüngen hier nicht grundsätzlich in Frage stellen, sondern nur deutlich machen, dass die ethische Problematik unseres Lebens nicht allein über die Diskussion, Setzung und Weiterentwicklung von normativen Regeln zu lösen ist, sondern, wie es meines Erachtens auch in den Überlegungen von Pinkard und Johnston klar wird, von einer nichtdiskursiven und vor-diskursiven, folgt man der in dieser Arbeit entwickelten Vorstellung, sogar vor-reflexiven, vor-kognitiven und vor-evaluativen Ebene individuellen Verhaltens abhängig bleibt. Und diese Ebene ist nicht im Mindesten von geringerer praktischer Bedeutung als das, was wir aus den in dieser gründenden Antrieben heraus in unserem diskursiven Verhalten normativ machen. Und ich halte es durchaus im pragmatischen Sinne für angezeigt, theoretisch zu thematisieren, wie die hier in Frage stehende praktische Haltung als eine ihrer Wirklichkeit nach mögliche gedacht werden kann; d.h., nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit und deren Objektivität zu fragen. Denn moralisches Verhalten kann nur dann sinnvoll als oberste Norm gesellschaftlichen Zusammenlebens verstanden, d.h. reflexiv vermittelt werden, wenn auch die Bedingungen seiner möglichen Wirklichkeit einsichtig gemacht werden können und damit der teleologischen Suffizienz-Bedingung theoretisch Genüge getan wird. Kitcher setzt diese Problematik als gelöst voraus. In der Auseinandersetzung mit Johnston wurde aber deutlich, dass dies keineswegs der Fall ist und auch Johnstons Lösungsversuch, soweit ich sehe, fehlgeschlagen ist. Aber Kitcher kann sich dieser Problematik in seinem aus antireligiöser in eine antimetaphysische Haltung übergehenden Naturalismus auch gar nicht wirklich stellen, weil sie, wie bei Johnston deutlich geworden, reflexive Bezugnahmen metaphysischer Art notwendig werden lässt, die Kitcher in seiner 456 Ebd., Seite 44. 211 naturalistischen Programmatik aus dem theoretischen Diskurs gerade verbannen möchte. Damit ist er weiß Gott nicht allein. Der mit Habermas’ Worten als „nachmetaphysisches Denken“ bezeichenbare Zeitgeist der Philosophie hat die Ablehnung der Metaphysik in einem Maße um sich greifen lassen, von dem ich mit de Vries einer Meinung bin, dass es sprichwörtlich das Kind mit dem Bade ausschüttet.457 Ich stelle nicht völlig gerechtfertigte Kritiken an unhaltbaren metaphysischen Theorien in Frage, doch aber eine meines Erachtens oberflächliche und vorurteilsbeladene Ablehnung einer Ebene menschlicher Reflexion, um die selbst die Naturwissenschaft nicht herumkommt. Leonard Nelson hat in seinem Aufsatz Ist metaphysikfreie Wissenschaft möglich? zu Recht bemerkt: „Wer die Metaphysik aus der Wissenschaft eliminieren will, der liefert, da ohne Metaphysik überhaupt nicht geurteilt werden kann, die Wissenschaft an irgendeine Metaphysik außerhalb der Wissenschaft aus, d.h. der spielt, ohne es zu wissen und zu wollen, die Wissenschaft dem Mystizismus in die Hände. Das sollten diejenigen beizeiten bedenken, denen die Sache der Wissenschaft und der Aufklärung am Herzen liegt.“458 In diesem Sinne setzt auch Kitcher praktisch etwas voraus, das er theoretisch nicht thematisieren will. Natürlich ist keiner zu einer solchen Thematisierung gezwungen, aber es schadet der Wissenschaft auch nicht; mit Nelson würde ich sogar das Gegenteil behaupten. Von daher halte ich, nicht nur im inhaltlichen Zusammenhang dieser Arbeit – und dieses Abschnittes insbesondere –, Johnstons metaphysische Problematisierung des „incurvatus in se“ für eine wichtige Öffnung des theoretischen Diskurses. Ein Problem in der Argumentation Johnstons besteht jedoch im Festhalten an dem auch von Kitcher zentral gesetzten Begriff des Altruismus. Johnstons „radical altruism“ setzt zu seiner Verwirklichung die Vorstellung eines selbstlosen Individuums voraus, eine Vorstellung, die meines Erachtens unserer Natur objektiv widerspricht. Hat Kant das individuelle Selbst unsterblich machen wollen, um es der Erfüllung seines „moralischen Gesetzes“ mächtig werden zu lassen, so versucht Johnston in gewisser Weise anders herum, die Möglichkeit der Erfüllung des „radical altruism“, der agape, durch die Negation dieses individuellen Selbst theoretisch einsichtig zu machen. Dies wird im Rahmen seiner Diskussion der Unsterblichkeit deutlich: „Indeed, legitimate naturalism itself opens up an intriguing theological possibility. Most surprisingly, the way beyond death can be found in naturalism’s denial of the soul, that is, in the empirical discovery that at the core of our mental lives there are no separately existing entities, distinct from our brains and bodies, whose persistence constitutes our personal identity over time. The realization that there is no separately existing entity distinct from our brains and bodies can 457 Vgl. ebd., Seite 14. Nelson, Leonard: Ist metaphysikfreie Wissenschaft möglich?, in: ders.: Gesammelte Schriften in neun Bänden, Dritter Band, 1974, Seite 281. 458 212 be seen to lead to the discovery that our personal identity over time is actually secured by certain patterns of personal identification with what then become our future selves. [...] The demise of the soul, and hence of the self, means that the extent and focus of one’s special concern is not antecedently justified by an independently persisting entity that itself determines the temporal and spatial extent of who we are. Rather, our temporal and spatial extent is determined by our pattern of special concern. This is the new ,Copernican Revolution‘ induced by naturalism’s (re)discovery that there is no self behind our mental functioning.“ 459 In dieser Negation des Selbst sieht Johnston eine Bestätigung der Möglichkeit einer irgendwann einmal von agape erfüllten Wirklichkeit. Diese Selbstlosigkeit wird ihm zur natürlichen Möglichkeit einer Identifizierung mit allen anderen, auch zukünftigen Individuen, in der das Individuum sein „incurvatus in se“ hinter sich lassen und sich schließlich sogar als unsterblich verstehen könne. „In any case, we can now see how it could be that Christ is resurrected as ,the first fruit‘ of the collective victory over death of those who are truly good. Christ conquers death on our behalf by ideally exemplifying agape, and stimulating it in us.“460 Johnston scheint mir, wie zum Beispiel auch Thomas Metzinger in Being No One und viele andere mehr, fälschlicherweise davon auszugehen, dass die Frage nach dem individuellen Selbst mit der Negation eines identischen Kernes im Prinzip geklärt ist, und zwar negativ. Ich halte einen solchen Schluss mindestens für eine Ungenauigkeit in der reflexiven Betrachtung von Individualität und eine unbegründete Reduzierung des Selbst auf ein aus reflexiver Tätigkeit hervorgehendes Konstrukt. An anderer Stelle dieser Arbeit habe ich bereits meiner eigenen Position Ausdruck verliehen, dass ich ebenfalls nicht von der Annahme einer identischen individuellen Seele ausgehe. Ich sehe darin jedoch keinen Grund, einem Individuum damit auch schon ein Selbst abzusprechen. Vielmehr verstehe ich, letztlich nicht viel anders als Aristoteles, das Selbst gerade als das jeweilige Individuum, als der jeweilige raumzeitlich sich ausdehnende individuelle Lebensprozess, mag er sich selbst reflektieren oder nicht. Individualität setzt keine Identität voraus, reicht aber völlig dazu hin, einen meines Erachtens durch Reflexionen nicht aus der Welt zu schaffenden Begriff eines natürlichen Selbst deutlich werden zu lassen. Jeder Organismus ist ein solches individuelles Selbst, im Falle des Menschen eines, das sich darüber hinaus als ein solches individuell reflektieren kann. Dass mein individuelles Dasein als interessiertes, erlebendes und freies Subjekt nicht durch den Begriff der Identität treffend zu erfassen ist, sondern einen individuellen Prozess und Veränderung bedeutet, hindert mich, d.h. diesen individuellen Prozess, der ich bin, in keiner Weise daran, sich selbst als diesen individuellen Prozess und damit als ein individuelles Selbst zu reflektieren, das nicht niemand, sondern jemand werdend ist; und das auch dann, wenn es 459 460 Johnston (2009), Seite 184f. Ebd., Seite 186. 213 sich in Zuständen befindet, in denen es sich nicht selbst reflektiert. Solange dieser Organismus, der ich auch bin, lebt, lebt auch mein Selbst, lebe und existiere ich. Auch Johnston kommt in der Vorstellung der Selbstüberwindung nicht ohne dieses Selbst aus, sondern muss es als dasjenige, das sich mit anderen identifiziert, stets voraussetzen. Weil es meines Erachtens dieses individuelle Selbst jeweils objektiv und wirklich gibt, noch dazu, wie ich argumentiert habe, in seinem Kern als ein zweckfreies Interesse am individuellen Erleben, halte ich seine Negation und die Behauptung einer Selbstlosigkeit letztlich für ein an unserer Natur vorbeigehendes Gedankenspiel; damit aber auch das durch dieses für Johnston scheinbar ermöglichte Festhalten an der wie auch immer bewirkten Verwirklichung der agape als „radical altruism“ und die dadurch anvisierte Überwindung des „incurvatus in se“. Ein solcher „radical alturism“ ist für unsere Natur nicht weniger illusorisch als Kants Konzeption der Moral. Es müsste schon ein wahrlich messianisches Wunder geschehen, damit sich daran etwas ändert. In seiner Argumentation verpasst Johnston auch eine, meiner Ansicht nach überaus zentrale Pointe der Geschichte Christi. Und diese besteht in nichts anderem als der Vorstellung der Erfüllung der teleologischen Suffizenzbedingung. Denn gegenüber der jüdischen Erwartung des erst noch kommenden Messias, bedeutet die Geburt Christi, dass dieser bereits erschienen ist. Christi Geburt kann verstanden werden als der Hinweis, dass uns alles Notwendige offenbart ist, oder weniger religiös gesprochen, alles nötige Wissen und vor allem alle Fähigkeit zur Verfügung steht, um ein „sündloses“ Leben zu führen. Wir können erfüllen. Dennoch gilt es, so denke ich, beide Momente, das jüdische „Nochnicht“ und das christliche „Schon“ zu bewahren: Christus bedeutet die Fähigkeit, erfüllen zu können, der Messias, dass sich immer erst noch zeigen wird, in welchen konkreten Anforderungen diese Fähigkeit je immer wieder neu zu verwirklichen ist; die situative Angemessenheit bedeutet nicht auch schon die völlige Angemessenheit. Bei alldem ist jedoch entscheidend, die Begriffe von dem, was es zu erfüllen gilt, nicht in etwas bestehen zu lassen, was unserer bedingten Natur wegen unerreichbar sein muss. In Hinsicht auf das „incurvatus in se“ heißt dies, dass dessen Überwindung nicht in einer gottgleichen, unbedingten Liebe, der agape, gesucht werden kann, sondern vielmehr nach einem Verständnis dieses Problems Ausschau zu halten wäre, das unserer bedingten Liebe gerecht zu werden vermag. Die Kritik an Johnstons Auflösung des „incurvatus in se“ bedeutet jedoch nicht, dass ich von meiner anfänglichen Zustimmung abrücke, dass wir dieses im Rahmen des moralischen Verhaltens nicht aus uns selbst heraus auf befriedigende Weise in den Griff bekommen können. Um zu einer theoretisch gangbaren Lösung zu gelangen, scheint mir die Auseinandersetzung mit Nietzsche und sein unablässiges Festhalten am Individuum ein fruchtbarer Ausgangspunkt zu sein; auch wenn ich den Eindruck habe, dass Nietzsche am Ende zu sehr selbstisch geblieben ist. „Der Fortschritt in der Moral bestünde in dem Überwiegen altruistischer Triebe über egoistische und ebenso der allgemeinen Urtheile 214 über die individuellen? Ist jetzt der locus communis. Ich sehe dagegen das Individuum wachsen, welches seine wohlverstandenen Interessen gegen andere Individuen vertritt (Gerechtigkeit unter Gleichen, insofern es das andere Individuum als solches anerkennt und fördert); ich sehe die Urtheile individueller werden und die allgemeinen Urtheile flacher und schablonenhafter werden.“461 Johnston hat die Allgemeinheit der Urteile fallen gelassen, nicht aber das Primat des Altruismus. Ich hingegen verstehe mit Nietzsche das moralische Verhalten, das den Wert und die Würde sowie Gleichheit und Gerechtigkeit als Prinzipien in jeweilig konkreten Situationen zu verwirklichen sucht, nicht primär als ein altruistisches, sondern, wenn man so will, als ein ausgewogenes Verhältnis egoistischer und altruistischer Tendenzen. Um mit Nietzsche einem unserer individuellen interessierten Natur gerecht werdenden Verständnis dieses Verhaltens näher zu kommen, gilt es zunächst, dieses als ein dem jeweiligen individuellen Interesse entsprechendes Verhalten zu begreifen, und nicht als ein Verhalten selbstloser Subjekte. Der entwickelte Begriff des individuellen moralischen Interesses bedeutet genau dies. Doch wie uns etwa ein mögliches Interesse an der individuellen Unsterblichkeit nicht auch schon unsterblich macht, ist mit dem individuellen Interesse am eigenen moralischen Verhalten nicht auch schon seine Wirklichkeit gegeben. Noch einmal: Für Moralität bzw. moralisches Verhalten im hier verstandenen Sinne ist es entscheidend, dass im Falle eines Interessenwiderspruches die physische und psychische Macht der beteiligten Subjekte allein in einer freiwilligen Annäherung und Modifikation der jeweiligen individuellen Interessen ihren Ausdruck findet. Wie aber kann vor diesem begrifflichen Hintergrund die Möglichkeit einsichtig gemacht werden, dass wir die problematisierte Asymmetrie unseres Interessiert-Seins, wenn nicht verlassen, so doch aber uns in einer wirklichen Haltung begegnen können, die nicht darauf hinausläuft, dass es am Ende die kontingente Verteilung physischer und psychischer Macht ist, die darüber entscheidet, wie Interessenskonflikte aufgelöst werden. Wir müssen uns dazu der Wirklichkeit nach in eine Haltung bringen können, in der wir die kontingente Asymmetrie individueller Macht im Sinne des moralischen Verhaltens zu wenden in der Lage sind. Wir müssen der Wirklichkeit nach unseren eigenen Wert und unsere eigene Würde weder über noch unter die des anderen stellen. Diese Wirklichkeit kann jedoch nicht die unseres jeweiligen individuellen Interessiert-Seins allein sein. Denn in diesem sind wir jeweils immer nur der Wert und die Würde unserer selbst. Aus bloßer Individualität heraus mögen wir dazu fähig sein, unsere Interessen anderen gegenüber über- oder unterzuordnen, auch fähig sein, Kompromisse zu finden. Aber es wird nicht ersichtlich, wie wir in dieser interindividuellen Interessenanpassung dem Spiel der Macht aus uns selbst heraus entgehen können und in intersubjektiver Reziprozität wirklich den Wert und die Würde unserer selbst und des jeweils konkreten Anderen gleichwertig ins Zentrum unseres Verhaltens stellen und eine moralische Auflösung des Interessenwiderspruches hervorbringen können; außer vielleicht 461 Nietzsche zitiert nach Zachriat (2001), Seite 159. 215 dem Ergebnis nach durch einen unwahrscheinlichen Zufall. Aber es soll hier ja gerade nicht um einen Zufallsprozess gehen, sondern um ein Verhalten, das in unserer Macht steht, das wir als eine konkrete Option unserer Freiheit verstehen können; wenn auch nicht um eines, das wir aus uns alleine heraus erfüllen könnten. Eine Lösung dieses Problems scheint sich mir theoretisch dann zu eröffnen, wenn wir zu jenem, in dieser Arbeit immer wieder betonten zweckfreien individuellen Interesse am Erleben, jenem innersten Interesse überhaupt zurückkehren, das ich auch als das zwar grund-lose, doch aber grund-legende Interesse jedes individuellen interessierten Daseins bezeichnet habe.462 Die Grund-losigkeit bedeutet, dass es weder aus einer äußeren Ursache noch aus einem inneren Grund auf befriedigende Weise erklärt werden kann, aber als je individuelles Ergreifen der Möglichkeit interessierten Daseins überhaupt an diese als eine Wirklichkeit zurückverwiesen bleibt. Die Potentialität interessierten Daseins ist nicht die eines bestimmten individuellen interessierten Daseins, sondern die aller jemals diese Möglichkeit wirklich ergreifenden Individuen. Diese Potentialität kann dabei offenbar in den unterschiedlichsten, evolutionär bedingten Formen ergriffen werden, ist somit die Potentialität eines Dass interessierten Daseins, nicht aber die eines bestimmten Was. Sie lässt es unbestimmt, wie sich ihr jeweils individuelles Ergreifen manifestiert und entwickelt, lässt Raum und Zeit zur Evolution. Die Potentialität interessierten Daseins macht keinen Unterschied zwischen den Formen ihres Ergriffen-Werdens, sie sind in ihr gleichwertig, so aber auch ein jedes interessiertes Individuum. Ich halte es in diesem Zusammenhang durchaus für gerechtfertigt, den Wertbegriff zu gebrauchen, wenn man sich auch vor einer Anthropomorphisierung desselben hüten sollte. Denn die Potentialität interessierten Daseins ist keine diesem gegenüber indifferente Wirklichkeit, sondern bedeutet ja gerade positiv seine Möglichkeit. Sie ist jedoch neutral gegenüber den Formen, in denen sie ergriffen wird. Wenn das zweckfreie individuelle Interesse am Erleben nun aber nichts anderes heißt, als ein wirkliches Ergreifen und wirkliches Interesse an der Möglichkeit interessierten Daseins überhaupt, diese aber zugleich die Möglichkeit jedes konkreten interessierten Individuums ist, das in dieser seinem Dasein nach den gleichen Wert wie je alle anderen besitzt, dann bedeutet eine Konzentration auf unser innerstes Interesse eine Konzentration auf die Potentialität interessierten Daseins überhaupt – damit aber die Konzentration auf eine Wirklichkeit, in der es keine Wertunterschiede zwischen interessierten Individuen gibt. So wird unsere Haltung in dieser Konzentration von dieser Qualität maßgeblich geprägt. Zugleich bedeutet diese Konzentration offensichtlich kein interesseloses, sondern ein interessiertes Verhalten, noch dazu eines, welches das allen anderen, jeweils individuellen Interessen zugrunde liegende Interesse ins Zentrum stellt. In dieser Konzentration wird also nicht von allen Interessen überhaupt Abstand genommen, sondern gerade Partei für 462 Vgl. Seite 112ff. dieser Arbeit. 216 das grund-legende Interesse unseres individuellen Daseins selbst ergriffen. Es handelt sich hier also nicht um eine unparteiische Haltung, aber um eine, in der wir unseren ursprünglichen Wert nicht über, aber auch nicht unter den Wert unseres Gegenübers stellen. Auch handelt es sich weder um Egoismus noch um Altruismus, sondern um Moralität, verstanden in eben diesem Sinne. Alle sonstigen Interessen werden in der beschriebenen Konzentration prinzipiell relativiert, disponibel gemacht und somit im Falle intersubjektiver Interessenswidersprüche zu einer Anpassung freigegeben. Zwei Individuen, die in einer so konzentrierten Haltung je ihr eigenes Dasein und das des anderen gegenseitig und gleichwertig ins Zentrum ihres Verhaltens stellen, haben alle nur denkbaren Möglichkeiten, zu einer moralischen Auflösung ihres Interessenstreites zu gelangen. Zwar können sie ihre sonstigen Interessen nicht einfach hinter sich lassen, aber es ist der Wirklichkeit nach alle Freiheit gegeben, im Sinne Nietzsches mit vorsichtigem Abtasten, Gerecht-Werden und Erkennen der eigenen und fremden Grenzen, gegenseitigem Respektieren, mit Feinfühligkeit, Empfindsamkeit und Leidensfähigkeit nach einer Lösung des Interessenwiderspruches zu suchen, ohne den jeweils anderen zu unterdrücken. Die je individuelle Konzentration auf das grund-legende und zweckfreie Interesse am Erleben bedeutet nicht, die Interessen des anderen zu den eigenen zu machen, sondern sie ins Spiel und zu einem Ausgleich mit den eigenen Interessen zu bringen; ein Spiel, das nicht durch Macht, sondern durch gegenseitige und ebenbürtige Wertschätzung geprägt ist. Der Ausdruck Konzentration bekommt in diesem Zusammenhang eine tiefergehende Bedeutung. Er bedeutet dann eine Konzentration. Unserem jeweiligen grund-legenden Interesse nach sind wir alle immer schon konzentriert. In dieser Konzentration aber sind und bleiben wir auf die Potentialität interessierten Daseins überhaupt verwiesen. Aus uns allein heraus könnten wir weder existieren noch uns moralisch verhalten. Die Potentialität interessierten Daseins ist dabei aber nicht, wie etwa Johnstons Gott, als Retter, Erlöser oder Heiland zu verstehen, sondern eben als eine Potentialität. Wir bleiben in unserer Existenz als interessierte, erlebende und freie Subjekte darin frei, die in dieser liegende Möglichkeit moralischen Verhaltens zu ergreifen, wann immer wir in Interessenswidersprüche mit anderen geraten. Auch ist die Potentialität interessierten Daseins, wiederum anders als bei Johnston, nicht als etwas zu verstehen, das „outside our fallen natures“ liegt; also auch nicht als eine „metaphysische Dimension der Exteriorität“, nach der de Vries Ausschau gehalten hat. 463 Die Potentialität interessierten Daseins ist weder außerhalb noch innerhalb unserer individuellen Natur, ist weder Exteriorität noch Interiorität, sondern eine Ateriorität. Sie hat keine Raumzeit, sondern ist ein raumzeitloser Punkt, ist eine absolute oder unbedingte Wirklichkeit. Als eine raumzeitlose Wirklichkeit aber ist die absolute Potentialität 463 Vgl. Seite 155 dieser Arbeit. 217 dimensional unermesslich und kann am Ende nur gedacht werden als die unbedingte Möglichkeit bedingter Existenz überhaupt. Würde sie als bedingte Möglichkeit gedacht, so wäre dieser eine unbedingte Möglichkeit ihrer selbst vorauszusetzen, in der das der bedingten Möglichkeit nach Mögliche selbst enthalten sein müsste. Es macht in existenzieller Hinsicht deshalb keinen Sinn, der unbedingten Möglichkeit im Verhältnis zu bedingter Existenz eine bedingte Möglichkeit sozusagen zwischenzuschalten. Die Möglichkeit des Dass bedingter Existenz ist stets als unbedingt und selbst als eine Wirklichkeit zu denken. Das Was oder Wie bedingter Existenz kann hingegen sehr wohl bedingt gedacht werden, es kann durch äußere Bedingungen geprägt oder bestimmt sein. Für interessierte, erlebende und freie Subjekte aber gilt, wie ich weiter oben deutlich gemacht habe, dass sie, wenn auch ihrer evolutorischen Form nach, nicht aber als solche aus äußeren Bedingungen heraus erklärt werden können. Sie sind in direkter Weise auf die absolute Potentialität bezogen. Die Potentialität interessierten Daseins aber wäre damit als die absolute Potentialität bedingter Existenz überhaupt zu denken. Das Verhältnis der absoluten Potentialität zur bedingten Existenz interessierter, erlebender und freier Subjekte kann, auch das habe ich weiter oben bereits ausgeführt, nicht als eines zwischen einem Schöpfer und einem Geschöpf gedacht werden. Denn als ein Schöpfer bleibt dieser seinem Geschöpf eine äußerliche Ursache und kann den inneren Grund, das grund-legende zweckfreie individuelle Interesse am Erleben nicht erklären; würde es meines Erachtens im Gegenteil vielmehr verklären. Gunnar Hindrichs hat in Das Absolute und das Subjekt in ähnlicher Weise auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. Das individuelle Subjekt könne sich nicht selbst begründen und müsse daher am Ende sein Sein als ein „Sein in einem anderen verstehen“.464 Doch dieses Verhältnis sei durch eine Merkwürdigkeit geprägt. „Das Sein in einem anderen entzieht sich seiner gewohnten Bestimmung, obgleich es dem Bestimmbaren verwandt ist. Denn einerseits stimmt das Verhältnis von Begründetem und Grund nur insofern überein, als auch das Begründete seinen Stand erst durch seinen Grund gewinnt; andererseits aber ist das Verhältnis des Subjekts zu dem, in dem es ist, gerade kein Verhältnis zwischen Begründetem und Grund. Auch hier benötigen wir eine vorläufige Bezeichnung dieses abnormen Verhältnisses. Der Begriff eines unbegründeten Verhältnisses des letzten Grundes aller Begründungen [das ist das individuelle Subjekt; T. W.] zu einem Ungrund kann uns zu dieser vorläufigen Bezeichnung dienen.“465 An anderer Stelle beschreibt Hindrichs diesen „Ungrund“ als einen Bezugspunkt, an dem das Subjekt hängt und an dem allein es seinen Stand gewinnt.466 „Das Subjekt ist – positiv – bezogen 464 Hindrichs, Gunnar: Das Absolute und das Subjekt, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2008, Seite 290. 465 Ebd., Seite 291f. 466 Vgl. ebd., Seite 318ff. 218 auf das, in dem es ist, und es bleibt – negativ – von ihm geschieden, da das, in dem es ist, seine grundlegende Andersheit behält.“467 Diese Andersheit versteht Hindrichs auch als Entzogenheit. „Das Positive der Beziehung – das „in“ – birgt so das Negative der Entzogenheit [...] in sich.“468 Weiter schreibt Hindrichs: „Die Beziehung gegenseitigen Andersseins [...] entfaltet somit die anwesende Abwesenheit. Die anwesende Abwesenheit aber ist das Geheimnis. Die Beziehung gegenseitigen Andersseins muß demnach als die Beziehung des Subjektes auf ein Geheimnis verstanden werden.“469 Hier scheint mir Hindrichs letztlich nicht weit von der Position von Hent de Vries entfernt zu liegen, der in Theologie im Pianissimo & Zwischen Rationalität und Dekonstruktion ebenfalls von einem Absoluten schreibt, das sich uns entzieht und doch irgendwie auch nicht; etwas, das gedacht und doch wieder nicht gedacht werden kann.470 Beide wehren sich in diesem Verständnis dagegen, ihre Bezugnahmen auf ein Absolutes mit positiven Prädikationen zu verbinden. De Vries sieht diese Absage mit Habermas als integrativen Aspekt der kulturellen Moderne und sagt: „Wer auf religiöse und metaphysische Wahrheiten zurückfallen möchte, verlässt ipso facto den philosophischen Diskurs, der die Moderne begleitet.“471 Soweit ich sehe, fallen für de Vries sowie für Hindrichs auch Existenzaussagen unter dieses Prädikationsverbot. Und auf genau eine solche habe ich hier nicht verzichtet, sondern von der Wirklichkeit der absoluten Potentialität gesprochen, man könnte aber auch sagen von ihrer Existenz. Ich kann hier erst einmal nur offen zugestehen, dass mir kein Grund für das Verbot einer diesbezüglichen Existenzaussage ersichtlich wird. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um beliebige metaphysische Existenzaussagen, sondern um eine ganz bestimmte, nämlich die bezüglich einer absoluten Potentialität. Bei de Vries fällt es mir schwer, eine wirkliche Begründung für ein Verbot dieser speziellen Aussage ausfindig zu machen. Er konstatiert vielmehr bloß, als dass er begründet: „Ein Absolutes aber, das nicht länger dem höchsten Sein ähneln oder es repräsentieren kann und darf, sondern in gewisser Weise eben nicht ‚ist‘, werden wir wohl als Ab-solutes benennen müssen. In einem etymologischen Sinne wäre es das sich jedem festen oder definitiven Bedeutungskontext Entringenden.“ 472 Das Verbot bezieht er auf einen Begriff des Absoluten als „dem höchsten Sein“. Ich spreche im Gegensatz dazu nicht von einem „höchsten Sein“, sondern von einer absoluten Potentialität. Sie ist absolut, insofern sie unbedingt ist. Ich verstehe sie als die Bedingung bedingter Existenz überhaupt. Das steht für mich in keinem Kontext mit „Höhe“ oder ähnlichen Begriffen. So sehe ich etwa auch nicht, inwiefern mit der absoluten 467 Ebd., Seite 319. Ebd., Seite 317. 469 Ebd., Seite 321. 470 Vgl. de Vries (1989), Seite 1ff. 471 Ebd., Seite 38f. 472 Ebd., Seite 2. 468 219 Potentialität in irgendeinem nachvollziehbaren Sinne, wie etwa in der Scholastik, im Bezug auf ein höchstes Sein die Vorstellung verbunden sein sollte, dass dieses mehr oder eigentlicher existiere als bedingt Existierendes. Anders herum sehe ich ebenso nicht, wieso letzteres weniger existieren sollte als erstere. Der Unterschied liegt meiner Ansicht nach primär darin, dass die absolute Potentialität in ihrer Existenz unabhängig von bedingter Existenz ist, während dies anders herum nicht gilt; was dem Sachverhalt nicht entgegensteht, dass die absolute Potentialität bedingter Existenz trotz ihrer Unabhängigkeit als deren Potentialität stets auf bedingte Existenz bezogen ist. Wenn man aus dieser Unabhängigkeit nun ein „Höher“ oder, wie Hindrichs dies tut, ein „Über“ machen möchte, so kann man dies tun. Der Klarheit zuliebe will ich es lieber vermeiden.473 Welchen Grund aber kann es geben, etwas, von dem ich mich in meiner Existenz als abhängig denken muss, nicht ebenso wie mir selbst Existenz zuzusprechen? Mir will auch nach reiflicher Überlegung kein Grund ersichtlich werden. Ich gehe in diesem Gedankengang den gleichen Weg wie Hindrichs und versuche nicht, zur absoluten Potentialität über den Gedanken eines notwendigen Seins, über den ontologischen Gottesbeweis zu gelangen. Ich beschränke mich wie er darauf, „daß das Subjekt seine eigene Verfasstheit zu Ende denkt“, das aber heißt die seiner Existenz.474 In diesem ZuEnde-Denken kann das Subjekt am Ende, wenn es den ganzen Weg gegangen ist, nicht anders, als sich in „die abnorme Beziehung zu seinem Ungrund“ zu setzen.475 Dem stimme ich zu. Was ist nun aber für Hindrichs der Grund dafür, diesem Ungrund nicht auch Existenz zuzusprechen? Ich kann dies hier nur kurz skizzieren. Der Grund, soweit ich das sehe, liegt für ihn in dem Abnormen der Beziehung zwischen dem Subjekt und seinem Ungrund sowie im Abnormen des Ungrundes selbst. Das Normale ist für Hindrichs die bestimmend tätige Existenz des Subjektes als ein Ordnen, Begründen und Machen. Aber die Beziehung zwischen Subjekt und Ungrund sowie der Ungrund selbst seien eben nicht durch diese normalen Bestimmungen zu erfassen, sind kein Ordnen, Begründen und Machen. „Wir verfehlten also geradewegs das, was sich uns als der Kern jener Abnormität erwiesen hatte: den grundsätzlichen Durchbruch durch die normalen Bestimmungen.“476 Deswegen seien Analogieschlüsse von der Existenz des Normalen auf die Existenz des Ungrundes nicht zulässig. Nun hält sich Hindrichs in diesem Schluss meines Erachtens nicht ganz an die Zwischenergebnisse seiner eigenen Untersuchung.477 Denn in diesen macht er deutlich, dass das ordnende Sein des Subjektes selbst nicht innerhalb seiner Ordnungen steht, sondern ein außerordentliches ist; dass das begründende Sein des Subjektes nicht innerhalb 473 Vgl. Hindrichs (2008), Seite 320. Ebd., Seite 325. 475 Ebd. 476 Ebd., Seite 315. 477 Vgl. ebd., Achtes bis Elftes Kapitel. 474 220 seiner Begründungen steht, sondern ein unbegründetes ist; dass das machende Sein des Subjektes nicht innerhalb des von ihm Gemachten steht, sondern ein ungemachtes ist. Die Existenz des Subjektes als ein Ordnen, Begründen und Machen ist somit eine außerordentliche, unbegründete und ungemachte und gehört so selber nicht zu den normalen Bestimmungen, die sie hervorbringt. Die Existenz des Subjektes ist bereits selbst ein Durchbruch durch die normalen Bestimmungen. Wäre sie dies nicht, so würde der Weg über das Subjekt wohl auch kaum zur Frage nach dem Absoluten bzw. dem Ungrund führen. Was aber spricht dagegen, diese abnorme Existenz des Subjektes auch seinem Ungrund zuzusprechen? – Hindrichs’ Argument kann nun kein Einwand mehr sein. Wieso sollte man etwas, von dem man sich in seiner abnormen Existenz als abhängig denken muss, nicht ebenso diese abnorme Existenz zusprechen? Es müsste schon der Ungrund selber sein, der dagegen spricht. Jedoch stellt Hindrichs zum einen selbst fest, dass nicht nur die Beziehung des Subjektes zu diesem, sondern der Ungrund selbst abnorm ist. Und zum anderen kann dieser, wenn er, wie hier geschehen, als Potentialität gedacht wird, nur als eine wirkliche oder existierende gedacht werden. Denn sonst wäre er keine Potentialität. Eine Potentialität, die nicht wirklich ist, ist keine Potentialität. Auch aus Hindrichs’ Argumentation wird kein Grund ersichtlich, diesem Ungrund, dieser absoluten Potentialität nicht auch Existenz zuzuschreiben. Dass der Ungrund als absolute Potentialität gedacht werden kann, scheint sich mir indessen auch aus Hindrichs’ Ausführungen zu ergeben. Denn er beschreibt das Subjekt als ein kontingentes.478 Die Möglichkeit des Subjektes aber ist die absolute Potentialität bedingter Existenz. Und so kann die absolute Potentialität als der Ungrund verstanden werden, aus dem das Subjekt grundlos entsteht und seinen Stand, seinen Halt und seine Haltung gewinnt. Hindrichs’ Absolutes, sein Ungrund, kann also auch mit Hindrichs selbst als absolute Potentialität interpretiert werden. Wenn nicht die Absage an die Existenz der absoluten Potentialität, so drängt sich mir aus der Abnormität dieses existentiellen Sachverhaltes jedoch ein anderer Gesichtspunkt auf, der sich im Zusammenhang mit der Frage nach moralischem Verhalten als entscheidend herausgestellt hat. Die Beziehung zwischen Subjekt und absoluter Potentialität ist, da sie nicht durch ein Ordnen, Begründen und Machen bestimmt ist, eine, die in beide Richtungen durch den Begriff der Herrschaftslosigkeit beschrieben werden kann. Die absolute Potentialität ist keine Macht, sondern eine herrschaftsfreie Kraft. Damit aber scheint ihr genau jene Qualität zuzukommen, die es im moralischen Verhalten beim konkreten Aufeinandertreffen individueller Subjekte zwischen diesen durch die Konzentration auf das zweckfreie individuelle Interesse am Erleben und damit in der Konzentration auf die absolute Potentialität zu verwirklichen gilt. Die Konzentration ist dabei nicht so sehr eine reflexive Konzentration auf die absolute Potentialität oder das 478 Vgl. ebd., Seite 249. 221 zweckfreie individuelle Interesse am Erleben. Sondern sie bedeutet das Einnehmen einer diesem Interesse folgenden Haltung, in der die Reflexion zur Anpassung der Interessen gerade freigehalten und für die Suche nach einer für alle Beteiligten befriedigenden Lösung von Interessenswidersprüchen flexibilisiert wird. So ist es auch möglich, diese Haltung einzunehmen, ohne überhaupt jene Bezogenheit auf die absolute Potentialität reflektiert und expliziert zu haben. Moralisches Verhalten wird nicht erst durch die Reflexion und Explikation seiner Bedingungen möglich, sondern entspricht einer davon unabhängigen Fähigkeit interessierter, erlebender und freier Subjekte – der Fähigkeit zu einem Verhalten, das aus einer Haltung entspringt, die sich nicht an bestimmte Vorstellungen eines richtigen oder guten Lebens unabänderlich bindet, sondern, wenn die Widerspruchssituationen es erfordern, sich zu einem flexiblen Umgang mit diesen bereitet. In dieser Flexibilität aber hält sie stets fest am Wert und der Würde ihrer selbst und des anderen, damit aber auch an Gleichheit und Gerechtigkeit. Im wirklichen Bezug auf die absolute Potentialität, in der wirklichen moralischen Haltung wird so der Blick auf sich selbst und den anderen geöffnet, wird das Subjekt so frei für ein vorsichtiges Abtasten, Gerecht-Werden und Erkennen der eigenen und fremden Grenzen, ein gegenseitiges Respektieren, für Feinfühligkeit, Empfindsamkeit und Leidensfähigkeit. Die Zuwendung zur absoluten Potentialität bedeutet eine offene Zuwendung zum anderen. Wenn ich die absolute Potentialität als Bedingung moralischen Verhaltens in ihrer Existenz als einen raumzeitlosen Punkt beschrieben habe, so liegt darin auch eine Kritik an der von Johnston aufgegriffenen Philosophie Whiteheads, nach der allein raumzeitlich Ausgedehntes existieren könne. Einen Punkt versteht Whitehead als einen Nexus, eine Verbindung zweier oder mehrerer wirklicher Einzelwesen.479 Dabei schreibt Whitehead einem solchen Nexus keine ihm eigene Wirklichkeit zu, sondern leitet ihn bloß sekundär aus der Differenz wirklicher Ereignisse ab. „Wirkliche Einzelwesen – auch wirkliche Ereignisse genannt – sind die letzten realen Dinge, aus denen die Welt zusammengesetzt ist.“ Wenn diese Betonung der Wirklichkeit des Einzelnen keine begriffliche Chimäre sein soll, dann hätte Whitehead meiner Ansicht nach jedoch gerade die Wirklichkeit eines raumzeitlosen Punktes voraussetzen müssen. Denn wie ist es zu denken, dass etwas wirklich voneinander Verschiedenes aufeinander bezogen sein kann, wenn nicht durch einen wirklichen Punkt, der dieses Bezogen-Sein und damit den Gesamtzusammenhang aller Beziehungen in ihrer Totalität überhaupt erst ermöglicht? Der Gesamtzusammenhang kann das Bezogen-Sein einzelner Wirklichkeiten aufeinander nicht begründen, weil dieser deren Bezogen-Sein bereits voraussetzt. Auch die einzelnen Wirklichkeiten können ihre Bezogenheit nicht begründen, weil ihre Verschiedenheit sie 479 „Ein Punkt ist ein Nexus von wirklichen Einzelwesen mit einer bestimmten ›Form‹“, Whitehead (1979), Seite 545. 222 gerade voneinander differenziert. Wollen wir einen solchen Zusammenhang von Verschiedenheit ohne einen absoluten Bezugspunkt verstehen, so könnte es sich nur um eine begriffliche, nicht aber eine wirkliche Verschiedenheit handeln. Whiteheads Negation der Existenz eines raumzeitlosen, d.h. absoluten Punktes negiert, wenn man zu Ende denkt, die Wirklichkeit der Vielheit von Einzelwesen bzw. Ereignissen. Der Punkt oder Nexus, durch den wirklich voneinander Verschiedenes aufeinander bezogen ist, kann nicht weniger wirklich sein als das, was durch ihn miteinander in Bezug steht. Seiner Wirklichkeit nach kann der Punkt aber nicht in, außer bzw. zwischen einzelnen Ereignissen liegen, muss also eine raumzeitlose Wirklichkeit sein; und da seine Beziehung zu den durch ihn aufeinander bezogenen raumzeitlichen Ereignissen nicht ihrerseits raumzeitlich bestimmt werden kann, bleibt schließlich allein die Möglichkeit, ihn als absolute Potentialität der Vielheit der Ereignisse, d.h. raumzeitlicher Existenzen zu verstehen. Die absolute Potentialität bedingter Existenz als ein raumzeitloser Punkt lässt die Vielheit bedingter Existenzen in ihrem Zusammenhang als eine wirkliche Vielheit denken. Whitehead hat meiner Meinung nach also Recht damit, dass ein Punkt nicht in Raum und Zeit existiert. Und genau das ist der Hintergrund der Rede von der absoluten Potentialität als einem raumzeitlosen Punkt. Der Unterschied zu Whitehead liegt jedoch darin, den Begriff der Existenz nicht grundsätzlich auf raumzeitliche Ereignisse zu beschränken. Des Weiteren scheint mir auch seine Beschreibung eines Punktes als „ein Nexus von wirklichen Einzelwesen“ durchaus treffend zu sein. Denn genau das heißt es ja, wenn hier gesagt wird, dass die wirklichen Ereignisse in dem Punkt der absoluten Potentialität als der ihnen gemeinsamen Bedingung aufeinander bezogen sind. Unrichtig scheint mir dahingegen zu sein, diesen Nexus aus der Bezogenheit wirklicher Ereignisse allein abzuleiten, anstatt ihm eine eigene Wirklichkeit bzw. Existenz zuzusprechen. Und schließlich hat Whitehead meines Erachtens auch Recht damit, dass uns in der Reflexion der Bezogenheit von verschiedenen Ereignissen dieser Nexus begrifflich ersichtlich wird; nämlich genau dann, wenn wir uns klar machen, dass diese Ereignisse durch einen Punkt aufeinander bezogen sein müssen. Dieser aber muss eine von seiner Reflexion unabhängige und unbedingte Wirklichkeit sein; zumindest dann, wenn die Wirklichkeit bedingter Einzelwesen bzw. Ereignisse nicht als Illusion erscheinen soll. In der Annahme der Wirklichkeit einer Vielheit aufeinander bezogener Einzelwesen hätte Whitehead meines Erachtens von der Existenz oder Wirklichkeit eines absoluten raumzeitlosen Punktes ausgehen müssen. Im Gegensatz dazu ist das Absolute bei Whitehead und so auch bei Johnston kein Punkt, sondern der totale Zusammenhang eines raumzeitlichen, zweipoligen Prozesses. Die zwei komplementären Pole sind zum einen der physische Pol eines jeden wirklichen Einzelwesens, eines jeden wirklichen Ereignisses der endlichen Vielheit, zum anderen der 223 begriffliche Pol als allumfassende, die endliche Vielheit in sich aufnehmende Einheit. Den begrifflichen Pol versteht Whitehead als ein Streben, als stets mit einer begrifflichen Wertung verbundenen Drang zur Realisierung des begrifflich Erfassten. 480 Der allgemeinste Begriff kann mit Whitehead verstanden werden als Gott, als der strebende Inbegriff „des absoluten Reichtums an Potentialitäten. Unter diesem Aspekt ist er nicht vor, sondern mit aller Schöpfung.“481 Denn als nach Verwirklichung aller Potentialitäten strebender Begriff sei er zwar „uranfänglich“, doch „so weit von ‚höchster Realität‘ entfernt, daß es ihm in dieser Abstraktion ‚an Wirklichkeit mangelt‘ – und das in zweierlei Hinsicht. Seine Empfindungen sind nur begrifflich, so daß es ihnen an der Fülle der Wirklichkeit fehlt. Zweitens kommt es in den subjektiven Formen begrifflicher Empfindungen nur dann zu Bewußtsein, wenn eine komplexe Integration mit physischen Empfindungen stattfindet.“482 Der allgemeinste Begriff, Gott, verweise so auf den anderen Pol als Bedingung der Verwirklichung seines Strebens. Vor diesem Hintergrund spricht Whitehead von den beiden Polen auch als „Urnatur“ und „Folgenatur“ Gottes.483 Diese zwei Pole, das sind die endliche Vielheit der Welt und Gott, die im Prozess „immerwährend“ aufeinander bezogen sind. „Immerwährend“, das ist bei Whitehead „die Eigenschaft, kreatives Fortschreiten mit der Beibehaltung wechselseitiger Unmittelbarkeit zu verbinden [...].“484 „Gott und die Welt stehen einander gegenüber und bringen die letzte metaphysische Wahrheit zum Ausdruck, daß strebende Einheit und physisches Erleben gleichermaßen Anspruch auf Priorität in der Schöpfung haben. Es können aber noch nicht einmal zwei Wirklichkeiten auseinandergerissen werden: jede ist alles in allem. Daher verkörpert jedes zeitliche Ereignis Gott und wird in Gott verkörpert. [...] Daher muß das Universum so gedacht werden, daß es seine eigene Vielheit von Gegensätzen selbst aktiv zum Ausdruck bringt – seine eigene Freiheit und seine eigene Notwendigkeit, seine eigene Vielheit und seine eigene Einheit, seine eigene Unvollkommenheit und seine eigene Vollkommenheit. All die ‚Gegensätze‘ sind Elemente in der Natur der Dinge und lassen sich nicht wegdenken. Der Begriff ‚Gottes‘ ist die Weise, in der wir diese unglaubliche Tatsache verstehen – daß doch ist, was nicht sein kann.“485 „Die Aufgabe der Philosophie besteht darin, wieder zu der Totalität zu finden, die in der Selektion verlorenging. Sie ersetzt in der rationalen Erfahrung, was in der höheren sinnlichen Erfahrung unterdrückt und durch die anfänglichen Operationen des Bewußtseins selbst noch tiefer versenkt wurde. Der selektive Charakter der individuellen 480 Vgl. ebd., Seite 80. Ebd., Seite 614. 482 Ebd. 483 Ebd., Seite 616. 484 Ebd., Seite 617. 485 Ebd., Seite 322ff. 481 224 Erfahrung ist insofern moralisch, als er mit den Prioritäten übereinstimmt, die in der rationalen Anschauungsweise sichtbar werden; und umgekehrt berichtigt die Umwandlung der intellektuellen Einsicht in eine emotionale Kraft die sinnliche Erfahrung in Richtung auf die Moral. Die Stärke der Korrektur steht im Verhältnis zur Rationalität der Einsicht. Die Moralität einer Weltanschauung ist untrennbar mit ihrer Allgemeingültigkeit verbunden. Der Widerspruch zwischen dem allgemein Guten und dem individuellen Interesse kann nur aufgehoben werden, wenn das Individuum so beschaffen ist, daß seine Interessen dem allgemeinen Guten entsprechen; auf diese Weise dient es als Beispiel für den Verlust der geringeren Intensitäten, um sie mit feinerer Zusammensetzung in einem erweiterten Interessenhorizont wiederzufinden.“ 486 Das allgemeine Gute erscheint bei Whitehead wie bei Johnstons agape nicht als eine bestimmte Vorstellung, sondern als Überwindung der Individualität, des „incurvatus in se“ durch eine aus dem allgemeinen Begriff der Existenz erwachsende zur Moralität befähigende emotionale Kraft. Je totaler die rationale Einsicht umso stärker das moralische Verhalten. Zwar distanziert sich Whitehead in seinem Begriff des Absoluten ausdrücklich von Hegel, der sich, soweit ich Whiteheads Interpretation hier verstehe, in seinem „evolutionären Monismus“ vornehmlich auf das „stetige Vergehen“ der Formen, den „Übergang von einem besonderen Seienden zum anderen [Hervorhebung im Original; T. W.]“ konzentriert und damit den Begriff des Prozesses vom Besonderen weg allein in Richtung auf die allgemeine Begrifflichkeit reduziert habe; die andere „Art des Fließens“ aber vom begrifflich Allgemeinen hin zum konkreten wirklichen Ereignis, „die Konkretisierung“ dabei aus dem Blick verloren habe.487 In Abgrenzung zu solchen Vereinseitigungen zum Allgemeinen hin will Whitehead in seiner organistischen Philosophie den absoluten Prozess als „ein ausgewogeneres Verhältnis“ der zwei Arten des Fließens denken.488 Ob Whiteheads Kritik an Hegel so berechtigt ist, kann man in Frage stellen. Doch auch unabhängig von der Frage nach der Berechtigung dieser Kritik versteht auch Whitehead wie Hegel das Absolute als eine Totalität. Die „letzte metaphysische Wahrheit“ liegt bei ihm, wie bei Hegel, in der absoluten Einheit der Widersprüche – „All die ‚Gegensätze‘ sind Elemente in der Natur der Dinge und lassen sich nicht wegdenken. Der Begriff ‚Gottes‘ ist die Weise, in der wir diese unglaubliche Tatsache verstehen – daß doch ist, was nicht sein kann.“ Damit aber gilt gegenüber Whitehead die gleiche Kritik, die ich mit Schnädelbach bezüglich der hegelschen Wahrheitslehre deutlich gemacht habe.489 Wir können den Begriff eines Absoluten als eines Ganzen von Gegensätzen nicht verstehen. Wenn Whitehead von der Unglaublichkeit der Tatsache spricht, die wir durch den Begriff der zweipoligen Natur Gottes verstehen würden – „daß doch ist, was nicht sein kann“ – so 486 Ebd., Seite 52f. Vgl. ebd., Seite 388f. 488 Ebd., Seite 60. 489 Vgl. Seite 125ff. dieser Arbeit. 487 225 verstehe ich diese Unglaublichkeit als Reaktion auf einen in sich widersprüchlichen „Begriff“. Einen solchen können wir aber gerade, anders als Whitehead es behauptet, nicht verstehen. Schließlich müsste man ihm aus diesem Grund entgegenhalten: Je totaler die Einsicht, umso unverständlicher wird sie, desto weniger ist sie rational; desto weniger dürfte sie uns dann aber auch in Whiteheads Verständnis zur Moralität befähigen. In diesem Zusammenhang könnte man wiederum de Vries’ und Hindrichs’ Votum gegen Existenzzuschreibungen hinsichtlich eines mit dem Ganzen identifizierten Absoluten und der damit verbundenen Widersprüchlichkeit nachvollziehen. Denn wir sollten einem widersprüchlichen „Begriff“ von etwas, das wir durch einen solchen eben gar nicht begreifen können, keine Existenz zusprechen. Denn wir verstehen letztlich gar nicht, was wir da sagen. Vor dem Hintergrund dieser Kritik scheinen de Vries und Hindrichs also nur konsequent zu sein, wenn sie von einem als Totalität verstandenen Absoluten, das sich uns begrifflich entzieht, nicht sagen wollen, dass es existiere, sondern angesichts solcher Widersprüche stattdessen, wie de Vries, von einem „Tertium Datur“ oder, wie Hindrichs, von einem „Geheimnis“ sprechen. Ob de Vries und Hindrichs das Absolute latent als eine Totalität verstehen, wird mir aus ihren Texten jedoch nicht ersichtlich. Man müsste es ihnen unterstellen. Wie dem auch sei, die hier angesprochene Nachvollziehbarkeit des Verbotes von Existenzaussagen über das Absolute erübrigt sich, wenn man das Absolute nicht als das Ganze, sondern vielmehr als eine unbedingte raumzeitlose Wirklichkeit, eben als einen Punkt versteht. Die Vielheit der wirklichen bedingten Einzelwesen bzw. Ereignisse hängt durch diesen absoluten Punkt miteinander zusammen. Das Unbedingte wird hier nicht als das Ganze, nicht als Totalität, sondern allein als die Potentialität alles Bedingten verstanden; und so auch als die Potentialität der durch den Zusammenhang bedingter Existenzen bedingten totalen Wirklichkeit. Totalität ist der Begriff eines bedingten Zusammenhanges. Auch ist die absolute Potentialität anders als bei Hegel nicht „die Wahrheit“. Wahrheit ist ein Anspruch, den wir mit Aussagen verbinden, so hier mit der Aussage, dass die absolute Potentialität existiert; mit anderen Worten, dass der Begriff der absoluten Potentialität ein objektiver ist. Wahrheitsansprüche sollten nachvollziehbar begründet werden können. Dass mir kein Grund ersichtlich wird, der absoluten Potentialität keine Existenz zuzuschreiben, habe ich bereits verdeutlicht. Darin liegt aber nicht auch schon anders herum eine Begründung dafür, dieses zu tun. Ist eine solche Begründung einer Existenzaussage hinsichtlich der absoluten Potentialität als eines raumzeitlosen Punktes möglich? Ich denke schon. Denn im Hinblick auf meine Kritik der whiteheadschen Absage an die Existenz eines raumzeitlosen, d.h. absoluten, Punktes lässt sich Folgendes sagen: Jeder Gedanke, der eine wirkliche Differenz zwischen einem Subjekt und einer von ihm unterschiedenen Wirklichkeit beinhaltet, setzt die Wirklichkeit eines absoluten Punktes voraus, durch den das diesen Gedanken denkende Subjekt und die von ihm unterschiedene Wirklichkeit 226 aufeinander bezogen sind. Das aber bedeutet nichts anderes, als dass jede Aussage über eine von einem wirklichen Subjekt unterschiedene Wirklichkeit ebenso die Wirklichkeit eines absoluten Punktes voraussetzt. Daraus wiederum ergibt sich: Jede in irgendeinem nachvollziehbaren Sinne Objektivität für sich beanspruchende Aussage über eine vom Subjekt unterschiedene Wirklichkeit – wie auch immer genau das Verhältnis zwischen den dieser Aussage zugrunde liegenden Begriffen und der vom Subjekt unterschiedenen Wirklichkeit gedacht wird – setzt die Wirklichkeit eines absoluten Punktes voraus. Solchermaßen Objektivität beanspruchende Aussagen tragen in sich implizit die Voraussetzung eines absoluten Bezugspunktes. In ihrer Explikation kann diese Bedingung nicht als weniger objektiv gedacht werden, als das, was unter ihrer impliziten oder expliziten Voraussetzung als objektiv ausgesagt und begründet wird. Solange wir auch nur ansatzweise an dem Gedanken objektiver Aussagen über eine extraindividuelle Wirklichkeit festhalten wollen, müssen wir, zumindest implizit, von der Objektivität eines absoluten Bezugspunktes ausgehen. Sage ich, dass die Sonne als von mir unterschieden wirklich existiert, so kann der absolute Punkt durch den ich auf die Sonne bezogen bin, nicht weniger wirklich sein, als die Sonne und ich selbst. Jedes Elementarteilchen, das als ein wirkliches Teilchen in einer Wechselwirkung zu einem anderen wirklichen Teilchen steht, setzt die Wirklichkeit eines absoluten Punktes voraus, durch den beide Teilchen aufeinander bezogen sind. Würden wir die Wirklichkeit eines absoluten Punktes verneinen, so müssten wir konsequenterweise behaupten, dass alles Eins ist, alle Vielheit und Differenz letztlich Halluzination und Illusion – die unio mystica der Moderne. Nelson hat Recht: „Wer die Metaphysik aus der Wissenschaft eliminieren will, der liefert, da ohne Metaphysik überhaupt nicht geurteilt werden kann, die Wissenschaft an irgendeine Metaphysik außerhalb der Wissenschaft aus, d.h. der spielt, ohne es zu wissen und zu wollen, die Wissenschaft dem Mystizismus in die Hände.“490 Aber man kann es noch stärker formulieren: Die Wissenschaft selbst gerät zu einem Mystizismus. In der begrifflichen Entdifferenzierung würde alle Differenz im begreifenden Subjekt als halluziniert und illusioniert zusammenschnurren; und es müsste schließlich entweder der von ihm unterschiedenen Wirklichkeit eine von ihm unabhängige Existenz abstreiten und sich damit selbst zum absoluten Punkt gerieren; oder das Subjekt müsste seine eigene Existenz verneinen. Wer die Wirklichkeit bzw. Existenz eines absoluten Punktes bestreitet, durch den alles bedingt Wirkliche direkt oder indirekt aufeinander bezogen ist, beginnt sich entweder selbst zu verabsolutieren oder sich selbst zu negieren. Beide Konsequenzen sind meiner Meinung nach und wie ich weiter oben ausgeführt habe praktisch und praktisch-theoretisch unhaltbar.491 490 491 Nelson (1974), Seite 281. Vgl. Seite 139f. dieser Arbeit. 227 Die Beziehung zwischen dem absoluten Punkt und der Vielheit der durch ihn aufeinander bezogenen raumzeitlichen Existenzen kann, auch das habe ich bereits in meiner Kritik an Whitehead deutlich gemacht, selbst nicht raumzeitlich bestimmt werden. Diese Beziehung kann am Ende nur als die zwischen unbedingter Potentialität und bedingter Existenz gedacht werden. Der Gedanke einer Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ist deshalb auszuschließen, weil er der in der intra- und extraindividuellen Wirklichkeit erfahrbaren bedingten Freiheit, dem individuellen Interesse und dem individuellen Erleben derselben nicht gerecht wird.492 Wir leben in einer Wirklichkeit, die in all ihrer Regularität dennoch nicht ohne kausale Wunder, statistischen Zufall und praktische Freiheit beschreibbar ist. Ich gehe davon aus, dass in dieser Feststellung kein grundsätzlicher Widerspruch zur Naturwissenschaft – zumindest der zeitgenössischen – besteht, wenn auch wahrscheinlich zu den naturalistischen Weltbildern einzelner Wissenschaftler. Denn in den Naturwissenschaften ist man seit längerem davon abgekommen, die Wirklichkeit insgesamt ohne die Integration des nicht-epistemischen Zufallsgedankens beschreiben zu können. Der Einfluss des Zufalls auf den Gang der Entwicklung ist in kausaler Hinsicht jedoch völlig unerklärlich, und insofern wunderlich. Und auch die Negation individueller Freiheit hält einer eingehenden Prüfung der naturwissenschaftlichen Theorien keinesfalls stand. Das hat Brigitte Falkenburg zuletzt in Mythos Determinismus eindringlich herausgearbeitet.493 Es scheint mir aus diesen Gründen mit Nelson ratsam, angebracht und möglich, im theoretischen Diskurs eine über das Anliegen der Kategorien-Analyse, also eine über deskriptive Metaphysik hinausgehende Metaphysik mit aller Vorsicht und rigoroser Kritik wieder ernster zu nehmen. Auch bin ich der Meinung, dass eine solche philosophische Auseinandersetzung keine theoretische Abkapselung zur Folge haben muss. So kann man in Bezug auf die absolute Potentialität, die in dieser Arbeit vor allem im Rahmen praktisch-philosophischer Erörterungen thematisch wurde, danach fragen, was die Annahme derselben etwa für die physikalische Theorie bedeuten kann. Um es konkret zu machen, zwei kurz skizzierte Beispiele. Dennis Lehmkuhl schreibt über das physikalische Existenzproblem: „Was existiert? Raum, Zeit, Materie. Aber was ist fundamental. [...] In der modernen Debatte werden meist zwei Möglichkeiten angeboten: Entweder sind Raumzeit und Materie gleichermaßen fundamental (Substanzialismus), oder aber materielle Körper sind das einzige Fundamentale, und Raum und Zeit sind nur Abstraktionen von oder ergeben sich nur durch Beziehungen, in denen materielle Körper zu einander stehen (Relationalismus). [...] Aber es gibt eine dritte Möglichkeit [...]. Sklar [...] hat dieser Position den Namen ‚Super-Substanzialismus‘ gegeben. Die Idee ist einfach: Alles, was wir wahrnehmen, sind nur Aspekte und Eigenschaften der 492 493 Vgl. Seite 112ff. dieser Arbeit. Falkenburg, Brigitte: Mythos Determinismus, Berlin/Heidelberg: Springer, 2012. 228 Raumzeit.“494 Unter der Annahme einer absoluten Potentialität aber gibt es eine vierte Möglichkeit, der ich hier jedoch keinen Namen geben will. Fundamentale Existenz, d.h. unbedingte Existenz käme dann allein der absoluten Potentialität zu. Dahingegen wären Raumzeit und Materie gleichermaßen bedingt und ihrer Wirklichkeit nach überhaupt nicht voneinander zu trennen; Raumzeit gibt es nicht ohne materielle Körper, materielle Körper nicht ohne Raumzeit. Ein zweites Beispiel. Die absolute Potentialität könnte etwa auch im Zusammenhang des Casimir-Effektes diskutiert werden. Sie könnte dann als absolutes Vakuum bezeichnet werden, das alles andere als nichts ist, sondern eben absolute Potentialität. Was in der Versuchsanordnung zum Nachweis des Casimir-Effektes getan wird, könnte verstanden werden als eine experimentelle Präparation, in der in einem Teilbereich der materiellen Raumzeit die absolute Potentialität in gewisser Weise freigelegt wird. In diesem so präparierten Bereich käme es aus der absoluten Potentialität heraus zum Entstehen einfachster als Quantenfluktuationen bezeichneter Teilchen-Ereignisse, die zu dem beobachteten Effekt führen. Die angedeuteten Überlegungen gehen natürlich noch viel weiter, als ich dies hier darstellen kann. Es kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht tiefer in die Diskussion dieser Beispiele eingestiegen werden. Es sollte nur kurz deutlich gemacht werden, dass es sich bei dem vorgeschlagenen Begriff einer raumzeitlosen und damit dimensional unermesslichen absoluten Potentialität um keinen Begriff handelt, der die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Beobachtungen und Theorien scheuen muss. Und ich halte eine solche Annäherung an naturwissenschaftliche Phänomene und Theorien nicht zuletzt auch zur kritischen Kontrolle metaphysischer Vorstellungen für sehr ratsam. Wenn etwa die Vorstellung einer absoluten Potentialität wohl auch nicht direkt experimentell überprüft werden kann, so kann doch getestet werden, inwiefern diese mit naturwissenschaftlichen Phänomenen zumindest nicht im Widerspruch steht, vielleicht aber sogar auch inwiefern sie positiv zur Plausibilisierung bestimmter Phänomene beitragen kann. Wenn ich die Annahme der Wirklichkeit der absoluten Potentialität nicht nur behaupte, sondern darüber hinaus auch mit Argumenten zu begründen versuche, so kann ich wahrscheinlich mit Hindrichs’ kritischer Nachfrage rechnen, ob hier nicht die Grenze des in metaphysischer Hinsicht Erlaubten überschritten werde. Denn mache ich die absolute Potentialität auf diese Weise nicht zu einer von mir begründeten und ziehe sie damit in den Bereich der normalen Bestimmungen, der von mir gemachten gedanklichen Ordnungen, die ihrer Abnormität jedoch nicht gerecht werden? Hierzu sei Folgendes gesagt: Es wird hier nicht die absolute Potentialität, sondern es werden Gedanken begründet; auch wird hier nicht die absolute Potentialität, sondern es werden Gedanken geordnet; schließlich 494 Lehmkuhl, Dennis: „Super-Substanzialismus in der Philosophie der Raumzeit“, in: Michael Esfeld (Hrsg.): Philosophie der Physik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2012, Seite 50. 229 wird hier nicht die absolute Potentialität, sondern es werden sich Gedanken gemacht. Dies ist der nicht nur für die Metaphysik entscheidende Unterschied zwischen der Begründung einer Objektivität beanspruchenden Aussage und der Begründung des durch diese Aussage bezeichneten Sachverhaltes. Letzteres wurde hier nicht auch nur ansatzweise versucht. Es wurden hier Gründe dafür gegeben, die dafür sprechen, von der objektiven Wirklichkeit einer absoluten Potentialität auszugehen. Eine mögliche Begründung liegt darin, um es noch einmal zu sagen, dass wir eine absolute Potentialität voraussetzen müssen, um die wirkliche Differenz zwischen intra- und extrasubjektiver Wirklichkeit theoretisch aufrecht zu erhalten, damit aber auch für jegliche sich auf eine extrasubjektive Welt beziehenden Aussagen. Solange wir an solchen Aussagen festhalten wollen, und wir haben allen Grund, dieses zu tun, liegt in diesen Gründen und dem Festhalten an der metaphysischen Differenz zwischen Subjekt und Umwelt auch eine Begründung für die Annahme einer absoluten Potentialität; so aber auch eine Begründung für die Annahme der objektiven Wirklichkeit desjenigen Sachverhaltes, der hier als die Bedingung der Möglichkeit moralischen Verhaltens und damit für ein befriedigendes Leben in Frieden vorausgesetzt wurde. Wenn Schnädelbach sagt: „In der praktisch-politischen Verlängerung des Gedankens der kommunikativen Einheit der Vernunft wird das sichtbar, was auch real solche Einheit allein ermöglicht: der Frieden [Hervorhebung im Original, T. W.]“, dann würde ich hier ergänzen wollen, dass darin auch ein Verweis auf die absolute Potentialität liegt.495 Denn diese ist der raumzeitlose Punkt, durch den „endliche, zugleich natürliche und geschichtliche und im übrigen vernunftbegabte Wesen“ überhaupt existieren und sich kommunikativ und in einer Haltung aufeinander beziehen können, die ein friedliches Zusammenleben erst ermöglicht.496 Aber ein solches Leben bleibt stets „nur“ eine Möglichkeit, deren Ergreifen von unserer durch kein unbedingtes Sollen verargumentierbaren freien Entscheidung und stetigen Suche nach einer Verwirklichung moralischen Verhaltens in der Widerspruchshaftigkeit alltäglicher und konkreter Begegnungen mit anderen und unserem moralisch-politischen Verhalten abhängig bleibt. Dass wir dazu frei sind, davon kann man, denke ich, ausgehen. Denn nach einem solchen Leben zu suchen, bedeutet, sich jeweils auf das innerste individuelle Interesse zu konzentrieren und sich dadurch in eine Haltung zu bringen, die es zumindest prinzipiell ermöglicht, in einer mitunter sehr anstrengenden gegenseitigen Anpassung der Interessen zu einer Auflösung des Interessenwiderspruches ohne gegenseitige Unterdrückung zu gelangen. Und stets erst hinterher wird man wissen, was das eigene moralische und moralisch-politische Verhalten für das eigene Leben jeweils immer wieder neu konkret bedeutet. Sich in diesem Sinne mit Nietzsche als experimentellforschend zu verstehen, ist ein zentraler Aspekt einer Moralität, die keine moralische 495 496 Schnädelbach (1993), Seite 23. Ebd., Seite 23. 230 Idolatrie betreibt, sondern den Wert und die Würde seiner selbst und des anderen sowie Gleichheit und Gerechtigkeit zu ihrer Norm erhebt. Pinkard sagt: „Self-comprehension as equally free does not require the oppression of others.“497 Zu diesem Selbstverständnis sollte es meiner Ansicht gehören, in der Reflexion der Bedingungen eines solchen Verhaltens zu erkennen, dass wir dieses nicht allein aus uns selber schöpfen können. Nietzsche scheint mir in seiner Betonung des Übermenschen vor diesem Schritt zurückgewichen zu sein. Aber es sollte deutlich geworden sein, dass moralisches Verhalten nicht erst durch die Reflexion seiner Bedingungen möglich wird, sondern eine Fähigkeit ist, zu deren Ergreifen wir auch ohne eine solche Reflexion frei sind. Die Möglichkeit moralischen Verhaltens bedeutet einen Aspekt unserer bedingten Freiheit. Einer Freiheit, die einige einseitig argumentierende Wissenschaftler meinen, uns generell absprechen zu können. Dazu eine letzte Anmerkung. Könnte der Gedanke der Freiheit falsifiziert werden, so wäre dies für die Freiheit eine schlechte Nachricht. Tatsache ist, dass eine solche Falsifizierung unserer bedingten Freiheit bis heute nicht gelungen ist.498 Aber auch ein positiver Nachweis, der über die Bedingung des individuellen Erlebens der Freiheit hinausginge, angenommen ein solcher sei wie auch immer möglich, wäre keine gute Nachricht für die Freiheit. Begriffliches Denken ist eine Tätigkeit, die, wenn der Gedanke der Freiheit wahr ist, selbst unter der Bedingung dieser Freiheit steht. Wie aber könnte der Gedanke der Freiheit wahr sein, wenn man zu seiner Anerkennung durch Argumente gewissermaßen genötigt werden könnte? Freiheit ist in ihrem Begriff allein in einem freien Ergreifen desselben zu verstehen. Wir könnten unsere Freiheit nicht als Freiheit verstehen, könnten wir zu ihrer Anerkennung argumentativ überredet oder gar gezwungen werden. In einer Wirklichkeit, in der Freiheit nachweisbar wäre, wäre Freiheit genauso wenig wahr, wie in einer Wirklichkeit, in der sie falsifiziert werden könnte. Dass wir in einer Wirklichkeit leben, in der beides bisher nicht gelungen ist, kann einen da nur beruhigen. Freiheit, wenn sicherlich auch nicht bloße Willkür, ist darüber hinaus eine Bedingung wahren Erkennens. Wären wir gezwungen, etwas anzunehmen, so würden wir es nicht anerkennen, weil es wahr ist. Das freie Anerkennen ist Bedingung dafür, etwas überhaupt als wahr zu erkennen. Eine Wirklichkeit, in der Freiheit falsifizierbar oder nachweisbar wäre, würde eine Wirklichkeit sein, in der wahres Erkennen unmöglich wäre, damit aber auch die Falsifikation oder der Nachweis von Freiheit; eine solche Wirklichkeit kann es nicht geben, oder etwas zurückhaltender, ist nicht konsequent denkbar. Wer die Freiheit grundsätzlich negiert und in welchen Erkenntniszusammenhängen auch immer mehr will als plausible, intersubjektiv überprüfbare Gründe, begibt sich, genau genommen, automatisch aus dem wissenschaftlichen Diskurs heraus. 497 Pinkard (2012), Seite 173. Vgl. Falkenburg (2012); sowie Mele, Alfred R: Effective Intentions – The Power of Conscious Will, Oxford/New York: Oxford University Press, 2009. 498 231 Philosophie ohne Fortschritt? Diese Arbeit soll ihren Schluss in derjenigen Frage finden, die titelgebend jenen Gedankengängen voransteht, die uns bis hin zu der Thematisierung eines unbedingten, raumzeitlosen Bezugspunktes, der absoluten Potentialität geführt haben. Die absolute Potentialität erscheint dabei nicht nur als die Bedingung bedingter Existenzen überhaupt und ihrer Bezogenheit, sondern auch als eine Voraussetzung der Möglichkeit moralischen Verhaltens. Denn sie erweist sich als eine Wirklichkeit, in der keine Wertunterschiede zwischen in ihrer Existenz bedingten Subjekten bestehen. Die absolute Potentialität steht als solche in einer positiven Beziehung zu sämtlichen bedingten Existenzen, nicht aber begründet sie evaluative Differenzen zwischen diesen. Damit aber bedeutet sie eine Wirklichkeit, in der moralisches Verhalten am Ende allein möglich erscheint. Denn soweit wir unser Verhalten wirklich an dieser orientieren, orientieren wir uns damit an einer Wirklichkeit, in der bedingte Existenzen eine gleiche Wertschätzung erfahren. Diese Orientierung, so wurde argumentiert, drückt sich in einer Haltung aus, in der im Falle kollidierender Interessen nach einer moralischen Auflösung des Widerstreits gesucht wird. Diese Haltung kann in der Konzentration auf das auf die absolute Potentialität bezogene je individuelle zweckfreie Interesse am Erleben gewonnen werden. Das in dieser Haltung ermöglichte moralische Verhalten wurde als dasjenige Verhalten identifiziert, durch welches das kontingente Spiel reiner Machtverhältnisse in der gegenseitigen Anerkennung des individuellen Wertes und der individuellen Würde durchbrochen werden und das zugleich dem normativen Relativismus Einhalt gebieten kann. Keine Gesellschaft, mit welchen konkreten Normen auch immer, kann ohne das individuelle moralische Verhalten ihrer Mitglieder auskommen, d.h. die freiwillige Berücksichtigung der den eigenen widersprechenden Interessen anderer. Damit erscheint das moralische Verhalten als aus unserer Natur als interessierte, erlebende und freie Subjekte entspringende oberste Bedingung gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dieser Sachverhalt liegt in unseren moralischen Ansprüchen begründet, denen wir uns gegenseitig aussetzen. Und so wir ein befriedigendes Leben in Gesellschaft suchen wollen, kommen wir um die Entwicklung eines moralischen Interesses nicht umher. Insoweit das individuelle moralische Interesse an Freiwilligkeit gebunden bleibt, einem solchen Leben überhaupt nachzugehen, damit aber auch gebunden bleibt an die stets latente Machtproblematik, erwächst aus den moralischen Ansprüchen ein Interesse an der politischen Bewältigung dieser Kontingenz; ein politisches Interesse an einer dritten Gewalt, an einem Staat, der, um selbst nicht wiederum Ausdruck kontingenter Machtverhältnisse zu sein, konsequenterweise das moralische Verhalten und damit den Wert und die Würde eines jeden sowie Gleichheit und Gerechtigkeit als seine zentralen Prinzipien setzt und diese in der sozialen Praxis stetig umkreist. Die Verwirklichung solcher politischen Verhältnisse ist daran geknüpft, dass die individuellen Subjekte in irgendeiner Form an der Formulierung und Reformulierung der Normen, nach denen moralisch nicht aufgelöste Interessenswidersprüche beigelegt werden 232 sollen, beteiligt werden. Das beinhaltet aber auch ein für eine solche Beteiligung vorauszusetzendes moralisch-politisches Interesse und Engagement der Subjekte selbst. Moralisches und moralisch-politisches Interesse werden als diejenigen Interessen herausgestellt, durch welche die je individuelle Suche nach einem befriedigenden Leben eine objektive Richtung bekommen kann, als eine Suche nach einem befriedigenden Leben in Frieden. Ein individuelles Leben, das in dieser Weise seine sonstigen Interessen kontextualisiert, kann als ein sich um Fortschritt, um eine objektiv gute Entwicklung bemühendes Leben verstanden werden; als ein Leben, das nach seinem Beitrag zu einer solchen Entwicklung sucht. Philosophie ohne Fortschritt? – Diese Frage kann auf zwei Weisen gelesen werden. Zum einen dahingehend, wie es um den Fortschrittsbegriff in der philosophischen Diskussion bestellt ist bzw. bestellt sein sollte; zum anderen dahingehend, ob in der Philosophie selbst ein Fortschritt Statt hat. In Bezug auf die erste Lesart bedeutet die vorliegende Untersuchung eine Verneinung. Ich denke nicht, dass die Philosophie darauf verzichten sollte, den Fortschrittsbegriff erneut zu ergreifen und an einem Begriff desselben zu arbeiten, zu dem wir uns subjektiv in ein praktisches Verhältnis setzen können, der aber zugleich auch die universale Offenheit bewahrt, in der nach einer objektiv guten Entwicklung gesucht werden kann. Dies bedeutet die Suche nach einer begrifflichen Brücke, die uns den Übergang ermöglicht von einem recht abstrakten Verständnis unserer Selbst und unseres Eingebunden-Seins in subjektiv nicht zu überblickende Wirkungszusammenhänge zu einer Alltagspraxis, in der wir in konkreten Situationen uns auf diese konzentrierend dennoch darüber bewusst sein können, dass gerade auch in diesen Alltagssituationen unausweichlich an jenem größeren Zusammenhange mitgewirkt wird. Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zu einer in diesem Sinne erneuerten Fortschrittsdiskussion. In Anbetracht des hier vorgelegten Entwurfes eines möglichen Fortschrittsbegriffes scheint sodann aber auch eine Verneinung der zweiten Lesart der Titelfrage zu liegen, also der Frage, ob in der Philosophie selbst sich Fortschritt vollzieht. Denn zum einen kann die theoretische Diskussion des Fortschrittsbegriffes selbst als Teil- und Anteilnahme an einem solchen verstanden werden. Zum anderen gibt es in einer weiteren Hinsicht einen Zusammenhang zwischen Philosophie und dem hier vorgeschlagenen Fortschrittsverständnis: In dieser Arbeit wird der Philosophie eine Mittlerrolle zwischen ästhetischem, theoretischem und praktischem Diskurs zugesprochen. Diese drei Diskurse werden verstanden als ein den drei natürlichen Vernunftaspekten entsprechendes kreatives, adaptives und kooperatives, reflexiv-diskursives Verhalten. Die Vermittlung zwischen diesen Vernunftaspekten, auch auf einer reflexiv-diskursiven Ebene, wird ihrerseits als in der Konzentration auf das zweckfreie individuelle Interesse am Erleben gründend verstanden. Das heißt, dass eine Philosophie in diesem Sinne dem gleichen Interesse folgt 233 wie das hier im Rahmen des Fortschrittsbegriffes entwickelte moralische Verhalten. Man könnte also sagen, dass Philosophie in gewisser Weise selbst ein moralisches Verhalten ist. Oder man könnte anders herum sagen, dass moralisches Verhalten in gewissem Sinne immer auch ein philosophisches ist. Als ein solches aber verweist das moralische Verhalten auch auf die anderen Aspekte natürlicher Vernunft und ist letztlich nicht von diesen zu trennen. Moralisches Verhalten bedeutet nicht weniger als das künstlerische Schaffen, dem zweckfreien individuellen Interesse am Erleben einen Ausdruck zu verleihen, wenn auch vor dem speziellen Hintergrund einer moralischen Auflösung konkreter interindividueller Interessenswidersprüche. Genauso bedeutet es ein Anpassen der Reflexionen und in diesen der Begriffe über das, um was es je individuell und konkret geht, und worin eine jeweilige konkrete Auflösung der Widersprüchlichkeit bestehen könnte. Moralisches Verhalten ist also nicht allein praktisch, sondern beinhaltet auch theoretische und ästhetische Aspekte. Moralisches Verhalten erscheint somit auch als ein philosophisches genauso wie philosophisches Verhalten auch als ein moralisches erscheint. Und vor dem Hintergrund dieses Zusammenhanges und des hier vorgeschlagenen Fortschrittsbegriffes könnte man auch die philosophische Tätigkeit als einen Bereich unseres diskursiven Verhaltens verstehen, in dem sich ein Fortschritt tatsächlich vollziehen kann. Nur sollte dieser primär nicht als Steigerungs- oder Verbesserungsgeschehen verstanden werden, sondern als ein in der Vermittlung der Aspekte unseres vernünftigen Verhaltens liegender Beitrag zu einer sich in ihrem Optimum im modus sufficiens vollziehenden, anhaltenden Suche nach einem befriedigenden Leben in Frieden. Ein solcher Fortschritt ist ein beständiges Projekt und bleibt ein beständiges Problem und so auch eine beständige Frage. 234 Literatur Adorno, Theodor W.: „Fortschritt“, in: Helmut Kuhn/Franz Wiedmann: Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt, München: Verlag Anton Pustet, 1964. Alff, Wilhelm: „Condorcet und die bewußt gewordene Geschichte“, in: ders. (Hrsg.): Condorcet – Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1976. Arendt, Hannah: Besuch in Deutschland, Berlin: Rotbuch Verlag, 1993. Aristoteles: Nikomachische Ethik (Übers. Olof Gigon), Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler, 2001. Aristoteles: Metaphysik (Übers. Hermann Bonitz), Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1991. Aristoteles: Über die Seele (Übers. nach W. Theiler), Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1995. Bacon, Francis: Novum Organum, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Baron, Marcia: „Handeln aus Pflicht“, in: Karl Ameriks/Dieter Sturma (Hrsg.): Kants Ethik, Münster: mentis, 2004. Baumgartner, Hans Michael: „Die Idee des Fortschritts – Versuch einer Grundlegung“, in: Max Müller/Michael Schmaus (Hrsg.): Philosophisches Jahrbuch, 70. Jahrgang, 1. Halbband, München: Verlag Karl Alber, 1962, Seite 157-168. Baurmann, Michael/Leist, Anton (Hrsg.): Analyse und Kritik, 2012 (34) Heft 1, Symposium on Philip Kitcher, The Ethical Project. Benjamin, Walter: „Über den Begriff der Geschichte“, in: ders.: Erzählen – Schriften zur Theorie der Narration und zur literarischen Prosa, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007. Bernard, Larry u.a.: „A Evolutionary Theory of Human Motivation“, in: Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131(2), 2005, 129-184. Blumenberg, Hans: Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996. Brandom, Robert B.: Making It Explicit, Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 1994. Bury, John B.: The Idea of Progress - An inquiry into its origin and growth (1960), Toronto: General Publishing Company, 1987. Cassirer, Ernst: Vom Mythus des Staates, Zürich: Artemis, 1949. Chalmers, David: „Facing Up to the Problem of Consciousness“, in: Journal of Consciousness Studies, 2(3), 1995, Seite 200-219. Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Die Naturphilosophie des Aristoteles, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 1980. Delgaauw, Bernard: Geschichte als Fortschritt, Band I - III, Köln: Verlag J. P. Bachem, 1962-1966. Dennett, Daniel C.: Ellbow Room, Cambridge, MA/London, England: The MIT Press, 1984. 235 Derpmann, Simon/Düber, Dominik/ Rojek, Tim/ Schnieder, Konstantin: „Can Kitcher Avoid the Naturalistic Fallacy?“, in: Marie I. Kaiser/Ansgar Seide (Hrsg.): Philip Kitcher – Pragmatic Naturalism, Heusenstamm: ontos verlag, 2013. de Vries, Hent: Theologie im pianissimo & Zwichen Rationalität und Dekonstruktion, Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1989. El-Ghazali, Abdel Hamid: „Man ist the Basis of the Islamic Strategy for Economic Development“, in: Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank (Hg.): Islamic Economics Translation, Series No. 1, 1994. Eucken, Walter: Die Grundlagen der Nationalökonomie, Jena: Gustav Fischer, 1944. Falkenburg, Brigitte: Mythos Determinismus, Berlin/Heidelberg: Springer, 2012. Fetscher, Iring (Hrsg.): Auguste Comte – Rede über den Geist des Positivismus, Hamburg: Felix Meiner, 1956. Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974. Foucault, Michel: „Was ist Aufklärung?“, in: Eva Erdmann/Rainer Forst/Axel Honneth (Hrsg.): Ethos der Moderne Foucaults Kritik der Aufklärung, Frankfurt a.M./New York: Campus Verlag, 1990. Habermas, Jürgen: „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“, in: ders.: Kleine politische Schriften, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. Habermas, Jürgen: Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1983. Habermas, Jürgen: „Ein Interview mit der New Left Review“, in: ders.: Die neue Unübersichtlichkeit, Kleine politische Schriften V, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985, Seite 213-257, Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1 und 2, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995. Habermas, Jürgen: „Entgegnung“, in: Axel Honneth/Hans Joas (Hrsg.): Kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2002, Seite 327-405. Hampe, Michael: Erkenntnis und Praxis: Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006. Hampe, Michael: Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbegriffs, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes, in: ders.: Werke, Band 3, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: ders.: Werke, Band 7, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, in ders.: Werke 9, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: ders.: Werke, Band 18, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979. Hindrichs, Gunnar: Das Absolute und das Subjekt, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2008. 236 Horn, Christoph: „Die Menschheit als objektiver Zweck – Kants Selbstzweckformel des kategorischen Imperativs“, in: Karl Ameriks/Dieter Sturma (Hrsg.): Kants Ethik, Münster: mentis, 2004. Horn, Christoph: „Glück bei Aristoteles“, in: Dieter Thomä/Christoph Henning/Olivia Mitscherlich-Schönherr (Hrsg.): Glück – Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart: J. B. Metzler, 2011. Horn, Christoph/Mieth, Corinna/Scarano, Nico: „Kommentar“ in: Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007. Iser, Mattias: Empörung und Fortschritt – Grundlagen einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt a.M./New York: Campus Verlag, 2008. Johnston, Mark: Saving God, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009. Jonas, Hans: Organismus und Freiheit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, in: ders: Werke in zwölf Bänden, Band III und IV, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956. Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metapyhsik der Sitten, in: ders.: Werke in zwölf Bänden, Band VII, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956. Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft, in: ders.: Werke in zwölf Bänden, Band VII, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956. Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten, in: ders.; Werke in zwölf Bänden, Band VIII, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1956. Kitcher, Philip: The Ethical Project, Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 2011. Kleingeld, Pauline: Fortschritt und Vernunft: Zur Geschichtsphilosophie Kants, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995. Kleingeld, Pauline: „Zwischen kopernikanischer Wende und großer Erzählung. Die Relevanz von Kants Geschichtsphilosophie“, in: Herta Nagl-Docekal (Hrsg.): Der Sinn des Historischen, Frankfurt a.M.: Fischer, 1996. Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin: Walter de Gruyter, 2002. Koselleck, Reinhart: „›Fortschritt‹ und ›Niedergang‹ – Nachtrag zur Geschichte zweier Begriffe“, in ders.: Begriffsgeschichten, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006. Koselleck, Reinhart: „Fortschritt“, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 1975, Seite 351423. Lehmkuhl, Dennis: „Super-Substanzialismus in der Philosophie der Raumzeit“, in: Michael Esfeld (Hrsg.): Philosophie der Physik, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2012. Lévi-Strauss, Claude: Traurige Tropen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1978. Lowe, E. Jonathan: The Posibility of Metaphysics – Substance, Identity, and Time, Oxford/New York: Oxford University Press, 2001. Löwith, Karl: Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart: Kohlhammer, 1973. 237 Löwith, Karl: „Das Verhängnis des Fortschritts“, in: Helmut Kuhn/Franz Wiedmann: Die Philosophie und die Frage nach dem Fortschritt, München: Verlag Anton Pustet, 1964. Lyotard, Jean-François: Das postmoderne Wissen, Wien: Passagen Verlag, 2009. Marquard, Odo: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1982. Mäder, Denis: Fortschritt bei Marx, Berlin: Akademie Verlag, 2010. Meier, Christian: „‘Fortschritt’ in der Antike“, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Band 2, Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1975, Seite 353-363. Mele, Alfred R: Effective Intentions – The Power of Concious Will, Oxford/New York: Oxford University Press, 2009. Metzinger, Thomas: Being No One, Cambridge, MA/London: The MIT Press, 2004. Nagl-Docekal, Herta: „Ist Geschichtsphilosophie heute noch möglich?“, in: dies. (Hrsg.): Der Sinn des Historischen, Frankfurt a.M.: Fischer, 1996. Nelson, Leonard: Kritik der praktischen Vernunft, in: ders.: Gesammelte Schriften in neun Bänden, Vierter Band, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972. Nelson, Leonard: Ist metaphysikfreie Wissenschaft möglich?, in: ders.: Gesammelte Schriften in neun Bänden, Dritter Band, 1974. Neuser, Wolfgang: „Fortschritt“, in: Hermann Krings/Hans Michael Baumgartner/Christoph Wild (Hrsg.): Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Band 1, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2011, Seite 787-798. Nietzsche, Friedrich: Menschliches, Allzumenschliches – Erster Band, in: ders.: Nietzsche Werke, IV2, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1967. Nietzsche, Friedrich: Also sprach Zarathustra, in: ders.: Nietzsche Werke, VI1, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1968. Nietzsche, Friedrich: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, in: ders.: Unzeitgemässe Betrachtungen, Zweites Stück, in: ders.: Nietzsche Werke, III1, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1972. Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente – Anfang 1888 bis Frühjahr 1889, in: ders.: Nietzsche Werke, VIII3, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1972. Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente – Herbst 1884 bis Herbst 1885, in: ders.: Nietzsche Werke, VII3, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1974. Nisbet, Robert: History of the Idea of Progress, New York: Basic Books, 1980. O´Neill, Onora: „Kantische Gerechtigkeit und kantianische Gerechtigkeit“, in: Karl Ameriks/Dieter Sturma (Hrsg.): Kants Ethik, Münster: mentis, 2004. Owen, David S.: Between Reason and History – Habermas and the idea of Progress, New York: State University of New York Press, 2002. Pinkard, Terry: Hegel´s Naturalism – Mind, Nature, and the Final Ends of Life, New York: Oxford University Press, 2012. 238 Platon: Siebenter Brief, in: ders.: Werke, Band 5, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. Platon: Theaitetos, in: ders.: Werke, Band 6, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. Rapp, Friedrich: Fortschritt – Entwicklung und Sinn einer Philosophischen Idee, Darmstadt: Wissenscahftliche Buchgesellschaft, 1992. Ritter, Joachim: „Fortschritt“, in: ders. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2, Basel/Stuttgart: Schwabe & Co Verlag, 1972, Seite 1032-1059. Rohbeck, Johannes: „Turgot als Geschichtsphilosoph“, in: ders. (Hrsg.): Turgot – Über die Fortschritte des menschlichen Geistes, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990. Rohbeck, Johannes: Aufklärung und Geschichte – Über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft, Berlin: Akademie Verlag, 2010. Rorty, Richard: „The End of Leninism, Havel and Social Hope“, in: ders.: Truth and Progress, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Rosen, Michael: „Fortschritt“, in: Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie, Hamburg: Felix Meiner, 2010, Seite 218-239. Ruse, Michael: „Evolution and Progress“, in: Trends in Ecology and Evolution, 8 (2),1993, Seite 55-59. Ruse, Michael: Monad to Man – the concept of progress in evolutionary biology, Cambridge, MA/London, England: Harvard University Press, 2009. Salvadori, Massimo L.: Fortschritt – die Zukunft einer Idee, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach, 2008. Schnädelbach, Herbert: Hegels Lehre von der Wahrheit, Berlin: Humboldt-Universität, 1993. Seele, Peter/Wagner, Till: „Eine kleine Geschichte des Neuen“, in: Peter Seele (Hrsg.): Philosophie des Neuen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschft, 2008, Seite 3863. Smith, Adam: The Theory of Moral Sentiments, in: ders.: The Works of Adam Smith, Vol. I.., Aalen: Otto Zeller, 1963. Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, in: ders.: The Works of Adam Smith, Vol. II.-IV., Aalen: Otto Zeller, 1963. Spaemann, Robert: „Unter welchen Umständen kann man noch von Fortschritt sprechen?“, in: ders.: Philosophische Essays, Stuttgart: Reclam, 1994. Taguieff, Pierre-André: Le Sens du Progrès – Une approche historique et philosophique, Paris: Éditions Flammarion, 2004. Teilhard de Chardin, Pierre: Die Entstehung des Menschen, München: C. H. Beck, 2006. Thomä, Dieter: Vom Glück in der Moderne, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003. Voland, Eckart: „Die Fortschrittsillusion“, in: Spektrum der Wissenschaft, 04/07: 108-113, 2007. 239 Voltaire, François Marie Arouet: Essai sur le Mœurs et l’Esprit des Nations, in: ders.: Œuvres Complètes, 11-13, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967. Voltaire, François Marie Arouet: Le sièle de Louis XIV. et de Louis XV., in: ders.: Œuvres Complètes, 14, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967. Voltaire, François Marie Arouet: Traité de Métaphysique, in: ders.: Œuvres Complètes, 22, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967. Weber, Max: Wissenschaft als Beruf, Stuttgart: Recalm, 1995. Weischedel, Wilhelm: Der Gott der Philosophen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971. Welsch, Wolfgang: Der Philosoph. Die Gedankenwelt des Aristoteles, München: Wilhelm Fink Verlag, 2012. Whitehead, Alfred North: Prozeß und Realität, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979. Williams, Bernard: Ethics and the Limits of Philosophy, London: William Collins, 1985. Wittgenstein, Ludwig: „Vortrag über Ethik“, in: ders.: Vortrag über Ethik und andere kleine Schriften, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989. Zachriat, Wolf Gorch: Die Ambivalenz des Fortschritts – Friedrich Nietzsches Kulturkritik, Berlin: Akademie Verlag, 2001. Webseiten The Second Charter (1663) http://www.royalsociety.org/about-us/history/royal-charters/ Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum http://www.esf.de/portal/generator/15418/prooerty=data/2011_01_04_europa_2020strategie.pdf Beyond GDP http://www.beyond-gdp.eu/ OECD: The Global Project of Measuring the Progress of Societies http://www.wikiprogress.org/index.php/Definition_of_progress#A_brief_history_of.C 2.A0Progress.C2.A0 Papst Benedikt XVI.: Enzykliken http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/index_ge.htm 240 Lebenslauf Studium Universität Witten/Herdecke, Witten, Oktober 2000 - September 2007 Studium der Wirtschaftswissenschaften und Philosophie, Diplom an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät mit der Arbeit: Zum Wachstum als politischem Ziel Promotion Universität St. Gallen, St. Gallen, Schweiz, Februar 2009 - Mai 2014 Promotion im Fachbereich Philosophie der Kulturwissenschaftlichen Abteilung, Titel: Philosophie ohne Fortschritt? - Zur kritischen Erneuerung eines problematischen Begriffes, Gutachter: Prof. Dr. Dieter Thomä (1. Gutachter), Prof. Dr. Michael Hampe (2. Gutachter) Universitäre Arbeitsverhältnisse - Studentische Hilfskraft, Witten, Februar 2002 - Oktober 2006 Lehrstuhl für Volkswirtschaft und Philosophie der Universität Witten/Herdecke - Wissenschaftlicher Assistent, St. Gallen, Mai 2009 - Juni 2014 Fachbereich Philosophie der Universität St. Gallen - Lehrauftrag an der Universität Witten/Herdecke, Witten, April 2011 - Juli 2011 - Lehrauftrag an der Universität St. Gallen, St. Gallen, September 2011 - Dezember 2011 Stipendium Stiftung der Deutschen Wirtschaft, Berlin, November 2009 - Oktober 2013 Promotionsstipendium Publikation „Eine kleine Geschichte des Neuen“ (zus. mit Peter Seele), in: Peter Seele (Hrsg.): Philosophie des Neuen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008, Seite 3863. 241

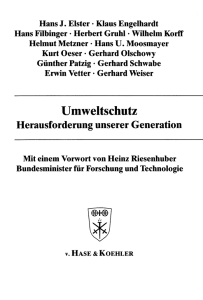




![Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles (384–322 vor Chr.)](http://s1.studylibde.com/store/data/005638826_1-b4d7b201002dc1d51101ec71945d9e0c-300x300.png)