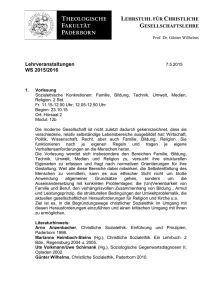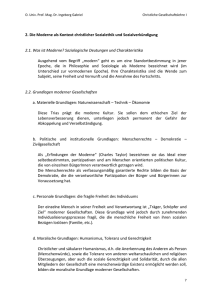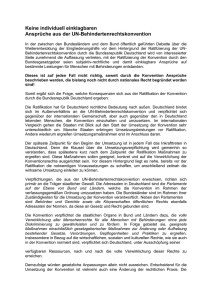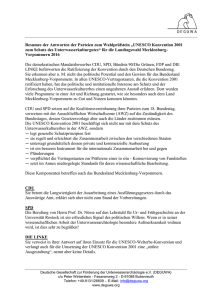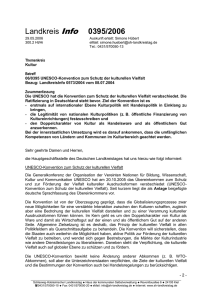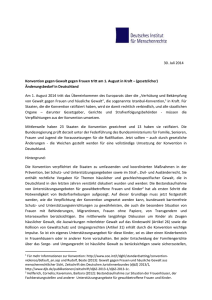AKSB-Werkstattheft Nr. 4 "Am Puls der Zeit"
Werbung

-werkstatt Werkstatt >>> Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland AKSB (Hg.) Am Puls der Zeit Beiträge zur AKSB-Konventionsdebatte 4 2 © 2008, Verein zur Förderung katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e.V., Bonn www.aksb.de Am Puls der Zeit. Beiträge zur AKSB-Konventionsdebatte. AKSB (Hrsg.) 2008 Diese Veröffentlichung wurde aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Grundlayout und Umschlaggestaltung: Gipfelgold Werbeagentur GmbH Seiten- und Textlayout: Markus Schuck, Susanne Klabunde Fotonachweis: Titelbild, Gipfelgold; S. 2, 3, 5, AKSB-Geschäftsstelle; S. 6, Dr. Alexander Filipović; S. 27, Dr. Hermann-Josef Große Kracht; S. 36, Prof. Dr. Günter Wilhelms; S. 48, Prof. Dr. Joachim Wiemeyer; S. 60, Prof. Dr. Peter Massing. Druck: Das Druckhaus Bernd Brümmer 3 >>> AKSB-Werkstatt Nummer 4 AKSB (Hrsg.) Am Puls der Zeit Beiträge zur AKSB-Konventionsdebatte 4 Inhaltsverzeichnis Inhalt Editorial 5 Teil I: AKSB-Konvention - Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit 6 Stellungnahmen der Fachwissenschaft zu zentralen Aspekten der AKSB-Konvention Dr. Alexander Filipović Das Personalitätsprinzip: Zum Zusammenhang von Anthropologie und christlicher Sozialethik 6 Dr. Hermann-Josef Große Kracht Katholische Sozialprinzipien in der Krise? Eine Warnung vor voreiligen Verabschiedungen. 27 Prof. Dr. Günther Wilhelms Subsidiarität 36 Prof. Dr. Joachim Wiemeyer Die Bedeutung außerschulischer politischer Bildung in der christlichen Sozialethik 48 Prof. Dr. Peter Massing Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ aus Sicht der Politikdidaktik 60 Teil II: AKSB-Konvention - Relevanz für die Bildungspraxis Stellungnahmen zu einzelnen Aspekten der Konvention 74 75 1 Stellungnahmen der Fachgruppen zu Art. 19 „Gesellschaftliche und politische Ziele“ der AKSB-Konvention Stellungnahme der Fachgruppe I - „Das Politische“ von Marica Zelenika 75 Stellungnahme der Fachgruppe II - „Das Soziale“ von Ekke Seifert 77 Stellungnahme der Fachgruppe III - „Das Gesellschaftliche“ von Bernhard Eder 80 2 Stellungnahmen der Fachgruppen zu den Art. 18 „Lernziele“ und Art. 31 „Das personale Angebot“ der AKSB-Konvention 82 Stellungnahme der Fachgruppe I - „Das Politische“ von Marica Zelenika 82 Stellungnahme der Fachgruppe II - „Das Soziale“ von Ekke Seifert 84 Stellungnahme der Fachgruppe III - „Das Gesellschaftliche“ von Bernhard Eder 85 Editorial 10 Jahre AKSB-Konvention – Einladung zur Reflexion Am 26. November 1998 beschloss die Mitgliederversammlung der AKSB in Trier die „Konvention über katholisch-sozial orientierte politische Jugend- und Erwachsenenbildung“. In ihr wurde das Selbstverständnis der in der AKSB zusammengeschlossenen Träger formuliert hinsichtlich der sozialethischen, didaktischen und bildungspolitischen Grundzüge ihrer Arbeit. Seither bildet die Konvention die gemeinsame Arbeitsgrundlage der Arbeitsgemeinschaft. Sie stellt damit einen wichtigen Baustein im Prozess der sich weiterentwickelnden Professionalisierung politischer Bildung katholischer Träger dar. Zehn Jahre nach Verabschiedung der Konvention scheint die Zeit gekommen, sich der aktuellen Gültigkeit des Grundlagentextes zu vergewissern. Vieles ist seit 1998 geschehen in Kirche und Gesellschaft, Fachdidaktik und Bildungspolitik. Neue Themen wie der weltweite Kampf gegen den Terrorismus oder die drängenden Fragen von Migration und Integration haben Politik und Gesellschaft verändert; finanzielle Engpässe der Diözesen und die Umgestaltung der Rahmenbedingungen staatlicher Förderung wirkten sich auf die Situation vieler Träger aus; die Evaluation der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung und der fachliche Diskurs um die Profession der politischen Bildung haben neue Akzente in der bundesweiten Fachdebatte gesetzt. Aus diesem Grunde wurde Anfang 2008 ein zweijähriger Reflexionsprozess begonnen mit dem Ziel, die Konvention auf ihre Aktualität mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der Bildungspraxis und den Referenzwissenschaften zu überprüfen. Eine Wiederveröffentlichung der Konvention im Taschenbuchformat sollte dazu dienen, den Text erneut zugänglich zu machen im Hinblick auf die anstehende Debatte. In den Konferenzen der AKSB-Fachgruppen wurden einzelne Abschnitte der Konvention unter der Fragestellung diskutiert, inwieweit der Konventionstext auch zehn Jahre nach seiner Entstehung noch die Praxis katholisch-sozial orientierter politischer Bildung widerspiegelt. Die Ergebnisse dieser Debatten wurden in dieses Werkstattheft aufgenommen. Eine besondere Funktion im Rahmen dieses Reflexionsprozesses kommt der AKSB-Jahrestagung vom 24. bis 25. November 2008 in Schwerte zu. Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftlern aus der Sozialethik und der politischen Fachdidaktik soll die Konvention auf ihre wissenschaftliche Anschlussfähigkeit und ihre Relevanz für die Bildungspraxis diskutiert werden. In diesem Werkstattheft veröffentlichen wir die Untersuchungen der beteiligten Wissenschaftler vorab, um allen, die an der Jahrestagung teilnehmen, die Möglichkeit zu gründlicher Vorbereitung zu geben, und um alle, denen eine Teilnahme nicht möglich ist, diese wichtigen Akzente in unserem Reflexionsprozess zukommen zu lassen. Der Diskurs über die Aktualität der Konvention versteht sich als offener Prozess. Die Diskussionen auf der Jahrestagung werden zeigen, welche weiteren Schritte erforderlich sind, um eine zeitgemäße Arbeitsgrundlage innerhalb der AKSB zu sichern. Dr. Alois Becker Lothar Harles Dr. Alois Becker Vorsitzender der AKSB Lothar Harles Geschäftsführer der AKSB 5 6 Filipović, Das Personalitätsprinzip Teil I: AKSB-Konvention – Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit Stellungnahmen der Fachwissenschaft zu zentralen Aspekten der AKSB-Konvention Dr. Alexander Filipović Das Personalitätsprinzip: Zum Zusammenhang von Anthropologie und christlicher Sozialethik Dr. Alexander Filipović, 1975 in Bremen geboren, seit 2006 Akademischer Rat mit der Funktion eines wissenschaftlichen Mitarbeiters am Lehrstuhl Christliche Soziallehre der Universität Bamberg. Es gibt in der christlichen Sozialethik, verstanden als der wissenschaftliche Betrieb, der das soziale Lehren der Kirche reflektiert, kritisch begleitet und voranbringen möchte, keine aktuelle und spannende Diskussion des sozialethischen Personalitätsprinzips. Im Gegensatz zu den anderen beiden klassischen Sozialprinzipien Solidarität und Subsidiarität, zu dem neueren der Retinität/Nachhaltigkeit und zu Fragen sozialer Gerechtigkeit gibt es keine Konferenzen und aktuellen Sammelbände oder sozialethische Monographien zum Thema Personalitätsprinzip. Wird über Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit als heuristische Prinzipien christlicher Soziallehre debattiert, so gilt dies nicht in gleicher Weise für das Personalitätsprinzip. Nimmt man, und das kommt hinzu, die sozialethische Fachdiskussion und analysiert die grundlegende systematische Diskussion, so spielt die ausdrückliche Diskussion der Sozialprinzipien keine oder eine untergeordnete Rolle (vgl. die Beiträge des 43. Bandes des Jahrbuches für Christliche Sozialwissenschaften 2002). Einigermaßen aktuelle Aussagen zum Personalitätsprinzip findet man daher ausdrücklich vor allem in der Einleitungs-, Lexikon und Handbuchliteratur. Diese Fehlanzeige aktueller sozialethischer Debatten, gar streitbarer Debatten um das Personalitätsprinzip, mag darin begründet sein, dass (a) die Prinzipiensystematik christlicher Sozialethik mit ihrem ihr zu Grunde liegenden Personbegriff in kirchlichen Texten spätestens seit dem zweiten Vaticanum im Grunde konstant blieb und höchstens behutsam weiterentwickelt wurde und (b) die Darstellung des Prinzipientraktats in sozialethischen Lehrbüchern und Lexikonartikeln weniger dem Zweck folgt, diese Prinzipien zu problematisieren als den gewissen erreichten Stand darzustellen. Beides trifft vor allem auf das Personprinzip zu, da wir es hier mit einem gleichzeitig so grundlegenden, abstrakten und theologisch wie philosophisch hoch voraussetzungsvollen Zusammenhang zu tun haben, so dass schon eine Darstellung eine Herausforderung darstellt und, noch wichtiger, wir im Personbegriff offenbar genug Elemente finden, über die gar kein Streit oder wenigstens eine kritische Debatte notwendig oder möglich ist. Dieser letzte Gedanke führt direkt zur Frage, ob Prinzipien sich überhaupt ändern oder kritisch diskutiert werden können: Die ohne Zweifel naturrechtliche Heimat christlicher Sozialethik und Soziallehre fördert nicht aus sich heraus eine dynamische Diskussion und Infragestellung ihres grundlegenden Prinzips. Das Personprinzip scheint sich im Gegenteil (und vielleicht im Gegensatz zu den anderen heuristischen Prinzipien) dadurch auszuzeichnen, dass es sich inhaltlich nicht verändert, Neuansätze abblockt und eine Filipović, Das Personalitätsprinzip Relektüre kaum zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Die z. B. neuscholastische Weigerung, der Wirklichkeit als solcher bzw. dem wahren Sein eine zeitliche/geschichtliche Qualität und Veränderung zuzusprechen, betrifft vor allem die im Personbegriff sich verdichtende Anthropologie1. Das Überzeitliche als notwendiges Element christlicher Sozialethik wird in der (theologischen) Anthropologie lokalisiert und im Ausdruck Person auf den Begriff gebracht. Im Stichwort „Person“ als Sozialprinzip versammelt sich in christlich-sozialethischen Kontexten daher nicht selten dasjenige, was sich durch ruhige Lagerung der sozialethischen Erbmasse die Jahre hindurch abgesetzt hat.2 Dann markiert der Gebrauch des Begriffs eine mehr oder weniger reflektierte Bezugnahme auf einen letzten Grund oder Bezugsrahmen, der aber nicht selten seltsam unbestimmt bleibt, aber über den synonym verwendeten (Menschen-)Würdebegriff auf allgemeine Akzeptanz hoffen kann. Die Frage bleibt, wie wir uns zu dieser Erbmasse und in unserem Fall zu diesem Bodensatz verhalten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Bildungsarbeit christlich gestalten und verantworten wollen und dabei auf den Personbegriff rekurrieren. Aufgabe jeder Wissenschaft, also auch der christlichen Sozialethik als Wissenschaft, ist die Darstellung, Systematisierung und vor allem Problematisierung von Sachverhalten. Dieser Text stellt sich der Aufgabe, das Personalitätsprinzip der christlichen Sozialethik zu problematisieren mit dem Ziel, Material bereitzustellen, mit dem die entsprechenden Aussagen der AKSB-Konvention geprüft werden können. Die grundlegende sozialethische Orientierung, dass das Soziale, die Institutionen und die gesellschaftlichen Strukturen persongerecht gestaltet werden müssen, werde ich nicht erschüttern, sondern höchstens variieren und ergänzen. Vielmehr suche ich im Umkreis des sozialethischen Personprinzips nach Anlässen, erneut über die Bedeutung des Personprinzips für eine christliche Sozialethik nachzudenken, die ihrer Aufgabe einer „verantworteten Zeitgenossenschaft“ (Auer 1986) immer besser nachkommen will. Ausgegangen werden soll dabei vom Text der Konvention, dessen Argumentation mit dem Personbegriff in einem ersten Schritt dargestellt werden soll. In einem zweiten Abschnitt werden jüngere Aussagen zum Personprinzip gesammelt und auf ihre Stellung und Bedeutung in und für sozialethische Ansätze dargestellt. Dieser Schritt ergibt, dass das Personprinzip an drei entscheidenden Stellen auftaucht, die für eine christliche Sozialethik zentral sind. Von grundlegender Bedeutung ist der Kontext von (theologischer) Anthropologie und Ethik/Moral (ethische und moralische Personen), der im Abschnitt drei beleuchtet wird. Im Abschnitt vier kehre ich damit zum Text der AKSB-Konvention zurück. I. Der Gebrauch des Personprinzips in der AKSB-Konvention Der Text der AKSB-Konvention geht in den Absätzen 3, 4, 6, 9, 14 und 15 direkt auf den Personbegriff ein. Die Textpassagen lassen sich gemäß der Gliederung der Konvention in zwei Abschnitte (I = 3, 4, 6, 9 und 10; II = 14 und 15) unterteilen, wobei der erste Abschnitt nochmal unterteilt werden kann (Ia = 3, 4, 6; Ib = 9, 10). 1 Diese beschriebene Weigerung ist kein Alleinstellungsmerkmal der Neuscholastik, sondern betrifft grundsätzlich im weitesten Sinne den Platonismus, die traditionelle Naturphilosophie und überhaupt die traditionelle Metaphysik. Zum verfehlten neuscholastischen Ansatz: „Das neuscholastische Naturrecht war bestrebt, diese freiheitsrelevante Offenheit der Frage nach dem Menschen so weit wie möglich durch material-naturrechtliche Wahrheitsansprüche zu schließen bzw. einzuschränken“. Sein „Selbstverständnis ignoriert die eigene hermeneutische Bedingtheit durch den christlichen Glauben, aber auch jene durch den faktischen kirchlich-lehramtlichen Kontext.“ Und: „In seinem eigentümlichen Rationalismus konnte das neuscholastische Naturrecht nicht sehen, dass die diversen Positionen [...] aus diversen Grundüberzeugungen resultieren, und dass darum unter den Bedingungen der Freiheit notwendigerweise ein legitimer Pluralismus entsteht, der sich nicht glatt auf den Nenner von Wahrheit und Irrtum bringen lässt.“ (Anzenbacher 2002, S. 31) 2 Das mag schärfer klingen als es gemeint ist; insofern die Sozialprinzipien erst im Verlauf einer kontinuierlichen Verwendungsweise zu solchen werden, handelt es sich bei ihnen immer um ein Korrelat. Das Verständnis von Solidarität und Subsidiarität als heuristische Prinzipien, die das Personprinzip politisch-praktisch verwendbar machen, verweist aber darauf, dass das Personprinzip als Grund-Satz einen anderen, stabileren Status hat. 7 8 Filipović, Das Personalitätsprinzip Der Abschnitt I formuliert grundlegende Werte für die katholisch-sozial orientierte politische Bildungsarbeit. Ia formuliert dies im Hinblick auf anthropologische und ethische Vorentscheidungen. Das „durch den christlichen Glauben geprägte[n] Verständnis des Menschen als Person“ stellt die „feste Begründung“ der Bildungsarbeit dar. Als erstes Attribut dieses Verständnisses wird sogleich die doppelte Verfassung des Menschen als Individuum und als soziales Wesen angeführt, wofür keine Begründung und kein Verweis auf eine Quelle dieser Ansicht angeführt werden. Danach erwähnt der Text als zweites Attribut der Personalität des Menschen die „unantastbare Würde“, die ihren Grund in der Glaubensüberzeugung findet, „dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist“ und diese daher durch eine Gottebenbildlichkeit ausgewiesen sind. Dies sei der Grund für die Transzendenzfähigkeit (Fähigkeit zur Selbstüberschreitung) des Menschen, die als drittes Attribut gezählt werden kann. Weitere Attribute werden im Folgenden zusammen genannt: Vernunft, Gewissen und freier Wille; mit diesen Fähigkeiten sei er „angelegt“ und diese „leiten“ ihn. Hinzu tritt eine damit in Verbindung stehende „Anlage“, nach der eine solche Person „sich ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und die Schöpfung bewusst sein und diese wahrnehmen soll“. Neben die Ausstattungs- bzw. Fähigkeitsattribute (Individualität, Sozialität, Würde, Vernunft, Gewissen, freier Wille) der Personalität des Menschen tritt hier ein abgeleitetes Sollensattribut (Verantwortung), das die einzelnen Personen betrifft. Gebündelt wird dieses Verständnis der Personalität mit dem Ausdruck der „Mensch ist ein [...] moralisches Subjekt“. Den Abschluss dieser Personbestimmung bildet die Überzeugung, dass Freiheit und Selbstbestimmung als personale Eigenschaften der Menschen zu bewahren und zu fördern sind, was eine „verantwortliche Teilnahme am Politischen“ einschließe (Nr. 3). Absatz 4 schließt an diese letzte Aussage an und formuliert als normative Grundorientierung aus dem Personsein des Menschen die „Entfaltung des Menschen als Person“. Diese normative Grundkategorie der personalen Entfaltung und Identitätsbildung (in Absatz 9 auch „Verwirklichung“) wird als Herausforderung verstanden, der gesellschaftliche Trends entgegenstehen bzw. sie erschweren. „Identitätsbildung und die Entfaltung des Menschen“ werden schwieriger und gleichzeitig freier zu gestalten, was eine „wachsende eigenständige Verantwortung“ bedeute. Zuletzt wird die Aufgabe katholisch-sozial orientierter politischer Bildungsarbeit darin gesehen, Möglichkeiten freier menschlicher Identitätsentwicklung „als eine auf die Gesellschaft verwiesene Person“ anzustoßen. In Abschnitt 6 werden die personalen Attribute und die daraus abgeleitete normative Grundkategorie als christliche Wertebasis sozialethisch formuliert: „freie Entfaltung als Person“ wird hier als Selbstverwirklichung charakterisiert, der „jede gesellschaftliche Ordnung [...] zu dienen hat“. Eine so verfasste persongerechte Ordnung habe sich an der gleichen Personwürde und daraus entstehenden Freiheitsrechten aller zu orientieren. Gerechtigkeit sei aber nicht nur „eine Forderung an Gesellschaft und Staat“, sondern sei auch als individuelle menschliche Tugend zu verstehen. Ib: Diese Grundlage wird in Form sozialethischer Prinzipien neu formuliert und (im Falle von Solidarität und Subsidiarität) ausgedeutet. Aus dem Personverständnis ergebe sich das Personalitätsprinzip und das Gemeinwohlprinzip. Ersteres besage, „dass alles menschliche und gesellschaftliche Handeln immer die Würde des Menschen zu beachten und letztlich seiner Verwirklichung als Person zu dienen hat“ (Nr. 9). Das Verhältnis dieses Prinzips mit den Menschenrechten wird erwähnt, wobei nur knapp dargestellt wird, dass die Menschenrechte vom Personprinzip inspiriert seien. Das Gemeinwohlprinzip „stellt den eigentlichen Sinn der staatlichen Ordnung dar“ und die „gesellschaftliche Ordnung soll möglichst so beschaffen sein, dass alle Menschen sich als Person in ihrem Leben verwirklichen können“ (Nr. 10)3. 3 Diese nahezu gleichlautende Formulierung in Bezug auf die normative Grundkategorie der personalen Verwirklichung in Nr. 9 und 10 weist darauf hin, dass eine Ableitung von Person- und Gemeinwohlprinzip aus dem Personbegriff schwierig ist. Diese Systematik ist vermutlich von FURGERS Sozialethik beeinflusst (vgl. Furger 1991, S. 134–137) und kann natürlich einige Plausibilität beanspruchen, erscheint aber nicht unbedingt als beste Möglichkeit der sozialethischen Prinzipiensystematik: ANZENBACHER verortet das Gemeinwohl in der Nähe der Solidarität (vgl. Anzenbacher 1998, S. 200–204), HEIMBACH-STEINS spricht nicht von einem Gemeinwohlprinzip, sondern lokalisiert „Gemeinwohl“ als Element des Personprinzips (vgl. Heimbach-Steins 2008, S. 183) und findet dies dann konsequenterweise auch impliziert bei Solidarität und Subsidiarität; BAUM- Filipović, Das Personalitätsprinzip Die Absätze 14 und 15 in Abschnitt II konkretisieren die Wertgrundlage auf die politische Bildungsarbeit. Nr. 14 leitet ein mit der Formulierung: „Der Prozess der Personwerdung des Menschen wird durch Erziehung und Bildung gefördert.“ Neben die bisherigen Formulierungen der „Identitätsbildung und Entfaltung des Menschen als Person“ (Nr. 4 und 6), der „Selbstverwirklichung des Menschen [...] als Person“ (Nr. 6) und der „Verwirklichung als Person“ (Nr. 9) tritt damit eine weitere Formulierung der sozialethischen Grundnorm hinzu, für die hier die Relevanz von Erziehung und Bildung allgemein behauptet wird. Die in der Personalität des Menschen inhärente bzw. die aus der Personalität des Menschen abgeleitete Verantwortung für das Politische wird hier wiederholt und erneut als moralischer Anspruch, als moralische Verpflichtung an den Menschen formuliert: Die Person hat eine Verantwortung für das Politische und soll diese damit wahrnehmen, auch und gerade in Zeiten des „raschen gesellschaftlichen und technischen Wandels“. Politische Bildung fördert diese Verantwortung und hilft so, menschenwürdiges Leben in der Gesellschaft zu verwirklichen. Deutlich erkennt man in der Art und Weise, wie die Konvention den Personbegriff fasst und mit ihm sozialethisch argumentiert, dass genuin sozialethische Quellen dafür herangezogen wurden. Natürlich liegt mit der Konvention kein ausführlich argumentierender sozialethischer Text vor, sondern Ziel der Konvention ist es ja, kurz und prägnant die Werte- und Normgrundlage der Bildungsträger zu artikulieren. Ganz klar aber ist die Referenz auf christliche Sozialethik in ihrer wissenschaftlichen und kirchlichen Gestalt. Für eine problemorientierte Auseinandersetzung mit dem Personbegriff, auf den die Konvention Bezug nimmt, bietet sich daher zunächst ein Blick auf die sozialethische Fassung des Personbegriffs als Person- bzw. Personalitätsprinzip an. II. Zum christlich-sozialethischen Verständnis des Personprinzips 1. Definitionen des Personalitätsprinzips Einige Bestimmungsversuche des Personprinzips als Sozialprinzip der letzten Jahre geben einen Einblick in die Kontinuität der Begriffsverwendung und der grundlegenden Denkrichtung: • „Ziel jeder christlichen Ethik ist es [...], durch klärende Überlegung Grundsätze und Leitlinien herauszuarbeiten, welche die volle Entfaltung jeder menschlichen Persönlichkeit in mitmenschlicher Gemeinschaft bestmöglich verwirklichen helfen. [...] Die Achtung der menschlichen Person [...] muß daher als sog. ‚Person prinzip‘ Ausgangspunkt jeder Sozialethik sein.“ (Furger 1991, S. 135) • „Communities exist for the persons who are their members, and their purpose is the protection and promotion of human dignity.“ (Dwyer 1994, S. 733) • „Die sozialethisch-legitimatorische Frage, ob die betreffenden Regelungen (In stitutionen, Strukturen, Verhältnisse) gerecht sind, rekurriert auf [...] den [...] Status des Menschen als Person, denn ‚die gesellschaftliche Ordnung und ihre Entwicklung müssen sich dauernd am Wohl der Personen orientieren‘.“ (Anzenba cher 1998, S. 188 mit Rekurs auf Gaudium et spes, 26).4 Ein soziales Gebilde ist dann gerecht, wenn darin Menschen ihre „Bestimmung als Person“ (Anzenbacher 1998, S. 184, vgl. auch S. 189) verwirklichen können. • Das „Personalitätsprinzip kennzeichnet in der katholischen Soziallehre einen GARTNER/KORFF vermeiden den Begriff (vgl. Baumgartner, Korff 1999). Es ist meines Erachtens möglich, die individuell-substanzielle Seite des Personbegriffs dem Gemeinwohlbegriff zur Seite oder entgegen zu stellen. Das Personprinzip dagegen bietet eine normative Orientierung an, die diese Entgegensetzung gerade vermeidet, da das Prinzip neben der substanziellen Seite die relationalen Elemente betont. 4 Die lehr- und kirchenamtlichen Texte werden zitiert nach Bundesverband der Katholischen ArbeitnehmerBewegung Deutschlands 1992. 9 10 Filipović, Das Personalitätsprinzip analytischen und normativen Maßstab zur ethischen Auszeichnung der Strukturen und Institutionen einer Gesellschaft. [...] Mit der Bestimmung des Personalitätsprinzips als eines ‚Sozialprinzips‘ [...] wird der politisch-ökonomischen Verfassung einer Gesellschaft und ihrer Organisation in funktionalen Teilsystemen (z. B. Wirtschaft, Recht, Bildung) eine instrumentale Funktion zugewiesen. Sie sind ebenso Bedingung wie Resultat menschlicher Interaktion und stehen als solche im Dienst des Menschen, dessen ontologische Signatur als ‚Individualitätin-Sozialität‘ zu bestimmen ist.“ (Höhn 1999, Sp. 61, Abkürzungen aufgelöst) • „Gesellschaftliche Einrichtungen sind der menschlichen Person wegen da und nicht umgekehrt. Sie gewinnen ihre ethische Rechtfertigung also erst daraus, dass sie sich als funktionale Vollzugs- und Entfaltungsbedingungen menschlichen Personseins erweisen.“ (Baumgartner 2004, S. 265f.)5 • „Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind [...] so einzurichten und auszugestalten, dass dem Personsein des Menschen Rechnung getragen, seine personale Selbstentfaltung ermöglicht und gefördert wird.“ (Heimbach-Steins 2008, S. 183) Das christlich-sozialethische Personprinzip erhebt den „Anspruch der Persongerechtigkeit an die gesellschaftlichen Institutionen“ (Heimbach-Steins 2008, S. 187). Diese Aussagen entsprechen sich zum Teil wörtlich. Der Grund dafür liegt in der gemeinsamen Bezugnahme auf einschlägige Texte kirchlicher Soziallehre. Zu nennen ist hier zunächst die bekannte Formel der Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Konzils (1965): „Wurzelgrund nämlich, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institutionen ist und muß auch sein die menschliche Person, die ja von ihrem Wesen selbst her des gesellschaftlichen Lebens durchaus bedarf“ (Gaudium et spes 25, vgl. auch 26). Eine ähnliche, frühere Formulierung findet sich in der Enzyklika Mater et magistra 219: Es „muß der Mensch der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein. Und zwar der Mensch, sofern er von Natur aus auf Mit-Sein angelegt und sofern er zu einer höheren Ordnung berufen ist, die über die Natur ganz und gar hinausgeht“. 2. Personkonzept und sozialethische Argumentationsstrategien Diese definitorischen Aussagen bleiben für sich genommen natürlich nur aussagekräftig, wenn man an der grundlegenden Argumentationsweise bezüglich des Personprinzips interessiert ist. Diese Aussagen geben also noch keine Antworten auf die Frage, woran sich denn die Gestaltung einer persongerechten Gesellschaft näherhin orientieren soll. Auch wenn Sozialprinzipien nicht dazu geeignet sind, aus ihnen direkt Normen für die Gestaltung der Gesellschaft ableiten zu wollen, so geben sie einen Rahmen vor, in dem diese Normfindung zu geschehen hat. Zu fragen ist also nach dem das Personprinzip jeweils fundierenden Personkonzept (das das Prinzip inhaltlich prägt) und nach dem Status dieses Konzepts im (sozial-)ethischen Argumentationsgang. Untersucht man die Entwürfe von KERBER, ANZENBACHER, BAUMGARTNER/KORFF und HEIMBACH-STEINS6 daraufhin, so können doch deutliche Unterschiede in der Systematik ausgemacht werden. Freilich konvergieren diese Entwürfe in wesentlichen Punkten, so dass eine politische Konkretion anhand dieser Entwürfe in praktischen 5 Vgl. auch die gleich lautenden Stellen in Baumgartner, Korff 1999, S. 227 und Baumgartner, Korff 2000. 6 Bei der Auswahl dieser Entwürfe in diesem Abschnitt war neben einer gewissen Aktualität maßgeblich entscheidend, dass diese Entwürfe eine Bandbreite im gängigen sozialethischen Diskurs präsentieren, aber einen eigenen Charakter aufweisen (auf den sie freilich nicht reduziert werden dürfen): KERBER steht einer traditionellen Naturrechtsethik nahe, ANZENBACHER kombiniert diese mit moderner Vernunftethik und aktueller politischer Philosophie, BAUMGARTNER/KORFF fokussieren das spezifisch Neuzeitliche der Sozialethik und HEIMBACH-STEINS legt Wert auf theologische und kontextuelle Hermeneutik. Andere, hier nicht zu leistende, aber, das sei ausdrücklich betont, prinzipiell nicht weniger legitime oder erkenntnisversprechende Ansätze könnten sich z. B. auf die Entwürfe konzentrieren, die weiter „am Rand“ des Diskurses zu lokalisieren wären, oder z. B. auf die Entwürfe, die sozialethische Nachwuchswissenschaftler vorgelegt haben. Filipović, Das Personalitätsprinzip Fragen nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen muss. Die Frage nach den sozialethischen Konsequenzen der im Folgenden ausgemachten Differenzen muss aber noch auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben werden. 2.1 „Überzeitlich Gültiges“ (Walter Kerber) Für WALTER KERBER handelt es sich beim Personbegriff nicht um ein Prinzip christlicher Sozialethik. Für KERBER gibt der Personbegriff im Grunde eine Antwort auf die Frage, was eine menschliche Gesellschaft bzw. Gemeinschaft ist und was man unter dem Menschen als Sozialwesen verstehen kann. Dazu hat die Sozialethik „etwas ebenso Grundsätzliches und überzeitlich Gültiges wie Griffiges über den Menschen als Sozialwesen auszusagen“ (Kerber 1998, S. 28). Jede Sozialethik (also auch eine christliche) „muss von einer philosophischen Anthropologie ihren Ausgang nehmen“ (Kerber 1998, S. 29). In der Definition des Menschen als Person bündelt sich eine solche Anthropologie, die keine konkreten, sondern abstrakte Aussagen über den Menschen treffen möchte und daher aufmerksam ist für „Elemente, die allen Menschen als Menschen gemeinsam sind“ (Kerber 1998, S. 29). Als Kriterien für die Personalität des Menschen bzw. als Merkmale der Personalität werden genannt: „Der Mensch ist wesentlich konstituiert durch das Mit-Sein, durch Gemeinschaft mit anderen.“ (Kerber 1998, S. 38) Dieses Mit-Sein wird weniger existenzial im Sinne einer im menschlichen Wesen verankerten Bezogenheit auf andere, sondern als formales Element im Sinne eines Seins, „das einer konkret existierenden Gesellschaft oder Gemeinschaft als solcher zukommt“ (Kerber 1998, S. 38). Wie wird mit dem Personbegriff sozialethisch argumentiert bzw. wie wird daraus ein Sozialprinzip entwickelt? „Gesellschaft“ wird als „Ordnung“ gedacht, die in der Personwürde ankert und deren Kriterium im gemeinsamen Ziel selbstständiger Personen gefunden wird. Insofern Menschen Geistwesen sind, können sie dieses Ziel jede/jeder für sich und zusammen erkennen und leisten damit die gesellschaftliche Integration (Kerber 1998, S. 39). Gesellschaft als Beziehungsform „reicht als etwas Nicht-Personhaftes nicht an die Würde der Person heran, hat reinen Dienstwert, der von der Würde der Person abgeleitet wird“ (Kerber 1998, S. 37). Formaler Ausgangspunkt dieser Argumentation ist die Ansicht, dass jedes „Sozialgebilde [...] eine Vielheit [ist], eine Einheit bestehend aus vielen Menschen“ (Kerber 1998, S. 28), also in dem Schema Ganzes/Teile denkt. Wird der Person ein nicht-personaler Wert vorgeordnet (wie „Nation“), so verstößt dies gegen die Personwürde. Gründe für eine Bringschuld des Einzelnen für die Gemeinschaft, etwa im Falle von Katastrophen, können daher nicht in der „Höherwertigkeit der abstrakten Gemeinschaft als Gemeinschaft“ gefunden werden, sondern nur „in der Sozialnatur der sittlichen Persönlichkeit des einzelnen, in deren Ausrichtung auf das soziale Zusammenleben mit anderen und auf solche gesellschaftlichen Werte“ (Kerber 1998, S. 38). Die damit angesprochene „wesentlich soziale Ausrichtung des Menschen“ betont die jeweils konkreten Menschen in konkreter Gesellschaft und nicht bloß das Abstraktum Gesellschaft. 2.2 „Weltanschaulicher Standpunkt“ (Anzenbacher) ARNO ANZENBACHER steht in einer ähnlichen naturrechtlichen Tradition; Sozialethik ist Naturrechtsethik (vgl. Anzenbacher 2002). Sein Grundansatz ist die Vermittlung einer klassischen naturrechtlichen Tradition mit dem modernen freiheitlichen Vernunftrecht, für die er Grundlagen in den beiden Ansätzen selbst entdeckt. Das Prinzip der Personalität leistet eine Formulierung des „Begriff[s] vom Mensch und seiner Bestimmung“ (Anzenbacher 1998, S. 178), die jede ethische Reflexion des Sozialen voraussetzen muss, da es „im Raum des Sozialen [...] immer um Interaktionen von Menschen“ (Anzenbacher 1998, S. 178) geht. Christliche Sozialethik geht 11 12 Filipović, Das Personalitätsprinzip also von einem weltanschaulichen Standpunkt aus, der im Begriff des Menschen als Person zusammengefasst ist. So beginnt die Bestimmung des Personbegriffs mit einem Verweis auf die biblisch-theologische Sicht des Menschen, die „von der Erschaffung des Menschen als Gottes Abbild über die Stellung des sündig gewordenen Menschen in den heilsgeschichtlichen Bundeskontexten des Volkes Israel bis zu der in Jesus Christus eröffneten Berufung ‚zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes‘ (Röm 8,21)“ (Anzenbacher 2002, S. 179f.) reicht. Daraus entwirft ANZENBACHER fünf „Aspekte“ des christlichen Menschenbildes (Anzenbacher 2002, S. 180–183). Diese sind Geist in Leib (Einheit von materieller Naturhaftigkeit und „Selbstbewußtsein vernunfthafter Subjektivität“ als Bei-sich-sein), MitSein (Mensch als „wesentlich“ sozial bezogene individuelle Person), moralisches Subjekt (Fähigkeit zur Autonomie), Transzendenz (existenzielle Religiosität des Menschen) und Sünde (moralisches Subjekt in der Spannung von Schuld und Erlösung). In diesen Aspekten, so legt ANZENBACHER nahe, besteht die „Würde der menschlichen Person“ (Anzenbacher 2002, S. 183). Die für die Sozialethik entscheidende Personalitätsbewandtnis bestehe „in der Verschränkung von Bei-sich-Sein und Mit-Sein innerhalb des Begriffs der Person“ (Anzenbacher 2002, S. 183). Die Ausfaltung dieser sozialethischen Anthropologie im Rückgriff auf das christliche Menschenbild zu einem Personalitätsprinzip läuft bei ANZENBACHER auf eine anspruchsvolle und umfassende Explikation der christlich-sozialethischen Fragestellung hinaus. Ausgegangen wird vom System existenzieller Zwecke (Selbsterhaltung, ökologische, kulturelle und religiöse Zwecke in ökologischer Konditionierung), auf die der Mensch „natural unbeliebig [...] hingeordnet“ ist und die er als „Bestimmung“ nur „in sozialer Interaktion verwirklichen“ (Anzenbacher 2002, S. 184) kann: „Nur in Partizipation am sozialen Interaktionsgeschehen vermag der Mensch seine Bestimmung als Person zu verwirklichen.“ (Anzenbacher 2002, S. 183) Daraus folgt das menschenrechtliche Anerkennungsverhältnis: „Dabei impliziert diese Anerkennung, dass sie [die Menschen] sich wechselseitig jene Rechte einräumen, die im Sinne des Systems der existenziellen Zwecke den Charakter von Grundbedingungen des Menschseins haben, und dass sie die diesen Rechten korrespondierenden Pflichten übernehmen. Wir nennen diese Rechte Menschenrechte.“ (Anzenbacher 2002, S. 185)7 Dieses Anerkennungsverhältnis wird in Form der Menschenrechte als Grundrechte durch den Staat als politischen Herrschaftsverband (MAX WEBER) positiviert. ANZENBACHER versteht es als „unverzichtbar-natürlich“ und zeigt aber, wie und warum es sich als Ratschlag der Klugheit und als moralischer Imperativ begründen lässt, womit er gleichzeitig grundlegend Stellung nimmt zum Zusammenhang von Anthropologie und Ethik. So kommt ANZENBACHER zu seiner Formulierung des oben schon zitierten Personbegriffs als Sozialprinzip. Aufgrund der modernen Differenz zwischen Fragen des guten Lebens und der Gerechtigkeit ergänzt er dies durch eine gerechtigkeitstheoretische Differenzierung des menschenrechtlichen Anerkennungsverhältnisses, indem er Freiheitsrechte und soziale Rechte in einen Ausgleich bringt. 2.3 „Schlüsselrolle als ethisch relevanter Terminus“ (Baumgartner/Korff) Bei BAUMGARTNER/KORFF wird die Personalität des Menschen zum Angelpunkt der für die Moderne typischen sozialethischen Frage überhaupt: „[D]as ganze neue sozialethische Paradigma mit seinem Übergreifen der ethischen Frage auf die Strukturen [ruht] letztlich auf der Überzeugung von der personalen Würde des Menschen [auf].“ (Korff 2000, S. 385) Das Personalitätsprinzip und die anderen Sozialprinzipien sind „als Baugesetzlichkeiten entwicklungsoffener Gesellschaft zu begreifen und lassen sich als solche keinem stationären, essentialistisch argumentierenden Ethikmodell zuordnen [...]“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 7 Den Ausdruck „Grundbedingungen des Menschseins“ entlehnt ANZENBACHER von OTFRIED HÖFFE (vgl. Höffe 1996, S. 72) Filipović, Das Personalitätsprinzip 405). Unter dieser Voraussetzung halten sie zunächst fest, „dass dem Begriff ‚Person‘ erst im Prozess der ethischen Reflexion der Neuzeit eine Schlüsselrolle als ethisch relevanter Terminus zugewachsen ist“. Damit stellt sich nicht mehr in erster Linie die Forderung an den Menschen, einer „gegebenen Ordnung gerecht zu werden“, sondern die Forderung „weitet sich dahin aus, diese Ordnungen so zu gestalten, dass sie umgekehrt auch dem Menschen gerecht werden“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406).8 Personwürde als „Unverfügbarkeit als Person“ wird somit zu dem „letzten Maßstab“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406) einer äußeren Ordnung. Die Person ist ihre eigentliche „Anspruchswirklichkeit“.9 Diese Personwürde liegt darin begründet, dass der Mensch „Zweck an sich selbst“ (Kant 2007, S. 70, AA 434/W 68) sei. Die Aspekte der menschlichen Personalität werden vor allem als Fähigkeiten verstanden, die ihm „eigen“ sind; genannt werden neben der Eigenheit des moralischen Subjektstatus die Fähigkeit zu Selbstreflexion und zu „Selbstüberschreitung auf anderes und andere hin“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406). An anderen Stellen wird von Korff diese Anthropologie in zwei Hinsichten ergänzt bzw. vorbereitet. Er schreibt der Liebe eine wesentliche Bedeutung für die neuzeitliche Fassung der Personwürde zu, insofern sie eine „ihr eigene Unmittelbarkeit zum Menschsein“ auszeichnet und insofern Motor, Vorbild und Sinn der Personwürde ist (vgl. Korff 2000, S. 383). Und in dem immer noch sehr lesenswerten Artikel „Was ist Sozialethik“ fasst Korff seine Anthropologie der naturalen Antriebskomponenten des Menschen zusammen, die er zur Sozialnatur des Menschen rechnet: „Der Mensch ist dem Menschen Bedürfniswesen, Konkurrent und Fürsorger zugleich.“ (Korff 1987, S. 333)10 Ausgehend von dieser Anthropologie handelt es sich beim Personalitätsprinzip um eine SOZIAL- ODER GESELLSCHAFTSTHEORIE, insofern die drei Aspekte „gleichermaßen notwendige [...] Komponenten einer gegenwartsgerechten ethischen und politischen Theorie der Institution“ (Korff 1987, S. 333) darstellen. Die „natural angelegte[n] Wirkkräfte“ sind nicht als „Produkte menschlicher Kulturstilisierung“ zu interpretieren, sondern sie bestimmen „die interaktionellen Organisationsformen der höheren Lebenswelt“ (Korff 1993, S. 155). Gesellschaftliche Einrichtungen legitimieren sich erst dann, wenn „sie sich als funktionale Vollzugs- und Entfaltungsbedingungen menschlichen Personseins erweisen“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406). Dieser „fundamentale strukturethische Zusammenhang“ sagt etwas über die „Natur von sozialen Institutionen, gesellschaftlichen Strukturen und Ordnungsgestaltungen aus, nämlich dass sie keine Naturbestände, keine biologisch vorgegebenen Programme, aber auch keine zeit- und geschichtsenthobenen Wesensordnungen darstellen, sondern aus vielfältigen Bedingungen gefügte Konstrukte sind.“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406) Die sozialen Strukturen „sind Produkte des Menschen und damit unlösbarer Teil seiner am Universalitätsanspruch menschlicher Personwürde auszurichtenden und zu verantwortenden Praxis“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406). Diesen Anspruch gelte es „in die 8 Eine andere Formulierung durch KORFF lautet: „Es gibt nicht nur gutes und schlechtes Handeln im Hinblick auf gegebene Normen, gut oder schlecht können auch die dieses Handeln regelnden Normen und Institutionen selbst sein. Damit aber sieht sich der Mensch nicht nur in Gehorsamsverantwortung vor Normen gerufen, sondern ebenso auch in Gestaltungsverantwortung für sie. Erst darin wird die besondere sozialethische Aufgabenstellung endgültig ansichtig. Sozialethik ist Ethik der gesellschaftlich übergreifenden Normen, Institutionen und sozialen Systeme, sie ist »Sozialstrukturenethik« (A. Rich).“ (Korff 1987, S. 328) 9 Korff 1993, S. 147. Weiter heißt es dort: „Was immer den Menschen in seinem Handeln normiert, bleibt als Produkt seiner eigenen Selbststeuerung an dessen Bedingungen und Möglichkeiten und damit an seine ‚Natur‘ zurückgebunden.“ 10 Der gesamte Abschnitt lautet: „Menschliches Sozialverhalten ist keineswegs nur durch institutionelle Außenprägungen bestimmt, sondern folgt einem komplexen inneren Strukturgesetz [...]. Es manifestiert sich im Spannungsgefüge dreier unterschiedlich aufeinander wirkender nicht voneinander ableitbarer Antriebskomponenten, die den Umgang des Menschen mit dem Menschen fundamental bestimmen, nämlich erstens einer sachhaft-gebrauchenden Komponente, kraft deren sich der eine den anderen in der Vielfalt seiner individuellen Möglichkeiten und Interessen zunutze macht, zweitens einer (stammesgeschichtlich aus dem innerartlichen Aggressionsverhalten abzuleitenden) konkurrierenden Komponente, die Selbstand und Eigenwertigkeit der Individuen im Umgang miteinander ermöglicht und sichert, und schließlich drittens einer (bis in naturale Dispositionen des Brutpflegeverhaltens zurückverfolgbaren) fürsorgenden Komponente, kraft deren der eine den anderen nicht überspielt, sondern ihn in seinem Sein und Seinkönnen um seiner selbst willen annimmt und zustandebringt. Der Mensch ist dem Menschen Bedürfniswesen, Konkurrent und Fürsorger zugleich.“ (Korff 1987, S. 332f.) 13 14 Filipović, Das Personalitätsprinzip sozialen Strukturen hineinzuvermitteln und in ihnen zur Geltung zu bringen“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406). Dabei ist die Wahrung der Personwürde „grundsätzlich auf den konkreten Menschen in seinen [...] naturalen, geschichtlichen und kulturellen Verfasstheiten bezogen“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406) und hat „sonach notwendig etwas mit handfesten Entfaltungsbedingungen zu tun, wie sie aus der Bestimmung des Menschen zur Freiheit, aus seiner Verantwortungsfähigkeit, seiner Entwurfsoffenheit, seinen individuellen und sozialen Bedürfnissen, Erwartungen und Erfordernissen resultieren“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406). Personen haben also aufgrund ihrer Würde einen „Anspruch auf Sicherung von Gütern und die Wahrung von Rechten“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 406). Personwürde konkretisiert sich in einer Sammlung von Personrechten, die als Menschenrechte positiviert werden und zu mehrfach dimensionierten „Gestaltungsformen der Gesellschaft“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 407) werden. Damit geht es im Personalitätsprinzip nicht nur um einen „ethischen Begründungs- und Verweisungszusammenhang zwischen menschlicher Personwürde und Menschenrechten“ (Baumgartner, Korff 2000, S. 407), sondern ebenso um einen solchen Zusammenhang zwischen Menschenrechten und sozialen Strukturen, die die entscheidende Bedeutung des Personalitätsprinzips in der christlichen Sozialethik eindringlich aufzeigen. 2.4 „Fundamentale menschliche Erfahrungen“ (Heimbach-Steins) HEIMBACH-STEINS startet die Darstellung des „Grundprinzips Personalität“ mit der Diagnose, dass der Personbegriff heute eine vielfältig Verwendung findet, „insbesondere in aktuellen ethischen Debattenzusammenhängen [...], um die großen ethischen Fragen um Menschsein, Menschenbild und Menschenwürde zu bearbeiten“ (Heimbach-Steins 2008, S. 179). Daher müsse eine christlich-sozialethische Formulierung des Personbegriffs sowohl die „unaufgebbaren Eckpunkte“ (Heimbach-Steins 2008, S. 179) kennzeichnen und gleichzeitig zu einer Kommunikation über Fragen zur menschlichen Person einladen. Damit ist der Ausgangspunkt gegeben für eine theologische Anthropologie christlicher Sozialethik. Ausgegangen wird zunächst von den im Wirtschafts- und Sozialwort festgehaltenen Grundkonstanten des christlichen Menschenbildes: „Im Licht des christlichen Glaubens erschließt sich eine bestimmte Sicht des Menschen: Er ist als Bild Gottes, als das ihm entsprechende Gegenüber geschaffen und so mit einer einmaligen unveräußerlichen Würde ausgezeichnet. Er ist als Mann und als Frau geschaffen; beiden kommt gleiche Würde zu. Zugleich ist er mit der Verantwortung für die ganze Schöpfung betraut; der Mensch soll Sachwalter Gottes auf Erden sein (Gen/1. Mos 1,26-28). So ist der Mensch geschaffen und berufen, um als leibhaftes, vernunftbegabtes, verantwortliches Geschöpf in Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer, zu den Mitmenschen und zu allen Geschöpfen zu leben. Das ist gemeint, wenn vom Menschen als Person und von seiner je einmaligen und unveräußerlichen Würde als Person die Rede ist.“ (Heimbach-Steins, Lienkamp 1997, S. Nr. 93) Diese Konstanten werden als Vorlage verstanden und „dynamischer“ formuliert: „Fundamentale menschliche Erfahrungen werden aufgenommen, in denen sich Spannungen zeigen, die das Menschsein prägen und als ethische Existenz herausfordern.“ (Heimbach-Steins 2008, S. 180) Die vier Spannungsbögen können als offene Formulierungen des gesamten Terrains verstanden werden, auf dem menschliches Leben geschieht. Menschen nehmen sich und andere (1) als verdankt und autonom wahr: sie erfahren sich einem anderen Sein verdankt, als Gottes Geschöpf mit „Hoffnung auf Gelingen“ und als eigenständig bzw. autonom. Beides wird in der theologischen Perspektive nicht als Gegensatz wahrgenommen. Menschen erfahren sich (2) als individuell und sozial verwiesen: Individualität und Sozialität sind gleichursprünglich und notwendig zusammengehörig. Sozialität ist zudem „zugleich als Befähigung und als Bedürftigkeit zu verstehen“ (Heimbach-Steins 2008, S. 181). Dieser Gedanke betont die Körperlichkeit und verstehe Filipović, Das Personalitätsprinzip dadurch Leib und Geist als Einheit. Die leibgebundene Existenz wird inkarnatorisch gedeutet und erfährt dadurch besondere Würde. Menschen erfahren sich (3) als verantwortlich frei und schuldanfällig: menschliche Praxis kann gelingen, aber auch scheitern. Im Scheitern nehmen Menschen eine Schuld wahr. Die christliche Terminologie lautet hier Sünde und Erlösung und ist in der Rede von den „Strukturen der Sünde“ (Sollicitudo rei socialis 36) auch sozialethisch bedeutsam. Zuletzt nehmen sich (4) Menschen wahr in ihrer Sterblichkeit und in ihrer Fähigkeit, Grenzen des eigenen Lebens zu überschreiten: „Die Tatsache, dass jeder Mensch sterben muss und darum weiß, bedeutet eine grundlegende Fraglichkeit des Lebens als Ganzes.“ (Heimbach-Steins 2008, S. 182). Ihre Zusammenfassung leistet ein Zweifaches, nämlich die christlich-theologische Begründung der Personwürde und eine besondere Gestalt von Ethik: „[D]er Mensch [ist] als Mann und Frau von Gott erschaffen und durch Jesus Christus erlöst [...]. In dieser Hinsicht sind alle Menschen gleich und mit einer unverlierbaren Würde ausgestattet. In der Spannung von Schöpfung und Befreiung erschließt sich christlichem Verständnis eine Ethik, die nicht zuerst eine Sollensforderung erhebt, sondern mit der Vergewisserung und Ermutigung des von Gott geschenkten Könnens beginnt.“ (Heimbach-Steins 2008, S. 180) Diese Skizze der „anthropologische[n] Grundüberzeugung“ wird durch „[D]ie sozialethische Reflexion ‚übersetzt‘ [...], indem sie das Personprinzip und die daraus resultierende Ausrichtung der Vergesellschaftungsformen auf das Gemeinwohl als Fundament der Gesellschaft und ihrer Institutionen formuliert.“ (Heimbach-Steins 2008, S. 183) Hiermit ist die klassische Formulierung des Personalitätsprinzips in Gaudium et spes 25 und 26 angesprochen. Einen wichtigen Schlussstein findet die Entfaltung des Grundprinzips Personalität bei HEIMBACH-STEINS in einer Reflexion auf die Menschenrechte, die als „Auslegung des Personprinzips“ verstanden werden. Menschenrechte repräsentieren nicht nur das personale Ethos, sondern gießen dieses „in eine rechtlich bindende Gestalt“ (Heimbach-Steins 2008, S. 184). Offenbar geschieht die Auslegung also nicht oder weniger auf der repräsentativen Eigenschaft der Menschenrechte, sondern in der Ausformulierung einer rechtlichen Gestalt. Damit greifen sie die „Sicherung von Freiheit“ und „Spannung von Individualität und sozialer Gebundenheit der personalen Existenz“ auf und legen diese aus durch rechtliche Formulierungen zum „Schutz der persönlichen Sphäre, durch Sicherung von politischen Partizipationsrechten und durch die Absicherung grundlegender Bedürfnisse und Ansprüche“ (Heimbach-Steins 2008, S. 185). 2.5 Auswertung Die Gemeinsamkeiten sind unverkennbar. Beim Durchgang durch wichtige Entwürfe christlicher Sozialethik hat sich gezeigt, wie der Personbegriff inhaltlich gefüllt wird und wie mit ihm sozialethisch argumentiert wird. Die Zusammenstellung zeigt zugleich eine reichhaltige Terminologie theologischer Anthropologie und ihrer sozialethischen Reflexion. Freiheit, Subjekthaftigkeit, Moralität, Vernunft, Würde, Selbststand, Identität, Verwiesenheit, Mit-Sein und Sozialität, Leiblichkeit und Personrechte – die Vielfalt der uns begegneten personalen Eigenschaften, Prädikate, Eigenheiten, unaufgebbaren Eckpunkte, Fähigkeiten, Bestimmungen, der fundamentalen menschlichen Erfahrungswerte und menschlicher Natur und naturalen und geistigen Verfasstheit soll hier nicht Gegenstand einer Kritik in dem Sinne sein, dass das eine begründet dazu gehört und das andere nicht. Auch die mindestens für den/die systematisch interessierte(n) Sozialethiker/-in spannenden Unterschiede, vor allem hinsichtlich der abwägenden und sehr vorsichtig geäußerten „Natur“ oder „Bestimmung“ des Menschen und ihrer theologischen, metaphysischen, transzendentalen oder theologisch-hermeneutisch-erfahrungsbasierten Herleitung (inklusive ihrer Kombinationsmöglichkeiten), sollen nicht als solche behandelt werden. Innerhalb ihrer jeweiligen Konzeption argumentieren alle herangezogenen Entwürfe auf hohem Niveau und bereichern durchweg. Obwohl man wohl vor allem an der Argumentation von 15 16 Filipović, Personalitätsprinzip B. Vinke, Das Partizipation als pädagogische Haltung KERBER merkt, dass selbst eine vorsichtig und abwägend vorgetragene ableitende Naturrechtsethik in der Durchführung für heutige theologisch-ethische „Ohren“ befremdet, kann festgehalten werden: Die inhaltlichen Konvergenzen des Menschenbildes zu z. B. einer hermeneutisch-erfahrungsbezogenen theologischen Anthropologie à la HEIMBACH-STEINS sind kaum so groß zu nennen, als dass einem der beiden Entwürfe eine „Wahrheit“ abgesprochen werden kann. Was allerdings schwerer wiegt, ist ein Argument, das letztlich der Frage und dem Bestreben nach der Wirksamkeit christlicher Sozialethik geschuldet ist: Die plurale (Welt-)Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Vorannahmen, Traditionen, religiösen Identitätsrahmen, Kulturen, Communities – letztlich: mit ihren unterschiedlichen Menschenbildern – ist der Referenzrahmen und Resonanzraum christlich-sozialethischen Nachdenkens und Sprechens. Nur hier kann sich Christliche Sozialethik bewähren und hier sind der Ort und die Zeit, an dem und in der die Gesellschaft persongerecht durch sie in christlich motivierter und verantworteter Zeitgenossenschaft mitgestaltet werden möchte.11 Wo keine rechtsstaatliche Demokratie verankert ist, wird christliche Sozialethik aufgrund ihrer eigenen Grundlage helfen, diese zu befördern. In modernen säkularen Demokratien ist dann aber eine religiöse Begründung sozialethischer Vorschläge „prekär“; klassisch-liberale Vorstellungen gehen so weit zu fordern, dass in öffentlichen Aushandlungsprozessen „weltanschauliche“ und damit partikuläre Argumente nichts zu suchen haben. Als Argument könne nur gelten, was prinzipiell von jeder und jedem einzusehen ist.12 Wie auch immer man zu diesem liberalen Verständnis von Religion und Demokratie steht: Die Frage der Gesprächsvoraussetzung stellt sich in unserer pluralen Gesellschaft auf jeden Fall, und Christliche Sozialethik muss dazu etwas sagen. Die naturrechtliche Argumentation der Neuscholastik versuchte dies durch eine Theologieabstinenz zu lösen, um über (eine bestimmte) Philosophie eine gemeinsame Gesprächsgrundlage zu schaffen. Eine solche Preisgabe der eigenen wesentlichen christlichen Identität erscheint heute nicht sinnvoll; zu wertvoll sind die Identitätsmerkmale. Ein Verbergen der implizit doch immer vorhandenen Vorprägung eines jeden Sozialethikers führt dazu, nicht mehr ernst genommen zu werden. Der Auftrag lautet heute, Voraussetzungen und materiale Optionen explizit zu machen und DARÜBER in eine Verständigung einzutreten.13 Daher geht momentan der Versuch in Richtung einer Abschwächung dezidiert christlicher Anthropologie oder in Richtung einer „dynamischen“ Formulierung zentraler Topoi des christlichen Menschenbildes. ANZENBACHER wählt den ersten Weg: Mit Recht schätzt er seinen Personbegriff als „weltanschaulich voraussetzungsreich“ und „stark“ ein und formuliert: „Im Diskurs mit anderen Positionen können bei bestimmten Fragestellungen allerdings auch schwächere Fassungen hinreichend sein.“ (Anzenbacher 1998, S. 183) In der erfahrungsbasierten theologischen Anthropologie von HEIMBACH-STEINS wird die Kommunikabilität der theologischen Position mit einer „dynamischen Formulierung“ von untereinander in Spannung stehenden Koordinaten erreicht (Heimbach-Steins 2008, S. 180f.). Hinzu kommt ihre Andeutung, der Kanon der Menschenrechte wäre eine Auslegung des Personprinzips, die – unter der Voraussetzung, dass Auslegung immer auch Sinnkonstitution ist – das Personprinzip dann zusätzlich allgemein kommunikabel macht (insofern die Menschenrechte allgemein kommunikabel sind). Ein durch die Menschenrechte ausgelegtes Personprinzip stellt dann auch eine Vorgabe für christlich-sozialethisches und kirchliches Denken dar. Aber schon der Rückgriff auf menschliche Erfahrung (statt auf „Natur“) deutet hier auf eine allgemeine Ver11 Vgl. zu diesem Verständnis „verantworteter Zeitgenossenschaft“ Auer 1986. Voraussetzung dieser Vorstellung ist die kirchliche „Annahme der Welt in ihrer ‚Wirklichkeit‘“, die in der Pastoralkonstitution des II. Vaticanums formuliert wird (vgl. Lehmann 1989, hier S. 169). Das verweist auch auf die sozialethische Hermeneutik, die sich anhand des Stichwortes der „Zeichen der Zeit“ artikuliert (vgl. Heimbach-Steins 1997). Dieser ganze Zusammenhang wird von HÖHN in die Fassung „Sozialanalyse als Zeitdiagnose“ gebracht (vgl. Höhn 1991, hier S. 283). 12 Mit JEFFREY STOUT stehe ich dieser Einstellung kritisch gegenüber (vgl. Stout 2005). 13 Das ist der Kernsatz von ROBERT BRANDOMS großem Versuch der Grundlegung einer normativ relevanten Bedeutungstheorie, vgl. Brandom 2000 (engl. Titel: Making it Explicit, 1994). B. Vinke, Partizipation pädagogische Haltung Filipović,als Das Personalitätsprinzip ständigungsbasis hin, wobei die Ausführung natürlich stark auf eine im christlichen Kontext situierte und artikulierte Erfahrung rekurriert.14 So entscheidend der grundsätzliche Modus ist, in dem auf das christliche Personverständnis als Legitimationsbasis gesellschaftlicher Strukturen hingewiesen wird, so sehr ist, das zeigt der Durchgang durch die Texte, der spezifische systematische Kontext bedeutsam, in dem mit dem Personbegriff argumentiert wird. Hier ist Differenzierungsarbeit zu leisten. Christliche Sozialethik erschöpft sich nicht allein im normativ-politischen Streit um die Gestaltung des Sozialstaats oder der (menschen-) rechtlichen Normierung. Sie ist kein Appendix einer ins soziale gedrehten Moraltheologie als Individualethik und auch keine passive Verwertungswissenschaft der Soziologie, Politologie und Volkswirtschaft. Auf verschiedenen Ebene gilt es also, ein eigenes sozialethisches Profil zu entwickeln, oder anders: mit einem normativ gehaltvollen Personbegriff umzugehen. In Fragen der politischen Umsetzung, in philosophisch und theologisch grundlegender Hinsicht oder in sozialwissenschaftlicher Weise leistet der Personbegriff Unterschiedliches. Diese verschiedenen Ebenen können aus der Darstellung sozialethischer Personalitätskonzepte gewonnen werden: Zunächst hängt der Personbegriff unmittelbar mit dem Ethikbegriff zusammen. Die Person als moralisches Subjekt oder ihre Sozialität als Bedürftigkeit zu kennzeichnen ist nicht nur eine anthropologische, sondern auch eine ethische Frage. Der Personbegriff wird also (1) auf der Ebene des Verhältnisses von Anthropologie und Ethik relevant. Die die Gesellschaft formende Antriebsstruktur des Menschen und Relationalität der Personalität (die konstitutive Relevanz des Anderen für das Ich oder Selbst) bringen die Ebene des Gesellschafts-, Institutionen- und Strukturbegriffs in den Blick. Christliche Sozialethik braucht notwendig eine Vorstellung bzw. Reflexion ihres Gegenstandes (des Sozialen). Die Frage lautet (2): Wie kann und wird auf dieser gesellschafts- und sozialtheoretischen Ebene mit dem Personbegriff umgegangen. Und schließlich führt die eminente Bedeutung der Verrechtlichung des personalen Anspruchs als notwendige Praxisbewegung christlicher Sozialethik (3) zur Ebene des Rechts, die in modernen Rechtsstaaten immer auch die der demokratischen Politik ist. Bei diesen Ebenen geht es letztlich um das Design der Disziplin Christliche Sozialethik: Es sind diese Ebenen, die das Diziplinierende des Faches darstellen: (theologische) Ethik - Sozial- und Gesellschaftswissenschaft – Politik und Recht.15 Es ist nicht zufällig, dass sich diese sehr grundsätzliche Fragestellung nach der Gestalt der Disziplin christliche Sozialethik im Kontext des Personalitätsprinzips stellt, denn mit diesem Prinzip ist schließlich die Grundlegung christlicher Sozialethik auf den Begriff gebracht. Eine Reflexion dieses Prinzips bedeutet also auch notwendig eine Reflexion der Disziplin. Eine intensive Entfaltung jeder Ebene ist an dieser Stelle nicht möglich; ich beschränke mich auf die grundlegende Ebene von Anthropologie und Ethik. 14 Der Rückgriff auf „menschliche Erfahrung“ oder der Umgang mit „Erfahrung“ als hermeneutischem und erkenntnistheoretischem Schlüsselwort ist in der christlichen Sozialethik eher selten anzutreffen. Bei HEIMBACH-STEINS steht der Begriff im Kontext eines hermeneutisch-kontextuell vermittelten und dialogisch gefundenen theologischen Standpunkts (vgl. Heimbach-Steins 1995). Bei MIETH hat „Erfahrung“ den Status eines Zirkulationspunktes theologischer Ethik (vgl. Mieth 1999 und Mieth 1998), den HAKER dann vor allem narrativ entfaltet und auf Identität hin denkt (Haker 1999). Vgl. allgemein zur hermeneutischen und narrativen Ethik Lesch 2002. Dass „Natur“ nicht anders erkannt werden kann als über Erfahrung, Erfahrung und Natur also nicht zwei sich störende Größen sind (z. B. in dem Sinne, dass Erfahrung wahre Natur verfälscht oder „ungenügend“ wiedergibt), steht im Mittelpunkt des Werkes von JOHN DEWEY (Dewey 1993, engl. 1925). 15 Auf allen drei Ebenen ist der Modus wiederum relevant: Interdisziplinäre Konstellationen und die gesellschaftliche Situation mehrerer, sich vielleicht untereinander ausschließender Vorannahmen sind der Referenzrahmen für eine christliche Sozialethik in verantworteter Zeitgenossenschaft. Auch können die Ebenen nicht so voneinander getrennt werden, dass sie allein für sich in der Perspektive der Sozialethik analysiert und bearbeitet werden können. Die Ebenen sind eng miteinander verknüpft und Präferenzen auf der einen Ebene beeinflussen die Möglichkeiten auf der anderen. 17 18 Filipović, Das Personalitätsprinzip III. Die grundsätzliche Problemebene: (Theologische) Anthropologie und Ethik 1. Anthropologie und normative Orientierungen Durch die Psychoanalyse, die Sozialwissenschaften und vor allem durch die Biologie besonders in der Gestalt der Evolutionsbiologie ist der Anspruch von Theologie und Philosophie, alleinig für die Anthropologie verantwortlich zu sein, seit längerer Zeit aufgeweicht. Die Evolutionsbiologie mit ihrer Initiation durch CHARLES DARWIN und in ihren spezifischen Weiterentwicklungen (Ethologie, Soziobiologie und Evolutionspsychologie) beeindruckt durch das Angebot einer umfassenden kausalwissenschaftlichen Erklärung nicht nur für das Natur-, sondern immer mehr auch für das Geistwesen Mensch (Illies 2006, S. 10). Die biotechnische Revolution unserer Tage nimmt diese Fäden auf und verbindet sie mit neuen Allmachtsphantasien über die Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten. Als damalige Reaktion auf diese sich entwickelnden ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Theorien über das allgemein Humane (hinzuzählen lassen sich auch die Ökonomie und die entstehende Sprachwissenschaft) entstanden eine Reihe von Texten, die zusammen die „Blüte der philosophischen Anthropologie im 20. Jahrhundert“ (Illies 2006, S. 19) ausmachen. Die entscheidenden Werke dieser Zeit von MAX SCHELER, HELMUTH PLESSNER und ARNOLD GEHLEN reagieren alle auf eine Herausforderung: „Ist der Mensch ein Gegenstand der Wissenschaften unter vielen anderen, dessen Tun und Lassen, aber auch Denken und Fühlen aus den soziokulturellen Umständen (etwa den Produktionsbedingungen) oder unbewussten Triebimpulsen (etwa der Libido) abschließend verstanden werden können?“ (Illies 2006, S. 10). In der Anthropologie des frühen 20. Jahrhunderts wurde die Frage nach dem Wesen des Menschen wieder vermehrt gestellt und versucht zu beantworten. Mit der Krise der Wesensmetaphysik hat dann die philosophische Anthropologie an Bedeutung verloren und die moderne biologische Anthropologie, zum Teil explizit mit philosophischem Anspruch, rückt an ihre Stelle. Warum ist es notwendig, dennoch nach Wegen einer philosophischen und theologischen Anthropologie zu suchen? ILLIES nennt für den Fall der philosophischen Anthropologie unter anderem das Argument, dass wir „praktisch genötigt [sind], ein philosophisches Selbstbild zu entwickeln“ (Illies 2006, S. 25). Er geht aus von KANTS Anthropologie in pragmatischer Hinsicht: „Eine Lehre von der Kenntniß des Menschen, systematisch abgefaßt (Anthropologie), kann es entweder in physiologischer oder in pragmatischer Hinsicht sein. - Die physiologische Menschenkenntniß geht auf die Erforschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische auf das, was er als freihandelndes Wesen aus sich selber macht, oder machen kann und soll.“ (Kant, AA XII, 119) Die praktische (bei Kant pragmatische) Anthropologie erscheint als praktische Notwendigkeit. Jede Vorstellung von dem, was wir tun wollen, schließt eine Selbstdeutung ein. Diese wiederum ist ohne eine normative Orientierung nicht denkbar: Identität wird definiert durch einen Rahmen, der vorgibt, was gut ist und getan werden sollte, und der es überhaupt erst möglich macht, einen Standpunkt zu beziehen (Taylor 1994). Der deskriptiven Wissenschaft des Menschen (bei KANT die „physiologische Menschenkenntniß“), auch die mit einem philosophischen Anspruch auftretende biologische Anthropologie, ist eine Begründung normativer Einsichten nicht möglich, weil sie damit ihre methodischen Grenzen überschreitet. Wie ist angesichts dieser Problemlage das Verhältnis von Anthropologie und Ethik zu beschreiben? Die evolutionäre Ethik geht davon aus, dass Anthropologie Moralität begründen kann. Auch wenn man sich der Argumentation anschließen kann, dass dies nicht möglich ist (Illies 2006, Kap 5.4 und 7), so bleibt das Verhältnis von Anthropologie und Ethik doch schwierig, da die menschliche Frage nach seinem Selbstverständnis unvermeidbar ist und Filipović, Das Personalitätsprinzip normative Implikationen notwendig einschließt, und Ethik, wenn man sie nicht auf die formale Begründung von Moralität schlechthin einengt, mit dieser Normativität zu tun hat. Hier sieht man, dass die Anthropologie auch auf die Ethik zurückwirken, wenn sie sie auch nicht „begründen“ kann (vgl. Thyen 2007). 2. Hermeneutische Anthropologie Eine mit JEAN-PIERRE WILS (Wils 1997) akzentuierte hermeneutische Anthropologie kritisiert formale Ethikkonzeptionen in der Hinsicht, dass diese ohne empirische Erkenntnisse auskommen wollen. Insofern wohnt der hermeneutischen Anthropologie in Bezug auf eine so ausgerichtete Sozialethik ein wichtiges empirisch-deskriptives Korrektur-Moment inne. Eine solche hermeneutische Anthropologie sieht aber auch, dass empirische Erkenntnisse einer Deutung aus ethischer Perspektive bedürfen. Weder das empirische noch das normative Moment soll also aufgegeben werden. Hier gelingt die Vermittlung mit einem Begriff der hermeneutischen Anthropologie, der für die Bestimmung des Christlichen einer Anthropologie hilfreich ist: „Gerade in diesem Spannungsfeld hat Anthropologie eine korrelativ-kritische Funktion: Empirische Korrekturen ethischer Engführungen und ethische Korrekturen empirischer Reduktionismen gehören zu ihrer genuinen Aufgabe. Ich verstehe also unter Anthropologie eine hermeneutische Betätigung, eine interpretative Tätigkeit hinsichtlich dominanter und/oder signifikanter Erfahrungen und Selbstthematisierungen des Menschen. Anthropologie will nämlich zugleich mehr sein als eine deskriptive und doch weniger als eine rein präskriptive Wissenschaft. Positiv ausgedrückt: Anthropologie unternimmt den Versuch, den latenten Empiriemangel ethischer Theorien auszugleichen und die Distanz zu normativen Schlussfolgerungen bei den empirischen Wissenschaften zu verringern. Anthropologie macht die Empirie normfähig und die Ethik empiriefähig.“ ((Wils 1997, S. 40), Hervorheb. i. Orig.) Diese Konzeption eröffnet die Möglichkeit einer hermeneutischen Sozialethik, für die der Zusammenhang von „Wirklichkeit und Sollen“ (Mieth 2002, S. 223) im Zentrum steht. Diese Terminologie kann also als Kurzformel einer theologisch-ethischen Hermeneutik verstanden werden und ist so das komplementäre Gegenstück zur herangezogenen hermeneutischen Anthropologie. Wirklichkeit ist doppeldeutig: „Der Begriff »Wirklichkeit« umschließt das Reale und das Mögliche zugleich.“ (Mieth 1998, S. 31) Damit liegt im Begriff der Wirklichkeit trotz der Kontrafaktizität des Sollens gegenüber den empirischen Verhältnissen der Grund für die prinzipielle Vermittelbarkeit von dem, was mit Wirklichkeit und mit Ethik bezeichnet wird. Sozialethik erscheint als eine engagierte Wirklichkeitswissenschaft.16 Das Sozialethische ist in diesem Sinne eine „reflektierte Anerkennung anthropologischer Bedürftigkeit“ im Kontext von Gesellschaft, eine „Parallelsprache, die zwar nicht aus ‚Ist’-Plausibilitäten deduziert werden kann, die sich aber mit der ‚Ist’-Plausibilität [in] einer gewissen Konvergenz befindet, nicht wie Linien, die sich im Unendlichen schneiden, so[ondern] in der Art wie auf zwei Parallelstraßen die jeweilige Plausibilität des Ist im Soll und die jeweilige Evidenz des Soll im Ist beobachtet werden kann“ ((Mieth 1998, S. 64). 3. Theologisch-sozialethische Antworten auf die Herausforderung Die theologische Ethik hat traditionellerweise weniger das Problem, aus humanwissenschaftlich-deskriptiven Aussagen über den Menschen Sollenssätze abzuleiten, d. h. mit empirischer Anthropologie die Ethik zu begründen. Die theologische Anthropologie hat 16 Für die sich hier andeutende Integration von Erkenntnistheorie und Ethik vgl. in Orientierung vor allem am Pragmatisten JOHN DEWEY Filipović 2008. 19 20 Filipović, Das Personalitätsprinzip es vielmehr mit der von KANT bei CHR. WOLF diagnostizierten kreisförmigen Verstrickung zu tun, wenn das Gesollte aus einer metaphysischen Wesensnatur des Menschen abgeleitet wird (Schröer 1988). Wie aber soll die theologische (Sozial)Ethik hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Anthropologie auf die Herausforderung reagieren, Anthropologie und Ethik in ein Verhältnis zu setzen? Innerhalb einer Kantischen Ethik bleiben dafür nur beschränkte Möglichkeiten offen, da darin die Entflechtung einer metaphysischen und empirischen Anthropologie von der Ethik konstitutiv ist. Es ist kein Wunder, dass die christliche Sozialethik nach der Verabschiedung des neuscholastischen Paradigmas sich auch gegenüber der Anthropologie abstinent verhielt, weil sie mehrheitlich diskursethisch orientiert war (Bohmeyer 2006) und diese Orientierung ja auf wesentlichen Elementen der kantischen Ethik beruht. Dies gilt in ähnlicher Weise für sozialethische Entwürfe, die einen transzendentalphilosophischen Autonomiebegriff ganz in das Zentrum stellen, also freiheitsanalytisch verfahren und deontologisch ansetzen.17 Freilich operieren diese Beiträge nicht ohne eine Anthropologie, aber sie ist minimal-formal angelegt und daher fällt eine oben angesprochene Vermittlung von Wirklichkeit und Ethik schwer. Gerade aber z. B. bei HÜBENTHAL wird die freiheitsanalytische Herangehensweise durch eine passende „Anschlusstheorie“ (Hübenthal 2006, S. 206) ergänzt, die am Handlungsbegriff ansetzt, aber in gewisser Weise ebenso minimalistisch verfährt und nach „zusätzlichen anthropologischen Überlegungen“ (Mieth 2004, S. 74, Anm. 14)18 verlangt. Die von HÜBENTHAL gezeigten Parallelen zum hermeneutischphänomenologischen Ansatz von CHRISTOF MANDRY (Mandry 2002) und die Option für die Integration einer Ethik des guten Lebens und der Sollensethik (Hübenthal 2006, S. 199) deuten hierfür Wege an, die aber von ihm für das Programm einer Grundlegung christlicher Sozialethik nicht weiter verfolgt werden. Vielversprechend scheint die sozialethische Aufnahme des Anerkennungsbegriffs. AXEL HONNETH, durchaus in der Tradition der kritischen Theorie stehend, hat hier viel geleistet (Honneth 1992) und die sozialethische Beschäftigung mit diesem Entwurf kann fruchtbar gemacht werden in dem Sinne, dass sie mit einer geschichtlich-kontextuellen theologischen Anthropologie vermittelt werden kann (Bohmeyer 2006).19 Wie der Durchgang durch die sozialethischen Konzepte gezeigt hat, liegt eine solche geschichtlich-kontextuelle theologische Anthropologie als Grundlegung christlicher Sozialethik vor (WILS, MIETH, HAKER, HEIMBACH-STEINS). Das Schlüsselwort dieser Anthropologie ist Erfahrung, ihre Methode ist induktiv, sie begründet sich biblisch und ihr Charakteristikum ist, dass sie es vermeidet, einen Katalog menschlicher Eigenschaften, Prädikate und Eigenheiten aufzustellen. Der ihr entsprechende Ethiktyp ist narrativ und/oder rekonstruktiv hermeneutisch beziehungsweise theologisch-kontextuell (vgl. zu diesem Ethiktyp Lesch 2002).20 4. Personbegriff im Verhältnis von Anthropologie und Ethik Der Personbegriff bleibt höchst bedeutsam für jede Ethik; in ihm wird der Brennpunkt der Ethik beschrieben, insofern er die in der Selbstzwecklichkeit begründete Würde des Menschen ins Spiel bringt. Theologisch-ethisch bleibt er zentral, weil er die Würde des 17 Vgl. z. B. Hübenthal 2006, Hausmanninger 2002 und Pröpper 1995. 18 HÜBENTHAL meint dieser Forderung zu entsprechen, in dem er in seinem Handlungsreflexiven Ansatz „ein substanziell anspruchsvolles Moralprinzip“ (Hübenthal 2006, S. 266) erkennt. Hinsichtlich der grundsätzlichen Strategie, die Anthropologie durch den Handlungsbegriff mit der Sozialethik zu vermitteln, kann man kritisch sein, da man sich dadurch Probleme mit der Gesellschaftstheorie einhandelt: „Der Mensch wird an der Unterseite des Handlungsbegriffs angeklammert und, wie Odysseus am Fell des Liebsten der Böcke, aus der Zyklopenhöhle in die Gesellschaft seiner Gefährten gerettet.“ (Luhmann 2005b, S. 9) 19 Ein weiterer Versuch der Vermittlung von Anthropologie und theologischer Sozialethik (auf den hier nicht weiter eingegangen werden kann) besteht in der Berücksichtigung des capabilities approach von MARTHA NUSSBAUM. Vgl. dazu Winkler 2006, S. 135–139. 20 Ein an einer Vermittlung von philosophischem Pragmatismus und Christlicher Sozialethik interessierter Entwurf scheint hier weitere Möglichkeiten zu präsentieren. Vgl. die dafür bereits vorliegenden ersten vorbereitenden Versuche Filipović 2008 und Filipović 2007. Filipović, Das Personalitätsprinzip Menschen an sein Gottesverhältnis koppelt. Auf der Ebene der Moralität und auf der Ebene der (die Moral reflektierenden) Ethik auf diese Weise von „Person“ zu sprechen leitet aber auch zu konkreteren Aussagen über das Menschsein über: Die Notwendigkeit einer philosophischen und für die christliche Sozialethik theologischen konkreten Anthropologie ist begründet in der nicht zu trennenden unvermeidbaren menschlichen Selbstdeutung und den darin enthaltenen normativen Orientierungen. Die in unterschiedlicher Gestalt vorliegende Selbstdeutung dieser Personen hat normative Implikationen, die auf die Ethik zurückwirken. Ob diese (christlichen) Selbstdeutungen, die aus der intersubjektiven (Gottes-) und Welterfahrung immer neu entstehen, überhaupt sinnvoll in einem Begriff der Person vereint werden können, erscheint mir zweifelhaft. Die Selbstdeutungen des Menschen, insofern sie als Gegenstand einer Reflexion vorliegen, sind gar nicht anders als geschichtlich und kontextuell zu denken, d. h. sie sind kulturell geformt und hängen von je verschiedenen Bedingungen der Identität ab. Ganz abgesehen von der unbeantwortbaren (aber vielleicht notwendigen?) Frage, ob in diesen Selbstdeutungen ein ungeschichtlicher, sogar wesensmäßiger Kern des Menschen verborgen liegt, wird der Versuch, das Menschliche in einem Katalog von Attributen festzuhalten, „unvermeidlich dilettantisch“ (Luhmann 2005a, S. 260). Mit einem starren, gegen zeitgebundene Phänomene sich abschottenden Katalog personaler Attribute im Rücken verspielt die Ethik tendenziell ihre Möglichkeiten, mit der sich ändernden und je neu zu entdeckenden Wirklichkeit in Kontakt zu treten. Gegen die mit der notwendigen Aktualisierung des Personbegriffs entstehende Gefahr, gesellschaftliche Zustände zu affirmieren, ist nicht nur das Würde-Attribut in der Selbstzweckformel (z. B. freiheitsanalytisch) zu bewahren und kritisch einzubringen. Auch die Selbstdeutungen des Menschen, die aus ihren Erfahrungen entstehen, können das leisten. Wenn Christinnen und Christen, ausgehend von den in der Bibel urkundlich bewahrten intersubjektiven Gottes- und Welterfahrungen, ihre je spezifischen Selbstdeutung (in Liturgie, Diakonie, Verkündigung und Theologie) zum Ausdruck bringen, führt das bestimmte normative Optionen mit sich, die kritisch gegen andere Selbstdeutungen einzubringen sind und deren normative Orientierungen argumentativ unterstützt werden können. Diese Selbstdeutungen samt ihrer normativen Implikationen sind aber nicht abzuleiten, sondern herauszufinden. Dieses Herausfinden, sofern es methodisch gesichert geschieht und seine Ergebnisse der Überprüfung durch andere ausgesetzt werden, nennt man theologische Anthropologie und sie wirkt auf die Ethik als Begründungs- und Reflexionsgestalt inhaltlich zurück. Das Ergebnis dieser Anthropologie ist ein dynamisches christliches Menschenbild, das ohne eine Liste menschlicher Attribute auskommt und auf reflektierter menschlicher Erfahrung beruht. Dies ist der „weltanschauliche Standpunkt“ christlicher Sozialethik, der sich einer genauen Ortsangabe entzieht. Die Herausforderung, Anthropologie und Ethik in ein Verhältnis zu setzen, lässt sich umformulieren zu der Herausforderung, menschliche Erfahrungen als Deutungen in unterschiedlichster Gestalt (als Erzählungen, als Kunst, als Wissenschaft...) wahrzunehmen, sie zu verstehen und zu reflektieren und auf ihre normativen Implikationen zu untersuchen. Die Würde der menschlichen Person und die konkreten Selbstdeutungen des Menschen sind das normative Fundament. Formal ist es in der Selbstzweckfomel unverhandelbar und steht für eine Begründung moralischer Urteile zur Verfügung, inhaltlich ist es aber offen zu halten und erfahrungsbasiert zu erheben und steht als Kompass und Maßgabe für eine verantwortliche Zeitgenossenschaft christlicher Ethik zur Verfügung. Eine christliche Sozialethik, die mit einem Personprinzip operiert, steht vor der Herausforderung, den Personbegriff nicht zu überfrachten. Das Personprinzip verweist dann auf die unveräußerliche Würde jedes Menschen und darauf, menschliche Selbstdeutungen ernst zu nehmen, also sich auf eine konkrete Anthropologie zu beziehen, die nicht aus Ableitungen und festen Setzungen besteht. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. 21 22 Filipović, Das Personalitätsprinzip IV. Der Personbegriff als Grundlage politischer Bildungsarbeit in christlicher Verantwortung? Im bisherigen Verlauf der Überlegungen ist nicht dafür plädiert worden, das Gesellschaftliche auf die Sozialität des Menschen zurückzuführen. Dass der Mensch „seinem Wesen nach“ ein soziales Wesen ist und von daher diese Sozialität die Grundnorm alles Sozialen ist, ist in dieser Form der Argumentation ein methodisch fragwürdiger Kurzschluss. Die menschliche Eigenschaft oder Bestimmung der Sozialität kann sozialethische Urteile nicht begründen und ist so formuliert auch schwerlich als eine menschliche Selbstdeutung zu identifizieren, die auf die Sozialethik inhaltlich einwirken kann. Wenn sie dennoch als solche identifiziert wird, dann nur als eine geronnene Form, die zwar zurückliegende Erfahrungen in sich aufgenommen hat, aber die mittlerweile so abstrakt geworden ist, dass deren implizite konkrete normative Optionen nicht mehr zu identifizieren sind. Eine Bezugnahme auf die wesensmäßige Sozialität des Menschen bleibt so für sozialethisches Denken gleichsam nur gut gemeint, gibt aber dem sozialethischen Vorschlag nichts inhaltlich Bemerkenswertes hinzu. Dies bedeutet freilich nicht, dass man sich deswegen von der Maßgabe, gesellschaftliche Strukturen, Institutionen oder das Gesellschaftliche im Ganzen sollen persongerecht gestaltet werden, verabschieden könnte. In formaler Hinsicht bedeutet persongerecht, dass die Selbstzwecklichkeit des Menschen Ziel und Grenze gesellschaftlicher Strukturen und Institutionen ist. In inhaltlicher Hinsicht bedeutet dies, dass sie seinen Selbstdeutungen entgegenkommen und sich befragen lassen müssen, ob sie den darin implizierten normativen Orientierungen entsprechen. Diese Selbstdeutungen sind aber kontingent, plural, veränderlich und, wie sollte es anders sein, selbstbestimmt. Der freiheitsanalytische Begründungsweg christlich sozialethischer Urteile, der die Freiheit und die Autonomie des Menschen betont und im Ausdruck Person auf den Begriff bringt, ist seinerseits wieder systematisch untrennbar mit der Selbstzwecklichkeit verbunden. Selbstbestimmte Selbstdeutung soll also sein. Wenn dies so ist, und Gesellschaft muss sich dadurch legitimieren, dann ist der Inhalt menschlicher Selbstdeutung Startpunkt einer Sozialethik, die die Verfassung des Menschen ernst nimmt und die Wirklichkeit und das Sollen des Menschen nicht getrennt voneinander behandelt. So geht es um die menschliche Erfahrung von und in Sozialität, wie sie sich heute darstellt. Sie liegt in den verschiedensten Ausdrucksformen vor, etwa in Literatur, Kunst, öffentlicher Kommunikation und Film. Hier zeigt sich aktuell, dass es gerade die Erfahrung des Ausgeschlossenseins ist, die Menschen heute in und mit der Gesellschaft und ihren Formen machen. Die Phänomene der Abkopplung und Ausgrenzung werden ansichtig in der Rede von der Hauptschule als „Restschule“, von der sich abkapselnden Unterschicht und von dem abgehängten Prekariat. „Bestimmte Gruppen“, so HEINZ BUDE, verlieren „den Anschluss an den Mainstream unserer Gesellschaft. Sie laufen mit, aber sie haben keine Adresse in der kollektiven Selbstauffassung unseres Gemeinwesens.“ (Bude 2008, S. 9) Diese Ausgrenzung ist nicht restlos auf Benachteiligung zurückführbar: „Sie betrifft vielmehr die Frage nach dem verweigerten oder zugestandenen Platz im Gesamtgefüge der Gesellschaft. Sie entscheidet darüber, ob Menschen das Gefühl haben, dass ihnen Chancen offenstehen und dass ihnen ihre Leistung eine hörbare Stimme verleiht, oder ob sie glauben müssen, nirgendwo hinzugehören, und dass ihnen ihre Anstrengung und Mühe niemand abnimmt. Für die Exkludierten gilt der meritokratische Grundsatz ‚Leistung gegen Teilhabe’ nicht mehr. Was sie können, braucht keiner, was sie denken, schätzt keiner, und was sie fühlen, kümmert keinen.“ (Bude 2008, S. 14f.) Diese „Erzählungen“ (und gemeint sind damit auch sozial- und politikwissenschaftliche „Erzählungen“) drängen zurzeit an die Oberfläche, müssen von der christlichen Sozialethik aufgenommen und mit formalen Methoden der Begründung von bestimmten Gerechtigkeitsforderungen verbunden werden. Mit der Konzeption der Beteiligungsgerechtigkeit reagiert die christliche Sozialethik auf diese Erfahrungen und begründet ein spezifisches Konzept sozialer Gerechtigkeit.21 21 Vgl. Filipović 2008 - im Druck. Filipović, Das Personalitätsprinzip Dieses Konzept ist gerade für bildungsethische Fragen hoch relevant, ja ist sogar ihr Schlüsselbegriff (Heimbach-Steins 2005). Beteiligungsgerechtigkeit kann als Bemühen verstanden werden, Gesellschaft in einer Situation persongerecht zu gestalten, in der fehlende (politische) Teilhabemöglichkeiten aufgrund fehlender (politischer) Bildungsmöglichkeiten bedrückende Erfahrungen sind. In formaler Hinsicht wird die Einforderung von gerechten Beteiligungsstrukturen u. a. mit dem konkreten Vollzug menschlicher Autonomie begründet. Diese Begründung zielt auf die politische Ebene, wonach Menschenwürde politische Mitwirkungsrechte einfordert. Hinsichtlich dieser skizzierten Verwendung des Personbegriffs fällt an der AKSB-Konvention zunächst auf, dass sie zu kaum anderen Ergebnissen kommt. So wird die „verantwortliche Teilnahme am Politischen“ mit der Bewahrung und Förderung von Freiheit und Selbstverwirklichung begründet. Unterschiede zu der hier vorgeschlagenen sozialethischen Verwendung des Personbegriffs und des Personprinzips lassen sich dennoch erkennen. Neben einer meines Erachtens fehlenden menschenrechtlichen Argumentation (wie sie in den präsentierten sozialethischen Texten durchweg eine wichtige Rolle spielt) fällt vor allem auf, dass als normative Grundorientierung die „Entfaltung des Menschen als Person“ oder der „Prozeß der Personwerdung“ betont wird. Über den Status dieser Formulierungen bin ich mir nicht sicher. Die Betonung des Prozesshaften könnte ein Versuch sein, den Personbegriff zu dynamisieren. Dies würde verhindert, wenn das Ziel dieser Entfaltung schon gewusst wird. Möglich wäre auch, dass sich hier pädagogische und theologische Anthropologie vermischen. Ich würde besonders im letzten Fall für eine Explikation der diesen Ausdrücken zu Grunde liegenden Annahmen plädieren. Worauf ich aber auf Grund meiner bisherigen Überlegungen hauptsächlich eingehen will, ist dies: Unterschiede können auch dort entdeckt werden, wo sich die Konvention um eine Liste der personalen Attribute bemüht, die im Menschen „angelegt“ sind. Sie gibt zwar vereinzelte Hinweise darauf, woher sie dieses Wissen gewinnt („durch den christlichen Glauben“, Nr. 3), aber sie rekurriert nicht auf die Erfahrungswirklichkeit der Menschen, die ja durchaus Glaubenserfahrung sein kann. Fällt aber die Bezugnahme auf menschliche Selbstdeutung aus, so bleibt die Bestimmung menschlicher Personalität formelhaft und unbestimmt und der Versuch, damit Bildungsarbeit zu begründen, muss ebenso formelhaft bleiben. Nicht, dass nicht auch Formeln ihren Sinn haben. Aber eine in konkreten Lebenswirklichkeiten ansetzende politische Bildungsarbeit sollte anders über menschliche Personalität sprechen als Kompendien kirchlicher Soziallehre. Absatz 4 deutet nur sehr vorsichtig an, wie der Bezug auf menschliche Erfahrungswerte aussehen könnte: Identitätsbildung, so wird gesagt, ist heute immer schwieriger zu realisieren. Aber auch hier fehlt der Verweis auf die Quellen dieser Einsicht. Ich würde mir auf Grund der hier präsentierten Überlegungen wünschen, dass die Anthropologie als Diagnose menschlicher Wirklichkeit in der Welt von heute ausführlicher dargestellt und systematisch stärker betont wird. Auf einen Katalog personaler Eigenschaften würde ich verzichten. Vielleicht könnte man nach einer biblisch-theologischen Begründung der Menschenwürde und menschlicher Autonomie und einer menschenrechtlichen Deutung dieser Menschenwürde mit den Erfahrungen der Menschen in Bezug auf Politik und ihre Teilhabemöglichkeiten fortfahren, wie sie in der konkreten politischen Bildungsarbeit geäußert werden? Kann darin etwas spezifisch Christliches entdeckt werden? Welche normativen Optionen werden darin ansichtig? Ich bin mir sicher, dass jede und jeder, der in der politischen Bildungsarbeit tätig ist, solche Erfahrungen aufgenommen hat und beisteuern kann. Politische Bildungsarbeit persongerecht zu gestalten mit dem Ziel, dass die Gesellschaft immer persongerechter wird, könnte hier ihren Ausgang nehmen. Politische Verantwortung nicht als Wesensmerkmal des Menschen als Person einzuführen, sondern ausgehend von menschlichen Erfahrungen darauf einzugehen, zu sammeln und zu refomulieren, was politische Verantwortung heute für Menschen heißt, wie sie sie selbst beschreiben, womit sie ihre Probleme haben, welche Intuitionen und Gefühle sie in Bezug auf politische Verantwortung äußern können, worauf sie ihr Verständnis von Verantwortung gründen, wem sie sich verantworten wollen und können und wo sie Möglichkeiten sehen, diese Verantwortung zu stärken – das wird der Funktion 23 24 Filipović, Das Personalitätsprinzip des christlichen Personbegriffs gerecht, nämlich die ethische Relevanz selbstbestimmter Selbstdeutung ins Spiel zu bringen. Freie Selbstdeutung zu ermöglichen, die Ergebnisse der Selbstdeutung verändernd und gestaltend, in verantwortlicher Freiheit in demokratisch organisierte Politik einzubringen, wird schließlich das Ziel politischer Bildungsarbeit in christlicher Verantwortung sein. Was spricht dagegen, dass sich dies vom Ansatz her aber auch inhaltlich an grundlegender Stelle in der AKSB-Konvention niederschlägt? Das würde allerdings eine Bereitschaft zur ständigen Aktualisierung der Abschnitte der Konvention bedeuten. Aber genau das, die Berücksichtigung aktueller menschlicher Selbstdeutungen und die Entdeckung der darin enthaltenen normativen Orientierungen, fordert das Personprinzip von der christlichen Sozialethik. V. Literaturverzeichnis Anzenbacher, Arno (1998): Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien. Paderborn u. a.: Schöningh. Anzenbacher, Arno (2002): Sozialethik als Naturrechtsethik. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Jg. 43, S. 14–32. Auer, Alfons (1986): Verantwortete Zeitgenossenschaft. In: Hunold, Gerfried W. / Korff, Wilhelm (Hrsg.): Die Welt für morgen. Ethische Herausforderungen im Anspruch der Zukunft. München: Kösel, S. 426–437. Baumgartner, Alois (2004): Personalität. In: Heimbach-Steins, Marianne (Hrsg.): Christliche Sozialethik. Ein Lehrbuch. Bd. 1. Grundlagen. Regensburg: Pustet, S. 265–269. Baumgartner, Alois / Korff, Wilhelm (1999): Sozialprinzipien als ethische Baugesetzlichkeiten moderner Gesellschaft: Personalität, Solidarität und Subsidiarität. In: Korff, Wilhelm u. a. (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftsethik. Band 1-4 / Hrsg. im Auftragder Görres-Gesellschaft. Bd. 1. Verhältnisbestimmung von Wirtschaft und Ethik. Gütersloh: Gütersloher Verlags-Haus , S. 225–237. Baumgartner, Alois/Korff, Wilhelm (2000): Art. Sozialprinzipien. In: Korff, Wilhelm / Beck, Lutwin / Mikat, Paul (Hrsg.): Lexikon der Bioethik, Bd. 3. Pe-Z. Studienausg. Gütersloh: Gütersloher Verlags-Haus , S. 405–411. Bohmeyer, Axel (2006): Jenseits der Diskursethik. Christliche Sozialethik und Axel Honneths Theorie sozialer Anerkennung. Münster, Westf.: Aschendorff (Forum Sozailethik, 2). Brandom, Robert B. (1994): Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und diskursive Festlegung. Fankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. Bude, Heinz (2008): Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft. München: Hanser. Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands, K.A.B. (Hrsg.) (1992): Texte zur katholischen Soziallehre. Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Mit Einf. von Oswald von Nell-Breuning, Johannes Müller. 8., Erw. Aufl. Bornheim: Ketteler. Dewey, John (1925): Erfahrung und Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. Dwyer, John C. (1994): Person, Dignity of. In: Dwyer, Judith A./Montgomery, Elizabeth L. (Hrsg.): The new Dictionary of Catholic Social Thought. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, S. 724–737. Filipović, Alexander (2007): Beteiligungsgerechtigkeit als (christlich-) sozialethische Antwort auf Probleme moderner Gesellschaften. In: Eckstein, Christiane / Filipović, Alexander / Oostenryck, Klaus (Hrsg.): Beteiligung, Inklusion, Integration. Sozialethische Konzepte für die moderne Gesellschaft. Münster, Westf.: Aschendorff (Forum Sozialehtik, 5), S. 29–40. Filipović, Alexander (2008): Die Kritik an der Unterscheidung von Sein und Sollen im Pragmatismus. Über den Zusammenhang von Erkenntnistheorie, Ethik und Pädagogik. In: Pädagogische Rundschau, Jg. 62, H. 1, S. 107–114. Filipović, Alexander (2008 - im Druck): Elemente einer kritischen Theorie der Beteiligungsgerechtigkeit. Sondierungen zum Verhältnis von Teilhaben und Beitragen. In: Heimbach-Steins, Marianne / Kruip, Gerhard / Neuhoff, Katja (Hrsg.): Keine(r) darf zurückbleiben! Bildungszugänge und -übergänge auf dem Prüfstand (Arbeitstitel) (Forum Bildungsethik, 5). Furger, Franz (1991): Christliche Sozialethik. Grundlagen und Zielsetzungen. Stuttgart: Kohlhammer (Kohlhammer Studienbücher Theologie, 20). Haker, Hille (1999): Moralische Identiät. Literarische Lebensgeschichten als Medium ethischer Reflexion. Mit einer Interpretation der Jahrestage von von Uwe Johnson. Tübinge, Basel: Francke. Filipović, Das Personalitätsprinzip Hausmanninger, Thomas (2002): Grundlegungsfragen der christlichen Sozialethik als Strukturenethik auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert. In: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, Jg. 43, S. 185–203. Heimbach-Steins, Marianne (1995): Erfahrung: Konversion ungd Begegnung. Ansatzpunkte einer theologischen Profilierung christlicher Sozialethik. In: Heimbach-Steins, Marianne / Lienkamp, Andreas / Wiemeyer, Joachim (Hrsg.): Brennpunkt Sozialethik. Theorien, Aufgaben, Methoden. Für Franz Furger. Freiburg, Basel, Wien: Herder, S. 103–120. Heimbach-Steins, Marianne (1997): Das Stichwort: Zeichen der Zeit. In: Bibel und Lithurgie, Jg. 70, S. 297– 298. Heimbach-Steins, Marianne (2005): Bildung und Beteiligungsgerechtigkeit. Bildungspolitische und sozialethische Anfragen. In: Hirsch, Klaus / Seitz, Klaus (Hrsg.): Zwischen Sicherheitskalkül, Interesse und Moral. Beiträge zur Ehtik der Entwicklungspolitik. Frankfurt a. M.: IKO - Verlag für Interkulturelle Kommuniaktion, S. 257–272. Heimbach-Steins, Marianne (2008): Sozialethik. In: Arntz, Klaus / Heimbach-Steins, Marianne / Reiter, Johannes / Schlögel, Herbert (Hrsg.): Orientierung finden. Ethik der Lebensbereiche. Freiburg im Breisgau: Herder Freiburg (Theologische Module, 5), S. 166–208. Heimbach-Steins, Marianne / Lienkamp, Andreas (1997): Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland. Eingeleitet und kommentiert von Marianne Heimbach-Steins und Andreas Lienkamp (Hrsg.) Unter Mitarbeit von Gerhard Kruip und Stefan Lunte. München: Bernward bei Don Bosco. Höffe, Otfried (1996): Vernunft und Recht. Bausteine zu einem interkulturellen Rechtsdiskurs. Höhn, Hans-Joachim (1991): Im Zeitalter der Beschleunigung. In: Furger, Franz / Heimbach-Steins, Marianne (Hrsg.): Perspektiven christlicher Sozialethik. Hundert Jahre nach Rerum Novarum. Münster: Regensberg , S. 283–302. Höhn, Hans-Joachim (1999): Art. Personalitätsprinzip. In: Kasper, Walter u. a. (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 8, Pearson bis Samuel. 3., völlig neu bearb. Auflage. Freiburg im Breisgau, Basel, Rom, Wien: Herder, Sp. 61–62. Honneth, Axel (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Hübenthal, Christoph (2006): Grundlegung der christlichen Sozialethik. Versuch eines freiheitsanalytisch-handlungsreflexiven Ansatzes. Münster, Westf.: Aschendorff (Forum Sozialethik, 3). Illies, Christian (2006): Philosophische Anthropologie im biologischen Zeitalter. Zur Konvergenz von Moral und Natur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Kant, Immanuel: Anthroplogie in pragmatischer Hinsicht. In: Preußische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Kants Werke (Berlin 1902 ff.), Bd. 7 (AA). Nachdruck: Berlin de Gruyter 1968, S. 117–334. Kant, Immanuel (1786): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kommetar von Christoph Horn, Corinna Mieth und Nico Scarano. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007 (Suhrkamp Studienbibliothek, 2). Kerber, Walter (1998): Sozialethik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer (Grundkurs Philosophie,13). Korff, Wilhelm (1987): Was ist Sozialethik. In: Münchener theologische Zeitschrift, H. 38, S. 327–335. Korff, Wilhelm (1993): Die naturale und geschichtliche Unbeliebigkeit menschlicher Normativität. In: Hertz, Anselm u. a. (Hrsg.): Handbuch der christlichen Ethik. Bd. 1 Aktualisierte Neuausgabe, Freiburg: Herder, S. 147–167. Korff, Wilhelm (2000): Art. Sozialethik. In: Korff, Wilhelm / Beck, Lutwin / Mikat, Paul (Hrsg.): Lexikon der Bioethik, Bd. 3. Pe-Z. Studienausgabe Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, S. 377–388. Lehmann, Karl (1989): Christliche Weltverantwortung zwischen Ghetto und Anpassung: Die nachkonziliare Aufnahme der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. In: Bader, Dietmar (Hrsg.): Freiburger Akademiearbeiten 1979-1989. MünchenSchnell & Steiner (Schriftenreihe der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, 41) S. 153–170. Lesch, Walter (2002): Hermeneutische Ethik/Narrative Ethik. In: Düwell, Marcus / Hübenthal, Christoph/ WerMicha H. (Hrsg.): Handbuch Ethik. Stuttgart, Weimar: Metzler, S. 231–242. ner, Luhmann, Niklas (2005A): Die Soziologie und der Mensch. In: Luhmann, Niklas (Hrsg.): Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 252–261. Luhmann, Niklas (2005B): Vorwort. In: Luhmann, Niklas (Hrsg.): Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. 2. Auflage Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 7–11. Mandry, Christof (2002): Ethische Identität und christlicher Glaube. Theologische Ethik im Spannungsfeld von Theologie und Philosophie. Mainz: Grünewald. Mieth, Dietmar (1998): Moral und Erfahrung II. Entfaltung einer theologisch-ethischen Hermeneutik. Freiburg, Schweiz: Univ.-Verlag (Studien zur theologischen Ethik, 76). 25 26 Filipović, Das Personalitätsprinzip Mieth, Dietmar (1999): Moral und Erfahrung I. Grundlagen einer theologisch-ethischen Hermeneutik. 4., überarb. und erg. Neuauflage, Freiburg, Schweiz: Univ.-Verlag (Studien zur theologischen Ethik, 2). Mieth, Dietmar (2002): Sozialethik als hermeneutische Ethik. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Jg. 43, S. 217–240. Mieth, Dietmar (2004): Kleine Ethikschule. Freiburg, Basel, Wien: Herder. Pröpper, Thomas (1995): Autonomie und Solidarität: Begründungsprobleme sozialethischer Verpflichtung. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften. Jg. 36, S. 11–26. Schröer, Christian (1988): Naturbegriff und Moralbegründung. Die Grundlegung der Ethik bei Christian Wolf und deren Kritik durch Immanuel Kant. Stuttgart u. a.: Kohlhammer (Münchener Philosophische Studien. Neue Folge, 3). Stout, Jeffrey (2004): Democracy and Tradition. 4. print and 1. paperback print. Princeton NJ.: Princeton University Press, 2005 (New Forum Books). Taylor, Charles (1994): Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Frankfurt a. M. Thyen, Anke (2007): Moral und Anthropologie. Untersuchungen zur Lebensform ‚Moral‘. Weilerswist: Velbrück Wiss. Wils, Jean-Pierre (1997): Anmerkungen zur Wiederkehr der Anthropologie. In: Wils, Jean-Pierre (Hrsg.): Anthropologieund Ehtik. Biologische, sozialwissenschaftliche und philosophische Überlegungen. Tübingen, Basel: Francke (Ethik in den Wissenschaften, 9), S. 9–40. Winkler, Katja (2006): Körperlichkeit - Gesundheit - Gutes Leben. Zur Begründung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung aus der Perspektive des Capabilities Approach. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Jg. 47, S. 129–149. Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? 27 Dr. Hermann-Josef Große Kracht Katholische Sozialprinzipien in der Krise? Eine Warnung vor voreiligen Verabschiedungen. Alle reden heute von der Gerechtigkeit; und jede Akademie, die auf sich hält, widmet ihr erhöhte Aufmerksamkeit. Auf dem Markt der politischen Philosophie dürfte es mittlerweile ein gutes Dutzend unterschiedlicher Gerechtigkeitstheorien geben, die sich einen munteren Konkurrenzkampf liefern. Es ist gewissermaßen für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel ein passendes Angebot dabei. Die Diskussion kreist um Begriffe wie Leistung und Eigenverantwortung, Freiheit und Chancen, Teilhabe und Inklusion, Beteiligung und Befähigung – und in den meisten Fällen geht es dabei auch um den Versuch, Abstand zur klassischen Idee der Verteilungsgerechtigkeit zu entwickeln, die in den gegenwärtigen Debatten eher keinen guten Klang mehr hat. Klassische ‚katholische‘ Sozialprinzipien – wie Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität – finden angesichts dieses Booms der Gerechtigkeitssemantik heute nur noch geringe Resonanz, nicht zuletzt auch im Raum der katholischen Kirche selbst. Das klassische Gemeinwohl-Motiv, das im 20. Jahrhundert vielfach missbraucht wurde, galt in den 1970er und 1980er Jahren als Unwort, wurde von konservativen Kräften nur noch vorsichtig verwendet und war bei progressiven Geistern geradezu verpönt.1 In letzter Zeit taucht es jedoch in der politischen Rhetorik ebenso wie in der politischen Philosophie gelegentlich wieder auf – so etwa zu Beginn der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder, als er seine Regierung emphatisch darauf verpflichtete, ein von ihm behauptetes, aber nicht näher definiertes ‚Gemeinwohl‘ kraftvoll gegen gesellschaftliche ‚Partikularinteressen‘ durchzusetzen... Damit war der alte Bann gegenüber der Gemeinwohl-Semantik gebrochen. Dennoch spielt dieser Topos in den gegenwärtigen Debatten kaum ein Rolle; und auch innerhalb der kirchlich-sozialethischen Selbstverständigungsdebatten taucht er gegenwärtig nur selten auf. Und auch die katholische Rede von der Solidarität ist in den letzten Jahren in eine veritable Krise geraten. Hatte es im Sozialwort der Kirchen von 1997 noch eine prominente Rolle gespielt und im Titel dieses Textes sogar den ersten Rang eingenommen (‚Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit‘), so hat es diesen Platz mittlerweile verloren. Im Gesundheitspapier vom Mai 2003 ist das katholische Prinzip der Solidarität dem liberalen Prinzip der Eigenverantwortung schon semantisch untergeordnet worden (‚Solidarität braucht Eigenverantwortung‘), und in der bisher letzten sozialpolitischen Grundsatz-Verlautbarung aus der Bischofskonferenz vom Dezember 2003 werden dann auch nicht mehr die alten Prinzipien von Solidarität und Gerechtigkeit, sondern nur noch diffus ein ‚neues Denken‘ (‚Das Soziale neu denken‘) eingefordert.2 Auch in der Kirche scheinen also mittlerweile viele ihre politisch-moralischen Hoffnungen weniger auf die gute alte Botschaft der Solidarität als auf die neue Rede von der Eigenverantwortung zu setzen; und zumeist verstehen sie die Solidarität dabei nicht mehr als ein fundamentales Strukturprinzip der Gesellschaft, sondern nur noch als moralisierende Aufforderung zu einer individualethischen Haltung des Mitleids und der Barmherzigkeit; ein Solidaritätsverständnis, das die katholische Soziallehre seit jeher, sei es in der Per- 1 Hermann-Josef Große Kracht, Die überraschende Renaissance des Gemeinwohls. Strohfeuer oder Auftakt zu einer neuen Debatte um das politische Selbstverständnis moderner Gesellschaften?, in: Soziologische Revue 27 (2004) 3, 297-311. 2 Vgl. dazu Hermann-Josef Große Kracht, Von der ‚Solidarität‘ zur ‚Eigenverantwortung‘? Wie es nach dem Sozialwort der Kirchen weiterging..., in: Karl Gabriel/Werner Krämer (Hg.), Kirchen im gesellschaftlichen Konflikt. Der Konsultationsprozess und das Sozialwort ‚Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit‘, 2. Auflage 2004, Münster 2004, 292-323. Dr. Hermann-Josef Große Kracht, geboren 1962 in Glandorf, Kreis Osnabrück, seit 2000 Assistent am Institut für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster. 28 Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? son Oswald von Nell-Breunings3 oder in der Person von Johannes Paul II.4, stets vehement zurückgewiesen hat. Die AKSB-Konvention von 1998 atmet dagegen noch deutlich den ‚Geist‘ des Wirtschafts- und Sozialworts von 1997, was angesichts der zeitlichen Nähe auch nicht verwunderlich ist. Sie nennt als Prinzipien der christlichen Sozialethik die Personalität, das Gemeinwohl, die Solidarität und die Subsidiarität. Ganz in der Tradition der katholischen Soziallehre erinnert sie daran, dass das Gemeinwohl „den eigentlichen Sinn der staatlichen Ordnung“ darstelle, dass dieses Gemeinwohl darauf zielt, „dass alle Menschen sich als Person in ihrem Leben verwirklichen können“ – und dass die Subjekte und Träger dieser Gemeinwohlorientierung in der Gesellschaft selbst und keineswegs ausschließlich beim Staat zu suchen seien: „Das Gemeinwohlprinzip widerspricht deshalb sowohl jenen, die dem Staat die Verantwortung für die Herstellung gerechter Lebensbedingungen absprechen, als auch jenen, die dem Staat allein die Verantwortung für die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit zusprechen.“ (ASB-Konvention, Nr. 10) Auch den Topos der Solidarität fasst sie zurecht nicht primär als moralisch-normative Kategorie ethischer Tugendhaftigkeit, sondern als gesellschaftliches Strukturprinzip, wenn sie erklärt: „Solidarität beschreibt die menschliche Verbundenheit und die mitmenschliche Schicksalsgemeinschaft.“ Allerdings lässt sie es dann bei dieser (allzu) knappen Formel auch schon bewenden. Und anstatt die Ursachen und Entstehungskontexte, die Formen und Dimensionen dieser ‚Schicksalsgemeinschaft‘ näher zu thematisieren, kommt sie dann allzu schnell auf die individualethischen Konsequenzen dieser solidarischen Schicksalgemeinschaft zu sprechen. Wie auch immer; das Verständnis der klassischen katholischen Sozialprinzipien von Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität ist in den letzten zehn Jahren gehörig ins Rutschen gekommen. Grund genug also, einige Vergewisserungen über das katholische Verständnis von Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität vorzunehmen und die Frage aufzuwerfen, inwiefern diese altehrwürdigen Sozialprinzipien heute noch orientierende Kraft und argumentatives Potenzial beanspruchen können. I. Gemeinwohl: Von der ‚Wohlfahrt des Staatsschiffes‘ zum Dienstwert jenseits von Kollektivismus und Individualismus Das klassische Gemeinwohlprinzip ist seit dem II. Vatikanischen Konzil auch innerhalb der katholischen Soziallehre in eine schwere Krise geraten, aus der es bis heute nicht herausgefunden hat. Ein emphatisch-offensiver Rekurs auf das Gemeinwohl als sozialmoralisches Legitimationsprinzip spielt gegenwärtig weder in Texten der lehramtlichen Sozialverkündigung noch bei Autoren der katholischen Soziallehre eine nennenswerte Rolle. Dabei war das Gemeinwohl (bonum commune) seit jeher der schlechthin zentrale Leitbegriff der kirchlichen Staats- und Gesellschaftslehre. Bei Thomas von Aquin (12251274) im politisch-sozialen Kontext seiner Zeit, der vormodernen Welt des ‚christlichen 3 Schon 1951 schrieb Nell-Breuning, dass das Solidaritätsmotiv des ‚Einer für alle, alle für einen‘ einen ‚Seinsverhalt‘ bezeichne, der sich Folgendermaßen ausdrücken lässt: „wir fahren alle in einem Boot; sinkt das Boot, so gehen wir alle unter; kommt das Boot glücklich ans Ziel, so wird wir alle gerettet; (...) Das sind keine ‚ethischen Postulate‘, sondern ganz nüchterne Tatsachen.“ (Oswald von Nell-Breuning, Art. Solidarismus, in: Ders./Hermann Sacher (Hg.) Gesellschaftliche Ordnungssysteme (Beiträge zu einem Wörterbuch der Politik, V), Freiburg i. Br.: Herder 1951, Sp. 357-376, 361. 4 So betont Johannes Paul II. in der Enzyklika Sollicitudo rei socialis (1987), dass die Solidarität „nicht ein Gefühl vagen Mitleids“ meine, sondern dem Bewusstsein einer „tiefen wechselseitigen Abhängigkeit“ entspringe, denn: „Mehr als in der Vergangenheit werden sich die Menschen heute dessen bewußt, durch ein gemeinsames Schicksal verbunden zu sein, das man vereint gestalten muß, wenn die Katastrophe für alle vermieden werden soll.“ (SRS 26,5) Aus diesem Wissen folgen dann unmittelbar politisch-moralische Konsequenzen: „Wenn die gegenseitige Abhängigkeit in diesem Sinne anerkannt wird, ist die ihr entsprechende Antwort als moralische und soziale Haltung, als ‚Tugend‘, die Solidarität. Diese ist nicht ein Gefühl vagen Mitleids oder oberflächlicher Rührung wegen der Leiden so vieler Menschen nah und fern. Im Gegenteil, sie ist die feste und beständige Entschlossenheit, sich für das ‚Gemeinwohl‘ einzusetzen, das heißt für das Wohl aller und eines jeden, weil wir für alle verantwortlich sind.“ (SRS 38,6) Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? Abendlandes‘ – fungierte die Rede vom Gemeinwohl als Chiffre für eine vor aller Zeit in der göttlichen Schöpfungsordnung festgeschriebene Ziel- und Zweckbestimmung der ‚Wesensnatur‘ sozialer Gemeinschaften. Hier schien jeder Person und jedem Stand ein unverrückbar feststehender Ort im hierarchisch gegliederten Ordnungsgefüge der Welt zugewiesen zu sein. Das Gemeinwohl einer Gemeinschaft, angefangen vom ‚ganzen Haus‘ über die dörfliche Gemeinschaft bis hin zum politischen Gemeinwesen, galt dabei als eine für die menschliche Vernunft zwar nochvollziehbare, individueller Wahl- und Dispositionsfreiheit aber entzogene Zielgröße allen individuellen und gemeinschaftlichen Lebens. Geradezu klassisch für die Sozialphilosophie des Thomas und die auf ihn aufbauende Schulphilosophie des politischen Aristotelismus, die bis weit in das 19. Jahrhundert hinein zur Standardausbildung an deutschen Universitäten gehörte, ist in diesem Zusammenhang die Metapher vom ‚Staatsschiff‘, dessen Wohl darin besteht, sicher und ungefährdet den Stürmen des Meeres zu trotzen und wohlbehalten den vorbestimmten Zielhafen zu erreichen. Und auch wenn Historiker heute zurecht betonen, dass „auch vormoderne Gesellschaften sich keineswegs durch eine von allen geteilte Sinnperspektive integriert haben, wie dies die Vertreter einer nach Ständen gegliederten und in der ‚Harmonie der Ungleichheit‘ geordneten Gesellschaft immer und bis tief in die Moderne hinein behaupteten“5, so haftet dieses holistisch-harmonistische Gemeinschaftsmotiv der Begriff des Gemeinwohls bis heute an – und macht ihn deshalb prima facie so ungenießbar. Nicht zuletzt die katholische Neuscholastik der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war – mitunter geradezu halsstarrig – davon überzeugt, über einen umfassenden Entwurf wohlgeordneten gesellschaftlichen Lebens zu verfügen, den man den jeweils Regierenden einfachhin als verbindliche Richtschnur ihres Handelns auferlegen könne und müsse. Die Vorstellung, ein göttlich vorgegebenes und von der menschlichen Vernunft (notfalls mit der autoritativen Hilfe des kirchlichen Lehramtes) irrtumsfrei erkennbares ‚Gemeinwohl des Staates‘ könne und müsse von den politischen Autoritäten nur treu umgesetzt werden, um ‚gute Politik‘ zu gewährleisten, ist mit den modernen Prinzipien der Volkssouveränität, der moralischen Autonomie der Person und einer freien politischen Öffentlichkeit als Medium demokratischer Meinungs- und Willensbildung jedoch kaum zu vereinbaren. Mit dem weltanschaulichen Pluralismus moderner Massengesellschaften wird eine solche ‚statisch-objektivistische‘ Vorstellung vom Gemeinwohl zudem politisch unbrauchbar, wenn sie nicht gar, wie so oft, einem weltanschaulichen Totalitarismus Vorschub leistet. Vor diesem Hintergrund hat sich auch das Zweite Vatikanische Konzil deutlich von der traditionellen Gemeinwohl-Konzeption distanziert. Es hat den Topos des Gemeinwohls aber keineswegs aufgegeben, sondern in spezifischer Weise modernitäts- und pluralitätskompatibel umformuliert – und dabei gewichtige normative Verschiebungen vorgenommen. Das Gemeinwohl wird jetzt nämlich nicht länger substanzialistisch-objektivistisch, als eine den Individuen gegenüberstehende feste Größe verstanden, die es nur fehlerfrei zu erkennen und dann politisch konsequent umzusetzen gelte. Vielmehr wird das Gemeinwohl jetzt bezeichnet als die „Gesamtheit jener Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, die sowohl den Gruppen als auch deren einzelnen Gliedern ein volleres und leichteres Erreichen der eigenen Vollendung ermöglichen“ (Gaudium et Spes, 26); und jedes Sozialgebilde hat dabei sein je eigenes Gemeinwohl, angefangen bei den primären Lebensgemeinschaften über den Nationalstaat bis hin zum ‚Gemeinwohl der ganzen Menschheitsfamilie‘. Oswald von Nell-Breuning, der ‚Nestor der katholischen Soziallehre‘, hat das Gemeinwohl auf dieser Grundlage näherhin definiert als „den guten Befund oder Zustand eines gesellschaftlichen Gebildes oder Gemeinwesens, kraft dessen es imstande ist, seinen Gliedern zu helfen, zu erleichtern oder überhaupt zu ermöglichen, durch ihre eigenen Anstrengungen das, was sie erstreben, das ist ihr eigenes Wohl oder ihre eigene Ver5 Otto Gerhard Oexle, Konflikt und Konsens. Über gemeinschaftsrelevantes Handeln in der vormodernen Gesellschaft, in: Herfried Münkler/Harald Bluhm (Hg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn. Historische Semantiken politischer Leitbegriffe (Forschungsberichte der interdisziplinären Arbeitsgruppe ‚Gemeinwohl und Gemeinsinn‘ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1), Berlin 2001, 65-83, 80. 29 30 Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? vollkommnung oder ein von ihnen gemeinsam erstrebtes Ziel, zu erreichen“.6 Das Gemeinwohl ist demnach zunächst und vor allem als Dienstwert zu bestimmen, denn es ist „wertvoll nicht um seiner selbst willen, sondern um des Dienstes willen, den es leistet; ganz offenbar ist das ein Dienst an den einzelnen; so kommt der gute Befund oder Zustand des Ganzen, den wir das Gemeinwohl nennen, ganz und gar den einzelnen, die Glieder dieses Ganzen sind, zustatten und ist genau so viel wert, wie es ihnen dient“.7 Als solcher Dienstwert kommt dem Gemeinwohl dann zugleich auch ein Selbstwert für die sozialen Gruppen und Gemeinschaften zu, insofern es das „ihnen allen gemeinsame Wohl“ bezeichnet. „Beim Staat ist das mehr oder weniger das gesamte irdische Wohl; bei der Familie ist es jenes spezifisch menschliche Wohl, dessen die Familienmitglieder im Familienkreis sich erfreuen; bei einem auf Interessenvertretung angelegten Verband ist es das oft sehr spezielle Interesse, das durch den verbandlichen Zusammenschluß durchgesetzt werden soll.“ 8 Nell-Breuning verortet die Kategorie des Gemeinwohl somit in einer spezifischen Weise jenseits von ‚Individualismus‘ und ‚Kollektivismus‘. Kollektivistische Engführungen ergeben sich immer dann, wenn man ein übergeordnetes angebliches Gemeinwohl unvermittelt gegen legitime und berechtigte Einzel- und Gruppeninteressen in Stellung bringen will – und dabei übersieht, dass sich dieses Gemeinwohl immer als Dienstwert für die Realisierung prinzipiell aller Einzel- und Gruppeninteressen plausibilisieren lassen muss. Individualistische Engführungen treten immer dann auf, wenn man das Gemeinwohl vollständig in die real anzutreffenden und sich politisch und ökonomisch entsprechend artikulierenden Einzel- und Gruppeninteressen aufzulösen versucht. Dies geschieht etwa dann, wenn man das Gemeinwohl als Summe der Wohlstands- und Nutzeneinheiten der Individuen definiert und Gemeinwohlförderung rein quantitativ als Steigerung des ‚größten Glücks der größten Zahl‘ begreift; oder wenn man das Gemeinwohl rein formal, gleichsam als ‚Resultante eines Parallelogramms‘ zu bestimmen versucht, das sich aus den realen Kräfteverhältnissen der unterschiedlichen politischen, ökonomischen und kulturellen Interessengruppen, Bewegungen und Initiativen der Gesellschaft ergibt und als solches dann als Leitlinie der Politik fungieren soll. In beiden Fällen droht der Gemeinwohltopos seine politisch-moralische Orientierungskraft einzubüßen und seine Funktion als kritisches Korrektiv gegenüber den realen gesellschaftlichen Verhältnissen einzubüßen. Deshalb sollte man den Begriff des Gemeinwohls – in seiner nachkonziliaren Lesart – nicht vorschnell aufgeben, denn gerade die ‚überindividuellen‘ Gehalte dieser Semantik erinnern daran, dass sich die komplexe Wechselwirkung von Individuum und Gesellschaft, von Person und Gemeinschaft weder kollektivistisch noch individualistisch auflösen lässt. Die Person geht weder in der Gesellschaft auf, noch lässt sich die Gesellschaft als willkürliche Ansammlung isolierter Individuen verstehen, der der Einzelne je nach seiner individuellen Interessenlage beitreten kann oder auch nicht. Insofern ist neben dem Einzelwohl der Individuen weiterhin von einem ‚Gemeinwohl der Gesellschaft‘ zu reden, auch wenn dies heute nicht mehr durch den autoritativen Rückgriff auf einen ‚objektiv‘ vorgegebenen und ewig unveränderlichen Gemeinwohlbestand, sondern nur noch im Rahmen einer freien und öffentlichen Meinungs- und Willensbildung über die jeweils hier und jetzt dringlichen Gemeinwohlbedürfnisse und Gemeinwohlinteressen möglich ist. Ein zukunftsfähiges Konzept von ‚Gemeinwohl‘ darf insofern nicht hinter ‚die Sperrklinken der politischen Moderne‘ zurückfallen. Es muss den Kriterien der (politischmoralischen) Individualisierung, der (demokratisch-diskursiven) Prozeduralisierung und der (weltanschaulich-kulturellen) Pluralisierung gerecht werden. Vielleicht kann hier aber sogar das alte Leitbild von der ‚Wohlfahrt des Staatsschiffes‘ noch einmal didaktische Hilfestellung leisten. Denn mit dem Siegeszug der politischen Moderne wird das Staatsschiff nicht einfach – wie einst Donoso Cortés (1809-1859) im Gestus eines antimodernistischen Katholizismus ebenso wortgewaltig wie unzutreffend formulierte – zu einem orientierungslos dahintreibenden Boot, „das ziellos auf dem Meer 6 Oswald von Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre, Wien 1980, 34. 7 Ebd., 35 (Herv. i. O.). 8 Ebd. Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? herumgeworfen wird, bepackt mit einer aufrührerischen, ordinären, zwangsweise rekrutierten Mannschaft, die gröhlt und tanzt, bis Gottes Zorn das rebellische Gesindel ins Meer stürzt, damit wieder Schweigen herrsche....“.9 Unter demokratischen Bedingungen ist vielmehr zu erwarten, dass die Crew „nicht nur ‚gröhlt und tanzt‘, sondern sich auch gemeinschaftlich berät, was zu tun sei, nachdem das Vertrauen in Gottes Kursvorgaben und die Autorität eines Kapitäns von Gottes Gnaden geschwunden ist“.10 Und dieses Bild einer inklusiven, demokratisch-deliberativen Gemeinwohlberatung dürfte heute aktueller denn je sein. Für einen leichtfertigen katholischen Verzicht auf die klassische Gemeinwohlformel besteht vor diesem Hintergrund jedenfalls keinerlei Notwendigkeit. II. Solidarität: nicht nur moralische Tugend, sondern auch soziale Tatsache Auch die Kategorie der Solidarität ist gegenwärtig hochgradig umstritten. Thematisiert wird sie heute vor allem in der Debatte über den Aufbau und die Aufgaben, die Ausgestaltung und die Ausmaße des Sozialstaates. Dabei hört man zur Zeit immer wieder die Warnung, dass man die Solidarität nicht zu weit treiben, die Solidaritätsbereitschaften der Bürger nicht überfordern dürfe, so dass es statt um Solidarität eher um die Stärkung der Eigenvorsorge und der Eigenverantwortung gehen müsse. Solidarität wird dabei zumeist als individuelle moralische Tugend, als Bereitschaft der Einzelnen zur Hilfeleistung und Unterstützung für andere verstanden, als ein zartes und verletzliches Gefühl mitmenschlicher Anteilnahme, das man auf keinen Fall überstrapazieren darf. Fragt man aber nach der Herkunft des Wortes ‚Solidarität‘, so fällt auf, dass dieser Begriff mit Moral und Tugendhaftigkeit nichts zu tun hatte; er leitet sich nämlich her vom lateinischen Adjektiv solidus (solide, dicht, fest zusammengefügt), so dass schon der etymologische Befund ein erstes Indiz dafür liefert, dass ‚Solidarität‘ ursprünglich ein weitgehend moral- und tugendfreier Begriff gewesen ist. Als politischer Topos ist ‚Solidarität‘ eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.11 Er stammt aus dem nachrevolutionären Frankreich, aus dem Versuch der laizistischen Republik, jenseits von Kirche und Katholizismus, jenseits überkommener religiöser Werte und Vorstellungen, das Zusammenleben der Staatsbürger frei und gerecht zu organisieren. Der Solidaritätsbegriff greift dabei zurück auf die römische Rechtstradition, auf die so genannte obligatio in solidum, die wechselseitige Bürgschaft, in der sich ein oder mehrere Vertragspartner vertraglich verpflichten, im Zweifelsfalle für die Schulden des oder der jeweils anderen nach dem Motto ‚Einer für alle, alle für einen‘ einzustehen. Als ein politisch-programmatischer Grundbegriff der sozialen Sprache, der die enge Verbundenheit, die wechselseitige Abhängigkeit und das Aufeinander-Angewiesensein der Menschen thematisiert, wurde die ‚Solidarität‘ vor allem durch die Arbeiterbewegung prominent. Die in Restbeständen noch heute anzutreffende Solidaritätskultur der Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts, die nicht selten auch ihre Gaststätten, Gesangsvereine und Schrebergartenkolonien auf den Namen ‚Solidarität‘ taufte, zeugt davon, welche emotionale Wärme und welche politisch-moralische Strahlkraft der Solidaritätsbegriff zu transportieren vermochte und bis heute zu transportieren vermag. Politisch relevant wurde der Topos der Solidarität aber nicht nur hier, sondern auch in der seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstehenden Soziologie, der neuen ‚Wissenschaft von der Gesellschaft‘, wie sie im republikanischen Frankreich vor allem von Auguste Comte (1798-1857) und Émile Durkheim (1858-1917) entwickelt wurde. Comte hat in den 18409 Dieses suggestive Bild des spanischen Gegenrevolutionärs greift 1922 in seiner ‚Politischen Theologie‘ genüsslich auf (Vgl. Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 6. Aufl., Berlin 1993, 639). 10 Ulrich Rödel/Günter Frankenberg/Helmut Dubiel, Die demokratische Frage, Frankfurt 1989, 133. 11 Vgl. zum Folgenden Hermann-Josef Große Kracht, Jenseits von Mitleid und Barmherzigkeit. Zur Karriere solidaristischen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert, in: Karl Gabriel (Hrsg.), Solidarität (Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, 48), Münster 2007, 13-38. 31 32 Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? er Jahren erstmals ohne alle normativen Implikationen von der ‚sozialen Solidarität‘ als einer Kategorie zur Beschreibung der immer dichter werdenden gesellschaftlichen Interdependenzverhältnisse moderner Gesellschaften gesprochen; und mit Durkheims Buch über die Arbeitsteilung aus dem Jahr 1893 sollte die ‚soziale Solidarität‘ dann zu einem festen Topos soziologischer und sozialphilosophischer Theoriebildung in Frankreich avancieren. Solidarität erscheint hier – gleichsam als Synonym zu ‚Verflechtung‘ und ‚Interdependenz‘ – als eine wert- und moralfreie, rein sozialwissenschaftliche Kategorie; und überraschender Weise sollte später auch die katholische Soziallehre den Begriff der Solidarität genau in diesem ‚wertfreien‘, also nicht primär moralisch, sondern vor allem sozialwissenschaftlich-deskriptiv angelegten Sinne übernehmen. Für den jungen Émile Durkheim, den überzeugten Republikaner, der als der eigentliche Gründervater der modernen Soziologie gelten kann, soll die ‚Wissenschaft von der Gesellschaft‘ die Menschen über die ‚sozialen Tatsachen‘ (faits sociaux) aufklären und ihnen das bewusste Leben in der modernen, für viele so bedrohlich erscheinenden Industrie- und Massengesellschaft erleichtern. Die Soziologie sollte dazu beitragen zu erklären, wie ‚soziale Integration‘ funktioniert, wie der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft zustande kommt und warum moderne Gesellschaften, die nicht mehr durch einen von allen geteilten Glauben an Gott und die Gebote seiner Kirche zusammengehalten werden, nicht auseinanderbrechen und in Chaos und Anarchie versinken. Den entscheidenden Grund dafür sieht Durkheim in der ungeheuren Zunahme der Arbeitsteilung, die für moderne Gesellschaften kennzeichnend ist. Die Arbeitsteilung mache die Menschen, wie er sagt, ‚zu gleicher Zeit persönlicher und solidarischer‘, d. h. freier und individueller wie auch unfreier und abhängiger voneinander. Mit zunehmender Arbeitsteilung kommt es zu Prozessen der Individualisierung, Spezialisierung und Professionalisierung, zur massenhaften Ausbildung individueller Persönlichkeiten und zur Entdeckung der Freiheit und Autonomie des modernen Individuums. Es kommt aber auch zu einem bisher unbekannten Reichtum und Wohlstand der Gesellschaft, zur Blüte von Handwerk und Kultur, von Kunst und Literatur, wie schon Adam Smith, der Urvater der modernen Wirtschaftstheorie, am Ende des 18. Jahrhunderts prophezeit hatte. Die Menschen werden also einerseits immer freier und persönlicher. Sie haben in den großen arbeitsteiligen Massengesellschaften die Chance, sich immer mehr voneinander zu unterscheiden, immer spezieller, persönlicher, individueller zu werden, sie haben immer größere Chancen, ihre Talente, Fähigkeiten und Begabungen nicht nur zu entdecken, sondern auch zu entfalten und dauerhaft zu kultivieren. Sie werden im diesem Sinne immer freier, immer autonomer, immer personaler. Zugleich werden sie durch diese arbeitsteiligen Differenzierungsprozesse jedoch auch immer abhängiger voneinander, immer dichter miteinander verbunden, immer mehr aufeinander angewiesen, ob sie wollen oder nicht; und auch unabhängig davon, ob sie dies überhaupt wahrnehmen oder nicht. Diese faktische Abhängigkeitssolidarität der Menschen untereinander nimmt in den modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften immer mehr zu. Wenn Gesellschaften größer, komplexer und leistungsfähiger werden, machen sie ihre Mitglieder in diesem Prozess also zugleich personaler und abhängiger, gewissermaßen im Gleichschritt freier und unfreier. In einer hoch arbeitsteiligen Gesellschaft haben zwar alle zusammen viel mehr Wohlstand und Komfort, viel höhere Freiheits- und Entfaltungsmöglichkeiten, aber keiner lebt mehr für sich alleine, keiner ist mehr unabhängig, keiner kann mehr allein von seiner Scholle, allein von seinen privaten Produktionsmitteln, allein von seiner eigenen Hände Arbeit leben. Vielmehr ist nun – im Zeitalter der ‚großen Industrie‘ – jeder darauf angewiesen, dass er in angemessener Art und Weise an den nun nicht mehr individuell, sondern kollektiv erarbeiteten Gütern partizipieren und so seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und erst dadurch entsteht der ‚moderne Kulturmensch‘, von dem der Soziologe und Wirtschaftshistoriker Werner Sombart vor über 100 Jahren gesprochen hatte. Mit dem modernen Kulturmenschen verhält es sich nämlich völlig anders als mit dem ‚freien Bauern‘ früherer Zeiten. „Der Bauer auf seinem Gute, der sich noch seine gewerblichen Zeugnisse selber schuf, der alles aus dem Boden selber holte, was er für diese gewerbli- Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? chen Produkte an Rohstoffen und was er an Nahrungsmitteln brauchte, das war ein freier Mann, ein wirtschaftlich freier Mann: der moderne Kulturmensch, der nichts mehr selbst produziert von dem, was er braucht, sondern der alles von andern Produzenten erhält dafür, daß er für alle andern eine Ware produziert oder einen Dienst verrichtet, dieser moderne Kulturmensch ist in wachsendem Maße wirtschaftlich unfrei, gebunden.“12 Auf der Grundlage dieser Solidaritätsidee entstand dann im Frankreich der Jahrhundertwende eine sozialpolitisch sehr erfolgreiche Reformbewegung, die nach einem ‚Dritten Weg‘ jenseits von Manchesterliberalismus und Staatskollektivismus Ausschau hielt und sich programmatisch auf das Konzept der Solidarität verpflichtete: die Reformbewegung des solidarisme. Das Stichwort solidarité wurde hier zum zentralen Schlüsselbegriff einer umfassenden Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitik, die das Zeitalter des bürgerlichen Liberalismus überwinden und die große Parole der Französischen Revolution, die Trias von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, auf die veränderten Verhältnisse der modernen Industriegesellschaft umschreiben wollte. Der unumstrittene Anführer der solidaristischen Bewegung im Frankreich der Jahrhundertwende, der Jurist Léon Bourgeois (1851-1925), der zahlreiche sozialpolitische Reformprojekte einleitete. Er brachte die Bedeutung der solidaristischen Philosophie auf die beiden Formeln: „Nous naissons débiteurs! – Der Mensch wird als Schuldner der menschlichen Assoziation geboren.“13 Und: „Die Solidarität ist die primäre Tatsache, sie ist früher als jede soziale Organisation; zugleich ist sie der objektive Seinsgrund der Brüderlichkeit. Mit ihr muß begonnen werden. Solidarität zuerst, dann Gleichheit oder Gerechtigkeit, was in Wahrheit dasselbe ist; und schließlich die Freiheit.“14 Interessant ist nun, dass das katholische Solidaritätsprinzip genau dieselbe Stoßrichtung hat wie die Solidaritätsidee der antiklerikalen Solidaristen im Frankreich der Jahrhundertwende. Der Begründer des katholischen Solidaritätsgedankens, der aus Köln stammende Jesuit Heinrich Pesch (1854-1926), hat sich nämlich deutlich wahrnehmbar von den französischen Solidaritätstheoretikern inspirieren lassen. Er hat den neuen Programmbegriff ‚solidarisme‘ übernommen und als Solidarismus eingedeutscht. In einem groß angelegten, zwischen Sozialphilosophie und Nationalökonomie pendelnden Entwurf hat Pesch versucht, jenseits von Liberalismus und Sozialismus ein „System des Solidarismus“ zu entfalten, das er als einen eigenständigen Ordnungsentwurf für die Organisation des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens in Deutschlands anbieten wollte.15 Zwar war Pesch als katholischer Priester weit davon entfernt, eine rein säkulare oder gar laizistische Sozialphilosophie zu entwickeln. Vielmehr blieb er voll und ganz auf der klassischen Linie des neuscholastischen Naturrechtsdenkens seiner Zeit stehen und verankerte die Solidarität als Seinsprinzip in der von Gott erschaffenen, unveränderlichen Wesensnatur des Menschen und seiner sozialen Ordnungen. Dennoch versteht auch Pesch das Prinzip der Solidarität nicht moralisch, sondern – wie die französischen Soziologen – als Synonym für das soziale Faktum einer unhintergehbaren wechselseitigen Abhängigkeit der Menschen, als – wie sein Schüler Oswald von Nell-Breuning später sagen sollte – ‚Gemeinverstrickung‘, aus der die moralische Forderung nach ‚Gemeinhaftung‘ aller für alle resultiert. Bei Nell-Breuning heißt es an einer klassischen Stelle: „Die Gemeinschaft und ihre Glieder sind in das gleiche Geschick verstrickt (‚wir sitzen alle in einem Boot‘). ... Was die einzelnen tun oder lassen, wirkt – gleichviel, ob gewollt oder nicht – auf die Gemeinschaft. Und was die Gemeinschaft tut oder läßt, das wirkt – wiederum gleichviel, ob bezweckt oder nicht – auf die einzelnen, die Glieder dieser Gemeinschaft sind.“16 12 Werner Sombart, Technik und Wirtschaft. Vortrag gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 16. Februar 1901, Dresden 1901, 9f. 13 Léon Bourgeois, Solidarité, Paris 1896; zit. nach Christian Gülich, Die Durkheim-Schule und der französische Solidarismus, Wiesbaden 1991, 33 14 Léon Bourgeois, Solidarité, Paris 1896, zit. nach François Ewald, Der Vorsorgestaat (L‘État Providence), Frankfurt 1993, 532f. 15 Mit diesem Interesse hat Pesch zwischen 1905 und 1923 ein fünfbändiges, nahezu 4000 Druckseiten umfassendes Lehrbuch der Nationalökonomie vorgelegt, das in den Wirtschaftswissenschaften jedoch kaum rezipiert wurde; vgl. zum Solidarismus Heinrich Peschs jetzt auch die Beiträge in Hermann-Josef Große Kracht/ Tobias Karcher SJ/Christian Spieß (Hrsg.), Das System des Solidarismus. Zur Auseinandersetzung mit dem Werk von Heinrich Pesch SJ (Studien zur Christlichen Gesellschaftsethik, 11), Berlin 2007. 16 Oswald von Nell-Breuning, Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Subsidiarität. Durchgesehene Neuausgabe, Freiburg i. Br. 1990, 17. 33 34 Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? Und wenn in diesem Sinne ‚alle in einem Boot sitzen‘, auch wenn sie in verschiedene Richtungen segeln oder sich mit dem Ruder am liebsten gegenseitig die Köpfe einschlagen wollen, dann ist jeder Einzelne gut beraten, nicht leichtfertig von Bord zu gehen, um fortan in einem ‚Ein-Mann-Schlauchboot‘ frei zu sein und auf stürmischer See eigenverantwortlich seinen individuellen Glück nachzujagen. Ratsamer wäre es nämlich, im Boot zu bleiben und mit allen anderen – mit denen auf dem Sonnendeck ebenso wie denen im Maschinenraum – einen demokratischen Beratungsprozess aufzunehmen und sich darüber zu verständigen, wie man das gemeinsame Boot am besten funktionstüchtig erhält und welcher Kurs in den nächsten Jahren eingeschlagen werden soll, auch wenn einem das mühsame Alltagsgeschäft der Demokratie, die langwierige Suche nach Konsens und Verständigung dabei nicht selten gehörig auf die Nerven geht. III. Subsidiarität: Hilfestellungsgebot und Kompetenzanmaßungsverbot jenseits von Eigenverantwortung und Staatspaternalismus Das Solidaritätsprinzip hat also zunächst einen beschreibenden, deskriptiven Fokus und erst dann auch eine politisch-moralische Dimension. Das Subsidiaritätsprinzip dagegen ist von vorn herein und ausschließlich ein sozialethisch-normatives Prinzip. Es will angeben, wie innerhalb des Solidaritätszusammenhangs sozialer Gemeinschaften die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die Zuständigkeiten und Kompetenzen sinnvoll und sachgerecht zu verteilen sind; und zwar so, dass die Personalität der Menschen und der Eigenwert ihrer kleineren sozialen Gemeinschaften innerhalb des großen gesellschaftlichen Solidarzusammenhangs nicht unter die Räder kommen. Da das Prinzip der Subsidiarität hier in einem eigenen Beitrag behandelt wird, möchte ich mich auf den Hinweis beschränken, dass Subsidiarität auch im katholischen Raum nicht immer konsequent genug als positives Prinzip der Hilfeleistung, als ‚hilfreicher Beistand‘ (Nell-Breuning), sondern nicht selten nur als negatives Prinzip eines reinen Ersatzbehelfs verstanden wird, der erst in wirklichen Notlagen zum Einsatz kommen dürfe. Subsidiarität wäre dann kein echtes Hilfsprinzip, sondern eher ein Prinzip der möglichst weitgehenden Hilfezurückhaltung. So heißt es etwa in dem bisher jüngsten ‚Gemeinsamen Wort‘ der beiden christlichen Kirchen, in der im November 2006 unter dem Titel Demokratie braucht Tugenden erschienenen Stellungnahme zur ‚Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens‘: Von den Bürgern könne und müsse erwartet werden, „dass sie Hilfe, wie es die christliche Sozialethik im Subsidiaritätsprinzip ausformuliert hat, erst dann beanspruchen, wenn sie sich tatsächlich nicht selbst helfen können. Dann allerdings soll sie ihnen auch zur Verfügung stehen“.17 Hier klingt also mittlerweile auch in einem hochrangigen Kirchendokument deutlich die nicht aus dem sozialkatholischen, sondern aus dem individualistisch-liberalen Denken 17 Demokratie braucht Tugenden. Gemeinsames Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens (Gemeinsame Texte, 19), Hannover-Bonn 2006, 21. Nell-Breuning hat gegen derartige Strategien, Subsidiarität nicht als Gebot einer ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘, sondern als Gelegenheit, Selbsthilfe gegen Fremdhilfe in Stellung zu bringen, immer wieder heftig protestiert: „Dann kommt der Unsinn heraus, der Einzelmensch (die Gliedgemeinschaft) müsse sich bis zum letzten, bis zum völligen Zusammenbruch der Kräfte auspumpen, bevor die Gemeinschaft helfend beispringen darf. Zum Beispiel: ein Familienvater könnte bei Aufbietung aller seiner Kräfte eben noch den notdürftigen Unterhalt seiner Familie bestreiten, aber nur um den Preis, daß er niemals sich um Frau und Kinder kümmern könnte. Alsdann müßte die Familie alles, was über den notdürftigen Lebensunterhalt hinausgeht, entbehren: keine Erholung, keine Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben, keine den Anlagen der Kinder entsprechende Ausbildung usw. ... Einen solchen Unsinn wollen einige Leute in das Subsidiaritätsprinzip hineintragen...“ (Nell-Breuning, Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Subsidiarität. Durchgesehene Neuausgabe, Freiburg i. Br. 1990, 84.) Auch Joseph Höffner, der neben Nell-Breuning als der zweite große ‚katholische Soziallehrer‘ in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gelten kann, betonte mit Nachdruck, dass das Prinzip der Subsidiarität ‚Hilfe von oben nach unten‘ fordert, „was zuweilen tendenziös übersehen wird“ (Joseph Höffner, Christliche Gesellschaftslehre (zuerst 1962), Neuauflage, Kevelaer 2000, 60). Große Kracht, Katholische Sozialprinzipien in der Krise? stammende Tendenz an, soziale Hilfe nur ersatz- und behelfsweise zuzugestehen. Die AKSB-Konvention von 1998 wusste dagegen noch, dass es dem katholischen Subsidiaritätsprinzip nicht darum geht, „Hilfe erst dann zu beanspruchen, wenn es gar nicht mehr anders geht“, sondern dass „die übergeordneten Gebilde den untergeordneten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils unterstützend zu Hilfe kommen sollen“ (AKSB-Konvention Nr. 12). Und sie wusste auch noch, dass die Gefahr eines Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip nicht darin liegt, dass Hilfesuchende nach Hilfe suchen, sondern darin, dass die Politik – wie die Enzyklika Quadragesimo anno 1931 vor dem Hintergrund des italienischen Faschismus so klar und eindrücklich formuliert hat – die Belange der Einzelnen sowie der „kleineren und untergeordneten Gemeinwesen“ obrigkeitlich-autoritär zu dominieren versucht, sie also nicht, wie es sein soll, „unterstützen“, sondern „zerschlagen oder aufsaugen“ will (vgl. QA, 79.). Das katholische Subsidiaritätsprinzip sperrt sich also dagegen, die Ideen von Selbsthilfe und Staatshilfe gegeneinander in Stellung zu bringen. Es betont vielmehr den engen Zusammenhang beider und die Notwendigkeit, dass sich alle Staatstätigkeit als eine permanent mitlaufende und dauerhaft unterstützende ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ für die verschiedenen Personen und ihre sozialen Gemeinschaften verstehen lassen muss, wenn sie ihrer Verpflichtung zur Gemeinwohlorientierung und der Tatsache der zunehmenden sozialen Solidarität in den modernen arbeitsteiligen Gesellschaften gerecht werden will. Eine m. E. besonders gut gelungene Beschreibung dieses Zusammenspiels von eigener Verantwortung und subsidiärer Hilfe stammt übrigens schon von Ferdinand Lassalle, der sich 1863 deutlich gegen die auch damals schon grassierende Entgegensetzung von ‚Selbsthilfe‘ und ‚Staatshilfe‘ zu Wehr setzte. In seinem berühmten ‚Offenen Antwortschreiben‘ rief er seine Leser dazu auf, sich „nicht durch das Geschrei derer täuschen und irreführen (zu lassen), die Ihnen sagen werden, daß jede solche Intervention des Staates die soziale Selbsthilfe aufhebe. Es ist nicht wahr, daß ich jemanden hindere, durch seine eigne Kraft einen Turm zu ersteigen, wenn ich ihm Leiter oder Strick dazu reiche. Es ist nicht wahr, daß der Staat die Jugend daran hindert, sich durch eigne Kraft zu bilden, wenn er ihr Lehrer, Schulen und Bibliotheken hält. Es ist nicht wahr, dass ich jemanden hindere, durch eigne Kraft ein Feld zu umackern, wenn ich ihm einen Pflug dazu reiche...“18 18 Ferdinand Lassalle, Offenes Antwortschreiben an das Central Comité zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen Arbeiter-Congresses zu Leipzig 1863 (Sozialökonomische Texte, 9), hg. von August Skalweit. Frankfurt/M. 1948, 71. 35 36 Günter Wilhelms, Subsidiarität Prof. Dr. Günter Wilhelms Subsidiarität Prof. Dr. Günter Wilhelms, geboren 1958 in Borgentreich/Westfalen, seit September 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Gesellschaftslehre an der Theologischen Fakultät Paderborn, von Oktober 2005 bis Oktober 2007 Rektor der Theologischen Fakultät in Paderborn. Ausgangspunkt der nun folgenden Überlegungen ist die Beobachtung eines eklatanten Selbstwiderspruchs im modernen Verständnis vom Menschen: Die überall behauptete Selbstzwecklichkeit und Autonomie des Menschen stellt in der politischen und gesellschaftlichen Realität keine mehr dar. Je mehr der Anspruch auf Selbstverwirklichung betont wird, umso mehr geraten die vielfältigen Abhängigkeiten, gerade im Zuge wissenschaftlich-technischer und politisch-ökonomischer Instrumentalisierung, ins Bewusstsein. Und die in den Medien zu hörenden Stimmen moralischer Empörung scheinen diesen Widerspruch nur noch einmal zu bestätigen; sind sie nicht ein Ausdruck eher wachsender Ohnmacht der Menschen angesichts der eingespielten rationalen Mechanismen von Markt und Staat? Ist es nicht so, dass Glauben, Moral, überhaupt die Unmittelbarkeit von Wertbezügen nicht mehr imstande sind, adäquate Reaktionen auf reale Problemlagen zu strukturieren, gerade weil sich die moderne Gesellschaft so verändert hat, dass der Einzelne mit seinem sittlichen Bewusstsein grundsätzlich die falsche Ebene ist, wenn es um die Gestaltung der Gesellschaft geht, einer Gesellschaft, die durch hohe Komplexität und Differenziertheit gekennzeichnet ist? Was hat diese, zugegeben, recht grobe Diagnose moderner Gesellschaft mit dem hier zu diskutierenden Begriff der Subsidiarität zu tun? Soviel kann an dieser Stelle vorweggenommen werden: Sehr viel, weil die Subsidiarität ein Prinzip bezeichnet, das den wesentlichen Wert der Gesellschaft für den Menschen zum Ausdruck bringen will und zwar mit Blick auf ihre Ordnung, ihre institutionelle Seite. Es bezeichnet ein formales Strukturprinzip, das den inneren Aufbau der Gesellschaft bestimmt. Es bezeichnet die Rahmenbedingungen, ohne die eine solidarische Verbundenheit der Gesellschaft insgesamt und ihrer Glieder untereinander nicht möglich wäre. Es kennzeichnet eine Gesellschaft, die eben nicht nach mechanischen Regeln funktioniert, sondern sittlich integriert ist.1 I. Subsidiarität in der lehramtlichen Verkündigung Was heißt eigentlich Subsidiarität? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir zunächst auf den bis heute gültigen Referenztext, die von Papst Pius XI. 1931 verfasste Enzyklika „Quadragesimo anno“. Was aber nicht heißen soll, dass das Prinzip als „katholisches“ vereinnahmt werden soll, zu lang ist seine Vorgeschichte, man denke etwa an die vielzitierten Namen Althusius und Lincoln, zu vielfältig sein Gebrauch. In Quadragesimo anno heißt es in Nr. 79: „Wenn es nämlich auch zutrifft, was ja die Geschichte deutlich bestätigt, daß unter den veränderten Verhältnissen manche Aufgaben, die früher leicht von kleineren Gemeinwesen geleistet wurden, nur mehr von großen bewältigt werden können, so muß doch allzeit unverrückbar jener höchst gewichtige sozialphilosophische Grundsatz festgehalten werden, an dem nicht zu rütteln noch zu deuteln ist: wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch 1 Mit den Worten einer „Strukturenethik“: Die Institutionen müssen sich daran bemessen lassen, „wieweit sie ihm (dem Menschen (G. W.) zu sittlich fundierter humaner Entfaltung seines Daseins verhelfen.“ Das bedeutet, „das Individuum in allen Formen seiner Vergesellschaftung als Subjekt ernst zu nehmen und präsent zu halten.“ (W. Korff: Institutionstheorie: die sittliche Struktur gesellschaftlicher Lebensformen, in: A. Hertz u. a. (Hg.): Handbuch der christlichen Ethik, Bd. 1. Freiburg 1993, 168-176, 173. Günter Wilhelms, Subsidiarität zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.“ 2 Es geht, wie schon eingangs angedeutet, um die Gesellschaft und ihre Ordnung; und es geht um den Menschen, den Einzelnen als gesellschaftliches Wesen. Wie kann er seine sittliche Identität als Person entfalten und welche Rolle spielen dabei die gesellschaftlichen Institutionen und Ordnungen, das ist die Frage. Dabei ist zu beachten, dass der Text von Anfang an und bis heute auf eklatante Weise missdeutet und fehlinterpretiert worden ist und zwar vor allem in individualistischer Manier. Viele kennen nur den Namen, so beklagte sich etwa Nell-Breuning, und hören das Eigenschaftswort „subsidiär“ heraus, „das in unserem Sprachgebrauch so viel bedeutet wie ersatzweise, als Behelf, wenn es nicht anders geht, als Notbehelf, nach dem man greift, wenn man nichts Besseres zur Verfügung hat.“3 Das bedeutet dann angewandt auf das Subsidiaritätsprinzip: es wolle „die Staatstätigkeit und überhaupt die Wirksamkeit aller öffentlichen Institutionen soviel wie möglich einschränken, auf das unvermeidliche Mindestmaß zurückdrängen“.4 Eine solch extrem individualistische Interpretation hat mit dem klassischen Wortlaut nichts gemeinsam. Der Einzelne ist auf die Gesellschaft angewiesen, so wie die Gesellschaft auf den Einzelnen angewiesen ist. Anders gesagt: Wenn die Gesellschaft ihre ureigene Aufgabe erfüllen will, nämlich den Einzelnen zu unterstützen, kann sie das nur, wenn sie so organisiert ist, dass sie ihm Verantwortung zutraut. Wobei eben nur dem einzelnen Menschen eine unverrückbare Würde zukommt und deshalb der Gesellschaft eine Dienstfunktion, die allerdings unverzichtbar ist. Dem Subsidiaritätsprinzip liegt also ein ganz bestimmtes Bild vom Menschen zugrunde: Der Mensch ist ein mit einer persönlichen Würde und mit Freiheit ausgestattetes Geschöpf. Er ist zugleich verflochten in seine konkrete und geschichtliche Wirklichkeit. Er ist sich selbst aufgegeben, er kann, soll und will seine Persönlichkeit entfalten, und zwar vermittels der Gesellschaft. Anders gesagt: Die Gesellschaft ist die „Verlängerung der Personen in Raum und Zeit“5, analog dem Leib-Seele-Verhältnis. Sie ist eine „Ordnungseinheit tätiger Menschen“.6 Papst Johannes XXIII hat in Mater et magistra Nr. 219 den „obersten Grundsatz“ der katholischen Soziallehre entsprechend definiert: der Mensch ist „Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen (…). Und zwar der Mensch, sofern er von Natur aus auf Mit-Sein angelegt (…).” Der Mensch ist Subjekt, aktiv, niemals nur Objekt, nur das, was andere aus ihm machen. Deshalb ist alles das für ihn hilfreich, was es ihm erlaubt, sich als Subjekt zu betätigen und sich dadurch zu entfalten. Zwar macht jede Hilfe den Bedürftigen per definitionem zum Objekt. Aber der „Sinn dieser Maßnahmen darf kein anderer sein, als dem hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, wieder weniger Objekt und mehr Subjekt zu sein. Das besagt: die Hilfsmaßnahmen haben es darauf abzulegen, dem Hilfsbedürftigen soviel Gelegenheit wie möglich zu bieten, zu seiner Befreiung aus der Not durch eigenes Tun mitzuwirken, sollen Hilfe zur Selbsthilfe sein.“7 Die Gemeinschaft hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Glieder bestehen können, etwas unternehmen können, der einzelne sich entfalten kann. Man denke in diesem Zusammenhang auch an die Idee der Menschenrechte, die von Freiheitsrechten und politischen Gestaltungsrechten, aber auch von Sozialrechten spricht. Die Rechte werden dem Einzelnen nicht vom Staat verliehen, er hat sie „von sich aus“. Und die Idee der Freiheit, die in der Menschenrechtsidee impliziert ist, ist immer eine konkrete, die die materiellen Voraussetzungen der Freiheits- und Gestaltungsrechte, also ihre vielfältigen Vermittlungen, einschließt. 2 Pius XI: Quadragesimo anno, in: AAS 23 (1931) 177-228, 203, zit. nach: Texte zur katholischen Soziallehre. Die sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente, hrsg. vom Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands – KAB. Kevelaer 8. Aufl. 1992, 90f. 3 0. von Nell-Breuning: Subsidiarität – ein katholisches Prinzip? in: F. Hengsbach (Hg.): 0. von Nell-Breunning: Den Kapitalismus umbiegen. Schriften zu Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Lesebuch. Düsseldorf 1990, 349-370, 350. 4 Ebd. 5 E. Link: Das Subsidiaritätsprinzip. Sein Wesen und seine Bedeutung für die Sozialethik. Freiburg 1955, 91. 6 Ebd., 112. 7 O. von Nell-Breuning: Subsidiarität, a. a. O., 352. 37 38 Günter Wilhelms, Subsidiarität Es geht also um das Verhältnis Einzelner – Gesellschaft, und es geht um Hilfeleistung. So findet sich in Quadragesimo anno auch eine ganz bestimmte Vorstellung von gesellschaftlicher Ordnung, die als Ausfaltung der Idee der Subsidiarität interpretiert werden kann: das Modell „berufsständischer Ordnung“, später weniger missverständlich „leistungsgemeinschaftliche Ordnung“ genannt. Worum geht es? Die französische Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 wurde sowohl durch das „personale Motiv der am Leistungsprinzip orientierten individuellen Entfaltungsfreiheit“ als auch durch das „transpersonale Motiv (…) der Ausschaltung der die Artikulation des Gemeinwohls gefährdenden Gruppeninteressen aus dem Prozeß der politischen Willensbildung“8 auf den Weg gebracht. Dieses fundamentale Nivellierungsinteresse der Revolutionäre traf damit die alte berufsständische Ordnung im Kern. Gegen diese „Nivellierungsinteressen“ organisierte sich eine vor allem konservativ geprägte Bewegung, die in der sogenannten politischen Romantik das „Unbehagen über den Verlust einer (…) Lebensmitte“9 zum Ausdruck bringen wollte. Der Kerngedanke ist die „ständische Mediatisierung des Individuums“10, die gesellschaftliche Vermittlung des Einzelnen. „Leistungsgemeinschaften in diesem Sinne (im Sinne von Quadragesimo anno, G. W.) wären Körperschaften, in denen alle an einer bestimmten sozialen Leistung beteiligten Menschen zusammengeschlossen sind, gleich, ob sie als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, in leitender oder bloß ausführender Tätigkeit beteiligt sind. Die Leistungsgemeinschaften sind für das Individuum frei wählbar (…). Das dem Gemeinwohl dienende Verhalten der verschiedenen Leistungsgemeinschaften soll durch ihre ethische Einstellung und durch die ausgleichende Tätigkeit des Staates bewirkt werden (…).“11 Wenn man sich vor Pauschaldiskreditierungen hütet12, kann man in dieser Ordnungsvorstellung ein beachtenswertes Modell entdecken, das zwischen Individuum und Staat „intermediäre Institutionen“ schaffen wollte, „die dem Antagonismus der Klassengesellschaft die Spitze nehmen und als gesellschaftliche Selbstregulierungsinstanzen den Staat entlasten sollten.“13 Nachdem das Prinzip geraume Zeit in den lehramtlichen Texten kaum noch, und wenn, nur am Rande, Erwähnung gefunden hat, rückt es, wenigstens der Intention nach, im Gemeinsamen Wort der beiden deutschen Kirchen von 1997 „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“14 in die Position eines Leitgedankens. Er lautet: Dass die Kirchen vornehmlich den Staat in die Pflicht nehmen wollen bei der Lösung der drängenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme, ist nicht neu. Aber auch die gesamte Gesellschaft in ihren vielfältigen und vielgestaltigen Organisationsformen — das ist neu. Die Zukunft in „Solidarität und Gerechtigkeit” erwarten die Kirchen nicht zuletzt von diesen gesellschaftlichen Potentialen. Das bedeutet dreierlei: 1. Die vielfältigen gesellschaftlichen Akteure sind mitverantwortlich für die Gestaltung des Ganzen. 2. Es gilt, die Möglichkeiten zur Stärkung „zivilgesellschaftlicher” Solidaritätspoteniale zu entdecken und zu fördern, von einer „neuen Sozialkultur” (Nr. 221) ist die Rede. 3. Die Partizipationsmöglichkeiten und Beteiligungschancen gerade für die Armen, Schwachen und Benachteiligten sind zu erhöhen. Dabei stößt vor allem die aktuell zu beobachtende Forcierung der Marktkräfte bei den Kirchen auf Kritik. Dass Solidarität und Gerechtigkeit heute keine „unangefochtene Wertschätzung” mehr genießen, hat nicht zuletzt damit zu tun, dass viele fälschlich glauben, „ein Ausgleich der Interessen stelle sich in der freien Marktwirtschaft von selbst ein” 8 P.C. Mayer-Tasch: Korporativismus und Autoritarismus. Eine Studie zu Theorie und Praxis der berufsständischen Rechts- und Staatsidee. Frankfurt 1971, 9. 9 Ebd., 11. 10 Ebd., 13. 11 Sie regeln „das berufliche Aus- und Fortbildungswesen, die Erziehung zum Berufsethos, die Überwachung echten Leistungswettbewerbs, der Kartellgesetzgebung, Sozialversicherung, freiwillige Alters- und Krankenversicherung (…)“ und vieles mehr. (N. Monzel: Die katholische Kirche in der Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. von T. Herweg/K.H. Grenner. München 1980, 273f.) 12 Vgl. etwa T. Rendtorff: Subsidiaritätsprinzip oder Gemeinwohlpluralismus? in: ZEE (1993) 91-93. 13 A. Baumgartner: „Jede Gesellschaftstätigkeit ist ihrem Wesen nach subsidiär.“ Zur anthropologischen und theologischen Begründung der Subsidiarität, in: Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit. Zur Reichweit eines Prinzips in Deutschland und Europa, hrsg. von K. W. Nörr/Th. Oppermann. Tübingen 1997, 13-22, 17. 14 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, hrsg. vom Kirchenamt der Ev. Kirche in Dt. und vom Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz. (Gemeinsame Texte 9). Bonn 1997. Günter Wilhelms, Subsidiarität (Nr. 2). Das Gegenteil scheint richtig: Auf diese Weise wird der Egoismus gefördert, strukturell wie individuell. Auf der anderen Seite schwindet das „Vertrauen in die demokratische Gestaltbarkeit der Gesellschaft” (Nr. 53) — weil sich die Politik scheinbar nur noch um sich selbst kümmert und weil sie ihre Gestaltungskompetenz immer mehr abgibt, Beispiel Globalisierung, die immer mehr den Charakter einer Naturgewalt annimmt. Demgegenüber favorisiert das Gemeinsame Wort ein anderes Modell von Gesellschaft: Für die gesellschaftliche Wohlfahrt werden, neben Staat und Markt, gesellschaftliche Gruppen und Institutionen immer wichtiger, die einen „eigenständigen Beitrag” (Nr. 156) leisten. Das Papier spricht von einer neuen Besinnung auf die „Sozialkultur” und meint damit „soziale Netzwerke und Dienste, lokale Beschäftigungsinitiativen, ehrenamtliches Engagement und Selbsthilfegruppen” (Nr. 221 u. 12). Alle diese Formen ergänzen, vermitteln und fördern gleichsam die zwei anderen Ebenen von Moral in der Gesellschaft: die Rahmenordnung mit dem Recht als Medium und die individuelle Moral. Deshalb kann man sie als Ausdruck subsidiärer Gesellschaft verstehen. Und diese Formen bieten neue Möglichkeiten, sich an der gesellschaftspolitischen Debatte zu beteiligen. In diesem Sinne will das Papier alle Versuche, auf Sachzwänge zu verweisen, als ideologieverdächtig entlarven. Die Probleme sind in die politische Debatte hineinzuholen. Das heißt den Legitimationszwang zu erhöhen, wenn Benachteiligungen herrschen. II. Ordnung in der modernen Gesellschaft? Die Vorstellungen des Gemeinsamen Wortes von einer neuen Sozialkultur werden allerdings erst verständlich, wenn man ein bestimmtes zentrales Ordnungsproblem ins Auge fasst: Wie ist Gestaltung, wie ist Steuerung in modernen Gesellschaften denkbar? Aus der Sicht moderner Gesellschaftsanalysen hat die Frage nach der gesellschaftlichen Ordnung eine typisch neue Form angenommen: In den primitiven Gesellschaften war sie in den Sitten und Gebräuchen und Ritualen eingelassen und verdankte ihre unbefragte Selbstverständlichkeit nicht zuletzt den engen sozialen Bindungen der Gruppenmitglieder. Dann übernahm die hierarchische Zuordnung von Kirche und Staat oder Staat und Gesellschaft die Ordnungsfunktion: die Kirche bzw. der Staat definierte die gesellschaftlichen Ziele und setzte sie durch. Heute, das heißt in komplexen, entwickelten Gesellschaften, können Ziele wie Gerechtigkeit, Abrüstung, Frieden „nicht mehr schlicht beschlossen und verwirklicht werden, weil Störfaktoren, Gegenbewegungen, Eigendynamiken, Überreaktionen, unbeabsichtigte Nebenfolgen etc. um so wahrscheinlicher sind, je differenzierter und komplexer eine Gesellschaft ist.“15 „Nicht nur Großstädte, Bildungssysteme, Versicherungssysteme, technologische oder militärische Großorganisationen scheinen mit wachsender Komplexität weniger regierbar und steuerbar zu werden; inzwischen wird dies immer häufiger von ganzen Gesellschaften behauptet.“16 Was also zunächst als ein rein theoretisches Problem erscheint, die Steuerung der Gesellschaft, erweist sich bei näherem Hinsehen als konkret und folgenreich und ethisch hoch relevant. Diese Entwicklung hat die soziologische Systemtheorie wie keine andere begrifflich auf die Spitze getrieben. So charakterisiert Niklas Luhmann „die Moderne“ als eine funktional differenzierte Gesellschaft. Das bedeutet, dass die moderne Gesellschaft als Ganzes aus „ungleichartigen, aber gleichrangigen Teilen“ zusammengesetzt ist. Luhmann denkt dabei vor allem an Wirtschaft, Politik, Recht, Militär, Wissenschaft, Kunst, Religion, Massenmedien, Erziehung, Gesundheitswesen, Sport, Familie und Intimbeziehungen.17 „Alle Teilsysteme leisten aufgrund ihrer funktionalen Spezialisierung einen andern Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Reproduktion. Gleichrangig sind sie für Luhmann deshalb, weil 15 H. Willke: Systemtheorie entwickelter Gesellschaften. Dynamik und Riskanz moderner gesellschaftlicher Selbstorganisation. 2. Aufl. Weinheim 1993, 69 16 H. Willke: Systemtheorie. Eine Einführung in die Grundprobleme der Theoriesozialer Systeme. 3. Aufl. Stuttgart 1991, 59. 17 Vgl. U. Schimank: Ökologische Gefährdungen, Anspruchsinflationen und Exklusionsverkettungen — Niklas Luhmanns Beobachtungen der Folgeprobleme funktionaler Differenzierung, in: Ders./U. Volkmann (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen I. Opladen 2000, 125-142, 126. 39 40 Günter Wilhelms, Subsidiarität alle gleichermaßen unverzichtbar für die Reproduktion der modernen Gesellschaft sind und auch keines dabei durch ein anderes ersetzt werden kann. Die Wirtschaft dürfte genauso wenig ausfallen wie die Massenmedien oder das Gesundheitswesen (...).“18 Die klassische Vorstellung von funktionaler Differenzierung, etwa bei Durkheim oder auch Parsons, fasst diese noch als gesamtgesellschaftliche Arbeitsteilung auf. Jedes Teilsystem trägt das Seine zum Erhalt des Ganzen bei, wie der Arbeiter am Fließband. Die Koordination der einzelnen Beiträge geschieht bei Luhmann gerade nicht nach einem irgendwie gearteten Plan, sondern eher zufällig, evolutiv.19 Die Entstehung der modernen Gesellschaft ist nicht nach dem Muster der Arbeitsteilung zu verstehen, „sondern als spannungsreiches Neben- und Gegeneinander.“20 „Was z.B. wirtschaftlich nützlich ist, ist nicht unbedingt auch politisch opportun oder künstlerisch wertvoll.“21 Jedes Teilsystem tendiert zur Selbstverabsolutierung und zur entsprechenden Gleichgültigkeit gegenüber den Belangen anderer Systeme. Oftmals gerät so ein und dasselbe soziale Ereignis unter den Zugriff divergierender Sachlogiken: „Das Kunstwerk kostet Geld oder ist darüber hinaus politisch anstößig, und politische Machtkalküle durchkreuzen wirtschaftliche Investitionspläne.“22 Die Gesellschaft zerfällt regelrecht in die Vielfalt der möglichen Perspektiven, aus denen ein soziales Ereignis beobachtet werden kann. „Ein Zugunglück beispielsweise lässt sich nicht der alleinigen Zuständigkeit eines bestimmten Teilsystems zuordnen, um so gleichsam unsichtbar, nämlich bedeutungslos — im doppelten Sinne des Wortes — für die übrigen Teilsysteme zu bleiben. Sondern das Zugunglück stellt sich als rechtliches, wirtschaftliches, politisches, massenmediales, wissenschaftlich-technisches, medizinisches, gegebenenfalls auch militärisches, pädagogisches oder künstlerisches Geschehen dar — und jedes Mal ganz anders!“23 Wie muss man diese Entwicklung beurteilen angesichts der Tatsache, dass die „Rücksichtslosigkeit“ der Bereiche als eine wesentliche Ursache der aktuellen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Korruption und Egoismus, auch „Nebenfolgen“ sachrationalen Handelns genannt, erscheint? Der Soziologe Ulrich Beck glaubt nicht, dass die ausdifferenzierten Mechanismen ihre Nebenfolgen noch intern verrechnen können. Den einzelnen „egoistischen” Rationalitäten gelingt es nicht mehr, so seine These, von den selbstproduzierten Nebenfolgen noch einmal zu profitieren, indem man sich, als Spezialist, für die Pathologie allein zuständig erklärt. Gleichwohl nötigen die Nebenfolgen systemischen Handelns die Sachrationalitäten zum „Umdenken”, so interpretiert Beck weiter. „Was nicht reflektiert wird, summiert sich zu dem Strukturbruch.“24 Das heißt dieser Strukturbruch zwingt die Systeme dazu, reflexiv zu werden, die möglichen Folgen ihres Handelns besser zu kalkulieren. Und in diesem Augenblick bekommen Demokratisierung und Moralisierung wieder eine Chance, weil die geschlossenen Systeme aufbrechen, „flüssig” werden, gestaltbar werden. Der Verantwortlichkeit des einzelnen und einzelner Organisationen und Initiativen werden wieder Entfaltungsmöglichkeiten eingeräumt. Alle ausdifferenzierten Systeme bekommen die Möglichkeit, sich neu zu organisieren. Das klingt zunächst ganz anders als bei Luhmann, für den die Risikokommunikation den Effekt hat, die Teilsysteme noch mehr gegeneinander abzuschließen. Aber in welche Zukunft eine solche reflexive Moderne geht, ist auch für Beck noch einmal völlig offen. Sie kann „Weiterentwicklung oder Gegenmoderne zur Folge haben: Neofaschismus oder ökologische Demokratie; Ökodiktatur, Gewalt, Fundamentalismus oder eine Weiterentwicklung von Demokratie und Aufklärung über die Verkrustungen und Bornierungen der Industriezivilisation hinweg.“ 25 18 Ebd. 19 Allerdings wollte Durkheim nicht einem Automatismus vertrauen. Es sollten vielmehr Regelsysteme entwickelt werden, zum Beispiel in Form von Korporationen, die das soziale Band fördern und garantieren, vgl. G. Wilhelms: Die Ordnung moderner Gesellschaft. Gesellschaftstheorie und christliche Sozialethik im Dialog, Stuttgart 1996, 50 und vgl. die Idee der leistungsgemeinschaftlichen Ordnung, s. o. 20 U. Schimank: Niklas Luhmann, a. a. O., 127. 21 Ebd. 22 Ebd. 23 Ebd., 128. 24 U. Beck: Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. Frankfurt 1993, 71f, kursiv: G. W. 25 Ebd. 64. Günter Wilhelms, Subsidiarität Bei den Nebenfolgen, den Verselbständigungstendenzen, setzen auch moderne Demokratietheorien an. Anonymisierung und funktionale Differenzierung bedeuten nämlich einen Verlust an Partizipationsmöglichkeiten. Und sie suchen nach einem Gegengewicht gegenüber diesen undemokratischen Tendenzen und finden es in vielfältigen Formen und Assoziationen partizipatorischer Demokratie.26 Was bei der Systemtheorie, aber auch bei Beck noch von einem eher evolutiv gedachten (sich selbst bewusst werdenden) gesamtgesellschaftlichen Prozess erwartet wird, sich hinter dem Rücken der (ursprünglich verantwortlichen) Akteure durchsetzend, wird nun in den rechtsstaatlichen, demokratischen Prozess eingeordnet. Die Folgen mangelnder Systemintegration werden, so Habermas gegen Luhmann, gerade vor dem „lebensgeschichtlichen Hintergrund verletzter Interessen und bedrohter Identitäten” als lösungsbedürftig erfahren. Nicht zuletzt deshalb bleiben für Politik und Recht zentrale integrative Aufgaben — auch und gerade in einer hochkomplexen, funktional ausdifferenzierten und anonymen Gesellschaft. Sie bleiben, weil Politik und Recht „zur Lebenswelt hin geöffnet” sind. Sie können ihrerseits nicht als geschlossene Systeme begriffen werden, weil sie die „unterhalb der Differenzierungsschwelle der Spezialkodes (…) gesellschaftsweit zirkulierende Umgangssprache” gerade für die Behandlung gesamtgesellschaftlicher Probleme nutzen und also eine Integration „an der kommunikativen Macht des Staatsbürgerpublikums vorbei”, systempaternalistisch, nicht sinnvoll abgewickelt werden kann.27 Auch der Diskurs von Experten muss mit dem demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozess rückgekoppelt werden, wenn Integration durch Legitimation gelingen soll. Außerdem zeichnet, so Habermas, die Systemtheorie ein sehr einseitiges Bild von der Gesellschaft, so als bestünde sie ausschließlich aus selbstreferentiell geschlossenen Systemen. Als ein solches im engen Sinne kann er nur die kapitalistische Wirtschaft verstehen und vielleicht noch die öffentliche Administration.28 Wie dem auch sei: Lassen sich die verschiedenen Perspektiven vermitteln? Kann man die Einsichten der Systemtheorie mit denen der Demokratietheorie so in Verbindung bringen, dass auf der einen Seite die Problemanalyse nicht „unterkomplex“ gerät und auf der anderen Seite die Idee von einer humanen, von den Menschen zu verantwortenden Gesellschaft nicht verloren geht? Mit Ulrich Beck hatten wir von einer „Verflüssigung“ der gesellschaftlichen Systeme gesprochen, von einem „Reflexivwerden“ angesichts der drängenden Probleme. In eine ähnliche Richtung denkt auch ein anderer Systemtheoretiker, Helmut Willke, der, anders als Luhmann, für den fürs Überleben der Gesellschaft eine Koevolution der Sachbereiche genügt, von vermittelnden Instanzen spricht. „In der Praxis entwickelter Gesellschaften haben sich systemische Diskurse (kursiv: G. W.) (in Form von Verhandlungssystemen, konzertierten Aktionen, sozialökonomischen Räten, Bildungsrat, Wissenschaftsrat, tripartistischen Kommissionen und ähnlichen) an Brennpunkten sozietaler Konflikte herausgebildet. Inzwischen rücken entsprechende Diskurssysteme auch auf regionaler und kommunaler Ebene — z. B. im Bereich der Sozialpolitik oder der Berufsbildung — ins Blickfeld (...). Wesentlich ist, daß es nicht den einen übergreifenden Systemdiskurs gibt, sondern entsprechend der föderalen und polyzentrischen Struktur moderner Gesellschaften eine Vielzahl dezentraler Diskurse. Wichtiger noch: Das Funktionieren dieser Diskurse hängt nicht an einer vorgegebenen übergreifenden Idee des Ganzen von Gesellschaft, präsupponiert nicht eine einheitliche Identität oder Subjektivität von Gesellschaft. Es gibt keine zentrale Instanz, welche die Richtung sozietaler Steuerung angeben oder kontrollieren könnte. Die Kontrolle der Richtung der Steuerung erfolgt im Zusammenspiel der betroffenen autonomen Akteure; sie ist deshalb notwendig dezentral und zurückverlagert in die Prozesse der Reflexion und Abstimmung eigenständiger Funktionssysteme.“29 Und abschließend stellt er fest: „(...) überzogene Ansprüche an Kontrolle, Beherrschbarkeit, Machtausübung und Steuerung von Gesellschaften” sind zu reduzieren. „Zugleich macht diese Perspektive deutlich, daß bloßes Durchwursteln nicht mehr ausreicht. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte genau 26 Vgl. etwa R. Dahl: On Democracy. New Haven/London 1998. Vgl. dazu M.G. Schmidt: Demokratietheorien. Ein Einführung. 3. Aufl. Opladen 2000, bes. 251ff. 27 J. Habermas: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt 1992, 426f. Zur Kritik an der Systemtheorie vgl. ebd., 399-467, bes. 420ff. 28 Vgl. ebd., 427f. 29 H. Willke: Systemtheorie entwickelter Gesellschaften, a. a. O., 139. 41 42 Günter Wilhelms, Subsidiarität darin liegen, die Fähigkeiten naturwüchsiger Evolution zu verknüpfen mit dem Anspruch, der aus der Besonderheit psychischer und sozialer Systeme folgt: die Fähigkeiten zu dezentraler Selbstorganisation zu stärken und sie auf das Ziel einer Zivilisierung auszurichten, welches auch und gerade die Moderne noch längst nicht erreicht hat.“30 Was Willke höchstens andeutet, ist der normative Orientierungspunkt. Zwar macht er auf die Unzulänglichkeit des rein funktionalen Aspektes aufmerksam. Aber es bedarf des bürgerschaftlichen Engagements, es bedarf der vielfältigen Aktionen „vor Ort”, die dem einzelnen das Gefühl geben, das es (noch) gesellschaftliche Bereiche gibt, die er mitgestalten kann. Es gilt das individuelle sittliche Subjekt zu retten. Nur so kann beispielsweise das fatale Bild der (Partei)Politik, nämlich sich auf Talk spezialisiert zu haben (Luhmann), korrigiert werden und sie dadurch ihre Handlungsfähigkeit Stück für Stück zurückgewinnen. Auch das Wirtschaftssystem braucht Einrichtungen, die die möglichen Folgen von Entscheidungen für die Umwelt, für die Menschen in den Unternehmensprozess integrieren (Beispiel Umweltbeauftragte, Datenschutzbeauftragte u. a.), braucht handlungsrelevante Leitbilder, die die Verantwortung des einzelnen auf allen Ebenen einbeziehen wollen. Nur so kann sie wieder rückeingebunden werden in den gesellschaftlichen Diskurs und die Sorge ums Gemeinwohl. Und es braucht ein Medium, „über das sich die aus einfachen Interaktionen und naturwüchsigen Solidarverhältnissen bekannten Strukturen gegenseitiger Anerkennung in abstrakter, aber bindender Form auf die komplexen und zunehmend anonymen Handlungsbereiche einer funktional differenzierten Gesellschaft übertragen lassen.“31 Das ist die bleibende Aufgabe der Institutionen des Rechtsstaats. Die soziologische Systemtheorie hat die Frage der gesellschaftlichen Ordnung ohne Rückgriff aufs sittliche Subjekt, auf den Einzelnen, in den Blick genommen. Zugleich hat sie allerdings Strukturen und Institutionalisierungen beschrieben, die, so die These, mit den normativen Perspektiven moderner Demokratietheorie verbunden werden können. Mehr noch: Die „Reflexivität“ der Systeme ist ohne das sittliche Subjekt nicht denkbar, weil sie, wie gesehen, eine Infragestellung der Sachlogiken bedeutet. In dem Augenblick, in dem die Sachgesetzlichkeiten „verflüssigt“ werden, bekommt der „ganze“ Mensch wieder eine Chance mitzugestalten. Mit dieser Perspektive wäre das Eingangsszenario eingeholt und eine Möglichkeit angedeutet, so etwas wie eine moderne subsidiäre Gesellschaft zu bestimmen. Anders gesagt: Mit dieser Perspektive wäre die klassische Idee der Subsidiarität mit Hilfe moderner Gesellschaftsanalyse lebensweltlich verortet. Darüber hinaus fordert das sozialethische Interesse, so eine weitere These, institutionelle Arrangements zu beschreiben, die dieser gesellschaftlichen Dynamik gleichsam entgegenkommen. Es reicht nicht, sich auf evolutiv verbrämte, individualistisch oder funktionalistisch gedachte Entwicklungen zu verlassen. Ein erster Hinweis steckt in der Idee intermediärer Mechanismen oder systemischer Diskurse. Damit sind wir auch wieder bei den Vorschlägen des Gemeinsamen Wortes und den Stichwörtern „Zivilgesellschaft“ und „neue Sozialkultur“. Wobei diese sozialen Phänomene nicht überfordert werden dürfen, das sei ausdrücklich angemerkt in Richtung einer berechtigten Kritik an solchen Positionen, die die Zivilgesellschaft zum neuen gesellschaftlichen Steuerungszentrum stilisieren wollen: Sie treten nicht an die Stelle des Staates, sie sind keine Expertengremien. Sie können vielmehr nur indirekt einwirken auf die Funktionssysteme, sie können als Katalysatoren für sozialen Wandel wirken und gesellschaftliche Selbststeuerungspotentiale entfalten.32 Sie sind aufeinander verwiesen… III. „Neue“ Subsidiarität? In dieses Szenario soll sich der Subsidiaritätsgedanke einfügen? Wenn wir das annehmen, haben wir dann nicht stillschweigend die Idee der Subsidiarität uminterpretiert und ausgeweitet? Ging es nicht ursprünglich um eine rein institutionelle Frage, also um die 30 Ebd., 140. 31 J. Habermas: Faktizität und Geltung, a. a. O., 387. 32 Vgl. G. Kneer: Zivilgesellschaft, in: Soziologische Gesellschaftsbegriffe. Konzepte moderner Zeitdiagnosen. München 1997, 228-251, 245ff. Günter Wilhelms, Subsidiarität Frage der hierarchischen Gliederung der verschiedenen gesellschaftlichen Sachbereiche? So hat etwa Nell-Breuning darauf hingewiesen, dass man für die Anwendbarkeit des Prinzips darauf achten muss, ob es sich um ein Verhältnis von Ganzem und Glied handelt. „Im Verhältnis von Ortsgruppe zu Kreisverband, von Kreisverband zu Landesverband, von Landesverband zu etwa bestehendem noch höherem, übergeordnetem Verband ist dieses Verhältnis gegeben (...); ebenso im Verhältnis von Fachverband zu Gesamtverband (Fachverband Textil zu Gesamtverband Industrie, Einzelgewerkschaft zu Gewerkschaftsbund); nicht anwendbar ist es auf Sozialgebilde verschiedener Zielsetzung, am allerwenigsten, wenn die Ziele nicht nur verschieden, sondern gegensätzlich sind.”33 Dagegen macht Koslowski zu Recht darauf aufmerksam, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht nur auf die Zuständigkeitsverteilung innerhalb eines Ganzen anzuwenden ist, sondern über die institutionelle Ebene hinausgeht und Fragen der „Funktionsverteilung und –koordination zwischen Subsystemen und Kultursachbereichen“ miteinbezieht.34 Koslowski will damit eine Interpretation im Sinne „linearer Subsidiarität“, nur in eine „Richtung“ zielend, oder im Sinne einer „aufhebenden Abfolge“, abwehren und sie vor allem als Kooperationsprinzip verstanden wissen. Staat und Markt sollen ihr Versagen in der Erfüllung der eigenen Funktion wechselseitig kompensieren.35 Diese Erweiterung der „klassischen“ Interpretation von Subsidiarität, die sich auf die institutionelle Ebene konzentriert, um die funktionale Perspektive, findet ihren Anhalt bei näherem Hinsehen schon in Quadragesimo anno. Insofern man mit der Enzyklika als die eigentliche Funktion der Gesellschaft ihren Dienst an der Vervollkommnungsmöglichkeit des Menschen bestimmen muss und der Text vor allem die Erosion intermediärer Gesellschaftsformen beklagt36, erweitern sich die Anwendungsbedingungen in dem normativen Sinn, dass intermediäre Gesellschaftsformen zu stärken und gegebenenfalls neu zu etablieren sind.37 Was bedeutete das anderes als die streng hierarchische Gliederung als Anwendungsbedingung des Prinzips zu relativieren? Der Einzelne gibt den letzten Bezugspunkt, nicht die Gemeinschaft, ganz gleich ob „oben“ oder „unten“. Eine solche „Funktionalisierung“ bringt das Subsidiaritätsprinzip in Verbindung mit der zentralen Kritik an eingespielten Sachrationalitäten, hier vor allem Marktmechanismen und Verwaltungsformen, die den Einzelnen außen vor lassen, und der Kritik an fremdbestimmten Lebensräumen (s. o.); und bringt es ebenso in Verbindung mit einer Liberalismuskritik, wie sie etwa der Kommunitarismus betrieben hat. Hierher gehört alles, was in der Debatte über die Bürger- oder Zivilgesellschaft zusammengetragen worden ist. Nur so ist die Subisidiarität zu verbinden mit dem zentralen Ordnungsproblem moderner Gesellschaft, der Steuerung unter Bedingungen funktionaler Differenzierung. Ihre Integration, also die wechselseitige Rücksichtnahme der funktionalen Bereiche, bedarf des individuellen Subjekts, um die Systeme reflexiv werden zu lassen; diese wiederum bedürfen der institutionellen Unterstützung durch vielfältige intermediäre Mechanismen und zivilgesellschaftliche Engagementformen, aber auch der Rechtsordnung und der Politik – denn Integration bedarf auch der Legitimation. Wenn man nun noch einmal die steuerungstheoretische Problematik mit Hilfe des Subsidiaritätsbegriffs zusammenfassend rekonstruieren möchte, kann man zwei sozialethische Funktionen des Begriffs unterscheiden: Dann wird das Subsidiaritätsprinzip (1) zum kritischen, normativen Maßstab für ganz bestimmte Folgen der Ausdifferenzierung, insbesondere für die Selbstgenügsamkeit und tendenzielle Ignoranz gesellschaftlicher Teilsysteme gegenüber der jeweiligen „Umwelt” — gegenüber den jeweils anderen Teilsystemen und vor allem gegenüber Person und Natur. Dann muss es aus ethischer Sicht das Ziel sein, die Abspaltung des aktiven, individuellen Subjekts von den Teilrationalitäten 33 Ebd., 356f. 34 P. Koslowski: Subsidiarität als Prinzip der Koordination der Gesellschaft, in: Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, a. a. O., 39-48, 46. 35 Vgl. ebd., 44. 36 „In Auswirkung des individualistischen Geistes ist es so weit gekommen, daß das einst blühend und reich gegliedert in einer Fülle verschiedenartiger Vergemeinschaftungen entfaltete menschliche Gesellschaftsleben derart zerschlagen und nahezu ertötet wurde, bis schließlich fast nur noch die Einzelmenschen und der Staat übrigblieben – zum nicht geringen Schaden für den Staat selber.“ (Quadragesimo anno Nr. 78) 37 Vgl. O. Höffe: Subsidiarität als staatsphilosophisches Prinzip, in: Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, a. a. O., 49- 67, 55. 43 44 Günter Wilhelms, Subsidiarität partiell rückgängig zu machen, Subjekt und System zu vermitteln, ohne gleichzeitig ihre Spannung völlig aufzulösen — das wäre nämlich das Ende der Differenzierungsdynamik, die die moderne Gesellschaft trägt und die weitgehend ohne den Einzelnen funktioniert.38 Auf der anderen Seite — aus (2) „konstruktiver” und „systemlogischer” Sicht — vermag gerade die Einbindung der Verantwortung des Einzelnen die Selbstreflexionsfähigkeit der Systeme — das heißt die möglichen Folgen eigenen Handelns für andere — zu erhöhen. Der Einzelne ist eben nie nur Teil einer bestimmten Systemlogik, nur Rolle, sondern immer auch eingebunden in eine konkrete Lebenswelt mit ihrer Umgangssprachlichkeit. Das ist notwendig, weil die Krisenlagen moderner Gesellschaften als nichtintendierte Folgen sachlogischen Handelns interpretiert werden können. D. h. die kommunikative Schließung der Systeme führt dazu, dass die Folgen systemischen Handelns durch das System selbst kaum mehr wahrgenommen werden können. Beide Perspektiven, kritisch normative und konstruktive, systemlogische, führen zu ganz ähnlichen Konsequenzen, nämlich der Forderung, organisatorische Arrangements zu entwickeln, die den Prozess der Ausdifferenzierung unterbrechen, indem sie Verantwortung möglich machen! Es geht darum, konkrete Vermittlungen zu suchen, die das individuelle Subjekt im System zum Zuge kommen lassen. Diese Vermittlungsstellen hätten, ganz allgemein gesagt, die Aufgabe, die Systeme zur Legitimation zu zwingen.39 Sie hätten die Aufgabe, den Subjekten Möglichkeitsbedingungen anzubieten für die Übernahme von Verantwortung. Je größer, komplexer, differenzierter, folgelastiger die gesellschaftlichen Gebilde werden, umso wichtiger sind vermittelnde Instanzen, die den Einzelnen die Chance einräumen, an der Willensbildung „unmittelbarer” beteiligt zu sein! Und solche Instanzen erhöhen wiederum die Chance, die Teilrationalitäten jeweils zu unterbrechen. Nur so ist die persönliche Verantwortung zu retten. Nicht dadurch, dass ihre Nichtexistenz zur Bedingung gesellschaftlicher Ordnung gemacht wird, um ihre faktische Labilität und Beschränktheit zu kompensieren — die „Minima moralia“ moderner Gesellschaften finden sich nicht schon und ausschließlich in den moralfreien, evolutiven Steuerungserfordernissen der wichtigsten Subsysteme —, sondern dadurch, dass Strukturen entwickelt werden, die die funktionalen Erfordernisse mit persönlichem Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln gestatten. Noch einmal anders gesagt und formelhaft zusammengefasst: Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft wird mit dem Subsidiaritätsbegriff nach dem Prinzip des „hilfreichen Beistandes“ bestimmt. Diese Bestimmung hat ihren Grund im christlichen Menschenbild. Die entsprechenden Institutionalisierungen müssen wiederum unter drei zentralen Aspekten beurteilt werden: 1. Freiheit, im Sinne gesellschaftlicher Vermittlung der Entfaltung des Individuums; 2. Institutionalisierung, im Sinne der kooperativen Zuordnung der Bereiche; 3. Funktionalität, im Sinne von Kompetenz und Effizienz. IV. Sozialstaat und Bildungsreform Zum Abschluss sollen in aller Kürze zwei Problemfelder hervorgehoben werden, an denen der mögliche Beitrag der Subsidiaritätsidee konkret gemacht werden kann: Sozialstaat und Bildung. Dabei geht es nicht darum, diese Themenbereiche umfassend zu diskutieren; vielmehr sollen mit Hilfe des Subsidiaritätsbegriffs einige Akzente gesetzt werden, die für die aktuelle politische Debatte von Bedeutung sein können. Angesichts der Tatsache, dass wir unseren Sozialstaat nur mit Mühe finanzieren können, sind Subsidiaritätsvorstellungen zunächst naheliegend und erleben eine neue Konjunk38 Bezüglich der Funktion der Kompetenzabgrenzung weißt Höffe darauf hin dass das Subsidiaritätsprinzip eine Entzauberung vornimmt, „die über die respektlose Diagnose von Systemtheoretikern noch hinausreicht. Daß der Staat weder allein noch primär zuständig ist, ohnehin seine Fähigkeiten überschätzt, erkennt das Subsidiaritätsprinzip an; zusätzlich kritisiert es noch das Überschreiten seiner Befugnisse. Dort geht es lediglich um Grenzen des staatlichen Könnens, hier zusätzlich um Grenzen des staatlichen Dürfens.” (0. Höffe: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung. München 1999, 128f.). 39 Hierher gehört auch die Frage nach der Demokratisierung der gesellschaftlichen Bereiche, vgl. etwa U. Beck: Die Erfindung, a. a. O., bes. die Kap. V ff. Günter Wilhelms, Subsidiarität tur – man denke an seine Bedeutung für die Gestaltung der deutschen Sozialgesetzgebung nach dem letzten Krieg. Heute geht es nicht mehr, anders als damals, um das Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern, sondern um das Verhältnis „kleiner sozialer Netzwerke und selbstorganisierter Initiativen zu den etablierten Institutionen der Sozial- und Jugendhilfe, zu denen auch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege gezählt werden.“40 Es geht also um die „Instandsetzung gesellschaftlicher Teilglieder für die Hilfe zur Selbsthilfe“; und das politische Ziel ist die „Demokratisierung lokaler Sozialpolitik“ und die „Erhöhung der Partizipationsmöglichkeiten Betroffener“.41 Der Gedanke der Selbsthilfe ist nicht nur bedeutsam für die Umverteilung sozialer Verantwortung, sondern darüber hinaus für ein humanes Gesicht des Sozialstaats. Aber, ganz im Sinne des oben Festgestellten, bleiben die Grenzen der Selbsthilfe und der funktionale Aspekt deutlich im Blick. „Das Subsidiaritätsprinzip entlastet zwar den Staat von sozialen Aufgaben, die von der Gesellschaft oder dem Einzelnen gelöst werden können. Es tut dies jedoch mit dem Ziel, ihn zur Ausübung seiner koordinierenden und stimulierenden Funktion in der Sozialpolitik sowie seiner sozialpolitischen Gesamtverantwortung zu befähigen.“42 Das Prinzip wird also nicht mehr als Plädoyer für eine „prinzipielle Vorrangstellung“ der Verbände verstanden, sondern für ein „neue Balance zwischen den verschiedenen Typen von Eigenhilfe und Fremdhilfe.“ Und die Aufgabe der Verbände sollte in Zukunft nicht zuletzt darin bestehen, „Voraussetzungen für die Stabilisierung sich neu herausbildender autonomer (Selbst-) Hilfepotentiale zu schaffen.“43 Aus evangelischer Sicht hat Ursula Schoen mit Hilfe des Subsidiaritätsprinzips drei Forderungen an die Diakonie formuliert, die in gleicher Weise auch für die Caritas gelten.44 1. Der Mensch und die Erhaltung seiner Würde ist der Maßstab diakonischen Handelns. „Diese Forderung gewinnt angesichts zunehmender Spezialisierungs- und Zentralisierungstendenzen mehr und mehr an Bedeutung.“45 Daraus ergibt sich der Vorrang einer „gemeinwesen- und gemeindebezogenen Diakonie vor überregionaler, spezialisierter und lebensweltbezogener Diakonie.“46 2. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt eine „Partnerschaft“ von Diakonie oder Caritas mit den gesellschaftlichen Kräften, „die dem Einzelnen am nächsten stehen“.47 Das sind Familienangehörige, Selbsthilfegruppen u. ä. Diese Forderung läuft der gängigen Orientierung kirchlicher Sozialdienste „nach oben“, zu den politischen Institutionen, eher entgegen. 3. Das bedeutet aber nun nicht, dass die „höheren“ Organisationen und der Staat aus ihrer Verantwortung zu entlassen wären. Für den Staat bleibt die Verantwortung für die Rahmenbedingungen, die verantwortliches Handeln ermöglichen. Ähnliches gilt für die Aufgabe der Experten.48 Insgesamt gilt, dass persönliche Freiheit und Selbstorganisation der Lebenswelt, im Sinne individueller Autonomie und „partizipatorischer Planungsbeteiligung“, als generell „höherrangig“ begriffen werden müssen gegenüber verwalteten, fremdbestimmten Lebensräumen. Wobei immer daran zu denken ist, dass die „Höherrangigkeit“ Maß nehmen muss an ihrer Funktion; der entscheidende Maßstab aller Gemeinschaft und aller Gesellschaft ist der „homo singularis“, jeder einzelne Mensch. Diese Forderung lässt sich auch auf das Thema Bildung anwenden. Auch hier sollen einige Hinweise genügen. Die aktuelle Bildungsdebatte in unserem Lande ist geprägt von Institutionalisierungsfragen. Reformieren, Strukturieren, Modularisieren, Profilieren, Vergleichen und Wettbewerb sind nur einige Stichworte, die deutlich machen können, dass auch hier die grundlegende Ordnungsfrage nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gestellt werden muss. Was ist eigentlich das Ziel der aktuellen Reformbemühungen? Wettbewerbsvorteile zu sichern, Anpassung an veränderte gesellschaftliche Bedingungen (Globalisierung) organisieren? Oder aber Bildung der Persönlichkeit 40 41 42 43 44 45 46 47 48 U. Schoen: Subsidiarität, a. a. O., 224. Ebd. 225. Ebd., 226. Ebd. Unter Rückgriff auf die sogen. Bratislava-Erklärung von 1994. Ebd., 231. Ebd., 232. Ebd. Dieser Hinweis findet sich nicht bei Schoen. 45 46 Günter Wilhelms, Subsidiarität und Beteiligung aller an den Bildungsgütern? Wie soll man sich die Hilfe der Gesellschaft vorstellen? Auch wenn es überholt klingen mag und für manche „erledigt“ scheint, so sind doch das als klassisch bezeichnete Bildungsverständnis des deutschen Humanismus und die Reformen Humboldts erhellend für die heutige Situation. Damals war der Ausgangspunkt der Erwägungen über Bildung die Analyse der Zeitsituation. „Von Herder über Schiller und Hölderlin bis zu Fichte und Pestalozzi werden die entmenschlichenden Tendenzen eindringlich hervorgehoben.“49 Der Mensch wird, so die damaligen Überlegungen, im Zuge der Industrialisierung und Technisierung, dem Beginn dessen, was oben als Prozess funktionaler Differenzierung beschrieben wurde, zu einem Fragment, zu einer Maschine, die für beliebige Zwecke verfügbar ist. Die notwendige Antwort lag und liegt auch heute in der Rückbesinnung auf das, was der Mensch ist und sein soll. Zweck von Bildung ist und muss sein der Mensch selbst. Deshalb ist Bildung nur als Selbstbildung denkbar. Jede vorzeitige Inanspruchnahme durch äußere Zwecke lässt Bildung in diesem Sinne erst gar nicht aufkommen. Gleichwohl bedarf die Bildung der Welt und der Gesellschaft. Das, was wir auch Kultur im weiteren Sinne nennen, regt den Bildungsprozess an, gibt ihm Orientierung und Halt. Aber nicht allen Weltbezügen kommt eine solche bildende Funktion zu. „Folglich gilt es, sie so einzurichten, daß sie die Bildung des Individuums fördern. Also müssen jene die Weltbezüge vorgängig normierenden Mächte so umgestaltet werden, daß sie der Selbst-Bildung des Menschen Raum geben.“50 Der Humanismus sah vor allem Staat, Religion und Erziehung als solche Mächte an. Bildung ist „Ausdruck für den Vorgang der Aneignung von Welt und der Entwicklung der Person“51, so heißt es auch programmatisch in der neueren Bildungs-Denkschrift der evangelischen Kirche Deutschlands. An dem Beispiel Bildung kann man sehr gut zeigen, dass die als subsidiär zu qualifizierende Unterstützung von Seiten der Gesellschaft und von Seiten des Staates die Autonomie eines Sachbereiches zunächst achten und schützen muss, damit er seine Effizienz entfalten kann. Weil es in der Bildung um den „ganzen“ Menschen geht, seine Lebensgeschichte und die wesentlichen Weisen seiner Welterfahrung, um die Begegnung mit kognitiver, moralisch-evaluativer, ästhetisch-expressiver und religiös-konstitutiver Rationalität52, deshalb ist sie in ihrer Art von „Aneignung von Welt“ vor vorschnellen und einseitigen Indienstnahmen von außen zu schützen. Aus dieser Perspektive kann dann auch das problematische Verhältnis von Bildung und Wirtschaft anders gesehen werden. Der Bericht der bayrisch-sächsischen Zukunftskommission von 1997 hat es so ausgedrückt: „Das politisch zu gestaltende Bildungsparadox lautet: Die konsequente Orientierung am wohlverstandenen Bedarf der Wirtschaft führt zu einer Wiederbelebung Humboldtscher Bildungsideale. Die Zukunft gehört den sattelfest spezialisierten Generalisten.“53 Aber es gibt noch einen anderen Aspekt in der aktuellen Bildungsdebatte, auf den mit dem Subsidiaritätsprinzip aufmerksam gemacht werden kann, nämlich dass die sogenannte informelle Bildung, die Alltagsbildung, die Bildung in der Familie, im Sport- oder Musikverein, einen unersetzlichen Wert haben. Die Forderung, diese Bereiche zu unterstützen gründet schon in ihrer Personnähe, gründet aber auch in ihrer Spannung zu organisierter, verwalteter, verzweckter Bildung. Allerdings gilt auch hier die „Metaregel“54, nämlich die Pflicht der höheren Einheiten, Verantwortung zu übernehmen, wenn etwa die Familie ihre Aufgabe nicht erfüllen kann, nämlich die individuelle Autonomie und angemessene Beteiligung aller Betroffenen zu fördern. Von dieser Notwendigkeit der Kompensation ist die aktuelle politische Debatte geprägt, man denke etwa an das Thema 49 C. Menze: Art. Bildung, in: Staatslexikon der Görres-Gesellschaft. Freiburg, 7. Aufl. 1995, Bd. 1, Sp. 783796, 785. 50 Ebd., 786. 51 Maße des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gütersloh 2003, 12. 52 Vgl. K. E. Nipkow: Zur Bildungspolitik der evangelischen Kirche. Eine historisch-systematische Studie, in: P. Biehl/Ders.: Bildung und Bildungspolitik in theologischer Perspektive. Münster 2003, 153-252, 221. 53 Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen: Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Entwicklungen, Ursachen und Maßnahmen, Teil III: Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungslage. Bonn 1997, 44f. 54 Vgl. O. Höffe: Subisidarität: Über den Dienst der Gemeinschaft am Individuum, in: Synthesis Philosophica 26 (1998) 595-605, 605 Günter Wilhelms, Subsidiarität Ganztagsbetreuung. Aber Kompensationen sind immer erst der zweite Schritt! Zunächst hat der Staat alles zu unternehmen, um die Familien zu stärken. D. h. Familie und Staat gegeneinander auszuspielen ist der falsche Ansatz; es muss vielmehr um Kooperationen gehen, um Vernetzungen von Vereinen, Familien und Schulen etwa. Solche Strukturen hätten auch den Sinn, einseitige Leistungsorientierung, die mit der Schule automatisch verbunden ist, in Frage zu stellen und „Übernützliches“ (Th. Mann) in den Bildungsprozess einzubringen, in einen Prozess, der bei uns zunehmend nach ökonomischen Kriterien organisiert werden soll: immer schneller, vergleichbarer, profilierter… 47 48 Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung Prof. Dr. Joachim Wiemeyer Die Bedeutung außerschulischer politischer Bildung in der christlichen Sozialethik Einleitung Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, seit 1998 Professor für Christliche Gesellschaftslehre in Bochum, von 20002006 Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Professoren für Christliche Sozialethik in Deutschland. Erwachsenenbildung hatte für die christlich-soziale Bewegung in Deutschland in der Geschichte eine hohe Bedeutung. Der Katholizismus wies damit eigene Initiativen als Alternative zu Arbeiterbildungsvereinen liberaler und sozialistischer Provenienz sowie zur Volkshochschulbewegung auf. Die Bildungsanstrengungen im sozialen Katholizismus erstreckten sich auf die breite Mitgliederschaft der katholischen Verbände sowie auf die spezielle Schulung von Führungspersonen, der geistlichen Präsides wie der Vorstandsmitglieder von Vereinen und Gewerkschaften, die teilweise auch in der Zentrumspartei vor 1933 politische Ämter und Mandaten übernahmen. Diese Ausbildung der Führungskräfte organisierte vor allem der Volksverein für das katholische Deutschland.1 Nach der Unterbrechung durch den Nationalsozialismus nahm 1945 das christlich-sozialethische Bildungswesen einen neuen Aufschwung, wurde doch nach den Erfahrungen der Diktatur eine Wertorientierung auf der Basis der Katholischen Soziallehre als Grundlage für eine gesellschaftliche Erneuerung angesehen. Die sozialen Seminare, die Gründung vieler katholisch-sozialer Akademien etc. zeugen von diesen Bemühungen. Angesichts kriegsbedingter Bildungslücken und der Orientierungssuche nach der NSZeit stießen diese Angebote auf verbreitetes Interesse. Im kritischen Rückblick muss man aber sagen, dass die Soziallehre der Kirche für den gesellschaftlichen Neuaufbau keine hinreichende Grundlage gab, da die ständestaatlichen Vorstellungen von Quadragesimo anno weder ein hinreichendes Verständnis für eine dynamische Marktwirtschaft auswiesen noch vorbehaltlos zu einer parlamentarischen Demokratie passten. Ebenso wenig konnte sich die Kirche in den 50-er Jahren vorbehaltlos den Menschenrechten öffnen. Trotzdem hat die christlich-sozialethische Bildung dazu beigetragen, dass sich die deutschen Katholiken mit großer Mehrheit mit der Ordnung des Grundgesetzes und der sozialen Marktwirtschaft identifizieren konnten. Die Nachfrage nach christlich-sozialen Bildungsinhalten ging in der Folgezeit erheblich zurück, was sich z. B. an der klassischen Form der sozialen Seminare2 ablesen ließ. Ursachen dafür waren: • ein höherer Stand schulischer Bildung, vor allem auch in der politischen Bildung, so dass weniger Nachholbedarf bestand; • Entwicklung der christlichen Gesellschaftslehre, die sich für etwa 20 Jahre nach dem Konzil in einer wissenschaftlichen Stagnation3 befand.4 Damit entstand Raum für Konzeptionen, die das Verhältnis von Kirche und Welt neu vermessen wollten wie die politische Theologie oder die Theologie der Befreiung. Um diese Ansätze ist es mittlerweile wieder sehr still geworden. Ebenso verunsicherte der im Konzil anerkannte legitime Pluralismus (Gaudium et spes Nr.43) unter Katholiken; 1 Vgl. Emil Ritter, Die katholisch-soziale Bewegung Deutschlands im 19. Jahrhundert und der Volksverein, Köln 1954. 2 Vgl. Das Soziale Seminar, Leutersdorf 1976 u. Das Soziale Seminar. Bibliographie, Leutersdorf 1978. Der Vfs. hat Anfang der 80er Jahre mehrfach mehrere Reihen als nebenamtlicher Dozent im Bistum Münster geleitet. 3 Vgl. Joachim Wiemeyer, Giovanni Battista Montini/ Paul VI. und die Christliche Soziallehre in Deutschland, in: Hermann-Josef Pottmeyer (Hrsg.) Paul VI. und Deutschland, Brescia 2006, S. 45-60. 4 Es ist daher vermutlich kein Zufall, dass in der Informationsschrift „Das soziale Seminar“ jahrelang kein Professor für Christliche Sozialethik als Autor vertreten war. Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung • Abnahme weltanschaulicher Konflikte mit Protestanten, Liberalen und der Sozialdemokratie; • die Verbreitung des Fernsehens und anderer Medien als Informationsquelle. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich ein katholisches Milieu als Ort christlich-sozialer Bildung schrittweise aufgelöst hat und eine Reihe von Einrichtungen christlich-sozialethischer Bildungsarbeit ihre Tätigkeit eingestellt haben oder durch die Abkehr von im engeren Sinne christlich-sozialethischer Bildungsarbeit ihren Aufgabenbereich neudefiniert haben. Es stellt sich daher die Frage, welche Aufgabe christlich-sozialethische Bildungsarbeit, die von ihrer Intention immer auch politische Bildungsarbeit ist, heute haben kann. Dazu ist im ersten Schritt das Verhältnis der drei Träger der Soziallehre der Kirche5 – der kirchlichen Sozialverkündigung, der wissenschaftlichen Reflexion in der christlichen Sozialethik und dem Praxisengagement der Gläubigen – zu behandeln und ihre Beziehungen zur christlich-sozialen Bildungsarbeit aufzuzeigen. I. Soziallehre der Kirche und politische Bildung Im 19. Jahrhundert ging das soziale Engagement der Kirche aus der Sensibilität von Gläubigen, einfachen Klerikern, den von ihren Gegnern als „rote Kapläne“6 bezeichneten Seelsorgern, hervor. Diese vielfältigen Initiativen der kirchlichen Basis wurden 1891 vom kirchlichen Lehramt mit der Enzyklika „Rerum novarum“ Papst Leo XIII. durch die Etablierung einer kirchenoffiziellen Sozialverkündigung aufgegriffen und gebündelt. 1893 erfolgte dann mit der Errichtung des ersten Lehrstuhls für christliche Gesellschaftslehre an der Universität Münster und seiner Besetzung mit Franz Hitze die wissenschaftliche Reflexion. Im Laufe der Entwicklung sollte dieses Verhältnis „Initiative der kirchlichen Basis“, Bündelung und Bestärkung durch das Lehramt und dann erst Ausfaltung durch die wissenschaftliche Reflexion umgekehrt werden. Es setzte sich das hierarchische Verständnis der Kirche durch, so dass die kirchenoffizielle Verkündigung wie die Sozialenzykliken, aber auch die Weihnachtsansprachen Papst Pius XII. die grundlegende Richtung vorgaben. Anschließend wurden im Sinne eines Verständnisses der christlichen Gesellschaftslehre als „Exegese päpstlicher Dokumente“ durch die Wissenschaft die gesamtkirchlichen Impulse auf die konkrete Situation eines Landes hin ausgelegt und konkretisiert. Da einige Sozialethiker wie Oswald von Nell-Breuning oder Gustav Gundlach „Ghostwriter“ päpstlicher Verlautbarungen waren, konnten sie ihre eigenen Vorlagen für kirchenamtliche Dokumente interpretieren. Im Sinne dieses hierarchischen Modells hatten die Laien, die in der gesellschaftlichen Praxis engagierten Christen, nur noch die Aufgabe die Soziallehre umzusetzen. Aufgabe christlich-sozialer Bildungsarbeit war es lediglich, die Verkündigung des päpstlichen Lehramtes und der wissenschaftlichen Reflexion zu vermitteln. Sie sollten wie ein Katechismuswissen7 gelernt werden. Nach dem Konzil, vor allem beeinflusst durch das apostolische Schreiben Papst Pauls VI. Octogesima adveniens von 1971, hat sich das Verhältnis der drei Träger der Soziallehre der Kirche gewandelt. Es kam zur Entwicklung einer lokalen Sozialverkündigung (Octogesima adveniens Nr. 4), für die etwa die Friedens- und Wirtschaftshirtenbriefe der US-amerikanischen Bischöfe stehen, ebenso das deutsche ökumenische Wirtschaftsund Sozialwort “Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“.8 Diese Dokumente wurden in einem Dialogprozess innerhalb der Kirchen mit anderen gesellschaftlichen 5 Vgl. Andreas Lienkamp, Christliche Sozialethik, in: Karl-Wilhelm Dahm, Franz Furger u. a. (Hrsg.) Christliche Sozialethik, S. 29-88, bes. 37-42. 6 Vgl. Heinz Budde, Handbuch der christlich sozialen Bewegung, Recklinghausen 1967, S. 242f. 7 Vgl. Eberhard Welty, Herders Sozialkatechismus, 3 Bde. Freiburg 1951-1958. 8 Vgl. Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, eingeleitet und kommentiert von Marianne Heimbach-Steins und Andreas Lienkamp, München 1997. 49 50 Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung Gruppen (Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgebern) und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen erarbeitet. An diesem Prozess hatten kirchliche Bildungseinrichtungen erheblichen Anteil. Der Konsultationsprozess macht ein verändertes Verhältnis der drei Träger der Soziallehre der Kirche deutlich.9 Das Lehramt hört bewusst auf das, was ihm die engagierten Christen, die kirchliche „Basis“, sagen wollen. Umstritten ist hier, ob dieses dialogische Verfahren grundsätzliche ekklesiologische Bedeutung hat oder ob das Verfahren sich auf sozialethische Fragestellungen zu begrenzen hat, weil erstens hier in der Weltverantwortung primär Aufgaben der Laien liegen und zweitens Gesellschaftsgestaltung sozialwissenschaftliches Fachwissen voraussetzt, das nicht primär bei kirchlichen Amtsträgern zu finden ist. Aufgabe der wissenschaftlichen Sozialethik ist es, auf den Stand der Wissenschaften, auf dem Niveau der zeitgenössischen Sozialphilosophie und Sozialwissenschaften christliche Wertvorstellungen zu formulieren und den Kenntnisstand der profanen Wissenschaften für den binnenkirchlichen Diskurs fruchtbar zu machen. Sie hat dabei nach außen in die Gesellschaft hinein die christlich-sozialethischen Wertvorstellungen in profaner Hinsicht argumentativ zu verbreiten, aber im binnenkirchlichen Diskurs den Anschluss an die biblische Überlieferung und die christliche Tradition zu vermitteln. Dabei steht die christliche Sozialethik auch in Beziehung zur gesellschaftlichen Praxis der Gläubigen, indem sie deren Praxisengagement reflektiert und begleitet, deren Fragen und Probleme aufgreift, aber auch von der Basis Anstöße bekommt.10 Da Konsultationsprozesse als wechselseitige Lernprozesse von Lehramt, wissenschaftlicher Sozialethik und den gesellschaftlich engagierten Christen systematisch angelegt sind, ist eine christlich-sozialethische Bildungsarbeit in solche Prozesse involviert, nicht nur, weil sie in der Regel den Ort dieser Konsultationen darstellt, sondern auch inhaltliche Anstöße gibt, wie solche Lernprozesse aufbereitet werden. Welche Bedeutung hat christlich-soziale Bildungsarbeit für das neue Verständnis der Soziallehre der Kirche? Zwar wird die kirchliche Sozialverkündigung auch durch Verkündigung im Gottesdienst, in den kirchlichen Medien, Zeitschriften und Büchern, durch die Programmdiskussion in kirchlichen Verbänden, durch Diskussionen in Arbeitskreisen „Mission, Entwicklung, Frieden“, das Internet und andere binnenkirchlichen Vermittlungsformen verbreitet. Ebenso gibt es in die Gesellschaft hinein Vermittlungsformen wie die allgemeinen Medien, Dialoge mit Parteien und Verbänden, institutionalisierte Vertretungen der Kirche wie katholische Büros etc. Nachhaltige Lernprozesse, die über eine oberflächliche Wahrnehmung hinausgehen und konkrete Anstöße zum Handeln geben, sollten aber vor allem durch Bildungsanstrengungen zum Tragen kommen. In der Erarbeitung der kirchlichen Sozialverkündigung ist man häufig schon dann zufrieden, wenn man sich endlich auf ein Dokument geeinigt hat und man es auf einer Pressekonferenz vorgestellt hat. Auch beim Wirtschafts- und Sozialwort ist eine systematische Umsetzungsstrategie nicht vorhanden gewesen. Deshalb konnte Kardinal Lehmann beklagen, dass das Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage „totgelobt“ worden sei. Für eine solche Umsetzung ist eine christliche sozialethische Bildungsarbeit ein wesentlicher Akteur, der daher bereits bei der Erarbeitung eine systematische Stimme haben sollte. Hat christlich-soziale Bildungsarbeit für die Soziallehre der Kirche eine weitere Bedeutung? Christlich-sozialethische Bildungsarbeit greift die jeweiligen Fragen und Herausforderungen der Zeit auf. Dabei wird man in der Bildungsarbeit folgende Erfahrungen machen: • Zu drängenden Fragen und Herausforderungen findet man gar keine ausführlichen und fundierten Aussagen der kirchlichen Sozialverkündigung. So gibt es zu Fragen der Globalisierung und weltweiter Umweltprobleme bisher keine gesamtkirchlichen Dokumente der Sozialverkündigung. 9 Vgl. Judith Wolf, Kirche im Dialog. Sozialethische Herausforderungen der Ekklesiologie im Spiegel des Konsultationsprozesses der Kirchen in Deutschland (1994 - 1997) Münster 2002. 10 Vgl. Joachim Wiemeyer, Christliche Sozialethik und weltwirtschaftliche Gerechtigkeit, Münster 1998. Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung • Zu einigen Fragen und Bereichen, man nehme etwa die Ausführungen des Sozialkompendiums11 zur Gentechnik, findet man sehr allgemeine und wenig konkrete Aussagen, die daher unbefriedigend bleibend. • Aussagen der kirchlichen Sozialverkündigung stoßen auf Desinteresse, auf Abwehr bzw. Ablehnung (z. B. kirchliche Stellungnahmen zu Migrationsfragen). Christlich-sozialethische Bildungsarbeit hat daher die Aufgabe, Themen, Inhalte und Fragen an die kirchliche Sozialverkündigung wie die wissenschaftliche Sozialethik heranzutragen und damit Impulse zur Weiterentwicklung der Sozialverkündigung wie der wissenschaftlichen Sozialethik anzustoßen. Es ist daher zu fragen, wie dies systematisch angegangen und institutionalisiert werden kann. Einen Anknüpfungspunkt gibt es darin, dass ein Direktor einer katholischen Akademie12 Berater der Kommission VI für gesellschaftliche und soziale Fragen der Bischofskonferenz ist. Ebenso stellt sich die Frage, wie die Verbindung von wissenschaftlicher Sozialethik und christlich-sozialer Bildungsarbeit in dem genannten Sinne intensiviert werden könnte. II. Politische Bildung aus christlich-sozialethischer Sicht 1. Der Bedarf an politischer Bildung Grundfunktionen politischer Bildung sind Sachwissen über politische Abläufe, Institutionen und Prozesse zu vermitteln, eine eigenständige Urteilsfähigkeit des Einzelnen zu fördern und zum politischen Handeln, zur Wahrnahme politischer Rechte (Wahlrecht, Demonstrationsrecht) etc. und zur Übernahme politischer Verantwortung (Mitgliedschaft in Parteien, Verbänden, Bürgerinitiativen einschließlich von Vorstandspositionen und Mandaten) zu ermuntern.13 Politische Bildung kann dabei nicht wertfrei erfolgen. Sie ist immer wertgebunden. Dabei hat sich im Kontext des Grundgesetzes politische Bildung in öffentlicher Verantwortung (Schulen) sowie mit öffentlicher Förderung auf der Wertgrundlage des Grundgesetzes zu bewegen. Da das Grundgesetz von einer pluralistischen Gesellschaft ausgeht, gibt es eine natürliche Spannweite legitimer Wertvorstellungen im Grundgesetz und damit auch eine legitime Vielfalt von Ansätzen politischer Bildung. Daher könnte eine christlich-sozialethisch ausgerichtete politische Bildung im Kontext des Grundgesetzes legitim sein. Es stellt sich daher die Frage, ob eine katholisch ausgerichtete Bildungsarbeit mit den Wertvorstellungen des Grundgesetzes konform geht? Eine solche Frage wird in der Regel nicht aufgeworfen: Sie würde aber in unserer Gesellschaft sofort gestellt, wenn eine islamisch-politische Bildungsarbeit mit öffentlicher Förderung etabliert werden sollte. Dass eine solche Frage im katholischen Kontext nicht völlig absurd ist, kann man historisch damit verdeutlichen, dass 1949 Bischöfe das Grundgesetz abgelehnt haben und die Bischöfe wie katholische Sozialethiker wie Oswald von Nell-Breuning in den 50-er Jahren gegen Art. 3 des Grundgesetzes proklamierten, dass der Mann nach Offenbarung und Schöpfungsordnung Oberhaupt der Familie sei. In dem 1961 veröffentlichten Heft 1 „Das Soziale Seminar“ schrieb Albrecht Beckel gegen das Grundgesetz: „Wenn man (...) bedenkt, (...) daß die schematische Anwendung des Gleichheitssatzes hier nicht zur Lösung führt, (…) ergibt sich die Angemessenheit der letzten Verantwortung eines Teils. Dieser Teil ist der Mann kraft der ihm von Gott übertragenen Sprecherfunktion des Menschengeschlechts (Gen 2,15) und der Gehilfenstellung der Frau (Gen 2,18).“14 1953 schloss der Vatikan mit dem spanischen Diktator Franco ein Konkordat, 11 Vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg 2006, Nr. 472ff (S. 340-344). 12 Michael Schlagheck, Direktor der Akademie „Die Wolfsburg“ Mülheim. 13 Vgl. in: Bernhard Sutor, Politische Bildung im Streit um die „intellektuelle Gründung“ der Bundesrepublik Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 45/ 2002 v. 11.11., S. 17-27. 14 Albrecht Beckel, Grundfragen der Christlichen Gesellschaftslehre, Das Soziale Seminar Heft 1, Münster 51 52 Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung das von Spanien ausdrücklich die menschenrechtswidrige Unterdrückung der Religionsfreiheit aller Nichtkatholiken verlangte. Ein solcher kritischer historischer Rückblick legt in den heutigen Fragen der Migrationsgesellschaft bei manchen Positionsbeschreibungen, etwa bei einer kritischen Auseinandersetzung mit islamischen Strömungen, eine gewisse Zurückhaltung nahe. Nachdem mit dem Zweiten Vaticanum die Kirche mit der Religionsfreiheit, den Menschenrechten allgemein und der Demokratie ihren Frieden geschlossen hat, ist eine Kompatibilität der Soziallehre der Kirche mit der Wertordnung des Grundgesetzes zu konstatieren. Im Rahmen einer pluralistischen Demokratie sind daher christlich-sozialethische Positionen legitime Wertvorstellungen, die ihren berechtigten Ort innerhalb politischer Bildungsarbeit haben. Sie können daher aus gesamtgesellschaftlicher Sicht als förderungswürdig anerkannt werden. Wie sieht nun umgekehrt die binnenkirchliche Sichtweise aus? Im Evangelium ist das von Jesus verkündete zentrale Gebot die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Was Nächstenliebe ist, erläutert Jesus am Beispiel der Erzählung vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37). Daher gibt es von Beginn an in den christlichen Gemeinden konkretes Handeln aus dem Geist der Nächstenliebe. Dieses hat sich im Laufe der Geschichte der Kirche in Institutionen wie der Hospitäler und anderer Sozialeinrichtungen verfestigt und institutionalisiert. In der modernen Gesellschaft nach Aufklärung, nach französischer und industrieller Revolution ist deutlich geworden, dass das Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch strukturell zu lesen ist: Warum gibt es keinen institutionalisierten Rettungsdienst, der die Opfer aufliest? Warum werden die Strukturen der Räuberei nicht bekämpft? Warum gibt es keine soziale Sicherung, die die Pflege und Versorgung des Verletzten übernimmt? Da von solchen Institutionen aber die Humanität der Gesellschaft abhängt, ist der Einsatz für humane Institutionen und Strukturen ein Gebot für Christen. Das Gebot der Nächstenliebe ist daher ins politisch-institutionelle Feld hinein zu erstrecken. Wenn das Gebot der Nächstenliebe für Christen zentral ist, und wenn sich dieses Gebot in einer modernen Gesellschaft auf das kollektive Handeln zur Gestaltung der gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen bezieht, darf dann ein Christ unpolitisch sein?15 Wenn somit ein Christ politisch zu sein hat, muss er sich politisch informieren und politisch bilden. Das Engagement in politischen Ämtern ist - wie Paul VI. dies ausdrückte - eine hervorragende Tat der christlichen Nächstenliebe. Es gibt daher sowohl einen allgemeinen Bedarf an politischer Bildung wie spezieller politischer Bildung für Führungspersonen und Mandatsträger. Da sich die kirchliche Sozialverkündigung an „alle Menschen guten Willens“ richtet, sind auch Nichtkatholiken und Nichtchristen Adressaten. Worin besteht ein Bedarf an christlich-sozialethischer Bildung? Wenn man davon ausgeht, dass aufgrund der schulischen politischen Bildung, der Behandlung auch sozialer Fragen im Religionsunterricht und der Rezeption von Massenmedien ein sozialethisches und politisches Grundwissen vorhanden ist, reicht dies angesichts der fortlaufenden vielfältigen Wandlungsprozesse nicht aus. Dies gilt deshalb, weil es grundlegende neue Herausforderungen gibt, die in herkömmlicher Weise nicht reflektiert sind. 2. Zentrale Themen politischer Bildungsarbeit Wenn man sozialethische Herausforderungen aufzählt, sollte dies nicht beliebig, uferlos und modeabhängig sein, sondern eine ethisch begründete Gewichtung darstellen. Dies wird im Folgenden versucht: 1961, S. 8. 15 Vgl. Joachim Wiemeyer, Das politische Engagement von Christen in Parteien und freien politischen Vereinigungen, in polnisch: Zaangażowanie polityczne chrześcijan w partiach politycznych i wolnych stowarzyszeniach, w: K. S. Stanisław Fel, Bp Józef Kupny (Hg.): Katolicka nauka społeczna, Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, Katowice 2007, 205-225. (deutscher Text zum Herunterladen auf meiner hompepage: http://www.ruhr-uni-bochum.de/cgl/Publikationen/Politischeverantwortung.pdf) Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung 1. Aus der Sicht der christlichen Sozialethik ist das prioritäre Thema die absolute Armut von rund einer Milliarde Menschen auf der Erde, die sich vor allem in Afrika sowie in Südasien konzentrieren. Deshalb hat Bundespräsident Köhler Afrika zu Recht zu einem Kernanliegen seiner Präsidentschaft gemacht. 2. Bekämpfung absoluter Armut, wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt, Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt, Begrenzung von Migrationsströmen etc. sind nur zu erreichen, wenn Kriege und Bürgerkriege beendet werden. 3. Langfristig ist für das Leben der Menschen auf dieser Erde die Erhaltung der natürlichen Umwelt zentral. Hier sind Fragen der Ressourcenschonung, des C02Problems und des Klimaschutzes zu sehen. Lange fehlte eine angemessene sozialethische Kategorie in dieser Frage.16 4. Die Globalisierung der Wirtschaft hat sich in den letzten 15 Jahren erheblich in tensiviert. Probleme der Finanzmärkte bedürfen dabei einer angemessen Regulierung. Diese Probleme sind vielfältig miteinander vernetzt, stellen aber die zentralen Herausforderungen dar. Als Voraussetzung wie als Ergebnis ökonomischer Entwicklung werden sich Menschenrechte und Demokratie ausbreiten. Konflikte, in die Religionsgemeinschaften involviert sind, sind in der Regel nicht durch Religionsgemeinschaften als primäre Konfliktursache ausgelöst. Die Religion wird von Politikern als Instrument zur Konfliktverschärfung benutzt. Auf die globalen Herausforderungen kann auch das größte Land in Europa, nämlich Deutschland, nicht mehr allein angemessen reagieren, noch weniger gilt dies für alle übrigen europäischen Länder. 5. Die Lösung globaler Probleme und die Rolle Europas in der Welt hängen davon ab, ob die EU als friedlicher Zusammenschluss von Staaten weltweite Leitbild funktion gewinnt. Dies setzt Handlungsfähigkeit, wirtschaftliche Prosperität und sozialen Zusammenhalt voraus. Die EU mit ihrer neuen Verfassung ist daher wichtig. Auch in Zeiten der Globalisierung und der Europäisierung vieler Politikbereiche bleiben der nationalen Ebene wesentliche Handlungsmöglichkeiten. Deshalb gibt es zentrale gesellschaftliche Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten im Inland. Diese sind: 6. Demographische Entwicklung und soziale Sicherung. Erst ab 2020 - 2030 beginnen die gravierenden Probleme aufgrund der Demographie tatsächlich. 7. Bereits gegenwärtig herrscht in ca. 25% Deutschlands Vollbeschäftigung. Die Knappheit an qualifizierten Arbeitskräften, nicht ein „Ende der Arbeitsgesellschaft“ oder eine Alimentation von Langzeitarbeitslosen durch ein „Grundeinkommen“ ist das Zukunftsthema der Gesellschaft. 8. Die Knappheit qualifizierter Arbeitskräfte hat zur Folge, dass die Einkommensschere auseinander geht. Für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft ist wichtig, dass durch präventive Maßnahmen (Bildung von Migranten) dem strukturell entgegengewirkt wird, indem Wachstumsziele (Investitionen in Humankapital) und Verteilungsziele (Mindestlebensstandard) nicht stärker in Konflikt geraten. Ein Querschnittsthema, das systematisch immer mitgedacht werden muss, ist die Gender-Perspektive, die für weltweite Fragestellungen ebenso wie in Europa und Deutschland in allen Feldern Relevanz hat. Wenn ein hoher Beschäftigungsstand gegeben wäre, Vertrauen in soziale Sicherungssysteme wiederhergestellt und der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft gewährleistet ist, dürfte auch das Vertrauen in das politische und wirtschaftliche System, in Politiker 16 Vgl. Werner Veith, Intergenerationelle Gerechtigkeit, Ein Beitrag zur sozialethischen Theoriebildung, Stuttgart 2006. 53 54 Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung und Parteien wachsen und negative Erscheinungen wie die Wahl extremistischer Parteien zurückgehen. Politischer Bildung selbst wird daher nur eine nachrangige Rolle im Verhältnis zu den Sachproblemen zugewiesen. Bei einem hohen Beschäftigungsstand werden Migranten ebenfalls leichter akzeptiert. Die näheren Inhalte politischer Bildung aus christlich-sozialethischer Sicht werden im folgenden Abschnitt näher erläutert. 3. Lernziele politischer Bildung aus christlich-sozialethischer Sicht Das erste wichtige Lernziel sollte sein, dass Christen motiviert werden, sich mit den komplexen Sachverhalten vertraut zu machen und angesichts schwieriger Güterabwägungen zu einer eigenen Urteilsfähigkeit gelangen. Dabei besteht die Erwartung, dass die christlich-sozialethischen Beurteilungskriterien so überzeugend sind, dass sie als Basis der eigenen Urteile übernommen werden. Ein zweites zentrales Lernziel ist die Bedeutung gesellschaftlicher Institutionen. In modernen Gesellschaften können gesellschaftliche Regeln und Institutionen zwar durch kollektives Handeln der Menschen geändert werden - dies ist etwa gegen Gesellschaftstheorien Luhmann´scher Prägung festzuhalten, Regeln, Institutionen und Strukturen haben einen gesellschaftlichen Sinn, in sie ist investiert worden, sie beruhen auf sozialen Suchprozessen. Daher können sie zu Recht nicht leichthin geändert werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Erfolg von Strukturreformen längere Zeit in Anspruch nimmt. So kann etwa nach den Arbeitsmarktreformen (Hartz IV) erst ab etwa 2008 erwartet werden, dass organisatorische Änderungen greifbare und nachhaltige Erfolge vorweisen können. Das dritte Lernziel sollte sein, dass die Christen für soziale Herausforderungen, für offenliegende, aber auch eher verborgene, Ungerechtigkeiten sensibilisiert werden und ein Einfühlungsvermögen17 aufweisen, solche Probleme nicht auf sich beruhen zu lassen. Ein viertes Lernziel sollte sein, dass man sich zum gesellschaftlichen Engagement motiviert fühlt. Man sollte weder vor der Komplexität der Herausforderungen resignieren, noch euphorisch glauben, gesellschaftliche Probleme ließen sich rasch bei entsprechendem Engagement und gutem Willen ändern. Die Vielfalt der Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Engagement vom Wahlrecht, über Demonstrationen, Leserbriefe, Petitionen, Musterklagen, direkte Demokratie auf Kommunal- und Landesebene, die Beteiligung in Parteien, Verbänden, Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen sollte bewusst sein. Ein fünftes Lernziel bezieht sich auf die ethische Abwägung unterschiedlicher Formen politischen Engagements. Dies bezieht sich auf Sachgerechtigkeit von Behauptungen, keine Diffamierung von Kontrahenten und Gegnern, und auf Fragen der Beachtung von Regeln, etwa der Gewaltlosigkeit bei Demonstrationen bis hin zur ethischen Problematik der Überschreitung von Regeln im Kontext des zivilen Ungehorsams. Wenn diese fünf Lernziele erreicht werden, würde sechstens auch Politiker- und Parteienverdrossenheit entgegengewirkt und die Kritikfähigkeit an der gegenwärtigen Politikvermittlung durch die heutigen Massenmedien erhöht werden. 4. Adressaten christlich-sozialethischer Bildung Traditionell zielte christlich-sozialethische Bildung auch darauf ab, Personen mit Benachteiligungen in ihrer Bildungslaufbahn weitere Perspektiven zu eröffnen. Unter dem Gesichtspunkt der politischen Bildung ist bei sozialen Unterschichten die Distanz zur Politik 17 Johann Baptist Metz sprich in diesem Zusammenhang vom „Compassion“; vgl. ders., Memoria passionis,. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg 2006, 158ff. Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung am größten.18 Dies lässt sich daran ablesen, dass hier das Engagement in der Politik und die Wahlbeteiligung am geringsten sind. So lag in der Stadt Bochum die Wahlbeteiligung zwischen dem am besten situierten Stadtviertel und einem sozialen Problemviertel um 20% auseinander.19 Damit kann ein Teufelskreis entstehen, indem Parteien sich in ihrem Politikangebot nicht um Personen kümmern, die sowieso nicht zur Wahl gehen, so dass sie mit ihren Interessen keine Wahlen gewinnen können. Dies kann wiederum die politische Apathie dieser sozialen Schichten verstärken. Im Idealfall müsste aus einer christlich-sozialen Sicht, in der ein Gesichtspunkt wie die „vorrangige Option für die Armen“ eine Rolle spielt, diese Gruppe in der Bildungsarbeit erreicht werden. Neben sozial benachteiligten Deutschen, die sich vor allem durch einen geringen Grad formaler schulischer und beruflicher Abschlüsse auszeichnen, gibt es besondere Probleme bei Migrantengruppen. Dabei wird im katholischen Raum in der Regel schamhaft verschwiegen, dass, obwohl italienische Zuwanderer am längsten in Deutschland ansässig sind, diese unmittelbar nach den Türken bei den Sozialindikatoren einer hohen Bildungsbeteiligung oder der Arbeitslosenrate die schlechtesten Werte aufweisen. Ob und wie solche Zielgruppen generell für Bildungsmaßnahmen erreicht werden können und durch welche Inhalte und Methoden für diese politische Bildung möglich ist, ist eine schwierige Aufgabe. Adressaten christlich-sozialethischer Bildung haben aber auch gerade Multiplikatoren, Funktionsträger und Führungspersonen zu sein, die in der Regel nicht über eine fundierte theologische Ausbildung, vor allem hinsichtlich sozialethischer Kompetenz, verfügen. Dass an zentralen sozialethischen Herausforderungen der Gegenwart generell ein großes Bildungsinteresse besteht, lässt sich daran absehen, dass im August 2008 eine soziale Bewegung wie ATTAC eine Sommeruniversität20 mit 800 Teilnehmern betreibt. Dort finden sich junge Leute ein, um sich mit den komplexen Fragen der Globalisierung auseinanderzusetzen. III. Anfragen der politischen Bildung an die christliche Sozialethik Aus der Sicht einer politischen Bildung in christlich-sozialethischer Trägerschaft könnten eine Reihe von Anfragen an die wissenschaftliche Sozialethik gerichtet werden. Solche möglichen Anfragen aus meiner Sicht wären: • Eine politische Bildung mit einer christlich-sozialethischen Orientierung setzt voraus, dass es ein christlich-sozialethisches Profil gibt. Ein solches Profil könnte aber deshalb nicht gegeben sein, weil die Kriterien der Sozialethik zu allgemein bleiben und mit fast jedem Inhalt gefüllt werden können: So könnte „Sozialabbau“ und mehr Eigenverantwortung mit Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip begrüßt, unter Bezugnahme auf Solidarität und soziale Gerechtigkeit aber auch bekämpft werden. • Ein zweite Anfrage ist mit dem ersten Vorwurf von Beliebigkeit und Belanglosigkeit verbunden: Es gibt nach dem Zweiten Vaticanum (Gaudium et spes Nr. 43) einen legitimen politischen Pluralismus im Katholizismus. Ein solcher Pluralismus hat sich auch in der einschlägigen Wissenschaft, der Christlichen Sozialethik niedergeschlagen. Es gibt sowohl in konzeptioneller Hinsicht wie in konkreten Anwendungsfragen ein breites Spektrum von Optionen. • Die dritte Anfrage betrifft die gesellschaftliche Relevanz sozialethischer Theo riebildung. Wenn man davon ausgehen würde - was biblisch gut begründet wäre -, 18 Vgl. Joachim Detjen, Politische Bildung für bildungsferne Milieus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 32-33/ 2007 v. 6.8., S. 3-8. (auch weitere Beiträge in diesem Heft). 19 Vgl. Sozialbericht der Stadt Bochum 2008, S. 92-94. (im Internet unter: http://www.bochum.de) 20 Vgl. etwa: http://www.european-summer-university.eu/media/de/Saarkurier.pdf (Zugriff 1.9.2008) und http:// www.attac.de/aktuell/presse/detailsicht/datum/2008/08/06/erste-europaeische-sommeruniversitaet-von-attacein-riesenerfolg/?cHash=c6b627bdfa 55 56 Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung dass sozialethische Theoriebildung ihren Ausgangspunkt bei realen Problemen, Leiden und Nöten von Menschen hat, etwa von Armen, Langzeitarbeitslosen, Migranten etc. und der Wert der Theoriebildung darin liegt, ob diese Theorien etwas zur Problemlösung beitragen können, könnte die Relevanz mancher Diskurse in Frage gestellt werden. • Die vierte Anfrage betrifft die Frage, ob sich die christliche Sozialethik selbst hinreichend Überlegungen über ihre Vermittlung und entsprechende didaktische Methoden (z. B. Planspiele) Gedanken macht. Zur ersten Anfrage ist folgendes festzuhalten: Die zentralen Kategorien der Sozialprinzipien wie Personalität, Gemeinwohl, Solidarität, Subsidiarität und neuerdings Nachhaltigkeit ebenso wie der Begriff der „sozialen Gerechtigkeit“ und seine Ausfaltung primär in Beteiligungsgerechtigkeit, nachgeordnet in Chancengerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, und intergenerationelle Gerechtigkeit sind in der jüngeren Diskussion der wissenschaftlichen Sozialethik präzisiert und entfaltet worden. Ebenso ist das Verhältnis der Kategorien untereinander näher bestimmt worden. Deshalb wäre es unzulässig, wenn man hier von einer Beliebigkeit sprechen würde. Zum zweiten Aspekt ist in der Tat festzuhalten, dass ein Pluralismus in der Sozialethik besteht. Dies ist aber grundsätzlich nichts Neues, denn es gab bereits vor dem zweiten Weltkrieg erhebliche Kontroversen, etwa der Wiener Richtung mit dem Solidarismus, Unterschiede zwischen Dominikanern und Jesuiten, sowie innerhalb des Jesuitenordens etwa zwischen Nell-Breuning und Gundlach, später zwischen Friedhelm Hengsbach und Anton Rauscher. Der Pluralismus in der Christlichen Sozialethik betrifft die Methoden, die Themen und die Ergebnisse. Dies ist zunächst deshalb der Fall, weil man der für alle verbindlichen Grundlage, den biblischen Schriften, für heutige sozialethische Fragen nur offene Optionen entnehmen kann. Diese offenen Optionen der biblischen Schriften sind im sozialethischen Diskurs der Gegenwart mit Hilfe der Sozialphilosophie zu konkretisieren. Sozialethiker/ innen übernehmen dabei unterschiedliche Sozialphilosophien, etwa die Vertragstheorie, die Diskursethik, den Kommunitarismus oder eine traditionelle Naturrechtslehre. Konkrete gesellschaftliche Probleme bedürfen dann aber auch einer näheren Analyse durch Sozialwissenschaften. Da es verschiedene Sozialwissenschaften gibt, haben sie einen unterschiedlichen Zugang zu Problemen. Innerhalb einer Sozialwissenschaft gibt ebenfalls unterschiedliche Theorien, was wiederum zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen kann. Selbstverständlich ist nicht auszuschließen, dass die jeweilige politische Option des Sozialethikers bzw. der Sozialethikerin sich in der Theoriewahl für bestimmte Sozialphilosophien bzw. Sozialwissenschaften ebenso niederschlägt. Auch dann, wenn die gemeinsamen biblischen Grundlagen unstrittig sind, genauso die Frage, welche Themen Sozialethik bearbeiten soll und welche Zielsetzung Sozialethik hat, kann man durch eine unterschiedliche Rezeption der Sozialphilosophie und einer Sozialwissenschaft zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Es stellt sich die Frage, ob es innerhalb der Sozialethik hinreichende Diskurse gibt, die kontroversen Fragen ausgiebig zu diskutieren. Zum dritten Aspekt ist festzuhalten, dass manche Sozialethiker/-innen die Neigung haben bzw. ihr Interesse darin liegen kann, selbst Theoriediskurse zu führen bzw. an Theoriediskussionen von Nachbarwissenschaften teilzunehmen. Solche Theoriedebatten mögen intellektuell spannend und anregend sein. Wenn man aber die christliche Sozialethik als eine an der Praxis orientierte Wissenschaft versteht, wäre die Frage, welcher Praxisbezug einer Theoriediskussion vorliegt. Die neue sozialethische Zeitschrift Amosinternational ist so konzipiert, dass sie relevante Sachthemen aus fachwissenschaftlicher wie sozialethischer Perspektive beleuchtet. Zum vierten Aspekt ist festzuhalten, dass es bisher weder für die schulische Bildung noch für die Jugend- und Erwachsenenbildung innerhalb der christlichen Sozialethik systematische Überlegungen und Konzepte ihrer Umsetzung gibt. Dieses könnte für die Sozialethik selbst einen eigenen heuristischen Wert haben. Dieses Desiderat ist einzuräumen. Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung IV. Marginalien zur AKSB-Konvention Dass auch in einer Reihe von Fragen die Praxis der AKSB über die zehn Jahre alte Konvention hinweggegangen ist, kann man deutlich im AKBS-Bericht 2007 sowie in aktuellen Heften AKSB-inform ablesen. Insofern kann man diese Weiterentwicklungen nur begrüßen. Im Folgenden werden Aspekte aufgegriffen, die in der AKSB bereits weitgehend selbst thematisiert werden. Als Vorbemerkung möchte ich zu bedenken geben, dass die AKSB–Konvention nach dem vorkonziliaren deduktiven Duktus von obersten Prinzipien ausgehend hin zu Konkretionen aufgebaut ist. Seit mater et magistra hat das von der CAJ stammende Konzept von „Sehen – Urteilen – Handeln“, das auch der Grundgliederung des gemeinsamen Wortes zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland zugrunde liegt, in der Sozialethik Resonanz gefunden. Man könnte sich auch eine Konvention ausdenken, die mit dem I. Sehen von 1. den zentralen politischen Herausforderungen der Gegenwart, 2. der Lage der außerschulischen politischen Bildung in Deutschland 3. der Rolle der christlich-sozialethischen Bildung im Gesamtzusammenhang politischer Bildung ausgeht, dann II. als Urteilen eine sozialethische Reflexion vornimmt, und III. Handlungsoptionen für die Bildungsarbeit aufzeigt. 1. In der Konvention spielt das „christliche Menschenbild“ eine wesentliche Rolle. Hinsichtlich seines Gebrauchs sollen hier zwei Anmerkungen gemacht werden: Erstens hat auch in der christlichen Sozialethik die Gender-Diskussion eine kritische Reflexion überkommender Vorstellungen stattgefunden und herausgearbeitet, dass häufig hinter einem „christlichen Menschenbild“ ein Männlichkeitsbild steht.21 Die Bipolarität der Geschlechter ist nicht systematisch aufgearbeitet und in allen Konsequenzen reflektiert. Dies führt auch innerkirchlich aktuell zu Kontroversen, wenn etwa in der Frage der frühkindlichen Kindererziehung implizit traditionelle Vorstellungen vom „Wesen der Frau als Mutter“ zugrunde liegen. Auf der anderen Seite gibt es gesellschaftliche Diskurse, in denen kritisiert wird, dass Frauen im Schnitt weniger Einkommen als Männer beziehen, in Führungspositionen von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft unterrepräsentiert sind etc. Zudem wird die niedrige Geburtenrate in Deutschland beklagt. In diesem Punkt bestehen erhebliche Diskrepanzen zwischen dem Reflexionstand innerhalb der christlichen Sozialethik und kirchenamtlichen Verlautbarungen, die „Gender-Diskurse“ und Feminismus ablehnen. Traditionell gehörte zum christlichen Menschenbild immer der Hinweis auf die Fehlbarkeit des Menschen, d. h. seine Anfälligkeit für sachliche und moralische Irrtümer. So lange die Kirche betonte, dass der Mensch vor allem Sünder ist, konnte man in der kirchlichen Terminologie den Ausdruck der Menschenwürde kaum finden. Mir scheint die AKSB-Konvention mit der gegenteiligen Position, indem die Fehlbarkeit des Menschen praktisch nicht auftaucht, ins gegenteilige Extrem zu verfallen. Dabei hat die Fehlbarkeit des Menschen für die Demokratie und damit für die politische Bildung einen zentralen Stellenwert. Gewaltenteilung, Begrenzung von Amtszeiten, Abwahlmöglichkeiten, Amtsenthebungsverfahren etc. sind systematisch aus der Logik des „homo oeconomicus“ gestaltete Institutionen. Es wird gefragt, welche Folgen Institutionen haben, wenn alle nur ihren kurzfristigen Eigeninteressen folgen. Bei unbefriedigenden Ergebnissen sind die Institutionen neu zu gestalten. Es muss die Spannung thematisiert werden zwischen dem proklamierten Ideal eines mündigen Staatsbürgers auf der einen Seite, das letztlich von einem sehr optimistischen Menschenbild ausgeht, und auf der anderen Seite politischem Geschehen, das durch das „radikal Böse“ gekennzeichnet ist, was nicht nur die deutsche Geschichte, sondern eine Vielzahl gegenwärtiger Diktaturen, Kriege, Terror, Selbstmordattentäter etc. weltweit bestimmt. 2. Die Ausführungen des ersten Teils der Konvention sind in der Regel aus einer nationalstaatlichen Perspektive verfasst, in dem zum Beispiel nicht ausdrücklich die 21 Vgl. Marianne Heimbach-Steins, Sichtbehinderung. Das Geschlechterverhältnis in der Wahrnehmung christlicher Sozialethik, in: Ulrike Gentner (Hrsg.), Geschlechtergerechte Visionen, Frankfurt/M. 2001, 257–392. 57 58 Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung gleiche Würde aller Menschen für den weltweiten Horizont proklamiert wird. In Konzilstexten und Enzykliken gebrauchte Kategorien, wie die „Einheit des ganzen Menschengeschlechts“ oder eine „menschheitsweite Familie“, tauchen nicht auf. Beim Gemeinwohl ist lediglich vom nationalen Gemeinwohl die Rede, nicht aber vom „Weltgemeinwohl“. 3. Indem traditionelle Semantiken der vorkonziliaren Soziallehre fortgeschleppt werden, indem z. B. Staat und Politiker für das Gemeinwohl verantwortlich gemacht werden (Nr. 6) und nicht der Souverän der Demokratie, der Wähler, ist man Kategorien eines monarchischen Obrigkeitsstaates näher als einer partizipativen Demokratie. In dieser ist der/die Staatsbürger/-in der Souverän und der/die Politiker/-in (Minister = Ministrant) die rechenschaftspflichtigen „Diener“, aber nicht die (vormundschaftliche paternalistische) Obrigkeit. 4. In dem Grundlagenteil wird der Gerechtigkeitsdiskurs aufgegriffen. Dabei taucht mit Eigentumsgerechtigkeit eine Gerechtigkeitskategorie auf, die in der Sozialethik nicht zu finden ist. Hingegen fehlt der wichtige Ansatz der Beteiligungs- oder Teilhabegerechtigkeit, die grundlegende Gerechtigkeitskategorie, die der Leistungsgerechtigkeit etc. vorgeordnet ist 5. Im Grundwerteteil wird nicht hinreichend die Frage der Ökologie thematisiert und problematisiert, ob z. B. nicht die Sozialprinzipien durch ein Prinzip wie „Nachhaltigkeit“ ergänzt werden müssten. 6. Im Grundwerteteil wird die „Option für die Armen“ nicht erwähnt. Diese taucht vielmehr unvermittelt in Nr. 19 auf, ohne dass deutlich wird, wie Gerechtigkeitsüberlegungen oder Sozialprinzipien mit der „Option für die Armen“ zusammenhängen. 7. Problematisch erscheint im Abschnitt I: „Grundwerte“, dass jeweils aktuelle Herausforderungen benannt werden, z. B. Individualisierung und Wertewandel, Egozentrik und Nützlichkeitsdenken, Wirtschaftsliberalismus und neue Sozialkultur. Es ist problematisch, umstrittene Aspekte, z. B. ob es überhaupt einen Wertewandel gibt oder ob wirtschaftliche Probleme in der Bundesrepublik wie die Arbeitslosigkeit auf wirtschaftsliberale Einflüsse oder gerade zu wenig marktwirtschaftliche Instrumente zurückzuführen sind, hier aufzunehmen. Häufig wird vorschnell ein Wertewandel behauptet, statt gründlich über beobachtete Verhaltensänderungen nachzudenken. So kann der Geburtenrückgang in Deutschland ohne Annahme eines Wertewandels durch a) eine technische Innovation (Pille), b) höhere Kosten pro Kind durch längere Ausbildung, c) höhere Opportunitätskosten entgangenen Einkommens durch Aufgabe oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit der Frau, wegen des relativen Anstiegs der Frauengehälter zu Männergehältern, d) Strukturwandel der Wirtschaft hin zu Frauen als Beschäftigungsgewinnern im Dienstleistungsbereich etc. erklärt werden. In Frankreich und Schweden herrschen bei höheren Geburtenzahlen keine anderen Wertvorstellungen vor, sondern auf die oben angeführten Strukturelemente haben die gesellschaftlichen Institutionen (z. B. Ganztagsschulen) angemessener als in Deutschland reagiert. 8. Als Lernziele der politischen Bildung könnte man sich auch die Vermittlung von Grundhaltungen, um das altertümlich klingende Wort Tugend nicht zu gebrauchen, vorstellen. Zwar klingt dies teilweise an, wenn etwa Kompromissbereitschaft eingefordert wird. Die Förderung eines Gerechtigkeitssinns, der bei Wahlen auch an nicht stimmberechtigte Migrante im Inland, zukünftige Generationen und die dritte Welt denken lässt, wäre hier ein Ansatzpunkt. Weiterhin könnten Maßhalten / Mäßigung im politischen Kampf und Vermeidung von Freund- Feind-Verhältnissen weitere Ansatzpunkte sein. 9. In der Konvention ist die Selbstverpflichtung enthalten, dass Bildungsreferenten, die nicht über eine entsprechende Vorbildung verfügen, Grundkenntnisse der Soziallehre (Nr. 32) erwerben sollten. Dies ist unzureichend, weil damit „christliche Sozialethik“ nicht erlernbar erscheint. Tatsächlich erscheint christliche Sozialethik komplex22, weil sie erstens die biblischen Grundlagen sozialethischer Fragen behandelt, die die 22 Vgl. Werner Wertgen, Ist moralische Kompetenz lehrbar und lernbar? Sozialethische Bildung als Aufgabe der religiösen Erwachsenenbildung, in: Erwachsenenbildung 54 (2008), Heft 1, S. 12-17. Joachim Wiemeyer, Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung Tradition der kirchlichen Sozialverkündigung und der christlich-sozialen Bewegung umfassen, zweitens die moderne Sozialphilosophie und ihr Verhältnis zur theologischen Ethik und drittens ein Verständnis moderner Gesellschaft entsprechend der Sozialwissenschaften. 10. Im AKSB-Jahresbericht wird von „christlicher Gesellschaftsethik“ geschrieben, was den Eindruck erwecken muss, dass lediglich ein politisch besonders exponierter Lehrstuhls unseres Faches in der Bildungsarbeit eine Rolle spielt. Einige Aspekte, die ich in der Konvention vermisst habe, sollen hier angesprochen werden: • Die AKSB sollte ehrlich die Spannung ansprechen, unter der sie selbst steht, wenn sich Zielgruppen, Themen und Maßnahmen nicht nach selbstgesetzten Prioritäten richten, sondern nach aktuellen Fördertöpfen, den dort vorherrschenden Moden etc. • Wenn man „Option für die Armen“ betont, Solidarität mit Schwächeren erwähnt, stellt sich die Frage nach Sozialbenachteiligten und Migranten als ausdrücklicher Zielgruppe. • Weiterhin stellt sich die Frage, wie weit die AKSB die Behandlung esoterischer Themen und Veranstaltungen als die Aufgabe ansieht. Gemeint ist Esoterik im politischen Sinne, wenn solche Themen behandelt werden wie „zinslose Wirtschaft“ etc. Wenn man in kirchliche Bildungseinrichtungen kommt, ist man gelegentlich erstaunt, was dort angeboten wird. • Im Bereich des politischen Extremismus wird einseitig auf Probleme des Rechtsextremismus eingegangen. Dass der Linksextremismus in der Form der PDS/ Linkspartei, der Gewerkschaften, durch Regierungsbeteiligung in Berlin, an Universitäten, in Medien wohl etabliert ist, wird nicht thematisiert. V. Abschließende Thesen 1. Die soziale Botschaft ist integraler und unverzichtbarer Bestandteil der kirchlichen Verkündigung. Die Soziallehre der Kirche zielt auf die je größere Gerechtigkeit, die Humanisierung des Zusammenlebens der Menschen durch Verbesserung gesellschaftlicher Regeln und Institutionen, ab. 2. Diese gesellschaftlichen Regeln und Institutionen werden in einer demokratischen Gesellschaft durch kollektives Handeln der Menschen gestaltet. Um dieses kollektive Handeln sowie Dialoge zwischen Christen und Nichtchristen zu fördern, ist politische Bildung unverzichtbar. 3. Politische Bildung im christlich-sozialen Sinne zielt darauf ab, Christen zu befähigen, Weltverantwortung zu übernehmen und sie mit dem notwendigen Sachwissen, der ethischen Urteilsfähigkeit, moralischer Sensibilität und der Beurteilung des politischen Instrumentariums auszustatten. 4. Politische Bildung vor christlich-sozialethischem Hintergrund ist keine Form der Umsetzung und Vermittlung der kirchlichen Sozialverkündigung oder der wissenschaftlichen Sozialethik allein. Vielmehr kann christlich-soziale Bildung auch Anstöße zur Weiterentwicklung der Sozialverkündigung und der wissenschaftlichen Sozialethik bieten. Dazu bedarf es geeigneter Wege und Verfahren, die diese Interaktion sicherstellen. 5. Als Adressaten christlich-sozialethischer politischer Bildung sollten auch Personen, die am Rande der Gesellschaft stehen, wie Migranten oder schlecht qualifizierte Personen, im Auge gehalten werden. Ebenso darf es aber nicht aus dem Blickfeld verschwinden, heutige und potentielle Führungspersonen in der Gesellschaft mit dem nötigen sozialethischen Rüstzeug auszustatten. 59 60 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ Prof. Dr. Peter Massing Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ aus Sicht der Politikdidaktik Prof. Dr. Peter Massing, geboren in Dessau, seit 2002 Universitätsprofessor für Sozialkunde und Didaktik der Politik am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. Die Aufgabe meines Beitrages ist zu hinterfragen, inwieweit Begriffe wie Demokratie, Partizipation, Gesellschaft, Bürgerin und Bürger, die in der „Konvention“ verwendet werden, sowie das Gesamtanliegen politischer Bildung, dem heutigen Stand der Diskussion entsprechen. Bevor ich meine Überlegungen formuliere, scheint es mir notwendig eine Vorbemerkung zu machen. Ich argumentiere aus der Sicht der Politikdidaktik, und noch konkreter, ich argumentiere aus der Sicht einer politikwissenschaftlich orientierten Politikdidaktik, die nicht den Anspruch erhebt, die heutige Politikdidaktik als Ganzes zu repräsentieren. Davon unabhängig beschäftigt sich Politikdidaktik in erster Linie mit politischem Lernen in der Schule. Politikdidaktische Anmerkungen zur außerschulischen politischen Jugendund Erwachsenenbildung machen also nur Sinn, wenn sie sich auf Fragen beziehen, die für alle Bereiche der politischen Bildung gelten und das Spezifische schulischen und außerschulischen politischen Lernens außer Acht lassen. Vor diesem Hintergrund werde ich mich mit meinen Anmerkungen auf drei Bereiche im Zusammenhang der „Konvention“ beschränken. Ich werde mich zunächst mit den normativen Grundlagen der politischen Bildung auseinandersetzen, wie sie in der „Konvention“ deutlich werden. Dazu gehören neben dem Menschenbild das Demokratieverständnis und damit verknüpft das Bürgerbild und die Bedeutung von politischer Partizipation. Zweitens werde ich einige Anmerkungen zu den Lernzielen und den gesellschaftlichen und politischen Zielen politischer Bildung machen, wie sie in der „Konvention“ formuliert sind, und drittens erlaube ich mir eine einige Hinweise zu geben, welche aktuellen Diskurse in der Politikdidaktik und in der politischen Bildung für die Überarbeitung oder Ergänzung der „Konvention“ von Bedeutung sein könnten. Vor allem in den ersten beiden Bereichen werde ich die aktuelle Diskussion in der Politikdidaktik und der politischen Bildung darstellen und auf die „Konvention“ beziehen. I. Normative Grundlagen politischer Bildung Alle Konzeptionen politischer Bildung sind notwendigerweise normativ. Sowohl in den klassischen als auch in den aktuellen Konzepten politischer Bildung lassen sich in der Regel, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung, zwei normative Bezugspunkte erkennen: zum einen der Bezugspunkt des politischen Systems, zum anderen der Bezugspunkt des Individuums. Politische Bildung ist immer im Zustand und in den Bewegungen der Politik und der Gesellschaft verankert. Die Entstehung staatlich und gesellschaftlich initiierter, organisierter und geplanter politischer Bildung erfolgte im engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungs- und Modernisierungsprozessen. Je mehr die Individuen von politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Veränderungen unmittelbar betroffen wurden, je mehr politische und gesellschaftliche Prozesse von jedem Einzelnen neue Kenntnisse, Veränderungen von Einstellungen, Verhaltensweisen verlangten und je mehr die Stabilität der gesellschaftlichen und politischen Strukturen von der Akzeptanz und der Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger abhängig wurde, desto notwendiger erwies sich die Herausbildung einer politischen Bildung, die systematisch spezifische Kenntnisse und normative Orientierungen vermittelte (vgl. Massing 2005, S.20; Pohl 2004, 317f.). Politische Bildung ist dann ein Mittel, Bürgerinnen und Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ Bürger über die ihnen noch wenig vertrauten, veränderten oder noch zu verändernden gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Zusammenhänge zu informieren, „vor allem aber zu einem Mittel den Legitimationskonsens über die neu hergestellte, herzustellende oder bestehende oder vor Veränderung zu schützende Ordnung zu erhöhen“ (Behrmann 1972, 217). Politische Bildung soll also vor allem einen Beitrag zur Stabilisierung der bestehenden politischen Ordnung oder zu ihrer Veränderung leisten. In demokratischen Gesellschaften und in demokratischen politischen Systemen ist diese Aufgabe politischer Bildung überlebensnotwendig.1 Nur wenn es politischer Bildung gelingt, ein ausreichendes Maß an demokratischem Engagement von Gruppen und Individuen, die sich politisch für ein Verständnis eines demokratischen Weges der gesellschaftlichen Lebensweise und der Problemlösung einsetzen, zu erzeugen, kann sie Hoffnung auf die Zukunft der Demokratie begründen. „Jede Demokratie kann nur wahrhaftig existieren und sich entwickeln, wenn sie das aufgrund der praktisch wirksamen Einsicht und Anerkennung ihrer Bürger und Bürgerinnen tut. (...) Es ist weder von ihrem normativen Anspruch noch unter dem Gesichtspunkt ihres historischen Überlebens ausreichend, sie einfach als einmal historisch erfundenes Ensemble von Institutionen und Regeln zu betrachten. Ihr politischer Kerngehalt besagt, es sind die Bürger und Bürgerinnen einer Gesellschaft, die sich, darin ihre Freiheit zugleich konstituierend wie nutzend, eine selbst geschaffene Ordnung gegeben haben, die sie anerkennen, verteidigen und den sich wandelnden Aufgaben und Bedingungen entsprechend weiterentwickeln. Tun sie das nicht oder nicht ausreichend, dann steht es schlecht um ihrer Freiheit und der Demokratie Zukunft“ (Greven 2000, 83f.). Auch wenn jetzt der Eindruck entstanden sein sollte, durch die Betonung der mündigen, urteilsfähigen und/oder beteiligungsbereiten Bürgerinnen und Bürger, die die Demokratie zu ihrem Bestehen benötigt, stünde das Individuum, die Entwicklung seiner Persönlichkeit und seine Emanzipation im Zentrum, ist dies nicht der Fall, werden doch diese Eigenschaften vorwiegend funktional betrachtet. Ihr eigentlicher Wert liegt in der Erhaltung des politischen Systems, oder anders formuliert: Grundlegender normativer Bezugspunkt ist das politische System. Politische Bildung liegt zwar im Interesse des politischen Systems, in einer Demokratie kann sie sich aber nicht allein aus diesem Systeminteresse, sondern sie muss sich auch aus einer „politischen Anthropologie“ legitimieren, die die Demokratie voraussetzt. Das heißt, politische Bildung in der Demokratie bezieht sich auch auf das Individuum und strebt für dieses Autonomie und Mündigkeit an. Autonomie meint die Fähigkeit, selbstständig, eigenverantwortlich und kompetent Verantwortung zu übernehmen. Von Mündigkeit sprechen wir dort, wo der Mensch zu eigenem Denken gelangt ist, wo er – von Vorurteilen und Verblendungen frei – Distanz zur eigenen Zeit gewinnt, wo er gelernt hat, Vorgefundenes kritisch zu reflektieren, und wo er sich auf dieser Grundlage entscheiden kann, die jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse zu akzeptieren oder auf ihre Veränderung hin zu wirken: ein Mensch, dem aufgrund seiner Fähigkeit zu sittlicher Selbstbestimmung unabdingbare Würde, Selbstverantwortung für die ihm zurechenbaren Handlungen und Mitverantwortung für die von ihm beeinflussbaren sozialen und politischen Verhältnisse zukommt (vgl. Sutor 2004, 52). In diesem Kontext erhält politische Bildung ihren zentralen normativen Bezugspunkt vom Individuum her. Vor allem von diesem normativen Bezugspunkt aus begründet die „Konvention“ ihre Konzeption der politischen Bildung. Sie geht von einem Verständnis des Menschen als Person aus. Zu diesem Personsein gehört sowohl Individualität als auch Sozialität. Der Mensch ist ein moralisches Subjekt, dessen Handeln sich in Freiheit vollzieht und der für sein Handeln Verantwortung trägt. Dazu gehört auch die verantwortliche Teilnahme am Politischen. Die Identitätsbildung und die Entfaltung des Menschen als Person werden einerseits durch vielfältige gesellschaftliche und globale Entwicklungsprozesse und durch materielle und immaterielle Rahmenbedingungen beeinflusst und erschwert. Politische Bildung soll dem Individuum helfen, sich in einer ständig wandelnden Gesellschaft immer 1 Vgl. auch Antrag der CDU/CSU Fraktion und der SPD Fraktion an den Deutschen Bundestag vom 25.06.2008 „Zur Lage der politischen Bildung in Deutschland“. Dort heißt es: „ Der Bundestag stellt fest: Demokratie ist so stark, wie die Bürgerinnen und Bürger demokratisch sind. Eine Demokratie, die sich nicht über die Förderung der demokratischen Kenntnisse und Fähigkeiten kümmert, wird aufhören, Demokratie zu sein.“ (Drucksache 16/9766, S. 1). 61 62 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ wieder neu zu verorten. Darüber hinaus hat sie die Aufgabe wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Strukturen und Zusammenhänge für den Einzelnen transparent zu machen, zur wertenden politischen Urteilsbildung beizutragen und zum gestalterischen Handeln zu motivieren. Richtschnur für politische Urteile und politisches Handeln ist dabei Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird nicht nur als grundlegender Wert für die Ordnung der Gesellschaft gesehen, sondern auch als eine Tugend menschlichen Handelns, und dass sich Menschen in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für die Verwirklichung von Gerechtigkeit einsetzen, ist gleichzeitig zentrales Ziel politischer Bildung. Bei der Entwicklung der Kriterien, nach denen gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Strukturen und Handlungen im Hinblick auf Gerechtigkeit beurteilt werden können, stützt sich die „Konvention“ auf die Grundsätze und Prinzipien der christlichen Sozialethik. Dazu gehören das Personalitätsprinzip, das zu der Unantastbarkeit der Menschenwürde und zu den allgemeinen Grund- und Menschenrechten führt, das Gemeinwohlprinzip sowie die Prinzipien Solidarität und Subsidiarität, die als Handlungs- und Beurteilungsprinzipien gelten. Inwieweit nun entsprechen diese normativen Grundlagen der politischen Bildung, die sich im Wesentlichen vom christlichen Menschenbild und den Prinzipien der christlichen Sozialethik herleiten, der aktuellen Diskussion in der Politikdidaktik und der politischen Bildung? Der spezifisch christliche Aspekt, der bei der Begründung einer allgemeinen demokratischen politischen Bildung keine Rolle spielen kann, wird dabei nicht berücksichtigt. Dennoch finden sich viele Aspekte der anthropologischen und ethischen Vorentscheidungen der „Konvention“ auch in „weltlichen“ Konzeptionen politischer Bildung. Allgemein, lässt sich festhalten, – und darin ist eine wichtige Gemeinsamkeit zur „Konvention“ zu sehen – verstehen sich Politikdidaktik und politische Bildung heute offensiver normativ als in den 80-er und 90-er Jahren. Bezogen auf die beiden normativen Bezugspunkte Individuum und politisches System bedeutet dies folgendes: Eine Reihe von „klassischen“ und aktuellen Konzeptionen betonen stark den normativen Bezugspunkt Individuum. Sie gehen, ähnlich wie die Konvention, von der „Person“ (Sutor) bzw. vom Zielwert der Emanzipation aus (vgl. Schmiederer, Hilligen, Roloff, u. a.). Emanzipation meint Mündigkeit, d. h. die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Entfaltung der Persönlichkeit meint dies nicht minder. Das Denken in personalen Kategorien unterwirft Gesellschaft, Wirtschaft und Politik den Fragen, ob sie personale Entfaltung ermöglichen oder erschweren oder gar verhindern. Daraus ergibt sich die kritische Funktion politischer Bildung, denn dieses Denken stellt Bestehendes in Frage, wehrt sich gegen verfestigte Strukturen und strebt deren Veränderung an. Dieser kritische Impetus politischer Bildung wird allerdings sowohl in der „Konvention“ als auch in den meisten aktuellen Konzeptionen politischer Bildung bestenfalls implizit deutlich. Konzeptionen politischer Bildung, die ihren normativen Bezugspunkt vor allem im politischen System sehen, legitimieren Aufgaben und Ziele politischer Bildung in erster Linie politisch. Nicht die Qualifizierung des jungen Menschen mit Fähigkeiten für die Bewältigung seines Lebens kann politische Bildung rechtfertigen, sondern politische Bildung dient in erster Linie der Legitimierung der bestehenden demokratischen Ordnung vor dem jungen Menschen. Sie soll – im wörtlichen Sinne – die jungen Menschen einbürgern, und ihre Pflicht ist es, die demokratische politische Kultur zu festigen (u. a. Detjen 2004). Eine solche politische Bildung versteht sich weniger kritisch. Geht man allerdings davon aus, dass eine demokratische politische Kultur vor allem die entsprechenden Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen meint, ist die Differenz zwischen den beiden Positionen weniger groß, als dies auf den ersten Blick erscheint. Zusammenfassend lässt sich jedoch feststellen: In fast allen Konzeptionen politischer Bildung sind, trotz Unterschieden und Differenzen im Einzelnen, beide normativen Bezugspunkte und ihre Verknüpfung relevant. Dies wird zum Beispiel in den Vorschlägen für bundeseinheitliche Bildungsstandards der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) deutlich, die u. a. auch einen politikdidaktischen Minimalkonsens ausdrücken. Dort heißt Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ es: In einer Demokratie gehört es zu den Aufgaben politischer Bildung2, alle Menschen zur Teilnahme am öffentlichen Leben zu befähigen. Politische Bildung fördert beim jungen Menschen die Fähigkeit, sich in der modernen Wirtschaft und Gesellschaft angemessen zu orientieren, auf einer demokratischen Grundlage politische Fragen und Probleme kompetent zu beurteilen und sich in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur stets neu zu schaffenden Demokratiefähigkeit junger Menschen. Zusammenfassend lässt sich diese Zielperspektive politischer Bildung als Entwicklung politischer Mündigkeit bezeichnen. „Politische Mündigkeit ist aus der Sicht des Einzelnen eine Bedingung für erfolgreiche Partizipation, sie ist aber auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht für die Erhaltung und Weiterentwicklung einer demokratischen politischen Kultur und eines demokratischen politischen Systems eine unerlässliche Zielperspektive politischer Bildung“ (GPJE 2004, 9). In dem Begriff „politische Mündigkeit“ sind beide normativen Bezugspunkte miteinander verknüpft. Mündigkeit als Eigenschaft des Einzelnen ist Ziel politischer Bildung, weil sie ihn zur Teilnahme am öffentlichen Leben qualifiziert, andererseits ist das demokratische System unter dem Gesichtspunkt seines historischen Überlebens auf mündige Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Konzeptionen politischer Bildung heute finden also ihre normativen Bezugspunkte sowohl im Individuum und seinen Werten, als auch in der Demokratie als politischem System sowie in der Verknüpfung beider. Sie sind normativ komplex. In der „Konvention“ scheint mir der Schwerpunkt auf dem Individuum in seinem Personsein sowie in seinen Werten zu liegen. Zwar ist auch von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik die Rede, die nach Prinzipien der christlichen Ethik organisiert sein sollen. Auch geht die „Konvention“ bei der Definition des Gegenstandes der politischen Bildung von einem politikwissenschaftlich fundierten Politikbegriff aus, wenn sie schreibt: „Unter Politik verstehen wir jene spezifischen Formen gesellschaftlichen Handelns, in denen die Menschen die gemeinsamen Bedingungen ihres Zusammenlebens gestalten und auf je unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft gemeinsame Ordnungen entwickeln, mit deren Hilfe sie jeweils ihre für die Gesamtheit bedeutsamen Probleme und Konflikte regeln können. Politik ist kluges Bemühen um das Gemeinwohl. Dabei spielen Werte, Bedürfnisse und Interessen von Einzelnen und von Gruppen eine zentrale Rolle.“ (S.5). Abgesehen davon, dass sich in der politischen Bildung mittlerweile zwei konkretere Arbeitsbegriffe, die drei Dimensionen des Politischen und der Politikzyklus durchgesetzt, haben: Der Begriff der Demokratie oder des demokratischen Systems findet im ersten Teil der „Konvention“ keine Erwähnung, und ein Bezug zu politikwissenschaftlichen Demokratietheorien wird nicht hergestellt mit der Folge, dass die „Konvention“ in ihrem ersten Teil institutionell blass bleibt und die Forderung nach Beteiligung allein ethisch begründet wird. Eine demokratietheoretische Fundierung könnte dieser Forderung mehr Bodenhaftung verleihen. In der politikwissenschaftlichen Demokratietheorie werden heute drei Grundmodelle von Demokratie unterschieden, die in einer Vielfalt von unterschiedlichen Formen auftreten. Diese Grundmodelle sind: 1. das Modell liberaler Demokratie, 2. das Modell republikanischer Demokratie und 3. das Modell deliberativer Demokratie. Die Modelle unterscheiden sich im Kern nach der Art, dem Ausmaß und der Reichweite der Beteiligung der Bürger. In den Modellen republikanischer und deliberativer Demokratie umfasst die Beteiligung möglichst viele gesellschaftliche Bereiche. Ihre Vertreter vertrauen auf die Überzeugungskraft rationaler Argumente in der öffentlichen Debatte und setzen darauf, dass sich die Bürgerinnen und Bürger im Prozess demokratischer Deliberation durch konsensorientiertes kommunikatives Handeln auf gemeinschaftliche Normen und Ziele verständigen können und werden. Das Modell liberaler Demokratie favorisiert dagegen die Beschränkung der Beteiligung auf den Bereich des Politischen und setzt auf Repräsentation und auf Formen der Institutionalisierung der Beteiligung der Bürger. Trotz dieser Unterschiede im Einzelnen muss ein Demokratiekonzept, das einerseits normativer Bezugspunkt politischer Bildung sein kann und andererseits den Standards der De2 In den Bildungsstandards der GPJE die für die Schule formuliert wurden, heißt es immer „schulische politische Bildung“ oder „politische Bildung in der Schule“. Die Aussagen gelten jedoch für die außerschulische politische Bildung in gleicher Weise. 63 64 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ mokratietheorie genügen will, das „magische Dreieck der Demokratie“ (Buchstein) mit seinen Eckpunkten institutionelle Arrangements, Bürgerrechte und Bürgerqualifikationen berücksichtigt und justiert haben. So versucht die aktuelle Demokratiediskussion, diese Eckpunkte miteinander zu verbinden. Neben Neuarrangements, Umgewichtungen und intelligenten Kombinationen vorhandener institutioneller Formelemente, die von einer demokratisierten Weltgesellschaft über den kooperativen Staat bis hin zur assoziativen und reflexiven Demokratie reichen (vgl. Schmalz-Bruns 1993; Benz 1997; Schuppert 1997), ist der Bürger wieder in den Blickpunkt geraten und die Frage, wie dessen Bereitschaft zur Partizipation gefördert und zugleich sicher gestellt werden kann, dass sich erweiterte Teilhaberechte mit den anspruchsvollen ethischen, moralischen und kognitiven Bedingungen vernünftiger politischer Willensbildung zusammenschließen lassen (vgl. Buchstein 1995; Massing 2002). Bei dem Versuch, diese demokratietheoretische Diskussion für die politische Bildung zu nutzen, sind zunächst die Kompetenzen und Tugenden, die in der demokratietheoretischen Debatte genannt wurden, rezipiert worden. Hubertus Buchstein, der den ersten Impuls dazu gegeben hat, nennt drei Kompetenzen. Zum einen kognitive Kompetenzen bezüglich der Gegenstände politischer Entscheidungen. In dieser Dimension geht es ausschließlich um die Wissensaspekte von Politik, zum zweiten prozedurale Kompetenzen bezüglich der Verfahren politischer Entscheidungsfindung. Die beinhalten die Kenntnisse und strategischen Fertigkeiten, die notwendig sind, um die eigenen Ziele innerhalb der Regeln des politischen Systems zu verfolgen, d. h. die Fähigkeit, sich an Politik zu beteiligen. Drittens nennt Buchstein gemeinsinnorientierte und affektiv verankerte habituelle Dispositionen. Damit sind Tugenden gemeint, die im demokratietheoretischen Diskurs zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für die demokratischen Tugenden schlägt Hubertus Buchstein folgenden Katalog vor, der sich aus Tugenden des Liberalismus, des Demokratismus und des Sozialstaats zusammensetzt. Dazu gehören: Die Tugenden der Loyalität als der Bereitschaft, für die Gemeinschaft aller Mitbürger Verantwortung zu übernehmen, und des Mutes im Sinne von Zivilcourage als der Bereitschaft, das Gemeinwesen gegen Bedrohungen zu verteidigen. Rechtsgehorsam auf freiwilliger und daher reflexiver Basis, Kooperationsbereitschaft, Fairness und Toleranz, die Bereitschaft, ethische und ethnische Differenzen auszuhalten. Die Tugend der Partizipation, der Bereitschaft, politische Entscheidungen vor einem längeren Zeithorizont zu evaluieren sowie der Argumentation, der Bereitschaft, sich für die eigene Meinung öffentlich zu rechtfertigen. Die Tugenden des sozialen Gerechtigkeitssinns und der Solidarität (Buchstein 2000, S. 13).3 Vor diesem Hintergrund hat die politische Bildung unterschiedliche Bürgerrollen und Bürgerbilder konstruiert und ihre Ziele daran orientiert. Sie reichen von „politisch Desinteressierten“, die für sich das Recht in Anspruch nehmen, der Politik nur begrenzte Aufmerksamkeit zu schenken, und sich nur unregelmäßig oder selten an Wahlen und Abstimmungen beteiligen. Sie sind über die aktuellen Problemlagen der Politik wenig – und wenn, dann auch nur oberflächlich – informiert. Häufig kennzeichnet sie ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber politischen Eliten. Ihr politisches Wissen ist fragmentarisch, ihr politisches Denken vorurteilsgeprägt. In vielen politischen Sachfragen unschlüssig, neigen sie dazu, irrationalen Trieben und dunklen Impulsen nachzugeben. Sie wollen heute dies und morgen jenes; ihre Urteilsstandards werden der Komplexität und Kompliziertheit der politischen Angelegenheiten kaum gerecht, über die „informierten und urteilsfähigen Zuschauer/innen“. Diese interessieren sich für Politik und haben so viel Wissen und Einblick in die Zusammenhänge des politischen Lebens, dass sie diese Welt nicht als eine fremde, ihrer Einsicht entzogene betrachten. Sie werden zwar außerhalb von Wahlen und Abstimmungen selten aktiv, lassen sich jedoch nichts vormachen und sind in der Lage, sich in politischen Zusammenhängen zu orientieren und zu ihnen eine eigene, begründete Position zu entwickeln. Eine weitere Bürgerrolle ist die des „interventionsfähigen Bürgers und der interventionsfähigen Bürgerin“. Sie besitzen neben dem Wissen und den Fähigkeiten des informierten Zuschauers auch Kenntnisse über die tatsächlich vorhandenen Einflusschancen und Möglichkeiten zur Beteiligung 3 Diese Tugenden werden hier so ausführlich dargestellt, weil sich ein Großteil von ihnen auch in der Konvention wiederfindet. Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess sowie die Fähigkeit zu einer rationalen, d. h. begründeten, politischen Urteilsbildung und einer prinzipiellen Handlungsbereitschaft aufgrund von kommunikativen, aber auch strategischen und taktischen Fertigkeiten. Hinzu kommt soziales Vertrauen zu anderen Menschen, Selbstvertrauen und Selbstachtung, um die mit politischer Aktivität verbundenen Belastungen auf sich zu nehmen, sowie der Glaube an den eigenen Einfluss. Zuletzt die Rolle der Aktivbürger/ innen. Bei ihnen nimmt das Politische einen hohen Stellenwert ein. Sie sehen politische Beteiligung als ihre wichtigste Aufgabe und ihre moralische Pflicht an. Sie möchten das politische Geschehen aktiv mitbestimmen. Mitgliedschaft und Mitarbeit in Parteien, Interessengruppen, Bürgerinitiativen oder ideellen bzw. zivilgesellschaftlichen Vereinigungen scheinen ihnen selbstverständlich. Der Aktivbürger, die Aktivbürgerin will das als richtig Erkannte befördern bzw. umsetzen und orientiert sich dabei nicht nur an seinen/ihren Eigeninteressen, sondern auch am Gemeinsinn (vgl. Massing 2002). Politische Bildung sollte bei der Formulierung ihrer Ziele alle vier Gruppen berücksichtigen. Die „Desinteressierten“ bilden dabei eine ständige Herausforderung. Ihre Zahl zu verringern, und aus ihnen wenigstens informierte Zuschauer/innen zu machen, ist politischer Bildung dauerhaft aufgegeben. Informierte und urteilsfähige Zuschauer/innen bilden dann ihr Minimalziel, auch wenn sie für die Praxis der politischen Bildung schon eine erhebliche Herausforderung darstellen. Als anspruchsvolleres, aber noch immer realistisches Ziel kann die politische Bildung die interventionsfähigen Bürgerinnen und Bürger betrachten. Die Aktivbürger/innen scheinen dagegen für die politische Bildung ein eher utopisches Ziel zu sein. Sie sollten aber nicht aus den Augen verloren werden, denn als regulative Idee erfüllen sie wichtige Orientierungsfunktionen, solange sich politische Bildung bewusst bleibt, dass nur wenige diesen Grad der Aktivität erreichen (wollen). Zudem bedürfen Aktivbürger/innen im Grunde keiner – eigens auf sie abgestimmten – Bildungs- und Erziehungsbemühungen. Die Bereitschaft zur Aktivbürgerschaft geht überwiegend von der Person selbst aus und speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Denkbar ist allerdings auch, dass diese Bereitschaft durch politische Bildung angeregt oder verstärkt wird. Da es in der Demokratie innerhalb dieser Bandbreite eine Vielzahl von legitimen Bürgerrollen gibt und der Einzelne im Zeitverlauf auch mehrere Bürgerrollen wahrnehmen kann, tut politische Bildung gut daran, von unterschiedlichen Bürgerrollen auszugehen. Das gilt auch für die „Konvention“, die implizit dem Aktivbürger oder der Aktivbürgerin zuzuneigen scheint, mit der Gefahr, die Realität der Demokratie zu verfehlen. Aktuelle Konzeptionen politischer Bildung haben heute zwar das Konstrukt unterschiedlicher Bürgerrollen beibehalten. Es hat aber eine Schwerpunktverschiebung stattgefunden von den Bürgerleitbildern hin zu den Kompetenzen, die der Einzelne benötigt, um die eigene Bürgerrolle zu finden und sich frei, das heißt reflektiert und begründet, für eine oder in seinem Leben auch für verschiedene Bürgerrollen zu entscheiden. Aufgabe politischer Bildung ist dann die Kompetenzen zu vermitteln, die notwendig sind, um überhaupt irgendeine Bürgerrolle wahrnehmen zu können. Welche dies sein wird, ist seiner Verantwortung und seiner Entscheidung überlassen. Dies erscheint mir allerdings normativ zu blass. Wenn Demokratie immer Programm ist und bleibt, ein unabgeschlossenes Projekt, das sich nur in der öffentlichen Auseinandersetzung fortschreiben lässt und vor allem aus dem Spannungsverhältnis von Norm und Realität seine Dynamik und seine Orientierung gewinnt, dann muss sich politische Bildung auch dafür verantwortlich fühlen, dass die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger tatsächlich den Willen entwickeln, in eine Praxis einzutreten, in der sich Demokratie selbst fortschreibt. Dann reicht es auch nicht aus, dass politische Bildung sich bloß an unterschiedlichen Bürgerbildern orientiert, sondern sie muss auch die institutionelle und strukturelle Dimension von Demokratie wieder in ihre Konzeption einholen. Denn nur vor dem Hintergrund eines normativen Demokratiemodells ist die Kritik der politischen Realität möglich und scheint die Richtung auf, in die eine Weiterentwicklung des bestehenden demokratischen Systems führen kann oder soll. Bezogen auf die „Konvention“ könnte dies zweierlei bedeuten: Zum ersten scheint es notwendig, das Bürgerbild, das ihr implizit zugrunde liegt, bewusst zu machen, es zu differenzieren und es nicht nur anthropologisch durch das christliche Menschenbild und durch die christliche Ethik zu begründen, sondern es auch demokratietheoretisch zu fundieren. Dazu ist es zweitens erforderlich, der Demokratie konzeptionell mehr Aufmerk- 65 66 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ samkeit zu schenken. Das heißt, politische Bildung nicht nur allgemein auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu beziehen, sondern konkret auf ein normatives Demokratiemodell, zu dessen historischem Überleben politische Bildung – auch und vielleicht gerade eine katholisch-sozial orientierte politische Bildung – unabdingbar ist. II. Ziele der politischen Bildung Vor diesem Hintergrund differenzierter Bürgerbilder und eines normativen Demokratiemodells ergeben sich dann die Aufgaben und Ziele politischer Bildung, die sich im aktuellen politikdidaktischen Diskurs im Wesentlichen in der Formulierung von Kompetenzen zeigen. In der Politikdidaktik waren bereits seit den 90-er Jahren unterschiedliche Ansätze für die Beschreibung der Ziele politischer Bildung in Form von Kompetenzen entwickelt worden (vgl. Sander 2004, 36f.). Bernhard Sutor spricht z. B. von „kognitiven“, „kommunikativen“ und „moralischen“ Kompetenzen. Andere Modelle (im Anschluss an Oskar Negt (1997), z. B. Peter Henkenborg (2002) und Dagmar Richter (2003), enthalten stark normativ aufgeladene Kompetenzen wie z. B. „Sozial- und Gerechtigkeitskompetenz“, „ökologische Kompetenz“ oder „Erinnerungs- und Utopiefähigkeit“. Aktuell konkurrieren prinzipiell zwei unterschiedliche Kompetenzmodelle miteinander. Der eine Kompetenzbegriff ist im Rahmen der Bildungsstandarddiskussion entstanden, der andere stammt aus der Berufspädagogik. Wenden wir uns dem ersten Kompetenzmodell zu. Als ein Ergebnis der PISA-Studien und anderer internationaler vergleichender Schulleistungsuntersuchungen hat sich in Deutschland eine Diskussion entwickelt, in deren Mittelpunkt die Entwicklung von Kerncurricula und Bildungsstandards steht. Sie ist hierzulande mittlerweile zu einem Hauptziel der Schulpolitik geworden und hat auch die politische Bildung erfasst. Wenn derzeit von Bildungsstandards die Rede ist, geht es zumeist um performance standards4, die auf komplexe funktionale Fähigkeiten, d. h. auf bestimmte Kompetenzen, bezogen sind. Was in diesem Zusammenhang unter Bildungsstandards und Kompetenzen verstanden wird, ist definiert bzw. festgelegt durch die Expertise von Eckhard Klieme vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung (DIPF), der die für die aktuelle Diskussion maßgebliche Sprachregelung vorgenommen hat (Klieme u. a. 2003, 4). Nach der Expertise formulieren Bildungsstandards verbindliche Anforderungen an das Lehren und Lernen. Bildungsstandards benennen präzise, verständlich und fokussiert die wesentlichen Ziele der pädagogischen Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse. Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen Lernende zu einem bestimmten Zeitpunkt mindestens erworben haben sollen. Der Kompetenzbegriff der Expertise geht auf Franz Weinert zurück. Weinert definiert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volotitionalen (absichts- und willensbezogenen, P. M.) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. Der Anspruch allerdings, Kompetenzen auch messen zu wollen, führt letztlich dann doch zu einer Verengung auf kognitive Leistungsbereiche. Kompetenz stellt dann die Verbindung zwischen Wissen und Können her, ist als Befähigung zur Bewältigung unterschiedlicher Situationen zu sehen und erfordert eine entsprechend breite Umsetzung in Aufgaben und Tests. (vgl. Klieme 2004, S. 12.) 4 Bildungsstandards und Kompetenzen beziehen sich in der aktuellen Diskussion allein auf die Schule. Beide ließen sich allerdings auf die außerschulische politische Bildung übertragen. Der Begriff Bildungsstandard wird erst dann eindeutig, wenn angegeben wird, was standardisiert ist bzw. was standardisiert werden soll. In der aktuellen Literatur findet man folgende Unterscheidungen: Die Bildungsstandards beziehen sich auf die Unterrichts- bzw. Lerninhalte, sind also Inhaltsstandards (content standards). Sie beziehen sich auf die erwarteten Schülerleistungen und ihre Bewertung (performance standards) oder sie beziehen sich auf die für schulisches Lernen bereitgestellte Ressourcen (opportunity-to-learn-standards). Es sind aber auch andere – und weitergehende – Differenzierungen, etwa die Unterscheidung zwischen Mindest-, Regel- und Maximalstandards denkbar. Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ Im Anschluss daran geht der GPJE-Entwurf zu bundeseinheitlichen Bildungsstandards für die politische Bildung von folgendem Kompetenzmodell aus (vgl. GPJE 2004, 13): Konzeptuelles Deutungswissen Politische Urteilsfähigkeit Politische Ereignisse, Probleme und Kontroversen so wie Fragen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung unter Sachaspekten und Wertaspekten analysieren und reflektiert beurteilen können Politische Handlungsfähigkeit Meinungen, Überzeugungen und Interessen formulieren, vor anderen angemessen vertreten und Kompromisse schließen können Methodische Fähigkeiten Sich selbstständig zur aktuellen Politik sowie zu wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen orientieren, fachliche Themen mit unterschiedlichen Methoden bearbeiten und das eigene politische Weiterlernen organisieren können Das zweite Kompetenzmodell stammt, wie erwähnt, aus der Berufspädagogik und unterscheidet zwischen Sach-, Methoden-, Sozial- und Personal- bzw. Selbstkompetenz, die als Aspekte beruflicher Handlungskompetenz verstanden werden. Diese Kompetenzen werden in der politischen Bildung als Aspekte von Demokratiekompetenz konkretisiert. Diese verknüpft in spezifischer Weise die einzelnen Kompetenzen und lässt sich in Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ausdifferenzieren (vgl. zum Folgenden Massing 2002a, 37ff.). Bei der Sachkompetenz geht es in erster Linie um die Wissensdimension von Politik. Sie ist für die politische Bildung von besonderer Bedeutung, denn Demokratie kann ihre Überlebensfähigkeit nur bewahren, wenn sie von weiten Teilen der Bevölkerung verstanden und getragen wird. Demokratie ist eine so komplizierte politische Ordnungsform, dass man sich in ihr nur zurechtfinden kann, wenn man es gelernt hat. Dazu benötigt man vor allem Kenntnisse über die institutionelle Ordnung der Demokratie, ihrer verfassungsmäßigen Grundlagen, der wichtigsten Prinzipien und Institutionen sowie der Regeln, nach denen im Zusammenhang der auf Machtgewinn und Durchsetzung gerichteten politischen Interessen entschieden wird. Außerdem benötigt man Kenntnisse über im Rahmen der institutionellen Ordnung vorhandenen Einflussmöglichkeiten und Partizipationschancen, über politische Zuständigkeiten ebenso wie über rechtliche Verfahren, Kenntnisse über funktionale Zusammenhänge des politischen Systems sowie über seine weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Abhängigkeiten – über die Ergebnisse und Voraussetzungen der Globalisierung eben. Da Politik dem Einzelnen jedoch häufiger im Mikrobereich und dort vor allem in Form von Verwaltungshandeln begegnet, gehört zur Sachkompetenz auch, die Aufgaben, Befugnisse und Verfahrensweisen der Verwaltung zu kennen und zu wissen, wie man mit Behörden umgehen und sich gegen deren Entscheidungen und Maßnahmen wehren kann. Sachkompetenz beinhaltet allerdings auch das Wissen um die persönlichen Kosten, Mühen und Belastungen sowie über die begrenzten Folgewirkungen politischer Interventionen. Wissen im Rahmen von Sachkompetenz bedeutet jedoch nicht nur Kenntnisse von Fakten, sondern auch Wissen im Sinne von Verstehen5, das sich als Teil von Politikbewusstsein reproduziert, welches sich in der Fähigkeit zur kognitiven Orientierung in Politik und Gesellschaft ebenso ausdrückt wie in der bewussten Akzeptanz der Demokratie, insbesondere der Grund- und Menschenrechte, im Interesse an öffentlichen Aufgaben und in der Sensibilität für gesellschaftlich-politische Probleme auf den verschiedenen Politikfeldern. Verständnis von Demokratie und Einsichten in politische Zusammenhänge müssen durch politische Urteilsfähigkeit ergänzt werden, d. h. die Qualifikation, politische Pro5 Damit ist das Gleiche gemeint, wie mit „Konzeptuellem Deutungswissen“ in den GPJE-Standards. 67 68 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ gramme und Leistungen, Probleme oder Entscheidungen oder auch Amtsinhaber nach eigenen begründeten wertbezogenen und rationalen Maßstäben zu beurteilen und an den Werten, Normen und Gestaltungsmöglichkeiten des demokratischen Gemeinwesens zu messen. Methodenkompetenz als Ziel politischer Bildung meint zunächst die Fähigkeit, mit Hilfe von analytischen politischen Kategorien (z. B. Macht, Interesse, Konflikt, Konsens, Werte, Ideologien usw.), die in Schlüsselfragen umformuliert werden können, sich selbst politische Sachverhalte und Probleme sowie politische Entscheidungen und ihre Folgen erschließen zu können. Da in modernen Demokratien dem Einzelnen Politik im Wesentlichen als „medienvermittelte“ begegnet, bedeutet dies in erster Linie die Fähigkeit, sich selbstständig und gezielt über Massenmedien und/oder Neue Medien Informationen zu beschaffen, auszuwählen und kritisch zu verarbeiten. Darüber hinaus bedeutet Methodenkompetenz, dass man über die nötigen Qualifikationen verfügt, um ggf. in verschiedenen politischen Handlungsfeldern agieren zu können. Methodenkompetenz meint auf dieser Ebene die Fähigkeit zur Teilnahme an der politischen Öffentlichkeit. Dazu sind vor allem kommunikative Fähigkeiten notwendig. Sozial- und Selbstkompetenz sind eng miteinander verknüpft und aufeinander bezogen. Sozialkompetenz erwirbt man in unterschiedlichen sozialen Situationen und ist Teil der Selbstkompetenz. Selbstkompetenz beschreibt die Gesamtheit der verhaltensrelevanten Persönlichkeitsmerkmale, die sich wieder in sozialen Situationen äußern. Bezogen auf politische Bildung meint Sozial- bzw. Selbstkompetenz die handlungswirksame Aufnahme der Grundideen rechtsstaatlicher und sozialer Demokratie. Im Einzelnen beinhaltet sie die schon oben beschriebenen demokratischen Tugenden. Zur Sozialkompetenz gehören des Weiteren kommunikative, emotionale und soziale Fähigkeiten. Darunter versteht man, Gedanken, Gefühle und Einstellungen anderer sensibel wahrzunehmen, in der Lage zu sein, sich situations- und personenbezogen zu verständigen, zur sozialen Perspektivenübernahme (Gotthard Breit) fähig zu sein, sich in die Situationen, die Interessen und Denkweisen anderer hineinzuversetzen und Verständigungsmöglichkeiten zu suchen, aber auch konfliktfähig zu sein. Zur Selbstkompetenz gehört ein realistisches Selbstbild, im Sinne von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, d. h. Ich-Stärke, um den eigenen Überzeugungen gemäß handeln zu können, aber auch Kritikfähigkeit gegenüber sich selbst. Selbstkompetenz beinhaltet Neugier, Tatkraft und Freude am Experimentieren, aber auch die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten im eigenen Leben und in sozialen Zusammenhängen umgehen zu können. Die „Konvention“ unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen Lernzielen und gesellschaftlich-politischen Zielen der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung. In dieser Zweiteilung werden implizit die am Anfang beschriebenen beiden normativen Bezugspunkte Individuum und politisches System deutlich. Die Lernziele beziehen sich auf Fähigkeiten des Individuums, und in den gesellschaftlichen und politischen Lernzielen lassen sich implizit die Gesellschafts-, Wirtschafts- und Politikvorstellungen der „Konvention“ erkennen. In den Lernzielen ist zwar gelegentlich auch von Kompetenzen die Rede (z. B. Handlungskompetenz oder ethische Kompetenz), der Kompetenzbegriff, der aktuell die politische Bildung prägt, wird jedoch nicht für eine systematisierende und theoretisch fundierte Lernzielbeschreibung genutzt. Die Lernziele der „Konvention“ erscheinen dadurch zwar pragmatisch, aber ebenso beliebig und bleiben hinter dem aktuellen Stand der politikdidaktischen Diskussion zurück. Ähnliches gilt für die gesellschaftlich-politischen Ziele. Die „Konvention“ verzichtet darauf, ein politikwissenschaftlich gestütztes, normatives Demokratiemodell bzw. zentrale Elemente eines demokratischen Systems zu formulieren, die auch den Inhalt der politischen Bildung festlegen würden. Die Folge davon ist, dass die genannten Vorstellungen zur Gesellschaft, zur Wirtschaft, zur Globalisierung und zur internationalen Politik moralisierend wirken, zumindest moralisch stark aufgeladen sind und letztlich eben beliebig erscheinen. Darin scheint auch die Ursache dafür zu liegen, dass einige zentrale Entwicklungen, aus denen sich Herausforderungen für die politische Bildung ergeben, unterbelichtet sind. Ohne dies Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ hier weiter ausführen zu können, gilt dies z. B. für die Ursachen und Folgen der Globalisierung. Die Globalisierung hat in den letzten Jahren die Demokratie als Staats- und Lebensform vor ihre größte Belastungsprobe gestellt, und wie es scheint, ist sie dafür schlecht gerüstet. Zunehmend werden Zweifel vorgetragen, ob die tradierten Normen und Konzepte zur Begründung demokratischer politischer Ordnung im 21. Jahrhundert noch Bestand haben können. „Weil unter den Bedingungen marktorientierter Globalisierung die partizipativen Bürger der Zivilgesellschaft gegenüber den sachzwanghaften Marktkräften immer weniger zu sagen haben, kann eine Rückentwicklung der modernen Massendemokratie zu autoritären Mustern nicht ausgeschlossen werden.“ (Mahnkopf 1998, 55). Immer mehr Stimmen sind zu hören, die vor der demokratiefeindlichen Wirkung des „autoritären Liberalismus“ warnen. Die zentralen Fragen, die sich heute stellen, sind: Worin bestehen die Probleme, die sich aus der Globalisierung für Demokratien westlicher Prägung ergeben? Welche Möglichkeiten bieten sich an oder werden diskutiert, mit diesen Problemen umzugehen, und welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die politische Bildung? Eine Weiterentwicklung der „Konvention“ müsste dringend versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Ein weiteres Element, das in den gesellschaftlichen und politischen Zielen der „Konvention“ keine Erwähnung findet, ist „Diversity“ als theoretisches und praktisches Konzept. Diversity steht im Kontext des sozialstrukturellen Wandels moderner postindustrieller bzw. postmoderner Gesellschaften. Als Ausdruck der „neuen Unübersichtlichkeit“ (Habermas) formuliert es als Ziel den positiven Umgang mit pluralisierten und individualisierten Lebensentwürfen und –stilen, mit patchworkartigen Identitätsmustern in der Multioptionsgesellschaft, mit Heterogenität in der Migrationsgesellschaft usw. (vgl. Hor-mel/Scherr 2005, 208ff.). Diversity verweist auf Entwicklungen, die in den letzten Jahren eine erhebliche Beschleunigung und Intensivierung erfahren haben. Im Ergebnis folgt daraus, dass die, zu welchem Zweck auch immer, an einem Ort Versammelten heute fast nirgendwo die gleiche geographische und sprachliche Sozialisation haben. Gleichzeitig ist die soziale Durchmischung und bis zu einem gewissen Grad auch die soziale Durchlässigkeit eine normale Tatsache. Anders formuliert: Sprachliche und soziokulturelle Heterogenität sowie Pluralität bilden den Normalfall. Diversity, Interkulturalität und Internationalität sind im Alltag fast aller Institutionen und insbesondere in Bildungsinstitutionen physisch erfahrbar. Vor diesem Hintergrund hat sich in jüngster Zeit eine politische Strategie für eine gerechtere Gesellschaft entwickelt, die im Anschluss an „Gender Mainstreaming“, „Diversity Mainstreaming“ genannt werden kann. „Diversity Mainstreaming“ geht es um die Wertschätzung von Menschen schlechthin. Ziel ist es, nicht nur Vorbehalte gegenüber unterschiedlichen Nationalitäten und Hautfarben, sondern auch gegen andere Unterschiede, sei es durch Behinderung, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und sonstige Lebensweisen, im Sinne einer umfassenden Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik abzubauen. Dazu kann auch Diversity Lernen im Rahmen politischer Bildung einen wichtigen Beitrag leisten. Gerade eine katholisch-sozial orientierte politische Jugend- und Erwachsenbildung, die in der Gerechtigkeit den grundlegenden Wert für die Ordnung der Gesellschaft sieht, sollte die Diskussion zum „Diversity Lernen“ aufgreifen und produktiv verarbeiten (vgl. zur Diversity Diskussion: GPJE 2008). Der dritte Diskussionsstrang der Politikdidaktik und der schulischen politischen Bildung, der allerdings erst am Anfang steht, der aber für die Weiterentwicklung der „Konvention“ von Bedeutung sein könnte, ist die Kontroverse um die Notwendigkeit von Fachwissen bzw. um die inhaltliche Dimension der politischen Bildung. Die „Konvention“ möchte mit ihrem Bildungsangebot einen Beitrag zur Fortentwicklung staatlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ordnung auf der Basis der christlichen Sozialethik und insbesondere der Option für die Armen leisten. Welches Fachwissen dazu notwendig ist, bzw. mit welchen Inhalten dies zu leisten ist, sagt die „Konvention“ nicht. Bestenfalls lassen sich implizit und auf sehr allgemeiner Ebene aus den Zielen auch auf einige Inhaltsfelder schließen. Damit ist die katholisch-sozial orientierte politische Bildung auf einem ähnlichen Stand wie die Politikdidaktik. Hier hat aber in jüngster Zeit eine Diskussion begonnen, die das Problem des notwendigen Fachwissens neu aufgegriffen hat und eine Lösung in der Entwicklung von Basiskonzepten sieht. Die Diskussion wird zwar kontrovers geführt und es gibt noch keine Übereinstimmung. Dass das Problem der Inhalte der politischen 69 70 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ Bildung aber über Basiskonzepte gelöst werden sollte, darüber besteht weitgehend Einigkeit. Ich kann diese Diskussion hier nur knapp skizzieren. Im Zusammenhang mit der Entwicklung einheitlicher Bildungsstandards in der Form von Kompetenzanforderungen, auf die ich oben schon eingegangen bin, ist in jüngster Zeit die Kompetenzdimension „Fachwissen“ ins Zentrum fachdidaktischer, auch politikdidaktischer Diskussion geraten (vgl. dazu Georg Weißeno, 2008). Fachwissen verweist dabei auf die inhaltliche Dimension der Fächer, die zunehmend über Basiskonzepte abgebildet werden. Einer Reihe von Fachdidaktiken wie Biologie, Chemie, Physik oder Mathematik und Geographie ist es gelungen, sich auf solche Basiskonzepte zu einigen. Zwar werden auch in diesen Wissenschaften unterschiedliche Begriffe verwendet (Physik und Mathematik sprechen von Leitideen, die Geographie unterscheidet zwischen einem Hauptbasiskonzept und Basisteilkonzepten), inhaltlich meinen sie jedoch das Gleiche. Die Funktion von Basiskonzepten besteht darin, die Breite der entsprechenden Fachwissenschaft auf einen inhaltlich-fachlichen Kern zu reduzieren, um ein exemplarisches Vorgehen zu ermöglichen. Das Wissen wird auf der Grundlage von Basiskonzepten erarbeitet, die ein systematisches und multiperspektivisches Denken sowie eine Beschränkung auf das Wesentliche fördern. Sie bilden die Grundlagen eines systematischen Wissensaufbaus unter fachlicher und gleichzeitig lebensweltlicher Perspektive und dienen der vertikalen Vernetzung des erworbenen Wissens, und sie dienen der horizontalen Vernetzung, indem Verbindungen zu anderen Sachverhalten deutlich werden. Basiskonzepte sind so verstanden eine Reaktion auf die Rückkehr der fachlichen Inhalte in den Unterricht und auf die Wiederentdeckung der Bedeutung des Wissens sowie eine Antwort auf die Komplexität der Bezugswissenschaften. Basiskonzepte reduzieren die Breite der Fachwissenschaften auf einen inhaltlichen Kern und ermöglichen so ein exemplarisches Vorgehen. Die Politikdidaktik steht erst am Anfang dieser Diskussion. Die Begriffsvielfalt ist im Vergleich zu den anderen Fachdidaktiken größer und die Einigung auf bestimmte Basiskonzepte erscheint schwieriger. Folgende Definition scheint sich jedoch als konsensfähig zu erweisen. Danach versteht man unter politischen Basiskonzepten die strukturierte Vernetzung aufeinander bezogener Begriffe, Theorien und erklärender Modellvorstellungen, die sich aus der Systematik eines Faches zur Beschreibung elementarer Prozesse und Phänomene historisch als relevant herausgebildet haben. Die fachdidaktische und lerntheoretische Aufbereitung führt zu einer Auswahl und Rekonstruktion dieser Konzepte im Sinne der grundlegenden und für Lernende nachvollziehbaren Ausschnitte und damit zum Begriff der Basiskonzepte. Basiskonzepte sind also Grundvorstellungen, die zwischen den Phänomenen und theoretischen Modellbildungen vermitteln. Insofern sind es Setzungen, abhängig von theoretischen Entscheidungen. Zusammenfassend lässt sich also folgendes festhalten (vgl. Massing 2008, 184ff): Basiskonzepte sind, obwohl der Begriff von den Fachwissenschaften kaum genutzt wird – hier spricht man von wissenschaftlichen Ansätzen, wissenschaftlichen Theorien, Paradigmen oder auch Wissenschaftsmodellen – fachwissenschaftliche Konzepte. Da sie zwar fachwissenschaftlich plausibel sein können, sich aber nicht stringent fachwissenschaftlich ableiten lassen, sind Basiskonzepte normativ, d. h. es sind Setzungen, die auf theoretischen Entscheidungen beruhen. Damit Basiskonzepte nicht desintegrierend oder fragmentierend wirken und einen Weg in die Praxis finden, bedürfen sie einer Übereinkunft der Politikdidaktiker und der politischen Bildner. Basiskonzepte scheinen nur dann sinnvoll zu sein, wenn sie zumindest am Ende eines Diskurses von einer großen Mehrheit der community der politischen Bildung akzeptiert und für sinnvoll gehalten werden. Basiskonzepte sind zwar per definitionem fachwissenschaftliche Konzepte, bei ihrer Verwendung haben sie aber vor allem fachdidaktische Funktionen. Der Politikdidaktik ist es bisher noch nicht gelungen, sich auf Basiskonzepte zu einigen. Unterschiedliche Vorschläge konkurrieren miteinander. Einige Positionen gehen davon aus, dass die Dimensionen des Politischen oder der Politikzyklus mit den dazugehörigen Kategorien auch die Funktion von Basiskonzepten wahrnehmen können, andere Vorschläge sind als Basiskonzepte: Macht, Recht, Gemeinwohl, System, Öffentlichkeit, Knappheit, anzusehen (Sander 2007, 100ff.). Die GPJE-Bildungsstandards sprechen von konzeptuellem Deu- Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ tungswissen. Dahinter stehen die Basiskonzepte: Grundrechtsbindung und politische Freiheit als Kernkonzepte demokratischer Verfassungsstaaten; Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung; Demokratie als Volksherrschaft: repräsentative und plebiszitäre Demokratie; Parteiendemokratie; Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes; Pluralismus; Grundprinzipien der Marktwirtschaft; Internationale Verflechtungen moderner Gesellschaften (GPJE 2004). Georg Weißeno (vgl. ders. 2006, 120ff.) macht nach Durchsicht der politikwissenschaftlichen Einführungsliteratur folgenden Vorschlag für Basiskonzepte: Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Frieden; Öffentlichkeit; Macht und Legitimation; InteressenVermittlung und politische Willensbildung; Politische System; Pluralität. Ohne noch auf weitere Vorschläge einzugehen, lässt sich schon so erkennen, dass der Weg zur Formulierung konsensfähiger Basiskonzepte in der politischen Bildung noch weit ist. Dennoch hat diese Diskussion eine wichtige Funktion: Sie hat in der Politikdidaktik und in der politischen Bildung die Bedeutung des Wissens wieder bewusst gemacht, das in den letzten Jahrzehnten weitgehend vernachlässigt worden ist. Ob sich aus dieser Diskussion auch Impulse für die außerschulische politische Jugend- und Erwachsenenbildung ergeben können, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Es scheint mir aber durchaus sinnvoll, diese Diskussion zur Kenntnis zu nehmen und diese Frage intensiver zu überprüfen. III. Abschließende Hinweise Bei der Betrachtung der aktuellen Diskurse in der politischen Bildung und in der Politikdidaktik scheinen mir für die „Konvention“ folgende Aspekte diskussionswürdig: • Vor dem Hintergrund der demokratietheoretischen Diskurse in der Politikdidaktik wirkt die „Konvention“ normativ zu blass. Die Forderung nach Beteiligung, nach Partizipation wird allein moralisch bzw. ethisch begründet. Der Bezug zu normativen Demokratiemodellen würde die Legitimation dieser Forderung auf eine breitere, auch breiter akzeptierte Grundlage stellen. Dazu wären vor allem eine kritische Rezeption der politikwissenschaftlichen Demokratietheorien und ihre Verknüpfung mit der Politikdidaktik hilfreich. • Das Bürgerbild, das der „Konvention“ zugrunde liegt, hat eine große Nähe zum Aktivbürger und wirkt normativ zu aufgeladen mit der Gefahr, die Realität der Demokratie zu verfehlen. Hier könnte die „Konvention“ Anschluss suchen an die Diskussion in der Politikdidaktik, die von unterschiedlichen legitimen Bürgerrollen in der Demokratie ausgeht und unterschiedliche Bürgerbilder konstruiert hat. Zusammenfassend könnte dies, wie schon oben formuliert, bedeuten: Die „Konvention“ sollte von unterschiedlichen Bürgerbildern ausgehen und diese auch demokratietheoretisch fundieren sowie der Demokratie konzeptionell mehr Aufmerksamkeit schenken. • Im Zusammenhang mit den Lernzielen der politischen Bildung, die in der „Konvention“ offensichtlich pragmatisch gefunden und tendenziell beliebig erscheinen, sollte überprüft werden, inwieweit Elemente der politikdidaktischen Kompetenzdiskussion hilfreich sein könnten. • Für die Formulierung gesellschaftlich-politischer Ziele scheint der Bezug auf normative Demokratiemodelle und die schon geforderte Verknüpfung mit dem politikdidaktischen Demokratiediskurs weiterführend, um daraus systematisierende und orientierende Hinweise zu gewinnen. • Bei den Gegenständen politischer Bildung finden folgende Entwicklungen zu wenig Berücksichtigung: Zum einen die Ursachen und die Folgen der Globalisierung für die Demokratie und die Herausforderungen für die politische Bildung, die sich daraus ergeben. Zum anderen das theoretische und praktische Konzept „Diversity“ und „Diversity Lernen“ als zunehmend wichtige Aufgabe der politischen Bildung. 71 72 Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ • Letztlich wirkt auch die Wissensdimension, d. h. die Frage, welches Fachwissen notwendig ist, um die formulierten Ziele zu erreichen, in der „Konvention“ zu wenig ausgeführt. Inwieweit die aktuelle Diskussion um Basiskonzepte in der Politikdidaktik hier Anregungen bieten kann, muss zurzeit noch offenbleiben. Eine intensive Beobachtung oder auch Beteiligung an dieser Diskussion scheint jedoch angebracht. IV. Literatur Behrmann, Günter C. (1972): Soziales System und politische Sozialisation. Eine Kritik der politischen Pädagogik, Stuttgart u.a. Benz, Arthur (1997): Kooperativer Staat, in: Klein, Ansgar / Schmalz-Bruns, Rainer (Hrsg.): Politische Beteiligung und Bürgerengagement in Deutschland, Bonn, S. 88-113. Buchstein, Hubertus (1995): Zumutungen der Demokratie. Von der normativen Theorie des Bürgers zur institutionell vermittelten Präferenzkompetenz, in: Beyme, Klaus von / Offe, Claus (Hrsg.): Politische Theorie in der Ära der Transformation, Opladen, S. 295-361. Buchstein, Hubertus (2000): Bürgergesellschaft und Bürgerkompetenz, in: Politische Bildung, Jg. 33, H.4, S. 8-18. Detjen, Joachim (2004): „So möchte ich meine Aufgabe in der eines Wächters des Politikunterrichts vor pädagogischen ‚Verflüssigungen’ sehen, in: Pohl, Kerstin (Hrsg.), Positionen der politischen Bildung. Ein Interviewbuch zur Politikdidaktik, Schwalbach/Ts., S. 176-195. GPJE (2004): Anforderungen an Nationale Bildungsstandards in der Politischen Bildung an Schulen. Ein Entwurf, Schwalbach/Ts. GPJE (Hrsg.) 2008: Diversity Studies und politische Bildung, Schwalbach/Ts. Greven, Michael Th. (2000): Kontingenz und Dezision – Beiträge zur Analyse der politischen Gesellschaft, Opladen. Henkenborg, Peter (2002): Politische Bildung als Kultur der Anerkennung. Skizzen zu einer kritischen Politikdidaktik, in: Journal für politische Bildung, H. 2. Hormel, Ulrike / Scherr, Albert (2004): Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung, Wiesbaden. Klieme, Eckhard, u.a. (2003): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards – Eine Expertise, Berlin. Mahnkopf, Birgit (1998): Probleme der Demokratie unter den Bedingungen ökonomischer Globalisierung und ökologischer Restriktionen, in: Michael Greven (Hrsg.), Demokratie – eine Kultur des Westens? 20. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, Opladen, S. 55-79. Massing, Peter (2002): Demokratie-Lernen oder Politik-Lernen? In: Gotthard Breit / Schiele, Siegfried (Hrsg.), Demokratie-Lernen als Aufgabe der politischen Bildung, S. 160-187. Massing, Peter (2002a): Demokratietheoretische Grundlagen der politischen Bildung im Zeichen der Globalisierung, in: Butterwegge, Christoph / Hentges, Gudrun (Hrsg.), Politische Bildung und Globalisierung, Opladen, S. 25-44. Massing, Peter (2005): Normativ-kritische Dimensionen politischer Bildung, in: Weisseno, Georg (Hrsg.), Politik besser verstehen. Neue Wege der politischen Bildung, Wiesbaden, S. 19-42. Massing, Peter (2008): Basiskonzepte für die politische Bildung. Ein Diskussionsvorschlag. In: Weisseno, Ge(Hrsg.) Politikkompetenz. Was Unterricht zu leisten hat, Bonn, S. 184-198. org Negt, Oskar (1997): Kindheit und Schule in einer Welt der Umbrüche, Göttingen. Pohl, Kerstin (Hrsg.) (2004): Positionen der politischen Bildung. Ein Interviewbuch zur Politikdidaktik, Schwalbach/Ts. Richter, Dagmar (2003): Sachunterricht – Ziele und Inhalte. Ein Lehr- und Studienbuch zur Didaktik, Hohengehren. Sander, Wolfgang (2004): Die Bildungsstandards vor dem Hintergrund der politikdidaktischen Diskussion, in: Politische Bildung, Jg. 37, H. 4. S. 30-41. Sander, Wolfgang (2007): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung, 2.vollst. überarb. u. erw. Auflage, Schwalbach/Ts. Schmalz-Bruns, Rainer (1993) Reflexive Demokratie, Die demokratische Transformation moderner Politik, Baden-Baden. Peter Massing, Gesellschaftliche Relevanz der „Konvention“ Schuppert, Gunnar Folke (1997): Assoziative Demokratie, in: Klein, Ansgar / Schmalz-Bruns, Rainer (Hrsg.): Politische Beteiligung und Bürgerengagement in Deutschland, Bonn, S. 114-152. Sutor, Bernhard (2004): Meine Didaktik des politischen Unterrichts basiert auf der Tradition der Praktischen Philosophie, in: Pohl, Kerstin (Hrsg.): Positionen der politischen Bildung. Ein Interviewbuch zur Politikdidaktik, Schwalbach/Ts., S. 46-61. Weisseno, Georg (2006): Kernkonzepte der Politik und Ökonomie – Lernen als Veränderung mentaler Modelle, in: Weisseno, Georg (Hrsg.), Politik und Wirtschaft unterrichten, Wiesbaden. Weisseno, Georg (Hrsg.) (2008): Politikkompetenz. Was Unterricht zu leisten hat, Bonn 73 74 Stellungnahmen der Fachgruppen Teil II: AKSB-Konvention - Relevanz für die Bildungspraxis Stellungnahmen zu einzelnen Aspekten der Konvention Bei der Konzeption der Jahrestagung wurde angedacht, diese in eine Reihe von kleineren Projekten einzubinden. Damit sollte bereits während des Jahres eine Auseinandersetzung mit der Konvention gewährleistet werden. Unter anderem wurde vorgeschlagen, einzelne Abschnitte des Textes in den Konferenzen der Fachgruppen zu diskutieren und auf ihre Gültigkeit hin zu prüfen. Die Konvention benennt in Abschnitt 19 „Gesellschaftliche und politische Ziele der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung“ politische Handlungsfelder. Bereits in früheren Abschnitten werden gesellschaftliche Entwicklungen beschrieben, die in einer zeitgemäßen politischen Bildung katholischer Träger berücksichtigt werden müssen (z. B. der Prozess der Individualisierung, Abschnitt 4). Es wurde daher vorgeschlagen, die Konvention durch die drei Fachgruppen daraufhin diskutieren zu lassen, ob der in Abschnitt 19 enthaltene Themenkatalog die aktuelle Arbeit widerspiegelt oder ob neue Themen für die katholisch-soziale Bildung in den letzten Jahren relevant geworden sind. Ebenso sollten die Abschnitte 18 „Lernziele der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung“ und 31 „Das personale Angebot in der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung“ diskutiert werden. Die Fachgruppen sind dieser Aufforderung nachgekommen und haben sich in ihren ersten Sitzungen in 2008 mit Abschnitt 19 beschäftigt. In der zweiten Tagungsrunde wurden dann die Abschnitte 18 und 31 näher betrachtet. Die Ergebnisse der Diskussionen werden im Folgenden dargestellt. Marica Zelenika – Stellungnahme der Fachgruppe I zu Abschnitt 19 1.Stellungnahmen der Fachgruppen zu Abschnitt 19 „Gesellschaftliche und politische Ziele“ der AKSB-Konvention Fachgruppe I – „Das Politische“ Die Diskussion in der Fachgruppe orientierte sich an mehreren Fragestellungen. Zum einen wollten die Mitglieder die Aussagen der Konvention mit ihren Erfahrungen aus der eigenen Arbeit vergleichen. Zum anderen wurde der Text daraufhin überprüft, welche Thesen besonders aktuell und relevant sind und welche Aspekte neu diskutiert werden müssen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Diskussion dargestellt. Allgemeine Anmerkungen zum Abschnitt 19 Bei der Betrachtung des Konventionstextes ist der Fachgruppe die Missverständlichkeit vieler Begriffe deutlich geworden. Einige der verwendeten Begriffe müssen aus heutiger Sicht neu definiert, ergänzt oder ganz aus der Konvention herausgenommen werden. Ein erweitertes Stichwortverzeichnis wäre an vielen Stellen hilfreich. Wünschenswert ist zudem eine einheitliche Nutzung der Begriffe (z. B. Glieder der Gesellschaft, Menschen, Bürger/innen, Konsumenten). Zudem sollte diskutiert werden, ob der Begriff „außerschulische politische Bildung“ nicht generell durch „non-formale politische Bildung“ zu ersetzen ist. Die Fachgruppe stellte fest, dass das Politische im engeren Sinne im Abschnitt 19 allgemein zu kurz kommt. Hier muss diskutiert werden, ob die Stärkung der Zivilgesellschaft ohne die Anregung des Engagements in politischen Parteien, in Parlamenten auf unterschiedlichen Ebenen und ganz allgemein im politischen System noch zeitgemäß ist. Sollte nicht auch die Zuführung von Zielgruppen zu politischen Parteien, Parlamenten bzw. ins politische System Ziel unserer Arbeit sein? Diese Aspekte müssen aus Sicht der Fachgruppe neu diskutiert werden. Inhaltliche Diskussion Zum einleitenden Passus diskutierte die Fachgruppe, inwiefern der Ausdruck „Option für die Armen“ heute noch angemessen oder möglicherweise veraltet ist. Es wurde die Frage aufgeworfen, welche Zielgruppen durch diesen Passus definiert werden sollen bzw. welche bei der Formulierung des Abschnitts im Blick waren (benachteiligte und bildungsferne Schichten?). Durch die Themen, die wir als politische Bildnerinnen und Bildner in unseren Veranstaltungen aufgreifen, weisen wir auf die politischen und sozialen Missstände in unserer Gesellschaft hin. Die Fachgruppenmitglieder sprechen sich für „Multiplikator/innen auf allen Ebenen“ als weitere Zielgruppe der politischen Bildung aus. Diskutiert wurde ebenfalls das Spannungsfeld „Berufliche Bildung – Politische Bildung“. Gedacht war in der Konvention ehemals nur an politische Bildung – heute arbeiten einige Einrichtungen zum Teil überwiegend in der beruflichen Bildung. Dies ist in einer Selbstverständnisdebatte neu zu diskutieren. Die Fachgruppe bemängelt zudem, dass die Pluralität der Mitgliedseinrichtungen im Text nicht zum Tragen kommt. Am ersten Absatz des Abschnitts 19 kritisiert die Fachgruppe die sehr utopischen Zielformulierungen. Es handelt sich bei diesen Formulierungen nach Ansicht der Gachgrup- 75 76 Marica Zelenika – Stellungnahme der Fachgruppe I zu Abschnitt 19 pen-Mitglieder mehr um Ideale oder Visionen als um Ziele politischer Bildung. Gleichzeitig stellte die Fachgruppe fest, dass die „Befähigung zur Partizipation“ als Ziel im betrachteten Absatz fehlt. Die Formulierung „Glieder der Gesellschaft“ wird aus heutiger Sicht als nicht zeitgemäß empfunden. Zudem wurde vorgeschlagen, die Begrifflichkeit der „Gleichstellung von Frauen und Männern“ durch die heute gebräuchliche Formulierung „Geschlechtergerechtigkeit“ zu ersetzen. Der Aspekt „Migration“ findet hier leider keine Beachtung. Der Text berücksichtigt daher nicht die Wirklichkeit unserer Einwanderungsgesellschaft. Der zweite Absatz des Abschnitts spiegelt im Allgemeinen die Praxiserfahrungen der Fachgruppenmitglieder wider. Themenbereiche wie Beteiligung, Medien und Medienkompetenz spielen in der politischen Bildung nach wie vor eine wesentliche Rolle. Neue virtuelle Welten gewinnen in der Gesellschaft zunehmend an Bedeutung und stellen daher eine Herausforderung für unsere Praxis dar. Angemerkt wurde jedoch, dass der Begriff „Zivilgesellschaft“ in diesem Absatz fehlt. Die Bezeichnung „Bürgerinnen und Bürger“ wird von der FG als unklar angesehen, da nicht deutlich definiert wird, welche/r Bürger/in gemeint ist. Gerade im Hinblick auf die Zuwanderungsgesellschaft und die Globalisierung sind an dieser Stelle eine genaue Definition des Bürgerbegriffs und eine klare Positionierung seitens der AKSB notwendig. Hier wäre deutlicher auf Konzepte wie Aktivbürger/in, Initiativbürger/in, Weltbürger/in und auf Mitbürger/innen ausländischer Herkunft, die die Bürgerrechte nicht besitzen, etc. einzugehen. Der dritte Absatz des Abschnitts wird von der Fachgruppe allgemein als problematisch angesehen. Zum einen ist die Abfolge in diesem Absatz missverständlich, zum anderen werden die Unschärfen der Begriffe und die ungenaue Zieldefinition bemängelt. Die Fachgruppe weist auf die Gefahr des Missbrauchs des Begriffs „Subsidiarität“ als Rechtfertigung einer immer stärkeren Individualisierung hin. Als Problem wird angesehen, dass sich der Staat seiner Pflichten zunehmend entzieht. Hier wird von den Fachgruppen-Mitgliedern eine klare Positionierung durch die AKSB gewünscht. Zudem spricht sich die Gruppe für eine Stärkung der Aspekte „Sozialpflichtigkeit des Eigentums“ und „in der Wirtschaft: Vorrang der Person“ aus. Kritisiert wird, dass eine Definition des Familienbegriffs fehlt. Es wird nicht deutlich, welche Familienform/en gemeint ist/sind. Es sollte an dieser Stelle neu diskutiert werden, zu welcher Definition von Familie wir – als katholische Träger der Akademien – stehen möchten. Zum Bereich „Familie“ sollte es aus den genannten Gründen einen Extraabschnitt geben. Im fünften Absatz sollte nach Meinung der Fachgruppe verdeutlicht werden, dass die Bewahrung der Schöpfung immer und unabhängig vom Trend ein aktuelles und relevantes Thema in der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung ist. Im darauf folgenden Abschnitt sollte deutlicher werden, dass „Mensch = Konsument“ nicht das Menschenbild ist, welches wir mit dem christlichen Menschenbild verbinden. Im weiteren Verlauf wird der Ausdruck „arme Länder“ kritisiert. Zudem sollte der Wandel der Gesellschaft, der immer auch Einfluss auf die politische Bildung hat, stärker betont werden. Für die Fachgruppe I zusammengefasst: Marica Zelenika Ekke Seifert, Stellungnahme Fachgruppe II zu Absatz 19 Die Fachgruppe II – „Das Soziale“ Der Abschnitt 19 der Konvention der AKSB beschreibt die gesellschaftlichen und politischen Ziele katholisch-sozial orientierter Bildungsarbeit. Konkret werden hier, in Anlehnung an die Kapitel 3 und 4 des Gemeinsamen Wortes „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“, Ziele aufgezeigt, in deren Geist die Mitgliedseinrichtungen der AKSB politische Bildungsarbeit leisten wollen. In der Fachgruppe wurde diskutiert, inwiefern sich die Konvention in der Praxis der Arbeit der Mitgliedseinrichtungen bewährt hat. Es wurde aber auch deutlich benannt, wo inhaltliche Lücken im oder Probleme mit dem Text auftreten. Deshalb galt es, den Text auf seine Aktualität sowie auf seine gesellschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit zu überprüfen. Das Ergebnis des Diskussionsprozesses fiel durchaus vielschichtig aus. Generelle Anmerkungen zu Aufbau und Struktur Zunächst einmal wurde nach den inneren und äußeren Umständen gefragt, die eine Überprüfung der Konvention zehn Jahre nach ihrer Entstehung als notwendig erscheinen lassen. Deshalb würde es sich, nach einhelliger Auffassung der Teilnehmenden, lohnen, eine breitere Selbstverständnisdebatte anzustoßen. Ein Großteil der behandelten Inhalte hat auch heute noch als sinnvolle Leitidee Bestand. Der Abschnitt 19 enthält eine Vielzahl zeitloser Forderungen, die maßgebend für die inhaltliche Ausrichtung der politischen und katholisch-sozial orientierten Bildungsarbeit sind. Die Systematik der Anordnung der benannten Inhalte erschließt sich jedoch nicht auf den ersten Blick. In der Reihenfolge und Gewichtung einzelner Inhalte könnten Verbesserungen und Aktualisierungen erfolgen. Diese müssten jedoch nach Verständigung der zu benennenden Inhalte vorgenommen werden. Eine gute Vermittlung des Entstehungsund Diskussionsprozesses ist sinnvoll und wünschenswert, um inhaltliche Kontexte und Leitideen besser nachzuvollziehen. Gegebenenfalls kann es jedoch auch sinnvoll sein, zu einem neuen Aufbau und einer veränderten inhaltlichen Struktur zu gelangen. Neben normativen Aspekten der gemeinsamen Arbeit in der AKSB wäre es nach Meinung einiger Mitglieder wünschenswert, sich auf eine Situationsbeschreibung bestehender gesellschaftlicher und sozialer Verhältnisse zu verständigen. Eine abschließende Bearbeitung des Textes durch eine/n Fachmann/frau (Journalist/-in, Germanist/-in o.ä.) wird von der Gruppe nachhaltig unterstützt und begrüßt. Inhaltliche Anmerkungen Ausgangspunkt Die Formulierung der Leitideen und Ansätze ist nach Auffassung der Teilnehmenden weitgehend zeitlos gehalten. Deshalb gehe es bei einer möglichen Neuformulierung nicht um die Verwerfung weiter Textteile, sondern hauptsächlich um die weitere Ergänzung der Inhalte und eventuell eine neue Gewichtung. Gemeinwohl und soziale Gerechtigkeit Anspruch der politischen Bildung der Mitgliedseinrichtungen ist es nach wie vor, mit dem Bildungsangebot einen Beitrag zur „Fortentwicklung staatlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ordnungen auf der Basis der christlichen Sozialethik und insbesondere der Option für die Armen zu leisten“ (vgl. Art. 19 der Konvention). Unterstrichen werden durch die Fachgruppe II die Prinzipien der Förderung des Gemeinwohls und der sozialen Gerechtigkeit. Als Maßnahmen hierzu benennt die Konvention bisher den Abbau bestehender Diskriminierungen, Chancengleichheit bei unterschiedlichen Ausgangsvoraus- 77 78 Ekke Seifert – Stellungnahme Fachgruppe II zu Absatz 19 setzungen, Gleichstellung von Männern und Frauen sowie eine gerechte Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern. Bei der Auflistung dieser Punkte wäre eine Präzisierung der Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit wünschenswert, da nur so objektiv vermittelbare Wertvorstellungen glaubhaft zum Ausdruck gebracht werden können. Medienkompetenz Zur Stärkung der freiheitlichen Demokratie wird als Unterpunkt die Bedeutung der Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger unterstrichen, ohne jedoch präzisiert zu werden. Nach Meinung der Fachgruppe II wäre hier eine weitere Ausformulierung wünschenswert. Der kompetente Umgang mit modernen Medien, der Medienkonsum und der Einfluss neuer Medienformate und -strukturen auf Politik und Gesellschaft hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dies müsse auch einen verstärkten Ausdruck in der Konvention erfahren. Im Bereich Politik, Medien und Gesellschaft müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Anschlussfähigkeit an wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatten nicht zu verlieren. Zivilgesellschaft In mehreren Absätzen (1-4) werden zivilgesellschaftliche Strukturen beschrieben und deren Stärkung als Aufgabe katholisch-sozial orientierter Bildung genannt, ohne den Begriff der Zivilgesellschaft explizit zu verwenden. Auch hier sei eine Anpassung an sozialwissenschaftliche und sozialethische Debatten und Fragestellungen notwendig, da ein enormer Erkenntnisfortschritt in den letzten zehn Jahren zu konstatieren sei. Ferner sei zu überlegen, diesen Punkt an zentraler Stelle am Anfang zu platzieren. Der Punkt Förderung einer neuen Sozialkultur (Absatz 4) kann dabei stärker mit Themenbereichen wie Zivilgesellschaft und Stärkung der freiheitlichen Demokratie verknüpft werden, um bewusst auch inhaltliche Bezüge herzustellen. Solidarität und Subsidiarität Der Absatz über die Verwirklichung von Solidarität und Subsidiarität sollte neu gefasst werden. Insbesondere die Anordnung der Inhalte wirkt nach Auffassung einiger Teilnehmer willkürlich. Ferner sollte dieser Punkt insgesamt stärker mit dem christlichen Menschenbild verknüpft werden. Auch eine Trennung der Bereiche von Solidarität und weltweiter Solidarität sollte überprüft und dann ggf. zusammengefasst werden. Eine Erweiterung der Solidaritätsdiskussion hat im Bereich der Elitenforschung stattgefunden. Hier sollte überprüft werden, inwiefern diesen Entwicklungen und auch der Diskussion um Elitenverantwortung Rechnung getragen werden kann oder sollte. Interreligiöser Dialog Ein wesentlicher Mangel wird im Bereich des interreligiösen Dialogs empfunden. Hierzu taucht in Abschnitt 19 der Konvention keine Anmerkung auf. Das Anliegen der interreligiösen Verständigung sollte nach Auffassung der Fachgruppe II jedoch dringend im Leitbild festgehalten werden. Die Bereiche religiöse Bildung, Dialogkompetenz, interreligiöse und interkulturelle Kompetenz, Integration und der Bereich Politik und Religion sollten Ausdruck in der Konvention finden. In ihnen kommen wesentliche Ansprüche der Mitgliedseinrichtungen, aber auch eine wichtige Erwartungshaltung der Öffentlichkeit zum Ausdruck, denen die AKSB nicht nur begegnen sollte, sondern dies auch schon seit Jahren praktiziert. Gerade vor dem Hintergrund religiös orientierter und wertbasierter Bildungsarbeit kommt den Mitgliedseinrichtungen der AKSB nicht nur eine besondere Verpflichtung in diesem Bereich zu, sondern auch eine spezifische Kompetenz, die unbedingt im Leitbild erwähnt werden sollte. Denn die Mitgliedseinrichtungen sind in zahlreiche Dialogkontexte bei eigenem Standpunkt eingebunden. Auf den Bedeutungswandel Ekke Seifert – Stellungnahme Fachgruppe II zu Absatz 19 und auf die zahlreichen religiösen, politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskursen muss an dieser Stelle Bezug genommen werden. Nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklungen Die Formulierungen im Bereich der nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklungen könnten dem ökologischen Bildungsanspruch und der veränderten Ökologiedebatte in Politik und Öffentlichkeit angepasst werden. Der Klimawandel und die Entwicklungen im Sektor Energie- und Umweltpolitik werden die Politik dauerhaft beschäftigen. Die damit verbundenen Herausforderungen und Ziele werden auch in sozialethischen Diskursen aufgegriffen und thematisiert. Dementsprechend besteht auch hier eine Anschlussmöglichkeit der AKSB, die in der Konvention zum Ausdruck gebracht werden sollte. Schlussfolgerungen der Fachgruppe Insgesamt muss nach Ansicht der Fachgruppe II bei einer Neuformulierung der Konvention darauf geachtet werden, dass Anspruch und Wirklichkeit nicht eklatant auseinanderdriften. Die Konvention sollte die Ziele der Arbeit, das Wertfundament und das Selbstverständnis der AKSB zum Ausdruck bringen, nicht jedoch einzelne Inhalte und Begründungszusammenhänge formulieren. Für die Fachgruppe II lässt sich somit insgesamt festhalten: Der Abschnitt 19 sollte neu strukturiert und präzisiert werden. Es gilt die Reihenfolge und den Stellenwert der formulierten Inhalte zu überprüfen und ggf. anzupassen. Inhaltlich sollten Ergänzungen in den Bereichen Zivilgesellschaft, Klimawandel, Medienkompetenz sowie interreligiöser und interkultureller Dialog im Rahmen von sprachlichen und inhaltlichen Neuformulierungen vorgenommen werden. Wichtig ist es, mit einer möglichen Neufassung der Konvention auf der Basis der christlichen Sozialethik wissenschaftlich und gesellschaftlich anschlussfähig zu bleiben und eigene Standpunkte im öffentlichen Diskurs sichtbar zu machen. Für die Fachgruppe II zusammengefasst: Ekke Seifert 79 80 Bernhard Eder – Stellungnahme der Fachgruppe II zu Abschnitt 19 Fachgruppe III – „Das Gesellschaftliche“ Die Diskussion der Konvention ist ein Bestandteil des aktuellen Selbstvergewisserungsprozesses der AKSB, bei dem es darum geht, die Geltung und Aktualität dieses Grundlagendokumentes zu sichern. Die Diskussion des Abschnitts 19 ergab in der Fachgruppe III ein zweifaches Echo: 1. Die in der Fachgruppe III vertretenen Mitgliedseinrichtungen finden sich grundsätzlich in diesem Text wieder. All die nun folgenden Kritikpunkte müssen auf dem Hintergrund gelesen werden, dass das vorliegende Grundlagendokument nach wie vor konsensfähig ist. In ihm finden sich gemeinsame Grundüberzeugungen von Bildungsinstitutionen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern wieder. Auch zehn Jahre nach dessen Beschlussfassung informiert die Konvention authentisch darüber, was die AKSB und ihre Mitgliedseinrichtungen unter katholisch-sozial orientierter politischer Bildung verstehen. Bei all den kritischen Anmerkungen darf der fundamentale Wert dieses Textes nicht gering geschätzt oder gar negiert werden. 2. Um die Aktualität zu gewährleisten bedarf der vorliegende Text der Konvention einiger substantieller Ergänzungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konvention ein komprimierter Kompromisstext ist. Diey bringt logischerweise mit sich, dass manche Themen eben nur kursorisch angesprochen werden. In der Diskussion der FG III wurden Desiderata für die stärkere Berücksichtigung folgender Themen geäußert: Der europäische Einigungsprozess Der Aspekt der Integration der Europäischen Union ist in einem gemeinsamen Absatz mit der zunehmenden Globalisierung gefasst. Auch wenn mehrere sachliche Bezüge zwischen diesen beiden Trends vorhanden sind, hat der europäische Einigungsprozess doch ein derartiges Eigengewicht, dass es lohnt, diesen Aspekt in einem eigenen Absatz zu bearbeiten. Denn durch die verschiedenen Verträge ist in Europa ein transnationales Gebilde sui generis (mehr als ein Staatenbund aber weniger als ein Bundesstaat) mit zahlreichen Verflechtungen und Kompetenzübertragungen auf die Ebene der Europäischen Union entstanden. Die Integration von Migranten/Migrantinnen und damit einher gehend Aspekte der Interkulturalität und des interreligiösen Dialogs Die Integration der Zuwanderer/innen in Deutschland ist einer der zentralen politischen Zukunftsaufgaben. Sehr viele von ihnen haben längst ihren Platz in der deutschen Gesellschaft gefunden. Gleichwohl gibt es unübersehbare Integrationsprobleme: Teile der zugewanderten Menschen sprechen unzureichend Deutsch, schneiden in Bildung und Ausbildung schwächer ab und sind häufiger arbeitslos. Es gehört zum Alltag demokratischer, pluraler Gesellschaften, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen zusammen leben. Dieses Miteinander gedeihlich für alle Beteiligten zu gestalten ist nicht voraussetzungslos. Es setzt Ehrlichkeit und Offenheit auf beiden Seiten sowie eine gemeinsam anerkannte Wertebasis voraus. Die Debatten um die Einbürgerungsprüfungen und über Ziele und Wege nachhaltiger Integrationsrichtlinien zeigen, wie heftig umstritten dieses Thema ist. Die demographische Entwicklung und das Verhältnis der Generationen Eine abnehmende Geburtenrate und eine steigernde Lebenserwartung tragen wesentlich zu einem demographischen Wandel bei. Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wie auch in Relation zu den jüngeren Generationen nimmt erheblich zu. Dazu Bernhard Eder – Stellungnahme der Fachgruppe II zu Abschnitt 19 nur ein Beispiel: in zwanzig bis dreißig Jahren werden mehr Menschen zwischen 60 und 80 Jahre alt sein als zwischen 20 und 40. Dieser Trend hat erhebliche Konsequenzen für das Zusammenleben in Deutschland – gerade auch für die intergenerativen Beziehungen. Die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen dieses Phänomens sickern erst langsam in das öffentliche Bewusstsein ein. Bedenklich stimmt die Katastrophenrhetorik, die die mediale Darstellung des demographischen Wandels begleitet. Die ökologischen Herausforderungen Der Aspekt der Ökologie ist im vorliegenden Text mit ökonomischen Überlegungen verwoben. Dies ist nicht zu beanstanden, denn die Zusammenhänge von Wirtschaft und Umwelt sind offensichtlich. Bedenklich stimmt allerdings folgende Beobachtung: Die natürliche Umwelt wird im Basistext ausschließlich im Hinblick einer optimalen Nutzung für die gegenwärtigen und kommenden Generationen verstanden. Eine humane Ökologiepolitik wäre demnach ein generationenübergreifendes, langfristig angelegtes Ressourcennutzungsprogramm. Die Beachtung des Eigenwerts von Flora und Fauna jenseits der Verzweckung für menschliche Bedürfnisse fehlt. Die Menschenwürde Der Aspekt der Menschenwürde sollte noch stärker betont werden. Er hat unter anderem eine hohe Relevanz bei solchen existentiellen Fragen wie die nach dem Umgang mit Leid und Sterben. Weitere Themen: Familie / bürgerschaftliches Engagement Den Bereichen Familie sowie Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement sollte mehr Raum gewidmet werden und dabei der aktuelle Sachstand der wissenschaftlichen und politischen Debatten berücksichtigt werden. Impulse für die Weiterarbeit Diese kritischen Anmerkungen sind nicht als Mängelrüge oder als Defizitanzeige zu verstehen, sondern als Hinweise, wie die Konvention zu ergänzen wäre, um aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen und Entwicklungen gerecht zu werden. Auffällig ist nämlich, dass sich die kritischen Anmerkungen vor allem auf den Abschnitt „gesellschaftliche und politische Ziele der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung“ der Konvention beziehen. Zu den Aufgaben der politischen Bildung katholischsozialer Provenienz samt der fachlichen Eingrenzung sowie zu den Lernzielen gab es kaum kritische Anmerkungen. Für die Fachgruppe III zusammengefasst: Bernhard Eder 81 82 Marica Zelenika – Stellungnahme der Fachgruppe I zu den Abschnitten 18 und 31 2. Stellungnahmen der Fachgruppen zu den Abschnitten 18 „Lernziele“ und 31 „Das personale Angebot“ der AKSB-Konvention Fachgruppe I – „Das Politische“ Die Fachgruppenmitglieder diskutierten neben den Inhalten der Abschnitte 18 (Lernziele) und 31 (personales Angebot) auch die Zielgruppen unserer Bildungsarbeit. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auseinandersetzung zusammengefasst: Abschnitt 18: „Lernziele der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung“ Generell sind die Fachgruppenmitglieder mit den in der Konvention formulierten Zielen der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung einverstanden. Allerdings sind einige Dinge aufgefallen, die stärker diskutiert wurden und nach Ansicht der Fachgruppe I als kritisch zu betrachten sind. Diese werden nun im Folgenden vorgestellt. Die Ziele sind an einigen Stellen sehr utopisch formuliert. Es stellt sich die Frage, ob z. B. Ziele wie „Fähigkeiten entwickeln und einüben, Handlungskompetenzen erwerben und Handlungsfelder entdecken, die zur wirkungsvollen Teilnahme an gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Gestaltungsprozessen und zur Fortentwicklung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates, der europäischen Einigung und der Ausgestaltung der internationalen Beziehungen notwendig sind“ durch die politische Bildung erreicht werden können. Gerade im Hinblick auf die genannte europäischen Einigung und Ausgestaltung der internationalen Beziehungen erscheint die Zielformulierung utopisch. Insgesamt ist der Abschnitt sehr lang und besteht aus unzähligen Wiederholungen. Eine Straffung des Textes wäre vorteilhaft und würde wahrscheinlich auch zur besseren Verständlichkeit beitragen. Die Formulierungen sind außerdem sehr allgemein. Der Bezug zu gesellschaftlichen Realitäten wie Globalisierung, Demokratie und sozialen Fragen fehlt leider. Auch die kritische Perspektive im Sinne von kritischem Umgang mit Wissen, Urteilsfähigkeit und Meinungsbildung wird in diesem Abschnitt nicht benannt. Die Besonderheiten der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung in Abgrenzung zu anderen Anbietern der politischen Bildung kommen an dieser Stelle des Textes nicht zum Tragen. Eine Profilschärfung wäre aus Sicht der Fachgruppe wünschenswert. Abschnitt 31: „Das personale Angebot in der katholischen-sozial orientierten politischen Bildung“ Mit den wesentlichen Inhalten des Abschnitts 31 erklärten sich die Fachgruppenmitglieder generell einverstanden. Zu ergänzen wäre, dass sich bei den politischen Bildnern/ -innen um Vorbilder und interessante Erwachsene aus Perspektive der Jugendlichen handelt. Interessant erscheint die Frage, wie politisch eigentlich politische Bildner/innen sein sollten? Sind die Zugehörigkeit zu einer Partei und das politische Engagement im engeren Sinne wünschenswert? Diese Fragen sind sicherlich zu diskutieren und wurden in der Fachgruppe intern bereits angesprochen. Angesichts der Realität, dass es sich bei unserer Gesellschaft um eine Einwanderungsgesellschaft handelt, benötigt die politische Marica Zelenika – Stellungnahme der Fachgruppe I zu den Abschnitten 18 und 31 Bildung aus Sicht der Fachgruppe I mehr Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund. Zielgruppen der AKSB-Einrichtungen Bestehende Zielgruppen: • SVler/-innen • Multiplikatoren/-innen der SV (Pat/innen) • Schüler/-innen der Sekundarstufe I und II • Ganztagsschüler/-innen • Schülerzeitungsredakteure/-innen • Absolventen/-innen des internationalen FSJ • Auszubildende • Studierende • Eltern • Frauen und Männer • junge Senioren/-innen • Bürger/-innen aus den neuen Bundesländern • Bundeswehrsoldaten/-innen • Polizisten/-innen • Migranten/-innen • Multiplikatoren/-innen politischer Bildung • Ehrenamtliche • Kollegen/-innen aus dem Ausland (internationaler Fachkräfteaustausch) • Erzieher/-innen, Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Sozialwissenschaftler/ -innen Zielgruppen, die verstärkt in den Blick genommen werden sollten: • Verbindungslehrer/-innen • Ganztagsschüler/-innen • Eltern • Gruppen aus Ostdeutschland (deutsch-deutsche Begegnungen) Allgemeine Anmerkungen Bei der Konvention handelt es sich um einen historischen Text, der sehr lang und ausführlich ist. Natürlich sind manche Inhalte nicht mehr aktuell, trotzdem ist der historische Wert des Textes nicht zu verkennen. Die Fachgruppe regt aber an, einen prägnanten und aktuellen Text zusätzlich zu gestalten: einen Text, der den Kooperationspartnern, den Zielgruppen und anderen Menschen mitgegeben werden kann, eine viel kürzere Version, die prägnant auf ein paar Seiten deutlich macht, was die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland ausmacht. Die Konvention ist für so einen Zweck nicht geeignet. Für die Fachgruppe I zusammengefasst: Marica Zelenika 83 84 Ekke Seifert – Stellungnahme der Fachgruppe II zu den Abschnitten 18 und 31 Die Fachgruppe II – „Das Soziale“ Die Arbeit der Mitglieder abbilden Im Rahmen des gesamten Konventionstextes fand die bisherige Fassung des Artikels 18 weitgehende Zustimmung. Viele Punkte sind nach wie vor aktuell und bedürfen keiner grundsätzlichen Korrektur. Des Weiteren sind viele Begrifflichkeiten mit anderen Absätzen und inhaltlichen Fragestellungen der Konvention verknüpft und werden an anderer Stelle der Konvention aufgegriffen und eingehend erörtert. Ein fester Bestandteil der Arbeit zahlreicher AKSB Mitgliedseinrichtung ist es, umfassende Kenntnisse sozialethischer Konzepte zu vermitteln. Ferner verfolgen viele Weiterbildungs- und Lernangebote das Ziel, für soziale Ungleichheiten zu sensibilisieren und Möglichkeiten des Engagements für Benachteiligte aufzuzeigen. Diese Dimension der konkreten Bildungsarbeit sollte auch in der Konvention hinreichend zum Ausdruck kommen. Eine sinnvolle Ergänzung des Artikels 18 der Konvention wäre es, auch den Erwerb interkultureller und interreligiöser Kompetenzen als Lernziele politischer Bildungsarbeit zu benennen. An dieser Stelle würde die Konvention der tatsächlichen Praxis in den Mitgliedseinrichtungen folgen. Denn hier werden die Befähigung und Einübung interkultureller Kompetenzen schon lange praktiziert. Eine Anpassung kann dementsprechend als sinnvoll erachtet werden. Der Terminus „Fortentwicklung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats“ sollte aus Sicht der Fachgruppe II um den Terminus „Sozialstaat“ ergänzt werden. Generell lohnt es sich für die weitere Entwicklung der internen Lernzieldebatte die Entwicklung der Lernzielformulierungen der Zentralen für Politische Bildung zu beobachten und zu begleiten. Hier scheinen sich größere Veränderungen in den Verständnissen, Dimensionen und Begrifflichkeiten der Politischen Bildung insgesamt abzuzeichnen. Das personale Angebot Bei der Diskussion um das personale Angebot (Artikel 31) und die Zielgruppen wurde festgestellt, dass die Konvention keiner umfassenden Neuformulierung bedarf. Vielmehr gelte es hier, die Formulierungen weitgehend beizubehalten und weiterhin in der Öffentlichkeit und der Praxis der Mitgliedseinrichtungen zu vertreten. Im Hinblick auf die Lernziele und die bisher bestehenden und künftig zu erschließenden Zielgruppen sollte die Diskussion des personalen Angebotes spezifiziert werden. Es gilt, über die einzelnen Mitgliedseinrichtungen hinaus, immer wieder neu zu definieren, wie ein sinnvoller und effektiver Personaleinsatz im Rahmen der Bildungsarbeit gestaltet werden kann. Die Vereinbarkeit von individueller Biographie des Personals und der Lebenswelt der Teilnehmenden und die interne Verständigung darüber, welches Personal unter welchen Bedingungen ausgewählt wird, muss ständig neu ausgelotet werden. In der Fachgruppe II wird eine weitere Verständigung über den Zusammenhang von Milieudiskussion und Lernkultur angestrebt. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Milieus mit einer explizit katholisch sozial orientierten Bildungsarbeit noch erreicht werden können und de facto auch erreicht werden. Die weitere Ausdifferenzierung der Zielgruppen hängt darüber hinaus jedoch nicht nur vom personalen Angebot der Mitgliedseinrichtungen ab. Das personale Angebot ist hierbei nur ein Faktor. Generelle Lösungen oder Vorgehensweisen hängen dabei auch stark von den unterschiedlichen Einrichtungen, regionalen und inhaltlichen Kontexten ab und können nicht über die Verbandsstruktur vorgegeben oder gelöst werden. Generell ist die Fachgruppe II jedoch der Auffassung, dass der Faktor „personales Angebot“ zur Profilierung verstärkt betont werden sollte. Für die Fachgruppe II zusammengefasst: Ekke Seifert Bernhard Eder – Stellungnahme der Fachgruppe IiI zu den Abschnitten 18 und 31 Fachgruppe III – „Das Gesellschaftliche“ Auch die folgenden Anmerkungen zu den Abschnitten 18 und 31 der Konvention sind als Ergänzungen zur Weiterarbeit und Weiterentwicklung des vorliegenden Textes zu verstehen. Es gab kein Plädoyer, bestehende Textpassagen zu ersetzen. Die Aussagen werden im Folgenden dargestellt nach allgemeinen Voten, die nicht unmittelbar die beiden oben erwähnten Abschnitte betreffen, sowie nach Kommentaren zu diesen Textbestandteilen: 1. Allgemeine Aussagen Gewünscht werden Klarstellungen zur Abgrenzung bzw. zur Verbindung von politischer Bildung mit politischen Aktionen. Von den Kursteilnehmenden, vor allem von solchen im jugendlichen Alter würde gern gesehen, dass die Lernerfahrungen direkt in Aktivitäten münden. Auf diese Weise wäre ein Praxistransfer Bestandteil des Lernprozesses. Andererseits werden die Schwierigkeiten der unmittelbaren Verlinkung von Bildung mit politischer Aktion durchaus gesehen (Überwältigungsverbot nach dem Beutelsbacher Konsens, förderungsrechtliche Hindernisse). Auch bedürfe die Frage, ob propädeutische Themen – wie Kommunikation, Mediation, Konfliktmanagement – Bestandteile der politischen Bildung sind oder nicht, klärender Aussagen. Die Frage nach einem Mindestalter als Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen wurde diskutiert. Die Fachgruppe III plädiert bei der Altersbegrenzung grundsätzlich für eine Offenheit „nach unten“. Gemeint ist, dass auch Kinder für die politische Bildung empfänglich sein können. Ihnen sollte daher nicht verwehrt sein, an entsprechenden Kursen teilzunehmen. Dies sollte auch förderungsrechtlich berücksichtigt werden. 2. Anmerkungen zu Abschnitt 18, Lernziele der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung Die vorgegebene Liste an Lernzielen ist grundsätzlich konsensfähig, Es bestehen folgende Desiderata an Ergänzungen: Die Mechanismen des Machterhalts sollen reflektiert und dadurch den Teilnehmenden durchschaubar gemacht werden, um sie so gefeiter gegen manipulative Tendenzen zu machen. Gefragt wurde ferner, ob nicht der biblisch-christlichen Heilsbotschaft mit ihren messianischen Verheißungen, die etwa in bildhaften Aussagen vom „neuen Himmel und einer neuen Erde“ formuliert werden, eine Radikalität inhärent ist, die die in der Konvention formulierten Lernziele als Ausdruck einer gesellschaftspolitisch affirmativen „bürgerlichen Religion“ erscheinen lassen. Hier wäre der Hebel für einen Selbstvergewisserungsprozess, durch den die Relevanz dieser messianischen Dimension für die katholisch-soziale politische Bildung geklärt werden soll. In diesem diskursiven Prozess könnte auch die Gefahr minimiert werden, dass die messianische Radikalität in eine fundamentalistische Rigorosität mündet. Allerorts wird von den Muslimen erwartet, dass sie ihre „zivilen“ und demokratietauglichen Ideale aufzeigen und sich intern in einen entsprechenden Bildungsprozess begeben. Nun scheint heute das Verhältnis von Christen und Demokraten oft gelöst. Ein Blick in die Vergangenheit, aber auch in die „evangelikaleren“ und „orthodoxeren“ Kreise zeigt aber, dass dem Christlichen durchaus auch hinsichtlich der politischen Haltungen antidemokratische und kulturskeptische Punkte inhärent sind. Diese Indizien sind Anlass genug, der Öffentlichkeit, den politisch Verantwortlichen und den öffentlichen Sponsoren zu zeigen, dass: 1. die AKSB sich selbstreflexiv gewiss ist, dass die Religion selbst nicht nur Lösung, sondern auch Teil eines Problems für die liberale Ordnung ist, 2. die AKSB bereit und geneigt ist, hier historisch und sozialwissenschaftliche Aufklärungsarbeit zu leisten, 85 86 Bernhard Eder – Stellungnahme der Fachgruppe III zu den Abschnitten 18 und 31 3. die AKSB neben dieser wissenschaftlichen Dimension auch aufmerksam ist für die „pädagogischen“ und „bildnerischen“ Aufgaben und Verantwortung, die uns dabei auferlegt sind, 4. eine solche Arbeit in privilegierter Weise von denen übernommen werden kann, die selbst Gläubige sind, im Glauben stehen und die „radikalen“ Potentiale des Christlichen in der eigenen Biographie kennengelernt haben und sich somit in tugendethischer Hinsicht selbst an diesen Zumutungen der Religion abarbeiten müssen: Wenn sich diese christlichen politischen Bildner/innen dem Themenfeld widmen, dürfen auch ihre Stakeholder im politischen Kontext berechtigt hoffen, dass etwas Fruchtbares für das Gemeinwesen herauskommt. Ergänzend zu den inhaltlichen Lernzielen soll auch das Erlernen von Methoden als Lernziel aufgenommen werden. 3. Anmerkungen zu Abschnitt 31 „Das personale Angebot in der katholisch-sozial orientierten politischen Bildung“ Der Aspekt des personalen Angebots ist immer noch aktuell und wichtig. Er äußert sich in einer Anerkennungskultur, wonach mit den Teilnehmenden in einer wertschätzenden, achtenden Haltung umgegangen wird. Dazu gehört, als Kursleitung authentisch zu sein und für die Seminargruppe auch nach den Bildungseinheiten ansprechbar zu sein. Aus diesem Kommunikationsangebot ergeben sich vielfältige Gesprächskonstellationen mit Beratungsdienstleistungen, denn die Teamer/ -innen werden zu unterschiedlichsten Fragen und Problemen angesprochen. Dieser Einsatz ist nicht voraussetzungsfrei: Er bedingt Zeitaufwand, spezifische kommunikative Kompetenzen der Kursleitung und die Möglichkeit für diese Personen, unterstützende und Halt gebende Kommunikationskonstellationen zu haben, etwa durch eine Supervision. Ein solches Unterstützungssystem ist notwendig, um die Handlungsfähigkeit in Situationen, in denen Seminarleiterinnen und Seminarleiter mit psychosozialen Schwierigkeiten ihrer Teilnehmenden konfrontiert werden, zu erhalten. Das personale Angebot bedingt das Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme an Kursen der außerschulischen Bildung. Diskutiert wurde die Frage, ob eine explizit christliche Orientierung für alle im operativen Geschäft tätigen pädagogischen Mitarbeiter/innen katholisch-sozialer Einrichtungen vorausgesetzt werden kann. Für hauptamtlich Tätige wird dies bejaht, bei Honorarkräften erscheint dies nicht unbedingt erwartbar. Für diese soll als Mindestanforderung gelten, dass sie die grundlegenden Werte der Christlichen Gesellschaftsethik vertreten, auch wenn sie diese selbst für sich nicht aus einer christlichen Orientierung heraus begründen. Der Terminus des/der „Bildner/in“ erscheint angesichts des aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstands veraltet, denn er suggeriert einen Gestaltungszugriff der Kursleitenden auf die Teilnehmenden, der ihnen nicht zukommt. Sie sind vielmehr „Hebammen von Bildungsprozessen“ oder Gestalter von Lernarrangements und sollen den Teilnehmenden helfen, Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Auch ist der Lernprozess mit dem Seminarabschluss nicht zu Ende. Manche Kompetenzen entwickeln sich mit dem Transfer der Lerninhalte in die Lebenspraxis. Für die Fachgruppe III zusammengefasst: Bernhard Eder Programm der AKSB-Jahrestagung in Schwerte AKSB-Jahrestagung 2008: „Am Puls der Zeit“ Katholisch sozial orientierte politische Bildung zwischen wissenscharftlichem Diskurs und gesellschaftlicher Relevanz – Akademie Schwerte vom 24. bis 25. November Montag, 24. November 2008 15.00 Uhr Begrüßung, Dr. Alois Becker, AKSB-Vorsitzender Einführung in die Tagung, Detlef Herberts, Kommende Dortmund, Leiter der Erwachsenenbildung der AKSB-Fachgruppe II „Das Soziale“ 15.15 bis 16.00 Uhr Wertgrundlagen politischer Bildung im 21. Jahrhundert Prof. Dr. Udo Vorholt, Technische Universität Dortmund Moderation: Dr. Alois Becker 16.30 Uhr Katholisch-sozial orientierte politische Bildung im Blick der Sozialethik - Kurzreferate „Personalität“, Dr. Alexander Filipović, Uni Bamberg 20.00 bis 21.30 Uhr anschl. Diskussion, Moderation: Pater Tobias Karcher SJ, Stellvertretender AKSB-Vorsitzender „Gemeinwohl/Solidarität“, Dr. Hermann-Josef Große Kracht, ICS Münster „Subsidiarität“, Prof. Dr. Günter Wilhelms, Theologische Fakultät Paderborn 10 Jahre AKSB-Konvention - Spiegelbilder und Reflexionen AKSB im Gespräch mit ehemaligen Verantwortlichen der AKSB-Grund- satzpapiere, Moderation: Lothar Harles, AKSB-Geschäftsführer Dienstag, 25. November 2008 09.00 Uhr Politische Bildung aus katholisch-sozialem Impuls - Kurzreferate „Christliche Gesellschaftslehre und politische Bildung“, Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, Ruhr-Universität Bochum anschl. Diskussion, Moderation: Bernward Bickmann, AKSB-Vorstandsmitglied 11.00 bis 12.30 Uhr „Katholisch-sozial orientierte politische Bildung zwischen Selbstanspruch und gesellschaftlichen Erfordernissen“ Beiträge aus den Fachgruppen, präsentiert in drei Workshops 14.30 bis 15.15 Uhr „Katholisch-sozial orientierte politische Bildung aus Sicht der Politikdidaktik“ – Rückmeldung eines Beobachters aus der Politikdidaktik, Prof. Dr. Ingo Juchler, PH Weingarten Moderation: Sabine Wißdorf, AKSB-Vorstandsmitglied 15.45 Uhr Die Zukunft katholisch-sozial orientierter politischer Bildung Auswertung der Zukunftsreflexionen Moderation: Lothar Harles, AKSB-Geschäftsführer 17.00 Uhr Ende der Jahrestagung „Die gesellschaftliche Relevanz der AKSB-Konvention“, Prof. Dr. Peter Massing, FU Berlin, (Stand: 03. November 2008) 87 Hrsg.: Verein zur Förderung katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland e.V. Geschäftsstelle: Heilsbachstraße 6 · 53123 Bonn · Tel. 0228 - 2 89 29-30 · Fax 0228 - 2 89 29-57 [email protected] · www.aksb.de · Verantwortlich: Lothar Harles · Redaktion: Markus Schuck